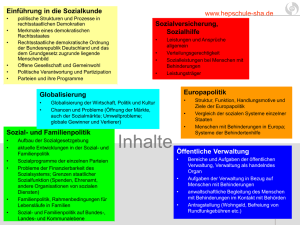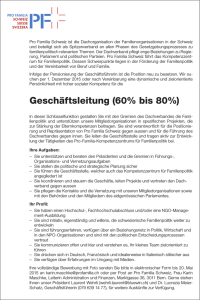Stabilität und Bindung
Werbung

376_17_20_Gauland 23.02.2001 13:59 Uhr Seite 17 Inhalt PM 376/01 Familie ist Gegenhalt im Wirbel der Globalisierung Stabilität und Bindung Alexander Gauland „Die vermittelnden Institutionen, auf die sich der freie Markt in der Viktorianischen Ära in England gestützt hatte, behinderten nun seinen Wiederaufbau im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert. Berufsverbände, örtliche Behörden oder stabile Familienstrukturen sah man jetzt als Störfaktoren für höhere Mobilität und größeren Individualismus an, mithin als Störfaktoren für den freien Markt. Wird dieser im spätmodernen Milieu rekonstruiert, dann gibt es nur eines: Man muss all jene Institutionen schwächen oder zerschlagen, denen in der Gesellschaft eine vermittelnde Funktion zukommt; und eben das geschah in Großbritannien. Es ist merkwürdig, dass es immer noch Menschen gibt, die den Zusammenhang von freiem Markt und gesellschaftlichem Ordnungsverlust leugnen. Selbst wenn der freie Markt als solcher stabil gehalten werden könnte, wird er auf Institutionen, die den sozialen Zusammenhalt gewährleisten sollen, zerstörerischen Einfluss haben. Keine Gesellschaft, die sich für den freien Markt entscheidet, kann dies verhindern.“ In diesen Sätzen von John Gray aus seinem Buch Die falsche Verheißung – der globale Kapitalismus und seine Folgen liegt das Scheitern moderner Familienpolitik begründet. Familienpolitik hatte schon immer etwas Defensives. Sie war und ist per definitionem der Versuch, eine Institution, auf die die Gesellschaft nicht glaubt verzichten zu können, gegen die ihr feindlichen Bedingungen in dieser Gesellschaft zu schützen, ihr mit Geld etwas von der Lebenskraft zu bewahren, die ihr täglich ausgesaugt wird. Die großen Gesellschaftstheoretiker des neunzehnten Jahrhunderts haben die Familie links liegen lassen. Für Karl Marx war sie Teil des Ausbeutungsapparates, ein Baustein der kapitalistischen Gesellschaft, die – zum Untergang verurteilt – auch dieses Bauelement in den Abgrund reißen würde. Burke, Tocqueville, Mill und noch Max Weber räsonierten über das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit, Demokratie, den Machtstaat und die Klassengesellschaft. Die Familie war ihnen funktionierende Voraussetzung von Staat und Gesellschaft. Das Konzept des bürgerlichen Liberalismus ging um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts davon aus, dass nicht jeder Einzelne, sondern die Familie Zelle des gesellschaftlichen Organismus ist. Auf politischer Ebene fand diese Familienstruktur ihre Entsprechung darin, dass meistens nur Familienhäupter politische Rechte hatten. Neben Kirchen und Ständen, den großen Korporationen, galt die Familie als stabilisierender Gegenhalt im Wirbel der revolutionären politischen und wirtschaftlichen Neuerungen. Allerdings – und das ist der Unterschied zu heute – stand sie nicht im Gegensatz zur kapitalistischen Produktionsweise. Im Gegenteil, sie unterstützte die notwendige Hierarchisierung und sicherte die für eine stabile Produktion notwendigen „Sekundärtugenden“ ab. Erst mit dem Übergang vom bürgerlichen Li- Nr. 376 · März 2001 Seite 17 376_17_20_Gauland 23.02.2001 13:59 Uhr Seite 18 Alexander Gauland beralismus zur Massengesellschaft wird die Familie zum Problemfall. Auf der einen Seite reichen die altständischen Mittel der Armenpflege nicht mehr aus, den Schwachen das Überleben zu sichern, auf der anderen Seite benötigt der Staat Massenheere, die eben aus jenen sozial Schwachen rekrutiert werden müssen. Familienpolitik beginnt als Armenund Sozialpolitik aus der Notwendigkeit heraus, die Schutzfunktionen der Familie für die ärmeren Schichten zu stärken. Zwei Weltkriege erhöhten noch einmal die Bedeutung der Familie als Schutzraum, Erziehungseinheit und Produktionsfaktor und sorgten dafür, dass die Routineformulierung von der Familie als der Keimzelle von Staat und Gesellschaft mit der Realität übereinstimmte. Dies gilt – cum grano salis – auch für die Nachkriegszeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus. Erst die Globalisierung bringt die Lebensvoraussetzungen des Familienverbandes ins Wanken. Dass Individualisierung und Flexibilisierung, Beweglichkeit und just in time-Verfügbarkeit, die neuen Symbolbegriffe globalen Wirtschaftens, langfristigen Bindungen widerstreiten, ist nur zu offensichtlich, auch wenn Wirtschaftsliberale und manche Konservative dem widersprechen. „Die permanente Revolution, die der freie Markt bewirkt, raubt der Vergangenheit ihre Autorität. Präzedenzfälle verlieren an Bedeutung, die Fäden der Erinnerung werden durchtrennt, vor Ort akkumuliertes Wissen in alle Winde zerstreut. Wenn und weil der individuellen Entscheidungsfreiheit Vorrang vor jedem gemeinsamen Gut eingeräumt wird, bekommen Bindungen etwas Widerrufliches, Provisorisches. Macht es in einer Kultur, in der die Möglichkeit freier Entscheidung der einzige unangefochtene Wert ist und in der Bedürfnisse für unstillbar gehalten werden, überhaupt noch einen Unterschied, ob man die Scheidung einreicht oder sein altes Auto gegen ein Seite 18 Die politische Meinung neues tauscht? Die Logik des freien Marktes, die sämtliche Beziehungen auf Konsumartikel reduziert, wird von seinen Ideologen hartnäckig geleugnet. Doch im Alltag jener Gesellschaften, die bereits vom freien Markt beherrscht werden, tritt sie nur allzu deutlich zutage.“ Man kann das sehr eindrücklich an der Diskussion um Ladenschlusszeiten und Sonntagsruhe festmachen. In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung – Ordnung der Wirtschaft – hat der frühere Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Herbert Giersch, das Problem der Sonntagsruhe auf die Frage reduziert, „ob Hinz die Möglichkeit der kostenlosen Sonntagsruhe haben soll, indem sie Kunz dazu zwingt, sein Geschäft ebenfalls geschlossen zu halten, obwohl dieser der Kundschaft schon des Verdienens wegen gern zu Dienste stünde. Ohne das Gesetz wäre Hinz nicht minder frei, sich der Sonntagsruhe hinzugeben; nur müsste er mit Verdienstausfall dafür bezahlen.“ Und Giersch resümiert, dass wir zu starr und unelastisch sind, weil wir die liberale Alternative ausblenden: Die Menschen müssen vor allem erst einmal dürfen, was sie wollen. Was das für die Ehe oder die Kinder von Hinz und Kunz bedeutet und ob die Sonntagsruhe nicht auch ein kulturelles Gut in der abendländischen Gesellschaft ist, taucht in den Überlegungen gar nicht erst auf; nichts zählt jenseits des Ökonomischen. Wenn also Anthony Giddens in seinem berühmten Traktat über den dritten Weg verkündet: „Die Familie ist die grundlegende Einheit der Zivilgesellschaft“, dann klingt das wie ein Pfeifen im Walde und ist mehr ein Sollen als ein Sein. Brauchen wir also noch die Familie und damit auch eine Familienpolitik? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, hilft ein Blick auf die Familienpolitik der letzten Jahrzehnte. Trotz der Geburtenhäufigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg und des Babybooms der Wirt- 376_17_20_Gauland 23.02.2001 13:59 Uhr Seite 19 Stabilität und Bindung schaftswunderjahre, trotz des Kindergeldes und der Ausweitung der Erziehungszeiten in der Rentenversicherung, trotz des Erziehungsurlaubes für beide Elternteile und trotz der Kindergartenplatzgarantie ist die Familienpolitik keine Erfolgsgeschichte. Die Wahlparole „Kinder statt Inder“ offenbart das Dilemma. In den Anfangsjahren der Bonner Republik, die noch nicht die eben genannten Wohltaten kannten, schien die Familie gefestigter, war die Geburtenrate höher. Dabei wird der relative Misserfolg der bundesrepublikanischen Familienpolitik von den verschiedenen ideologischen Positionen her ganz unterschiedlich bewertet. Wirtschaftsliberale Publizisten beklagen die „Entmündigung der Familie“ und sehen im Bedeutungsverlust der häuslichen Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft vor allem das Ergebnis staatlichen Interventionismus. Zu viel Umverteilung – so ihre These – habe die Familie geschwächt, weniger Umverteilung würde mehr Geld in den Händen der Familienmitglieder belassen. Der Staat, so das Fazit der radikalen Liberalen, habe durch Sprengung der Familienverfassung nicht die Emanzipation von Frau und Kindern, sondern nur die Knechtschaft aller gefördert. Ernster zu nehmen ist der auch vom Bundesverfassungsgericht geteilte Vorwurf an die Politik, dass sie die Familien nicht zu viel, sondern zu wenig gefördert habe. In seinem Urteil aus dem Jahre 1999 hat es festgestellt, dass Familien steuerlich stärker entlastet werden müssen und der Gesetzgeber das Steuervolumen so zu vereinfachen habe, dass das Familienexistenzminimum künftig dem Zugriff des Staates entzogen bleibe, ohne dass sich der Steuerpflichtige in einem Wirrwarr von Anträgen verheddere. Zu diesem Existenzminimum gehört auch ein Betreuungs- und Erziehungsbedarf, den alle Eltern und nicht nur Alleinstehende geltend machen können. Im Endergebnis heißt das auch weniger Umverteilung und mehr eigenes Geld für Kindererziehung und -betreuung. Denn obwohl in den vergangenen vier Jahrzehnten weniger Kinder geboren wurden, nahm die Familienförderung pro Kind nicht zu, sie ging sogar zurück. 1961 wurden in Deutschland etwa 1,3 Millionen Kinder geboren, 1998 waren es nur noch 900 000. Um das Niveau der Familienförderung von 1961 zu erreichen, müsste der Kinderfreibetrag heute etwa 15 300 D-Mark betragen. 1965 bekam nur jedes 75. Kind unter sieben Jahren Sozialhilfe, 1990 war es jedes elfte, 1994 jedes siebte. Etwa alle zehn Jahre hat sich der Anteil der Kinder, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, verdoppelt. Noch können die Auswirkungen des neuen Richterspruchs auf Familie und Kinderzahl nicht eingeschätzt werden, doch widerspräche es allen bisherigen Erfahrungen, wenn höhere Freibeträge zu mehr Kindern führen würden. Zu familien- und kinderfeindlich sind die Bedingungen des Marktes für Berufsarbeit während oder nach Ende der Kindererziehungszeit in der „Familienphase“. Nachdem die wirtschaftliche Notwendigkeit der Familie dahinschwindet, andererseits Emanzipation und die Individualisierung der Lebensstile die Gleichberechtigung der Frauen beim Zugang zur Berufsarbeit mit sich gebracht haben, kann die Notwendigkeit der Familienförderung nur mit Argumenten jenseits der Ökonomie begründet werden, die in ihrer Gesamtheit allerdings auch wirtschaftliche Bedeutung entfalten. Denn noch können wir uns nicht vorstellen, wie eine Gesellschaft aus vereinzelten Individuen die psychologische Stabilität aufrechterhalten kann, die die Bedingung modernen Wirtschaftens ist. Es gilt das Wort des Verfassungsrechtlers Böckenförde, nach dem die moderne Industriegesellschaft von Bedingungen abhängig ist, die sie Die politische Meinung Seite 19 376_17_20_Gauland 23.02.2001 13:59 Uhr Seite 20 Alexander Gauland nicht selbst schaffen kann und die auf vorindustriellen Werten und Traditionen beruhen. „Je mehr Individualismus und Egoismus unsere Gesellschaft prägen“ – so Wolfgang Schäuble –, „umso wichtiger wird die Erkenntnis, dass die Familie das Fundament von Staat und Gesellschaft ist.“ Das heißt, Familienpolitik resultiert nicht aus der christlichen Überzeugung von der Ehe als Sakrament, sondern sie ist Ausfluss der Überzeugung, dass der Einzelne menschlicher Bindungen bedarf, um die Herausforderungen der Moderne zu bestehen, also die Familie immer noch und mehr denn je als vermittelnde Institution, als Gegenhalt im Wirbel der Globalisierung. Wenn dies richtig ist, kann Familienpolitik nicht nur in weiterer Steuerentlastung bestehen, sie muss vielmehr direkt in die Wirtschaft eingreifen, und zwar gerade in dem heute unpopulären Sinne von Regulierung, Konkurrenzausschluss, Arbeitsplatzsicherheit, Erhaltung der Sonntagsruhe – also möglichst weitgehender Einhegung negativer Auswirkungen der Globalisierung. Die Familie widerstreitet den modernen Kultbegriffen Flexibilität und Individualisierung, und eine christliche wie konservative Partei muss sich entscheiden, ob sie bei ihren politischen Entscheidungen in jedem Fall dem globalen Wettbewerb Vorrang vor den Stabilitätsbedürfnissen der Familie einräumt. Doch da hier immer wieder Arbeitsplatzsicherungsargumente den Sieg davontragen werden, muss die Politik endlich dazu kommen, die Leistungen in der „Familienphase“ ähnlich zu honorieren wie die Erwerbstätigkeit, die damit auch unge- schmälert in die Rentenversicherung einginge. Nur eine solche Gleichbehandlung von Erwerbsarbeit und Erziehungsarbeit ist auf Dauer in der Lage, die von der Globalisierung belagerte Familie zu entsetzen. Längst sind wir dazu übergegangen, den Bauern die Landschaftspflege zu honorieren und ihr Einkommen nicht mehr nur an die Urproduktion zu binden. Wie viel notwendiger wäre ein Erziehungsgehalt, für das alle einkommensrechtlichen und damit auch sozialversicherungsrechtlichen Regeln gelten und das dem Kinderwunsch berufstätiger Paare das Risiko des sozialen Abstiegs nimmt. Wer darin den Triumph einer primitiv-materialistischen Anschauung sieht, die Kinder zu Vollzugshelfern der Rentenversicherung degradiert, zugleich aber der Marktgesellschaft das Wort redet, verschließt die Augen vor den Folgen eigenen Tuns. Dass Kinder auch Lebenssinn und Lebensglück bedeuten, die die Kritiker des Erziehungsgehalts am liebsten in Abzug bringen möchten, wäre dann endlich jenes mehr, ein Stück Transzendenz, das den Verteidigungskräften der Familie ein Prä im Abwehrkampf gegen die Globalisierung gibt. Nur wenn Familienpolitik künftig ebenso kraftvoll wie die der Familie widrigen Kräfte des Marktes agiert, hat sie eine Chance, die gesellschaftliche Basis jenes Wirtschaftens zu bewahren, das Institutionen zerstört, Traditionen aufzehrt und Werte verbraucht, die es nicht ersetzen kann. Die Familie ist neben dem Heimatbegriff, der nationalen Identität, der Kunst und der Religion das kräftigste Widerlager, sein stärkster Gegner. Gegengift „Der Reiz des Familienlebens ist das beste Gegengift gegen den Verfall der Sitten.“ (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778, in Émile 1) Seite 20 Die politische Meinung