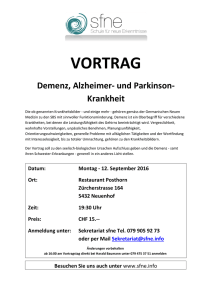"offenem Herzen" gegen Demenz
Werbung

Medizinisches Thema KV-Blatt 08.2009 19 Mit „geöffneter Hand“ und „offenem Herzen“ gegen Demenz A. Berlins demente Bürger: Aktuell ist der durchschnittliche Berliner 42 Jahre alt und hat eine Lebenserwartung von 77 Jahren. Sein Demenzrisiko liegt bei ca. 6 %. In Berlin leben zwischen 40.000 und 50.000 demente Bürger; die Mehrzahl (70 %) sind Frauen. Jährlich kommen schätzungsweise 8.000 an Demenz neu erkrankte Menschen hinzu. Die Wahrscheinlichkeit, wegen der Demenz irgendwann in eine Pflegeeinrichtung zu kommen, ist mit über 80 % hoch. Das stellt uns vor große Herausforderungen, denn diese Pflegeform ist sehr kostenaufwendig. Andererseits wünschen sich die meisten Betroffenen, möglichst lange in der eigenen häuslichen Umgebung verbleiben zu können. Folgerichtig konzentrieren sich die Anstrengungen darauf, ambulante Behandlungsmöglichkeiten zu optimieren. B. Verhaltener Optimismus gegenüber dem Altern ist berechtigt („offenes Herz“): Zunehmend reift die Erkenntnis, dass offensichtlich eine positive Einstellung zu Alten und zum Altern in jungen­Jahren ein in späteren Jahren statistisch niedrigeres Mortalitäts-Risiko bewirkt. So wurden jedenfalls die Ergebnisse einer 20-jährigen Langzeitstudie aus Ohio interpretiert, bei der bei entsprechenden Probanden eine um bis zu sieben Jahre längere Lebenszeit festgestellt wurde. Der „SelbstabschaffungsMonolog“, wie ihn Schirrmacher in seinem Buch „Das Methusalem-Komplott“ nennt, beschreibt dagegen unser aller Altersrhetorik, die uns reflex­artig den Satz entlockt: „So alt will ich gar nicht werden.“ Schirrmacher spricht vom „gerontophobischen Altersrassismus“ und „Ageism“. Er beklagt das Fehlen geriatrischer Helden in unserer noch vom Jugendwahn besessenen Kultur und Lebensphilosophie. Auch wir Mediziner könnten uns angesprochen fühlen. Unsere selektive Wahrnehmung von dem „kranken Alten“ könnte die Sicht auf das Gesunde verstellen. Die Bevölkerungsgruppe, die derzeit am meisten wächst, sind die über 85-Jährigen – und von denen sind 75 % eben nicht dement. Die jüngste Diskussion um die Salutogenese, um Resilienz und Reservekapazität hat bereits ein Umdenken in der Altersmedizin eingeläutet. C. Wir niedergelassenen Haus- und Fachärzte sind gefordert: „Die Demenzdiagnostik soll in der Regel ambulant erfolgen.“ So steht es in der Leitlinie der Expertengruppe der Deutschen, der Österreichischen und der Schweizer Gesellschaft für Neurologie von 2008. Wir ambulant tätigen Ärzte haben im Rahmen der integrierten Versorgungskonzepte die Leitstellenfunktion inne und sollten diese zum Wohl unserer Patienten auch verantwortlich wahrnehmen. In seinem Grußwort zum IX. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP), der vom 17. bis 20. Juni 2009 in Berlin stattfand, appellierte derPräsident, Prof. Dr. Hans Gutzmann, an uns alle, die gerade anlaufende Priorisierungsdebatte offen und ehrlich zu führen. Dazu passt, dass das Bewusstsein für die demografische Entwicklung und speziell auch das „Leuchtturmprojekt Demenz“ der Bundesregierung die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Krankheitsgruppe deutlich erhöht haben. Die Einsicht des gewachsenen Anzeige Die Statistiker liefern uns Jahr für Jahr ernüchternde Zahlen: Das Risiko, an Demenz zu erkranken, steigt in unserem Land rapide an. Bundesweit gibt es derzeit bereits über eine Mil­ lion Menschen – und es werden immer mehr. Das stellt uns vor große Heraus­ forderungen in der medizinischen Ver­ sorgung und pflegerischen Betreuung. Pos. 18 20 Medizinisches Thema KV-Blatt 08.2009 Fortsetzung von Seite 19 Versorgungsdrucks steht im Gegensatz zur „stillen“ Rationierung der letzten Jahre. lich ist, trotz geringer Effektstärken in das Behandlungsprogramm eingebaut werden. Dennoch haben sich die ambulant tätigen Ärzte der Herausforderung gestellt. Die medikamentöse Versorgung dementer Patienten mit Antidementiva ist weiterhin die Domäne der Nervenärzte, Psychiater und Neurologen. Sie tragen – trotz eines enormen Regressrisikos – mehr als die Hälfte dieser Verordnungen (Bohlken J: Verordnungshäufigkeit von Antidementiva – eine Bilanz aus Berlin, Neurotransmitter 2009; 5, 22–30). Die hausärztlichen Kollegen, das sei hier ebenfalls festgestellt, holen aber auf. Mit großem Interesse verfolgen die an der Demenzversorgung beteiligten Ärzte die in Forschung befindlichen Behandlungsansätze, die schon in einigen Jahren zugelassen werden könnten und dann die Priorisierungsdiskussion noch einmal anheizen dürften. Hierbei stehen die passive und aktive Immunisierung sowie die Sekretasen-Modulatoren im Vordergrund. Auch neuere diagnostische Früherkennungsverfahren wie das PIB-PET, mit dem Amyloidablagerungen sichtbar gemacht werden können, oder die Liquoranalytik, bei der ein hoher Quotient von AmyloidPeptiden (A-ß42 zu A-ß40) die Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer-Demenz scheinbar erhöht, sind Verfahren, die trotz der Kostendebatte Hoffnung aufkommen lassen. Allerdings erhielt gerade diese jüngst einen Dämpfer, nachdem in wissenschaftlichen Studien zwar Tiere, nicht aber Menschen hinsichtlich ihrer Kognition von der Beseitigung von Amyloidablagerungen profitierten. D.Die fünf Herausforderungen („offene Hand“): Andere Ansätze, wie z. B. die Behandlung mit reinen unselektiven Histaminantagonisten oder Methylenblau, dürften ebenfalls erst in einigen Jahren Marktreife erlangen. Motorische Bewegungsprogramme und andere nicht medikamentöse Konzepte könnten größere Bedeutung gewinnen und sollten, sofern dies im individuellen Fall mög- „Doktor, ich bin so vergesslich!“ Diese Äußerung eines Patienten in unserer Praxis ist und bleibt eine tägliche Herausforderung. Fünf Varianten von Patienten sind zu unterscheiden: 1. Subjektive kognitive Störung: Handelt es sich bei diesem „Fall“ um eine nicht objektivierbare, sondern nur subjektiv empfundene Beeinträchtigung (solide Testung und ADL-Anam­ nese sind wichtig), so sind mit sachlicher Aufklärung und empathischer Zuwendung häufig andere Probleme des Patien­ten zu eruieren. Auch der Ausschluss eines demenziellen Prozesses ist nicht selten therapeutisch wirksam. Viele hypochondrische Ängs­te treiben die Menschen wegen schon geringer Fehlleistungen zum Arzt. Häufig reicht bereits der Hinweis auf das zumeist nicht zutreffende Zeitkriterium „halbes Jahr“ und die fehlende „Alltagsrelevanz“, welche im ICD 10 für eine manifeste Demenz gefordert werden, um den Patienten zu beruhigen. Doch bedenken wir: Diese Menschen kommen zu uns, weil sie Rat suchen und sich in Not befinden. Ein nicht selten überheblich wirkendes Belächeln oder der im Kollegenkreis immer noch nicht verbannte Satz: „Sie haben nichts!“, sind in einer solchen Situation völlig fehl am Platz. Eine Angsterkrankung mit „nichts“ abzutun, wird dem Anliegen des Patien­ ten und unserer ärztlichen Profession nicht gerecht. Es bedarf ggf. einer spe­ zifischen Behandlung. Die Möglichkeiten reichen von einfachen supportiven und geduldigen Gesprächen in der Praxis über wiederholte psychoedukative Sitzungen oder eine antrags- und genehmigungspflichtige Verhaltenstherapie bis hin zur medikamentösen Behandlung (z. B. SSRI). 2. Vorübergehende leichte kognitive Defizite: Einige unterschwellige (lediglich kurz objektivierbare) kognitive Defizite treten­ nur vorübergehend auf und besitzen in der Regel auch keinen progredienten Charakter, wie z. B. bei Überforderungssituationen in einer Ausbildung oder im Beruf (schon der Input von Information ist gestört) oder der lückenhafte oder „blockierte“ Wissensabruf bei Prüfungen („Black out“). Viele von diesen Patienten sind in der fokussierten Aufmerksamkeitstestung der Praxis völlig unauffällig, schildern aber glaubhafte Beeinträchtigungen in den entsprechenden Alltagssituationen, wenn sie z. B. mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen müssen (geteilte Aufmerksamkeit). Einen nachhaltigen Charakter können reversible Gedächtnisstörungen, z. B. bei langen und schweren depressiven Erkrankungen, posttraumatischen Belastungsstörungen und somatoformen Störungen, haben. Nur in seltenen Fällen erreichen sie dabei das Ausmaß eines „Demenzsyndroms bei ...“ (früher „Pseudodemenz“ genannt). Siehe hierzu Punkt 5. 3. Dauerhafte leichte kognitive Störung: Sind objektivierbare kognitive Störun­ gen auch in der Testung dauerhaft vorhanden, aber nur leichter Ausprägung und ohne Auswirkung auf die Alltagskompetenz, so sprechen wir von einer leichten kognitiven Störung oder von MCI (mild cognitive impairment). Hier sollten wir zu einer halbjährlichen Kontrolle raten, denn immerhin ca. 20 % dieser Patien­ten entwickeln später eine Demenz. Da aber vier von fünf MCIPatienten jahrelang stabil bleiben, darf gleichwohl ein vorsichtig optimistischer Umgang obsiegen. 4. Progrediente (bisher nicht kurativ behandelbare) Demenz: Ist die Hirnleistungsschwäche deutlic­h und sogar durch Fremdanamnese gestützt, muss eine Differenzialdiagnos- Medizinisches Thema tik veranlasst werden. Wird der Betroffene von einem Angehörigen gebracht, so steigt bekanntlich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine relevante Beeinträchtigung handelt, die nicht selten sogar von dem Betroffenen selbst nicht als solche wahrgenommen wird (Anosognosie). Ein Routinefall sollte professionell die drei Säulen der Diagnostik durchlaufen (Test, Bildgebung, Labor), um dann in aller Regel (bei fehlender Kontraindikation oder Ablehnung) eine medikamentöse (Antidementivum und ggf. Antidepressivum oder Antipsychotikum) sowie nicht medikamentöse Hilfe zu erfahren, die den Angehörigen mit einschließt. Erforderlich ist eine Unterscheidung zwischen präseniler Demenz, d. h. vor dem 65. Lebensjahr auftretend, und „seniler“ Demenz. Bei der präsenilen Demenz ist noch einmal die sehr seltene familiäre genetische Form von den sporadischen Formen zu unterscheiden. „Senile“ Demenzen (früher: „Altersdemenzen“) unterteilen wir in Abhängigkeit von ätiologisch-pathogenetischen Erkenntnissen in die Untergruppen „Alzheimer-Demenz“, „ParkinsonDemenz“, „Lewy-Körperchen-Demenz“, „Frontotemporale Demenz“, „Vaskuläre Demenz“ oder auch „Misch-Demenz“ i. S. einer Demenz vom Alzheimer Typ mit vaskulärer Beteiligung. Die unterschiedliche Symptomatik in den ersten beiden Krankheitsstadien (im dritten Stadium besteht eine gemeinsame symptomatische End­ strecke) erfordert auch eine jeweils spezifische Behandlung. Zum Beispiel­ kann Logopädie oder Ergotherapie vorübergehend genauso indiziert sein wie Physiotherapie bei sekundär oder bereits primär bestehender Parkinsonsymptomatik sowie Gangstörung mit Sturz­neigung durch Schwindel, Spas­ tik, Ataxie, Gangapraxie usw. Weniger der akademische Anspruch als vielmehr diese unterschiedlichen therapeutischen Konsequenzen begründen­ den Sinn der Differenzialdiagnose. Im Übrigen zeigen Studien und klini­ 21 Anzeigen KV-Blatt 08.2009 Pos. 15 Pos. 32 22 Medizinisches Thema KV-Blatt 08.2009 Anzeigen Fortsetzung von Seite 21 Pos. 17 sche Erfahrung, im Gegensatz zum herkömmlichen Glauben, „Alzheimer“ habe die schlechteste Prognose, dass zum Beispiel die Prognose quod vitam (Überlebenszeit) bei den vaskulären Demenzen schlechter ist. Ebenso stirbt durchschnittlich derjenige schneller, der Pflegemaßnahmen aggressiv abwehrt. 5. „Heilbare“ Demenzsyndrome: Pos. 24 Eine große Verantwortung haben wir durch die Möglichkeit, dass wir es auch einmal mit einer „heilbaren“ Demenz oder einem Delir zu tun haben könnten. Diese „Exoten“ herauszufiltern und durch beherzte Intervention kurativ zu bessern oder das Leiden zu beheben­ ist die größte Herausforderung bei der Versorgung von Demenzpatienten ­(Folsäuremangel, subdurales Hämatom, Enzephalitis, Normdruck-Hydrozephalus, zerebraler Tumor, Depression, iatrogene/medikamentöse Intoxikation usw.). Der Arzt, der einen solchen Fall mal in seiner Praxis erlebt hat, hat für immer seinen Nihilismus bei dem Thema Demenz abgelegt. Eine Substitutionsbehandlung, Antibiotika, Kortison, eine OP, eine antidepressive Behandlung oder auch nur die Elimination schädlicher Medikamente (vor allem anticholinerg wirksamer) bzw. Noxen können das „Wunder der Heilung“ bewirken. Dr. med. Gerd Benesch Nervenheilkunde 10627 Berlin Pos. 26 Pos. 37