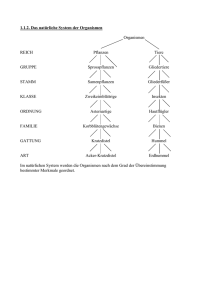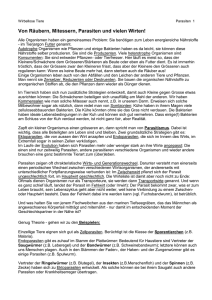Historisches Wörterbuch der Biologie - ReadingSample - Beck-Shop
Werbung

Neuerscheinungen J.B. Metzler Historisches Wörterbuch der Biologie Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe Bearbeitet von Toepfer, Georg Toepfer, Georg 1. Auflage 2011. Buch. C, 2404 S. Hardcover ISBN 978 3 476 02316 2 Format (B x L): 17 x 24 cm Gewicht: 5261 g Weitere Fachgebiete > Chemie, Biowissenschaften, Agrarwissenschaften > Biowissenschaften allgemein Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. 978-3-476-02316-2 Toepfer, Historisches Wörterbuch der Biologie/3 Bände © 2011 Verlag J.B. Metzler (www.metzlerverlag.de) Georg Toepfer Historisches Wörterbuch der Biologie Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe Band 1: Analogie – Ganzheit Verlag J. B. Metzler Stuttgart · Weimar Analogie 1 Analogie Der Ausdruck geht über das lateinische ›analogia‹ auf das griechische Wort ›ἀναλογία‹ »Verhältnis, Ähnlichkeit« zurück. Älterer, nicht-terminologischer Gebrauch Das Wort findet sich schon bei antiken Autoren in einer besonderen biologischen Bedeutung. So verwendet Aristoteles den Ausdruck für funktionale Ähnlichkeiten bei Organismen, also Ähnlichkeiten im Gebrauch von Organen: »Mit analog [ἀνάλογον] meine ich, daß die einen eine Lunge haben, die anderen stattdessen etwas anderes, bzw. daß die einen Blut, die anderen das dem Blut Analoge haben, was dieselbe Funktion wie das Blut bei den Bluttieren hat«.1 Für analog (»ἀνάλογον«) hält Aristoteles auch die Wurzel der Pflanzen und den Mund der Tiere, denn beide nehmen die Nahrung auf.2 Die Ähnlichkeit, die Aristoteles als ›analog‹ bezeichnet, grenzt er klar von einer Ähnlichkeit der Form ab und bestimmt sie auch als unabhängig davon: Analoge Körperteile müssen sich also morphologisch nicht ähneln. Nicht immer ist es aber die Funktionsähnlichkeit, in der nach dem Wortgebrauch von Aristoteles eine Analogie von Teilen besteht. Auch das Verhältnis von funktional verschiedenen Teilen wie das der Schuppen der Fische zu den Federn der Vögel bezeichnet Aristoteles als ›Analogie‹ (»ἀναλογία«).3 Als eine eigene Kategorie des Vergleichs ist die Ähnlichkeit »der Analogie nach« (»κατʼ ἀναλογίαν«) bei Aristoteles allein insofern bestimmt, als sie nicht eine Identität (d.h. strukturelle Ähnlichkeit) von Teilen darstellt und nicht auf der quantitativen Zu- oder Abnahme eines Merkmals beruht, sondern das Verhältnis von Teilen gleicher Lage bezeichnet, wie z.B. Knochen und Gräten, Fingernägel und Hufe oder Hände und Klauen.4 Die Einteilung von Lebewesen nach Analogien in ihrem Bau ist insgesamt sehr alt. Sie findet sich der Sache nach in allen antiken Texten (und auch der Bibel), die die Tiere in Land-, Wasser- und Lufttiere klassifizieren (↑Lebensform). Detailliertere Einteilungen auf dieser Basis werden seit dem 18. Jahrhundert entwickelt, so nimmt H.S. Reimarus eine Klassifikation der Tiere nach ihren Weisen der Fortbewegung vor.5 Auch die Einteilung der Vegetation durch A. von Humboldt am Ende des Jahrhunderts enthält eine Klassifizierung der Vegetation nicht nach Eine Analogie ist eine Ähnlichkeit der Funktion von Teilen oder Prozessen von Organismen verschiedener Arten. Analogie (Aristoteles 4. Jh. v. Chr.) 1 Anpassungsmerkmale (Blyth 1838) 5 Konvergenz (Watson 1860) 8 Parallelismus (Cope 1887) 9 Analogienlehre (Böker 1937) 6 Analogienbiologie (Koepcke 1952) 6 der Ähnlichkeit der Pflanze im anatomischen Feinbau ihrer Organe, sondern nach ihrer Gestalt und ↑Lebensform.6 Verwendungen im 18. und frühen 19. Jh. Trotz des richtungsweisenden Wortgebrauchs bei Aristoteles wird das Wort ›Analogie‹ bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts innerhalb der Biologie in nichtterminologischer Weise im Sinne von »Ähnlichkeit, Entsprechung« verwendet. Einige vereinzelte Nachweise: P.L.M. Maupertuis ist 1751 der Auffassung, die Ähnlichkeit (»analogie«) unter den Organismen erstrecke sich von den Tieren über die Zoophyten bis zu den Pflanzen, ja selbst bis zu den Mineralien und Metallen.7 An exponierter Stelle, nämlich im Titel eines Vortrags, den er vor der Malerakademie in Amsterdam hält, verwendet P. Camper im Jahr 1778 den Ausdruck.8 Camper stellt darin die Entsprechung in den Elementen des Skeletts verschiedener Wirbeltiere dar und macht die Ähnlichkeit der morphologischen Struktur zum Kriterium für das Vorliegen von Analogien. J.F. Blumenbach bringt die Klassifikation nach Analogien mit einer systematischen Einteilung von Organismen nicht nach einzelnen Merkmalen, sondern nach dem gesamten äußeren Habitus in Verbindung und unterscheidet sie von einer Klassifikation nach den Verhältnissen der genealogischen Verwandtschaft.9 Deutlich herausgearbeitet wird diese Unterscheidung aber nur von I. Kant und C. Girtanner (↑Art). 1796 differenziert Girtanner im Anschluss an Kant und mit Blick auf eine Klassifikation der Organismen zwischen »Naturgeschichte« und »Naturbeschreibung«: Die Naturgeschichte lehre, »wie das Urbild einer jeden Stammgattung von Thieren und Pflanzen ursprünglich beschaffen gewesen sei, und wie die Gattungen von ihrer Stammgattung allmählig abgeartet seien«.10 Girtanner schlägt vor, auch die biologische Taxonomie auf der naturgeschichtlichgenealogischen Verwandtschaft zu begründen (↑Systematik). Die Naturbeschreibung sei dagegen allein an der Ähnlichkeit der Organismen orientiert und Analogie vollziehe eine Einteilung der »organisirten Körper, nach dem Linneischen Systeme, in Klassen, Ordnungen, Geschechter und Arten. Diese Eintheilung der Schule, welche bloß für das Gedächtnis ist, bringt die organischen Geschöpfe unter Titel, nach ihrer Ähnlichkeit, oder nach der Analogie«.11 Die Analogie ist damit also bestimmt – wie in der späteren Bedeutung – als eine Ähnlichkeit, die nicht auf genealogischer Verwandtschaft beruht. Die vergleichenden Anatomen des frühen 19. Jahrhunderts beziehen das Wort aber auch noch auf diejenigen morphologischen Ähnlichkeiten, die später als ›Homologien‹ bezeichnet werden. Dies gilt etwa für É. Geoffroy Saint-Hilaire, der eine Theorie der Analogien (»théorie des analogues«) für die Methode des Vergleichs von Bauplänen formuliert.12 Im Verhältnis zu ↑›Homologie‹ stellt das Konzept der Analogie für Geoffroy die übergeordnete Kategorie dar: Zwei Organe, die allein in ihrer topografischen Lage im Körper einander ähneln, sind analog; wenn sich die Ähnlichkeit aber auch auf die Entwicklung bezieht, liegt eine besondere Form der Analogie vor, die Geoffroy ›Homologie‹ nennt.13 Auch schon G. Cuvier ist die Unterscheidung von zwei Formen der Ähnlichkeit von Organismen, einer strukturell und einer funktional bedingten, offenbar bewusst, denn er kann in der Auseinandersetzung mit Geoffroy über die Einheit des ↑Typus aller Lebewesen ins Feld führen, dass die Ähnlichkeit z.B. der Organe der Fische mit denen anderer Klassen allein auf den Ähnlichkeiten der Funktion, nicht aber auf den für ihn entscheidenden Ähnlichkeiten der Struktur beruht (»s’il y a des ressemblances entre les organes des poissons et ceux des autres classes, ce n’est qu’autant qu’il y en a entre leurs fonctions«).14 Analogie und Affinität Eine Differenzierung zwischen verschiedenen Formen der Ähnlichkeit unter Organismen wird zu Beginn des 19. Jahrhunderts von taxonomisch orientierten Biologen durchgeführt. Sie findet sich bereits bei Lamarck, der als Gründe für den Bau einzelner Organe einerseits die Lebensweise der Tiere, andererseits ihre innere Organisation angibt.15 Terminologisch wird diese Unterscheidung durch die Worte Analogie und Affinität markiert. Vor dem 19. Jahrhundert werden die beiden Ausdrücke meist unspezifisch und äquivalent zur Bezeichnung von Ähnlichkeiten verwendet (für ›Affinität‹ vgl. z.B. Bauhin 162316 und Linné 175117). Seit den späten 1810er Jahren wird als ›Affinität‹ (engl. »affinity«) die Ähnlichkeit von Organismen eines gemeinsamen Typus verstanden. Die über Affinität verbundenen Organismen bilden 2 (nicht notwendigerweise zeitlich verstandene) »Serien« oder »Kreise«. Die Analogien stellen dagegen die Ähnlichkeiten später Formen einer Serie dar, die sich einander annähern. Analogien und Affinitäten werden innerhalb verschiedener Organismengruppen aufgestellt: W.S. MacLeay beschreibt sie zunächst für Insekten18; 1823 definiert er eine Analogie allgemein als eine Korrespondenz von Teilen verschiedener Organismen, die sich in ihrer generellen Struktur unterscheiden (»correspondence between certain parts of the organization of two animals which differ in their general structure«19). Während die Affinitäten auf inneren Ursachen beruhen sollen, seien die Analogien Ausdruck äußerer Ursachen. Bereits in dieser Unterscheidung liegt eine Andeutung der späteren Differenzierung zwischen strukturellen und funktionellen Ähnlichkeiten, insofern die inneren Ursachen den inneren anatomischen Bauplan betreffen, die äußeren Ursachen aber auf die Anpassungen an eine jeweilige Umwelt bezogen werden können.20 Später wird die Unterscheidung von Analogien und Affinitäten auf Pilze21 und Vögel22 angewandt. Analogien werden dabei meist zwischen äußeren Teilen der Organismen aufgestellt (»exterior forms«23 oder »external characters«24) und auf weniger wichtige (»less essential«25) Merkmale bezogen. Der genaue Grund der Unterscheidung bleibt aber strittig. J.O. Westwood hält die Gegenüberstellung für allein relativ in Bezug auf ein Vergleichsobjekt: Verglichen mit Pflanzen sei die Ähnlichkeit zwischen Fledermäusen und Libellen (in Bezug auf das Fliegen) eine Affinität; verglichen mit Vögeln (also anderen Wirbeltieren, d.h. eines Taxons, zu dem die Fledermäuse selbst zählen), sei die Ähnlichkeit zwischen Fledermäusen und Libellen aber nur eine Analogie.26 Eine für alles Spätere richtungsweisende Analyse liefert H.E. Strickland 1840, indem er die Analogien eindeutig als Ähnlichkeiten, die auf Anpassungen beruhen, beschreibt (»adaptation of organic beings to their destined conditions of existence«).27 Eine Analogie ist danach eine Ähnlichkeit von Strukturen, die der Erfüllung einer ähnlichen Funktion dienen (»destined to perform a similar function«).28 Analog zueinander sind nach Strickland z.B. die bootsähnlichen Formen der im Wasser lebenden Organismen aus den unterschiedlichsten Affinitätskreisen, z.B. Fische, Wale, Tintenfische, Schwimmkäfer, Wasserwanzen und auch die Boote des Menschen. Analogie versus Homologie Terminologische Eindeutigkeit erlangt der Begriff der Analogie mit R. Owens Gegenüberstellung von Analogie und ↑Homologie in den frühen 1840er Jah- 3 Analogie ren. Owen definiert eine Analogie Ursache der Ähnlichkeit als eine funktionale Entsprechung Entwicklung Anpassung von Teilen verschiedener OrganisEntwicklungszwang Analogie men (»analogue«: »a part or organ nein (ontogenetische (Anpassung an anorganiin one animal which has the same Abhängigkeit »constraints«) sche Umweltfaktoren) function as another part or organ in der Ähnlichkeit von der Relati29 Homologie Koadaptation a different animal« ). In der Theo- on zu anderen ja (genealogische (Anpassung an andere rie Owens kann jeder Teil eines Or- Organismen Verwandtschaft) Organismen, z.B. Mimikry) ganismus unter den zwei Aspekten der Funktion und der Form betrach- Tab. 6. Kreuzklassifikation von Typen organischer Ähnlichkeit. tet werden: Der funktionelle Aspekt klärt die Frage der Anpassung eines theorie: »The real affinities of all organic beings, Teils; der Formaspekt gibt Aufschluss darüber, was in contradistinction to their adaptive resemblances, ein Teil seinem Wesen nach ist. Trotz seiner klaren are due to inheritance or community of descent. The Definition verwendet Owen den Begriff der Analogie Natural System is a genealogical arrangement«.33 nicht immer in seiner terminologischen Bedeutung, Wäre Selektion der entscheidende Mechanismus sondern macht daneben auch einen nicht-technischen zur Erklärung der organischen Ähnlichkeiten, dann Gebrauch von ihm. würde nicht die gemeinsame Abstammung, sondern Eine Abwertung erfahren die analogen Ähnlichdie gleichgerichtete Anpassung die Ähnlichkeiten erkeiten im Zuge der Privilegierung der Homologien klären und die Grundlage des »Natürlichen Systems« durch die Evolutionstheorie. Denn die Feststellung sein. Faktisch ist aber die Deszendenz zur Erklärung von Analogien ermöglicht keine Rekonstruktion phyvon organischen Ähnlichkeiten das stärkere Prinzip, logenetischer Verwandtschaften – Analogien können weil Analogien zwar einige, aber nicht die meisten die tatsächliche Verwandtschaft sogar im Gegenteil Ähnlichkeiten erklären. verdecken. In diesem Sinne betont C. Darwin, dass Owen versteht die Begriffe der Homologie und die eigentlichen und wesentlichen ÜbereinstimmunAnalogie noch so, dass sie sich nicht gegenseitig gen zwischen Organismen auf gemeinsamer Abstamausschließen (»homologous parts may be, and often mung beruhen, also Homologien darstellen: Die geare, also analogous parts in a fuller sense, viz., as meinsame Abstammung (»community of descent«) performing the same function«34). Diese Auffassung liefere einen tieferen Grund für die Klassifikation als die bloße Ähnlichkeit (»some deeper bond is inclufindet sich später auch bei Gegenbaur und Haeckel.35 ded in our classifications than mere resemblance«).30 Die Kiemen der Fische und Amphibien sind danach Analogien können für Darwin dagegen im Hinblick beispielsweise gleichzeitig einander homologe und auf natürliche Klassifikationen täuschende Ähnlichanaloge Körperteile. keiten sein (»analogy may be a deceitful guide«31). Heute werden dagegen im Allgemeinen nur solche Dass es neben der gemeinsamen Abstammung aber Merkmale als ›analog‹ bezeichnet, die nicht homoauch noch eine andere Grundlage für organische log zueinander sind.36 E. Jacobshagen definiert 1925: Ähnlichkeit gibt, sieht auch Darwin. Er erklärt diese »Organe übereinstimmenden oder ähnlichen Baues, Ähnlichkeit als Ergebnis einer Selektion (Konverdie nicht denselben Bestandteil des Bauplanes vergenz, s.u.): »the acquirement through natural seleckörpern und somit, trotz ihrer Ähnlichkeit, einen tion of parts or organs, strikingly like each other, ganz verschiedenen morphologischen Wert besitzen, independently of their direct inheritance from a comnennt man analog. Oder kürzer […]: Organe übermon progenitor«.32 einstimmenden oder ähnlichen Baues, welche nicht Darwin erkennt klar, dass Homologie und Analohomolog sind, nennt man analog«.37 Analog sind also gie zwei alternative Erklärungen für die Ähnlichkeit z.B. die Kiemen der Fische und Muscheln, nicht aber von Organismen sind. Beide sind mit zwei unterdie Kiemen der Fische und Amphibien. Die Konzepschiedlichen, ja diesbezüglich entgegengesetzten te der Homologie und Analogie gelten als die GrundAspekten seiner Theorie verbunden: die Homologie lage alternativer Erklärungen für die Ähnlichkeit von mit der Deszendenztheorie, die Analogie mit der SeStrukturen oder Funktionen (↑Homologie).38 lektionstheorie. Die Abwertung der Analogie als eine Außerdem werden heute meist nur solche Merkunzureichende Erklärung der »wirklichen Ähnlichmale als ›analog‹ bezeichnet, die nicht nur die gleikeiten« enthält damit gleichzeitig das Eingeständnis che Funktion ausüben, sondern auch noch einander der eingeschränkten Erklärungskraft der Selektionsstrukturell ähnlich sind – ebenfalls entgegen der Analogie 4 Abb. 5. Divergenz und Konvergenz innerhalb der Gruppe der Wirbeltiere. In der oberen Reihe sind typische Vertreter aus sieben »Klassen« der Wirbeltiere dargestellt, in der unteren Reihe befinden sich Vertreter mit fischartiger Körpergestalt aus der jeweils gleichen taxonomischen Gruppe. Es handelt sich der Reihe nach um folgende systematische Taxa: Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Knochenfische, Knorpelfische und Kieferlose (die Vertreter der fischartigen Reptilien und Kieferlosen in der unteren Reihe sind nur fossil bekannt) (aus Koepcke, H.-W. (1971-74). Die Lebensformen, 2 Bde.: I, 148; vgl. ders. (1952). Formas de vida y comunidad vital en la naturaleza. Mar del Sur (Lima) 24, 39-66: 48). ursprünglichen owenschen Definition und der verbreiteten Auffassung im 19. Jahrhundert, z.B. der von E.R. Lankester aus dem Jahr 1870: »Any two organs having the same function are analogous, whether closely resembling each other in their structure and relation to other parts or not«.39 Meist wird der Analogiebegriff aber enger gefasst, so dass allein in ihrer Struktur sich ähnelnde Merkmale als ›analog‹ bezeichnet werden. Einige der Autoren, die den Analogiebegriff auf bloße Funktionsähnlichkeit beschränken, nennen solche Merkmale, die sich darüber hinaus in ihrer Form ähneln, konvergent (s.u.). Schließlich lassen einige Autoren den Aspekt der Funktionsgleichheit in der Bestimmung des Analogiebegriffs ganz fallen und bestimmen Analogien allein durch die Formähnlichkeit (wie dies bereits in der obigen Definition von Jacobshagen der Fall ist). So deutet der Botaniker W. Troll Ähnlichkeiten im Bau von Blüten 1928 nicht als Ausdruck von Anpassungsähnlichkeiten, sondern als »Gestalttypen« (↑Typus).40 Und der vergleichende Morphologe M. Nowikoff sieht 1930 in einer Analogie »nicht bloß eine zufällige Konvergenz zweier Organe, die in gleiche Verhältnisse gelangt sind«, sondern hält sie für einen »Ausdruck allgemeiner, in der lebenden Natur liegender Gesetze der Formbildung«.41 Ob sich solche biologischen Gesetze aber wirklich formulieren lassen, ist bis in die Gegenwart umstritten. Unabhängig davon hält aber auch M. Ghiselin 1997 daran fest, Analogien als Formähnlichkeiten zu verstehen, die keine gemeinsamen Funktionen haben müssen, sondern allein dadurch spezifiziert sind, dass sie keine ↑Homologien sind: »although common function is one cause of the similarity between the wholes, it is not a defining property of the relation of analogy. It is neither a necessary nor a sufficient condition for two parts to be analogous«.42 Für Ghiselin sind Analogien also primär Strukturähnlichkeiten; die Bindung an die Funktionsgleichheit hält er für nicht sinnvoll, weil es höchst unterschiedlich geformte Merkmale geben kann, die die gleiche Funktion wahrnehmen (z.B. das Gift eines Pilzes und die Schale einer Muschel als Schutz vor dem Gefressenwerden). Das seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominante Verständnis des Begriffs bestimmt Analogien als Funktionsähnlichkeiten von ähnlich gebauten Organen, die nicht homolog zueinander sind.43 Unter Beschränkung auf die beiden Dimensionen der Funktionsgleichheit und der Abstammungsidentität lässt sich das Verhältnis von Analogie- und Homologiebegriff in einer einfachen Kreuztabelle wiedergeben (Tab. 6).44 Der Verweis auf Analogie und Homologie enthält also zwei unterschiedliche Formen der Erklärung der Ähnlichkeit von Organismen und ihren Teilen. Zwei weitere, davon unabhängige Erklärungen werden durch Entwicklungszwänge und Koadaptationen gegeben: Ein Entwicklungszwang ergibt sich aus dem inneren Bau eines Organismus; eine Koadaptation als eine Anpassung an andere Organismen. Ähnlichkeit aufgrund des Prozesses der Koadaptation ist allerdings ein nicht sehr häufiges Phänomen, ein bekanntes Beispiel sind die Ähnlichkeiten zwischen dem Bau von Blüten und den Mundwerkzeugen von Insekten, die als gegenseitige Anpassungen an die Blütenbestäubung bzw. Ernährung von Nektar entstanden sind. Eine besondere Form der Ähnlichkeit als Ergebnis der Anpassung an andere Organismen ist die ↑Mimikry. Sie ist vermittelt über einen dritten Organismus, der die Ähnlichkeit verursacht, z.B. einen Räuber, der zwischen dem »Modell« und dem »Imitator« des Mimikrysystems nicht zu diskriminieren vermag. Die Koadaptation besteht hier entweder 5 in einer beidseitig durch Selektion stabilisierten und verstärkten Ähnlichkeit an den jeweils anderen Organismus (wenn die Ähnlichkeit für beide Partner von Vorteil ist wie bei der Müllerschen Mimikry) oder in einer nur einseitig durch Selektion verstärkten Ähnlichkeit, der von der anderen Seite durch Betonung der Unterschiede entgegengewirkt wird (wie bei der Batesschen Mimikry). Verwandt mit der Unterscheidung von Analogie und Homologie ist die Gegenüberstellung von Anpassungsmerkmalen und Organisationsmerkmalen durch C. von Nägeli (1884). Anpassungsmerkmale sind nach Nägeli »durch die äusseren Reizeinflüsse hervorgerufen« und weisen eine »geringere Permanenz« auf als die Organisationsmerkmale, die durch eine »selbständige Umbildung des Idioplasmas bedingt« seien und sich »den äusseren Verhältnissen gegenüber gleichgültig verhalten«. Nägeli bezeichnet die Organisationsmerkmale daher auch als »rein morphologisch«, die Anpassungsmerkmale dagegen als »nützlich« (↑Homologie).45 Bereits vor der einflussreichen terminologischen Unterscheidung durch Nägeli ist der Begriff ›Anpassungsmerkmale‹ in ähnlicher Bedeutung und Abgrenzung in Gebrauch (Dub 1870: »Der grosse Unterschied im Werthe zwischen wahren Verwandtschafts- und analogen oder Anpassungsmerkmalen«46; Seidlitz 1876: »[Bei den Schwämmen wurden] viele individuelle Anpassungsmerkmale zur Aufstellung von Gattungen benutzt […], indem man sie irrthümlich für Ausrüstungsmerkmale gehalten hatte«47). Im Englischen erscheint ein sprachliches Äquivalent zu ›Anpassungsmerkmale‹ bereits gut zwanzig Jahre vor Darwins Veröffentlichung seiner Evolutionstheorie. E. Blyth verwendet es in verschiedenen Publikationen aus den 1830er Jahren. Er grenzt das Konzept dabei bereits von »intrinsischen« (physiologischen) Merkmalen ab und bezieht es auf solche, in einer Verwandtschaftsgruppe variablen48 Eigenschaften, die sich aus der besonderen Lebensweise eines Organismus oder seiner Anpassung an besondere Bedingungen des Lebensraums ergeben (1838: »It was the especial province of the zoologist to distinguish, in every instance, the intrinsical from the simply adaptive characters of animals; to disentangle and discriminate affinity from analogy«49; »in adaptive characters, rather than intrinsical physiological agreement«50; »the secondary or adaptive characters (which have reference to habit)«51; 1839: »adaptive characters which have reference to a special mode of life«52). Analogie Bauplan und Funktionsplan Die in den Analogien identifizierten Funktionsgleichheiten von Körperteilen können in einem eigenen System der organischen Leistungen beschrieben werden. Dieser Ansatz stellt neben den morphologisch-genealogisch begründeten Bauplan von Organismen einen »Funktionsplan«53 (von Uexküll 1928) oder »Leistungsplan«54 (Ungerer 1942) (↑Typus). Der Funktionsplan betrifft nicht die relative Lage der Körperteile zueinander, sondern die als Anpassungen an die jeweiligen Leistungen entstandenen Merkmale und Merkmalssyndrome. Weil der Funktionsplan vielfach die Relation des Organismus zu seiner Umwelt betrifft, sind es vor allem die äußeren Körperteile und die Gestalt des Organismus, die von einer Änderung des Funktionsplans betroffen sind. Delphine und Fische weisen z.B. einen grundlegend anderen Bauplan auf, sie verfügen aber über einen in vielem ähnlichen Funktionsplan (aufgrund gleichgerichteter Anpassungen an das Schwimmen im Wasser); Delphine und Fledermäuse haben dagegen einen grundlegend verschiedenen Funktionsplan, ihr Bauplan ist aber sehr ähnlich (aufgrund der gemeinsamen Zugehörigkeit zu der Verwandtschaftsgruppe der Säugetiere). Analogie und Taxonomie Nicht in allen Kontexten ist die Privilegierung der Klassifikation aufgrund der Homologien (Bauplan) gegenüber den Analogien (Funktionsplan) gerechtfertigt (»Wird der Wal als Fisch bezeichnet, so ist das in anatomischer, nicht aber in morphologischer Hinsicht zu beanstanden. Ob wir ein Objekt nach der Form oder dem Inhalt benennen, bleibt eine Frage der Vereinbarung«55). Der wesentliche Vorzug der Klassifikation aufgrund der Homologien liegt in seiner Eindeutigkeit: Unter Voraussetzung eines Stammbaums der Organismen führt eine Taxonomie auf der Grundlage der Verwandtschaft zu einem im Prinzip eindeutigen (wenn auch nicht immer leicht zu ermittelnden) Ergebnis; bei den Klassifikationen nach Analogien im Sinne von Funktionsähnlichkeiten können dagegen viele nebeneinander bestehen. Eine Typologie nach Lebensweisen und Funktionsplan liefert zwar oft eher als eine Verwandtschaftstypologie eine Klassifikation der Lebewesen nach ihren (äußeren) Ähnlichkeiten; dennoch müssen Übereinstimmungen in der Lebensweise nicht immer zu Ähnlichkeiten zwischen Organismen führen. Es können die Anforderungen eines Lebensraumes im Gegenteil zu sehr unterschiedlichen Lösungen seitens des Organismus führen, d.h. zu Merkmalen, die als verschiedene Anpassungen an den Lebensraum Analogie zu deuten sind. Beispielsweise kann die einheitliche Lebensweise von Organismen, die im Wasser schweben (also von Plankton), zu sehr unterschiedlichen Formen von Schwebe-Anpassungen führen, die nicht in ihrer Gestalt, sondern allein in ihrem Effekt übereinstimmen, ein Herabsinken zu vermindern – so etwa die Ausbildung von Schwebefortsätzen, die Einlagerung von leichten Stoffen (Schwimmblase) oder die Bildung einer Körpergestalt in Blasen-, Scheiben- oder Stabform56. Bauplan und Evolution Die Möglichkeit der Unterscheidung von Analogie und Homologie erfährt im Rahmen der Annahme einer Phylogenese eine einleuchtende Interpretation. Darüber hinaus ist die Verschiedenheit des inneren Bauplans von Organismen, die sehr ähnliche Lebensweisen haben, aber nicht näher miteinander verwandt sind, vielfach als ein Beleg für die Evolutionstheorie interpretiert worden.57 Angesprochen sind damit die »Dysteleologien«, also Eigenheiten eines Organismus, die offenbar für seine Lebensweise nicht zweckmäßig sind, die aus der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Organismus heraus aber verständlich werden. Wären die Organismen für ihre spezielle Lebensweise entworfen, dann würden viele ihrer merkwürdigen Parallelen zu anderen Organismen keine Erklärung finden können: »Nur aus der Sinnlosigkeit der Vogelmaskerade des Pinguins, aus der Zwecklosigkeit dieser Übereinstimmung mit fliegenden Tieren wird auf seine Abstammung von Organismen geschlossen, bei denen diese Eigenschaften zweckmäßig waren«.58 Nur seine Vergangenheit als fliegender Vogel erkläre viele der für seinen hauptsächlichen Aufenthalt unter Wasser unzweckmäßigen Eigenarten, wie die Notwendigkeit, an der Luft zu atmen oder seine Eier auf dem Trockenen abzulegen. »Analogienbiologie« Paradigmatisch können alle biologischen Disziplinen, die nicht phylogenetisch orientiert sind, sondern funktionale Analogien untersuchen, zu einer Analogienbiologie zusammengefasst werden. H. Böker stellt 1937 ausgehend von seinen Untersuchungen zu einer vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere eine Homologienlehre als »genetische Anatomie« einer Analogienlehre als »funktioneller Anatomie« gegenüber.59 Während Böker zu der Homologienlehre die Typologie (Taxonomie), Genetik und Deszendenzlehre rechnet, besteht die Analogienlehre bei ihm aus den Disziplinen Physiologie, Ethologie und Ökologie. Darauf aufbauend führt Koepcke 1952 die 6 Bezeichnung Analogienbiologie ein.60 Er hebt sie von der an der Evolution orientierten dominanten Strömung in der Biologie, der Homologienbiologie (↑Homologie), ab. Später entwirft Koepcke eine solche Richtung als eine »Disziplin der Biologie [...] in der das Prinzip der Analogie eine ähnliche zentral beherrschende Initialstellung einnimmt, oder doch ihrem Wesen nach einnehmen sollte, wie das Prinzip der Homologie in den mehr historisch orientierten Teilgebieten der Biologie«.61 Mit einer Analogienbiologie ist der Anspruch verbunden, nicht allein einen empirischen Nachvollzug der phylogenetisch gewordenen Organismenformen zu leisten, sondern eine von der Phylogenese unabhängige Systematik der ↑Lebensformen und der Physiologie zu entwickeln. Auch entwicklungsbiologische Bemühungen zur Aufstellung allgemeiner »Gesetze der Form«, die unabhängig von kontingenten phylogenetischen Verläufen gültig sind, können dem Paradigma der Analogienbiologie untergeordnet werden, einem Credo B. Goodwins folgend: »evolutionary trees […] are largely irrelevant to an understanding of organisms as transformational structures. […] Historical reconstruction cannot solve any problems about the nature of the entities with which biology is faced and the organisational principles which are embodied in organisms«.62 Analogien als Evolutionstrends Als Teil einer Analogienbiologie lassen sich einige allgemeine Trends im Zusammenhang von Funktionsplan und Morphologie formulieren, die analoge Organe in phylogenetisch weit voneinander entfernten Organismen identifizieren. Der auffälligste Zusammenhang besteht hinsichtlich der verschiedenen Arten der Fortbewegung der Lebewesen. Sich auf der Grenzfläche von Land und Luft bewegende Organismen verfügen in der Regel über Beine; in der Luft fliegende Organismen haben dagegen vielfach Flügel. Eine oft bis ins Detail übereinstimmende Körperform kennzeichnet solche Organismen, die sich unter Wasser durch einen pendelartig bewegten Körperteil (Flossen) am hinteren Körperende fortbewegen (»Wrickschwimmer«63). Die typische Spindelform dieser Organismen ist mehrfach und unabhängig voneinander in verschiedenen Verwandtschaftsgruppen, v.a. bei den Wirbeltieren (hier bei den Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren), ausgebildet worden (vgl. Abb. 5). Neben diesen allgemein bekannten und damit fast selbstverständlichen Parallelen von Morphologie und Lebensform lassen sich auch andere, überraschendere und z.T. spekulative Zusammenhänge herstellen. 7 Dies gilt z.B. für die Verbreitung von bunten Farben bei Tieren und Pflanzen. Farben können als auffällige Signale zur innerartlichen ↑Kommunikation verwendet werden. Auffällige Signale haben aber den Nachteil, dass sie nicht nur den Adressaten der Signale, sondern auch Feinde auf einen Organismus aufmerksam machen. Als Evolutionstrend ist daher zu erwarten, dass solche Organismen am auffälligsten gefärbt sind, bei denen aufgrund ihrer Lebensweise die Farben am wenigsten von Feinden wahrgenommen werden können. Weil Farben vor allem vor einem hellen und strahlenden Hintergrund wenig in Erscheinung treten, sind sie bei solchen Lebewesen am unscheinbarsten, die aus der Perspektive des Räubers sich häufig vor dem Hintergrund des Himmels bewegen, die sich also bevorzugt im dreidimensionalen Raum des Wassers oder des Geästes eines Baumes aufhalten. In der Tat sind Organismen mit einer solchen Lebensweise (z.B. viele Fische, Vögel und Insekten) oft dadurch gekennzeichnet, dass sie bunt und auffällig gefärbt sind. Im Gegensatz dazu sind Organismen, die sich auf der Erdoberfläche bewegen, aus Schutz vor Fressfeinden meist nicht auffällig bunt gefärbt, sondern durch Tarnfarben ihrer Umgebung angepasst (z.B. die meisten nicht fliegenden Gliedertiere, Amphibien, Reptilien und Säugetiere). In den extremen Fällen von Organismen, bei denen sich fast das gesamte Leben in der Luft abspielt, z.B. bei den Seglern, sind bunte Farben dagegen wieder selten, weil Analogie in diesen Fällen auch für die Artgenossen eine Wahrnehmung von Farben vor dem hellen Hintergrund des Himmels kaum möglich ist. In der Folge der als Kommunikationsform wichtigen bunten Farben einiger Organismen können auch andere Organismen farbige Strukturen ausbilden, wenn sie mit ersteren in ökologischen Beziehungen stehen. So kann die Farbigkeit der Blüten vieler Pflanzen letztlich daraus erklärt werden, dass sie funktional auf Organismen bezogen sind, die sich fliegend fortbewegen (die Insekten und Vögel als Bestäuber). Analogien und Gesetze der Biologie Analogien sind allgemeine Charakteristika von Lebewesen, die als Anpassungen an bestimmte Funktionen entstanden und definitionsgemäß nicht an einzelne taxonomische Gruppen gebunden sind. Feststellungen von formähnlichen Analogien können damit als die aufschlussreichsten Verallgemeinerungen der Biologie gelten. Einige Autoren, wie M.T. Ghiselin argumentieren sogar, dass über Analogien die einzigen Gesetze der Biologie formuliert werden können, weil die anderen biologischen Verallgemeinerungseinheiten, die ↑Homologien, sich definitionsgemäß auf monophyletische Gruppen beziehen, die seiner Auffassung nach Individuen sind (↑Art), für die keine Verallgemeinerungen im Sinne von Gesetzen formulierbar sind. Analogien hält Ghiselin dagegen für Klassen von Gegenständen, die durch Abb. 6. Augentypen bei Tieren, angeordnet in parallel verlaufenden Reihen zunehmender Komplexität in verschiedenen Stämmen wirbelloser Tiere, ausgehend von Gruppen lichtempfindlicher Zellen (I), über Becheraugen (II) zu Linsenaugen (III) (aus Nowikoff, M. (1930). Das Prinzip der Analogie und die vergleichende Anatomie: 103). Analogie allgemeine Naturgesetze bestimmt sind. So gebe es z.B. allgemeine Gesetze der Aerodynamik, die bestimmen, welche Formen dafür geeignet sind, als ein Flügel zu fungieren.64 Allerdings wird gegen diese Sicht eingewendet, dass Analogien häufig strukturell sehr divers sind, weil ein Funktionsproblem auf sehr verschiedenen strukturellen Wegen gelöst werden kann. Die unterschiedlichen von der Evolution hervorgebrachten Flügel haben daher trotz ihrer funktionalen Einheitlichkeit strukturell doch nur wenig miteinander gemeinsam.65 Dass Analogien ein so verbreitetes biologisches Phänomen sind und der Begriff damit so grundlegend ist, kann auch aus Sicht des Selektionsprozesses gedeutet werden: In der Selektion sind es die Effekte, die für den Erfolg einer Struktur ausschlaggebend sind. Die Selektion ist damit in gewisser Weise »blind« für Strukturen, wie A. Rosenberg es formuliert: In der Selektion wird nicht unterschieden zwischen verschiedenen Strukturen mit gleichen Effekten.66 Es sind die Effekte einer Struktur, auf die es für den Organismus und seinen Erfolg ankommt; daher können sehr unterschiedliche Strukturen für den gleichen Effekt selektiert werden und sind dann als Analogien anzusehen. Die Blindheit der Selektion für Strukturen kann damit als ein Grund für die Vielfalt der Formen in der Biologie – bei einem doch begrenzten Inventar an Funktionen – verstanden werden (↑Diversität). Konvergenz Ein älterer Begriff der Konvergenz entwickelt sich in der Biologie vereinzelt im Zusammenhang mit frühen Stammbaumdarstellungen. So spricht L. Agassiz 1833 von einer »Konvergenz« der Abstammungslinien bei Fischen (»la convergeance de toutes ces lignes verticales indique l’affinité des familles avec la souche principale de chaque ordre«).67 Dieses Konzept der Konvergenz nimmt eine in die Vergangenheit orientierte Perspektive ein, insofern es auf den gemeinsamen Ursprung von taxonomischen Gruppen zielt. Das seit Darwin verbreitete Konvergenzkonzept geht dagegen von einer zukunftsbezogenen Perspektive aus, indem es auf die – als gleichgerichtete Anpassungen interpretierte – Annäherung von Organismen verschiedener Gruppen im Hinblick auf ihre Formen zielt. Der Botaniker H.C. Watson kritisiert in einem Brief an C. Darwin vom Januar 1860, dass dieser in seinem ›Origin of Species‹ allein von der Divergenz (↑Phylogenese), nicht aber der Konvergenz von Merkmalen spricht. Watson versteht den Begriff phy- 8 logenetisch zunächst in einer rückwärtsgerichteten Sicht (also im Sinne von Agassiz) als Rückführung von verschiedenen Arten auf einen gemeinsamen Vorgänger (»convergence ancestrally backwards«); daneben verwendet er den Ausdruck aber auch für eine vorwärtsgerichtete parallele Bildung ähnlicher Strukturen (»convergence onwards from that prototype«).68 Darwin geht nach dieser Kritik in späteren Auflagen (ab 1861) auch auf eine mögliche Konvergenz ein.69 Er versteht den Begriff als Übereinstimmung zwischen ursprünglich genetisch getrennten Organismen in inneren Organisationsmerkmalen, die er für kaum möglich hält: »It is incredible that the descendants of two organisms, which had originally differed in a marked manner, should ever afterwards converge so closely as to lead to a near approach to identity throughout their whole organisation«.70 Das später als ›Konvergenz‹ bezeichnete Phänomen, die Übereinstimmung von Organismen gleicher Lebensformen in ihren äußeren Formen, beschreibt Darwin allerdings auch schon in der ersten Auflage seines Hauptwerks: »animals, belonging to two most distinct lines of descent, may readily become adapted to similar conditions, and thus assume a close external resemblance«.71 ›Konvergent‹ können im Anschluss daran organische Strukturen genannt werden, die zwar nicht auf die Struktur eines gemeinsamen Vorfahren zurückgehen, jedoch einander ähnlich sind und als Reaktion auf ähnliche Umweltbedingungen entstanden sind. Darwin verweist in seiner späteren Verwendung des Begriffs auch auf C. Vogt, der in seiner Beschreibung des Stammbaums der Primaten neben dem anfänglichen Auseinanderstreben der Äste eine spätere Wiederannäherung beschreibt (»die Vervollkommnung biegt die Zweige mit ihren Spitzen wieder gegeneinander«).72 Der Ausdruck wird am Ende des Jahrhunderts vornehmlich von deutschsprachigen Biologen verwendet (»the ›convergenz‹ of German writers«).73 Konvergenz und Analogie Die Begriffe ›Analogie‹ und ›Konvergenz‹ werden heute nicht selten synonym verwendet.74 Wenn sie unterschieden werden, dann meist danach, ob eine Formähnlichkeit zwischen den miteinander verglichenen Einrichtungen vorliegt oder nicht. Eine Konvergenz wird dann verstanden als eine Analogie von Organen, die einander in ihrem Bau ähneln. In diesem Sinne bestimmt H. Wurmbach 1957 die Konvergenz als die »Erscheinung, daß unabhängig voneinander in der Stammesgeschichte ähnliche Formen entstehen«.75 Bei einer Analogie muss eine morphologi- 9 sche Ähnlichkeit dagegen nicht vorliegen. Analog im Hinblick auf die Funktion der Lokomotion sind z.B. die Flügel der Insekten und die Beine der Säugetiere. Konvergent sind dagegen die Insektenflügel und Vogelflügel, weil sie sich nicht nur in ihrer Funktion, sondern auch äußerlich in ihrem Bau ähneln, ohne aber auf eine Bildung eines gemeinsamen Vorfahren zurückzugehen. Ein anderes Kriterium der Unterscheidung geht davon aus, dass in der Konvergenz »Ähnlichkeiten von ganz verschiedenen Grundorganen aus aufeinander zustrebend erreicht« werden76; bei der Analogie – und v.a. bei dem Parallelismus (s.u.) – aber ähnliche Vorläuferstrukturen vorgelegen haben. Eine andere, eigenwillige Grundlage der Unterscheidung gibt J.-W. Wägele 2001. Danach ist eine Konvergenz eine »nicht homologe Ähnlichkeit, die durch Anpassung an dieselben Umweltbedingungen evolviert ist«, eine Analogie dagegen eine »nicht homologe Ähnlichkeit, die durch Zufall evolviert ist«.77 In den letzten Jahren wird deutlich, dass viele als konvergent angesehene Erscheinungen auf genetischer Ebene auf konservierten gemeinsamen genetischen Grundlagen beruhen (z.B. beim Auge in verschiedenen Tierstämmen).78 Einige Konvergenzen haben also zumindest eine Komponente, die auf einer Homologie im Sinne gemeinsamer Abstammung beruht. Parallelismus Der Ausdruck ›Parallelismus‹ wird im evolutionsbiologischen Zusammenhang bereits von Darwin verwendet. Er bezeichnet damit die Ähnlichkeit von Formen in geografisch weit auseinander liegenden Regionen (»parallelism in the forms of life«).79 Später im 19. Jahrhundert erscheint das Wort in verschiedenen Kontexten. Bei dem Evolutionsbiologen E.D. Cope bezieht sich die vorherrschende Bedeutung auf die Theorie der Rekapitulation der Phylogenie in der Ontogenie (»the parallelism between taxonomy, ontogeny, and phylogeny«80); nur vereinzelt steht der Ausdruck bei Cope für das später damit Bezeichnete, nämlich die Ausbildung von ähnlichen Strukturen in verschiedenen Verwandtschaftslinien.81 Allerdings beschreibt Cope dieses Phänomen durchaus in einigen Passagen: »identical modifications of structure, constituting evolution of types, have supervened on distinct lines of descent«82 – er verwendet nur den späteren Ausdruck dafür nicht. Die später verbreitete Bedeutung wird 1891 von W.B. Scott in den Vordergrund gestellt. Scott versteht unter ›Parallelismus‹ das Phänomen, dass verschie- Analogie dene Arten einer Gattung unabhängig voneinander ein Merkmal ausbilden (»the various species of the ancestral genus may acquire the new character independently of each other (parallelism)«). Er grenzt dies von der Konvergenz (s.o.) ab, bei der das ähnliche Merkmal von den Mitgliedern nur wenig miteinander verwandter Arten ausgebildet wird (»the species of widely different genera may gradually assume a common likeness (convergence)«).83 Diese Gegenüberstellung von Konvergenz und Parallelismus wird 1905 von H.F. Osborn weiter präzisiert: Er unterscheidet zwischen Parallelismus als Ergebnis analoger Adaptationen (»analogous adaptations«), d.h. ähnlichen Merkmalen, die unabhängig voneinander in ähnlichen oder verwandten Organismen erscheinen (»similar characters arising independently in similar or related animals or organs, causing a similar evolution, and resulting in parallelisms«) und Konvergenz als Ergebnis von ähnlichen Anpassungen unähnlicher oder nicht miteinander verwandter Organismen (»similar adaptations arising independently in dissimlar or unrelated animals or organs, causing a secondary similarity or approximation of type, resulting in convergence«).84 Die Begriffe werden in der Folgezeit allerdings nicht immer in diesem Sinne verwendet: So kann für O. Abel ein Parallelismus auch zwischen »verschiedenen, nicht näher verwandten Arten« vorliegen85; und nach E. Dacqué kann umgekehrt eine Konvergenz auch bei nahe verwandten Arten vorkommen86. Die ältere Differenzierung bleibt aber doch immer noch präsent und wird auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht. So bestimmt O. Schindewolf 1940 Konvergenzen als »Formähnlichkeiten [...], die auf verschiedener Organisationsgrundlage erwachsen«87 oder genauer als »gestaltliche Annäherungen zwischen den Angehörigen verschiedener Stämme«88. ›Konvergenz‹ ist für Schindewolf ein wesentlich phylogenetischer Begriff, der sich nicht allein auf äußere Ähnlichkeit, sondern auf eine bestimmte Form der Geschichte bezieht: »›gegeneinander geneigte‹ Entwicklungsrichtungen aus verschiedenen Tier- und Pflanzenstämmen«.89 Parallelismus wird demgegenüber bestimmt als Ähnlichkeit, die zwischen genetisch enger verwandten Organismen besteht. Sie ähnelt also stärker der Homologie (im Sinne der Homogenie); unterschieden wird sie von dieser, insofern der »morphologische Ausdruck« der Ähnlichkeit erst nach der Trennung der Stammeslinien erscheint: »parallelism would be similarity in structure due to common genetic basis (and so far resembling homology) but not reaching morphological expression until after the separation of the two or Georg Toepfer Historisches Wörterbuch der Biologie Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe Band 2: Gefühl – Organismus Verlag J. B. Metzler Stuttgart · Weimar Gefühl 1 Gefühl Das seit dem 17. Jahrhundert gebräuchliche Substantiv ›Gefühl‹ ist abgeleitet von dem Verb ›fühlen‹ (mhd. ›vüelen‹, ahd. ›fuolen‹), das zunächst allein »tasten« bedeutet und seit dem 18. Jahrhundert auch auf seelische Empfindungen übertragen wird. Emotion Das im Englischen und den romanischen Sprachen verbreitete Wort ›emotion‹ wird als Entlehnung aus dem Französischen seit dem frühen 17. Jahrhundert auch im Deutschen verwendet. Es ist abgeleitet von dem lateinischen Verb ›emovere‹ »herausbewegen, emporwühlen«, das wiederum von ›movere‹ »bewegen« abstammt. Erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts etabliert sich die psychologische Bedeutung als semantischer Kern des Begriffs (Miller 1808: »emotion, and passions of the mind«1). Einflussreich für die Verbreitung ist die systematische Verwendung des Begriffs an Stelle von ›passion‹ und ›affection‹ in den 1820 gedruckten Vorlesungen T. Browns. Darin definiert Brown Emotionen als lebhafte Gefühle, die sich aus der Vorstellung gegenwärtiger oder erinnerter Gegenstände ergeben (»vivid feelings, arising immediately from the consideration of objects, perceived, or remembered, or imagined, or from other prior emotions«).2 Er bestimmt die Emotionen als dritte mentale Kategorie neben den intellektuellen Zuständen und den sich aus sinnlicher Wahrnehmung äußerer Objekte unmittelbar ergebenden Empfindungen (»[Emotions] form truly a separate order of the internal affections of the mind, – as distinct from the intellectual phenomena, as the class, to which they both belong, is distinguishable from the class of external affections, that arise immediately from the presence of objects without«).3 Der Ausdruck bezieht sich also auf Bewegungen des Gemüts; er wird meist für den äußerlich wahrnehmbaren Aspekt im Gegensatz zu dem Gefühl als subjektiver Empfindungsqualität verwendet. Den Status eines Terminus der Psychologie erlangt ›Emotion‹ erst am Ende des 19. Jahrhunderts, u.a. unter dem Einfluss von W. James Aufsatz ›What is an emotion?‹ (1884).4 Antike: Lust und Unlust Ein allgemeiner Terminus für den Begriff des Gefühls ist in der Antike nicht vorhanden. Der Ausdruck Ein Gefühl ist ein individuelles (subjektives) Erleben von bestimmter Qualität, dem ein körperlicher (neuronaler) Zustand entspricht und das eine Disposition für ein bestimmtes Verhalten einschließt. Gefühl (17. Jh.) 1 Selbstgefühl (Basedow 1764) 10 Stimmung (Lorenz 1931) 9 Stimmungsübertragung (Lorenz 1935) 10 limbisches System (MacLean 1952) 10 für »Leidenschaft« (griech. ›παθος‹; lat. ›passio‹) entspricht am meisten dem neuzeitlichen Begriff des Gefühls. Betont wird mit diesem Wort der Unterschied zwischen dem aktiven Tun und dem passiven Erleiden einer Sache. Einer verbreiteten antiken Anschauung gemäß sind die Gefühle eine Art Macht, in deren Einflussbereich ein Lebewesen geraten kann oder zu der es hinzutritt. H. Schmitz beschreibt 1989 die Gefühle in diesem Sinne als »teils weite, aber richtungslose« oder »teils gerichtete, aber gegenstandslose […] Atmosphären, die den Menschen leiblich ergreifen, ihn passivieren, ev. besessen machen«.5 Nach Platon ist die Leidenschaft mit Lust oder Schmerz verbunden.6 Er bringt diese beiden Aspekte mit dem Verlassen eines natürlichen Zustandes (Schmerz) bzw. der Wiederherstellung dieses Zustandes (Lust) in Zusammenhang7 und illustriert dies durch die Gefühle bei der Abwesenheit bzw. Erfüllung der körperlichen Grundbedürfnisse nach Nahrung (Hunger), Flüssigkeit (Durst) und Wärme (Frieren). Neben den auf einen gegenwärtigen Empfindungszustand bezogenen Gefühlen der Lust und des Schmerzes stellt Platon die auf einen zukünftigen Zustand bezogenen Gefühle der »Furcht« und »Zuversicht« (zusammen die »Erwartung«)8, so dass sich insgesamt ein Viererschema der emotionalen Grundeinstellungen ergibt, das insbesondere von der Stoa aufgegriffen wird (der »Tetrachord« der »vier Hauptaffekte«)9 (vgl. Tab. 100). Platon formuliert auch bereits das Programm einer näheren Bestimmung und Klassifikation der Gefühle.10 Er führt dieses Programm aber selbst nicht aus, wohl u.a. deshalb nicht, weil er den Gefühlen einen nur untergeordneten Status zuschreibt: Selbst die Lust sei nicht »das Gute«11, und die Gefühle würden den Menschen insgesamt in eine der Vernunft entgegengesetzte Richtung ziehen12. Es stimmt mit dieser Einordnung der Gefühle zusammen, dass Platon sie nicht als geistige Prozesse versteht, sondern sie aus physiologischen Prozessen erklärt: Im ›Timaios‹ deutet er sie als Bewegungen der Säfte im Körper.13 Eine ausführliche Thematisierung erfahren die Gefühle des Menschen auch bei Aristoteles. Er führt sie ein, nicht indem er eine allgemeine Definition liefert, sondern indem er Listen derjenigen Empfindungen gibt, die mit Lust und Schmerz verbunden Gefühl 2 der Begierde, 25 Arten des Schmerzes und fünf Arten der Lust).18 Nach verbreiteter antiker Auffassung bildet die Pogegenwärtig zukünftig larität von zwei Prinzipien, die Liebe und Hass oder Lust Begierde Lust und Unlust genannt werden, den Grund für die evaluative positiv Dimension negativ Bewegung der Dinge und Lebewesen (so schon EmSchmerz Furcht pedokles19). Die Gefühle erscheinen also als motivierende Gründe des Handelns. Auch als Maßstab für Tab. 100. Kreuzklassifikation der obersten Gattungen von das Zuträgliche und Schädliche werden sie verstanEmotionen nach ihrem evaluativen und temporalen Aspekt. den.20 Die Gefühle gelten dabei häufig als etwas den Das Grundmuster dieser Einteilung geht auf Platon zurück (Nomoi 644c-d); aufgegriffen wird es als »Tetrachord« Tieren und Menschen Gemeinsames: In seinen ele(Ariston) der »vier Hauptaffekte« besonders in der Stoa. mentaren Gefühlen des Genusses bei der Ausführung der lebensdienlichen Funktionen des Essens, Trinsind (vgl. Tab. 101).14 Die leidenschaftlichen Gefühkens, Schlafens und Sich-Fortpflanzens unterscheide le des Menschen gehören nach Aristoteles zwar dem sich der Mensch nicht von den Tieren, heißt es bei nicht vernünftigen Teil der Seele an, sie sind aber Xenophon.21 Platon bestimmt die Lust als die Kompensation eines Mangelzustandes des Körpers; so sei trotzdem der Vernunft zugänglich und können durch der Hunger Anzeichen für die Leere des Magens und diese verändert werden15 – eine in der Antike verdas Aufnehmen der Nahrung sei mit Lust verbunden, breitete Auffassung, die u.a. auch Epikur teilt16. Im weil dadurch der Körper wieder in seinen natürlistoischen Denken wird diese Position durch die enge chen, ausgeglichenen Zustand versetzt werde.22 Nach Verbindung von Emotionen mit Urteilen und besonAristoteles steht das Gefühl der Lust in Verbindung ders mit dem Ideal des stoischen Weisen, der über mit dem Nützlichen und wird von einem Lebewesen keine Leidenschaft verfügt (»ἀπαθής«), ins Extrem angestrebt; die Unlust sei dagegen mit dem Schädligetrieben.17 Ungeachtet der geringen Wertschätzung, chen verbunden und werde gemieden.23 Nicht nur der die den Emotionen im stoischen Denken zuteilwerMensch fühlt die Lust und Unlust; sie ist nach Arisden, finden sich in der Stoa die differenziertesten toteles vielmehr allen Sinnenwesen gemeinsam.24 An Systematisierungen von Gefühlen. So unterscheidet verschiedenen Stellen spricht Aristoteles ausdrückChrysipp 79 Emotionen und klassifiziert diese in lich von der Furcht bei Tieren.25 Es liege in der NaGattungen, Arten und Unterarten (darunter 27 Arten tur jedes Lebewesens, seine natürliche Lust zu suchen.26 Eine Interpretation der GefühEthica Nicom. Ethica Eudem. De anima Rhetorik le im Sinne ihrer Lebensdienlichkeit ist für Begierde Begierde die Antike insgesamt kennzeichnend. Schon Zorn Zorn Zorn Zorn Xenophon ist der Meinung, die auf SelbsterFurcht Furcht Furcht Furcht haltung gerichteten Lebensfunktionen (wie Zuversicht Zuversicht z.B. Ernährung und Schlaf) seien mit einem Neid Neid Freude Freude Gefühl der Lust verbunden, damit die LebeFreundlichkeit Freundlichkeit Freundlichkeit wesen ihre Selbsterhaltung anstreben.27 Hass Hass Hass Auf die späeren Kognitionstheorien der Sehnsucht Gefühle weisen die antiken Erörterungen Ehrgeiz Ehrgeiz von Gefühlen (besonders bei Aristoteles) Mitleid Mitleid Mitleid voraus, insofern den Gefühlen neben einer Scham Scham Empfindungskomponente immer auch ein Sanftmut Sanftmut Dankbarkeit Urteil über Tatsachen oder Werte zugeschrie Entrüstung ben wird (s.u.). zeitliche Dimension Tab. 101. Vier Aufzählungen von Emotionen bei Aristoteles (Reihenfolge teilweise verändert). Auffallend ist das Fehlen der Gefühle von Ekel, Trauer und Überraschung in diesen Listen (aus Ethica Nicomachea 1105b21-23; Ethica Eudemica 1220b12-14; De anima 403a1618; Rhetorik II, 2-11; Übersetzung der Termini nach Krajczynski, J. & Rapp, C. (2009). Emotionen in der antiken Philosophie. Definitionen und Kataloge. In: Harbsmeier, M. & Möckel, S. (Hg.). Pathos, Affekt, Emotion. Transformationen der Antike, 47-78: 64f.). Stoa und Mittelalter: Selbsterhaltung Im Anschluss an die älteren Vorstellungen werden in der Stoa die Gefühle von Lust und Schmerz als allgemeine Mittel zur Selbsterhaltung der Lebewesen interpretiert.28 Seneca deutet die Gefühle von Genuss und Schmerz als Ausdruck einer universalen Sorge für mich 3 (»cura mei«), die als ein erster Trieb allen Lebewesen angeboren sei.29 Weil die Affekte nach stoischer Lehre unmittelbar in einen funktionalen und evaluativen Kontext eingebunden sind, ähneln sie den Urteilen in Erkenntnisprozessen. Über Gefühle erfolgt eine evaluative Kategorisierung von Wahrnehmungsinhalten. In der stoischen Theorie der Gefühle kann daher einer der philosophiehistorischen Ursprünge der wirkmächtigen kognitiven Theorie der Affekte gesehen werden.30 Unter dem Einfluss der stoischen Lehre der Selbsterhaltung stehen auch die frühen christlichen und mittelalterlichen Deutungen der Gefühle. Augustinus sieht selbst im Schmerz eine wunderbare Kraft der Seele, die den Körper erhält und die Tiere vor unüberlegtem Handeln bewahrt.31 Nach Avicenna ist mit der sinnlichen Wahrnehmung auch bei Tieren häufig noch ein verborgenes Vermögen (»vires occultae«) verbunden, das ein komplexes Wissen von einem Gegenstand vermittelt. Avicenna führt für dieses mit einer Wahrnehmung verknüpfte häufig evaluative Moment den Begriff der intentio ein und erläutert es in einem viel diskutierten Beispiel: »Das Schaf erfasst zum Beispiel eine intentio, die es vom Wolf hat, nämlich, dass es ihn fürchten und vor ihm fliehen muss, obwohl dies keinesfalls von den Sinnesvermögen erfasst wird«.32 Über die intentio werden also auch nicht unmittelbar anwesende, aber für die biologischen Bedürfnisse eines Tieres hoch relevante evaluative Aspekte eines wahrgenommenen Gegenstandes vermittelt, z.B. das Bedrohungspotenzial im bloßen Bild eines Wolfs. Albertus Magnus differenziert in diesem Zusammenhang später explizit zwischen dem unmittelbaren Wahrnehmungsaspekt (»forma«) von Gegenständen und dem mit ihnen verbundenem Sinngehalt (»intentio«).33 Auch wenn Affekte bei Tieren eine evaluative Kategorisierung von Wahrnehmungsinhalten vornehmen (und sie sich dabei irren können), sind sie damit aber noch nicht als Urteile im strengen Sinne zu verstehen. Denn es fehlt die Fähigkeit zum begrifflichen Abwägen der Inhalte und der darüber erfolgenden Distanzierung von der unmittelbaren Wahrnehmung.34 Nach Albert können sich Tiere also in affektiven Zuständen befinden, ohne über Begriffe und Urteile zu verfügen. Die Furcht eines Schafs bei der Wahrnehmung eines Wolfs würde ihm z.B. nur als unmittelbares Erleben, nicht aber als Urteil zur Verfügung stehen. Gefühle stellen in dieser Hinsicht also unterbewusste und vorbegriffliche situationsbewertende und unmittelbar verhaltensauslösende Einstellungen dar. Analog zu den im funktionalen Kontext des Schutzes stehenden Furchtreaktionen von Tieren erklärt Albert die mit der Gefühl Abb. 174. Stimmungsausdruck eines Schimpansen (aus Kohts, N. (1935). [Infant ape and human child]. Trudy muzeja; Gosudarstvennyj Darvinovskij Muzej (=Scientific Memoirs of the Museum Darwinianum in Moscow; russ.) 3, 1: Taf. IX, Fig. 2). Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung verbundenen Bewegungen der Tiere mittels eines Lustgefühls. Weil sie die obersten biologischen Funktionen der Selbstund Arterhaltung betreffen, sind die mit Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung verbundenen Verhaltensweisen nach Albert mit dem größten Lustgefühl verbunden (»natura ordinavit nutrimentum propter salvationem individui et opus venereum [coitus sive generatio] propter salvationem speciei. Et ideo istis operationibus natura adiuncit maximas delectationes, et quanto magis intendit salvationem speciei quam individui, tanto maiorem delectationem ordinavit in opere venereo quam in opera nutritivae«).35 Im Mittelalter entfaltet sich eine breit geführte Debatte über Gründe und kognitive Dimensionen der Gefühle, bei der der Vergleich zwischen Mensch und Tier immer wieder als Prüfstein der Theorien herangezogen wird.36 Die mittelalterliche Diskussion der Gefühle steht also nicht allein im christlichen Kontext einer Selbstdisziplin und Affektkontrolle, sondern bemüht sich auch um naturalistische Gefühlstheorien. Auffallend ist dabei, dass der im 20. Jahrhundert am meisten diskutierte Aspekt der Gefühle, ihr qualitativer Empfindungsaspekt, also das spezifische, nur in der Ersten-Person-Perspektive erlebbare Sich-Anfühlen einer Emotion, kaum eine Rolle spielt.37 Frühe Neuzeit: Tierautomaten Auch in der Neuzeit wird die Lehre von den Gefühlen der Lust und Unlust vielfach mit dem Streben nach Selbsterhaltung in Verbindung gebracht: N. Malebranche formuliert es 1672 so, dass auch die Sinne des Menschen (»nos sens«) allein für die Erhaltung Gefühl 4 Abb. 175. Gesichtsausdruck eines jungen Schimpansen in verschiedenen Gefühlszuständen. Gleiche Falten im Gesicht sind durch gleiche Zahlen markiert. Die gleiche Falte kann also in unterschiedlichen Kontexten eine andere Bedeutung haben; entscheidend für den Signalwert des Gesichtsausdruck ist die Konstellation der Falten zueinander, also der Gesamteindruck. linke Spalten: 1 Aufmerksamkeit, 2 Erregung, 3 Grinsen, 4 Lachen, 5 Weinen, 6 Furcht; rechte Spalten: 1 Schrecken, 2 Zorn, 4 Aufregung, 3 Ekel, 5 Erstaunen, 6 Lächeln (aus Kohts, N. (1935). [Infant ape and human child]. Trudy muzeja; Gosudarstvennyj Darvinovskij Muzej (=Scientific Memoirs of the Museum Darwinianum in Moscow; russ.) 3, 1: Taf. VII-VIII). des Körpers gegeben seien (»donnez seulement pour la conservation de nôtre corps«).38 Selbst das Gefühl des Schmerzes sei vorteilhaft, weil es zum Schutz beitrage. Trotz dieser biologischen Interpretation der Gefühle spricht Malebranche den Tieren zumindest gelegentlich Gefühle wie Schmerz und Lust ab und sieht sie als reine Maschinen (»Ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur […] ils evitent machinalement & sans crainte, tout ce qui est capable de les détruire«).39 Er steht damit in der Tradition einiger Cartesianer, die den Tieren jedes Gefühl aberkennen und ihre Schmerzensschreie mit den Lauten von schlecht geölten Maschinen vergleichen – ein Vergleich, der auf das Vorwort zur posthumen Ausgabe von Descartes’ Schrift über den Menschen aus dem Jahr 1664 zurückgeht und in den 1670er Jahren von J. Rohault und I.G. Pardies aufgegriffen wird.40 Descartes selbst vergleicht die Tiere zwar wiederholt mit Maschinen, er spricht ihnen aber sehr wohl eine Sinnlichkeit (»sensus«) zu; allein der Verstand und die Sprache fehlen ihnen seiner Meinung nach (↑Bewusstsein; Intelligenz; Kommunikation).41 Neben den unmittelbar mit den Lebensfunktionen zusammenhängenden Gefühlen (z.B. Hunger, Durst und Furcht) schreibt er den Tieren zumindest in einer Passage auch abgeleitete Gefühle wie Angst (»crainte«), Hoffnung (»esperance«) und Freude (»ioye«) zu.42 An anderer Stelle reserviert Descartes aber selbst die elementaren Gefühle für den Menschen. So schreibt er in einem Brief an Mersenne von 1640, der Schmerz sei allein im Verstand gegeben (»la douleur n’est que dans l’entendement«) und die Tiere hätten daher Gefühl 5 keinen Schmerz im eigentlichen Sinne (»la douleur proprement dite«).43 Beim Menschen gehen die Empfindungen von Hunger, Durst und Schmerz nach Descartes aus einer Vermischung des Geistes mit dem Abb. 176. Sechs »Grundemotionen« des Menschen, die einem bestimmten GesichtsausKörper hervor; sie gelten druck entsprechen. Diese Grundemotionen gelten als universell und treten selbst bei taubihm als undeutliche Formen blinden Menschen auf. Von links nach rechts: Wut, Ekel, Angst, Trauer, Freude, Überrades Denkens und repräsen- schung (nach P. Ekman; aus Grammer, K. (1993/95). Signale der Liebe: 117). tieren quasi die animalische ihres Lebens. Die Pflanzengefühle werden hier als Seite der res extensa in der menschlichen Natur.44 Auch J. Locke deutet die Gefühle funktional und benützliche Anpassungen interpretiert, die adäquate Reaktionen in verschiedenen Situationen sichersteltrachtet es als Aufgabe des Schmerzes, den Körper vor den Gefahren eines Gegenstandes zu warnen und len. Populärer wird die Lehre vom Gefühl der Pflanihn zum Zurückziehen zu veranlassen.45 zen nach Bekanntwerden der Bewegungen der Blätter der »Sinnpflanze« (Mimosa pudica). J.A. Unzer schreibt den Pflanzen daraufhin 1766 nicht nur eine Gefühle bei Pflanzen? Die klassische Position verbindet den Begriff des GeEmpfindung zu, sondern auch »Geschmack und Gefühl«.47 Die Pflanzen stünden insgesamt den Tieren fühls mit Lebenserscheinungen des Menschen und allenfalls mit denen von Tieren. Gefühle stehen in sehr nahe. enger Bindung zur Sinnlichkeit und Wahrnehmungsfähigkeit, und weil diese den Pflanzen und niederen Gefühle als Ausdrucksbewegungen Tieren abgesprochen wurde, galten sie auch als frei Den mit Gefühlen bei Tieren und Menschen verbunvon Gefühlen. Gegen diese rein mechanistische Thedenen Ausdrucksbewegungen widmet C. Darwin orie des Pflanzenlebens wendet der Mediziner M. 1872 eine eigene Schrift.48 Er weist dabei auf den Alberti, ein Schüler von G.E. Stahl, 1721 ein, »daß stereotypen Charakter des Ausdrucks bei Organisdie Pflanzen ein Gefühl haben«.46 Die Gefühle der men der gleichen Art hin und hält die Emotionen Pflanzen erschließen sich nach Alberti nicht ausgefür angeboren. Darwin interpretiert die Ausdruckshend von den menschlichen Gefühlen, sondern ergebewegungen in dreifacher Hinsicht funktional: ben sich vielmehr aus der Ordnung und Ökonomie im Sinne der individuellen Regulierung von Erre- Descartes (1649) Leidenschaften der Seele McDougall (1908) Beziehung zu Instinkten Ekman, Friesen & Ellsworth (1972) Gesichtsausdruck beim Menschen Plutchik (1980) adaptive Komplexe Furcht (Flucht) Furcht Furcht Hass Ekel (Abwehr) Ekel Ekel Verwunderung Staunen (Neugier) Überraschung Überraschung Ärger (Kampf) Ärger Ärger Begehren Antizipation Freude Freude Freude Liebe Vertrauen Traurigkeit Trauer Trauer positives Selbstgefühl (Selbstbehauptung) negatives Selbstgefühl (Selbsterniedrigung) Fürsorglichkeit (Pflege) Tab. 102. Klassifikationen von Gefühlen (Reihenfolge teilweise verändert). Tomkins (1984) neuronale Stimulierung Furcht Ekel Überraschung Ärger Interesse Freude Belastung Scham Verachtung Gefühl Abb. 177. Die Demutshaltung eines Hundes (»humble and affectionate frame of mind«) (aus Darwin, C. (1872). The Expression of the Emotions in Man and Animals: 53). gung, als soziale Signale, die im Rahmen der Kommunikation eine Funktion spielen, indem sie auf den Motivationszustand eines Tieres hinweisen und als Form der symbolischen Darstellung. James-Lange: Gefühle als Handlungsfolge Eine einflussreiche Theorie zur Entstehung der Gefühle entwickeln W. James und C. Lange in den 1880er Jahren unabhängig voneinander. Danach verursachen Gefühle nicht Handlungen, sondern sind umgekehrt die Wirkung bestimmter Handlungen. Erst durch die Unterschiede der körperlichen Reaktionen werden die Gefühle in ihrer spezifischen Qualität bestimmt. So weinen wir in dem berühmten Beispiel von James nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind trau- Abb. 178. Ausdrucksformen des Hundegesichts im Konflikt zwischen Angriff und Flucht. Überlagerung von »Kampfintention« und »Fluchtintention«: Zunahme der Aggression nach rechts und der Furcht nach unten (aus Lorenz, K. (1952). Die Entwicklung der vergleichenden Verhaltensforschung in den letzten 12 Jahren. Verh. Deutsch. Zool. Ges. 36-58: 50) 6 rig, weil wir weinen (»we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, and not that we cry, strike, or tremble, because we are sorry, angry, or fearful«49). Kritisiert wird diese Auffassung in den 1920er Jahren vor physiologischem Hintergrund von W.B. Cannon: Weil körperliche Reaktionen durch das autonome Nervensystem vermittelt werden und dieses sehr unterschiedliche Reaktionen auf ähnliche Weise hervorruft und weil außerdem die Vermittlung über diesen Teil des Nervensystems zu langsam ist, erscheint eine Rückkopplung des autonomen Nervensystems auf die Erzeugung der Gefühle unwahrscheinlich. Cannon folgert daher, dass die Gefühle allein vom Gehirn erzeugt werden.50 Kognitive Bewertungstheorien Eine Verbindung zwischen den Hypothese der JamesLange-Theorie und den Ergebnissen Cannons schlagen S. Schachter und J. Singer in den 1960er Jahren vor: Sie argumentieren dafür, es seien Gedanken, die die Lücke zwischen der unspezifischen Rückmeldung aus dem autonomen Nervensystem und den spezifischen Gefühlen vermitteln würden. Für die kognitive Deutung der unspezifischen Erregung sei im Wesentlichen der Kontext der Situation entscheidend: Die zunächst unspezifische Erregung wird also erst in einem zweiten Schritt durch intellektuelle und bewertende Funktionen der Hirnrinde zu einem definierten Gefühl. Nach dieser kognitiven Theorie der Emotion kann ein und dieselbe körperliche Erregung je nach Bewertung mal als Freude, Ärger oder Scham erlebt werden.51 Eine empirische Stütze erfährt dieser Ansatz durch Experimente, in denen Versuchspersonen Adrenalin injiziert wird, und die resultierende Erregung im Anschluss daran kontextabhängig sehr unterschiedlich erlebt wird. Viele Versuche belegen jedoch auch, dass die Bewertung der Erregung oft unbewusst erfolgt, also ohne kognitive Prozesse: Bestimmte Gefühle stellen sich z.B. auch als Folge unterschwelliger, also nicht ins Bewusstsein dringender Wahrnehmung ein (Zajonc 1980: »Preferences need no inferences«).52 Die Tatsache, dass viele Menschen ihre Gefühle nicht als klar und begrifflich strukturiert erfahren, spricht für diese Hypothese einer unbewussten Verarbeitung von Gefühlen. Die Entwicklung der Theorien geht dahin, die enge Verbindung von emotionalen und kognitiven Komponenten herauszuarbeiten. Empirische Untersuchungen zeigen zwar eine enge Interaktion der verschiedenen Komponenten – so sind bereits viele Wahrnehmungen emotional gefärbt –, sie belegen aber auch eine getrennte Verarbeitung der Reprä- 7 sentation eines Objektes von seiner Bewertung (wie sich an spezifischen Läsionen zeigt, in denen die eine Funktion ohne die andere vorliegt). Gefühle nur bei Tieren, denen sie nützen Die Debatte, inwieweit auch den einfach gebauten Tieren Gefühle zugeschrieben werden müssen, entflammt zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter einer selektionstheoretisch begründeten Nützlichkeitsperspektive und im Rahmen der Diskussion von psychischen Fähigkeiten bei Tieren (↑Lernen; Intelligenz; Bewusstsein). Experimentelle Befunde zeigen, wie ungerührt Insekten und »Würmer« selbst nach schweren Verletzungen ihre normalen Lebensfunktionen fortsetzen: Bei Regenwürmern, die quer in zwei Hälften geteilt werden, läuft der vordere Teil, der das Gehirn enthält, normal weiter, allein der hintere, der kein zentralisiertes Nervensystem hat, krümmt sich, als ob er Schmerzen hätte.53 Ein ähnliches Verhalten wird bei marinen Würmern beobachtet.54 Und von Ameisen wird berichtet, dass sie die Aufnahme von Nahrung ruhig fortsetzen, auch nachdem ihnen Fühler und Abdomen abgeschnitten wurden.55 H.E. Ziegler schließt aus diesen Befunden 1904/20, »daß sich die Gefühle in der Tierreihe wahrscheinlich erst in Verbindung mit dem Assoziationsvermögen, dem Gedächtnis und der Intelligenz allmählich entwickelt haben«. Er gibt dafür folgende Erklärung: »Denn der Schmerz ist seinem biologischen Zweck nach ein Warnungssignal, welches auffordert, eine stattfindende Schädigung des Körpers aufzuheben oder in Zukunft zu vermeiden. Je mehr Verstand ein Tier hat, um so wichtiger wird diese Warnung sein, und um so nützlicher wird ihm diese Erfahrung werden. Aber bei niederen Tieren, deren Leben durch Reflexe und Instinkte in weitgehendem Maße determiniert ist, wäre diese Warnung zwecklos, da sie schon mechanisch auf gewisse schädliche Einwirkungen reagieren und nicht befähigt sind, Erfahrungen zu machen«.56 Das Argument lautet also: »Da demnach Lust- und Unlustgefühle bei den niederen Tieren keinen biologischen Sinn hätten, so bezweifle ich, daß solche bei ihnen vorhanden sind«.57 Die Gefühle, die nach Ziegler die Instinkte in biologischer Hinsicht »ergänzen«, werden erst dann von Bedeutung, wenn sie mit einer bestimmten Situation assoziiert und im Gedächtnis aufbewahrt werden können, so dass sie in zukünftigen Situationen eine funktionale Steuerung des Verhaltens übernehmen können. Systematik der Gefühle Seit der Antike werden unterschiedliche Typologisierungen und Klassifikationen der Gefühle vor- Gefühl geschlagen (vgl. Tab. 102). Weil die verschiedenen Einteilungskriterien aber zu unterschiedlichen Gliederungen kommen, wird bezweifelt, ob es überhaupt möglich ist, »Basisemotionen« zu identifizieren.58 Angesichts der Heterogenität der mit dem Begriff des Gefühls zusammengefassten Phänomene ist es auch umstritten, ob Gefühle überhaupt eine einheitliche natürliche Klasse (»natural kind«) darstellen.59 D. Perler diskutiert 2011 in historischer Perspektive fünf grundlegende Probleme des Gefühlsbegriffs, die mit der Systematik der Gefühle zusammenhängen: (1) das Einheitsproblem, d.h. die Frage, ob Gefühle eine klar umrissene natürliche Kategorie bilden; (2) das Strukturproblem, das die Frage nach dem Grund und Kriterium der Einheitlichkeit der emotionalen Phänomene betrifft; (3) das Zuschreibungsproblem, das sich besonders stellt, weil Gefühle sowohl körperliche als auch geistige Aspekte in sich vereinen; (4) das Kategorienproblem, das danach fragt, welcher Kategorie Gefühle angehören: Sind sie in ontologischer Hinsicht Zustände, Dispositionen oder Prozesse bzw. in mentaler Hinsicht Vorstellungen, Empfindungen oder Urteile?; und schließlich (5) das Zurechnungsproblem, das die Frage nach der Kontrollierbarkeit der Gefühle durch bewusste Entscheidungen betrifft.60 Einige der bekanntesten Einteilungen haben folgende Grundlage: R. Descartes unterscheidet 1649 sechs Grundaffekte auf der Grundlage der »Leiden- Abb. 179. Schematische Darstellung der Überlagerung von Angriffs- und Abwehrstimmung in der Mimik einer Katze; nach rechts zunehmende Angriffsstimmung, nach unten zunehmende Abwehrstimmung; ermittelt aus Foto- und Filmaufnahmen (aus Leyhausen, P. (1956). Verhaltensstudien an Katzen: 83). Gefühl 8 die Gefühlen und Affekten entsprechen«.68 Gefühle oder zumindest ihre Entsprechungen können damit auch weniger hoch organisierten Organismen zukommen. H. Hediger konstatiert 1967 allgemein eine ähnliche emotionale Grundausstattung bei Mensch und Tier und bezeichnet die Aussage, dass Tiere dem Menschen in affektiver Hinsicht näher stehen als in intellektueller in Erinnerung an den Psychologen D. Katz als Katzsches Gesetz.69 Fundamentalität für Lebendigkeit Im Rahmen einiger moderner Ansätze einer Philosophie des Lebens spielt das Konzept des Gefühls eine zentraAbb. 180. Funktionales Modell zur Erklärung von Verhalten als Ergebnis der le Rolle. So wehrt sich H. Jonas 1953 Interaktion von drei Subsystemen, einem Bedürfnissystem (»Need System«), dagegen, das Verhalten der Tiere im einem Bewertungssystem (»Belief-Value System«) und dem Verhaltensraum kybernetischen Modell auf die zwei (»Behavior Space«). In dem Bewertungssystem (auch »Erwartungs-Wert-Sy- Faktoren Wahrnehmung und Bewestem«), das zwischen Bedürfnissystem und Verhaltensraum vermittelt, werden gung zu reduzieren – der wesentliche die Gefühle verortet. Unabhängige Variable sind der Bedürfniszustand Hunger (»Deprivation«) und Umweltstimuli (»SSSS«). Die abhängige Variable des dritte Faktor sei das Gefühl: Dieses Modells ist das jeweils erfolgende Verhalten (aus Tolman, E.C. (1952). A co- sei der Ausdruck einer »fundamentalen Selbstbesorgtheit alles Lebens«; gnition motivation model. Psychol. Rev. 59, 389-400: 395). grundlegend für alles Leben sei das Verlangen, sich zu erhalten, das eigene Dasein fortschaften der Seele«.61 Der Psychologe W. McDouzusetzen. Weil die Lebewesen für ihre Erhaltung auf gall gibt 1908 sieben grundlegende Instinkte beim die Umwelt angewiesen sind, seien sie getrieben von Menschen an, die nach seiner Auffassung jeweils mit einem grundlegenden organischen ↑Bedürfnis; dieses einer charakteristischen Emotion einhergehen.62 Auf liege auch der Teleologie des Organischen zugrunde: ethologischer Grundlage bestimmt J.A. Gray 1982 »Die Pein des Hungers, die Leidenschaft der Jagd, drei primäre Emotionssysteme bei Säugetieren, die die Wut des Kampfes, der Schrecken der Flucht, der in unterschiedlichen Reizsituationen gezeigt werden Reiz der Liebe – diese und nicht die durch Rezepund mit einem Verhaltenstyp verbunden sind: Annätoren übermittelten Daten begaben Gegenstände mit herung, Verhaltenshemmung und Kampf-Flucht.63 dem Charakter von Zielen«.70 Gefühle werden hier Ausgehend von neurophysiologischen Untersuchungen am Gehirn von Ratten unterscheidet J. Panksepp als wirkungsvolle Motivatoren für Verhaltensweisen konzipiert, über die eine situationsangemessene Vervier elementare Reaktionsweisen: Panik, Wut, Erwartung und Furcht.64 Anhand der kulturübergreihaltensauslösung bewirkt wird. Jonas wendet sich allerdings auch dagegen, die Gefühle rein funktionafend konstanten Mimik des Menschen unterscheidet listisch zu deuten und sieht mit ihnen die Möglichkeit P. Ekman sechs elementare Emotionen.65 R. Plutchik gibt eine Einteilung der Gefühle auf der Grundlage einer Distanzierung von der biologischen Funktionader Beziehung emotionaler Zustände zu adaptiven lität gegeben. Den Raum für Gefühle verortet Jonas in der nicht unmittelbaren, sondern (räumlich) über biologischen Prozessen.66 Auf neuronaler Basis beSinnesorgane und (zeitlich) über Triebstrukturen verruht schließlich die Einteilung von S.S. Tomkins (1984).67 mittelten Lebensweise der Tiere. Ihr Charakter als Vermittelndes bringt für die Gefühle die Möglichkeit Vergleichende Verhaltensforschung der Gefühle der Verselbständigung mit sich, die Verselbständigung eines ursprünglichen biologischen Mittels der Im Anschluss an W. McDougall ist K. Lorenz 1935 der Auffassung, »daß bestimmten instinktiven VerSelbsterhaltung zu eigenen Zwecken: »Es ist eines der Paradoxe des Lebens, daß es Mittel benutzt, die haltensweisen bestimmte Affekte als subjektive Korrelate zugeordnet« seien, d.h. »daß die Instinkthandden Zweck modifizieren und selbst Teil desselben lungen mit subjektiven Erscheinungen einhergehen, werden. Das fühlende Tier strebt danach, sich als 9 Gefühl Abb. 181. Einfaches Modell für die komplexe, probabilistische Sequenz von Ereignissen, die von einem externen Stimulus über die Ausbildung eines Gefühls bis zu dessen Verhaltenskonsequenzen führt. Am Anfang der Sequenz steht ein typisches Ereignis in der Umwelt (»Stimulus Event«); dieses wird in einer ersten verarbeitenden Kognition kategorisiert (»Inferred Cognition«); aus der kognitiven Verarbeitung stellt sich unmittelbar ein Gefühl ein (»Feeling«); dieses motiviert zu einem Verhalten (»Behavior«); das Verhalten kann schließlich einem adaptiven Komplex zugeordnet werden (»Effect«). Die für jede Kategorie von Ereignissen postulierte enge Kopplung von Stimulus, Kognition, Gefühl, Verhalten und Anpassungskomplex ermöglicht die Beschreibung des gleichen Phänomens in verschiedenen Sprachen: einer subjektiven Sprache der Gefühle, einer objektiven Sprache des äußeren Verhaltens und einer funktionalen Sprache der Verhaltenseffekte (aus Plutchik, R. (1980). Emotion. A Psychoevolutionary Synthesis: 289; vgl. 154f.). fühlendes, nicht bloß metabolisierendes Wesen zu erhalten, d.h. es strebt danach, diese Aktivität des Fühlens als solche fortzusetzen: das wahrnehmende Tier strebt danach, sich als wahrnehmendes Wesen zu erhalten – und so fort«.71 Die traditionelle Auffassung besteht allerdings darin, Fühlen und Wahrnehmen als wirklichen Selbstzweck erst beim Menschen anzunehmen. Beim Tier werden sie dagegen funktional eingebunden in die Belange des organischen Lebens: »Die thierischen Instincte dienen nur zur Erhaltung der Arten, nicht zur Veredelung derselben« (von Baer 1860).72 Bereits für M. Scheler bildet »der bewußtlose, empfindungs- und vorstellungslose Gefühlsdrang« die »unterste Stufe des Psychischen«, die bereits den Pflanzen zukomme und sich bei ihnen als ein Drang zu Wachstum und Fortpflanzung manifestiere.73 In dieser Sicht ist das Gefühl gleichursprünglich mit der Lebendigkeit: Die basalen Lebensfunktionen sind mit einem Gefühl verbunden. In ihrer biologischen Rolle kann das System der Gefühle als ein grundlegendes Motivationssystem (»primary motivational system«) für Verhalten gedeutet werden.74 Gefühle können eine schnelle Verhaltensbereitschaft in charakteristischen Situationen herstellen, etwa eine Fluchtbereitschaft in Situationen der Bedrohung oder eine Bereitschaft zur Integration von Gruppenmitgliedern angesichts von Kummer. Über das System der Gefühle kann sich ein Organismus komplexen Situationen flexibel anpassen. Die Gefühle fungieren dabei als zwischen Wahrnehmung und Verhalten geschaltete Bewertungsinstanz. In dieser evaluativen Funktion »entkoppeln« sie die unmittelbare Verbindung von Reiz und Reaktion (Scherer 1994: »Emotion serves to decouple stimu- lus and response«).75 Die starke Bindung von spezifischen Gefühlen an bestimmte Umweltsituation und funktionale Kontexte zeigt sich an der Möglichkeit, das Grundinventar der Gefühle in drei verschiedenen Sprachen auszudrücken: einer subjektiven Sprache des Erlebens, einer auf das äußere Verhalten bezogenen Sprache für Bewegungsmuster und einer funktionalen Sprache der biologischen Funktionskontexte (die drei letzten Spalten in Abb. 181). Gefühl und Stimmung Eine wichtigere systematische Rolle als das Konzept des Gefühls spielt in der Frühphase der Ethologie der Begriff der Stimmung. Das Wort ist abgeleitet von ›Stimme‹ und wird seit dem 16. Jahrhundert auf Musikinstrumente, seit dem 18. auch auf den Menschen im Sinne von »Gemütszustand« bezogen. Philosophisch bedeutsam wird der Begriff einerseits bei W. Dilthey, der 1883 alle Weltdeutungen auf eine »Grundstimmung« zurückführt76, und andererseits bei M. Heidegger, der darin eine Grundweise des Daseins sieht, die im Gegensatz zu den Gefühlen nicht auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet ist.77 G. Ryle stellt in seinen Sprachanalysen fest, dass Stimmungen nicht nur in der ersten Person, sondern auch in der dritten Person zugeschrieben werden können78 – so dass der Begriff für Verhaltensbeschreibungen bedeutsam wird. Auf basaler physiologischer Ebene erkennt schon G. Jaeger 1878 eine »Stimmungsfähigkeit« und »Stimmung des Protoplasmas«, insofern es, je nach Zelltyp, nur für bestimmte Sinnesarten reizbar ist.79 In einem ähnlichen Sinne wird das Konzept dann auch in der Ethologie verwendet. Nach K. Lorenz ordnet O. Heinroth bestimmten Erregungsarten eines Georg Toepfer Historisches Wörterbuch der Biologie Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe Band 3: Parasitismus – Zweckmäßigkeit Verlag J. B. Metzler Stuttgart · Weimar Parasitismus 1 Parasitismus Die Bezeichnung ›Parasitismus‹ erscheint in der Biologie im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts (Nitzsch 1818: »Schmarotzerleben […] der vollkommene Parasitismus […], namentlich bei Dipteren«1; Erman 1819: »Parasitismus von mikroskopischen Entozoen [im Blut von Mollusken]«2). In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist er besonders in der Botanik verbreitet.3 Antike Ursprünge Die Verwendung des Grundwortes ›Parasit‹ hat antike Ursprünge. Im antiken Griechenland wird es in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Als ›Parasit‹ (griech. ›παράσιτος‹ »Mitesser«; abgeleitet von ›σῖτος‹ »Getreide, Speise«) wird einerseits ein hoch geachteter Beamter mit einer bestimmten kultischen Funktion bezeichnet: der Auswahl der Speise für das Opfermahl. Später, in der klassischen griechischen Komödie, ist der Parasit der Typus eines völlig verarmten Menschen, der um eines Essens willen die Tischgesellschaft auch auf Kosten der eigenen Person zu unterhalten versucht.4 In der antiken Komödie beruht das Verhältnis von Parasit und Wirt also auf einer Gegenseitigkeit: Der Parasit nimmt nicht nur, sondern gibt im Gegenzug auch etwas und wird von seinem Wirt für diese Leistung auch bewusst ausgewählt. Für den biologischen Begriff ist allerdings kennzeichnend, dass der Parasitismus ein einseitiges Verhältnis beschreibt, bei dem der Vorteil der Interaktion nur auf der Seite des Parasiten liegt, der seinen Wirt gegen dessen Interessen sucht. Wortgeschichte in der Biologie Biologisch sind zuerst Pflanzen, so die Misteln und Moose, die auf Bäumen wachsen, als ›Parasiten‹ bezeichnet worden. In Form des Adjektivs parasitisch (»parasiticam«) erscheint der Ausdruck Ende des 16. Jahrhunderts bei dem Botaniker A. Zaluziansky à Zaluzian, der ihn (unter Verweis auf Scaliger) in einem Kapitel über die Verbindungen von Pflanzen verwendet. Der Ausdruck bezeichnet hier die Eigenschaft Der Parasitismus ist eine (regelmäßige) Interaktion zwischen Organismen (meist verschiedener Arten), aus der ein Interaktionspartner, der Parasit, einen Nutzen zieht, der andere aber einen Schaden davonträgt. Im Unterschied zu einem Räuber ist ein Parasit in der Regel an nur einen anderen Organismus, seinen Wirt, gebunden. Außerdem ist es charakteristisch für einen Parasiten, dass er seinen Wirt nicht unmittelbar tötet, sondern nur schädigt, z.B. durch Entzug von Körpersubstanz zur eigenen Ernährung. parasitisch (Zaluziansky à Zaluzian 1592) 1 Entozoon (Rudolphi 1808) 2 Parasitismus (Nitzsch 1818) 1 Ektoparasiten (Leuckart 1827) 3 Entoparasiten (Leuckart 1827) 3 hyperparasitisch (Haliday 1833) 8 Pseudoparasit (von Martius 1835; van Mons 1835) 3 Brutparasitismus (Schmarda 1866) 4 superparasitisch (Woodward 1877) 8 Hyperparasitismus (Newman 1878) 7 Raumparasitismus (Klebs 1881) 4 Superparasitismus (Fiske 1910) 7 Parasitoid (Reuter 1913) 8 einiger Pflanzen, in oder auf anderen zu leben, so wie die Mistel auf Bäumen (»alia in alia vivit, ut quercus & viscum«).5 Im Englischen erscheint der Ausdruck zuerst 1646 bei T. Browne. Er beschreibt die Mistel sowie einige Farne und Moose als ›parasitisch‹ (»Parasiticall«) und charakterisiert sie durch ihre Ernährung auf Kosten anderer Lebewesen (»living upon the stock of others«).6 Sein Landsmann, der Botaniker N. Grew, übernimmt später diese Kennzeichnung.7 In E. Chambers’ Wörterbuch aus dem Jahr 1728 erscheint statt des Adverbs das Substantiv (»parasites«), und die schmarotzenden Pflanzen werden in der ›Familie der parasitischen Pflanzen‹ (»family of parasite plants«) zusammengefasst.8 Wohl erst seit dem 18. Jahrhundert ist auch von Parasiten unter den Tieren die Rede, z.B. schmarotzenden Würmern oder Schlupfwespen. C. von Linné nennt den Bandwurm (der Gattung Taenia), der ihm aus dem Darm von Menschen und anderen Wirbeltieren bekannt ist, 1735 eine parasitische Art (»species parasitica«9); sein Schüler P.S. Pallas widmet den parasitischen Würmern 1760 eine eigene Abhandlung.10 Am Ende des 18. Jahrhunderts tritt auch das deutsche Wort Schmarotzer, dessen Etymologie weitgehend ungeklärt ist (15. Jh. ›smorotzer‹: »Bettler«), in die biologische Fachsprache ein. P.A. Nemnich identifiziert in seinem Wörterbuch von 1793-95 eine ganze Reihe von Schmarotzerarten, u.a. einen »Schmarotzerkrebs«, der seine empfindlichen Körperteile durch die Schalen anderer Tiere schützt (also der später so genannte ›Einsiedlerkrebs‹), und eine »Schmarotzermöwe« (Larus parasiticus, wie sie schon Linné nennt11), die anderen Tieren die Nahrung abjagt12 (also die heute so genannten ›Raubmöwen‹). Wissenschaftsgeschichte Die am längsten bekannten Parasiten sind die auf der Haut und in den Eingeweiden lebenden Parasiten des Menschen. Seit dem 3. Jahrtausend vor Christus werden diese Parasiten in den schriftlichen Zeug- Parasitismus Abb. 358. Misteln, die an einem Apfelbaum para­sitieren. Der Querschnitt unten zeigt, wie die Wurzeln der Mistel das Gewebe des Apfelbaumes durchdringen (aus Malpighi, M. (1679). Anatome plantarum, Bd. II: Tab. XXVI). nissen verschiedener Kulturen beschrieben, z.B. in dem altägyptischen Papyrus Ebers aus der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends.13 Hippokrates unterscheidet nach der Form drei verschiedene Arten parasitischer Würmer, lange und kurze runde (Ascaris) sowie breite (Taenia).14 Auch Aristoteles und später Galen beschreiben drei verschiedene Arten von »Eingeweidewürmern«15, Aristoteles daneben auch Läuse, Flöhe und Wanzen, von denen er eine spontane Entstehung in geeigneten Medien annimmt16. Die erste Beschreibung der Leberegel bei Schafen gibt 1347 Jean de Brie, ein französischer Schäfer.17 G. Gambuccini verfasst 1547 die erste Abhandlung über parasitische Würmer.18 Einen großen Aufschwung erlebt die Parasitologie durch den Einsatz der Mikroskopie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. »Als Parasiten bezeichnen wir, im weitern und eigentlichen Sinne des Wortes, alle diejenigen Geschöpfe, die bei einem lebendigen Organismus Nahrung und Wohnung finden« (Leuckart 1879, 3). »Le parasitisme peut être défini la condition de vie normale et nécessaire d’un organisme qui se nourrit aux dépens d’un autre – appelé l’hôte – sans le détruire, comme le fait le prédateur à lʼégard de sa proie« (Caullery 1922, 13). »[A]n animal, whose environment is formed by another living animal« (Philipchenko 1937). »[A] small organism living on or in, and at the expense of, a larger one« (Chandler & Read 1961, 16). Tab. 226. Definitionen des Parasitenbegriffs. 2 F. Redi liefert 1668 die erste Abbildung eines Leberegels.19 Auch A. van Leeuwenhoek beschäftigt sich in den 1670er Jahren mit ihnen: Er untersucht mittels seines Mikroskops die Erreger in der Lunge der Schafe und vermutet, dass sie mit dem aufgenommenen Wasser in ihren Wirt gekommen sind.20 Die Aufklärung des Lebenszyklus des Leberegels gelingt Leeuwenhoek jedoch nicht; er nimmt sich der Sache erst wieder an, nachdem G. Bidloo 1698 einen Brief an ihn richtet.21 1681 beschreibt Leeuwenhoek auch den ersten einzelligen Parasiten (Giardia lamblia). C.A. Rudolphi, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine umfassende Monografie über die Eingeweidewürmer schreibt und damit als »Vater der Helminthologie« gilt, stellt fest, dass diese obligatorisch im Innern anderer Organismen leben und nicht daneben auch noch ein freies Leben führen können. Rudolphi prägt auch den von der Lebensform ausgehenden Begriff Entozoa (»Innentiere«), d.h. im Inneren anderer Organismen lebende Tiere (↑Symbiose).22 Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Auffassung verbreitet, dass die in den Eingeweiden lebenden Würmer einen Teil des Wirtsorganismus darstellen und kein selbständiges Leben führen können. Erst 1851 kann F. Küchenmeister durch Fütterungsversuche nachweisen, dass die »Finnen« (im Fleisch lebende Larven) Entwicklungsstadien der Bandwürmer sind.23 Er ermittelt später Rind und Schwein als Zwischenwirte, entwickelt eine Vorstellung der Wirtsspezifität der Parasiten und deckt auch den Entwicklungszyklus des Leberegels auf, indem er die Larven in Schlammschnecken nachweist und zeigt, dass sie ihren Wirt aktiv aufsuchen.24 Zusammen mit den nur mikroskopisch sichtbaren Einzellern bilden die Parasiten die Gruppe von Organismen, von denen am längsten angenommen wurde, dass sie spontan entstehen. So vermutet noch Rudolphi, dass parasitische Würmer durch entzündliche Prozesse erkrankter Gewebe entstehen können und H. Burmeister glaubt noch 1837 an die spontane Entstehung der Eingeweidewürmer, Milben und Läuse.25 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden zahlreiche Parasiten als Krankheitserreger des Menschen beschrieben, u.a. 1876 der Erreger der Elephantiasis Wuchereria bancrofti durch J. Bancroft26 und 1881 der Erreger der Malaria (Plasmodium) durch C.L.A. Laveran27. Allgemeine Definitionen Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden explizite Definitionen für die Lebensform der Parasiten gegeben. C.T. von Siebold definiert (tierische) Parasiten 1844 3 als Organismen, »welche nicht ohne Vermittlung anderer Thiere existiren können, indem ihnen diese letzteren Wohnort und Nahrung zugleich bieten«.28 Siebold liefert daneben Einsichten in den Lebenskreislauf vieler Parasiten; ihm gelingt der Nachweis, dass dieser oft mit einem Wirtswechsel verbunden ist.29 In seiner Monografie über den Parasitismus von 1875 definiert P.J. van Beneden: »Ein Schmarotzer ist ein Thier, welches berufsmässig auf Kosten seines Nachbarn lebt, und dessen ganzes Streben darin besteht, denselben haushälterisch auszubeuten, ohne sein Leben in Gefahr zu bringen«.30 Van Beneden grenzt den Parasitismus von anderen Formen der biologischen Interaktion von Organismen ab: Im Gegensatz zum Verhältnis der Konkurrenz liege beim Parasitismus eine direkte und keine über gleichgerichtete Ressourcenausbeute vermittelte Schädigung vor. Der Schmarotzer ernährt sich nach van Beneden von dem »Eigenthum« seines Wirts, nicht aber von dessen Nahrung.31 Auf der anderen Seite ist das Parasiten-Wirt-Verhältnis auch von einem Räuber-BeuteVerhältnis zu unterscheiden. Nach van Beneden ist es das Kennzeichen eines Parasiten – im Gegensatz zu einem Räuber – den Organismus, den er ausnützt, d.h. seinen Wirt, nicht zu töten.32 Unterschieden von einem echten Parasiten sind nach van Beneden auch solche Organismen, die nur in bestimmten Lebensstadien (z.B. im Larvenstadium) regelmäßig an einem anderen Organismus parasitieren (z.B. Schlupfwespen). Van Beneden grenzt diese Kategorie von den Parasiten ab, ohne ihr aber einen Namen zu geben33; später werden sie Parasitoide genannt (s.u.). Mit den Bestimmungen, die van Beneden den Parasiten gibt, sind weitere Merkmale eines parasitischen Verhältnisses gegeben, u.a. die Kleinheit eines Parasiten relativ zu seinem Wirt und die damit zusammenhängende Schädigung von meist nur einem Organismus (im Gegensatz zu einem Räuber, der im Lauf seines Lebens zahlreiche andere Organismen schädigt). Van Beneden entwickelt seine Kategorien zur Beschreibung des Parasitismus noch weitgehend deskriptiv und analysiert sie nicht im Rahmen der Evolutionstheorie. Spätere Definitionen des Parasitismus zielen meist auf die Einseitigkeit der Ernährungsabhängigkeiten in den Beziehungen von Organismen verschiedener Arten; daneben existieren aber auch »ökologische« Definitionen, die sich auf das Bereitstellen eines ganzen Lebensraums durch den Wirt beziehen (vgl. Tab. 226).34 Bezweifelt wird aber auch, dass sich überhaupt eine scharfe Definition des Parasitismus geben lässt. Parasitismus Denn Parasiten unterscheiden sich voneinander in ihren physiologischen, ökologischen und phylogenetischen Verhältnissen in starkem Maße.35 Besonders die phylogenetische Vielfalt gilt einigen Biologen dabei als Grund für die Heterogenität des Phänomens; denn klare Grenzen gebe es in der Biologie nur ausgehend von phylogenetischen Grenzen (Brooks & McLennan 1993: »there is no such thing as an unambiguous definition of parasitism, because only common ancestry is unambiguous in biology, and parasites do Abb. 359. Bandwurm not represent a monophyletic (Taenia echinococgroup«36). cus), ein Darmparasit des Hundes (aus Be- neden, P.J. van (1875). Differenzierungen F.S. Leuckart führt 1827 zwei Les commensaux et grundlegende Unterscheidun- les parasites dans le règne animal (dt. gen ein: Er differenziert nach Die Schmarotzer des der taxonomischen Stellung Thierreichs, Leipzig des Parasiten zwischen »Phy- 1876): 228). toparasiten« (»Schmarotzerpflanzen«) und »Zooparasiten« (»Schmarozterthieren«) sowie nach dem Aufenthaltsort des Parasiten im oder auf dem Wirt zwischen Endoparasiten und Ektoparasiten (»Entoparasiten«: »Im Innern des Körpers lebend« und »Ektoparasiten«: »Auf dem Körper lebend«37). Leuckarts Schüler J.H. Schmidt unterscheidet bereits in seiner Dissertation aus dem Jahr 1825 zwischen Ento- und Ectophyta sowie Ento- und Ectozoa38 – und greift damit eine schon seit längerem bestehende Terminologie auf (↑Symbiose). Der Sache nach differenziert auch A.P. de Candolle 1832 zwischen diesen beiden Formen (»un parasitisme […] externe ou interne«).39 In den 1840er Jahren wird Leuckarts Terminologie von anderen Parasitenforschern wie C.M. Diesing und C.T. von Siebold aufgenommen.40 Ein Organismus, der in enger Assoziation mit einem Organismus einer anderen Art lebt und als Parasit erscheint, tatsächlich aber in keinem schädigenden Verhältnis zu seinem Wirt steht, wird seit den 1830er Jahren als Pseudoparasit bezeichnet. Das Wort wird anfangs insbesondere auf epiphytisch wachsende Pflanzen wie Lianen (von Martius 183541) und auf Symbionten bezogen (van Mons 1835: »Quel est le légume qui n’a pas sa plante pseudoparasite, une Parasitismus 4 Abb. 360. Stadien aus dem Lebenszyklus eines Leberegels: Das Ei entwickelt sich zu einer frei schwimmenden Larve (a1); diese entwickelt sich zu einer Sporozyste (a2), wenn sie in eine Schnecke gelangt; innerhalb der Sporozyste entstehen Redien (b); die wiederum Zerkarien (c1) hervorbringen und sich, nachdem sie von einem Schaf aufgenommen wurden, zu dem ausgewachsenen Leberegel (c2) entwickeln (aus Huxley, J. (1912). The Individual in the Animal Kingdom: 22). plante particulière qui, sans être établie sur ses racines, vit des excrétions de ses racines?«42). Der Botaniker A.B. Frank fasst 1877 unter dem Pseudoparasitismus alle Fälle zusammen, »wo das Auf- oder Ineinanderwachsen zweier Wesen durch den Zufall bedingt, für keins der Beiden nothwendig ist, indem keiner durch den andern ernährt wird, vielmehr nur eine mechanische Verbindung besteht, so dass auch lebloses Substrat den tragenden Organismus ersetzen kann«.43 Beim »Parasitismus« müssten die beteiligten Wesen dagegen »ganz und gar von einem anderen Organismus, dem Wirth, beziehentlich der Nährpflanze, ernährt werden, ohne dass sie diesem dafür eine Gegenleistung bieten«.44 Komplexe Lebenszyklen Der Entwicklungszyklus von Parasiten verläuft nicht selten über verschiedene Wirte und kann dabei sogar gezielte Manipulationen des Verhaltens der Wirte einschließen. Ein bekannter und imposanter Fall ist ein parasitischer Saugwurm (Leucochloridium), der eine Schnecke (Succinea) als Zwischenwirt nutzt und dabei sowohl das Aussehen als auch das Verhalten der Schnecke in einer Weise verändert, so dass sie leichter von einem Vogel gefressen wird, in dem der Parasit seinen Entwicklungszyklus fortsetzen kann.45 Die von dem Saugwurm verursachte Verhaltensänderung der Schnecke besteht darin, dass diese sich verstärkt im Sonnenlicht aufhält, um damit eher von Vögeln entdeckt zu werden. In einem anderen bekannten Beispiel beeinflusst ein Strudelwurm (Dicrocoelium) das Verhalten seines Zwischenwirts (Ameisen der Gattung Formica) in der Weise, dass dieser sich an der Spitze von Grashalmen verbeißt und dadurch leichter von dem nächsten Wirt, einem weidenden Säugetier, aufgenommen werden kann.46 Diskutiert werden diese Manipulationen des Verhaltens des Wirts durch den Parasiten auch vor dem Hintergrund des Konzepts des erweiterten Phänotyps (↑Genotyp). R. Dawkins beurteilt 1982 das veränderte Aussehen und Verhalten der Schnecke in dem obigen Beispiel als einen Teil des erweiterten Phänotyps des Parasitengenoms, weil es von dessen Genen bewirkt wird und deren Fitness erhöht. Ein Parasit ist für Dawkins also nicht nur häufig räumlich in den Wirt integriert, vielmehr können auch seine physiologischen Wirkungen integrale Bestandteile des Verhaltens des Wirts werden. Die Grenze zwischen Wirt und Parasit kann in solchen Fällen nicht mehr morphologisch oder ethologisch gezogen werden, sondern allein funktional: Verhaltensweisen des Wirts, die von dem Parasiten initiiert werden und dem Wirt schaden, sind damit funktional nicht eigentlich dem Wirt, sondern dem Parasiten zuzuordnen, eben als Teil seines »erweiterten Phänotyps«. In der Koevolution von Wirt und Parasit kann es zu einer engen physiologischen und ethologischen Durchdringung von Wirt und Parasit kommen, in der die Grenze zwischen Parasitismus und Symbiose nicht mehr scharf gezogen werden kann. Formen des Parasitismus Die am weitesten verbreitete Form des Parasitismus betrifft Ernährungsbeziehungen: Ein Organismus ernährt sich von der Körpersubstanz eines anderen (Nahrungsparasitismus). Zwei andere Formen des Parasitismus haben auch eine eigene terminologische Bezeichnung erhalten: der Raumparasitismus bei Pflanzen und Tieren sowie der Brutparasitismus bei Vögeln und anderen Tieren. Den Ausdruck Raumparasitismus führt G. Klebs 1881 ausgehend von Untersuchungen von endophytisch wachsenden Algen ein.47 Er wird seit den 1880er Jahren auch auf Tiere übertragen.48 Nach F. Dahl (1910) liegt ein Raumparasitismus vor, wenn bei zusammen vorkommenden Organismen einer den anderen »lediglich durch seine Gegenwart, nicht durch seine Ernährung« schädigt.49 Der Brutparasitismus ist in Form des Verhaltens des Kuckucks bereits in der Antike bekannt.50 Der Terminus erscheint seit Mitte des 19. Jahrhunderts (Schmarda 1866: »der Nest- und Brutparasitismus einiger Vögel«51; engl. Davis 1904: »brood parasitism«52). W.M. Wheeler überträgt das Konzept 1910 auch auf Ameisen.53 Insgesamt sind etwa 85 Vogelarten, d.h. rund 1% aller bekannten Vogelarten interspezifische Brutparasiten.54 Neben dem interspezifi- 5 Parasitismus schen Brutparasitismus ist auch der intraspezifische Brutparasitismus verbreitet, also das Legen von Eiern in ein fremdes Gelege eines Artgenossen. Der Definition des Parasitismus gemäß müssen auch viele Formen der heterotrophen Ernährung der Tiere als ›parasitisch‹ bezeichnet werden. Denn auch hier erfolgt oft eine Schädigung des Beuteorganismus, ohne dass dieser getötet wird, so z.B. in der Regel bei Tieren, die sich von Pflanzen ernähren. Begrifflich durchaus konsequent spricht H. Plessner in diesem Sinne 1928 von dem »konstitutiven Schmarotzertum der tierischen Welt«.55 Im Unterschied zum echten Schmarotzer ernähren sich viele herbivore Tiere allerdings nicht nur von einem anderen Organismus, sondern von vielen. Darüber hinaus sind aus einer thermodynamischen Perspektive alle Organismen als Parasiten beschrieben worden. Denn die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Ordnung einer dissipativen Struktur, die die Abb. 361. Entwicklungszyklus des Kleinen Leberegels (Dicrocoelium Organismen thermodynamisch betrachtet dendriticum). A Endwirte (in denen sich die Larven zum erwachsenen sind, kann nur lokal unter Energiezufuhr von Tier entwickeln): hauptsächlich Schaf und Rind, Mensch als Nebenwirt der Umwelt erfolgen. Der Energieaustausch (»Zufallswirt«); 1 Geschlechtsreifer Leberegel; 1a Ei mit ausgebildemit der Umwelt ist also eine Voraussetzung tem Miracidium (Wimpernlarve); 2 Geschlüpftes Miracidium; B Erster Zwischenwirt: Landschnecken; 3a-c Sporocysten, 3d Cercarie (Larve), für die Aufrechterhaltung einer dissipativen 3e-f Schalen der Zwischenwirte; C Zweiter Zwischenwirt: Ameise; 4a Struktur. E. Schrödinger formuliert es 1943 Von der Schnecke abgesetzte Schleimballen an einem Grashalm, 4b Einso, ein Organismus »ernähre« sich von »ne- zelner, von Schnecken abgesetzter Schleimballen, 5a Ameise verzehrt gativer Entropie«56; er bestehe mittels eines Schleimballen, 5b Reife Metacercarie aus Ameise (aus Piekarski, G. »Kunstgriffs«, dem »fortwährenden ›Auf- (1962/73). Medizinische Parasitologie in Tafeln: 98). saugen‹ von Ordnung aus seiner Umwelt«57. Im Anschluss daran werden Organismen mit Parasinieren diese als Nukleinsäuren, denen es gelingt, die Genprodukte anderer Nukleinsäuren auszubeuten: ten verglichen, »die sich von der Ordnungsstruktur der Welt ernähren, selber aber nur Unordnung ver»A parasite can be considered to be the device of a breiten« (Heuser-Keßler 1986).58 nucleic acid which allows it to exploit the gene products of other nucleic acids – the host organisms«60. Parasiten auf genetischer Ebene F. Dyson versteht darüber hinaus die Nukleinsäuren allgemein als die »Software« und die »Parasiten« Nicht nur Organismen mit einem eigenen Körper und Stoffwechsel, sondern auch Viren oder sich selbst-reder Aminosäuren, die die »Hardware« der Zellen darplizierende Elemente im Genom eines Organismus, stellen.61 Hinter diesem Verständnis steht die Vorsteldie für diesen Organismus nicht funktional sind, lung, dass das eigentliche ↑Leben der ↑Stoffwechsel können als Parasiten beschrieben werden (Orgel & ist, der an den Aminosäuren und Proteinen hängt, Crick 1980: »Selfish DNA: the ultimate parasite«59). nicht an der Reproduktionsfähigkeit. Parasiten in diesem Sinne sind also Teile eines Organismus, die die eigene Reproduktion auf Kosten der Häufige Lebensform Reproduktion des Gesamtorganismus befördern. Ihre Schätzungen gehen davon aus, dass die OrganisEntstehung kann erklärt werden durch eine Selektimen von weit mehr als der Hälfte aller existierenden on nicht auf Ebene des Organismus, sondern seiner Arten Parasiten sind.62 In der sehr gut untersuchten selbst-replizierenden Teile (der DNA-Sequenzen). S. Fauna der britischen Inseln sind Mitte der 1970er Nee und J. Maynard Smith sprechen 1990 in einem Jahre 20.244 Arten von Insekten bekannt; von dieweiten Sinne von molekularen Parasiten und defisen lassen sich 16.929 leicht einem Ernährungstyp Parasitismus 6 hige Nachkommen zeugen kann. Die eigene Infektion der Weibchen bildet also quasi ein Gegengift zur Neutralisation der Infektion des Paarungspartners. Diese Verhältnisse können als Ergebnis einer Evolutionsstrategie der Bakterien interpretiert werden.63 »Parasitogenetische Regeln« Zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Wirt und Parasit (Wirtsspezifität) werden in der Mtte des 20. Jahrhunderts so genannte »parasitogenetische Regeln« aufgestellt. Die drei bekanntesten Regeln lauten64: 1. »Bei stetigen Parasiten lässt sich aus der Verwandtschaft der Parasiten auf die Verwandtschaft der Wirte schließen« (»Fahrenholzsche Regel«); 2. »Bei stetigen Parasiten lässt sich aus der Organisationshöhe der Parasiten meist unmittelbar auf das relative Stammesalter der Wirte schließen« (d.h. »Primitive Wirte enthalten primitive Parasiten«, »Szidatsche Regel«); 3. »Wirtstiere, die einer artenreichen Gattung angehören, besitzen oft eine viel verschiedenartigere Parasitenfauna als Wirtsarten wenig artenreicher Gattungen« (»Eichlersche Entfaltungsregel«). Abb. 362. Vier Modelle parasitischer Lebenszyklen, mit einer Sequenz von einem, zwei, drei oder vier verschiedenen Wirtsarten. Offene Kreise: Eier, gefüllte Kreise Larven oder Adultstadien der Parasiten (aus Combes, C. (1995). Interactions durables. Écologie et évolution du parasitisme, engl.: Parasitism. The Ecology and Evolution of Intimate Interactions, Chicago 2001: 37). zuordnen, gut 72% davon dem Ernährungstyp des Parasitismus (vgl. Abb. 363). Die quantitativ häufigsten Parasiten auf der Erde sind wahrscheinlich Bakterien der Gattung Wolbachia. Diese leben in den Zellen vieler Insekten und werden über die weiblichen Eier von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Im Dienste der eigenen Reproduktion ist es den Bakterien bei einigen Wirtsarten gelungen, das Geschlechterverhältnis der Wirtsinsekten so zu verschieben, dass fast ausschließlich Weibchen gebildet werden (denn durch die Bildung von Männchen werden sie nicht weitergegeben). In einigen Fällen können diese dann parthenogenetisch Nachkommen erzeugen; in anderen Fällen gelingt es den Bakterien sogar, durch Veränderung des Hormonhaushalts ein Männchen in ein Weibchen umzubilden. Bei einem hohen Durchseuchungsgrad in der Population kann es für ein Insektenweibchen von Vorteil sein, selbst infiziert zu sein, weil sie nach der Paarung mit einem infizierten Männchen nur bei vorliegender eigener Infektion überlebensfä- Evolution des Parasitismus Eine evolutionstheoretische Deutung erfährt der Parasitismus bereits bei Darwin, indem er das Verhältnis dynamisch als einen Kampf zwischen Parasit und Wirt versteht (»a sort of struggle between the parasite and its prey«65). Später ist es verbreitet, hier von einem »Wettrüsten« zu sprechen und den Parasitismus als einen wesentlichen Motor der Evolution zu sehen. Die wechselseitige Bezogenheit von Wirt und Parasit aufeinander bedingt es, dass jede Veränderung eines Organismus eine Veränderung der Selektionsbedingungen für den anderen nach sich zieht. L. Van Valen hat dieser Autodynamik der Evolution 1973 den Namen RoteKönigin-Hypothese gegeben (nach einer Figur aus L. Carrolls ›Through the Looking-Glass‹): Um mit den Veränderungen in ihrer Umwelt Schritt zu halten, müssen sich die Organismen einer Population beständig selbst verändern.66 Weil jeder Parasitismus definitionsgemäß zum Schaden anderer Organismen erfolgt, die daraufhin Mechanismen der Bekämpfung der Parasiten entwickeln, kann ein ausgeprägter Parasitismus als ein für jede Interaktion selektionsgeschichtlich frühes Stadium angesehen werden. Der Selektionsprozess wird sich in der Regel dahin entwickeln, den Schaden für den Wirt zu begrenzen. W.M. Wheeler geht 1923 7 Parasitismus Abb. 363. Ernährungstypen britischer Insekten (Anzahl der Arten in den größten taxonomischen Ordnungen). Insekten, deren Ernährung nicht eindeutig einem Typ zugeordnet werden konnte, sind nicht berücksichtigt. Viele der aufgeführten Insekten gehören nur in bestimmten Lebensphasen einem Typ zu: Viele Schmetterlinge (Lepidoptera) sind z.B. nur als Raupen parasitisch, als Imagines dagegen vielfach symbiontisch. Umgekehrt sind nicht wenige Fliegen (Diptera) (*) nur als Imagines parasitisch (z.B. Vertreter der Familien der Culicidae, Ceratopogonidae und Simuliideae) (aus Price, P.W. (1977). General concepts on the evolutionary biology of parasites. Evolution 31, 405-420: 406). so weit, die Parasitismusvermeidung (besonders in menschlichen Gemeinschaften) als einen »kategorischen Imperativ« der Biologie zu bezeichnen: »Biology has one great categorical imperative to offer to us and that is: Be neither a parasite nor a host, and try to dissuade others from being parasites or hosts«.67 Aufgrund seiner weiten Verbreitung wird dem Parasitismus eine große Rolle in der Evolution der Organismen zugeschrieben.68 Durch zunehmende Spezialisierung auf bestimmte Wirtstypen haben jeweils die von den typischen Vertretern einer Art abweichenden Individuen einen Vorteil, so dass der Parasitismus an der Wurzel einer beständigen Dynamik in der Koevolution von Wirt und Parasit stehen kann. Hohe Variation, auf phänotypischer und genetischer Ebene, kann also das Ergebnis eines starken Parasitendrucks in einer Wirtspopulation sein.69 Eine besondere Bedeutung wird dem Parasitismus darüber hinaus für die Erhaltung der Sexualität zugeschrieben (↑Geschlecht), weil diese einen Mechanismus darstellt, eine hohe Variation in einer Population aufrechtzuerhalten (und dabei doch keine Zufallsvariation erzeugt, sondern auf in der Vergangenheit bewährte Kombinationen zurückgreift). P.W. Price gibt 1977 eine Übersicht über einige allgemeine Prinzipien zur Charakterisierung der Evolution von Parasiten.70 Kennzeichnend ist danach die Anpassung der Parasiten an kleinräumige, diskontinuierliche Umweltbedingungen, die sich aus der Bindung an einen Wirtsorganismus ergibt. Das für den Parasiten nicht vorhersehbare Vorkommen des Wirts bedingt die Schwierigkeit, auf Artgenossen zu treffen und kann damit eine Erklärung für die weite Verbreitung von ungeschlechtlicher, parthenogenetischer Fortpflanzung unter den Parasiten liefern. Die weite Verbreitung der ungeschlechtlichen Fortpflanzung wiederum führt zu einer starken Fraktionierung der Genpools und bedingt damit insgesamt hohe Artbildungsraten und eine ausgeprägte adaptive Radiation. Sympatrische Muster der Artbildung sind dabei offenbar mindestens ebenso wichtig wie allopatrische durch geografische Isolation. Super- oder Hyperparasitismus Ein Super- oder Hyper-Parasitismus liegt vor, wenn ein Parasit einen anderen Parasiten befällt. Verbreitete Superparasiten sind Schlupfwespen, die ihre Parasitismus Eier in die Larven von parasitischen Insekten legen, die in anderen Insekten leben. Als hyperparasitisch (»hyperparasitic«) werden Hymenopteren bereits 1833 bezeichnet.71 Von einer super-parasitischen Lebensgeschichte (»super-parasitic history«) spricht H. Woodward 1877, und zwar in Bezug auf einen Krebs (Cryptothiria) und zwei Asseln (Bopyrus und Cryptoniscus)72. Die abstrakten Bezeichnungen für das Phänomen Hyperparasitismus bzw. Superparasitismus werden erst in der zweiten Hälfte des 19. bzw. im 20. Jahrhundert gebildet (Newman 1878: »In Diptera I have observed the frequent occurrence of hyperparasitism, that is when the fly has deposited its egg on or in the larva of a Lepidopteron: the larva proceeding from that egg has become the prey of a Biophagan, and thus the original life has been forfeited; the life of the dipterous destroyer has also been forfeited; and the destroyer of the destroyer, or the hyperparasite, has been the only life to escape«73; Fiske 1910: »superparasitism«74). Parasitoid Organismen, die allein im Larvenstadium parasitisch leben und dabei ihren Wirt töten, im Adultstadium aber freilebend sind, d.h. zu ihrer Ernährung nicht mehr nur an einen Wirtsorganismus gebunden sind, werden ›Parasitoide‹ genannt.75 Sie stehen in Bezug auf ihre Ernährungsform also zwischen dem Parasitismus und dem Räubertum. Das Wort geht zurück auf O.M. Reuter, der es 1913 prägt: »Parasitenartige Raubinsekten (Parasitoïdea). Das Ei wird auf oder unter die Haut des zukünftigen Raubes gelegt oder in die nächste Nähe desselben. Die vom Raub lebende Larve fängt nicht ihre Beute ein, sondern wird vom Muttertiere damit versehen. In typischen Fällen stirbt die Beute, nachdem sie zum größten Teil verzehrt worden ist. Die Imago weicht in ihrem Bau nicht von dem für die Ordnung typischen ab«.76 Die Bezeichnung wird 1923 von W.M. Wheeler übernommen77 und verbreitet sich im Anschluss daran auch im englischen Sprachraum. In einem nicht-terminologischen Sinn kommt der Ausdruck bereits Mitte des 19. Jahrhunderts vor (Fowler 1860: »Parasitoid«: »Resembling a parasite«78; Macdonald 1865: »parasitoid form of foetal development«79) Die bekanntesten Parasitoide sind Hautflügler und Fliegen, die ihre Eier auf oder in die Wirtsorganismen ablegen, von denen sich die Larven dann ernähren. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 25% aller Organismenarten auf der Erde Parasitoide sind.80 8 Nachweise 1 Nitzsch, C.L. (1818). Die Familien und Gattungen der Thierinsekten (insecta epizoica). Magazin der Entomologie 3, 261-316: 270. 2 Erman, P. (1819). Wahrnehmungen über das Blut einiger Mollusken (Vorgelesen den 25. April 1816). Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin aus den Jahren 1816-1817, 199-216: 215. 3 Guillemin, J.B.A. (1825). Gui. Dictionnaire classique d’histoire naturelle, Bd. 7, 585-586: 585; Candolle, A.P. de (1830). Collections de mémoires servir à l’histoire du règne végétal, sixième mémoire: Sur la famille des Loranthacées; ders. (1832). Physiologie végétale, Bd. 3: 1401; Decaisne, J. (1847). Sur le parasitisme des Rhinanthacées; Johnston, G. (1853). The Botany of the Eastern Borders: 258 (nach OED 1989); Frauenfeld, G. von (1864). Das Vorkommen des Parasitismus im Thier- und Pflanzenreiche. 4 Vgl. Meier, M.H.E. (1838). Parasiten. In: Ersch, F.S. & Gruber, F.G. (Hg.). Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, Bd. 11, 417-423; Kruschwitz, P. & Hiepe, T. (2000). Die antiken Wurzeln des Begriffs ›Parasit‹. Nova Acta Leopold. N.F. 83, 147-158; Enzensberger, U. (2001). Die Parasiten: 13ff. 5 Zaluziansky à Zaluzian, A. (1592). Methodi herbariae libri tres (Frankfurt 1604): [85] (Cap. I, xxxii: De coniunctis plantis). 6 Browne, T. (1646). Pseudodoxia Epidemica: 98 (nach OED 1989). 7 Grew, N. (1682). The Anatomy of Plants: Preface. 8 Chambers, E. (1728). Cyclopædia or an Universal Dictionary of Arts and Science. 9 Linné, C. von (1735). Systema naturae: Observationes in regnum animale, Punkt 10. 10 Pallas, P.S. (1760). De infestis viventibus intra viventia. 11 Linné, C. von (1735/58). Systema naturae, Bd. 1: 136. 12 Nemnich, P.A. (1793-95). Allgemeines PolyglottenLexicon der Naturgeschichte, 4 Bde.: 4, 334. 13 Théodoridès, J. (1966). Les grandes étapes de la parasitologie. Clio Medica 1, 129-145; 185-208. 14 Hippokrates, Krankheiten: 4, 54. 15 Aristoteles, Hist. anim. 551a.; vgl. Hoeppli, R. (1959). Parasites and Parasitic Infections in Early Medicine and Science: 8; Foster, W.D. (1965). A History of Parasitology: 2. 16 a.a.O.: 556bff.. 17 Vgl. Reinhard, E.G. (1957). Landmarks of parasitology, I. The discovery of the life cycle of the liver fluke. Experimental Parasitology 6, 208-232: 209; Kean, B.H., Mott, K.E. & Russell, A.J. (eds.) (1978). Tropical Medicine and Parasitology. Classic Investigations, 2 vols.: 561f. 18 Gambuccini, G. [lat.: Gabucinus, H.] (1547). De lumbricis alvum occupantibus, ac de ratione curande eos, qui ab illis infestantur, commentaries; vgl. Reinhard (1957): 209; Egerton, F.N. (2004). A history of the ecological sciences, part 12: Invertebrate zoology and parasitology during the 1500s. Bull. Ecol. Soc. Amer. 85, 27-31: 28. 19 Redi, F. (1668). Esperienze intorno alla generazione 9 del’insetti: 190; vgl. Reinhard (1957): 212; Egerton, F.N. (2005). A history of the ecological sciences, part 17: invertebrate zoology and parasitology during the 1600s. Bull. Ecol. Soc. Amer. 86, 133-144: 137. 20 Leeuwenhoek, A. van. (1679). [Brief vom 21. Feb. 1679] (Collected Letters, vol. 1-15, Amsterdam 1939-99): II, 417-419; vgl. Egerton, F.N. (2006). A history of the ecological sciences, part 19: Leeuwenhoek’s microscopic natural history. Bull. Ecol. Soc. Amer. 87, 47-58: 53. 21 Bidloo, G. (1698). [Letter from G. Bidloo to Antony van Leeuwenhoek. About the animals which are sometimes found in the liver of sheep and other beasts] (Nieuwkoop 1972); vgl. Foster (1965): 52. 22 Rudolphi, C.A. (1808-10). Entozoorum sive vermium intestinalium historia naturalis, 2 Bde. 23 Küchenmeister, F. (1852). Ueber die Umwandlung der Finnen (Cysticerci) in Bandwürmer (Taenien). Vierteljahrschrift für die Praktische Heilkunde (Prag) 33, 106-159; ders. (1853). Ueber Cestoden im Allgemeinen und die des Menschen insbesondere: 11ff. 24 Vgl. Reinhard (1957). 25 Burmeister, H. (1837). Handbuch der Naturgeschichte, 2. Abth. Zoologie: 388f. 26 Bancroft, J. (1876) On filaria. Trans. Intercol. Med. Congr. Melbourne, 49-54. 27 Laveran, C.L.A. (1880). Note sur un nouveau parasite trouvé dans le sang de plusieurs malades atteints de fièvre palustres. Bull. Acad. Med. 9, 1235-1236; ders. (1881). Un nouveau parasite trouvé dans le sang de plusieurs malades atteints de fièvre palustre. Bull. Mém. Soc. Médic. Hôpitaux Paris, 2e sér. 17, 158-164. 28 Siebold, C.T. von (1844). Parasiten. In: Wagner, R. (Hg.). Handwörterbuch der Physiologie, Bd. 2, 641-692: 641; ähnlich: Küchenmeister, F. (1855). Die in und an dem Körper des gesunden Menschen vorkommenden Parasiten, 2 Bde.: I, 1. 29 Siebold, C.T.E. von (1854). Über die Band- und Blasenwürmer. 30 Beneden, P.J. van (1875). Les Commensaux et les Parasites dans le Règne Animal (dt. Die Schmarotzer des Thierreichs. Leipzig 1876): 94. 31 a.a.O.: 7. 32 a.a.O.: 94. 33 a.a.O.: 7f. 34 Nachweise für Tab. 226: Leuckart, (1879). Allgemeine Naturgeschichte der Parasiten: 3; Caullery, M. (1922). Le parasitisme et la symbiose: 13; Philipchenko, A.A. (1937). [Ecological concpet of parasitism]. Uchen. Zapiski Leningr. Gos. Univ. Ser. Biol. 3, 4-14; zit. nach Dogel, V.A. (1962). General Parasitology: 5; Chandler, A.C. & Read, C.P. (1961). Introduction to Parasitology: 16. 35 Vgl. Noble, E.R. & Noble, G.A. (1961/76). Parasitology. The Biology of Animal Parasites; Schmidt, G.D. & Roberts, L.S. (1977/85). Foundations of Parasitology. 36 Brooks, D.R. & McLennan, D.A. (1993). Parascript. Parasites and the Language of Evolution: 4. 37 Leuckart, F.S. (1827). Versuch einer naturgemäßen Eintheilung der Helminthen: 7. 38 Schmidt, J.H. (1825). De corporum heterogeneorum in Parasitismus plantis animalibusque genesi: 45. 39 Candolle, A.P. de (1832). Physiologie végétale, Bd. 3: 1401. 40 Diesing, C.M. (1840). Neue Gattungen von Binnewürmern nebst einem Nachtrag zur Monographie der Amphistomen. Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte 2, 219-242: 234; Siebold, C.T. von (1844). Parasiten. In: Wagner, R. (Hg.). Handwörterbuch der Physiologie, Bd. 2, 641-692: 641. 41 Martius, C.F.P. von (1835). Conspectus regni vegetabilis secundum characteres morphologicos praesertim carpicos in classes ordines et familias digesti: 31; ders. (1838). Ueber die geographischen Verhältnisse der Palmen, mit besonderer Berücksichtigung der Haupt-Floren-Reiche (Forts.). Gelehrte Anzeigen der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München 6, 953-960: 960. 42 Mons, J.B. van (1835). Arbres fruitiers, leur culture en Belqique et leur propagation par la graine, Bd. 1: 500. 43 Frank, A.B. (1877). Ueber die biologischen Verhältnisse des Thallus einiger Krustenflechten. Beitr. Biol. Pflanz. 2, 123-200: 195. 44 a.a.O.: 196. 45 Wesenberg-Lund, C. (1931). Contributions to the development of the Trematoda digenea, I. The biology of Leucochloridium paradoxum. K. dansk. Vidensk. Selsk. Skr. 9. Ser. 4, 89-142; Holmes, J.C. & Bethel, W.M. (1972). Modification of intermediate host behaviour by parasites. In: Canning, E.U. & Wright, C.A. (eds.). Behavioural Aspects of Parasite Transmission, 123-149; vgl. Dawkins, R. (1982). The Extended Phenotype: 212f. 46 Hohorst, W. & Graefe, G. (1961). Ameisen – obligatorische Zwischenwirte des Lanzettegels (Dicrocoelium dendriticum). Naturwiss. 48, 229-230; Dawkins (1982): 218. 47 Klebs, G. (1881). Beiträge zur Kenntniss niederer Algenformen, Teil V. Bot. Zeitung 39, 313-319: 318; Franke, M. (1883). Endoclonium polymorphum. Beiträge zur Biologie der Pflanzen 3, 365-376: 372. 48 Zelinka, C. (1887). Studien über Räderthiere. Der Raumparasitismus und die Anatomie von Discopus synaptae nov. gen. nov. sp. Zool. Anz. 1887, 465-468; Hertwig, R. (1910). Lehrbuch der Zoologie: 402. 49 Dahl, F. (1910). Anleitung zu zoologischen Beobachtungen: 39; vgl. 91f. 50 Vgl. Aristoteles, Hist. anim. 563b f.; Aelian, De nat. animal. 3, 30. 51 Schmarda, L.K. (1866). Die Thiergeographie und ihre Aufgabe. Geographisches Jahrbuch 1, 402-427: 416. 52 Davis, J.R.A. (1904). The Natural History of Animals. The Animal Life of the World in its, vol. 7: 186. 53 Wheeler, W.M. (1910). Ants. Their Structure, Development and Behavior (3rd printing 1960): 406. 54 Payne, R.B. (1977). The ecology of brood parasitism in birds. Ann. Rev. Ecol. Syst. 8, 1-28; ders. (1998). Brood parasitism in birds: Strangers in the nest. Bioscience 48, 377-386; May, R.M. & Robinson, S.K. (1985). Population dynamics of avian brood parasitism. Amer. Nat. 126, 475494. 55 Plessner, H. (1928). Die Stufen des Organischen und der Mensch (Berlin 1975): 234.