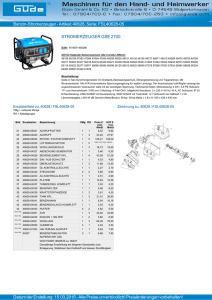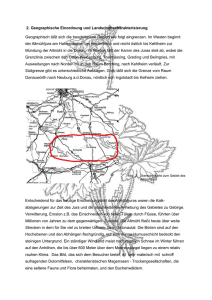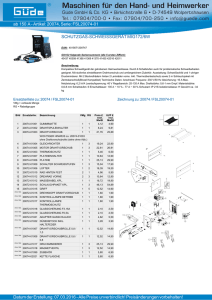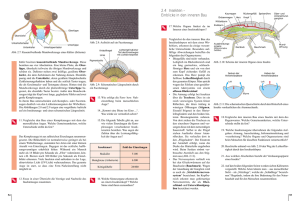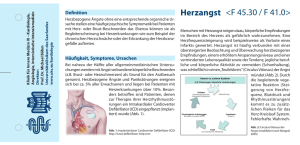AUKTIONSHAUS KAUPP
Werbung
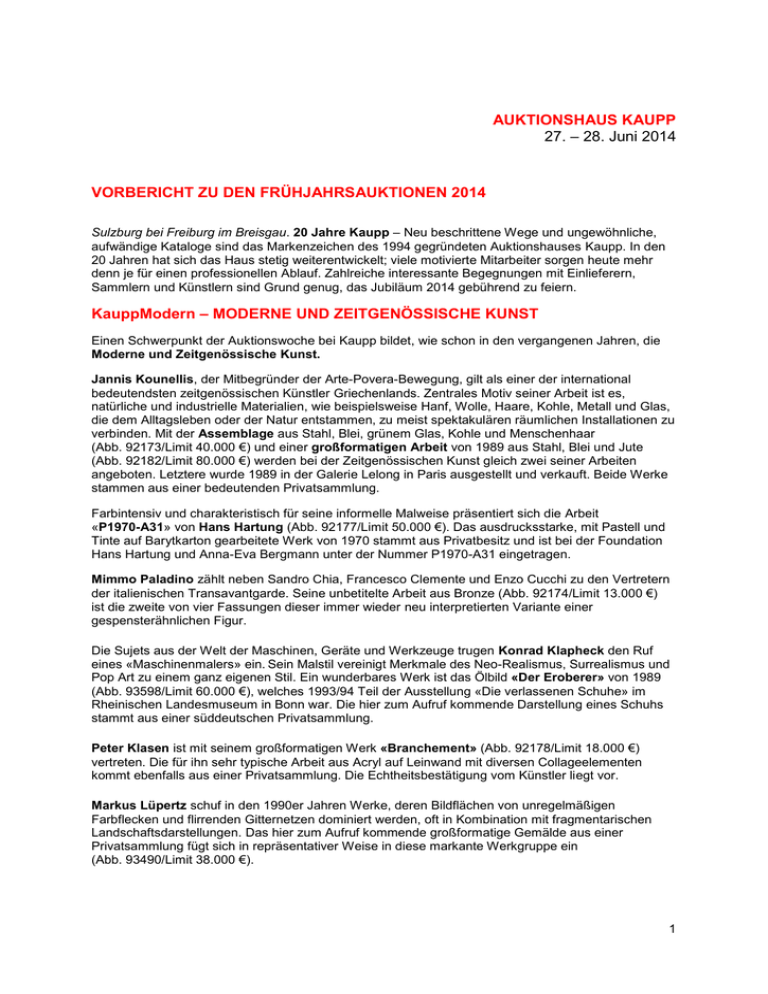
AUKTIONSHAUS KAUPP 27. – 28. Juni 2014 VORBERICHT ZU DEN FRÜHJAHRSAUKTIONEN 2014 Sulzburg bei Freiburg im Breisgau. 20 Jahre Kaupp – Neu beschrittene Wege und ungewöhnliche, aufwändige Kataloge sind das Markenzeichen des 1994 gegründeten Auktionshauses Kaupp. In den 20 Jahren hat sich das Haus stetig weiterentwickelt; viele motivierte Mitarbeiter sorgen heute mehr denn je für einen professionellen Ablauf. Zahlreiche interessante Begegnungen mit Einlieferern, Sammlern und Künstlern sind Grund genug, das Jubiläum 2014 gebührend zu feiern. KauppModern – MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST Einen Schwerpunkt der Auktionswoche bei Kaupp bildet, wie schon in den vergangenen Jahren, die Moderne und Zeitgenössische Kunst. Jannis Kounellis, der Mitbegründer der Arte-Povera-Bewegung, gilt als einer der international bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Griechenlands. Zentrales Motiv seiner Arbeit ist es, natürliche und industrielle Materialien, wie beispielsweise Hanf, Wolle, Haare, Kohle, Metall und Glas, die dem Alltagsleben oder der Natur entstammen, zu meist spektakulären räumlichen Installationen zu verbinden. Mit der Assemblage aus Stahl, Blei, grünem Glas, Kohle und Menschenhaar (Abb. 92173/Limit 40.000 €) und einer großformatigen Arbeit von 1989 aus Stahl, Blei und Jute (Abb. 92182/Limit 80.000 €) werden bei der Zeitgenössischen Kunst gleich zwei seiner Arbeiten angeboten. Letztere wurde 1989 in der Galerie Lelong in Paris ausgestellt und verkauft. Beide Werke stammen aus einer bedeutenden Privatsammlung. Farbintensiv und charakteristisch für seine informelle Malweise präsentiert sich die Arbeit «P1970-A31» von Hans Hartung (Abb. 92177/Limit 50.000 €). Das ausdrucksstarke, mit Pastell und Tinte auf Barytkarton gearbeitete Werk von 1970 stammt aus Privatbesitz und ist bei der Foundation Hans Hartung und Anna-Eva Bergmann unter der Nummer P1970-A31 eingetragen. Mimmo Paladino zählt neben Sandro Chia, Francesco Clemente und Enzo Cucchi zu den Vertretern der italienischen Transavantgarde. Seine unbetitelte Arbeit aus Bronze (Abb. 92174/Limit 13.000 €) ist die zweite von vier Fassungen dieser immer wieder neu interpretierten Variante einer gespensterähnlichen Figur. Die Sujets aus der Welt der Maschinen, Geräte und Werkzeuge trugen Konrad Klapheck den Ruf eines «Maschinenmalers» ein. Sein Malstil vereinigt Merkmale des Neo-Realismus, Surrealismus und Pop Art zu einem ganz eigenen Stil. Ein wunderbares Werk ist das Ölbild «Der Eroberer» von 1989 (Abb. 93598/Limit 60.000 €), welches 1993/94 Teil der Ausstellung «Die verlassenen Schuhe» im Rheinischen Landesmuseum in Bonn war. Die hier zum Aufruf kommende Darstellung eines Schuhs stammt aus einer süddeutschen Privatsammlung. Peter Klasen ist mit seinem großformatigen Werk «Branchement» (Abb. 92178/Limit 18.000 €) vertreten. Die für ihn sehr typische Arbeit aus Acryl auf Leinwand mit diversen Collageelementen kommt ebenfalls aus einer Privatsammlung. Die Echtheitsbestätigung vom Künstler liegt vor. Markus Lüpertz schuf in den 1990er Jahren Werke, deren Bildflächen von unregelmäßigen Farbflecken und flirrenden Gitternetzen dominiert werden, oft in Kombination mit fragmentarischen Landschaftsdarstellungen. Das hier zum Aufruf kommende großformatige Gemälde aus einer Privatsammlung fügt sich in repräsentativer Weise in diese markante Werkgruppe ein (Abb. 93490/Limit 38.000 €). 1 Einer der wichtigsten und einflussreichsten zeitgenössischen Künstler Spaniens ist sicherlich der 1954 geborene José Maria Sicilia. Typisch für die meist großformatigen Arbeiten des Künstlers ist das Spiel mit unterschiedlichen Materialien, häufig Wachs in Verbindung mit Öl- und Acrylfarben. Die hier zum Aufruf kommende Arbeit «Fleur vert» fügt sich beispielhaft in die Serie der roten, schwarzen und weißen Blumenbilder der späten 1980er Jahre ein (Limit 20.000 €). Das Werk von Théo Tobiasse war zeitlebens geprägt von seiner Kindheit in Litauen, der Beziehung zur Frau als Mutter und Liebhaberin und seinem Exil. Dies spiegelt sich auch in den beiden erotischen Gouachen «Le Cantique des Cantiques» wider, die der jetzige Besitzer direkt vom Künstler erworben hat (Abb. 93085/Limit 9.000 € und Abb. 93086/Limit 9.000 €). Die Bronzeskulptur «Kopf» des Malers und Bildhauers Michael Croissant aus dem Jahre 1991 gelangt mit einem Limit von 8.000 € zum Aufruf. Ein Privatsammler kaufte es direkt im Atelier des Künstlers. Dieses Unikat wurde im Entstehungsjahr in der Galerie Scheffel in München ausgestellt und ist im Werkverzeichnis des Künstlers aufgeführt (Abb. 92456/Limit 8.000 €). Mit Lyonel Feininger ist die Klassische Moderne mit einem ihrer bedeutendsten Künstler vertreten. Das hier zum Aufruf kommende Aquarell «Stadtansicht mit Kirche» von 1955 besticht durch seine hellen Blautöne, die der Szene die für Feininger typische kristalline Atmosphäre verleihen. Das Werk ist von Achim Möller bestätigt und im Archiv des Lyonel Feininger Project, New York/Berlin, unter der Nummer 111-02-23-05 registriert (Abb. 92997/Limit 25.000 €). Des Weiteren sind in der Jubiläumsauktion beeindruckende Werke u.a. von Jean Fautrier, Otto Dix, Enrico Bay, Anne und Patrick Poirier, Sol LeWitt, Arnulf Rainer, Mimmo Rotella, Valerio Adami und Joseph Beuys vertreten. KauppPremium In dieser Auktion finden sich viele Pretiosen und begehrte Objekte der Abteilungen Schmuck und Uhren, Jugendstil und Art Déco, Porzellan, Silber, Möbel, Skulpturen, Malerei vom 16. bis 19. Jahrhundert, Vitrinen- und Sammlerobjekte sowie asiatische und außereuropäische Kunst. Hier ist der Nachlass des Barons Ruprecht Böcklin zu Böcklinsau besonders hervorzuheben. Er war der letzte Nachkomme der Besitzer von Schloss Balthasar in Rust, welches heute mitten im weit über die Landesgrenzen bekannten Europa-Park liegt. Zahlreiche Möbel und Sammlerobjekte aus der Barock- und Frühbarockzeit gelangen hier zum Aufruf. GEMÄLDE ALTER UND NEUERER MEISTER Unter den zahlreichen Gemälden des 19. und 20. Jahrhunderts gefällt besonders das aus Privatbesitz stammende Gemälde «Rue de Geôle, la maison des Quatrans à Caen, Normandie» von Édouard Cortès. Das Bild ist ein typisches Beispiel seiner Straßenszenen, bei denen Cortès gekonnt den Einsatz von Licht nutzt, um in seinen Werken eine dichte Atmosphäre zu schaffen (Abb. 92733/ Limit 8.000 €). Der Rottmann-Schüler Carl Morgenstern ist wie sein Münchner Lehrer der Romantik zuzuordnen. Die Bilder aus seiner frühen, von der Italienreise beeinflussten Zeit zeigen überwiegend Landschaften, welche durch besondere Lichteffekte überraschen. Seine aufgrund von Skizzen ausgeführten Atelierbilder italienischer Motive machten Morgenstern bekannt und verschafften ihm den Ruf eines «Italianisten». Auch das hier zum Aufruf kommende Bild aus Berliner Privatbesitz zeigt als Motiv eine typische Mittelmeerlandschaft – diesmal wohl bei Marseille (Abb. 93138/Limit 5.000 €). Die Bilder von Hans Thoma wurden über fünf Jahrzehnte hinweg vom Publikum strikt abgelehnt, bis ihm mit einer Ausstellung in München 1890 der Durchbruch gelang. Zwei Jahre später, 1892, entstand «Der Fahnenträger» (Abb. 93525/Limit 10.000 €). Als anerkannter Künstler wurde er 1899 als Direktor der Großherzoglichen Kunsthalle und Professor der Kunstakademie nach Karlsruhe bestellt und zählte Anfang des 20. Jahrhunderts zu den angesehensten Malern Deutschlands. 2 Jean Ulrich Tournier schuf 1824 mit erst 22 Jahren das «Traubenstillleben in einer Mauernische» (Abb. 93589). Der zu Lebzeiten hoch geschätzte Stilllebenmaler machte sich später auch durch seine Arbeit in den weltweit berühmten Stoff-und Tapetenmanufakturen seiner elsässischen Heimat Mulhouse einen Namen. Dieses meisterliche Werk aus einer französischen Privatsammlung wird mit einem Limit von 48.000 € aufgerufen. Die mythologische Darstellung «Landschaft mit Nymphen und Satyrn» von Johann Georg Schütz ist ein sehr charakteristisches Beispiel dafür, wie die Kunst in der Renaissance Wege fand, auch Erotisches unverfänglich in Gemälden darzustellen (Abb. 93543/Limit 15.000 €). In der Auktion der Malerei des 19./20. Jahrhunderts kommen zudem Werke von Pál Böhm, László Mednyánszky, Gustav Schönleber, Haynes King, Curt Liebich, Emil Lugo, den Schwarzwaldmalern Karl Hauptmann und Hermann Dischler sowie von Emil Bizer und Julius Kibiger zum Aufruf. Bei den Gemälden der Alten Meister ist besonders das Werk «Küstenlandschaft mit Hero und Leander» von Pieter Mulier d.J. hervorzuheben (Abb. 93536/Limit 16.000 €). Herr Prof. Marcel Roethlisberger, u.a Experte für Pieter Mulier und Verfasser des Werkverzeichnisses, bezeichnet es in seinem Gutachten als charakteristisches und typisches Werk dieses bedeutenden Malers. Er datiert das Werk anhand formaler und stilistischer Aspekte in die Schaffensphase um 1680. Jacob de Wit war vor allem bekannt für seine Dekorationsmalerei, die man noch heute in vielen Häusern der Keizersgracht in Amsterdam bestaunen kann. Von ihm kommen zwei Grisaillen mit allegorischen Darstellungen mit Putti zum Aufruf. Die sehr feinen Grauabstufungen imitieren täuschend realistisch Steinreliefs, die beim Betrachten wie vollplastische Stuckaturen wirken (Abb. 93590/Limit 20.000 €). Zwei seltene Gemälde der peruanischen Cuscoschule aus dem 17./18. Jahrhundert seien ebenfalls erwähnt. Die beiden Werke «Angel Arcabucero» (Abb. 92275/Limit 6.000 €) und «Virgen de Candelaria» (Abb. 92274/Limit 6.000 €) sind eindrucksvolle Beispiele dieser in Lateinamerika einflussreichen Kunstrichtung. Kennzeichnend für die Cuscomalerei ist ihre Vorliebe für Darstellungen christlicher Heiligenfiguren, in die Vorstellungen andiner Götter einfließen, sowie reich mit Ornamenten geschmückte Gewänder, die den Einfluss des spanischen Barocks offenbaren. ASIATIKA UND AUSSEREUROPÄISCHE KUNST Für internationale Käufer ist die Auktion für asiatische- und außereuropäische Kunst immer von besonderem Interesse und auch für die kommenden Frühjahrsauktionen konnte das Auktionshaus Kaupp Objekte von hoher Qualität gewinnen. Nennenswert ist eine große, aus China stammende blau-weiße Guan-Vase aus der Ming-Dynastie (Abb. 92553/Limit 50.000 €). Das unterglasurblau bemalte Gefäß stellt auf der Wandung in zwei von Wolken gerahmten Kartuschen eine Landschaft mit Palast und einen Reiter mit seinen Dienern dar. Ebenfalls aus China stammt ein eisenroter und grüner Drachenteller der Zhengde-Periode. Dieses besonders schöne Porzellanexemplar zeigt im Spiegel einen fünfklauigen Drachen, der in dichte Lotosranken eingebettet und von zwei weiteren Drachen auf der Innen- und Außenwandung gerahmt ist. Der fünfklauige Drache war Symbol des Kaisers und allein dem Kaiser und seinen höchsten Beamten vorbehalten. Er kommt, wie auch die Vase, aus einer Privatsammlung in Süddeutschland (Abb. 92554/Limit 25.000 €). Außerdem zu erwähnen sind zwei großformatige indische Pichhavai mit Legendendarstellungen der Gottheit Krishna, einmal mit dem großen Tanzreigen des «Rasa Lila» (Abb. 92269/Limit 14.000 €) und einmal mit Motiven des Herbstvollmondfestes «Sarat Purnama» (Abb. 92270/Limit 3.000 €). Beide sind mit Tusche, Farben und Gold auf Tuch gemalt und haben ihren Ursprung im Nathdwara, Rajasthan, des 19. Jahrhunderts. 3 Ab Anfang Juni bietet das Auktionshaus Kaupp auch die Möglichkeit, die jeweiligen Auktionskataloge mit zahlreichen Farbabbildungen, detaillierten Beschreibungen und Limitangaben im Internet unter www.kaupp.de einzusehen. Abbildungen zu den im Text erwähnten Werken finden Sie in einer Übersicht der Pressebilder unter: http://outbox.nodesign.com/presse/ Ein Download der Abbildungen ist möglich. Falls Sie noch Fragen haben oder zusätzliches Bildmaterial benötigen, kontaktieren Sie uns bitte: Auktionshaus Kaupp GmbH, Schloss Sulzburg Tel.: 07634/50 38 0, Fax: 07634/50 38 50 E-Mail: [email protected] Bildunterschriften: Der Übersichtlichkeit halber sind die Abbildungen chronologisch sortiert und folgen nicht der Erwähnung im Pressetext. Abb. 92173: Jannis Kounellis (Geb. 1936 Piräus, lebt und arbeitet in Rom) Ohne Titel. Assemblage aus Stahl, Blei, grünem Glas, Kohle und Menschenhaar. Unsign. H. 70,5, B. 100, T. 12,5 cm. Jannis Kounellis gilt als wichtiger Vertreter und Mitbegründer der italienischen Künstlerbewegung «Arte Povera». Zentrales Motiv seiner Kunst ist es, natürliche und industrielle Materialien, wie beispielsweise Hanf, Wolle, Haare, Kohle, Metall und Glas, die dem Alltagsleben oder der Natur entstammen, zu meist spektakulären räumlichen Installationen, Performances und Objektkunst zu verbinden. Mündliche Echtheitsbestätigung: Wir danken Herrn Jannis Kounellis für die mündliche Bestätigung der Echtheit, anhand von Photos, 20.05.2014. Provenienz: erworben in den 1990er Jahren in der Galerie Sprovieri, Rom; seitdem Privatsammlung. Limit: 40.000 € Abb. 92174: Mimmo Paladino (Geb. 1948 Paduli, lebt und arbeitet in Mailand und Benevento) Ohne Titel. Animalische Maske. Bronze, partiell farbig gefasst. Auf der Plinthe sign. und 2/4 num. H. 65,8, B. 36,8, T. 22 cm. Paladino zählt neben Sandro Chia, Francesco Clemente und Enzo Cucchi zu den Vertretern der italienischen Transavantgarde. Authentifizierung: Wir danken der Galerie Michael Haas, Berlin, für die Bestätigung der Echtheit via E-Mail, anhand von Photos. Provenienz: Galerie Michael Haas, Berlin; seitdem Privatbesitz. Limit: 13.000 € Abb. 92177: Hans Hartung (Leipzig 1904 – Antibes 1989) «P1970-A31». Pastell und Tinte auf Barytkarton. U.r. sign. und (19)70 dat. Verso bez. mit der Archivnr. sowie weiteren Angaben. H. 72, B. 104,5 cm. Das vorliegende Werk zeigt beispielhaft die für Hartung typische zeichenhaft-abstrakte Linienführung, mit welcher er das Spannungsverhältnis zwischen Farbfläche und Linie untersucht. Hartung gilt als einer der wichtigsten Vertreter des europäischen Informel. Echtheitsbestätigung: Wir danken der Foundation Hans Hartung und Anna-Eva Bergmann, Antibes, für die Bestätigung der Echtheit via E-Mail, anhand von Photos. Provenienz: Galerie de France, Paris, 1971; Perrin-Royère-Lajeunesse, Versailles, 18.03.1990, Los 33; seitdem Privatsammlung. Archiv: Das vorliegende Werk ist in der Foundation Hans Hartung und Anna-Eva Bergmann unter der Nr. P1970-A31 gelistet. Limit: 50.000 € 4 Abb. 92178: Peter Klasen (1935 Lübeck, lebt und arbeitet in Vincennes) «Branchement». Acryl auf Leinwand. Verso sign., 1988 dat. und bet. sowie zwei Etiketten der Galerie Louis Carré, Paris. H. 162, B. 130 cm. Peter Klasen ist ein bedeutendes Mitglied der «Figuration Narrative». Typisch für seine Werke sind Acrylmalereien in Kombination mit Collage- bzw. Assemblageelementen, die Einteilung seiner Bilder in Zonen sowie die ab den 1960er Jahren stets wiederkehrenden Motive und diverse Armaturen wie Steckdosen, Schalter oder auch gemalte oder applizierte Wasserhähne. Mit dieser Anordnung, dem «modellierenden Malen», erzielt Klasen eine sehr plastische Wirkung seiner Bildgegenstände, denen eine kühle, photoartige Formsprache zu eigen ist. Photo-Zertifikat: vom Künstler signierte Photographie des Werkes, Vincennes, 04.02.2014. Provenienz: Galerie Louis Carré, Paris; Privatsammlung. Limit: 18.000 € Abb. 92182: Jannis Kounellis (Geb. 1936 Piräus, lebt und arbeitet in Rom) Ohne Titel. 1989. Assemblage aus Eisen, Blei und Jute. Unsign. H. 204, B. 184, T. 21 cm. Der in Italien lebende griechische Künstler stellt in seinen Werken mithilfe der von ihm als «arme Materialien» bezeichneten Werkstoffe das Verhältnis der Natur zur Kultur dar. Die verwendeten Utensilien werden dazu in organische, anorganische und vorgefertigte Materialien aufgeteilt und zu Sinnbildern für Evolution, Energie und Transparenz veredelt. Zentrale Themen seiner Werke, die er aus scheinbar zufällig gefundenen Gegenständen entstehen lässt, sind unter anderem «Flaschen, Zahlen und Buchstaben» und, wie bei der hier vorgestellten Arbeit, «Körper auf Metall». Authentifizierung: Wir danken Herrn Patrice Cotensin, Galerie Lelong, Paris, für die Bestätigung der Echtheit via E-Mail, anhand von Photos. Provenienz: Galerie Lelong, Paris, 1989; seitdem Privatsammlung. Literatur: Katalog Galerie Lelong, Kounellis. Exposition Galerie Lelong, Repères Nr. 60, Paris 1989, S. 22, Nr. 8 (vgl.). Limit: 80.000 € Abb. 92269: Prachtvoller Pichhavai mit Darstellung des «Rasa Lila» Nordindien, Rajasthan, Nathdwara 19. Jh. Tusche, Farben und Gold auf Tuch. Bei dem großen Tanzreigen tanzt Krishna achtmal mit verschiedenen Gopi-Paaren um ein zentrales Tanzpaar, das aus ihm selbst und seinem erwählten Hirtenmädchen Radha besteht. Rechts und links im Vordergrund begleiten musizierende Gopi die Tanzenden. Im Hintergrund erscheint der Wald von Brindaban mit Bäumen und Palmen unter einem klaren Sternenhimmel mit dem Vollmond und sechs Gondeln mit göttlichen Paaren. Das Mittelfeld wird von 31 kleinen Feldern mit Legendendarstellungen aus dem Leben Krishnas gerahmt. H. 300, B. 300 cm. Der Pichhavai stellt Indiens klassische Liebesgeschichte dar, die von Krishnas Liebesabenteuern mit den Gopi, den Hirtenmädchen, erzählt. Unter der Bezeichnung «Rasa Lila» bekannt geworden, schildert die Legende, wie Krishna in einer Mondnacht im Herbst mit dem Spiel auf seiner Flöte die Hirtinnen herbeilockt, um sein Versprechen, mit ihnen zu tanzen, einzulösen. Die liebeskranken Hirtinnen waren überaus entzückt, und jede tanzte mit ihm, als wäre Krishna ihr besonderer Liebhaber. Dabei machte Krishna jede von ihnen durch seine magische Kraft glauben, er tanze mit ihr allein. Der «große Liebestanz» (Rasa) markiert in den Mythen den Höhepunkt der Erlebnisse Krishnas mit den Gopi und das Ende seiner Jugend. Die Geschichte ist Ausdruck der Vereinigung der Seele in ewiger Liebe mit der höchsten Gottheit in einem «göttlichen Spiel» (Lila). Provenienz: Privatsammlung Elsass. Literatur: Robert Skelton, Rajasthani Temple hangings of the Krishna Cult, New York 1973, S. 38ff. (vgl.). Limit: 14.000 € 5 Abb. 92270: Pichhavai mit Darstellung des «Sarat Purnama» Nordindien, Rajasthan, Nathdwara 19. Jh. Tusche, Farben und Gold auf Tuch. Der frontal auf einem Baldachinthron stehende Shrinathji bildet die zentrale Figur des Herbstvollmondfestes. Gekleidet in dem für ihn typischen roten Krachhni, wird Shrinathji seitlich von je drei Gopi begleitet. Im Hintergrund erscheint der Wald von Brindaban mit Früchte tragenden Bäumen und Palmen unter einem klaren Sternenhimmel mit dem Vollmond und sechs Gondeln mit göttlichen Paaren. Unterhalb des Gottes sind der Felsenberg Govardhan, auf dem die Puja-Zeremonie stattfindet, und eine Ochsenherde. Das Mittelfeld wird von 24 kleinen Feldern mit Darstellungen jahreszeitlicher Feste gerahmt. H. 190, B. 149 cm. Provenienz: Privatsammlung Elsass. Literatur: Robert Skelton, Rajasthani Temple hangings of the Krishna Cult, New York 1973, S. 42ff. (vgl.). Limit 3.000 € Abb. 92274: Cuscoschule (Peru 17./18. Jh.) «Virgen de Candelaria (Jungfrau mit Kerze)». Öl auf Leinwand, Spannränder hinterklebt. Unsign. H. 87,8, B. 71,5 cm. Die Cuscoschule erhielt ihren Namen nach der gleichnamigen vorspanischen Inkahauptstadt, die im Süden Perus inmitten des Andenhochlandes liegt und auch während der Kolonialzeit ihre führende Rolle als kulturelles und politisches Zentrum beibehielt. Der italienische Jesuit Bernardo Bitti, der 1583 nach Cusco kam, beeinflusste mit der Einführung des Manierismus entscheidend die Entwicklung der Cuscoschule. So fanden die für den Manierismus typischen überlängten Figuren und eine Betonung des Bildvordergrundes Eingang in die Cuscomalerei, wobei der europäische Einfluss durch indigene Künstler wie Diego Quispe Tito und Juan de Santa Cruz Pumacallo mehr und mehr durch indigene Stilelemente und Bildvorstellungen verdrängt wurde. Ihren Höhepunkt erlebte die Cuscoschule in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nachdem ein schweres Erdbeben die Stadt stark zerstört hatte und viele Aufträge nun auch an indigene Künstler vergeben wurden, die allerdings zum größten Teil anonym blieben. Vorherrschendes Thema war die Bilderwelt der katholischen Religion, insbesondere Heiligendarstellungen, oft auch in Kombination mit andinen Göttern, wobei für die Cuscomalerei besonders der narrative Charakter typisch ist. Typisch für die in der Cuscoschule häufige Vermischung der Kulturen und Religionen sind unter anderen die trapezförmigen Mariendarstellungen, zu denen auch das hier gezeigte Gemälde gehört. Sie erinnern in ihrer Gestalt an die Silhouette des Berges Apu, welcher als Gottheit verehrt wurde. Das lange dunkle Haar ist als Hinweis auf das bis heute bestehende Matriarchat in der andinen Kultur zu verstehen. Provenienz: Privatsammlung Elsass. Limit: 6.000 € Abb. 92275: Cuscoschule (Peru 17./18. Jh.) «Angel Arcabucero (Engel mit Arkebuse)». Öl auf Leinwand, auf Hartfaserplatte kaschiert. Unsign. H. 90, B. 65,1 cm. Unverkennbares Merkmal des hier dargestellten Erzengels ist die Arkebuse. Diese Waffe wurde durch die Kolonialisten aus Europa eingeführt und hinterließ bei der einheimischen Bevölkerung vor allem durch das an Donner erinnernde Geräusch beim Abfeuern großen Eindruck. Die Flügel des Engels bestehen aus Flamingofedern. Die Flamingos nehmen in der Inkakultur einen hohen rituellen Stellenwert ein, da sie die Verbindung zwischen Himmel und Erde symbolisieren. Das Tragen dieser Federn war ausschließlich dem Adel vorbehalten. Provenienz: Privatsammlung Elsass. Limit: 6.000 € Abb. 92456: Michael Croissant (1928 Landau – 2002 München) «Kopf». Bronze, geschweißt. U. monogr. und (19)91 dat. H. 29, B. 27, T. 21 cm. Sehr schöne und typische Arbeit des Bildhauers, der in seinen oft großformatigen Werken den menschlichen Körper abstrahiert und thematisiert. Die im Laufe seines Werkes stetig zunehmende Reduktion auf den Kopf ist Zeichen und Ausdruck eines die Materie beherrschenden Geistes. Provenienz: Atelier des Künstlers; Privatsammlung Königswinter. Ausstellung: Galerie Scheffel, München, 1991. Literatur: Kunstverein München, Michael Croissant - Plastiken und Zeichnungen, München 1991, Abb. S. 25 (vgl.). Werkverzeichnis: Gabler/Ohnesorge 854. Limit: 8.000 € 6 Abb. 92553: Bedeutende blau-weiße Guan-Vase China, Ming-Dynastie. Porzellan, unterglasurblau bemalt. Auf der Wandung in zwei von Wolken gerahmten Kartuschen Landschaft mit Palast und einem Reiter, begleitet von einem Diener, und gefolgt von zwei weiteren Dienern. Umlaufend begrenzt von Spitzblattfries am Fuß, mit Blütenzweigen gefüllten Achtpassfeldern über cash-Musterbordüre auf der Schulter und Kreuzgittermuster am Hals. Ungemarkt. Brandrisse. H. 36, D. 35 cm. Diese große blau-weiße Vase ist ein repräsentatives Beispiel für die verfeinerte Figurenmalerei, die sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in den Porzellandekoren bemerkbar macht. Neben der klassischen Reihung floraler Motive sowie der Verwendung von Symbolen tauchen nun auch Darstellungen weiter Landschaftspanoramen mit Figurenstaffagen in einem narrativen Duktus auf, die ihre Vorlagen in der traditionellen Literatur und in populären Dramen finden. Kompositorisch sind diese Szenen vergleichbar mit den Rollbildern der frühen Ming-Zeit. Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland. Limit: 50.000 € Abb. 92554: Eisenroter und grüner Drachenteller China, Zhengde-Marke und -Periode. Porzellan, eisenrot und grün bemalt und glasiert. Auf eisenrotem Fond fünfklauiger Drache im Spiegel, eingebettet in dichte Lotosranken und von zwei weiteren Drachen auf der Innen- und Außenwandung gerahmt. Sechszeichen-Zhengde-Marke mit Doppelring. D. 24 cm. Der fünfklauige Drache war Symbol des chinesischen Kaisers und allein dem Kaiser und seinen höchsten Beamten vorbehalten. Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland. Limit: 25.000 € Abb. 92733: Édouard Cortès (1882 Lagny-sur-Marne – 1969 ebd.) «Rue de Geôle, la maison des Quatrans à Caen, Normandie». Um 1940. Öl auf strukturiertem Malkarton. U.r. sign. Verso bet. und bez. H. 41, B. 33 cm. Cortès malte hauptsächlich Straßenszenen. Dabei nutzte er den Einsatz von Licht und die daraus entstehenden Hell-Dunkel-Effekte sowie den Kontrast zwischen kalten und warmen Farbtönen, um seinen Werken eine dichte Atmosphäre zu verschaffen. Echtheitsbestätigung: Wir danken Frau Nicole Verdier, Verfasserin des Werkverzeichnisses, Paris, für die Bestätigung der Echtheit via E-Mail, anhand von Photos. Frau Nicole Verdier datiert das Werk anhand formaler und stilistischer Aspekte in die Schaffensphase um 1940. Provenienz: seit den 1940er Jahren Privatbesitz Bayern. Limit: 8.000 € Abb. 92997: Lyonel Feininger (New York 1871 – Berlin 1956) Stadtansicht mit Kirche. Aquarell und Tusche auf geripptem (Vergé) Papier von Ingres (Wasserzeichen). U.l. sign. und u.r. 13.VII.(19)55 dat. H. 15,9, B. 26 cm (Blattgröße). Darstellungen von Kirchen, Dörfern und Stadtansichten zählen zu Feiningers berühmtesten Werken. Ab den 1920er Jahren dominiert zunehmend der Einfluss der Ästhetik des Bauhauses. Exakt ausgeführte Geraden und klare geometrische Formen, beispielhaft in der hier gezeigten Arbeit Feiningers erkennbar, lösen die noch eher dynamischen und unruhigen Kompositionen der früheren Schaffensphasen ab. Ab den 1950er Jahren gewinnen in Aquarell ausgeführte Arbeiten immer mehr Bedeutung in Feiningers Gesamtwerk. Provenienz: Privatsammlung Hessen. Photo-Zertifikat: Achim Moeller, Managing Principal, The Lyonel Feininger Project LLC, New York, 05.03.2014. Archiv: Das vorliegende Werk ist im Archiv des Lyonel Feininger Project, New-York - Berlin, unter der Nr. 111-02-23-05 registriert. Limit: 25.000 € Abb. 93085: Théo Tobiasse (1927 Jaffa – 2012 St. Paul de Vence) «Le Cantique des Cantiques». Gouache und Mischtechnik auf Velin. O.l. sign. und u.r. (19)71 dat. Mitte o. bet. und u.r. mit der Werknr. «21» num. H. 51, B. 67 cm (Blattgröße). Photo-Zertifikat: zwei vom Künstler signierte Photographien des Werkes, XI.(20)04. Provenienz: Atelier des Künstlers; seitdem Privatsammlung. Limit: 9.000 € 7 Abb. 93086: Théo Tobiasse (1927 Jaffa – 2012 St. Paul de Vence) «Le Cantique des Cantiques». Gouache und Mischtechnik auf Velin. O.l. sign. und darüber (19)71 dat. Mitte u. bet. und u.r. mit der Werknr. «18» num. H. 51,2, B. 67 cm (Blattgröße). Photo-Zertifikat: zwei vom Künstler signierte Photographien des Werkes, XI.(20)04. Provenienz: Atelier des Künstlers; seitdem Privatsammlung. Limit: 9.000 € Abb. 93138: Carl Morgenstern (1811 Frankfurt a.M. – 1893 ebd.) Küste bei Marseille. Öl auf Leinwand. Unsign. Seitlich auf dem Spannrand bez. «bei Marseilles». Verso auf der Leinwand nahezu unleserlich gestempelt «C. Morgen(stern) (?)». Verso auf dem Keilrahmen ein altes Auktionsetikett mit Losnr. Kl. Retuschen. H. 28,4, B. 42,9 cm. Echtheitsbestätigung: Wir danken Herrn Dr. Christoph Andreas, Experte für Carl Morgenstern, für die Bestätigung der Echtheit via E-Mail, anhand von Photos. Provenienz: Nachlassauktion der Witwe Carl Morgensterns, Frankfurter Kunstverein, 19.11.1918, Los 58 (dort als «Italienische Landschaft» aufgeführt); seitdem Privatbesitz Berlin. Limit: 5.000 € Abb. 93490: Markus Lüpertz (Geb. 1941 – Böhmen, lebt und arbeitet in Düsseldorf, Berlin, Karlsruhe und Florenz) «Ohne Titel». 1997. Öl auf Leinwand. U.r. monogr. mit dem Künstlersignet. H. 160, B. 200 cm. Im Gesamtwerk von Markus Lüpertz, einem der wichtigsten Vertreter des deutschen Neoexpressionismus, nimmt die Malerei den zentralen Stellenwert ein. Bildmotive werden oftmals wiederholt und dabei stets in einem neuen Blickwinkel zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit neu interpretiert und hinterfragt. In den 1990er Jahren entstanden Werke, deren Bildflächen von unregelmäßigen Farbflecken und flirrenden Gitternetzen dominiert werden, oft in Kombination mit fragmentarischen Landschaftsdarstellungen. Das hier gezeigte Gemälde fügt sich in repräsentativer Weise in diese markante Werkgruppe ein. Mündliche Echtheitsbestätigung: Wir danken dem Atelier Lüpertz, Düsseldorf, für die mündliche Bestätigung der Echtheit, anhand von Photos, 09.04.2014. Provenienz: Privatsammlung. Limit: 38.000 € Abb. 93525: Hans Thoma (1839 Bernau – 1924 Karlsruhe) «Der Fahnenträger». Öl auf starkem Velin, auf Malpappe kaschiert. U.r. monogr. und (18)92 dat. Verso auf dem Rahmen Auktionsvermerke, auf einem Etikett bez. mit den technischen Daten des Werkes und der Provenienz sowie dem Literaturhinweis. H. 44,1, B. 29,9 cm. Provenienz: Gräfin Luise Erdödy, Schloss Novi Marof, Kroatien; Privatsammlung Baden-Württemberg. Literatur: Henry Thode (Hrsg.), Klassiker der Kunst, Bd. XV, Stuttgart/Leipzig 1909, S. 362 (vgl.). Limit: 10.000 € Abb. 93536: Pieter Mulier d.J. (1637 Haarlem – 1701 Mailand) Küstenlandschaft mit Hero und Leander. Um 1680. Öl auf Leinwand, doubliert. Unsign. Verso auf einem alten handschriftlichen Etikett «4675» num. sowie Auktionsvermerke. Altrest. H. 50,4, B. 61 cm. Echtheitsbestätigung: Prof. Marcel Roethlisberger, Experte für Pieter Mulier und Verfasser des Werkverzeichnisses, Genf, 10.04.2010, in Kopie. Prof. Roethlisberger beurteilt das Gemälde nach Betrachtung des Originals als authentisches und typisches Werk dieses bedeutenden Malers. Charakteristisch für das Œuvre Muliers ist neben der Wahl und Komposition der einzelnen Bildelemente - Küstenlandschaften mit zerklüfteten Felsen und hohen Bergen und aufgewühlter See, die Szenerie einrahmenden Bäume und sich teilweise bedrohlich auftürmenden Wolkenformationen in dramatischen Farbabstufungen von gelb bis violett auch die Ausführung der Figuren im Vordergrund, welche in Art und Weise der Darstellung mit denen seiner zeitgleich in Italien entstandenen Gemälde korrespondieren. Prof. Roethlisberger datiert das Werk anhand formaler und stilistischer Aspekte in die Schaffensphase um 1680. Provenienz: Privatsammlung Berlin. Limit: 16.000 € 8 Abb. 93543: Johann Georg Schütz (1755 Frankfurt a.M. – 1813 ebd.) Waldlandschaft mit Nymphen und Satyrn. Öl auf Leinwand, doubliert. Mitte u. sign. und 1787 dat. Altrest. H. 73,4, B. 60,3 cm. Johann Georg Schütz entstammte einer bekannten hessischen Malerfamilie. Er verbrachte viele Jahre zu Studienzwecken in Rom, wo ihn unter anderem eine enge Freundschaft mit dem Maler Jakob Philipp Hackert verband, dessen Einfluss in dem hier vorgestellten Werk noch deutlich spürbar ist. Mythologische Themen, wie dasjenige der Nymphen und Satyrn, erfreuten sich seit der Renaissance großer Beliebtheit, boten sie doch den Malern die Gelegenheit, auch erotische Bildinhalte zu thematisieren. Provenienz: Privatsammlung Berlin. Limit: 15.000 € Abb. 93589: Jean Ulrich Tournier (1802 Illzach – 1882 Mühlhausen) Traubenstillleben in einer Mauernische mit Spatzen. Öl auf Leinwand, doubliert. U.r. sign. und 1824 dat. Verso auf dem Keilrahmen ein Galerieetikett, bez. mit den Lebensdaten des Künstlers und bet. Altrest. H. 102,5, B. 70,5 cm. Der zu Lebzeiten hoch geschätzte und heute zu Unrecht weitgehend in Vergessenheit geratene Stilllebenmaler Jean Ulrich Tournier schuf dieses mit meisterlicher Präzision ausgeführte Werk im Alter von nur 22 Jahren. Dabei zitiert er Bildelemente der niederländischen Stilllebenmalerei des 16. und 17. Jahrhunderts, ohne jedoch auf ihren ursprünglichen ikonographischen Zusammenhang Bezug zu nehmen, und komponiert sie unter rein dekorativen Gesichtspunkten zu einem Ensemble von bestechender Schönheit. Besonders deutlich ist die Freude des Malers an der Charakterisierung unterschiedlicher Oberflächen erkennbar. So wird die malerisch äußerst gekonnte Darstellung der leicht flaumigen Haut der Pfirsiche dem glatten, teilweise bestäubten Glanz der Trauben gegenübergestellt. Provenienz: Kunsthaus Bühler, Stuttgart; Privatsammlung Frankreich. Limit: 48.000 € Abb. 93590: Jacob de Wit (1695 Amsterdam – 1754 ebd.) Zwei Grisaillen mit Darstellungen von Putti. Öl auf Leinwand, doubliert. Unsign. Altrest. H. 77, B. 83,7 bzw. H. 86,8, B. 79,4 cm. Ungerahmt. Jakob de Wit war bereits zu Lebzeiten vor allem für seine Trompe-l'oeil-Dekorationsmalereien bekannt und bis weit über die Grenzen der Niederlande hinaus hoch geschätzt. Dabei erreichte er höchste künstlerische Fertigkeiten in der Darstellung meist allegorischer Motive, häufig mit Putti bevölkerte Szenerien, die er in Öl auf Leinwand ausführte. Dabei verstand er es, in feinsten Grauabstufungen meisterlich und täuschend realistisch Steinreliefs zu imitieren, die dem Betrachter wie vollplastische Stuckaturen erschienen. Ursprünglich waren diese Gemälde Bestandteil der Wanddekoration und häufig als Supraporten in Vertäfelungen integriert. Provenienz: Galerie Dr. Schenk, Zürich; Privatsammlung Deutschland; Koller Auktionen, Zürich, 18.03.1999, Los 98; Privatsammlung Frankreich. Limit: 20.000 € 9 Abb. 93598: Konrad Klapheck (Geb. 1935 Düsseldorf, lebt und arbeitet in Düsseldorf) «Der Eroberer». Öl auf Leinwand. Verso Mitte sign. Verso auf der Rückwand auf einem eigenhändigen Etikett des Künstlers 1989 dat., bez. mit dem Namenszug, bet., mit Angabe der Technik und der Maße sowie genauen Anweisungen bezüglich der Handhabung des Werkes. Darüber auf einem Etikett der Kunstspedition Hasenkamp bez. mit dem Ausstellungstitel, Datum und Ort sowie den Angaben zum Werk. H. 66, B. 80 cm. Künstlerrahmung. Laut der freundlichen Auskunft des Künstlers handelt es sich um das Abbild eines Schuhs des ehemaligen italienischen Diktators Benito Mussolini, welcher als Ausstellungsstück in einem Schuhmuseum präsentiert wurde. Das hier zum Aufruf kommende Gemälde steht geradezu beispielhaft für den charakteristischen Malstil Konrad Klaphecks, welcher Merkmale des NeoRealismus, Surrealismus und der Pop Art zu einer oft monumentalen Objektmalerei vereint. Die dargestellten und oft alltäglichen Gegenstände, wie beispielsweise Schreibmaschinen, Nähmaschinen, Wasserhähne, Telefone, Bügeleisen und eben auch Schuhe oder Schuhspanner, sind in einer faszinierenden Detailgenauigkeit und technischen Exaktheit porträtiert und werden in Kombination mit den einprägsamen Titeln der Werke, beispielsweise «Die Gewalt der Dinge», «Das Orakel» oder in diesem Falle «Der Eroberer», zu Darstellern und surrealistischen Personen. Photo-Zertifikat: vom Künstler signierte Photographie des Werkes und beiliegender Brief mit Angaben zum Kunstwerk, Düsseldorf, 19.04.2014. Provenienz: Galerie Lelong, Paris; seitdem Privatbesitz Freiburg i.Br. Ausstellung: Die verlassenen Schuhe, Bonn, Rheinisches Landesmuseum, 1993/94, S. 35. Limit: 60.000 € 10