Die Kunst vom Wahn- und Wahrsagen: Orakelheiligtümer in der
Werbung
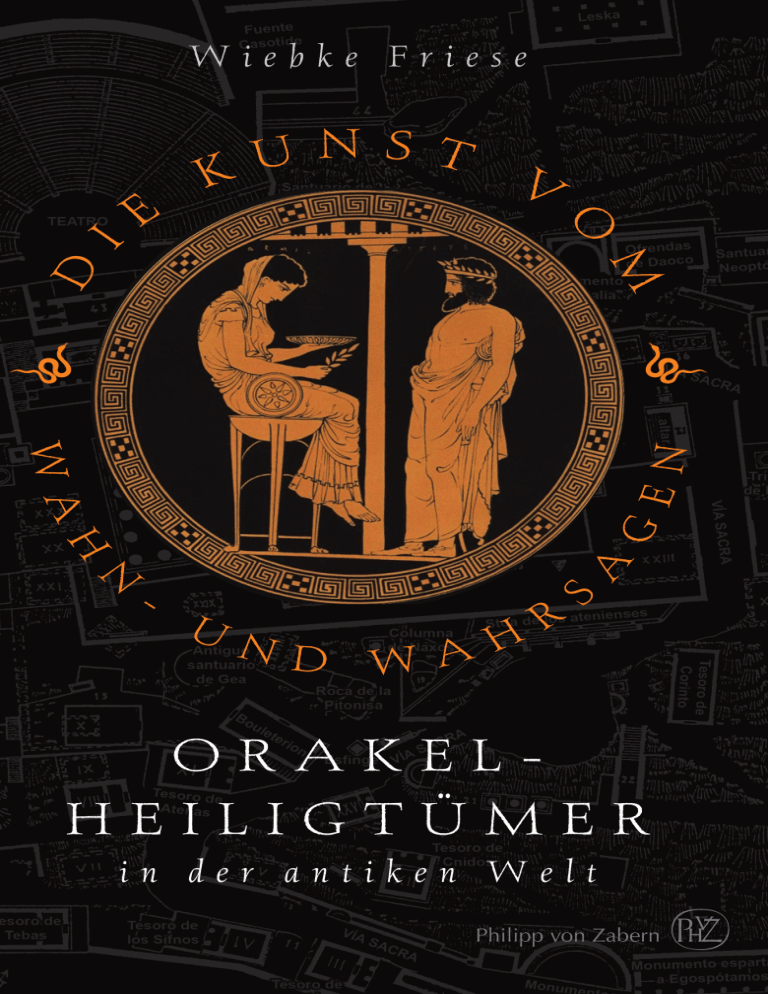
Abb. 2: Tempel des Amun. Oase Siwa. Frontansicht. traditionellen altägyptischen Orakelformen in Vergessenheit gerieten. Besonders in den großen Orakelzentren Ägyptens, wie Theben oder Siwa, scheint das Barkenorakel immer noch präsent gewesen zu sein. Doch gerade im Bereich der nicht offiziellen Orakel gab es nun weit mehr Bedarf als früher. Spätestens seit dem 5. Jh. v. Chr. traten als Vertreter dieser neuen Glaubenshaltung besonders heilige Tiere als Orakelgeber hervor. Diese galten bereits im Alten Reich als Mittler zwischen Gott und Menschen. Neben den eher regionalen Orakeltieren wie dem Ibis aus Kasr El-Auguz, dem Widder von Médamoud oder dem Lamm von Bocchoris war das wichtigste vergöttlichte Tier der Apisstier. Dieser lebte in seinem Heiligtum bei Memphis, bis er eines natürlichen Todes starb und innerhalb von 70 Tagen einbalsamiert und in den Katakomben des Sarapisheiligtums von Saqqara bestattet wurde. Zu Lebzeiten des Tieres befragte man ihn, indem ein Priester das Verhalten des heiligen Stieres beobachtete. Entweder entschied das Tier durch die Wahl eines bestimmten Stalles oder aber durch das Annehmen oder Ablehnen des ihm gegebenen Futters. Daneben war es auch üblich, am Grab des verstorbenen Vorgängerstieres zu nächtigen und auf ein Traumorakel zu hoffen (Inkubation). In Saqquara schliefen die ­Klienten vermutlich in dem von Bäumen beschatteten Hof des Heiligtums, nachdem sie die Frage schriftlich in einer Kapelle neben dem Eingang zu den Katakomben niedergelegt hatten. 17 Beim Tempelschlaf war es vor allem wichtig, den Göttern oder zumindest ihren Statuen so nahe wie möglich zu sein. Da aber ein normaler Ägypter auch in hellenistischer Zeit den Tempel der alten Götter immer noch nicht betreten durfte, legte man sich zum Schlafen kurzerhand an die Rückwand des hintersten Tempelraumes, denn hinter dieser befand sich in der Regel die Kultstatue des Gottes. Im Laufe der Zeit wurden an diesen Wänden so genannte Gegenkapellen errichtet. Dies waren meistens ­kioskartige Anbauten mit Reliefs der im Inneren aufbewahrten Götter. In dieser Form finden sie sich z. B. bei fast allen Haupttempeln in Karnak. Wie noch heute an den Wänden mancher katholischer oder griechisch-­ orthodoxer Kirchen konnten die Ratsuchenden hier ihre Fragen, Sorgen und Wünsche in den Stein ritzen oder auf Blechtäfelchen geschrieben ­anbringen. Typisch für diesen Orakeltyp war außerdem eine Öffnung in der Mauer, die zwar in der Regel zu hoch war, um ins Heiligtum blicken zu können, aber zumindest den Anschein verlieh, der Gott könne das zu ihm Gesagte auch tatsächlich erhören. Beispiele für eine solche Verbindung ­finden sich im Sarapistempel von Shenhur am Ostufer des Nils ebenso wie im Sarapis­tempel der Oase Kysis.. Wie in Griechenland galt der Tempelschlaf häufig der Heilung von Krankheiten. Spätestens seit hellenistischer Zeit entstanden in ägyptischen Heiligtümern, allen voran dem Hathortempel von Dendera, eigens errichtete so genannte Sanatorien, in denen die Kranken wie in den griechischen Asklepiosheiligtümern nicht nur schliefen, sondern auch heilendes Wasser tranken und von medizinisch geschulten Priestern behandelt wurden. Vor allem Sarapis wurde als bedeutender Heil- und Orakelgott verehrt. Zunächst hervorgegangen aus einer Verschmelzung der ägyptischen Götter Osiris und Apis übernahm er bald die Eigenschaften von vielen griechischen Göttern, allen voran von Zeus und dem Heilgott Asklepios. Ptolemaios I. (367–283 v. Chr.) ließ auf einen Traumbefehl hin die Statue des Pluto aus Sinope nach Alexandria bringen, wo er als neuer Gott Sarapis wirken sollte (Tac. hist. 4,83). Seine bedeutendsten Heiligtümer lagen in Memphis, Alexandria und in Kanopos im Nildelta. Mit seinen malerischen Gärten und Kanälen war Letzteres zugleich auch ein beliebtes Ausflugsziel alexandrinischer Lustreisender. Neu an diesem hellenisierten Gott war, dass nicht nur seine weitläufigen Tempelanlagen, sondern auch das Allerheiligste von einem Gläubigen betreten, ja sogar die Statue selbst berührt werden durfte. So galt es als glückbringend, am Ende einer Pilgerreise ins Sarapisheiligtum von Alexandria den Fuß der riesenhaften Götterstatue zu berühren. Und nicht nur das – sie soll besonders wichtigen Bittstellern sogar aus ihrem eigenen Mund geantwortet haben. Glaubt man den bissigen Stimmen der frühchristlichen Kirchenväter, war dies natürlich alles nur Betrug. Der alexan18 drinische ­Bischof Theophilus berichtet etwa, dass sich die Priester in der ausgehöhlten Statue versteckten, um durch deren geöffneten Mund die Fragenden zu täuschen (Theod. hist. eccl. 5.23). Archäologisch lässt sich dieser Betrug nur selten belegen. Eine mit einer sprechenden Apisstatue in Verbindung gebrachte Apparatur wurde etwa in Kom el-Wist gefunden. Neben und hinter einer Kultkapelle wurde eine Statuenbasis mit vier Standlöchern gefunden, die in Verbindung mit einem engen Metallrohr stand. Hinter der Apsis versteckt könnte ein Priester mit Hilfe des Rohres eine vierbeinige Statue auf dem Sockel „zum Sprechen gebracht“ haben. Möglich ist natürlich auch, dass sich die Priester, wie im Amunorakel von Siwa, in kleinen Kammern neben, über oder im Allerheiligsten selbst versteckten und von da aus die Stimme des Gottes imitierten. Dennoch scheint diese Methode eher eine Ausnahme von der üblichen Praxis des Tempelschlafes gewesen zu sein. 19 Griechische Orakel Im 2. Jt. v. Chr., zu einer Zeit also, als viele Menschen im Zweistromland und in Ägypten bereits in großen Städte lebten, ihren Göttern und Herrschern riesige Tempel und Paläste errichteten und der Kult wie auch das Orakelwesen bereits eng an das Staatswesen gekoppelt waren, herrschte in Griechenland eine kriegerische aristokratisch organisierte Kultur – die ­Mykener. Dank ihrer waffentechnischen Überlegenheit war es ihnen gelungen, die eingesessene Bevölkerung Griechenlands zu unterjochen und als Leibeigene zu verdingen. Durch Fernhandel, aber auch Piraterie und Sklavenhandel ­kamen sie bald zu unübersehbarem Reichtum, den sie in stark befestigten Palastanlagen zum Ausdruck brachten. Ihre Architektur wie ihre gesamte Kultur scheint stark von den kretischen Minoern, aber auch den Ägyptern beeinflusst zu sein. Dennoch – ob es bereits zu mykenischer Zeit eine Orakelkultur in Griechenland gegeben hat, ist umstritten. Zwar wurde im so genannten mykenischen Tempel II von Kition auf Zypern eine Bronzeleber mit Orakelinschriften aus dem 12. Jh. v. Chr. entdeckt. Ähnliche Beispiele stammen aus dem Haus eines Priesters auf der Akropolis von Ras Shamra, wo sie im Kontext mit ugaritischen Texten und mykenischen Rhyta aus dem 14/13. Jh. v. Chr. gefunden wurden. Beide Städte waren jedoch bedeutende mykenische Handelsniederlassungen im Ausland und auch wenn die Orakelgegenstände beweisen, dass die Mykener zumindest mit der östlichen Tradition der Eingeweideschau vertraut waren, können wir ohne weitere Funde vom griechischen Festland nicht davon ausgehen, dass die Mykener sie auch in ihrem Heimatland etabliert hatten. Dasselbe gilt für das viel­ gerühmte Orakel von Delphi. Zwar sind die frühesten Funde, die bei den Ausgrabungen ans Licht gebracht wurden, in mykenische Zeit zu datieren – bis man aber mit Sicherheit von einem florierenden Orakelkult an diesem Ort sprechen kann, sollten noch viele Jahrhunderte vergehen. Der Ruf des Phoebus Das Orakel von Delphi und die Weissagungen der Pythia „Der Herr, dem das Orakel von Delphi gehört, sagt nicht und verbirgt nicht, er deutet an“ (Plut. 21,404b), erklärte der Apollonpriester und Schriftsteller Plutarch im Jahre 95 n. Chr. einem Freund bei einem Rundgang durch das delphische Heiligtum. Erst kurz zuvor war er über das Parnassgebirge aus dem etwa 45 km westlich gelegenen Charoneia angereist, 20 wo er 50 Jahren zuvor geboren worden war und wo er immer noch mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen lebte. Für die kommenden 30 Jahre sollte er nun als einer der beiden Hauptpriester seinen Dienst in einem der berühmtesten Orakel der Welt verrichten. Der Blick, der sich dem Schriftsteller dabei von seiner Wirkungsstätte, dem Tempel des Apollon, aus bot, war sicherlich nicht weniger beeindruckend als heute. Über mehrere Terrassen schmiegt sich das Heiligtum auf etwa 550 m Höhe an den steilen Hang über der Pleistosebene mit ihren weiten Olivenhainen und frucht­ baren Weiden (Abb. 3). In der Ferne sieht man auch heute noch den Hafen von Itea und dahinter die spiegelnde Weite des Golfs von Korinth. Wie aber können wir uns Plutarchs priesterliche Wirkungsstätte zu seiner Zeit vorstellen? Das Heiligtum Obwohl die ersten Siedlungsspuren bereits aus mykenischer Zeit stammen, ist der Tempel des Apollon mit seiner „schön fließenden Quelle“ erst in den homerischen Hymnen aus dem 7. Jh. v. Chr. erwähnt (Hom. h. 287). Ob der Kult damals bereits ein Orakel enthielt und wie es aussah, ist nicht bekannt. Bis in die römische Zeit lassen uns die schriftlichen Quellen hierüber weitgehend im Unklaren. Herodot stellte im 5. Jh. v. Chr. die Weissagungen der Pythia in ihrer Bedeutung zwar bereits über alle anderen griechischen Orakelheiligtümer (Hdt. 1,51), über das Aussehen des Heiligtums selbst aber berichtet er nur wenig (Hdt. 2,180 und 5,62). Euripides erwähnt kurze Zeit später immerhin einen heiligen Hain und die Kastaliaquelle sowie das Tempeladyton als Ort der Weissagung (Eur. Ion 144–149). Pindar schließlich überliefert einen recht phantastischen Mythos über die vier ersten Tempel Delphis, von denen der erste aus Lorbeerzweigen, der zweite von Vögeln und Bienen aus Wachs und Federn, der dritte von den Göttern aus Bronze und der vierte schließlich von Menschenhand aus Stein gearbeitet war (Pind. P 8,58). Aber erst in nachchristlicher Zeit erschließt sich mit den römischen Reiseschriftstellern Strabo und Pausanias ein heute rekonstruierbares Erscheinungsbild der delphischen Kultstätte (Strab. 8,6,14 und Paus. 10,5). Ihre Beschreibungen waren es auch, die seit dem 15. Jh. immer wieder Abenteuerlustige aus aller Welt in die unwirtliche Gegend um den Parnass trieben. Doch was sie dort sahen, enttäuschte die meisten: Neben dem Stadion, der Kastaliaquelle und einigen zerstreuten Trümmern hatte sich von Delphis einstigem Glanz nichts erhalten. Die meisten der antiken Quadersteine waren in den Häusern des kleinen Dorfes Kastri (griech. Festung) verbaut, das sich über den Ruinen des Heiligtums erhob. In den Resten des Stadions weideten die Bewohner ihre Schafe. Nur die Mönche des kleinen 21
