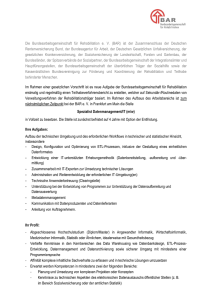2.2.4 Rehabilitation und Krebs
Werbung

2.2.4 | 1 Bedarfsorientierte Rehabilitation von Tumorpatienten nach Primärtherapie – was ist ambulant möglich, was ist stationär nötig? H.H. Bartsch, Klinik für Onkologische Rehabilitation und Nachsorge der Klinik für Tumorbiologie an der AlbertLudwigs-Universität Freiburg i.Br. Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen für onkologische Patienten werden in Deutschland zum überwiegenden Teil als stationäre Verfahren durchgeführt. Dies ist auf die seit Ende der 50iger Jahre entwickelten stationären Versorgungsstrukturen zurückzuführen. Bereits in dem Ergebnisbericht der VDR-Expertise «Krebsrehabilitation in der Bundesrepublik Deutschland» wurde 1995 festgestellt, dass sich die ambulante Betreuung von Tumorpatienten auf die sog. standardisierte Nachsorge oder gezielte therapeutische Interventionen (z.B. Chemotherapie etc.) konzentriert. Eigentliche ambulante Rehabilitationsstrategien waren nirgendwo zu erkennen. Durch die Diskussion zur Flexibilisierung medizinischer Rehabilitationsleistungen für Tumorpatienten wurden zunächst Modellprojekte ambulanter Rehabilitationsverfahren initiiert, im weiteren Verlauf entsprechend qualifizierte onkologische Rehakliniken zur teilstationären bzw. ambulanten Rehabilitation ermächtigt. Nach den bisherigen Erfahrungen werden die ambulanten Angebote jedoch nur von einem geringen Prozentsatz der Patienten in Anspruch genommen. Die Ursachen hierfür sind auf verschiedenen Ebenen zu suchen. Je nach Ausmaß der Folgestörungen auf die primäre Tumortherapie benötigt ein Teil der Patienten noch intensive ärztliche und/oder pflegerische Weiterbetreuung. Weiterhin möchten Patienten direkt nach Entlassung aus der Akutklinik nicht die zusätzlichen Belastungen durch tägliche Fahrt zur Rehaeinrichtung sowie Teilversorgung des Haushaltes auf sich nehmen. Einen wesentlichen Aspekt dürfte aber auch das Informationsdefizit über die Möglichkeit teilstationärer/ambulanter Angebote und die Unsicherheit der Zuordnung zu dem einen oder anderen Verfahren auf Seiten der Primärbehandler darstellen. In dem Beitrag wird auf typische Situationen von Tumorpatienten nach Primärtherapie eingegangen und versucht, eine bedarfsorientierte Leitlinie für die Empfehlung zu den verschiedenen medizinischen und psychosozialen Rehabilitationsmaßnahmen zu geben. 2.2.4 | 2 Strategien und Erfahrungen in der Rehabilitation von Patienten nach hämatologischer Stammzelltransplantation A. Mumm, Klinik für Onkologische Rehabilitation und Nachsorge der Klinik für Tumorbiologie an der AlbertLudwigs-Universität Freiburg i.Br. Seit 1993 wurden an der Klinik für Onkologische Rehabilitation und Nachsorge der Klinik für Tumorbiologie über 600 Patienten nach hämatologischer Stammzelltransplantation (HSCT) nachbetreut; ca. 50% davon nach allogener Transplantation. Das Spektrum der Grunderkrankung entspricht der in der Literatur zu findenden Verteilung großer Transplantationszentren, bzw. veröffentlichter Registerdaten. Die Mehrzahl der Patienten befindet sich in der Intermediärphase, d.h. vor Tag +100 nach HSCT. Beschrieben wird der Ablauf des primären Assessments in den Bereichen Medizin, Ernährung, Krankengymnastik / Sporttherapie, Psychologie / Neuropsychologie und Krankenpflege. Neben verbreiteten Angeboten der onkologischen Rehabilitation wurden für diese Patientengruppen spezialisierte Therapieangebote etabliert. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Formen eines kognitiv-neuropsychologischen Trainings, um ein spezielles, gerätegestütztes Ange- 26 bot zum «Muskelaufbautraining» im Rahmen der Sporttherapie und um eine Gesprächsgruppe zum Bereich Ernährung sowie um eine themenzentrierte Gesprächsgruppe mit den Schwerpunkten Langzeitfolgen nach HSCT, Verhaltensempfehlungen im häuslichen und außerhäuslichen Bereich sowie zu psychosozialen Problemen und zu sozialrechtlichen Fragen. Wie andere intensiv-medizinisch behandelte Patienten leiden HSCT-Patienten häufig an charakteristischen somato-psychischen Folgestörungen. Hierzu gehören Angststörungen, reaktive Verstimmungszustände, Fatigue, Rückzugstendenzen und eine zögerliche Zukunftsorientierung. Dargestellt werden Maßnahmen zur Sicherung in der Struktur und Prozessqualität. 2.2.4 | 3 Psychosoziale Strategien in der Rehabilitation onkologischer Patienten J. Weis, Psychosoziale Abteilung der Klinik für Tumorbiologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. Eine Krebserkrankung und deren Behandlung ist für viele Patienten durch eine Vielzahl psychosozialer Probleme bestimmt, die sich im Bereich psychischer Befindlichkeit, sozialer Einbettung, beruflicher Eingliederung sowie funktioneller Einschränkungen zeigen können. Viele Probleme treten erst nach Abschluss der Primärbehandlung auf und sind Ausdruck des Prozesses der versuchten Adaptation an die veränderte Lebenssituation. Eine wesentliche Aufgabe der Rehabilitation ist es, neben der medizinischen Behandlung auch psychosoziale Hilfestellungen anzubieten, um die Patienten in der Bewältigung der krankheits- oder behandlungsbedingten Probleme zu unterstützen. Zentrale Zielsetzungen dieser psychosozialen Maßnahmen liegen neben der Verbesserung der Lebensqualität und des individuellen Wohlbefindens allgemein in der Vermittlung von Selbstkontrolltechniken sowie Selbsthilfemöglichkeiten, in der Verbesserung von Funktions- und Fähigkeitsstörungen (bspw. neuropsychologische Leistungseinschränkung) sowie in einer auf die Probleme von Krebspatienten ausgerichteten Gesundheitsförderung. Obwohl die psychosoziale Betreuung und Behandlung gerade in der Rehabilitation immer als eine interdisziplinäre Aufgabe des gesamten Rehabilitationsteams zu verstehen ist, sind fachspezifische Kompetenzen gerade im Bereich der Psychoonkologie gefordert. In den letzten Jahrzehnten ist eine Reihe von spezifischen psychoonkologischen Behandlungsmaßnahmen entwickelt worden, die auch Eingang in die Rehabilitationsprogramme gefunden haben. Der Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten psychosozialen Behandlungsstrategien in der Rehabilitation, wobei die wesentlichen Elemente der psychosozialen Behandlungsansätze und der Gesundheitsförderung erläutert und neuere Forschungsergebnisse zur Evaluation dieser Interventionen vorgestellt werden. Es wird ausgeführt, dass in der Interventionsforschung als einem wichtigen Teil der Rehabilitationswissenschaft zentrale Forschungsfragen im Bereich der Indikationsstellung, einer bedarfsgerechten Zuweisung, der Bedeutung von Patientenmotivation, der Prozessevaluation sowie der Effektivitätsbeurteilung liegen. Abschließend werden die wichtigsten Forschungsdesiderata erörtert und zukünftige Forschungsaufgaben der psychosozialen Rehabilitation skizziert. 2.2.4 | 4 Prognoseadaptierte Nachsorge in der ambulanten Praxis – Wunsch und Realität? T. Reiber, Onkologische Schwerpunktpraxis, Freiburg i.Br. Ziele der Onkologischen Nachsorge sind 1. Aufdeckung der Tumorprogredienz mit der Frage der Weiterbehandlungsmöglichkeiten, 2. Evaluation der Primärtherapie zur Qualitätssicherung, 3. Medizinische Betreuung zur Rehabilitation und Erhaltung der Autonomie der Patienten. Downloaded by: 88.99.70.242 - 11/3/2017 1:24:24 AM 2.2.4 Rehabilitation und KrebsNachsorge 2.2.4 | 5 Stellenwert der MR-Diagnostik in der ambulanten Nachsorge bei Patientinnen mit Mammakarzinom M. Bauer, Niedergelassener Frauenarzt und Radiologe, Freiburg i.Br. Im Rahmen der Nachsorge nach Mammakarzinom hat die lokale Überwachung zentrale Bedeutung. Brusterhaltende Behandlungsverfahren stellen dabei hohe Anforderungen an die komplementäre Mammadiagnostik, da operative Narben und strahlenbedingte Veränderungen die frühe Rezidiventdeckung erschweren. Die dynamische Kernspintomographie unter Verwendung des paramagnetischen Kontrastmittels Gd-DTPA hat das diagnostische Spektrum erweitert. Aufgrund schneller FLASH-3D-Sequenzen und der Darstellung der Kontrastmitteldynamik im Zeitverlauf von ca. 6 Minuten kann heute eine gute Abgrenzung zwischen operativ bedingter Narbe und neu aufgetretenem invasivem bzw. In-situ-Karzinom erreicht werden. Heute stellt die Kernspintomographie nach BET bei der schwer beurteilbaren Mamma und zur Differenzierung von Narbe vs. Rezidiv das Verfahren der Wahl dar und kann bereits 6 Monate nach der Operation aussagekräftig eingesetzt werden. Bei radikal operierten Frauen mit Wiederaufbau mittels Implantat umfasst die dynamische Kernspintomographie einschließlich spezieller Silicon-Sequenzen die Diagnostik von Rezidiv, Narbe, Implantatdefekten, Siliconleckagen und ist der konventionellen Diagnostik in Ihrer Aussagekraft überlegen. Die dynamische Kernspintomographie ist heute bei der Diagnostik nach einer Operation der Mamma unverzichtbar geworden. Sie ist das Verfahren der Wahl bei der Rezidivdiagnostik und der Beurteilung von Implantaten. 2.2.5 Pädiatrische Onkologie 2.2.5 | 1 Retinoblastom. Ein Fallbeispiel T. Rogge, C. Niemeyer, Abt. Allg. Kinderheilkunde mit Poliklinik, Universitäts-Kinderklinik Freiburg i.Br. Im Rahmen der Sitzung über genetische Prädisposition für Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter stellen wir die Krankengeschichte eines Neugeborenen mit der Diagnose eines hereditären Retinoblastoms des rechten Auges vor. Der Vater des Jungen verlor wegen beidseitiger Retinoblastome durch Enukleationen im Alter von einem Jahr sein Augenlicht. Wegen dieser Anamnese wurde das Kind direkt postnatal untersucht. Der Befund im rechten Auge zeigte einen parapapillären bis in die Papille reichenden Tumor. Es wurde die Diagnose eines hereditären Retinoblastoms des rechten Auges gestellt. Unter der Vorstellung von zusätzlichen Mikroläsionen wurde eine Woche nach Diagnosestellung mit der Durchführung einer Chemotherapie begonnen (Cyclophosphamid, Vincristin, Carboplatin). An diese Therapie schloss sich eine Laserkoagulation des Tumors an. Die Chemotherapie wurde mit fünf weiteren Blöcken über einen Zeitraum von sechs Monaten fortgesetzt. Wegen neu aufgetretener Läsionen beidseits musste wiederholt eine Lokaltherapie mit Laserkoagulationen fortgeführt werden. Ein Jahr nach Beendigung der Chemotherapie und sechs Monate nach der letzten Lasertherapie gibt es keinen Hinweis für Tumorrezidive. Wegen der initialen Tumorlage zeigt das rechte Auge einen Ausfall des unteren Drittels des Gesichtsfeldes. Das linke Auge ist vollständig sehfähig. Der Junge zeigt eine altersgerechte Entwicklung. Die Kontrolluntersuchungen der Augen werden zur Zeit in vierwöchigen Abständen fortgesetzt. 2.2.5 | 2 Genetik des Retinoblastoms: Die Wiege der 2-Hit-Theorie G. Scherer, Institut für Humangenetik und Anthropologie, Universitätsklinikum Freiburg i.Br. Das Retinoblastom, ein von undifferenzierten Retinazellen ausgehender Tumor des Säuglings- und frühen Kindesalters und der häufigste Tumor des Auges in dieser Altersgruppe, existiert in zwei Formen. Beim sporadischen Retinoblastom ist nur ein Familienmitglied betroffen, der Tumor ist meist unilateral und tritt etwas später auf. Beim familiären, autosomaldominant vererbten Retinoblastom sind mehrere Familienmitglieder in aufeinanderfolgenden Generationen betroffen, die meist multiplen Tumoren sind gewöhnlich bilateral und treten früher auf. Zur Erklärung der unterschiedlichen Zahl an Tumoren beim sporadischen versus familiären Retinoblastom formulierte Alfred Knudson bereits 1971 seine berühmte «2-Hit-Hypothese». Sie besagt, dass beim familiären (hereditären) Retinoblastom durch eine frühere Keimbahnmutation ein Allel eines autosomalen Tumorsuppressorgens bereits inaktiviert vorliegt (first hit), und dass das Auftreten der Tumoren dann aus der Inaktivierung des zweiten Allels durch eine weitere, somatische Mutation in Retinazellen resultiert (second hit). Beim sporadischen (meist nicht-hereditären) Retinoblastom müssen nach diesem Modell beide Allele in einer einzelnen Retinazelle durch somatische Mutation inaktiviert werden, ohne vorausgehende Keimbahnmutation. Aus diesem Modell ergibt sich das scheinbare Paradox, dass die Vererbung der Prädisposition zum Retinoblastom dominant ist während der eigentliche Mechanismus der Tumorentwicklung auf zellulärer Ebene rezessiv ist. Die Entstehung von Knudsons «2-Hit-Hypothese», deren Schlussfolgerungen durch die nachfolgende Forschung am Retinoblastom glänzend bestätigt wurden und sie in den Status einer allgemein akzeptierten «2-Hit-Theorie» der Tumorgenese des Retinoblastoms erheben, wird nachgezeichnet. 27 Downloaded by: 88.99.70.242 - 11/3/2017 1:24:24 AM Zu 1: Eine Verbesserung der bildgebenden und serologischen Diagnostik ermöglicht eine frühere Rezidiverkennung. Dies hilft den Patienten, wenn sich eine erneute Kurationschance ergibt. Rezidive akuter Leukämien, hoch maligner Lymphome, bei Morbus Hodgkin oder Keimzelltumoren sind so zu betrachten, außerdem führt die Resektion von Solitärmetastasen bei Melanomen, Kolonkarzinomen oder Weichteilsarkomen manchmal zu Langzeitremissionen. Für die Mehrzahl der Patienten ergibt sich aus der Früherkennung des Rezidivs lediglich eine Verlängerung der «lead time»: dies bedeutet keine Verlängerung der Überlebenszeit, lediglich Verlängerung des Wissens um eine inkurable Situation. Zu 2: Eine umfassende Dokumentation des Patientenschicksals nach der primären onkologischen Therapie ist für den Erstbehandler unabdingbar. Sinnvoll wäre die Einführung klinischer Krebsregister als Verbesserung der bislang nur regional eingesetzten epidemiologischen Register (Todesursachenstatistik). Zu 3: Wunsch und Realität der onkologischen Nachsorge unterscheiden sich für den behandelnden Arzt in der Praxis insofern, als den Patienten mit der nüchternen Durchführung der Diagnostik gemäß den Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft (sofern vorhanden) nicht Genüge getan ist. Die Diagnose Krebs bedeutet für die meisten Betroffenen eine erhebliche Verunsicherung in ihrer Selbstsicherheit und hinterlässt Angst. Dies spiegelt sich auch in dem zwiespältigen Verhältnis der Betroffenen gegenüber den Nachsorgeterminen: einerseits baut sich vor jedem Termin eine erhebliche Spannung vor dem neuen Ergebnis auf, andererseits besteht der Wunsch nach Gewissheit. Dieses Spannungsfeld kann der nachsorgende Arzt/Ärztin durch Zuhören und individuelle Beratung/ Information zu lösen helfen.