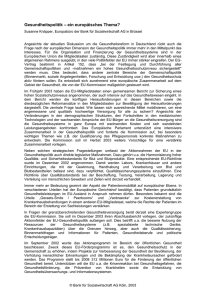Grenzenlos gesund?
Werbung

Schwerpunkt Gesundheitspolitik in der EU Grenzenlos gesund? Von Petra Spielberg I mmer noch müssen Patienten, die sich zu einer Behandlung im EU-Ausland entschließen, mitunter große Schwierigkeiten überwinden. Bürokratie, Misstrauen in die ärztliche Kunst ausländischer Spezialisten sowie abschlägige Bescheide für die Übernahme der Kosten einer Behandlung im Ausland können die Freizügigkeit der Patienten behindern. Und das, obwohl ihnen dieses Recht nach dem EG-Vertrag zusteht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat dies ebenso wie die grundsätzliche Pflicht der Krankenkassen, die Kosten für eine Auslandsbehandlung zu übernehmen, mehrfach bestätigt. Vor sechs Jahren stellten Ärzte bei Marie Fjellerup Brustkrebs fest. Die Operation und die anschließende Chemotherapie verliefen erfolgreich. Drei Jahre später aber hatten sich in Leber und Hüfte der Dänin Metastasen gebildet. Die Ärzte vom Herlev Klinikum bei Kopenhagen behandelten Marie Fjellerup erneut mit Chemotherapien. Doch der Krebs schritt voran. Die Bitte der Patientin, es mit einer anderen Therapie zu versuchen, wurde abgelehnt. Marie Fjellerup wandte sich in ihrer Verzweiflung schließlich an die Krebsspezialisten der Universitätsklinik Frankfurt am Main. Dort riet man ihr zu einer Kombination aus Chemo- und Laserinduzierter Thermotherapie. Die zuständige dänische Behörde lehnte jedoch eine Übernahme der Kosten für die Auslandsbehandlung ab. Marie Fjellerup verkaufte ihr Auto und lieh sich von Freunden Geld, um sich privat in Frankfurt behandeln zu lassen. Im Oktober 2006 begannen die Ärzte der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität mit der Therapie. Das Wunder geschah. Nach wenigen Monaten verschwanden die Metastasen. Seit Sommer letzten Jahres ist der Krebs nicht wieder zurückgekehrt. Auch der bürokratische Kleinkrieg mit den dänischen Behörden fand ein glückliches Ende. Die zuständige Kommune kam, vom Erfolg der Behandlung überzeugt, schließlich doch noch für die Kosten auf. „Ich hoffe, dass meine Erfahrung auch anderen Patienten Mut macht, sich im Ausland behandeln zu lassen, wenn sie in MDK-Forum 3/2008 2 ihrer Heimat nicht die medizinische Versorgung bekommen können, die sie sich wünschen“, sagt Marie Fjellerup heute. BSE brachte die Wende in der Gesundheitspolitik In mehr als der Hälfte der 27 EULänder, so eine Kommissionsbeamtin, werde das Recht auf Auslandsbehandlung aber nach wie vor mit Füßen getreten. Heißt das zugleich, dass die Staaten eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung für überflüssig halten? Nein! Denn der Schutz der Gesundheit der knapp 480 Millionen EU-Bürger über Ländergrenzen hinweg hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Ein kleiner Rückblick macht dies deutlich: Bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) im Jahr 1957 spielte das Thema Gesundheit so gut wie keine Rolle. Ausnahme bildeten Maßnahmen zum Schutz von Arbeitnehmern. Mit Beginn der 90er Jahre unternahmen die EG-Länder erste zaghafte Anläufe, auch auf gesundheitspolitischem Gebiet enger zusammen zu arbeiten. So verpflichteten sich die Regierungen der Gemeinschaft mit dem Vertrag von Maastricht im Jahre 1992 erstmals, gemeinsame Anstrengungen zur vorbeugenden Bekämpfung bestimmter Krankheiten, wie Aids und Krebs zu unternehmen. „Auf den Treffen der für Gesundheit und Soziales zuständigen Minister spielten gesundheitliche Themen dennoch weiterhin keine große Rolle“, Schwerpunkt sagt Hans Stein, damals Ministerialrat im Bundesministerium für Gesundheit in Bonn. Die große Wende kam Mitte der 90er Jahre. Auslöser war die BSE-Krise, die von Großbritannien aus den europäischen Kontinent erfasst hatte. Schlagartig wurde den politisch Verantwortlichen in der EG klar, dass die immer enger werdenden wirtschaftlichen Verflechtungen und die zunehmende Mobilität der Arbeitnehmer auch mit erhöhten Gesundheitsgefahren einhergehen. Gesundheitsschutz ist fester Bestandteil der EU-Politik Ein weiteres Zusammenwachsen der Wirtschaftsgemeinschaft war ohne gezielte Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung nicht mehr denkbar. Die Zuständigkeiten und Aufgaben der Gemeinschaft in der Gesundheitspolitik wurden daher stetig ausgeweitet und vertraglich festgeschrieben. Ferner richtete die Europäische Kommission 1999 eine neue für Gesundheit und Verbraucherschutzthemen zuständige Abteilung ein: die Generaldirektion Sanco. Inzwischen ist der grenzüberschreitende Gesundheitsschutz ein fester Bestandteil der EUPolitik. Die Maßnahmen beschränken sich dabei nicht auf den eng umrissenen gesundheitspolitischen Aktionsradius der EU, der in erster Linie auf die Prävention von Krankheiten und die Koordinierung und Kontrolle der zwischenstaatlichen Aktivitäten abzielt. Auch andere Politikfelder, wie die Arbeits- und Beschäftigungspolitik, die Unternehmenspolitik, die Wettbewerbs- und Binnenmarktpolitik sowie die Forschungspolitik mischen beim Gesundheitsschutz mit. Beispiele hierfür sind Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkohol- und Nikotinmissbrauchs, gemeinschaftsweite Programme gegen Infektionser- krankungen oder Krebs sowie Initiativen gegen die zunehmende Fettleibigkeit der Europäer. Ferner regeln Gesetze, welche Qualitäts- und Sicherheitsstandards innerhalb der EU für Bluttransfusionen oder für den Umgang mit menschlichen Geweben und Zellen gelten. Ein entsprechendes Regelwerk für Organtransplantationen ist in Vorbereitung. Darüber hinaus gibt es EU-weit gültige Pestizidgrenzwerte für Babynahrung und solche für den Chemikaliengehalt in Kinderspielzeug. Eine weitere Verordnung regelt die Versorgung von Kindern mit Arzneimitteln usw. usf. Nicht alles macht indessen Sinn. „Manchmal“, so der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese, „schießt die EU-Kommission mit ihren Vorschlägen übers Ziel hinaus.“ Beispiel: Der jüngste Änderungsvorschlag der Behörde zur EU-Strahlenschutzrichtlinie. Die geplante Verschärfung des Gesetzes zum Schutz von Arbeitnehmern vor elektromagnetischen Feldern hätte nach Meinung von Ärzten den diagnostischen Einsatz der Magnetresonanztherapie in der Medizin unmöglich gemacht. Der zuständige EU-Kommissar Vladimir Spidla lenkte glücklicherweise ein und verschob die Neufassung. Großes Gefälle zwischen den Versorgungsniveaus Der einzelne Bürger kriegt von all dem meist wenig mit. Für ihn zählt in der Regel nur, dass er im Krankheitsfall eine optimale medizinische Betreuung erhält und das möglichst nahe an seinem Wohnort. Doch wie gut und wie schnell ein Patient versorgt wird, hängt – bei allen Bemühungen, den Gesundheitsschutz in der EU zu verbessern – entscheidend davon ab, wo er lebt. Denn die Kluft zwischen den gesundheitlichen Versorgungsniveaus der einzelnen EU-Länder ist nach wie vor groß. In Bul- 3 garien und Rumänien beispielsweise, den jüngsten EU-Mitgliedern, sterben etwa dreimal so viele Menschen an Herzkreislauferkrankungen wie im EUDurchschnitt. Ähnlich hoch sind die Zahl der Krebstoten sowie die Sterblichkeitsraten bei Säuglingen und jungen Müttern. Szenario prophezeit einheitliche Minimalversorgung für alle Der Grund: Welche Leistungen in welcher Qualität und zu welchem Preis zur Verfügung stehen, bestimmen die Regierungen der Länder. Die EU darf hier nicht mitreden. Das führt zu unterschiedlichen medizinischen Standards, beispielsweise bei der Behandlung von Brustkrebspatientinnen. „In Polen wird den erkrankten Frauen in 98 Prozent der Fälle die vom Tumor befallene Brust amputiert. In Frankreich dagegen behalten drei Viertel der Patientinnen ihre Brust“, berichtet Karin Jöns. Die SPD-Europaabgeordnete setzt sich seit Jahren intensiv für eine Verbesserung der Krebsversorgung in der EU ein. Glaubt man hingegen den Ergebnissen einer Studie des europäischen Beratungsunternehmens Health Consumer Powerhouse (HCP), dann wird sich die medizinische Betreuung in der EU in wenigen Jahren so weit angeglichen haben, dass auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen überall nur noch eine Basisversorgung zu vergleichbaren Qualitätsstandards zur Verfügung steht. Das jedenfalls prophezeien die befragten 130 Patientenorganisationen aus 24 europäischen Ländern. Auch werde es für die meisten EU-Bürger im Jahr 2020 selbstverständlich sein, notwendige medizinische Leistungen im Ausland nachzufragen, so ein weiteres Ergebnis der HCP-Studie. Noch aber sieht die Realität anders aus. Noch entfällt nur knapp ein Prozent aller Leistungen der Sozialversicherungssysteme in der EU auf Patienten MDK-Forum 3/2008 Schwerpunkt aus dem Ausland. Am meisten nachgefragt werden nach einer Umfrage der TK Baden-Württemberg Arzneimittel, gefolgt von Kuren, Heil- und Hilfsmitteln sowie Zahnersatz. Erst dann folgen ambulante Leistungen und Krankenhausbehandlungen. Am häufigsten nutzen Patienten, die in einer so genannten Euregio, dem Grenzgebiet zwischen zwei oder mehr europäischen Seit März 2008 im Amt: Androulla Vassiliou, EU-Kommissarin für Gesundheit aus Zypern Ländern, leben, medizinische Leistungsangebote im Ausland. In einer solchen Euregio, wie die im deutsch-niederländisch-belgischen Dreiländereck, garantieren Kooperationsabkommen zwischen niedergelassenen Ärzten, stationären Einrichtungen und den Kostenträgern dies- und jenseits der Grenzen einen reibungslosen Ablauf der medizinisch bedingten Auslandsaufenthalte. Mehr Rechte für die Patienten Gründe für die geringe Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen fern der Heimat sind zum einen sprachliche und psychologische Barrieren. Zum anderen blockiert die Weigerung von Kassen, eine Genehmigung für stationäre Leistungen zu erteilen MDK-Forum 3/2008 beziehungsweise die Kosten für Auslandsbehandlungen zu übernehmen, die Freizügigkeit der Patienten. Zahlreiche Beschwerden bei den europäischen Verbraucherzentralen belegen dies. Nach dem Willen der EU-Kommission soll damit bald Schluss sein. Anfang Juli hat die Behörde einen Richtlinienvorschlag vorgelegt, der die Rechte der Patienten in der EU stärken soll. Danach sollen die staatlichen Kostenträger grundsätzlich dazu verpflichtet werden, die Kosten für ambulante oder stationäre Auslandsbehandlungen zu übernehmen – und zwar in Höhe der heimischen Erstattungssätze. Grundlage hierfür bilden die Urteile des EuGH zur Patientenmobilität. Der Vorschlag sieht weiterhin vor, die Information der Versicherten über die medizinischen Versorgungsangebote und die Qualität der Leistungen zu verbessern. Ansprechpartner hierfür sollen nationale Kontaktstellen sein. Doch damit nicht genug. Denn die EU-Kommission will mit dem Regelwerk zugleich die Modernisierung der Gesundheitssysteme vorantreiben. So sollen sich die Mitgliedsländer unter anderem dazu verpflichten, Standards für die Qualität und Sicherheit medizinischer Behandlungen zu erstellen. Die Kommission will es sich zudem vorbehalten, zusammen mit Vertretern der Länder eine Liste „stationärer und hoch spezialisierter sowie kostenintensiver“ Leistungen zu erstellen, für deren grenzüberschreitende Inanspruchnahme die Patienten möglicherweise eine Vorabgenehmigung einholen müssten. Auch soll die Richtlinie innovativen Medizintechnologien und telemedizinischen Anwendungen zu mehr Akzeptanz verhelfen. Harmonisierung nein – Annäherung ja Dies alles soll nicht auf dem Wege der Harmonisierung geschehen, wie EU-Gesundheits- 4 kommissarin Androulla Vassiliou nicht müde wird zu betonen, wohl wissend, dass die EU damit ihren vertraglich festgeschriebenen Handlungsspielraum in der Gesundheitspolitik überschreiten würde. Zweifelsohne aber soll die Richtlinie dafür sorgen, dass sich die gesundheitlichen Versorgungsniveaus weiter annähern. Inwieweit es wirklich dazu kommt, lässt sich noch nicht absehen. Denn die von Europaabgeordneten und EU-Regierungen geäußerte Kritik, der Kommissionsvorschlag unterhöhle den Solidaritätsgedanken und gefährde die Stabilität der Gesundheitssysteme, lässt erahnen, dass die Mitgesetzgeber einige Vorschriften noch abmildern werden. Ebenfalls zweifelhaft ist, ob das geplante Regelwerk die geforderte Rechtssicherheit bei Auslandsbehandlungen bringen wird. Details des Vorschlags, wie die geplante Definition stationärer Leistungen und die damit verbundene Option, Vorabgenehmigungen zu verlangen, könnten vielmehr zu neuen Rechtsunsicherheiten führen. „Am Ende muss wieder der EuGH entscheiden“, so Hans Stein. Es liegt nun an den europäischen Mitgesetzgebern, all dies klar zu regeln und dabei allzu starken Ambitionen der EUKommission, sich in einzelstaatliche gesundheitspolitische Kompetenzen einzumischen, einen Riegel vorzuschieben. Der Versuch, den Zug in Richtung Angleichung der Gesundheitssysteme aufzuhalten, würde hingegen das weitere Zusammenwachsen der EU-Staaten in Frage stellen. Petra Spielberg, Fachjournalistin für Gesundheits- und Sozialpolitik Redaktion Wiesbaden/Brüssel E-Mail: [email protected] www.europa-transparent.eu