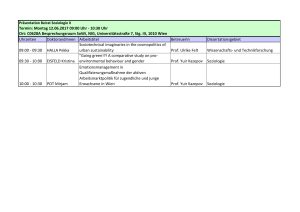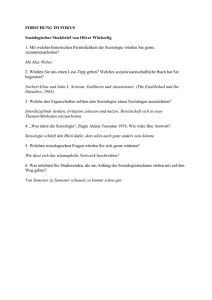Dürkheim vs. Bentham Anmerkungen zu zwei soziologischen
Werbung

Dürkheim vs. Bentham Anmerkungen zu zwei soziologischen Programmen Hans Gerd Schütte Die Renaissance des utilitaristischen Denkens in der Soziologie hat dazu beigetragen, dass eine Reihe von scheinbar bereits geklärten Problemen erneut an Interesse gewonnen hat. Dazu gehört die Frage nach der wis­ senschaftlichen Autonomie der Soziologie, nach der Rolle individuellen Handelns im sozialen Kontext, den Chancen und der Richtung der Theo­ riebildung, sowie schliesslich der Funktion der empirischen Forschung. Zwischen diesen Problemen bestehen interessante, und nicht immer leich t 1 zu klärende Beziehungen. Die energische Hinwendung zu den ‘faits sociaux’, die seit Dürkheim j Bestandteil des soziologischen Programms geworden ist, beinhaltet gleich­ zeitig die Forderung nach Autonomie der Disziplin auf der Grundlage eines besonderen Bereichs von Gegenständen, eben der ‘faits sociaux’. Die sozialen Tatbestände dienen nämlich der Abgrenzung von der individua­ listischen Psychologie und Ökonomie einerseits; sie werden aber auch in einer Sichtweise erfasst, in der empiristische Züge dominieren. Der Respekt vor den Fakten gehört seitdem zur soziologischen Tradition. Die theoretische Emanzipation dagegen scheint nicht in dem Masse gelungen zu sein, das Dürkheim vorschwebte. Überall da, wo gegenwärtig die Theo­ riebildung an Prägnanz gewinnt, lassen sich unschwer Anleihen bei der Psychologie und Ökonomie aufzeigen, die sowohl die Forderung nach Eigenständigkeit in Frage stellen, als auch dem — scheinbaren oder wirk­ lichen — Antiindividualismus des Durkheimschen Programms zuwider­ laufen. Offenbar überschneiden sich hier eine Reihe von Themen, und es fragt sich ob beispielsweise der soziologische Empirismus notwendigerweise an das Programm der Durkheimschen Soziologie gebunden ist, oder ob er nicht besser mit einem methodologischen und theoretischen Individualismus harmonieren würde. Gerade der Respekt vor den Fakten würde an sich 382 Hand in Hand mit individualistischen Tendenzen besonders verständlich erscheinen. Stattdessen findet sich besonders unter Autoren, die der sozio­ logischen Forschung nahestehen, eine Neigung zur Problematisierung von globalen oder emergenten Eigenschaften, die nicht von den Eigenschaften von Individuen abhängen sollen.1 G. C. Homans hat demgegenüber fest­ gestellt, dass es nicht um die Frage geht, ob es solche Eigenschaften gibt, sondern wie man sie erklärt, und er sieht einen engen Zusammenhang zwischen den Chancen soziologischer Theoriebildung und der individua­ listischen Tradition. In der Tat erscheint die theoretische Soziologie bei­ spielsweise im Vergleich mit der Ökonomie wenig artikuliert, und man gewinnt den Eindruck, dass sie hinter der Entwicklung der Forschung zurückgeblieben ist. Eine Fülle von Daten und empirischen Regelmässigkeiten ist relativ locker integriert,2 oder wird im Zusammenhang mit nor­ mativen Forderungen gedeutet, während die deduktiv-theoretische Argu­ mentation weniger ausgeprägt ist. Andererseits aber ergeben sich auf der Basis der soziologischen Forschung auch Möglichkeiten, vorschnellen Ver­ allgemeinerungen entgegenzuwirken, Möglichkeiten die leicht verkannt werden, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, die Dignität einer Disziplin hänge vom Stand ihrer Theoriebildung ab. Gerade grossangelegte theoretische Entwürfe, die zunächst recht eindrucksvoll erscheinen, leiden häufig darunter, dass sie einigermassen souverän mit den Fakten umgehen. Insofern dürfte das kritische Potential des soziologischen Empirismus noch nicht ausgeschöpft sein. Auch wenn die theoretische Integration einer Wissenschaft unvollkommen ist, so kann man doch ihre Resultate zur Kritik alternativer Positionen heranziehen. Gerade diese Möglichkeiten aber werden in der Soziologie Dürkheims deutlich. Unglücklicherweise ist die enge Verbindung von Empirismus und Anti­ individualismus in seinem Werk aus wissenschaftshistorischen Gründen besonders resistent gegen den Versuch einer kritischen Auseinanderset­ zung. Ein beträchtlicher Teil der Wirkung dieses Programms resultiert daraus dass eine erfolgreiche Kritik am Wissenschaftsprogramm des Utili­ tarismus zur Grundlage einer Ablehnung aller individualistischen Erklä­ rungsansätze wurde. Diese beiden Aspekten stehen jedoch in keiner not­ wendigen Beziehung zueinander. Auf der einen Seite haben wir es nämlich mit manchmal apodiktisch formulierten wissenschaftstheoretischen Fest­ setzungen zu tun, die auf ein allgemeines Verdikt individualistischer E r­ klärungen in der Soziologie hinauslaufen. Auf der anderen Seite ergibt sich besonders im Zusammenhang mit der Anomietheorie eine Widerlegung bestimmter Implikationen der utilitaristischen Gesellschaftslehre, die man zusammenfassend einmal das Benthamsche Programm nennen kann. Sie 383 stellt immer noch eine Herausforderung dar. Man muss sich der Problemsituation der Soziologie des 19. Jahrhun­ derts zuwenden um zu verstehen, wie diese enge Beziehung zwischen philosophischen Positionen und erfahrungswissenschaftlichen Ergebnissen zustandegekommen ist. Sie ist gekennzeichnet durch die Auseinanderset­ zung mit einer sozialen Realität, die neuartige Züge trägt, und man kann hier wohl mit Recht auf die Folgen der politischen und der wirtschaft­ lichen Umwälzungen hinweisen. Zum anderen jedoch scheint ihre Deutung in den Kategorien der Aufklärung und des utilitaristischen Denkens ein­ seitig, unvollständig oder sogar ganz unbefriedigend zu sein. Insofern stellt die Soziologie Dürkheims den Versuch einer theoretischen Alter­ native dar, und in mancher Hinsicht eine progressive Problemverschie­ bung. Sie macht nämlich auf Erscheinungen aufmerksam, die im Weltbild etwa der ‘philosophical radicals’ eine bestenfalls untergeordnete Rolle spielen. Da nun der Utilitarismus mit einer individualistischen Position verbunden ist, lag es offenbar nahe, wegen der Mängel dieser Perspektive auch die damit verbundene philosophische Einstellung abzulehnen. Diese Schlussfolgerung ist natürlich keineswegs gerechtfertigt, aber sie hat sich als ungemein folgenreich für die Entwicklung der Soziologie als theoreti­ scher Disziplin erwiesen. In diesem Zusammenhang kommt es zu einer Abgrenzung von typisch individualistischen Disziplinen wie der Ökonomie und der Psychologie. Nun ist allerdings dieser Versuch mehr eine Absichtserklärung als Realität gewesen, denn es zeigt sich ziemlich schnell, dass auch eine autonome Soziologie nicht ohne Bezugnahme auf bestimmte Annahmen über mensch­ liches Verhalten auskommt. Diese orientieren sich zwar erst seit kurzer Zeit wieder am Prinzip der Nutzenmaximierung, sondern vor allem an dem, was man heute Sozialpsychologie nennen würde, und auch die Postulierung einer sozialen Realität ‘sui generis’ ist in vielen Fällen nicht mehr als der Verweis auf die Bedeutung von sozialen Beziehungen. Die metaphernreiche Sprache nicht nur Dürkheims verdeckt diese Zusammen­ hänge häufig. Es soll nun nicht versucht werden, seine Argumente neu zu deuten. Aber vielleicht lohnt sich der Hinweis, dass auch in diesem Fall das deklarierte und das praktizierte Programm einer Wissenschaft nicht miteinander harmonieren. Es ist in der Tat auffallend, wie sehr in der Durkheim-Tradition und ihre Weiterentwicklung zum Funktionalismus eine ablehnende Haltung gegenüber Psychologie und Ökonomie Hand in Hand mit der Verwendung eines verhalten theoretischen Vokabulars geht. Betrachtet man zum Beispiel die Diskussion um den Begriff der sozialen Rolle, so wird man leicht feststellen, dass es hier im Prinzip um indi384 viduelle Erwartungen, um Werte, Normen und gegenseitige Sanktionen geht. Und auch wenn man, unabhängig von dieser Entwicklung, einen Blick auf den Marxismus wirft, der die Idee einer autonomen Theorie der Gesellschaft womöglich noch stärker betont als der Funktionalismus, so dürfte wohl der Hinweis auf die Annahme des Profitmotivs genügen um zu zeigen, dass auch hier individualistische Elemente Prämissen der Argu­ mentation bilden, auch wenn sie zusammen mit anderen Komponenten auftreten, die sich nicht in diesem Sinn klassifizieren lassen. Es spricht viel dafür, dass Annahmen über individuelles Verhalten in der Soziologie immer eine, wenn auch nicht explizit eingestandene Rolle gespielt haben. Damit ist jedoch keine inhaltliche Festlegung auf be­ stimmte Theorien verbunden. Ein individualistisches Programm ist mit einem ganzen Spektrum von Basisannahmen vereinbar, von der reinen Logik der Entscheidung und der verstehenden Soziologie bis zu den ver­ schiedenen Varianten der Lerntheorie, dem Prinzip der Nutzenmaximie­ rung oder der Theorie des kognitiven Gleichgewichts. Die Auswahl ist reichhaltig; zudem pflegen von den Vertretern der einen Richtung alter­ native Erklärungen abgelehnt zu werden, obwohl sie sich mit dem individualistischen Credo durchaus vertragen. Man kann etwa Dürkheims berühmtes Diktum ‘The determining cause of a social fact should be looked for among antecedent facts, and not among the states of individual consciousness’ akzeptieren, ohne darin eine Widerlegung des individualis­ tischen Prinzips oder der Psychologie zu erblicken. Einem Behavioristen, für den mentale Ereignisse keine theoretische Bedeutung haben, würde die Formulierung vertraut klingen, weil er darin mit Recht einen Angriff auf die Bewusstseinspsychologie erblicken wird. Es dürfte ihm auch nicht schwer fallen Dürkheims Kritik an der Instinktlehre beifällig aufzunehmen, denn Theorien angeborener Eigenschaften sind gerade vom lerntheoretischen Standpunkt aus suspekt. Insofern kann man sich mit guten Gründen auf den Standpunkt stellen, dass durch die Durkheimsche Kritik nur be­ stimmte Formen des Individualismus getroffen werden. Während nun aber die Instinktlehre heute keine enthusiastischen Vertreter mehr findet, steht es mit dem Benthamschen Programm anders. Es bildet nämlich in gewis­ sem Ausmass den Hintergrund der neo-klassischen Ökonomie wie der ver­ haltenstheoretischen Soziologie. Und in dieser Hinsicht sind die Einwände Dürkheims von grösserer Tragweite, denn es dürfte nicht möglich sein, utilitaristische Prinzipien ohne weiteres zur Erklärung anomischer Zustän­ de heranzuziehen. Die Idee der Nutzenmaximierung lässt sich nämlich nur in Verbindung mit der Annahme geordneter Präferenzen sinnvoll auf soziales oder ökonomisches Handeln anwenden. Bei Anomie kann jedoch 385 von einem geordneten Wertsystem nicht die Rede sein. Auf diesen Punkt wird noch zurückzukommen sein. Anom ie, Arbeitsteilung und M arkt Gleichzeitig mit der Autonomieerklärung der Soziologie gelangt auch eine Position zum Ausdruck, die auf gewisse Begleiterscheinungen des M arkt­ mechanismus verweist: auf die Desorganisation sozialer Gebilde, den Zusammenbruch von Moralsystemen, auf Anomie, abweichendes Verhal­ ten und Selbstmord. Der Optimismus der wirtschaftlichen Revolution wird von Soziologen wie Dürkheim, Tocqueville oder Marx trotz aller Unter­ schiede im Ausgangspunkt ihres theoretischen Räsonnements in Frage gestellt. Die Empfehlungen zur Korrektur der Situation weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Im einen Fall soll die Solidarität einer sozialen Klasse zur revolutionären Umformung des sozialen Systems führen, im anderen Fall wird der Ruf nach gesellschaftlicher Integration und einer korpora­ tiven Lösung erhoben. In beiden Fällen liegen Zweifel an der Wirksamkeit des Marktmechanismus als Verfahren optimaler Bedürfnisbefriedigung der kritischen Analyse zu Grunde. Im Gegensatz zu Marx, dessen Entfrem­ dungstheorie eine Reihe von Parallelen zur Anomietheorie aufweist, kann Dürkheim der Idee des nutzenorientierten Handelns als Erklärungsprinzip jedoch nichts abgewinnen. Nicht nur sein Gesellschaftsbild, sondern auch seine Theorie hat wenig Raum für die Konzeption der Gewinnmotivation. Die Auseinandersetzung zwischen der Soziologie Dürkheims und den Gedanken des Utilitarismus spielt sich nun gewissermassen auf zwei Ebenen ab. Auf der einen Seite stehen bestimmte Erklärungsprinzipien zur Debatte, die generell ein Licht auf die ‘Natur des Menschen’ werfen sollen. Darüber hinaus aber geht es um Implikationen dieser Basisannah­ men im konkreten gesellschaftlichen Kontext, wie zum Beispiel um die Forderung nach der Realisierung des Wettbewerbsmarktes. Es gehört ja zu den Merkmalen sowohl der Soziologie Dürkheims wie des Benthamschen Programms, dass sie sowohl zur Erklärung wie zur Legitimierung bestimmter gesellschaftlicher Zustände herangezogen worden sind. Die utilitaristische Lehre, in sich nicht homogener als das soziologische Gegenprogramm, gründet sich auf bestimmte Annahmen über mensch­ liches Handeln, die ihre Prägung durch eine Reihe von Denkern wie Hume, Smith, Bentham bis zu Mill und Spencer erhalten haben. Grundlage der theoretischen Sozialwissenschaften soll eine naturalistische Psychologie sein, die der menschlichen Erfahrung, der Bedürfnisbefriedigung und der 386 Möglichkeit des Lernens einen bedeutenden Platz einräumt. Die empiristi­ sche Erkenntnistheorie Humes findet ihre Ergänzung in einer Verhaltens­ theorie, die auf die Bedingungen der Verknüpfung von Vorstellungen konzentriert ist. Es geht dabei um die Frage nach der Möglichkeit von Induktion im psychologischen Sinne, und die Antwort die Hume findet besteht in der Formulierung von Lernhypothesen. Für ihn ergeben sich nur drei Prinzipien der Vorstellungsverknüpfung, nämlich Ähnlichkeit, Kontiguität und Ursache oder Wirkung. In dieser Weise organisiert sich menschliche Erfahrung .3 Zum anderen geht es darum, dass Handlungen durch psychische Zustände hervorgerufen werden, wie Affekte, Lust und Schmerz: pain and pleasure. Verhalten ist also einerseits durch Zustände des Organismus determiniert, andererseits durch den Umgang mit der Realität, wobei die Möglichkeiten der Erfahrung durch die Gesetze der Assoziation vorgegeben sind. Missvergnügen, Wohlgefallen und Asso­ ziation sind die letzten Erklärungsgründe für menschliches Handeln. Vor diesem theoretischen Hintergrund liegt es nahe, die Rolle der Bedürfnis­ befriedigung und der Nützlichkeit im gesellschaftlichen Handlungszusam­ menhang zu betonen, aber auch die des Lernens. Der gesellschaftliche Prozess ergibt sich aus dem individuellen ‘trial and error’, einem Ver­ fahren, das durchaus nicht blind ist, wie später die behavioristische Psy­ chologie annahm, sondern mit der Möglichkeit kausaler Einsicht in die Bedingtheit der Verhältnisse einhergeht. Infolgedessen kommt diese Ge­ sellschaftslehre auch weitgehend ohne eine Staatstheorie aus. Wenn jeder­ mann selber herausfinden kann was ihm nutzt, und was seinen Bedürf­ nissen angemessen ist, und in der Lage ist die Schlussfolgerungen aus seiner Situation zu ziehen, dann ist eine zentrale Instanz, in der sich die Moral verkörpert, die höhere Einsicht in die Natur der Dinge, oder die Notwendigkeit den Kampf aller gegen alle in Grenzen zu halten offenbar weitgehend überflüssig. Insofern beruht das liberale Gesellschaftsmodell auf einem durchdachten Paradigma, in dem individuellen Bedürfnissen und Nutzenvorstellungen, aber auch der Möglichkeit der Einsicht in die soziale Situation auf strikt individualistischer Basis Rechnung getragen wird. Als ideale Verwirklichung des Programms bietet sich der Wettbewerbs­ markt an, der ohne zentrale Steuerung auskommt. Zunächst aber ist die Konzeption einer Gesellschaft, die durch individuelle Einsichten und In­ teressen gesteuert wird — durch die ‘unsichtbare Hand’ — eine Idee, die über den ökonomischen Liberalismus weit hinausreicht. Die ‘propensity to truck, barter and exchange’ ist Folge der Tatsache, dass der Mensch ein denkendes und sprechendes Wesen ist: der Tausch zielt auf Kommuni­ 387 kation, nicht nur auf rationale Bedürfnisbefriedigung. Im einen Fall be­ wegen wir uns im Markt und orientieren uns an den Preisen, im anderen Fall orientieren wir uns an den Meinungen sozialer Gruppen. Aber in beiden Fällen folgt das Verhalten nicht den Weisungen einer autoritären Instanz, sondern den eigenen Interessen. Während aber in der sozialen Gruppe keine produktive Entwicklung stattfindet, sondern ein Tausch von Kommunikationen, in dem der einzelne seine Position finden kann, ist der Markt als Mechanismus der Bedürfnisbefriedigung expansiv und erfinde­ risch. Die Arbeitsteilung und die Differenzierung der Interessen tragen dazu bei, dass der Ertrag der Produktion ständig zunimmt, und damit individuelle Bedürfnisse wirkungsvoller befriedigt werden können, ln der ‘Theorie der moralischen Gefühl’ (A. Smith) entsteht noch keinerlei Span­ nung zwischen Wettbewerbsmarkt und sozialer Gruppe. Dürkheim hat dagegen gezeigt, dass Maximierung des Nutzens im Kontext des Marktes und Minimisierung von Anomie nicht grundsätzlich gleichzeitig möglich sind. Die motivationale Komponente des Handelns im Utilitarismus ist also das Nutzenprinzip. Damit ist nicht gemeint, dass Menschen in jedem Augenblick das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bewusst kalkulieren, sondern dass sie bestrebt sind, ihr Glück zu vermehren und Unglück zu vermeiden. ‘This is one of the oldest theories of social behavior, and one we use everyday to interpret our own behavior as when we say “ I found so and so rewarding” , or “I got a great deal out of him” ’, schreibt ein moderner Utilitarist, um das Prinzip zu charakterisieren.4 Nutzen kann natürlich nur erzielt werden, wenn nicht jeder dasselbe anzubieten hat, sondern wenn Interessen und Güterangebot möglichst differenziert sind, also bei Arbeitsteilung. Der Tausch von Gütern, aber auch von Infor­ mation und Gefühlen wird dann dazu führen, dass sich die Partner eines Tauschprozesses ex post auf einem höheren Niveau der Bedürfnisbe­ friedigung wiederfinden. Ihre präziseste Formulierung dürfte diese Idee im Pareto-Kriterium gefunden haben: ‘Consider any particular position and suppose that a small move is made from i t . . . If the well-being of all the individuals is increased, it is evident, that the new position is more ad­ vantageous for each one of t hem. . . The well-being of some may remain the same without these conclusions being affected.’ 5 Ein Pareto-optimaler Zustand kann durch Tausch unter den Bedingungen nutzenorientierten Handelns erreicht werden. Er ist dadurch ausgezeichnet, dass wenigstens einer besser gestellt ist, ohne dass andere schlechter gestellt sind. Bedauer­ licherweise vernachlässigt diese Konstruktion die Tatsache, dass schon die Ausgangspositionen vom individuellen Standpunkt aus höchst unbefriedi­ 388 gend sein können, so dass der Versuch zur Nutzenmaximierung nicht dazu führen muss, dass alle Bedürfnisse gleichermassen befriedigt werden. Die Vernachlässigung von Besitz- und Statusunterschieden lässt das soziale Optimum in einem zweifelhaften Licht erscheinen. Ausserdem aber wird hier der Versuch unternommen, ein Erklärungsprinzip für menschliches Handeln mit einem Kriterium gesellschaftlicher Wohlfahrt zu verbinden, das als Massstab politischer Massnahmen dienen kann. Diese Entwicklung kommt bereits bei J. Bentham zum Ausdruck, der gesetzgeberische Mass­ nahmen auf dem ‘grössten Glück der grössten Zahl’ aufbauen wollte. Das Prinzip der Nutzenmaximierung gerät zur Maxime der Legislative, die eine gerechte Verteilung von Mitteln sichern soll. Ausserdem aber beginnt es jetzt vor allem in der ökonomischen Dis­ kussion über die Lerntheorie Humes zu dominieren. ‘Die Nutzenmeta­ physik des Utilitarismus wurde nicht zu einer gehaltvollen Psychologie weiterentwickelt sondern zu einem Formalismus’, stellt H. Albert in diesem Zusammenhang fest.6 Der reine Wettbewerbsmarkt ist ex definitione durch Gewissheit gekennzeichnet. Die Annahme vollkommener Information macht einen Rekurs auf die Assoziationspsychologie überflüssig. In der utilitaristischen Philosophie pflegen diese beiden Komponenten deutlich unterschieden zu werden, während in der liberalen Marktsoziologie die kognitive Problematik immer mehr in die Randbedingungen verlagert wird. Das Ergebnis ist eine reine Wertlehre, die bemerkenswerte formale Präzision in der heutigen Präferenzaxiomatik erlangt. Selbst in der moder­ nen politischen Ökonomie werden Informations- und Lernprobleme im wesentlichen unter Kostengesichtspunkten behandelt,7 und in den behavioristischen Varianten der Soziologie pflegt analog die Bedeutung von Erwartungen minimisiert zu werden, so dass auch hier das Prinzip des grösstmöglichen Vorteils in der Argumentation dominiert.8 Die Eleganz der Problemlösung für das klassische Gleichgewichtsmodell des Wettbe­ werbsmarktes ergibt sich unter anderem aus der Unterstellung der Markt­ transparenz, und die Soziologie kleiner Gruppen kommt gleichfalls ohne spezielle Annahmen über den Prozess der Informationsverarbeitung aus, weil man hier annimmt, dass im Bereich direkter Interaktion Wahrneh­ mungsprobleme keine wichtige Rolle spielen. Insofern weichen sowohl die neo-klassische Ökonomie wie die verhaltenstheoretische Soziologie vom ursprünglichen Programm des Utilitarismus ab. Sie setzen eher die Linie fort, die schon bei Bentham an Konturen gewinnt: ‘What happiness is, every man knows, because, what pleasure is, every man knows, and what pain is, every man knows.’0 Das reine Nutzenprinzip führt nun nicht nur in die logischen Probleme 389 von Wohlfahrtsoptima, sondern auch zu theoretischen Problemen, wenn man es auf den Bereich sozialer und ökonomischer Beziehungen anwen­ det. Der Nutzen des einen wird mit dem Nutzen des anderen nicht immer kompatibel sein, und diese Feststellung beunruhigte bereits Th. Hobbes, der sie bis zur Konzeption des Kampfes aller gegen alle weiterdachte. Die Lösung für dieses Problem (in dessen Formulierung bereits fragwürdige Prämissen eingehen) liegt dann sowohl in der Postulierung staatlicher Macht wie in der Forderung nach normativen Regelungen — der ‘conscience collective’ und der Gesetzgebung — die verhindern sollen, dass Konflikt, Ausbeutung und Anomie ein Maximum erreichen. Und die klassische Lösung des Liberalismus liegt in dem Nachweis, dass ein Inter­ essenausgleich durch Tausch in Marktsituationen möglich ist. Zu den Bedingungen des Tauschprozesses scheinen allerdings immer schon in­ stitutionelle Regelungen zu gehören, deren Einhaltung erzwungen zu werden pflegt. Ein wenig präziser ausgedrückt: ein reines Tauschmodell ohne normative Restriktionen lässt beliebige Lösungen zu. Es gehört zu den Schwächen der utilitaristischen Lehre, besonders in ihrer Verkörperung durch die Ökonomie des neunzehnten Jahrhunderts, den engen Zusammenhang von Macht, Markt und Moral vernachlässigt zu haben. Jedenfalls liegt hier der Ansatzpunkt der soziologischen Kritik. Individualismus, Hedonismus, Nutzenkalkül und ein ‘atomisiertes’ Ge­ sellschaftsmodell: alles das rief das Misstrauen des Erzsoziologen Dürk­ heim hervor, der dazu einer Argumentation ohne empirische Kontrolle mit grösser Skepsis gegenüber stand. Der Ansatzpunkt seiner empirischen Kritik ist von subtiler Einfachheit. Folgt man der utilitaristischen Lehre, so müsste mehr Arbeitsteilung, mehr Wettbewerb und weniger Staat nicht nur zu einer effizienteren Lösung des Knappheitsproblems führen, sondern auch zu besserer Bedürfnisbe­ friedigung in einem Sinn, der über die Deckung materieller Bedürfnisse hinausgeht. Wahlfreiheit nach einer Periode normativer Regelungen wird gemäss dem liberalen Credo emanzipatorisch wirken, und eher zu mensch­ lichem Glück als Unglück beitragen. Die Erfahrung spricht jedoch gegen diese Thesen, wie Dürkheim erkannte. Der Wegfall normativer Regelungen führt vielmehr zu Erscheinungen der Orientierungslosigkeit und der Ano­ mie nicht nur im strikt ökonomischen Bereich. Wenn man die verschieden­ sten sozialen Assoziationen — Familien, Konfessionen, Armeen und Be­ rufsgruppen — nach dem Grad ihrer Integration und ihrer Anomie ver­ gleicht, so stellt sich heraus, dass Selbstmordraten und die Häufigkeit abweichenden Verhaltens invers mit ihrer Integration variieren, und dass ganz allgemein diese sozialen Erscheinungen über einen langen Zeitraum 390 hinwegzunehmen, und nicht abnehmen. Ein effizienter Wettbewerbsmarkt und die moralische Solidarität von Gruppen scheinen nicht, wie noch A. Smith angenommen hatte, in unproblematischer Weise kompatibel zu sein. Und hinsichtlich dieser These konnte sich Dürkheim auf eine Fülle empirischen Materials stützen, das mit methodologischer Sorgfalt und wissenschaftlicher Phantasie zusammengetragen wurde. Auf einer, wenn man so will, theoretischen Ebene wird dasselbe Thema noch einmal aufgegriffen und bezweifelt, dass ein System sozialer Normen im utilitaristischen Rahmen erklärt werden kann. Der Abschluss von Verträgen zwischen Individuen wirft immer die Frage nach den nichtkontraktuellen Elementen des Vertrages auf. Und auch in dieser Hinsicht stellt die Durkheimsche Kritik eine progressive Problemverschiebung dar. Die Respektierung von Normen ist nämlich durchaus mit den Nutzen­ kalkül vereinbar, wie auch der Fall, dass der Nutzen abweichenden Ver­ haltens mit der Wahrscheinlichkeit und den Kosten von sozialen Sank­ tionen in Beziehung gesetzt wird. Die Entstehung und Tradierung von Normen stellt dagegen ein Problem dar, an dem auch die moderne utilitaristische Soziologie in Schwierigkeiten gerät. Sie hängen zum Teil damit zusammen, dass bisher noch jede naturalistische Erklärung des Gehalts von Normen fehlgeschlagen ist, und darüber hinaus logisch be­ denklich erscheint. Wenn wir Normen als Erfindungen mit Problemlösungs­ charakter auffassen, wie etwa wissenschaftliche Theorien, dann ist eine Prognose auf den Gehalt zukünftiger Normen — zum Beispiel des Eigen­ tums- oder Wahlrechts — genauso widerspruchsvoll wie eine Prognose auf den Gehalt zukünftiger Theorien. Wer in diesem Sinne eine exakte Vorhersage wagt, ist definitionsgemäss bereits im Besitz der Theorie oder der Vorschrift. Es ist andererseits möglich, Bedingungen für das Aus­ handeln von Normen anzugeben, für ihre Tradierung und Internalisierung, sowie für ihre Stabilität im Zeitablauf. Dürkheim hat im Zusammenhang mit der Ablehnung der Kontrakttheorie besonders den spontanen Charak­ ter der Entstehung von Normen betont, und Nachdruck auf ihre funk­ tionale Notwendigkeit, sei es für den Bestand der Gesellschaft, sei es für die Orientierung des Individuums gelegt. Tradierung und Sozialisation von Moral dominieren in seinem Gesellschaftsbild über den Aspekt der ratio­ nalen Diskussion von Normen als Vorschlägen, die sich bezüglich ihrer sozialen Konsequenzen untersuchen lassen. Die naturalistische Wendung des Themas liegt in der Annahme, dass man Normen unter dem Gesichtspunkt ihrer Internalisierung behandeln kann, also als Motive des Handelns, die im Prozess der Sozialisation erworben wurden, und die durch die Disziplin der Gruppe intakt gehalten 391 werden. Die strukturelle Basis von Moral sind die sozialen Beziehungen innerhalb von Assoziationen und Gruppen, die unter dem Druck wirt­ schaftlicher Veränderungen zusammenbrechen können. Eine andere Mög­ lichkeit der Analyse von institutioneilen Regelungen besteht in der Annahme, die schon bei Hume eine Rolle spielte, und sich in der utilitaristischen Tradition gehalten hat, sie als Gewohnheiten zu deklarie­ ren, als stabilisierte Verhaltensweisen, die durch Versuch und Irrtum entstanden sind, und schliesslich den Stempel verbaler Formulierung erhalten .10 Die Akzentuierung des Themas der normativen Integration durch Dürk­ heim darf nicht von der Frage ablenken, wie sie zustandekommt. ‘Die Soziologen haben charakteristischerweise als ihren Ausgangspunkt ein soziales System gewählt, in dem Normen existieren, und die Individuen weitgehend durch diese Normen gelenkt werden’, schreibt J. Coleman in einer kritischen Anmerkung zu diesem Problem .11 Dass Normen als Steuerungsmechanismen individuellen Verhaltens betrachtet werden kön­ nen dürfte unbestritten sein, aber wir wissen deshalb noch nicht, wie ein konsistentes Wertsystem entsteht. Es empfiehlt sich daher, Dürkheims Kritik am Utilitarismus in dieser Hinsicht differenziert zu betrachten. Sein empirisches Interesse richtet sich auf den Zusammenbruch von existieren­ den Moralsystemen als Folge von Arbeitsteilung und Wettbewerb. In prak­ tischer Hinsicht sieht er die Lösung im Aufbau beruflicher Assoziationen, sowie der moralischen Erziehung durch staatliche Instanzen. Aber da er dem Aushandeln neuer Spielregeln skeptisch gegenüber steht, weil er die Schwächen der Kontrakttheorie nur zu deutlich sieht, bleibt am Ende nur der Appell an die Selbstheilungskräfte der Gesellschaft:1Wenn eine Gesell­ schaft ihrer selbst bewusst werden soll, und den nötigen Grad von In­ tensität aufrechterhalten soll, den sie so erreicht, muss sie sich versammeln und konzentrieren. Diese Konzentration bringt eine Steigerung des geistigen Lebens hervor die Form in Idealvorstellungen annimmt, in denen das so erweckte neue Leben sich wiederspiegelt.’12 Das ist in theoretischer wie in reformerischer Hinsicht eine eher resignative Antwort. Die empirische Analyse anomischer Zustände steht zweifellos in direkter Beziehung zu den theoretischen Interessen Dürkheims. Aber man kann seine kritische Leistung auch unabhängig von seinen Bemühungen auf diesem Gebiet betrachten und würdigen. Genau genommen hat er eine Entwicklungsthese skizziert, in der von zwei Gesellschaftstypen ausge­ gangen wird. Diese Typen stellen unterschiedliche Antworten auf die Frage nach den Bedingungen der Integration von Gesellschaften dar. Eine Ge­ sellschaft, die durch ‘mechanische Solidarität’ gekennzeichnet ist, wird 392 durch ein gemeinsames und konsistentes System von Werten und Normen zusammengehalten. Es gibt also einen weitreichenden Konsens bezüglich der Regelung menschlicher Aktivitäten der dazu beiträgt, dass Konflikte minimisiert werden, und dass die gesellschaftliche Kooperation nicht ent­ scheidend gestört wird. Die moralische Integration wirkt aber auch ver­ haltensstabilisierend auf der Ebene der Persönlichkeit: ‘Es gibt, kurz gesagt, in einer kohäsiven und lebendigen Gesellschaft einen konstanten Austausch von Ideen und Gefühlen, etwas wie gegenseitige moralische Unterstützung, die das Individuum nicht auf seine eigenen Mittel verweist, sondern ihm die Teilnahme an der gemeinsamen Energie möglich macht, und seine eigene unterstützt, wenn sie erschöpft ist.’13 Die Disziplin der Gruppe ermöglicht gleichermassen gesellschaftliche Ordnung und Stabilität der Persönlichkeit. Wenn nun eine Gesellschaft an Komplexität, Grösse und Dichte zunimmt, dann wird die mechanische Solidarität, die auf der Ähnlichkeit von Werten beruht, abnehmen. Gleichzeitig wird die Rate abweichenden Verhaltens, und ganz allgemein der individuellen Variabilität zunehmen. Die Arbeitsteilung, die auf Differenzierung und Unähnlichkeit beruht tritt an die Stelle der gemeinsamen Moral, und stellt gewissermassen eine gesellschaftliche Bindungskraft auf höherer Ebene dar. Als aus­ lösende Faktoren für diesen Prozess gesellschaftlicher Transformation gelten Bevölkerungsdichte, Grösse der Bevölkerung und soziale Dichte. ‘Die Arbeitsteilung variiert direkt mit Volumen und Dichte von Gesell­ schaften.’ Das Ergebnis ist ‘organische Solidarität’, die jetzt die Gesell­ schaft zusammenhält. Arbeitsteilung schafft die Bedingungen gegenseitiger Abhängigkeit und des ökonomischen Tausch Verkehrs und entlastet von den Bedingungen hoher Bevölkerungsdichte. Hier findet sich also eine ähnliche Unterscheidung wie schon im Utilitarismus. Der Wettbewerbsmarkt tritt jedoch in Konkurrenz zur sozialen Gruppe, und die historische Entwicklung wird für Dürkheim zum Ausgangspunkt einer neuartigen Fragestellung: Sind Markt und Moral miteinander vereinbar? Er geht davon aus, dass ‘der erste Ursprung aller sozialer Prozesse von einer gewissen Bedeutung in der inneren Verfassung der sozialen Gruppe gesucht werden sollte’. Die ‘innere Verfassung’ von Gruppen wird auf ihre ‘dynamische Dichte’ bezogen, die wiederum als die Anzahl von Individuen definiert wird, die ‘nicht nur in kommerziellen sondern auch in sozialen Beziehungen stehen, die also nicht nur Leistungen austauschen oder miteinander konkurrieren, sondern ein gemeinsames Leben führen .’14 Diese Unterscheidung von sozialen und ökonomischen Beziehungen wirft Fragen auf zwei Ebenen auf, nämlich einmal die nach ihrer faktischen 393 Kompatibilität unter bestimmten historischen Bedingungen, und die nach ihrem jeweiligen Erklärungsprinzip. Wie es scheint, neigte Dürkheim dazu, diese Ebenen zu verwechseln. Seine Theorie lässt sich in der Form eines Kausalmodells organisieren. Am Anfang der historischen Sequenz stehen Variationen der Bevölke­ rungsdichte und der sozialen Dichte. Daraufhin nimmt der Grad der Arbeitsteilung zu. Damit aber eine grössere Differenzierung von Interessen möglich wird, ist auch ein hohes Mass individueller Variationsbreite erforderlich. Aus diesem Grunde wird aber nun ein Zustand der Des­ organisation resultieren, einmal deshalb weil die gestiegene Variabilität individuellen Verhaltens eben zu abweichendem Verhalten beiträgt, ge­ messen an den herrschenden Standards. Zum anderen aber wird das gesellschaftliche Wertsystem in seiner Arbeitsweise beeinträchtigt mit dem Ergebnis weitverbreiteter Anomie. Anomie jedoch führt zur Zunahme der Selbstmordraten. Hier ist das Ende der Kausalkette, und die Schlussfolge­ rung erscheint gerechtfertigt, dass die Prinzipien des Utilitarismus vor bestimmten, eindeutig nachweisbaren sozialen Phänomenen versagen. Auch wenn man sich der Schwierigkeiten der empirischen Überprüfung dieser Hypothesen bewusst ist, so bleibt doch sowohl die Argumentation Dürk­ heims wie auch sein Datenmaterial eindrucksvoll genug. Hier werden zudem nicht nur allgemeine Prinzipien formuliert, sondern prüfbare Hypo­ thesen. Dürkheim geht dabei keineswegs naiv vor. Das zeigt sich, wenn man seine Beweisführung näher betrachtet. Eine besonders eindrucksvolle Teilhypothese findet sich im Zusammenhang mit der Erscheinung der ‘crise heureuse’. Seine Ausgangshypothese bezieht sich auf den Zusammen­ hang von Integration beziehungsweise Anomie und Selbstmordraten. Diese These wird auf Männer und Frauen, Geschiedene und Verheiratete, Pro­ testanten und Katholiken, Berufsgruppen, Soldaten und Zivilisten ange­ wendet. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Analyse der Auswirkungen von Wirtschaftskrisen, und hier zeigen sich die Vorzüge des Durkheimschen Empirismus sehr deutlich. Er untersucht nämlich nicht nur den Einfluss von konjunkturellen Krisen. Hier müsste ja auch nach der utilita­ ristischen Lehre eine Zunahme der Selbstmordrate recht plausibel sein. Dürkheim stellt jedoch fest, dass auch bei einer ‘crise heureuse’, also im konjunkturellen Aufschwung die Kohäsion sozialer Einheiten gestört wird, und die Selbstmordraten steigen. Es dürfte in der Tat schwer fallen, diese Tatsachen mit der Annahme der Gewinnmotivation in Einklang zu bringen. Es mag empirische Einwände gegen diese und ähnliche Hypo­ thesen geben, weil sie als Aggregathypothesen formuliert sind, die not­ wendigerweise mit gewissen Informationsverlusten einhergehen. Der Ge­ 394 samtzusammenhang der Argumentation wird davon jedoch kaum betroffen werden. Nach der utilitaristischen Lehre musste Arbeitsteilung zu grösserer Produktivität führen. Unter Wettbewerbsbedingungen wird dann ein höheres Mass von Bedürfnisbefriedigung möglich sein. Das individuelle Gewinnstreben wird durch den Konkurrenzmechanismus so gesteuert, dass die Produktionsfaktoren an den Ort ihrer optimalen Verwendung gelangen. Um ein reibungsloses Funktionieren des Marktes zu gewährleisten müssen die ‘corps intermédiaires’, die störend in den Prozess der Preisbildung eingreifen, ausgeschaltet werden. Dann ist eine Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt zu erwarten. Diese Schlussfolgerung ist jedoch weder mit der Anomiethese noch mit der Tatsache steigender Selbstmordraten verträg­ lich. Und da der Respekt vor den Fakten es verbietet soziale Tatsachen dieser Tragweite als Friktionen des Wettbewerbsmarktes hinwegzuerklären, muss man die Kritik am Utilitarismus und damit das Durkheimsche Pro­ gramm offenbar ernst nehmen. Maximierung des Nutzens und Minimi­ sierung von Anomie sind nicht gleichzeitig möglich. Betrachten wir den Zusammenhang noch einmal im Lichte von Vor­ stellungen, die für die moderne Ökonomie und die gegenwärtige Soziologie repräsentativ sein dürften. Unter dem Gesichtspunkt einer effizienten Steuerung der Produktion durch die Wünsche der Konsumenten und die Gewinnmotivation der Unternehmer wird es darauf ankommen beispiels­ weise Erfindungen und die Möglichkeiten der Arbeitsteilung so auszu­ nutzen, dass eine rasche Reallokation von Produktionsfaktoren erfolgt. Es ist nicht einfach sich vorzustellen, dass etwa arbeitssparende Erfin­ dungen unter Wettbewerbsbedingungen nicht dazu führen sollten, dass Arbeit durch Kapital ersetzt wird. Das bedeutet jedoch fast automatisch Mobilität von Arbeit, und damit eine Beeinträchtigung des Gefüges sozialer Beziehungen, die die strukturelle Basis intakter Moralsysteme bilden. In gewisser Hinsicht wird im Verlauf dieses Prozesses eine grössere Effizienz des Wirtschaftssystems erreicht. Die sozialen Kosten, die in Form anomischer Zustände und individueller Orientierungslosigkeit entstehen, tauchen aber in keiner Bilanz auf. Trotzdem lassen sie sich nicht hinweg­ diskutieren. Insofern bedeutet das Durkheimsche Programm eine entschei­ dende Korrektur der utilitaristischen Perspektive. Als theoretische Alternative betrachtet jedoch bleibt der Ertrag der soziologischen Kritik hinter dem damit verbundenen Anspruch zurück, und in diesem Zusammenhang rächt sich die Verwechslung der Ebene empirischer Kritik mit der Ebene von Erklärungsprinzipien. Von einer theoretischen Alternative muss man erwarten, dass sie nicht nur auf die 395 Mängel eines Programms hinweist, sondern mindestens dieselbe Erklä­ rungskraft bezüglich bestimmter Probleme aufweist, wie die verworfene Alternative. Ausserdem sollte sie bessere Erklärungen auf dem Gebiet anzubieten haben, auf das sich die Kritik richtet. Es dürfte aber nicht möglich sein, ohne Bezugnahme auf das Prinzip der Nutzenmaximierung Prozesse der Preisbildung, oder solche Erscheinungen wie Steuerhinterzie­ hung, Korruption, Berufsentscheidungen oder die Konkurrenz politischer Parteien zu erklären. Insofern stellt das Durkheimsche Programm keine theoretische Alternative dar, selbst die Entstehung von sozialen Assozia­ tionen wie Berufsgruppen, Parteien oder Gewerkschaften, die doch eine so wesentliche Rolle in der Soziologie Dürkheims spielen, kann ohne Be­ rücksichtigung der individuellen Interessenlage wohl nicht intellektuell bewältigt werden. Es reicht nicht aus, den ‘insatiable appetite’ für gewisse destruktive Konsequenzen der Arbeitsteilung verantwortlich zu machen, ohne ein besseres Erklärungsprinzip an seine Stelle zu setzen. Hier wird die enge Bindung von Empirismus und Antiindividualismus bedeutungsvoll, die in die Konzeption einer autonomen Soziologie eingeht. Die berechtigte Kritik sowohl an Theorien angeborener Eigenschaften sowie an bestimmten Schlussfolgerungen der utilitaristischen Gesellschafts­ lehre hat dazu geführt, dass die Möglichkeit der Erklärung individuellen Handelns ausser Sicht geriet, und damit auch eine theoretische Alternative. Der Preis für diese Strategie ist hoch. Wenn man sich an das Durkheim­ sche Programm hält, sind Konflikt und Wettbewerb in der Sprache der Soziologie nicht mehr formulierbar, obwohl andererseits Klarheit darüber besteht, dass sie die entscheidenden Bedingungen der Anomie sind. Literatur 1. Vgl. A. Etzioni und E .W. Lehmann, ‘Gefahren soziologischer Messmethoden’, in: W. Hochkeppel (Hrsg), Soziologie zw ischen Theorie und Empirie, Mün­ chen, 1970, S. 130 ff. 2. Eine umfangreiche Übersicht bei B. Berelson und G. Steiner, H um an behavior. A n inventory o f scientific findings, N ew York, 1964. 3. D. Hume, Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, Stuttgart, 1967, S. 39. 4. G. C. Homans, ‘Social behavior as exchange’, in: Sentim ents and activities, Glencoe, 1962, S. 279. 5. Nach: T. W. Hutchinson, A review o f econom ic doctrines, Oxford, 1953, S. 225. 6. H. Albert, M arktsoziologie und Entscheidungslogik, Neuwied, 1967, S. 25. 7. Vgl. P. Bernholz, Grundlagen der politischen Ö konomie, Tübingen, 1975, Kap. 4. 396 8. 9. 10. 11. 12. Vgl. G. C. Homans, G rundfragen soziologischer Theorie, Opladen, 1972. J. Bentham, C onstitutional code, Kap. 16, Abschn. 6. G. C. Homans, a.a.O., S. 86 ff. J. Coleman, ‘Collective decisions’, in: Sociological Inquiry, 1964, S. 167. E. Durkheim, The elem entary fo rm s o f the religious life. N ew York, 1965, S. 470. 13. E. Durkheim, Suicide, New York, 1951, S 210. 14. E. Durkheim, T he rules o f sociological m ethod, N ew York, 1938, S. 113 ff. 397