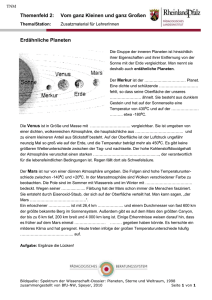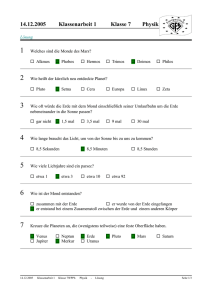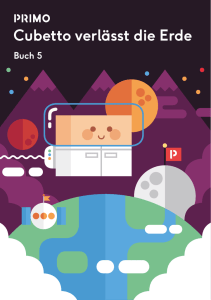Ein Gärtner im All
Werbung

Samstag, 2. Juli 2016 Ein Gärtner im All DLR-Forscher will 2017 Tomaten in einem Satelliten in der Erdumlaufbahn ziehen – Gewächshäuser auf Mond und Mars im Blick soren die gefährliche kosmische Strahlung messen, die insbesondere für Astronauten auf dem langen Weg zum Mars und zurück zum Problem werden könnte. Diese Strahlung würde auch die zukünftigen Gewächshäuser im All gefährden, sagt Jens Hauslage: „Käme etwa ein starker Sonnensturm, er könnte alle Pflanzen stark schädigen.“ Darum erwägen die DLR-Forscher, die Gemüsebeete auf Mond und Mars entweder unter der Oberfläche einzurichten oder sie gegen das Bombardement der geladenen Teilchen sehr gut abzuschirmen. Ein anderes Problem ist der Lichtmangel auf dem Mars, der 1,5-mal so weit von der Sonne entfernt ist wie die Erde. „Die Solarenergie wird nicht reichen. Wir werden daher mit Atomenergie künstliches LED-Licht erzeugen müssen, damit die Pflanzen gut wachsen“, schätzt Hauslage. Von Alexei Makartsev ● RAVENSBURG - Im Blockbuster „Der Marsianer“ (2015) rettet sich der gestrandete Astronaut Mark Watney auf dem Roten Planeten, indem er auf dem Marsboden Kartoffeln anbaut und sie mit eigenen Ausscheidungen düngt. Nach Meinung von Wissenschaftlern ist das ScienceFiction-Szenario des US-Autors Andy Weir gar nicht so weit weg von der zukünftigen Realität entfernt. 2017 startet mit „Eu:Cropis“ ein Kompaktsatellit des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DRL) ins All, der biologische Lebenserhaltungssysteme in 650 Kilometern Höhe testen soll. Die kühne Vision dahinter: Technologien für effiziente Gewächshäuser auf Mond und Mars zu entwickeln, die Langzeitmissionen auf anderen Planeten möglich machen sollen. Der Gravitationsbiologe Jens Hauslage hat kein Verständnis dafür, wenn jemand seine Space-Tomaten „ungenießbar“ nennt. „Die schmecken gut“, widerspricht der Kölner DLR-Forscher, der jedoch die Früchte seines außerirdischen Experiments nie probieren können wird. Schwerkraft simuliert Im kommenden Jahr sollen der Satellit und seine Nutzlast mit der Falcon-9-Rakete der US-Firma SpaceX in die Erdumlaufbahn befördert werden. Die Forscher wollen dort ein Jahr lang unter simulierter Schwerkraft Tomaten ziehen. Um Geld zu sparen, wird „Eu:Cropis“ die Proben nicht zurückbringen, der Satellit soll in der Atmosphäre verglühen. Zuvor wollen aber Hauslage und sein Kollege Michael Lebert von der Uni Erlangen-Nürnberg das Geschehen an Bord mithilfe von Videoaufnahmen beobachten. „Die Mission ist bereits ein Erfolg“, sagt der Biologe, „wenn unsere Kameras gekeimte Tomaten im All sehen. Wenn diese dann rote Früchte tragen, bedeutet das, dass die Früchte wiederverwendbare Samen entwickelt haben. Dies wäre ein Durchbruch“. Der Mensch und die Pflanzen bilden eine biologische Schicksalsgemeinschaft: Ohne das Grünzeug auf der Erde, das mit seiner fotosynthetischen Fähigkeit den Sauerstoff pro- Der Kölner Weltraumbiologe Jens Hauslage will mit seinen Tomaten hoch hinaus. duziert und den Biomüll in Nahrung umwandelt, könnte unsere Zivilisation nicht existieren. Für Experten steht außer Frage, dass die Kundschafter auf anderen Planeten nur dann eine Überlebenschance hätten, wenn sie Pflanzen mitnehmen würden. Die große Frage ist, wie man unter den extrem lebensfeindlichen Bedingungen im All das Weltraumgemüse in geschlossenen Systemen zuverlässig züchten und dabei den gesamten Abfall recyceln kann. „Eu:Cropis“ soll im All sechs Monate lang die Schwerkraft von Mond und genauso lang die Mars-Gravitation erzeugen – die jeweils 16 und 38 Prozent der Erdanziehungskraft betragen. Dazu wird der Satellit sich mithilfe von speziellen Stäben auf der Außenoberfläche vom Magnetfeld der Erde abstoßen, um sich zu drehen. In seinem Inneren werde in dieser Zeit ein Kampf um Nahrung ausbrechen, erklärt Jens Hauslage. Mit Urin besprüht Die Forscher schicken statt des Bodens einen von Mikroorganismen bewohnten Rieselfilter ins All, der mit künstlichem Urin berieselt werden soll. „Die Bakterien im ‚C.R.O.P.‘Filter und die mitreisenden Augentierchen Euglena, die Sauerstoff produzieren, werden den Urin in eine Nitratlösung umwandeln. Das ist der Dünger, den die Tomaten brauchen, um zu keimen“, so Hauslage. Das Modell ist eine mögliche Lösung dafür, wie die Astronauten ihre FOTO: PR organischen Abfälle recyceln könnten. „Bei mir im Garten macht das der Komposthaufen, aber man kann keinen Kompost auf einer Raumstation oder einer Mondbasis einrichten“, erklärt der Biologe. „Da können Bakterien und die Euglena helfen, die das schädliche Ammoniak als Zerfallprodukt des Urins abbauen.“ Das LED-Licht im Satelliten soll für die Augentierchen und Tomatensamen einen Tag-und-Nacht-Rhythmus erzeugen, ein Drucktank simuliert in den Gewächshäusern die irdische Atmosphäre. Ein Nebenziel der Mission ist es, herauszufinden, bei welcher Schwerkraft im Satelliten sich die Euglena wohlfühlen wird. Ein weiteres Ziel der Forscher: „Eu:Cropis“ soll mithilfe vieler Sen- Keine Ölpalmen im Weltraum Bleibt die Frage, welche Nahrung die Astronauten am besten anbauen sollen. Laut den Biologen lassen sich Eiweiße und Kohlenhydrate auf anderen Planeten noch relativ leicht gewinnen, während die Produktion von Fetten viel Abfall verursacht. Darum würden etwa Raps und Ölpalmen ausscheiden. „Die Kartoffel wie im Film ,Der Marsianer’ ist keine schlechte Idee, ich würde nur Süßkartoffeln nehmen“, sagt Jens Hauslage. „Noch besser wären aber Hülsenfrüchte, die mehr Protein haben“. Die Mission „Eu:Cropis“ hat bereits die ersten Planungshürden genommen. Zurzeit wird ein Flugmodell gebaut, das bis zum Frühjahr im DLR Bremen getestet werden soll. Während sie zuversichtlich sind, 2017 ins All starten zu können, wagen die Wissenschaftler keine Prognose darüber, wann das erste ständige Gewächshaus außerhalb unseres Planeten betrieben werden könnte. Das werde von den politischen Entwicklungen abhängen, sagen sie. „Zweifellos nützt aber dieses Wissen aus dem Weltraum unserem eigenen Planeten“, sagt Jens Hauslage. „Denn die Möglichkeit, geschlossene Lebenserhaltungssysteme betreiben zu können, könnte uns auf der Erde retten, wenn die Umweltverschmutzung weiter zunimmt.“ Forschung hilft gegen Gülle-Gestank Eine mögliche Anwendung der „Eu:Cropis“-Technologie, der „C.R.O.P.“-Filter, könnte in der Landwirtschaft all denen das Leben leichter machen, die angesichts des beißenden GülleGeruchs auf dem Land die Nase rümpfen. „Wir haben jedes Jahr in Deutschland 200 Millionen Tonnen Gülle, die auf die Felder gekippt wird. Gülle enthält das Gift Ammoniak, und bis zu 70 Prozent davon landen nicht im Boden, sondern gelangen in die Atmosphäre und verpesten unsere Luft“, erklärt der Biologe Jens Hauslage. Der bei der geplanten Weltraum-Mission „Eu:Cropis“ verwendete Rieselfilter sei in der Lage, den Ammoniak über die Zwischenstufe Nitrit zu Nitrat umzuwandeln, sagt der Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR). „Das Gülle-Problem könnte man also mit unseren Filtern in den Griff kriegen.“ Die Landwirte würden eine nicht riechende Flüssigkeit bekommen, die bis zu 32 Gramm Nitrat pro Liter enthält – eine hochkonzentrierte Lösung, die sie dosiert einsetzen könnten. Gäbe es weniger Gülle, würde das auch die Qualität des Trinkwassers verbessern, sagt Hauslage. Auch das Recycling von Urin in Hochhäusern sei ein möglicher Anwendungsbereich der DLR-Forschung. (alm) Der deutsche Satellit Eu:Cropis soll 2017 starten. Mit an Bord sind dann zwei Gewächshäuser. FOTO: DLR Der Sternhimmel im Juli Merkus und Venus sind nicht zu sehen – Mond und Jupiter übertreffen den Mars – „Sommerdreieck“ macht helle Sterne sichtbar Erläutert, wie immer an dieser Stelle, von der Volkssternwarte Laupheim ● Die Sonne Am 4. Juli erreicht die Erde mit 152,1 Millionen Kilometer ihre größte Entfernung von der Sonne. Fragen Sie sich vielleicht, warum genau dann in unseren Breiten Hochsommer herrscht? Das liegt am sommerlich-steilen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel ist er zur gleichen Zeit flacher: Dort herrscht jetzt Winter. Die Tabelle mit den Auf- und Untergangszeiten, angegeben – wie alle anderen Zeiten in diesem Artikel – in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ): 1. Juli 5.15 Uhr, 21.32 Uhr; 10. Juli 5.23 Uhr, 21.28 Uhr; 20. Juli 5.34 Uhr, 21.18 Uhr; 31. Juli 5.48 Uhr, 21.03 Uhr. ● Der Mond Kurz nach Monatsbeginn verschwindet in der Neumondnacht des 4. Juli die immer dünner werdende Mondsichel vom Firmament. Sie kehrt jedoch bald in den darauffolgenden Tagen an den westlichen Abendhorizont zurück. Bis zum 12. ist sie in das Sternbild „Jungfrau“ gezogen, wo sie sich zum zunehmenden Halbmond gerundet hat (Phase des ersten Viertels). Danach wandert der Erdtrabant weiter in den „Schützen“, wo er in der Vollmondnacht des 19. mit größter Leuchtkraft strahlt. Während seine Helligkeit nun wieder stetig schwindet, findet sich unser Erdbegleiter am 27. im „Walfisch“ als abnehmender Halbmond ein (Phase des letzten Viertels). Zurückverwandelt in eine dünne Sichel verabschiedet sich der Mond aus diesem Monat. ● Die Planeten Die beiden sonnennächsten Plane- ten Merkur und Venus kommen wieder hinter der Sonne hervor, können sich jedoch noch nicht aus ihrem Glanz lösen. Sie sind deshalb in diesem Monat von Deutschland aus nicht zu beobachten. Der Mars, unser Nachbarplanet im äußeren Sonnensystem, steht bereits abends am Firmament. Er verabschiedet sich jedoch immer früher aus der zweiten Nachthälfte. Am 1. Juli geht Mars um 2.17 Uhr unter, am 31. bereits gegen 0.30 Uhr. Der rote Planet streift durch die „Waage“. In dieser Sternenregion ist er leicht als hellstes Nachtobjekt zu erkennen. Er wird nur noch vom Mond und Jupiter in seiner Helligkeit übertroffen. Übrigens: Am 4. beginnt auf der Nordhalbkugel des Mars der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems mit elffachem Erddurchmesser, steuert südlich des „Löwen“ auf die „Jungfrau“ zu. Als auffälliger, heller Lichtpunkt ist er dort nicht zu verfehlen. Der Gasriese zieht sich allerdings auch wie Mars stetig aus der zweiten Nachthälfte zurück. Er versinkt am Monatsersten gegen 0.26 Uhr, am Monatsletzten gegen 22.37 Uhr unter den Horizont. Auch Saturn, der entlegenste mit bloßem Auge sichtbare Planet, ist leicht aufzuspüren: Im Süden des „Schlangenträgers“ hat er sich als auffälliger Lichtpunkt östlich des Mars eingefunden. Saturn bremst seine Bewegung immer mehr ab und kommt am 31. Juli fast zum Stillstand. Der berühmte Ringplanet geht am 1. gegen 3.40 Uhr und am 31. gegen 1.38 Uhr unter. Die Fixsterne Eine der bekanntesten Sternfiguren ist das „Sommerdreieck“. Es setzt sich zusammen aus den hellen Sternen Wega in der „Leier“, Deneb im „Schwan“ und Atair im „Adler“. Sie gehören zu den 20 der hellsten mit ● Der Sternhimmel am 1. gegen 0 Uhr, am 15. gegen 23 Uhr und am 31. gegen 22 Uhr (MESZ). Die Kartenmitte zeigt den Himmel im Zenit. Der Kartenrand entspricht dem Horizont. Norden ist oben, Westen rechts, Süden unten und Osten links. Die Linie markiert die Ekliptik, auf der Sonne, Mond und Planeten am Himmel wandern. FOTO: STERNWARTE LAUPHEIM bloßem Auge sichtbaren Sterne überhaupt. Über diese drei Sternbilder werden folgende Legenden berichtet: Auf der Leier spielte und sang Orpheus so ausgezeichnet, dass er sogar den Totengott dazu bewegen konnte, ihm seine verstorbene Frau aus der Unterwelt herauszugeben! Der „Schwan“ entstand durch den ersten Verkehrsunfall der Antike: Nachdem der junge Phaeton bei einer heimlichen Spritztour mit dem Sonnenwagen seines Vaters, des Sonnengottes Helios, schwer verunglückte, trauerte sein Freund so sehr um ihn, dass dieser aus Mitleid von den Göttern als Schwan an den Himmel versetzt wurde. Der Adler wiederum entführte einen Jungen namens Antinous, der fortan den Göttern auf dem Olymp diente. Im Fernglas leuchtet nahe des „Leier“-Hauptsterns Wega das Vierfachsystem Epsilon Lyrae, also vier sich gegenseitig umkreisende Sonnen. „Schwan“ und „Adler“ liegen im matten Band der Milchstraße, das das Fernglas in Tausende einzelner Sterne auflöst. Die Milchstraße ist unsere diskusförmige Heimatgalaxis, die wir von der Kante her sehen. Ihr Durchmesser beträgt etwa 100 000 Lichtjahre, ihre Dicke nur 16 000 Lichtjahre. Ihre etwa 200 Milliarden Sterne vollenden in 230 Millionen Jahren eine Umdrehung um das Zentrum der Galaxis, von dem die Sonne rund 27 000 Lichtjahre entfernt ist. Östlich des Sommerdreiecks liegt das ausgedehnte Sternbild „Schlangenträger“ und die dazugehörige „Schlange“. Beide sind leuchtschwach, ergeben aber ein lohnendes Puzzle für klare Sommernächte. Über dem Kopf der „Schlange“ liegt der Sternenbogen der „Nördlichen Krone“. Ihr östlicher Nachbar ist der bärenstarke „Herkules“. Zwischen den westlichen zwei „Kastensternen“, der Brust des Herkules, ist mit einem Fernglas – an dunklen Orten auch bereits mit bloßem Auge – der bekannte Kugelsternhaufen M 13 zu finden. Der vom „Herkules“ als erste seiner zwölf Heldentaten gejagte „Löwe“ versinkt bereits mit den beiden anderen Frühlingssternbildern „Bärenhüter“ und „Jungfrau“ im Westen. Da die milden Sommernächte immer wieder gerne zur Sternbeobachtung einladen, hier noch einmal, wie die Sternkarte zu benutzen ist. Zunächst ist rasch erklärt, warum auf ihr die Himmelsrichtungen Ost und West vertauscht sind. Um mit ihr den Sternhimmel zu beobachten, wird die Sternkarte mit dem Bild nach unten über den Kopf gehalten und den Himmelsrichtungen entsprechend ausgerichtet. Der Zenit, der Himmelspunkt direkt über dem Kopf, entspricht dem Schnittpunkt der gedachten Nord-Süd- mit der OstWest-Linie. Zur angegebenen Uhrzeit tummeln sich dort „Drache“ und der antike Hau-drauf-Held „Herkules“. Der aktuelle Sternhimmel und weitere besondere Ereignisse werden auch in öffentlichen Vorführungen des Planetariums in Laupheim erläutert. Nähere Informationen unter der Telefonnummer 07392/ 91 059 und im Internet unter www.planetariumlaupheim.de © 2016 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG STERNHIMMEL Schwäbische Zeitung