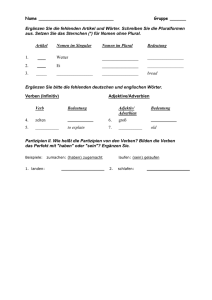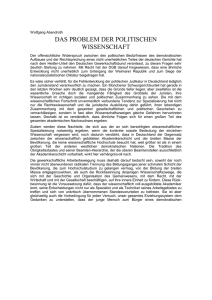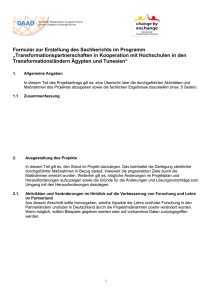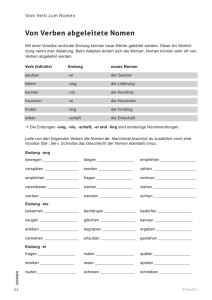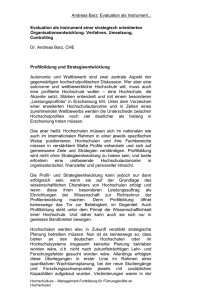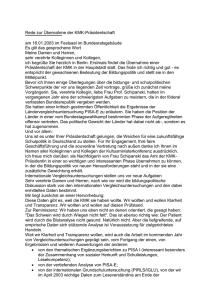Bologna-Diskurs
Werbung

Anmerkungen zum Text: zu lesen wäre primär nur (S. 1-15); die Dokumente sind Unterstrichen; der real zu lesende Text umfasst nur 10 Seiten; im Anhang ist ein bisschen Kontextrohmaterial (2 policy-frames (S. 15-17) und 3 polity-frames (S.1826) und Methodisches (S. 26)) 1. Diskurse 1.1. Bologna schreiben Bologna-Erklärung, 19. Juni 1999 „(1) Dank der außerordentlichen Fortschritte der letzten Jahre ist der europäische Prozess für die Union und ihre Bürger zunehmend eine konkrete und relevante Wirklichkeit geworden. Die Aussichten auf eine Erweiterung der Gemeinschaft und die sich vertiefenden Beziehungen zu anderen europäischen Ländern vergrößern die Dimension dieser Realität immer mehr. (2) Inzwischen gibt es in weiten Teilen der politischen und akademischen Welt sowie in der öffentlichen Meinung ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit der Errichtung eines vollständigeren und umfassenderen Europas, (3) wobei wir insbesondere auf seinen geistigen, kulturellen, sozialen und wissenschaftlichtechnologischen Dimensionen aufbauen und diese stärken sollten. (4) Inzwischen ist ein Europa des Wissens weitgehend anerkannt als unerlässliche Voraussetzung für gesellschaftliche und menschliche Entwicklung sowie als unverzichtbare Komponente der Festigung und Bereicherung der europäischen Bürgerschaft; (5) dieses Europa des Wissens kann seinen Bürgern die notwendigen Kompetenzen für die Herausforderungen des neuen Jahrtausends ebenso vermitteln wie ein Bewusstsein für gemeinsame Werte und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem sozialen und kulturellen Raum. (6) Die Bedeutung von Bildung und Bildungszusammenarbeit für die Entwicklung und Stärkung stabiler, friedlicher und demokratischer Gesellschaften ist allgemein als wichtigstes Ziel anerkannt, besonders auch im Hinblick auf die Situation in Südosteuropa. (7) Die Sorbonne-Erklärung vom 25. Mai 1998, die sich auf diese Erwägungen stützte, betonte die Schlüsselrolle der Hochschulen für die Entwicklung europäischer kultureller Dimensionen. (8) Die Erklärung betonte die Schaffung des europäischen Hochschulraumes 1 als Schlüssel zur Förderung der Mobilität und arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung seiner Bürger und der Entwicklung des europäischen Kontinents insgesamt. (9) Mehrere europäisch Länder haben die Aufforderung, sich für die in der Erklärung dargelegten Ziele zu engagieren, angenommen und die Erklärung unterzeichnet oder aber ihre grundsätzliche Übereinstimmung damit zum Ausdruck gebracht. (10) Die Richtung der Hochschulreformen, die mittlerweile in mehreren Ländern Europas in Gang gesetzt wurden, zeigt, dass viele Regierungen entschlossen sind zu handeln. (11) Die europäischen Hochschulen haben ihrerseits die Herausforderung angenommen und eine wichtige Rolle beim Aufbau des europäischen Hochschulraumes übernommen, auch auf der Grundlage der in der Magna Charta Universitatum von Bologna aus dem Jahre 1988 dargelegten Grundsätze. (12) Dies ist von größter Bedeutung, weil Unabhängigkeit und Autonomie der Universitäten gewährleisten, dass sich die Hochschul- und Forschungssysteme den sich wandelnden Erfordernissen, den gesellschaftlichen Anforderungen und den Fortschritten in der Wissenschaft laufend anpassen. (13) Die Weichen sind gestellt und das Ziel ist sinnvoll. (14) Dennoch bedarf es kontinuierlicher Impulse, um das Ziel größerer Kompatibilität und Vergleichbarkeit der Hochschulsysteme vollständig zu verwirklichen. (15) Um sichtbare Fortschritte zu erzielen, müssen wir diese Entwicklung durch Förderung konkreter Maßnahmen unterstützen. (16) An dem Treffen am 18. Juni nahmen maßgebliche Experten und Wissenschaftler aus allen unseren Ländern teil, (17) und das Ergebnis sind sehr nützliche Vorschläge für die zu ergreifenden Initiativen. (18) Insbesondere müssen wir uns mit dem Ziel der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems befassen. (19) Die Vitalität und Effizienz jeder Zivilisation lässt sich an der Attraktivität messen, die ihre Kultur für andere Länder besitzt. (20) Wir müssen sicherstellen, dass die europäischen Hochschulen weltweit ebenso attraktiv werden wie unsere außergewöhnlichen kulturellen und wissenschaftlichen Traditionen. (21) Wir bekräftigen unsere Unterstützung der in der Sorbonne-Erklärung dargelegten allgemeinen Grundsätze, und wir werden unsere Maßnahmen koordinieren, um kurzfristig, auf jeden Fall aber innerhalb der ersten Dekade des dritten Jahrtausends, die folgenden Ziele, die wir für die Errichtung des europäischen Hochschulraumes und für die Förderung der europäischen Hochschulen weltweit für vorrangig halten, zu erreichen: - (22) Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, auch durch die Einführung des Diplomzusatzes (Diploma Supplement) mit dem Ziel, die 2 arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der europäischen Bürger ebenso wie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems zu fördern. - (23) Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei Hauptzyklen stützt: einem Zyklus bis zum Abschluss (undergraduate) und einen Zyklus nach dem ersten Abschluss (graduate). (24) Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist der erfolgreiche Abschluss des ersten Studienzyklus, der mindestens drei Jahre dauert. (25) Der nach dem ersten Zyklus erworbene Abschluss attestiert eine für den europäischen Arbeitsmarkt relevante Qualifikationsebene. (26) Der zweite Zyklus sollte, wie in vielen europäischen Ländern, mit dem Master und/oder der Promotion abschließen. (...)“ (Bildungsminister 1999) Die oben und weiter unten im Text angeführten Diskursfragmente sind die Grundlage der „Bologna-Reformen“. Sie gelten als Beschlüsse von mittlerweile über 40 europäischen Bildungsministern, die zwar keine rechtliche Gültigkeit beanspruchen können, aber zumindest von den Unterzeichnern als verbindliche Dokumente behandelt werden. Das bedeutet zweierlei. Erstens ist nicht der rechtliche Status dieser Dokumente von Interesse sondern die Inhalte, die von den Ministern beschlossen wurden. Dies setzt zweitens voraus, dass diese Erklärungen und Kommuniqués nicht als europäische „Symbolpolitik“ gelten. Vielmehr verbindet sich damit ein fester Wille der europäischen Bildungsminister. Dies muss gerade vor dem Hintergrund der völkerrechtlichen Unverbindlichkeit dieser Papiere und deren Inhalte von Bedeutung sein. Die Reformen des Studiensystems, die im Rahmen des „Bologna-Prozesses“ durchgeführt werden, gelten daher nicht selten in öffentlichen Reden und Stellungnahmen als eine „grundlegende Reform“ oder gar „Revolution“. Von einem „revolutionären Prozess“ kann man in der Regel zwei Voraussetzungen erwarten. Einerseits ein „revolutionäres“ Subjekt, das von einer „heroischen Aura“ umgeben ist, und zweitens klare Forderungen. Auch wenn der „Bologna-Prozess“ keine „Revolution“ ist sondern nur eine „Reform“, dann können wir zumindest ein Subjekt erwarten, das selber spricht und sagt, was es will. Im folgenden wollen wir insbesondere die Bologna-Erklärung und einige Teile der Nachfolgekommuniqués einerseits nach Behauptungen und Forderungen absuchen, die auf die Inhalte der Dokumente verweisen, und andererseits fragen, wie und von wem diese Behauptungen und Forderungen hervorgebracht und verantwortet werden. Dafür wurde der Text in einzelne Aussageabschnitte gegliedert, die von (1) bis (33) durchnummeriert sind. Der 3 Text lässt sich zunächst grob in drei thematische Blöcke einteilen. Der erste Block (1) bis (12) beschreibt einleitend die allgemeine Bedeutung der Hochschulen für Europa, der zweite Block (13) bis (21) leitet die dann folgende Aufzählung der Hochschulreformmaßnahmen ein. Von (22) bis (33) werden schließlich Maßnahmen aufgezählt. Wir haben uns hier exemplarisch auf die Maßnahme beschränkt, die als die einschneidendste Maßnahme im „Bologna-Prozess“ gilt (Bachelor und Master), und die unterschiedlichen Formulierungen dieser Reformmaßnahme aus der Bologna-Erklärung, dem Prag-Kommuniqué und dem Berlin-Kommuniqué angeführt. In der Aussage (1) wird konstatiert, dass „der europäische Prozess“ für „die Union und ihre Bürger“ eine „konkrete“ und „relevante“ „Wirklichkeit“ geworden ist, sowie dass sich „die Dimension dieser Realität“ durch die „Erweiterung“ und sich „vertiefende Beziehungen“ zu „anderen europäischen Ländern“ „vergrößert“. In Aussage (2) kommen mit „weiten Teilen der politischen und akademischen Welt“ und der „öffentlichen Meinung“ zwei Stimmen (Sx/y) zu Wort, die sich für die „Errichtung eines vollständigeren und umfassenderen Europas“ aussprechen. Jedoch zeigt sich diese Forderung nicht über einen Willen oder ein Interesse, sondern über ein „wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit der Errichtung eines vollständigeren und umfassenderen Europas“. Durch das Personalpronomen „wir“ in Aussage (3) solidarisieren sich die Unterzeichner dieser Erklärung, die Minister, zunächst vordergründig mit den Forderungen, die von diesen beiden Stimmen (Sx/y) hervorgebracht werden. Diese Solidarisierung erfolgt durch das Relativadverb „wobei“, das in diesem Kontext die Forderungen der ersten beiden Stimmen ergänzt um die Forderung danach, „auf seinen geistigen, kulturellen, sozialen und wissenschaftlichtechnologischen Dimensionen“ aufzubauen. Diese Ergänzung, Erweiterung bzw. Spezifizierung des Forderungskatalogs wird durch das Adverb „insbesondere“ bekräftigt. Allerdings verläuft dieser Akt der „Spezifizierung/Ergänzung“ etwas komplizierter und ist insgesamt komplexer aufgebaut, als es die gerade vorgenommen lineare Beschreibung nahe legt. Das Adverb „insbesondere“, das Relativadverb „wobei“ und das Personalpronomen „wir“ sind Äußerungspartikel, die auf den Äußerungskontext verweisen und drei Sprecher instituieren. Das allinklusive „Wir“ verweist nicht nur deiktisch auf die Unterzeichner der Bologna-Erklärung, sondern schließt die beiden Sprecher der vorherigen Aussage (2) ebenso mit ein, wie ein umfassenderes, nicht weiter bezeichnetes „europäisches Publikum“. Mit „wir“ werden hier mehr oder weniger alle denkbaren Sprecherfiguren mit eingeschlossen. Interessanter mit Blick auf die polyphone Struktur dieser Aussage ist dagegen das Relativadverb „wobei“ und das Adverb „insbesondere“. Zwar verweist „wobei“ anaphorisch 4 auf Aussage (2) zurück und leitet in Verbindung mit „insbesondere“ cataphorisch eine Spezifizierung des in Aussage (2) Geforderten ein. Dies gelingt aber nur um den Preis einer Distanzierung von dem in Aussage (2) geforderten. So wird durch „wobei“ eine Stimme (Sa) instituiert, die das in Aussage (2) geforderte zurückweist („Nein, es besteht nicht die Notwendigkeit der Errichtung eines vollständigeren und umfassenderen Europas“), wobei der mit „wir“ induzierte Sprecher (Sp) sich mit dieser Stimme zunächst solidarisiert und sich damit von (Sx/y) distanziert, um dann durch „insbesondere“ diese Distanzierung aufzuheben, indem das in Aussage (2) Gesagte spezifiziert wird. Damit gelingt es (Sp) durch die Konstruktion von (Sa), der schließlich als künstliches Standbein fallengelassen werden kann, sich weder mit (Sx/y) zu solidarisieren, noch sich mit (Sx/y) nicht zu solidarisieren bzw. sich weder von (Sx/y) zu distanzieren, noch sich von (Sx/y) nicht zu distanzieren. Diese ambivalente Konstruktion der „Spezifizierung/Ergänzung“ hat den strategischen Vorteil, dass der Sprecher (Sp) Teile der Inhalte der Forderung von (Sx/y) übernehmen kann, ohne die Forderung selbst übernehmen zu müssen. Man überlässt es den „weiten Teilen der politischen und akademischen Welt sowie in der öffentlichen Meinung“ die Forderung zu artikulieren, um sich dann auf das, was einmal im Raum steht, beziehen zu können, ohne sich den Vorwurf einhandeln zu müssen, eine Forderung vorgetragen zu haben. In Aussage (4) und (5) wird behauptet, dass ein „Europa des Wissens“ eine „unerlässliche Voraussetzung für gesellschaftliche und menschliche Entwicklung sowie als unverzichtbare Komponente der Festigung und Bereicherung der europäischen Bürgerschaft“ ist und „seinen Bürgern die notwendigen Kompetenzen für die Herausforderungen des neuen Jahrtausends ebenso vermitteln“ kann „wie ein Bewusstsein für gemeinsame Werte und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem sozialen und kulturellen Raum“. Diese Behauptung wird in der 3. Person Singular, der „Nicht-Person“ nach Benveniste, vorgetragen („Es ist anerkannt, dass X“) und durch das Verb „anerkannt“, das konstatierend in der 3. Person vorgetragen wird, einem Sprecher untergeschoben, der weder genannt, noch spezifiziert oder irgendwie soziographisch verortet wird. Ohne die Adverbien „inzwischen“ und „weitgehend“ würde hier gesagt werden, dass absolut jeder und jede in Zeit und Raum das in Aussage (4/5) behauptete unterschreiben würde. Durch das Adverb „weitgehend“ wird dieser völlig unbestimmte Raum auf die möglichst unbestimmte Art und Weise, die uns die deutsche Sprache zur Verfügung stellt, eingegrenzt. Jeder, der mit der Behauptung in Aussage (4/5) nicht einverstanden ist, kann sich jenseits der Grenze, die durch „weitgehend“ gezogen ist, verorten, diejenigen, die damit einverstanden sind, diesseits. Zudem erschwert diese Art der schwammigen Grenzziehung einen Streit über die Grenze selbst. Da nicht klar ist, wo die 5 Grenze zwischen denjenigen, die einverstanden sind, und denjenigen, die nicht einverstanden sind, verläuft, kann keine Seite der anderen vorwerfen, falsche Lager zu konstruieren. Jeder kann sich selbst seine Grenze ziehen. Das Adverb der Zeit „inzwischen“ kann als eine Variante des deiktischen Partikels der Zeit „jetzt“ gelesen werden. „Inzwischen“ markiert einen zeitlichen Ort, ein „hier“, der wiederum einen anderen zeitlichen Ort, ein „damals“, in sich trägt. Anders als „jetzt“ könnte „inzwischen“ folgendermaßen umschrieben werden: „Jetzt ist es so, damals war es anders“. Das Adverb „inzwischen“ hat also eine polytemporale Struktur. Dadurch wird das in Aussage (4/5) Behauptete mitsamt der durch das Adverb „weitegehend“ evozierten Grenze in einem Raum des „jetzt“ verortet, wobei der nicht weiter spezifizierte Raum des „damals“ als eine Art Rückzugsgebiet für jene zur Verfügung steht, die dem, was in Aussage (4/5) behauptet wird, widersprechen. Der Kreis derjenigen, die die in Aussage (4/5) vorgetragene Behauptung vertreten, wird also durch zwei Grenzziehungen markiert, die einerseits so schwammig sind, dass niemand weiß, wer genau wo steht („weitgehend“) und wann genau das einmal anders gewesen sein soll („inzwischen“) und andererseits so unklar formuliert sind, dass die Grenze selbst kaum verortbar ist. So könnte „weitgehend“ 60% aber auch 90% bedeuten und „inzwischen“ die letzten 3 oder auch 20 Jahre ausschließen. In Verbindung mit „inzwischen“ könnte „weitgehend“ auch 40% bedeuten, wenn „damals“ mit dem in Aussage (4/5) Behaupteten niemand einverstanden gewesen ist. Nicht zuletzt muss der Sprecher (Sp) diese Behauptung nicht einmal selbst vertreten, wird doch durch die Anwendung der 3. Person exophorisch auf eine anonyme Instanz verwiesen, die das in Aussage (4/5) Gesagte vertritt. Aussage (6) wiederholt im Kern das, was Aussage (4/5) bereits artikulierte. Interessanter für die diskursive Operationsweise der Bologna-Erklärung sind dagegen die Aussagen (7) bis (10). Hier wird zunächst durch das anaphorische Pronomen „diese“ behauptet, dass die Sorbonne-Erklärung, die ein Jahr vor der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung in Paris von Deutschland, Frankreich, Groß Britannien und Italien unterschrieben wurde, sich auf das in Aussage (4), (5) und (6) Behauptete bezieht und darüber hinaus gesagt, dass die SorbonneErklärung „die Schlüsselrolle der Hochschulen für die Entwicklung europäischer kultureller Dimension“ und „die Schaffung des europäischen Hochschulraumes als Schlüssel zur Förderung der Mobilität und arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung seiner Bürger und der Entwicklung des europäischen Kontinents insgesamt“ betont. In diesen Aussagen wird eine anderes Papier zitiert, um diverse Inhalte hervorzubringen. Die Sorbonne-Erklärung fungiert hier als ein Sprecher (Ss), dem bestimmte Inhalte zugeschrieben werden, die im Hinblick auf ihre genaue Bedeutung nicht klar verortet werden. Die Aussage in der Bologna-Erklärung ist 6 eine deskriptive Behauptung („Die Sorbonne-Erklärung sagt/betont X“); die Aussage der Sorbonne-Erklärung wird jedoch als eine normative Forderung vorgetragen. Dies wird insbesondere in Aussage (9) deutlich („Aufforderung“), wo darüber hinaus behauptet wird, dass „mehrere Europäische Länder“ sich zu dem in der Sorbonne-Erklärung Geforderten bekennen und ebendiese Regierungen auch entschlossen sind zu handeln. Die exophorischen Partikel „mehrere Europäische Länder“, „in mehreren Ländern Europas“ und „viele Regierungen“ verweisen hier auf eine Sprecherinstanz (Sr), die sich zu dem von (Ss) Geforderten bekennt bzw. das von (Ss) Geforderte verantwortet und sich mit dem Sprecher (Ss) weitesgehend solidarisieren kann. Die Aussagen (7) bis (10) bleiben hingegen im „Berichtsmodus“ der „3. Nicht-Person“ [NP] (Benveniste). Das heißt, dass die Unterzeichner (Unp) der Bologna-Erklärung auf (Ss) und (Sr) exophorisch verweisen, um über diverse Forderungen zu berichten. Allerdings sind jene Individuen, die sich mit (Ss) und (Sr) verbinden, weitesgehend die gleichen Individuen, die das, was im Berichtsmodus behauptet wird, verantworten müssen (Unp). Die Unterzeichner-Individuen (Ui) verweisen auf die Sprecher-Individuen (Si) und lassen so sich selbst woanders sagen, was sie hier dokumentieren. Das Individuum spaltet sich in ein Subjekt der Forderung und ein NichtSubjekt des Berichtens. Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass erstens nicht alle (Ui)s identisch sein müssen mit allen (Si)s und zweitens jedes (Ui) sich nach belieben von (Si) distanzieren oder emphatisch damit identifizieren kann. Für ein und dasselbe Individuum stehen mit (Ss), (Sr) und dem leeren Ort (Unp) drei diskursive Positionen bereit, auf die es nach Gutdünken hin und her springen kann. Während Aussage (11) und (12) abschließend die „Hochschulen“ zu Wort kommen und das bisher Gesagte unterstützen lässt, wird mit Aussage (13) eine Art Wendepunkt markiert. Mit „die Weichen sind gestellt“ wird auf alles vorher Gesagte anaphorisch zurückverwiesen und konstatiert, dass „die Weichen gestellt“ sind, wobei der zweite Teilsatz von Aussage (13) „und das Ziel ist sinnvoll“ wie ein feierliches, emphatisches Bekenntnis zu „die Weichen sind gestellt“ wirkt. An dieser Stelle tritt ein Subjekt (Sp) durch das Adjektiv „sinnvoll“ erstmalig mit einer Stellungnahme hervor, um sich in Aussage (14) durch das Adverb „dennoch“ gleich wieder zurückzunehmen. Die Rücknahme weist zwar eine ähnliche Struktur wie die „Spezifizierung“ in Aussage (2/3) auf, konstituiert allerdings ein Subjekt, das den Leser über die dann folgenden, spannungsgeladenen Zeilen hinweg begleiten wird. „Dennoch“ instituiert einen Sprecher (Sa), der das in Aussage (13) von (Sp) Vertretene zurückweist („Nein, die Weichen sind nicht gestellt und das Ziel ist nicht sinnvoll“) und einen Sprecher (Sp1), der das dort von (Sp) Vertretene befürwortet. Das Subjekt (Sp) solidarisiert sich mit und distanziert 7 sich von beiden Sprechern und tritt dadurch als jemand auf, der es in gewisser Hinsicht „besser weiß“ als (Sp1) und (Sa), indem Subjekt (Sp) mit „erhobenem Zeigefinger“ darauf hinweist, dass es „kontinuierlicher Impulse“ (14) und der „Förderung konkreter Maßnahmen“ (15) bedarf. Der Spannungsbogen, der ausgehend von Aussage (13) aufgebaut wurde, setzt sich hier fort, indem das Subjekt (Sp) dem Leser der Bologna-Erklärung zu verstehen gibt, dass in den folgenden Passagen „die Katze aus dem Sack“ gelassen wird. Was ist ein „vollständigere[s] und umfassendere[s] Europa“ (2), ein „Europa des Wissens“ (4), worin besteht nun die „Bedeutung von Bildung und Bildungszusammenarbeit“ (6) und „die Schlüsselrolle der Hochschulen“ (7), welche Elemente enthält der „Europäische Hochschulraum“ „als Schlüssel zur Förderung der Mobilität und arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung seiner Bürger und der Entwicklung des europäischen Kontinents insgesamt“ (7)? Bevor uns (Sp) allerdings diese Frage(n) beantwortet, verweist die Bologna-Erklärung in Aussage (18) deiktisch mit „an dem Treffen am 18. Juni“ zunächst auf sich selbst und rekrutiert einige Experten („nahmen Experten und Wissenschaftler aus allen unseren Ländern teil“), um das zuvor installierte Subjekt des Wissens (Sp) mit noch mehr Wissen auszustatten, wodurch es gelingt, den Spannungsbogen für den Leser in letzter Sekunde noch einmal um ein paar Grad zu dehnen. Der Leser muss sich allerdings noch ein wenig über ein paar feierliche und staatstragende Formulierungen („Die Vitalität und Effizienz jeder Zivilisation lässt sich an der Attraktivität messen, die ihre Kultur für andere Länder besitzt“ (19)) hinweggedulden, bis er erfährt, wie die Minister (Sp) den „Europäischen Hochschulraum“ innerhalb der „ersten Dekade des dritten Jahrtausends“ (21) bauen wollen. Eine der in Deutschland populärsten Maßnahmen, die zur Schaffung eines Europäischen Hochschulraumes umgesetzt werden sollen, ist die Einführung von Bachelor und Master. Diese Maßnahme wird in der Bologna-Erklärung folgendermaßen festgeschrieben: „(23) Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei Hauptzyklen stützt: einem Zyklus bis zum ersten Abschluss (undergraduate) und einen Zyklus nach dem ersten Abschluss (graduate). (24) Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist der erfolgreiche Abschluss des ersten Studienzyklus, der mindestens drei Jahre dauert. (25) Der nach dem ersten Zyklus erworbene Abschluss attestiert eine für den europäischen Arbeitsmarkt relevante Qualifikationsebene.“ Hier wird klar und deutlich gesagt, dass es sich um zwei aufeinander folgende Abschlüsse handelt, wobei die Zulassung zum zweiten Zyklus den erfolgreichen Abschluss des ersten 8 Zyklus’ zur Voraussetzung hat, der selbst schon berufqualifizierend sein und mindestens drei Jahre andauern soll. Der zweite Abschluss kann folgendermaßen benannt werden: „(26) Der zweite Zyklus sollte, wie in vielen europäischen Ländern, mit dem Master und/oder der Promotion abschließen.“ Damit wurde von den Ministern beschlossen, was sowieso schon europäische Realität ist: ein Abschluss, der mindestens drei Studienjahre umfasst und ein darauf aufbauender Abschluss, der zum Master und zur Promotion oder zur Promotion führt. Auf der Ministerkonferenz, die zwei Jahre später in Prag stattfand, einigten sich die Minister auf folgende Formulierung: „(...) (27) Mit Genugtuung haben die Ministerinnen und Minister festgehalten, dass das Ziel – (28) die Einführung gestufter Abschlussgrade, die auf zwei Hauptstufen basieren, wobei Hochschulbildung als Undergraduate-Studium und Graduate-Studium definiert wird – in Angriff genommen und erörtert worden ist. (29) Einige Länder haben diese Struktur bereits eingeführt, und einige weitere Länder sind stark daran interessiert. (30) Es ist wichtig festzustellen, dass in vielen Ländern die Abschlüsse als Bachelor und Master oder vergleichbare zweistufige Abschlüsse an Universitäten und an anderen Hochschuleinrichtungen erworben werden können. (...)“ (Bildungsminister 2001) Neu ist an diesen Kommuniqués, dass die Minister hier weitesgehend gar nicht mehr selber sprechen. Vielmehr installiert das Kommuniqué einen Erzähler, der über das, was die Minister auf der Konferenz gesagt, getan und gedacht haben, berichtet („Mit Genugtuung haben die Ministerinnen und Minister festgehalten, dass X“ (27)) und an der einen oder anderen Stelle plötzlich selbst das Wort ergreift. So verweist das Adjektiv „wichtig“ in Aussage (30) auf einen Sprecher (Se), der in gewisser Hinsicht als Anwalt des „Bologna-Prozesses“ auftritt. Der Sprecher (Se) konstatiert, „dass in vielen Ländern die Abschlüsse als Bachelor und Master oder vergleichbare zweistufige Abschlüsse an Universitäten und an anderen Hochschuleinrichtungen erworben werden können“, und er weist darauf in, dass der Leser diesen Sachverhalt bitte zur Kenntnis nehmen möge, ohne daraus selbst weitere Schlussfolgerungen zu ziehen. So weist (Se) den Leser auf die eine oder andere Tatsache hin, deutet vorsichtig an, wer wo steht, ohne jedoch sich selbst als jemand hinzustellen, der etwas persönlich vertritt, noch als jemand, der in der Position wäre, Strafen zu verteilen. 9 Weitere zwei Jahre später, auf der Berlin-Konferenz 2003, wird Problematik des zweistufigen Studiensystems schließlich folgendermaßen formuliert: (31) Die Abschlüsse des ersten Studienzyklus sollten im Sinne des Lissabon-Abkommens den Zugang zum zweiten Zyklus, Abschlüsse des zweiten Zyklus den Zugang zum Doktorandenstudium ermöglichen. (...)“ (Bildungsminister 2003) Hier wird vom Erzähler mehr oder weniger empfohlen („sollte“), dass der zweite Abschluss dem ersten folgt und das Doktorandenstudium dem zweiten Abschluss. Damit lassen die Minister 4 Jahre nach der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung ihrem Erzählersprecher (Se) erstmalig eine klare Empfehlung aussprechen, wonach es nicht zwei sondern drei Abschlüsse geben soll. Einen feierlichen Beschluss der Minister selbst, wo der erste Abschluss den Titel „Bachelor“ trägt und der zweite Abschluss den Titel „Master“, finden wir auch im Kommuniqué der dritten Bologna-Nachfolgekonferenz in Bergen 2005 nicht. Zwar wird der Bolognakompetente Leser dem unwissenden Leser der Bologna-Dokumente empört entgegnen, dass es doch klar sei, dass mit dem „ersten Abschluss“ der „Bachelor“ und mit dem „zweite Abschluss“ der „Master“ gemeint war. Sicherlich, der Bolognakompetente Leser weiß das, weil er sich in den zahlreichen Ko- und Kontexten des Bologna-Diskurses auskennt. Und er hat auch kein Problem damit, in die Bologna-Dokumente genau diese Forderung nach Bachelor und Master hineinzulesen und klar und deutlich zu sagen: „Der Bologna-Prozess bedeutet die Einführung von Bachelor und Master!“. Ja, der Bolognakompetente Leser kann und weiß das alles! Aber warum die Minister nicht? Wie ist es zu erklären, dass die Minister zahlreiche andere Sprecher wie die „politische und akademische Welt“, die „öffentliche Meinung“, die Sorbonne-Erklärung, „viele Regierungen“ etc. zu Wort kommen lassen, um diese Sprecher Dinge fordern und beschreiben zu lassen, die weitesgehend bedeutungsleer bleiben? Wie interpretieren wir einen diskursiven Mechanismus, der ein wissendes, staatstragendes Subjekt einen Spannungsbogen ziehen lässt, der schließlich in nicht nur völkerrechtlich sondern darüber hinaus inhaltlich unverbindlichen Maßnahmen zur „Errichtung eines Europäischen Hochschulraumes“ erschlafft? Müssen wir vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse konstatieren, dass die Bologna-Erklärung fast nichts bedeutet und das Wenige auch noch von irgendwelchen anonymen Figuren vertreten wird? Sicherlich, wenn wir davon ausgehen, dass die Bedeutung des „Bologna-Prozesses“ sich in der Tiefe der Worte und der Entschlossenheit seiner Minister erschöpft. Aber die Bedeutung von Diskursen erschöpft sich nie allein in den Texten. Die Texte sind immer auch auf engere und weitere 10 Kontexte und Kotexte angewiesen. Aus der Sicht der Bologna-Erklärung sind die begeisterten Lesexperten und Expertenleser sowie die nationalen und regionalen Umsetzungsaktivitäten ein wichtiger Kontext, wo zahlreiche weitere Texte produziert werden. Ohne diese Kontexte wäre die Bologna-Erklärung auch dann bedeutungslos, wenn ihre Forderungen und Behauptungen inhaltlich etwas aussagen würden. 1.2. Bologna lesen Seit der zweiten Bologna-Nachfolgekonferenz in Berlin 2003 zählen policy-Fragen zu „Qualität“ zu den Top-Themen im „Bologna-Prozess“. Auf jener Berlin-Konferenz wurde eine Arbeitsgruppe aus EUA (Hochschulrektoren, Europa), EURASHE (Bildungseinrichtungen, Europa), ESIB (Studierende, Europa) und ENQA (Europäisches Netzwerk zur Qualitätssicherung) zusammengestellt, die den Auftrag erhielt, in ein Arbeitspapier zu Standards und Richtlinien zur Qualitätssicherung zu erarbeiten. Dieses Papier mit dem Titel „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ wurde auf dritten Nachfolgekonferenz in Bergen 2005 von den Ministern als Grundlage für die Qualitätssicherung beschlossen. In einem Artikel mit dem Titel „Neues zur Qualitätsfrage. Entwicklungen auf der Bergen-Konferenz“, veröffentlicht in einer Sonderausgabe des Hochschulmagazins „DUZ“ zum „Bologna-Prozess“, unterstützt und finanziert vom Bundesministerium (BMBF) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), bezieht sich Jürgen Kohler, Vorsitzender des deutschen Akkreditierungsrates (AR), zunächst auf jenen Passus im Bergen-Kommuniqué, wo das Papier der Arbeitsgruppe beschlossen wird. Anschließend berichtet Kohler über einen Aspekt zur Qualitätssicherung aus dem Arbeitspapier selbst, wonach Qualitätssicherung nicht nur die Überprüfung der Qualität von Studiengängen, sondern darüber hinaus die Überprüfung des Vorhandenseins eines Systems der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität an Hochschulen beinhaltet. Das folgende Textdokument folgt unmittelbar dieser Erörterung. Das Wort „damit“ in Aussage (1) verweist anaphorisch auf diesen Sachverhalt zurück. Um den Zusammenhang zu illustrieren, wird unten der letzte Satz des vor „damit“ Gesagten mit angeführt. „(...) Auf diesen Zweck gerichtet, sollen Hochschulen außer einer Selbstverpflichtung auf Qualität auch eine Strategie zur fortgesetzten Qualitätsentwicklung einführen. (einzeiliger Absatz im Originaldokument) 11 (1) Damit wird angedeutet, dass zumindest neben der Programmebene als Gegenstand der zu Akkreditierungszwecken zu analysierenden Qualität auch die hochschuleigenen Vorkehrungen zur Steuerung der institutionellen Prozesse bei Studiengangsentwicklung und – fortschreibung Akkreditierungsobjekt sein sollen. (2) Aus der Sicht des bisherigen deutschen Akkreditierungsansatzes hat dies eine erhebliche Brisanz, (3) weil damit für die interne, die externe und die agenturbezogen-externe Qualitätssicherung nicht mehr ausreichend erscheint, sich auf die Betrachtung des Studiengangs als solchen, also gewissermaßen des „Produkts“, zu beschränken, ohne den Blick auch auf die studiengangentwickelnde Qualität der Hochschule, also quasi des „Produzenten“, zu richten.“ Der einzeilige Absatz im Originaldokument und das Wort1 „damit“ markieren zunächst einen Bruch zwischen dem Bericht über die Inhalte des Arbeitspapiers und der Interpretation, die ab „damit“ folgt. Die anaphorische Geste des Wort „damit“, verbunden mit dem einzeiligen Absatz, verweist auf den Äußerungskontext der Aussage. Diese beiden Äußerungsspuren erzeugen beim Leser Aufmerksamkeit für das, was der Sprecher (Sp) nun zu sagen hat. In mündlichen Reden werden solche Äußerungsabdrücke durch das Heben des Kopfes, das Zuwenden zum Publikum oder eine Veränderung in der Stimmlage evoziert. Schriftliche Diskurse müssen auf andere Ressourcen zurückgreifen. Eine dieser Ressourcen ist das Einfügen eines Absatzes. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, statt „damit wird angedeutet“ „damit wird nun angedeutet“ zu sagen. Das Subjekt (Sp) wird in Aussage (1) als ein Leser des „Bologna-Prozesses“ hervorgebracht, der die Dokumente ausführlich studiert hat und mit viel Hintergrundwissen als Experte auslegen kann. Nach der berichtenden Darstellung über die „neuesten Entwicklungen zu Qualitätsfragen“ wird (Sp) in Aussage (1) als Interpretateur dieser neuesten Entwicklungen sichtbar, indem er sich (evoziert durch den Äußerungsabdruck) einem Publikum zuwendet, dem unterstellt werden kann, dass es über Dinge, die (Sp) kennt, nicht Bescheid weiß. Das Verb „angedeutet“ und das Adverb „zumindest“ sowie das Wort „auch“ instituieren einen Sprecher (Sb), den (Sp) behaupten lässt, dass „neben der Programmebene der Qualität die Prozessebene der Qualität akkreditiert werden muss“ (Fx), und einen Sprecher (Sa), der dies verneint („Nein, die Programmebene muss nicht akkreditiert werden“ (Fy)). Das Subjekt (Sp) weist in Aussage (1) den Sprecher (Sa) dabei vollständig zurück, ohne jedoch gänzlich die Position von (Sb) zu beziehen. Sprecher (Sb) vertritt hier die Position des „Bologna-Prozesses“. So lässt (Sp) (Sb) im Namen des „Bologna-Prozesses“ fordern, dass 1 Nehmt mir das hier nicht übel. Ich muss erst noch die Wortarten suchen. :-) 12 (Fx), wobei sich Sprecher (Sp) als sachkundiger und aufmerksamer Leseexperte des „Bologna-Prozesses“ nicht ganz darauf festlegt, ob (Fx) tatsächlich wahr ist. (Sp) weist zwar (Fy) als „falsch“ zurück, kann sich jedoch auch nicht emphatisch auf „(Fx) = wahr“ festlegen. In Aussage (2) bricht dieser Schwebezustand zusammen und es wird präsupponiert, dass (Fx). Das polytemporale Adverb „bisherigen“ evoziert einen Zeitpunkt „jetzt“ und einen Zeitpunkt „damals“. Dadurch wird ein Sprecher (Sad) evoziert, den (Sp) sagen lässt „es wird die Programmebene akkreditiert“ (Fyd), wobei das, was (Sad) behauptet, auf den Zeitpunkt „damals“ verschoben wird. Das Demonstrativpronomen „dies“ verweist anaphorisch auf Aussage (1) zurück und positioniert die Problematik der Aussage (1) auf den Zeitpunkt „jetzt“. Durch die Wertung „erhebliche Brisanz“ wird der Leseexperte (Sp) sichtbar, der nun präsuppositional (Fx) übernimmt, wobei (Fx) (Fyd) ausschließt (wenn (Fyd) wahr ist, dann ist (Fx) falsch; da (Fyd) wegen Aussage (1) aber in jedem Fall falsch ist, kann hier nun (Fx) wahr sein). So gelingt es dem Leseexperten (Sp) sich mit dem, was (Sb) in Aussage (1) behauptet hat, nämlich (Fx), zu identifizieren, ohne mit (Sb) zu verschmelzen. Der diskursive Mechanismus, der hier zur Anwendung kommt, ist allerdings nicht die klassische Präsupposition, sondern die Inferenz. Dadurch, dass (Fx), (Fy) und (Fyd) bereits geäußert waren, konnte Leseexperte (Sp) aus den geäußerten Inhalten eine Variante isolieren, die den offen gelassenen Ort (F...j) besetzt. Der Mechanismus der Inferenz geht dabei auf die Suche nach adäquaten Optionen, die bereits vorhanden sind, jedoch nicht notwendigerweise diesen Platz beziehen müssen. Der Leseexperte (Sp) kann nun problemlos vom Leser seines Diskurses, dem interessierten Publikum, erwarten, dass (F...j) mit dem Inhalt von (Fx) gefüllt werden muss, ohne jedoch die Form der Forderung von (Sb) in Aussage (1) zu übernehmen. Die Grundstruktur des diskursiven Mechanismus von Aussage (2) wird in Aussage (3) wiederholt und verfestigt. Das Wort „weil“ weist zunächst in Verbindung mit „damit“ anaphorisch auf Aussage (2) zurück. „Weil“ leitet zudem eine Begründung ein, die ebenfalls eine Äußerungsmarkierung ist, und transportiert so die in Aussage (2) inferierte Behauptung (Fx) in Aussage (3). In der Formulierung „nicht mehr ausreichend erscheint“ wird wiederum ein Sprecher (Sb), den der Leseexperte (Sp) sagen lässt „der Studiengang, das ‚Produkt’, und die studiengangentwickelnde Qualität der Hochschule, der ‚Produzent’, werden akkreditiert“ (Fx), und ein Sprecher (Sa) hervorgebracht, der (Fx) verneint. Der Leseexperte (Sp) orchsetriert hier diese beiden Stimmen, indem er (Sa) zurückweist und durch die Einschränkung „es scheint“ (Sb) Recht gibt und sich selbst als kritischer und sachkundiger Experte bestätigt. 13 Das Publikum weiß nun Bescheid! Nur, hat sich der Leseexperte vielleicht nicht doch ein wenig verhaspelt? Oder ist das hier nur ein Druckfehler? Meinte unser Leseexperte mit der zweiten Metapher wirklich den „Produzenten“ und nicht den „Produktionsprozess“? Sitzt da vielleicht jemand im Publikum, dem etwas Klar gemacht werden sollte? Oder ist die Problematik, die in Aussage (1) bis (3) entwickelt wurde, vielleicht gar nicht die Frage, ob nur das „Qualitätsprodukt“ oder aber beides, das „Qualitätsprodukt“ und der „Produktionsprozess“, akkreditiert werden muss? Am Ende des Beitrags bietet uns Jürgen Kohler noch eine zusammenfassende Interpretation der „neuesten Entwicklungen zur Qualitätsfrage“. „(...) (4) Es bietet sich auch die Basis dafür, die Freiheit von Forschung und Lehre nach Artikel 5 des Grundgesetzes und die Hochschulautonomie mit dem Akkreditierungssystem zu verbinden, das von einem kleinteiligen Überwachungssystem zu einem System gelangt, das auf dem Grundsatz des „vorsichtigen Vertrauens“ errichtet ist. (5) Und dass damit eine Forderung schon des Berliner Kommuniqués von 2003 erfüllt wird, zeigt wiederum nur, (6) dass das Akkreditierungswesen seine Legitimation aus dem Bologna-Prozess herleiten kann; (7) dort heißt es sinngemäß, auch wenn dies eine Nachschau von außen nicht ausschließt: (8) Die Zuständigkeit für die Qualitätssicherung liegt primär bei den Hochschulen.“ Durch die Formulierung/Nomen „Freiheit von Forschung und Lehre nach Artikel 5 des Grundgesetzes“ und „Hochschulautonomie“ vs. „Akkreditierungssystem“ und „kleinteiliges Überwachungssystem“ wird in Aussage (4) eine Lagerkonstellation konstruiert, die durch das Zitat „‚vorsichtiges Vertrauen’“ vom Leseexperten (Sp) zurückgewiesen wird. Aufgrund des Entscheidungssystems im kooperativen Bildungsföderalismus haben die Hochschulen das Recht, über die Abschlüsse, die Inhalte der Lehre und die Durchführung der Lehre frei zu entscheiden. Das betrifft gerade die Frage der Qualitätssicherung, die sich auf die Ausgestaltung der Studiengänge bezieht. Dadurch könnten sich die Hochschulen grundsätzlich dem Akkreditierungswesen entziehen und dies zur Not beim Bundesverfassungsgericht einklagen. Denn im Gegensatz zur Genehmigungspraxis durch die Ministerien greift die Akkreditierung direkt in die Studieninhalte ein. So wird in Aussage (4) der Gremien-Subframe und der Legislativ-Subframe des BKFF (vgl. Kapitel 4, Abschnitt 1.2.1) mobilisiert, wodurch der diskursive Raum zunächst in zwei kontradiktorische Lager „Freiheit von Forschung und Lehre“ (Hochschulen) vs. „Akkreditierungssystem als kleinteiliges Überwachungssystem“ (Akkreditierungsrat) aufgeteilt wird. Das Nomen 14 „Hochschulautonomie“ mobilisiert dagegen den Hochschulsteuerungsframe (HSF) (vgl. Kapitel 4, Abschnitt 1.1.1), wobei dieses Nomen in diesem Kontext eine den Hochschulen zugeschriebene und allgemein, also auch vom Leseexperten und Vorsitzenden des Akkreditierungsrates (Sp) anerkannte Forderung artikuliert. Dieser kontradiktorischen Lagerkonstellation wird nun ein „System des ‚vorsichtigen Vertrauens’“ gegenübergestellt. Die Formulierung „‚vorsichtiges Vertrauen’“ evoziert neben (Sp) vier weitere Sprecher: Zunächst einen Sprecher, den (Sp) „vorsichtiges Vertrauen“ für sich sagen lässt. Leseexperte (Sp) sagt also nicht selbst „vorsichtiges Vertrauen“, sondern lässt einen Sprecher (Sz) das „System“ umschreiben, für das (Sp) Partei ergreift. Dieser Sprecher (Sz) wird durch die Anführungszeichen instituiert. Sprecher (Sz) wiederum lässt ebenfalls andere Sprecher zur Sprache kommen. Ein Sub-Sprecher (Za), der sagt „kein Vertrauen“, einen Sub-Sprecher (Zb), der sagt „volles Vertrauen“ und einen Sub-Sprecher (Zx), der sagt „weder ‚kein Vertrauen’ noch ‚volles Vertrauen’“ und damit sowohl (Za) als auch (Zb) zurückweist. Mit diesem Sprecher (Zx) identifiziert sich (Sz). So gelingt es dem Leseexperten (Sp) Stellung zu beziehen, indem er einen Anderen (Sz) sagen lässt, was er fordert, der selbst „seine“ Forderung nur über einen weiteren Sprecher (Zx) artikuliert, der letztlich nur Position bezieht, indem er zwei weitere Sprecher (Za) und (Zb) zurückweist! In Aussage (5) triumphiert der Leseexperte regelrecht, indem er durch den Verweis auf das Berlin-Kommuniqué sein ganzes Expertenwissen hervorholt und die Legitimität seiner Agentur, des AR, aus den Forderungen des „Bologna-Prozesses“ in Form einer formallogischen Ableitung herleitet. Auch wenn nun alles geklärt, die kontradiktorische Frontstellung von „Hochschulen“ vs. „Akkreditierungsrat“ aufgelöst und mit dem „System des ‚vorsichtigen Vertrauens’“ eine Lösung für das Problem gefunden scheint – instituiert das Adjektiv „primär“ in Aussage (8), die wie ein Befreiungsschlag wirkt, nicht ein „sekundär“, wodurch eben jene Lösung gleich wieder eine neue Polyphonie einleitet, die den Leseexperten in einen weiteren Konflikt zwischen seiner unabhängigen Expertenrolle und seiner Rolle als Politiker im System der Politikverflechtung des kooperativen Bildungsföderalismus schlittern lässt? Anhang: 1) policy-frames: 1.2.1. Qualitätsframe 15 Die Entstehung des Qualitätsframes (QF) geht zurück auf den Umschwung in der hochschulpolitischen Debatte Anfang der 1990er Jahre, wo zunehmend die Hochschulen und weniger der Staat Gegenstand der Debatte wurden (siehe auch „Studienreformframe“ und „Hochschulsteuerungsframe“). Der QF zielt im Kern auf eine Evaluation der in den Hochschulen erzielten Produkte und Dienstleistungen in Bildung und Wissenschaft. Lehre und Forschung soll einerseits hinsichtlich der Effizienz der eingesetzten Mittel und andererseits hinsichtlich des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und ökonomischen Bedarfs (Effektivität) begutachtet werden. Im Rahmen der leistungsorientierten Finanzierung (siehe auch „Hochschulsteuerungsframe“), der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen (siehe auch „Spitzenuniversitätenframe“ und „Internationalisierungsframe“) und der Verbesserung der Lehre (siehe auch „Studienreformframe“) sollen Lehre und Forschung in ein System der Qualitätssicherung eingebettet werden (vgl. Friedrich 2003). Dieses System besteht aus drei Teilen: der Akkreditierung, der Evaluation und der Rechnungslegung (Accountability). Zunächst werden allgemeine Ziele definiert, die der Akkreditierung zu Grunde liegen. Im Falle der Lehre gehören pädagogisch definierte Kompetenzen wie Wissen, Verstehen und Können sowie (vgl. Kultusministerkonferenz 2005) formale Strukturen wie spezifische Abschlüsse (Bachelor/Master), Leistungspunktesysteme (ECTS), eine modularer Aufbau des Studiums etc. zu diesen Zielen (siehe auch „Bolognaframe“). Im Akkreditierungsprozess sollen Studiengänge von Akkreditierungsagenturen mit Blick auf solche Kriterien überprüft werden. Dafür verfassen die Antrag stellenden Hochschulen zunächst einen Bericht über den einzurichtenden Studiengang. Auf Grundlage dieses Berichts sowie ein- bis mehrtägigen Begehungen der Hochschulen durch eine Begutachterkommission erstellt die Akkreditierungsagentur einen Bericht, wo die Akkreditierung mit oder ohne Auflage erteilt oder nicht erteilt wird. Die Akkreditierungsagenturen, die selbst von einem Akkreditierungsrat zugelassen worden sind, sollen aus Repräsentanten der Wirtschaft, des Staates, der Wissenschaft, der Studierenden und international zusammengesetzt sein. Einige Jahre nach der Akkreditierung ist eine Evaluation vorgesehen. Das Evaluationsverfahren überprüft im wesentlichen, ob der akkreditierte Studiengang so, wie er im Rahmen der Akkreditierung zugelassen wurde, auch realisiert wurde. Der dritte Aspekt, die Rechnungslegung, bezieht sich auf eine permanente Re-Akkreditierung und Evaluation in der Zeit. Das heißt, Hochschulen sollen ständig die Aktualität, Effizienz und Notwendigkeit der von ihr angebotenen Dienstleitungen nachweisen (siehe auch „Hochschulsteuerungsframe“, „Studienreformframe“ und „Internationalisierungsframe“). 16 Das Qualitätssicherungssystem in der Forschung soll im Prinzip ebenso aufgebaut werden. Allerdings tut sich der QF schwer, die Forschung ebenso klar zu verorten wie die Lehre, weil in der Forschung diejenigen, die sie betreiben, auch diejenigen sind, die sie beurteilen, nicht jedoch diejenigen, die sie finanzieren. Im Grundsatz gilt allerdings auch für die Forschung, dass sie aktuellen internationalen Standards entsprechen (durch Veröffentlichungen in entsprechenden Zeitschriften), effizient durchgeführt und permanent begründet (Forschungsberichte) sowie gleichzeitig innovativ ausgerichtet sein soll. 1.2.2. Bolognaframe Der Bolognaframe (BF) geht zurück auf eine Erklärung von 29 europäischen Bildungsministerinnen und –ministern 1999, wurde 2000 in die Lissabonstrategie der Europäischen Union eingebunden, wonach Europa zum „wettbewerbsfähigsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ werden soll, und entwickelte sich im Zuge mehrerer Nachfolgekonferenzen weiter. Der BF zielt auf die Erschaffung eines Europäischen Hochschulraumes (EHEA) bis 2010 und auf eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen dieses Raumes (siehe auch „Hochschulsteuerungsframe“ und „Internationalisierungsframe“). Zudem soll der EHEA mit einem Europäischen Forschungsraum (ERA) verbunden werden (vgl. Bildungsminister 2003). Um diese Kernziele zu realisieren, sollen alle Studiengänge auf Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt werden und im Rahmen des EHEA leicht verständlich und vergleichbar sein. Zudem soll das Studium eine Beschäftigungsfähigkeit (Employability) aufweisen (siehe auch „Studienreformframe“), mit einem Kreditpunktesystem (ECTS) und einem Diploma Supplement (siehe auch Europaframe“), das den Inhalt des Studiums mehrsprachig darstellt, ausgestattet sein. Darüber hinaus sollen die Studiengänge in Modulform strukturiert sein, eine Europäische Dimension erhalten (siehe auch „Internationalisierungsframe“) und in ein Qualitätssicherungssystem eingebettet sein (siehe auch „Qualitätsframe“). Diese Maßnahmen sollen neben der Beschäftigungsfähigkeit innerhalb des EHEA die internationale Mobilität der Studierenden erleichtern (siehe auch „Hochschulausbauframe“ und „Internationalisierungsframe“). Schließlich sollen alle strukturellen Maßnahmen im Europäischen Rahmen abgestimmt und koordiniert werden (vgl. Eckardt 2005, Bildungsminister 1999). Auf der ersten Nachfolgekonferenz in Prag 2001 kam noch das Ziel hinzu, das Lebenslange Lernen zu fördern, die Studierenden in den Reformprozess mit einzubinden und 17 die internationale Attraktivität des EHEA zu fördern (vgl. Bildungsminister 2001). Auf der zweiten Nachfolgekonferenz in Berlin wurde das Doktorandenstudium als dritte Phase nach Bachelor und Master sowie die Integration des EHEA mit dem ERA in den BF mit aufgenommen (vgl. Bildungsminister 2003). 2) polity-frames: 1.3. polity-frames Polity-frames beschreiben das hochschulpolitische Entscheidungssystem. In der Politikwissenschaft spricht man hier auch vom institutionellen System (Scharpf). Wenn im folgenden von „Akteuren“ die Rede ist, dann wird damit weder eine Akteurstheorie unterstellt noch irgendeine andere Form von Subjektivismus. Wir benutzen den Begriff „Akteur“, weil sich die „Akteure“ in den polity-frames selbst als Akteure bezeichnen. Dieses Wort dient also nur der Markierung von diskursiven Instanzen, die in den Diskursen regelmäßig bezogen werden können. Wie auch die policy-frames bestehen die polity-frames aus Terminals und stellen allgemeine Bedeutungs- und Handlungsskripts dar. Allerdings liegt die Bedeutung dieser frames auf einer anderen Ebene als die der policy-frames. Im folgenden sollen einige zentrale Merkmale des institutionellen Systems herausgearbeitet werden, die wir im weitesten Sinne als Terminals bezeichnen können. Ebenso wie die Elemente der policy-frames werden auch die Elemente der polity-frames ausgehend von diskursiven Texten mobilisiert. Und ebenso wie die policy-frames sind auch die polity-frames keine Idealtypen sondern interdiskursive Ressourcen. Schließlich erhebt auch die folgende Darstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 1.3.1. der kooperative bildungspolitische Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland Das institutionelle Entscheidungssystem im Hochschulbereich der Bundesrepublik Deutschland entspricht im Kern der Grundstruktur des kooperativen Staates, der durch ein konsensorientiertes Zusammenwirken von Staat und zivilgesellschaftlichen Interessenverbänden gekennzeichnet ist (vgl. Esser 1999). Allerdings weist der bildungspolitische kooperative Föderalismus-frame (BKFF) gegenüber der üblichen Struktur des kooperativen Staates durch die grundgesetzlich festgeschriebene Wissenschaftsfreiheit und die ebenfalls grundgesetzlich festgeschriebene Kulturhoheit der Länder einige 18 Besonderheiten auf, die sich bereits in der Zusammensetzung der kooperativen Akteure zeigt. Neben den legislativen Organen von Bundesparlament, Länderparlamente und Hochschulgremien und den zivilgesellschaftlichen Interessenverbänden treten bundesweite Arbeits- und Koordinierungszusammenhänge. Zu den Gegenwärtig wichtigsten beiden dieser bundesweiten Zusammenhänge zählen die Kultusministerkonferenz (KMK) und der Akkreditierungsrat (AR). Diese Arbeitszusammenhänge dienen der bundesweiten Koordinierung von Bildungs- und Wissenschaftsfragen und haben weder eine Lobbyfunktion noch Gesetzgebungs- und Ausführungskompetenzen (vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1997). Von daher ist der BKFF durch eine dreipolige Akteurkonstellation, die jeweils als Subframe dargestellt werden kann, gekennzeichnet, die im folgenden in Umrissen beschrieben werden soll. 1.3.1.1.Der Legislativ-Subframe („Hauen und Stechen“) Zum Legislativpol zählen die Länderparlamente, der Bundestag und die Hochschulen. Auf der Grundlage des Art. 30 Grundgesetz haben grundsätzlich die Länder im Kulturbereich, zu dem auch die Hochschulen gehören, die gesetzgebenden und administrativen Kompetenzen (vgl. Arbeitgruppe Bildungsbericht 1997). Die Länder entscheiden autonom über die Errichtung und Schließung von Hochschulen. Über die Landeshochschulgesetze und die Finanzierung bestimmen sie darüber hinaus über die Struktur der Hochschulen. Die Steuerungsmöglichkeiten der Länder finden erst an der durch das Grundgesetz garantierten Wissenschaftsfreiheit, an den Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und an den eigenen fiskalischen Möglichkeiten ihre Grenze. Der Bund hat vor allem durch das Hochschulrahmengesetz, das Bundesausbildungsfördergesetz, die Nachwuchsförderung, die Forschungsförderung, das Dienstrecht und das Hochschulbaufördergesetz Kompetenzen im Hochschulbereich. Das Hochschulrahmengesetz legt allgemeine Normen und Grundsätze für den Hochschulbereich fest und über das Dienstrecht werden bundesweit einheitliche Laubahnen im öffentlichen Dienst festgeschrieben. Über die Forschungsförderung, die Ausbildungsförderung, die Nachwuchsförderung und den Hochschulbau hat der Bund vor allem Einfluss über seine Voll- bzw. Anteilfinanzierung. Darüber hinaus ist der Bund in der Lage, über Hochschulsonderprogramme den Hochschulen eine über das übliche bundesweite Budget hinausgehende Zusatzfinanzierung zukommen zu lassen. In der Regel „erkauft“ sich der Bund dadurch auch Einfluss auf die strukturelle Entwicklung im Hochschulbereich, weil die Länder seit der Gründung der Bundesrepublik auf die Zusatzfinanzierung des Bundes 19 angewiesen sind, um von ihren formalen Zuständigkeiten im Rahmen des Art. 30 Grundgesetz Gebrauch machen zu können. Die Kompetenzen des Bundes im Hochschulbereich finden in der Regel in der Kulturhoheit der Länder und der Wissenschaftsfreiheit ihre Grenzen, die oftmals erst vom Bundesverfassungsgericht gezogen werden. Die Hochschulen haben durch Art. 5 III. Grundgesetz das Recht auf Selbstverwaltung (vgl. Bauer 1999). Dazu zählen neben der Forschungsfreiheit das Recht, die Art und Weise festzulegen, wie der wissenschaftlichen Nachwuchs herangezogen wird und dies auch durchzuführen. Die Hochschulen entscheiden über die Lehrinhalte, die Vergabe wissenschaftlicher Titel und die Reproduktionswege der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Schließlich finden die Kompetenzen der Hochschulen ihre Grenzen an den Länderkompetenzen, die Bundeskompetenzen und an der Finanzierung. Gerade durch die Finanzhoheit und Entscheidungskompetenzen über die Struktur der Hochschullandschaft der Länder ist dem offiziellen, durch das Grundgesetz gesetzten Autonomierahmen der Hochschulen immer auch ein „inoffizieller“, durch eben jene Länderhoheit begründeter Handlungsrahmen an die Seite gestellt. Aus diesem System der Kompetenzverteilung ergibt sich schließlich, dass keiner der drei Akteure wirkliche Autonomie hat, weil sich die Kompetenzen dieser drei Akteure in den meisten Fällen überschneiden. Die jeweilige Überschneidungsform kann nur für jeden einzelnen Fall beschrieben werden. Neben der oben kurz umrissenen rechtlichen Kompetenzverteilung ergeben sich aus eben dieser Kompetenzverteilung zwei weitere Konfliktmechanismen, die wiederum auf die institutionellen Kompetenzen zurückstrahlen. Diese Konfliktform könnte man als „Hauen und Stechen“ beschreiben. Die obere Ebene (Bund – Land und Land – Hochschule) ist auf die untere Ebene immer angewiesen, wenn es darum geht Gesetze umzusetzen. Dadurch wird der unteren Ebene immer ein gewisser Raum für Boykot und interessengeleiteter Rechtsauslegung eröffnet („Stechen“). Ein Beispiel hierfür ist die teilweise Nichtumsetzung von Rahmenvorschriften des Bundes aus dem Hochschulrahmengesetz in die Landeshochschulgesetze der Länder und die gegenwärtige Umsetzungspraxis der Hochschulen im „Bologna-Prozess“. Umgekehrt ist die untere Ebene auf die obere Ebene durch die begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen, um ihre rechtlich festgeschriebenen Kompetenzen wahrnehmen zu können. Dadurch eröffnete sich der oberen Ebene immer ein gewisses Verhandlungs- bzw. Erpressungspotenzial („Hauen“). Hierfür wiederum ist die Ausweitung der Bundeskompetenzen im Hochschulbereich (Hochschulrahmengesetz und Hochschulbaufördergesetz) gegen Ende der 1960er/Anfang der 20 1970er Jahre sowie die Durchsetzung des „Bologna-Prozesses“ an den Hochschulen seitens der Länder ein Beispiel. 1.3.1.2.der Gremien-Subframe („Politikverflechtung“) Der zweite Pol im BKFF wird von bundesweiten Gremien und Arbeitsgruppe gebildet, die aus Vertretern von Bund, den Ländern und, in einigen Fällen, Hochschulen und der zivilgesellschaftlichen Interessensvertretungen zusammengesetzt sind. Zu diesen Arbeitgruppen zählen bzw. zählten die „Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung“ (BLK) (1970 bis heute), der „Wissenschaftsrat“ (WR) (1957 bis heute), die „Ständige Konferenz der Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland“, kurz: „Kultusministerkonferenz“ (KMK) (1949 bis heute), der „Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen“ (1953 bis 1965), der „Deutsche Bildungsrat“ (1965 bis 1975) und weitere, zu Einzelfragen sporadisch gebildeten Bund-Länder-Arbeitsgruppen (vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1997). Neuerdings muss auch der Akkreditierungsrat (AR), der als Stiftung 1999 eingerichtet wurde, dazugezählt werden. Der rechtliche Hintergrund für die Bildung zahlreicher bundesweiter Arbeitsgruppen ist die durch Art. 30 Grundgesetz festgeschriebene Kulturhoheit der Länder, die Kompetenzverteilung im Bildungsbereich sowie das Interesse aller Akteure, trotz Art. 30 Grundgesetz bundeseinheitliche Reglungen im Bildungsbereich herzustellen (vgl. Bauer 1999). Durch diese Konstellation entsteht ein Entscheidungssystem, das Scharpf als „Politikverflechtung“ beschrieben hat und das insgesamt als ein typisches Merkmal der föderalistischen Bundesrepublik gilt (vgl. Scharpf 1978). Politikverflechtung bedeutet, dass Gesetzgebungs- und Durchführungskompetenzen auf unterschiedlichen administrativen und legislativen Ebenen verteilt sind, wobei sich die Interessen der entsprechenden Akteure in der Regel widersprechen. Da aber kein Akteur autonom handeln kann und somit auf die Kooperation der anderen Akteure angewiesen ist, entsteht ein Koordinierungs- und Konsenszwang. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in allen oben aufgezählten Gremien bei allen wichtigen Fragen das Einstimmigkeitsprinzip und eine paritätische Zusammensetzung der beteiligten Akteursgruppen herrscht. Politikverflechtung führt in der Regel zu einem Entscheidungssystem, das entweder keine, keine weitreichenden oder Entscheidungen zustande bringt, mit der allen Beteiligten unzufrieden sind. Insofern erzeugt Politikverflechtung bei den Beteiligten und Betroffenen nach Scharpf enormen Entscheidungsstress und Frust. Allerdings gibt es nicht nur einen Mechanismus der 21 Politikverflechtung, sondern unterschiedliche Typen und Aspekte dieses Mechanismus. Die von Scharpf herausgearbeiteten Merkmale der Politikverflechtung gelten im Falle des Bildungsbereichs vor allem für Fragen der Finanzierung und Bildungsplanung (vgl. Raschert 1980)2. Welche konkrete Ausprägungsform der Politikverflechtung wir jeweils beobachten können, hängt immer von den beteiligten Akteuren und der Brisanz der Problematik ab. Für unseren Fall des „Bologna-Prozesses“ wollen wir uns auf die Beschreibung der Politikverflechtung in der KMK und im AK und die damit verbundene Problematik beschränken. Die KMK ist ein freiwilliger Zusammenschluss der für Kulturfragen zuständigen Minister/-innen und Senator/-innen der Bundesländer. In der KMK hat jedes Land eine Stimme und es herrscht in den meisten Fragen das Einstimmigkeitsprinzip. Die KMK fasst Beschlüsse und Empfehlungen und erarbeitet durch das Sekretariat und die Ausschüsse Berichte und Analysen. Die Beschlüsse der KMK sind nicht rechtskräftig, sondern müssen durch die Länderparlamente in Landesgesetze umgewandelt werden. Diese Praxis erzeugt bei den Landesparlamenten regelmäßig Unmut, weil so diese Beschlüsse einerseits den üblichen demokratischen Prozessen enthoben sind aber andererseits nicht nicht umgesetzt werden können, will ein Bundesland sich bundesweit nicht isolieren (vgl. Raschert 1980). Dies glit gerade für weitreichende Beschlüsse. Die Beschlüsse der KMK haben also von Fall zu Fall unterschiedliche informelle Verbindlichkeit. Im Falle des „Bologna-Prozesses“ spielte die KMK durch zahlreiche Beschlüsse zur Einführung von Bachelor und Master eine bedeutende Rolle. Zu nennen ist hier vor allem der Beschluss „Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“, die bereits 1999 verabschiedet wurde, sowie zahlreiche andere Dokumente zu dieser Problematik. Die „Strukturvorgaben“ wurden unmittelbar nach der Novellierung des HRG beschlossen, wo die Erprobung von Bachelor- und Masterstudiengängen vorgesehen war. Wie Witte betont, konnte dieses und andere Papiere zu den „Bologna-Reformen“ zu dieser Zeit relativ geräuschlos und unkontrovers die KMK passieren, weil die mit Bachelor und Master verbundenen Reformen zu dieser Zeit als relativ unverbindliche Vorschläge eingeschätzt wurden, denen man lediglich einen Nischenstatus für ausländische Studierende einräumte (vgl. Witte 2006b). Diesem und anderen Papieren wurde also eine gewisse Unverbindlichkeit zugesprochen. Vor diesem Hintergrund wurden dann zahlreiche andere Papiere beschlossen, die inhaltliche Ausgestaltungsräume für die erst ab ca. 2003 als solche in die politische Diskussion eingetretenen „Bologna-Reformen“ vorschreiben. Vor dem Hintergrund dieser 2 Aus diesem Grunde gilt die BLK ab ca. 1980 als „tot“. 22 spezifischen Form der Politikverflechtung bedeutet dies zweierlei. Erstens war die Frage nach Bachelor und Master, Akkreditierung und Modularisierung etc. zum Entscheidungszeitpunkt kein wirkliches Politikum, das in Politysystemen der Politikverflechtung zu Frust und Entscheidungsunfähigkeit führt (vgl. Raschert 1980). Die Entscheidung wurde getroffen noch bevor es etwas zu entscheiden gab, das heißt noch bevor sich andeutete, dass mit der „Bologna-Reform“ ein großflächiger Umwälzungsprozess in Gang gekommen ist. Zweitens war mit den zahlreichen Beschlüssen, Arbeitspapieren und Berichten ein umfassendes policyProgramm „dezentral“ erarbeitet, auf das in der Umsetzung der „Bologna-Reformen“ zurückgegriffen werden konnte. Den Ländern dienen diese Beschlüsse als Verweise für die über Zielvereinbarungen, Landeshochschulgesetze und im Rahmen von Finanz- und Strukturverhandlungen umzusetzenden „Bologna-Reformen“. Den Hochschulen wiederum dienen diese Papiere als willkommene Handlungsanweisungen für eine Reform, deren Gegenstand Teil ihrer durch Art. 5 III. Grundgesetz garantierten Wissenschaftsfreiheit ist. Eine ähnliche Struktur weist der AR auf. Der AR ist besetzt von Vertreter/-innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und den Studierenden und arbeitet auf Grundlage eines Vertrages zwischen den Ländern. Dieser Vertrag sieht vor, dass der Akkreditierungsrat allgemeine Qualitätsstandards für die Errichtung und Ausgestaltung neuer Studiengänge entwirft, Akkreditierungsagenturen akkreditiert, die das Recht haben, das Sigel des AR zu vergeben und diese Akkreditierungsagenturen überwacht. Zudem sieht der Vertrag vor, dass die Länder in der Zulassung neuer Studiengänge dieses Akkreditierungssystem akzeptieren und zur Grundlage ihrer Zulassungsentscheidung machen. Der Vertrag sieht darüber hinaus vor, dass jedes Land diesen Vertrag flexibel handhaben kann. Das heißt, dass sich die Länder hier keinesfalls endgültig darauf festgelegt haben, dieses Akkreditierungssystem als Grundlage ihrer Entscheidung zu akzeptieren. Das letzte Wort über die Übernahme der Verantwortung haben also immer noch die Länder. Das typische Merkmal dieses Systems der Politikverflechtung besteht darin, dass in diesem System der Ort der Entscheidung „verloren gegangen“ ist (KMK) und immer wieder in dieses System hin und her geschoben werden kann (AK). Dadurch wird der Entscheidungsstress aber keinesfalls vermieden sondern ebenfalls nur verschoben, und zwar auf die Hochschulen. 1.3.2. EU-Bologna-polity-frame 23 Seit der Regelung im Vertrag von Maastricht (EGV §§ 149/150) haben die Mitgliedstaaten im Hochschulbereich die alleinige Zuständigkeit. Die Europäische Union hat nur subsidiäre Kompetenzen. Das heißt, dass die Kommission nur dann tätig werden kann, wenn Aufgaben im Interesse der Union und ihrer Mitglieder durch die einzelnen Staaten allein nicht bewältigt werden können. Dabei kann dieses Subsidiaritätsprinzip stets nur von Fall zu Fall ausgelegt werden. Was genau ein Eingriff ist und was eine subsidiäre Maßnahme, ist daher selbst Gegenstand von politischen und juristischen Auseinandersetzungen (vgl. Hrbek 1994). Im Hochschulbereich erstrecken sich die Maßnahmen der Europäischen Union im wesentlichen auf die Koordination von Mobilitätsförderung, die Bereitstellung von Informationen zu europäischen Bildungsfragen und die Entwicklung von Instrumenten zur europäischen Vergleichbarkeit wie ECTS, Diploma Supplement, Qualitätssicherung etc. (vgl. Eckhardt 2005). Die Umsetzung der Entscheidungen der Europäischen Union ist grundsätzlich von der freiwilligen Kooperation der Mitgliedsstaaten abhängig. Im Kern erarbeitet die Kommission ein ganzes Set an Informationen, Strukturprogrammen und Mobilitätsprogrammen, die sie den Mitgliedstaaten als Servicedienstleistung zur Verfügung stellt. Das polity-System des „Bologna-Prozesses“ entfaltete sich in ebendiesem Kontext. Seit etwa Mitte der 1990er Jahre entstanden regelmäßige Treffen von Generaldirektoren des Bildungsbereichs aus unterschiedlichen europäischen Mitgliedstaaten. Vor dem Hintergrund der EGV-Regelung dienten diese Treffen zunächst nur einem lockeren Austausch auf höherer Beamtenebene (vgl. Friedrich 2001c). Im Mai 1998 unterzeichneten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien die sogenannte Sorbonne-Erklärung, worin diese vier Länder erklärten, gemeinsame Standards im jeweiligen nationalen Hochschulwesen einführen zu wollen. Die Sorbonne-Erklärung löste bei den anderen EU-Mitgliedsstaaten einerseits Empörung und andererseits Begehrlichkeiten aus, so dass man sich wenig später wiederum auf Beamtenebene darauf einigte, eine gemeinsame neue Erklärung zu verfassen und zu verabschieden. Dies geschah im Juni 1999 in Bologna, wo 29 Staaten die Bologna-Erklärung unterzeichneten. Sowohl die Sorbonne-Erklärung als auch die Bologna-Erklärung haben keinen rechtsverbindlichen Charakter. Sie sind lediglich Absichtserklärungen, die von den jeweiligen Unterzeichnern nach Gutdünken gehandhabt werden können. Darüber hinaus sind beide Dokumente sehr allgemein gehalten. Sie enthalten weder konkrete Maßnahmen, noch konkrete Umsetzungsschritte dieser Maßnahmen, noch irgendwelche anderen Festlegungen, die sich nicht in ganz unterschiedliche Richtungen interpretieren ließen (siehe nächstes Kapitel). 24 Ab der Bologna-Konferenz hat sich ein follow-up-Mechanismus entwickelt, der nach und nach vertieft wurde und als institutionelle Entscheidungsstruktur des EU-Bologna-polityframe (EBPF) beschrieben werden kann. Den offiziellen Kern des EBPF bilden die Ministerkonferenzen im Zwei-Jahres-Rhythmus. Auf den Ministerkonferenzen wird ein von einer Arbeitsgruppe, der Bologna-Follow-Up-Group (BFUG), auf Beamtenebene im Vorfeld ausgehandeltes Kommuniqué verabschiedet. Im Zuge dieser Nachfolgekonferenzen ist die Mitgliedzahl der Staaten, die die Bologna-Erklärung unterzeichnet haben, auf 45 Staaten bis 2005 angewachsen. Die BFUG besteht aus Vertretern aller Mitgliedesländer, der Europäischen Kommission, die ebenfalls Vollmitglied im „Bologna-Prozess“ ist, und acht (8) nicht stimmberechtigten Beobachtern. Dieser Beobachterstatus wurde den europäischen Stakeholdern eingeräumt. Dazu zählen die Studierenden (National Unions of Students in Europe, ESIB), die Hochschulen (European University Association, EUA), der Europarat, eine Vereinigung für weiterer Bildungseinrichtungen (European Association of Higher Education, EURASHE), die europäische Unteragentur der Bildungsabteilung der UNESCO (European Centre for Higher Education, CEPES), das europäischen Qualitätssicherungsnetzwerk (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA), die Gewerkschaften (European Trade Union Committee for Education, ETUCE) und die Arbeitgeber (Union for Industrial and Employer’s Confederations of Europe (UNICE). Die BFUG trifft sich alle acht (8) Wochen und trifft zwischen den Konferenzen alle wichtigen Entscheidungen. Aus der BFUG geht dann ein Board hervor, der die Arbeit der BFUG organisiert und die Implementierung der getroffenen Entscheidungen überwacht. Der Board besteht aus dem Land, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, das Land, das sie davor innehatte und das Land, das sie demnächst inne haben wird, der Kommission, dem Gastland und drei von der BFUG gewählten Ländern. Neben dem Board gibt es ein Sekretariat, das organisatorische Aufgaben übernimmt und vom jeweiligen Gastland gestellt wird. Schließlich finden regelmäßig Seminare zu den Einzelthemen des „Bologna-Prozesses“ statt. Diese Seminare bereiten policy-Programme vor und diskutieren diese in einem Kreis aus Experten der Regierungen und Stakeholder. Dann besteht jedes Land aus nationalen Bologna-Gruppen. Im Falle Deutschlands ist diese Bologna-Gruppe aus KMK, BMBF, fzs, GEW, BDA, HRK und dem DAAD zusammengesetzt. Diese Gruppe oder Delegation vertritt Deutschland im weitesten Sinne auf den Ministerkonferenzen, wobei jedes Land nur eine Stimme hat. Schließlich verfasst jedes Land einen Bericht über den Stand der Umsetzung der „Bologna-Reformen“. Drüber hinaus gibt die EUA regelmäßig zu den Ministertreffen einen Trendsbericht in Auftrag, der eine Evaluation und Einschätzung erstellt, 25 inwieweit der Europäische Hochschulraum als Ganzer verwirklicht ist. Dies alles wird überwiegend von der Europäischen Kommission bezahlt. Aus dieser Struktur können wir drei zentrale Merkmale des EBPF festhalten. Die Papieren oder Beschlüsse sind weitesgehend so formuliert, dass fast keine mögliche Interpretationsvariante des Beschlossenen ausgeschlossen wird. Zweitens wird so gut wie jeder, der sich als Stakeholder profilieren konnte, integriert. Da die Beschlüsse nicht rechtskräftig sind und der ganze Prozess auf die Freiwilligkeit der Beteiligten angewiesen ist, spielen drittens policy-Programme eine zentrale Rolle. Diese policy-Programme sind Initiativen, Interpretationsangebote und Reformvorschläge, die darauf angewiesen sind, dass ihnen auf nationaler Ebene eine gewisse Relevanz zugesprochen wird. Sie müssen, kurz gesagt, als prestigeträchtig anerkannt und von den nationalen Akteuren gelesen, interpretiert und für die politischen Auseinandersetzungen, Gesetzgebungsverfahren und Umsetzungsprozesse verwendet werden. Dabei sind die Akteure vor Ort „doppelt frei“. Einerseits enthalten diese europäischen Beschlüsse und Arbeitspapiere keine oder nur selten zwingenden Formulierungen, und zweitens müssen sie aufgrund ihrer Rechtsunverbindlichkeit nicht umgesetzt werden. Da aber der „Bologna-Prozess“ aufgrund seiner massiven Konsenstendenz von allen Stakeholdern und Legislativorganen eine öffentliche Bekenntnis verlangt, die über Positionspapiere abgeben wird, und drüber hinaus dahin tendiert, möglichst jeden auch institutionell einzubinden, wird jede Opposition tendenziell im Keim erstickt. Denn einerseits kann (und muss) die offiziellen Bologna-Papiere jeder und jede so interpretieren, wie er/sie das will; und andererseits ist es schwierig, sich gegen eine policy-Programmatik auflehnen, in dessen institutioneller und symbolischer Erarbeitung er/sie selbst integriert war und zu dessen Umsetzung er/sie sich bekannt hat. 3) Methode 2.1.5. Analyseinstrumente und Analyseziele. Die im deutschsprachigen Raum v.a. von Angermüller vertretene äußerungstheoretische Diskursanalyse trägt in der methodischen Umsetzung nicht nur der Offenheit und Unabschließbarkeit des oben vorgestellten Begriffs des Sozialen bzw. des Äußerungsfeldes Rechnung. Darüber hinaus erlaubt es dieser diskursanalytische Ansatz, die Heterogenität des Diskurses herauszuarbeiten. Während die Bedeutungsanalyse zwar der Kontingenz diskursiver Prozesse gerecht wird, lässt sie jedoch kaum Raum für den heterogenen Charakter 26 des Diskurses. Damit steht die Wissenssoziologische Diskursanalyse der Hegemonietheorie vielleicht insofern näher als Foucaults Äußerung/Aussage-Theorie, als es doch auch Laclau um die Frage nach Bedeutung und den Zusammenbruch von Bedeutung geht. Gerade letzteres müsste methodisch gezeigt werden können, um die Heterogenität von Bedeutungen zu analysieren. Darauf gibt uns aber weder die Hegemonieanalyse (vgl. Nonhoff 2006) noch die Wissenssoziologische Diskursanalyse bisher eine überzeugende Antwort. Die Pragmalinguistik fokussiert ebenso wie die Äußerungstheorie die illokutionäre Ebene von Sprache. Allerdings analysiert die Äußerungstheorie diese Ebene nicht als kompakte, voll realisierte Handlungsebene. Im Gegensatz zur Pragmalinguistik interessiert sich die äußerungstheoretische Diskursanalyse für das spannungsgeladene, heterogene Verhältnis zwischen der illokutionären und der propositionalen Ebene. Berücksichtigen wir den heterogenen Charakter des Diskurses, so müsste aus pragmalinguistischer Sicht gezeigt werden, wie sich Handlungsverläufe und –muster eben nicht voll entfalten können. Mit der Institutionenanalyse schließlich können wir den umfassenden Kontext analysieren und erklären, wie bestimmte Phänomene durch Interessenkonstellationen und kontextuelle Zwänge zustande kamen, die nicht von der Aussage reflektiert werden. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass Diskurse immer eine spezifische Verbindung von Text und Kontext realisieren, wobei weder der Text noch der Kontext in dieser Verbindung voll aufgefüllt sind, dann ist das kompakte institutionelle Feld, von dem Scharpf ausgeht, problematisch. In der folgenden Analyse wollen wir deshalb im Sinne der äußerungstheoretischen Formanalyse danach fragen, mit welchen diskursiven Mechanismen der Bologna-Diskurs operiert. Wir fragen also weder nach der Bedeutung noch nach den Handlungsmustern oder den institutionellen Konstellationen, die das Handeln der Akteure einbetten, sondern suchen das empirische Material nach unterschiedlichen sprachlichen Formen ab. Hierfür wollen wir im Folgenden eine Reihe von Analyseinstrumenten dafür vorstellen. Zwar sind Texte stets mit Kontexte verbunden. Jedoch lassen sich äußerungstheoretisch gesehen nur einige Aspekte der Äußerungssituation, das heißt des Kontextes, anhand der Äußerungsspuren in der Aussage analysieren. Um den weiteren Kontext analytisch in den Griff zu bekommen, wollen wir Minskys Rahmenbegriff für die Analyse fruchtbar machen. Während die Äußerungsspuren unmittelbar am Textdokument aufgezeigt werden können, sind wir im Falle der Rahmen auf Informationen angewiesen, die über das einzelne Textdokument des Bologna-Diskurses hinausgehen. Dies macht eine Zweiteilung der Analyse notwendig. Während es in der Äußerungsanalyse darum geht, die diskursiven Operationsmechanismen aufzuzeigen, wollen 27 wir in der Rahmenanalyse zeigen, wie Diskurse unterschiedliche Rahmen mobilisieren und sich so in ein weiteres Äußerungsfeld einschreiben. Wie im Falle der Diskursanalyse wird also auch in der Rahmenanalyse die Heterogenität des Äußerungsfeldes in den Blick genommen. 2.2. Heterogenitäten und formale Spuren. Im folgenden Abschnitt soll eine Reihe von Analyseinstrumenten vorgestellt werden, die es uns ermöglichen, Diskurse als formale Operationen und heterogene Konstrukte zu analysieren. Hierfür sollen Instrumente aus der Äußerungstheorie von Austin, Benveniste und Foucault, der Polyphonietheorie von Bachtin und Ducrot, der angelsächsischen Pragmatik und Theorien zum Vorkonstrukt und Nominationen von Pêcheux, Bühler und Benveniste herangezogen werden. Schließlich soll gezeigt werden, wie wir Minskys Rahmentheorie für die Analyse verwenden können. In der Darstellung der Analyseinstrumente wollen wir uns entlang dreier Unterscheidungen bzw. dreier Heterogenitäten abarbeiten: der Heterogenität zwischen Äußerung und Aussage, der Heterogenität innerhalb der Aussage und der Heterogenität zwischen Rahmen. Diese strikte Unterscheidung bezeichnet jedoch keine klare Trennlinie, gehen doch die unterschiedlichen Heterogenitäten immer ineinander über und überlagern sich. 2.2.1. Äußerung und Aussage. Neben Austins Theorie der Sprechakte bildet vor allem Emile Benvenistes Äußerungstheorie einen der wichtigen theoretischen Ausgangspunkte von Foucaults Theorie diskursiver Formationen. Als einer „der Epigonen von de Saussure“ (vgl. Angermüller 2003) interessiert sich Benveniste insbesondere für den Sprachgebrauch, das heißt für das, was auf der Seite von Saussures parole passiert. Ausgehend von Bühlers Origo (Bühler 1999[1934]), der Koordinatenausgangspunkt des Sprechens „ich“-„hier“-„jetzt“, entwickelt Benveniste eine Sprachtheorie, die insbesondere den Kontext des Sprachgebrauchs in den Blick nimmt. Benveniste unterscheidet zunächst zwischen Selbstreferenz und Sachreferenz. Selbstreferenz bezeichnet den Akt, wo mittels der deiktischen Pronomen „ich“ und „du“ der Sprachvollzug in der Aussage reflektiert wird. Die Personalpronomen „ich“ und „du“ sagen nicht nur etwas über einen Sachverhalt aus („ich bin hier, du bist dort“), sie zeigen (Deixis) dabei gleichzeitig auf die Person, die spricht und die angesprochen wird („ich bin hier, du bist 28 dort“). Dies gilt jedoch nicht gleichermaßen für die dritte Person „er“, „sie“, „es“, die Benveniste als „Nicht-Person“ bezeichnet und ebenso wenig für alle Demonstrativpronomen und Artikel wie „dieser“, „jenes“„der“, „die“, „das“, die nach Benveniste sach- bzw. fremdreferentiell sind. Insbesondere der deiktische Partikel „ich“ hat grundsätzlich eine Doppelstruktur. „Es gibt also bei diesem Prozess eine doppelte, gekoppelte Instanz: Instanz des ich als Referenz und Diskursinstanz, die ich als Referiertes enthält“ (Benveniste 1977: 281, Herv. i.O.). Demnach ist „ich“ als Objekt und Subjekt der Aussage analysierbar und reflektiert als deiktischer Partikel den Kontext der Äußerung. Neben den Personalpronomen „ich“ und „du“ haben auch die Adverbien „hier“ und „jetzt“ diese Funktion. „Die Anwendung“ dieser selbstreferentiellen Partikel „hat also die Diskurs-Situation und keine andere zur Voraussetzung“ (Benveniste 1977: 283). Während fremdreferentielle Partikel der Situation der Äußerung grundsätzlich enthoben sein können, ist dies im Falle der selbstreferentiellen Partikel nicht möglich. Mit den selbstreferentiellen Partikeln können wir nicht nur die Spuren des Äußerungskontexts in der Aussage analysieren, sondern finden hier im Gegensatz zu fremdreferentiellen deiktischen Partikeln immer zwei Bedeutungsebenen in der Aussage vor. Nach Benveniste markiert der deiktische Partikel „ich“ im Gegensatz zu den anderen selbstreferentiellen Partikeln „du“, „hier“ und „jetzt“ die subjektive Rede, „weil jeder Sprecher sich als Subjekt hinstellt, indem er sich in seiner Rede auf sich selbst als ich bezieht“ (Benveniste 1977: 289, Herv. i.O.) Damit gibt uns Benveniste ein Instrument an die Hand, um diskursive Subjektivität zu analysieren (vgl. Kapitel 2.2.6). Subjektivität ist damit jenseits der faktisch ausgeführten Äußerung nicht vorstellbar. Das Subjekt ist nach Benveniste weder vor der Sprache noch ohne Sprache denkbar. Die Vorstellung, wir könnten Sprache als Ausdruck von Subjektivität analysieren, bezeichnet Benveniste als „Fiktion“, unterstellt eine solche methodische Vorgehensweise doch ein Subjekt, das bereits vor der Äußerung konstituiert wäre. Das Subjekt ist nach Benveniste als kompakte Einheit überhaupt nicht denkbar. Vielmehr konstituiert es sich in der Äußerung immer nur als Facette des Diskurses. Neben dem deiktischen Partikel „ich“ können wir auch die Pluralform der ersten Person „wir“, explizite persönliche Wertungen wie „schön“, Konnotationen in schriftlichen und v.a. mündlicher Rede und konventionalisierte Wertungen wie „Bürokratieabbau“ als Spuren von diskursiver Subjektivität lesen (vgl. Angermüller 2003). Ausgehend von Austins Unterscheidung zwischen der illokutionären Kraft und der propositionalen Ebene, die jeden Sprachgebrauch kennzeichnet, müssen wir grundsätzlich davon ausgehen, dass auch Aussagen, die keine subjektiven bzw. auf den Kontext verweisende Spuren enthalten, mit 29 zwei Ebenen operieren. Insofern ist Benvenistes Unterscheidung zwischen dem Äußerungsmodus Diskurs, der mit selbstreferentiellen (deiktischen) Partikeln operiert, und Geschichte, der ohne solche Partikel auskommt und sich auf den Bericht von Tatsachen bezieht, kein Hinweis darauf, dass der Geschichtsmodus kein Diskurs im von uns oben definierten Sinne ist. Vielmehr bezeichnet dieser Modus nur eine spezifische Form von Diskursivität, die dadurch charakterisiert ist, dass sie weitesgehend ohne Subjektivität operiert. Während die meisten Diskursarten kaum ohne selbstreferentielle deiktische Partikel auskommen, könnten Protokoll und andere Sachberichte ein Beispiel für diese Art von Diskurs sein. 2.2.2. Äußerung und Aussage/Aussage. Durch eine ebenso heterogene Struktur ist der polyphone Aufbau des Diskurses gekennzeichnet. Michael Bachtin hat vor allem in seinen Analysen der Romane Dostoevskijs (Bachtin 1971) eine Theorie der „Dialogizität des Wortes“ entwickelt. Bachtin wendet sich damit gegen die Auffassung der „traditionellen Stilistik“ (Bachtin 1986: 96), wo Worte als isolierte, sinnerfüllte Bedeutungseinheit analysiert werden. Nach Volosinov ist mit der „traditionellen Stilistik“ vor allem der deutsche Idealismus angesprochen, der das Wort als Ausdrucksmittel eines sinngebenden Subjekts betrachtet, dessen tieferer Sinn hermeneutisch rekonstruiert werden muss. Bachtin (und Volosinov) grenzen sich mit der Dialogizitätstheorie aber auch von der Saussure’sche Linguistik ab, wonach das Wort nur ein Element der langue ist und dort seinen festen Platz hat (vgl. Volosinov 1975: 95-119). Mit der Dialogizität des Wortes bezeichnet Bachtin (und Volosinov) die Verwobenheit gesprochener Worte in andere Worte, Akzente, Ideologien, Genres etc. Ein einzelnes Wort ist niemals autonom, sondern beinhaltet immer schon eine Widerrede, eine Antwort und ist stets auf weitere, darauf folgende Worte ausgerichtet. Das Wort ist demnach weder als zeitlich ursprünglich denkbar noch als abgeschlossene Sinneinheit. Nach Bachtin/Volosinov taucht ein Wort immer inmitten anderer Worte auf und inkorporiert deren Akzente. Damit müssen wir uns das Wort nach Bachtin als dezentrales, unvollständiges Element vorstellen. Insbesondere am Beispiel der Parodie zeigt Bachtin, wie ein Wort aus unterschiedlichen, sich überlagernden Stimmen besteht. Das parodistische Wort ist demnach immer ein dezentriertes Wort, weil sich der andere Akzent im Wort befindet. So zeigt Bachtin wie in Formulierungen wie „Dieses Arztsöhnchen war nicht nur unbefangen...“ sowohl die Autorstimme als auch die Stimme des Romanhelden gleichzeitig präsent sind (Bachtin 1986). 30 Den formalen Merkmalen nach gehört diese Passage zur Situationsbeschreibung des Autors, der, indem er für seine Beschreibung die Formulierung „Arztsöhnchen“ wählt, sich mit der verachtenden Haltung des Romanhelden gegenüber der vom Autor beschriebenen Person solidarisiert. In diesem Wort sind also zwei Stimmen präsent: einerseits die Stimme des Romanautors, andererseits die des Helden. Ducrot hat Bachtins Dialogizitätstheorie aufgegriffen und darauf aufbauend unter Rückgriff auf die äußerungstheoretische Begrifflichkeit eine Polyphonietheorie formuliert (vgl. Angermüller 2003)3. Eine ironische Formulierung wie „Dieses Arztsöhnchen“ besteht nach Ducrot aus zwei unterschiedlichen Sprecherrollen, einem Lokutor und einem Enunziator. Mit Ducrot könnten wir das obige Beispiel als einen Konflikt zwischen mehreren Stimmen beschreiben. Der Lokutor lässt hier einen Enunziator sprechen, der den Sohn des Arztes benennt („Der Arztsohn“), und einen zweiten Enunziator, der dem „Arztsohn“ Status, Prestige und Anerkennung entzieht („Diese Pfeife“), wobei der Lokutor sich mit dem zweiten Enunziator identifiziert, ohne den ersten völlig zurückzuweisen. Denn die Ironie basiert in diesem Beispiel gerade darauf, dass die markierte Person („der Arztsohn“) in dieser Position des prestigeträchtigen Arztes bleiben muss, um ihn der Lächerlichkeit Preis geben zu können. Das spannungsgeladene Spiel sich widersprechender Stimmen ist ohne die Berücksichtigung der Äußerungsebene nicht darstellbar. Der Lokutor bezeichnet hier die Äußerungsinstanz, von der aus die multiplen Enunziatoren eingesetzt werden. Die Polyphonie bezieht sich aber nicht nur auf die Heterogenität zwischen Äußerung und Aussage, sondern rekrutiert aus dem interdiskursiven Raum unterschiedliche Aussagepartikel. Dies zeigt Angermüllers Beispiel der Aussage Oswald Metzgers, wo ein größerer Textumfang (ein Satz) nötig ist, um eine politische Forderung zu formulieren (vgl. Angermüller 2007a). Die diversen Stimmen, die hier eine Aussage orchestrieren, sind wiederum auf andere Aussagen oder Aussagenpartikel angewiesen, die weder einen kohärenten Raum bilden noch einem „ursprünglichen“ Zusammenhang entstammen. Diese Heterogenität zwischen den Aussagen in einer Aussage können wir auch am obigen Beispiel nachvollziehen. Während sich die Aussage von Enunziator I („Der Arztsohn“) auf eine Situation bezieht, wo der Sohn des Arztes als Sohn des Arztes eine Rolle spielt (z.B. er betritt einen Raum), spielt die Aussage von Enunziator II („Diese Pfeife“) mit persönlichen Eigenschaften dieser Person, indem sie ein gesellschaftliches Statussystem mobilisiert. Diskurse als Aussagesysteme sind nicht unterschiedlichen gesellschaftlichen 3 Bezüglich Ducrot, dessen Schriften weder auf Englisch noch auf Deutsch vorliegen, greife ich im Folgenden auf Angermüllers Darstellung der Polyphonietheorie zurück, ohne jedoch die Vielfältigkeit von Ducrots Arbeit, die Angermüller ausführlich darstellt, zu berücksichtigen (siehe dazu Angermüller 2003). 31 Sphären wie Alltag, Politik, Klasse, Stand, Ökonomie, Redegenres usw., die nach spezifischen Regeln funktionieren, isoliert zuortbar. Vielmehr vermischen Diskurse diese unterschiedlichen sozialen, ökonomischen, juristischen, kulturellen usw. Sphären, indem sie unvollständige Partikel zu heterogenen Gebilden anordnen. 2.2.3. Aussage und Intertextualität. Aussagen, so haben wir oben festgehalten (Kapitel 3.1.2), sind das Produkt des Äußerungsaktes. Damit sind Aussagen weder auf einzelne Signifikanten bzw. Worte reduzierbar noch sind Aussagen kompakte, abgeschlossene Gebilde. Als Diskurs wurde die Verknüpfung von Äußerung und Aussage definiert, was die spezifische, stets prekäre Verbindung von Text und Kontext impliziert. Nach Saussure können wir uns Texte als Signifikantennetze vorstellen, die durch Differenz ihre Signifikate erhalten. Ein solcher Textbegriff scheint aber problematisch zu sein, wenn Texte durch die diskursive Praxis nie völlig aufgefüllt werden, mithin ihren differentiellen Charakter nie wirklich zur Geltung bringen können, sondern vielmehr von Lücken und Rissen durchzogen sind. Laclau und Mouffe haben diese Problematik aufgegriffen. Hiernach können wir die Hegemonietheorie als einen Versuch verstehen, den Saussure’schen Textbegriff poststrukturalistisch zu reformulieren. Allerdings entfalten sich genau bei diesem Versuch die dekonstruierbaren Aporien der Hegemonietheorie, wie wir in Kapitel 2 gezeigt haben. Aus diesem Grunde erschien die methodische Übertragung der Kategorien der Hegemonietheorie als problematisch. Da nun Aussagen keine Texte sind, Diskurse aber ohne Texte nicht auskommen, stellt sich die Frage, welcher Textbegriff für unser Unternehmen adäquat ist. Ausgehend von Benvenistes Unterscheidung zwischen (deiktischer) Selbstreferenz und Fremd- bzw. Sachreferenz können wir die symbolische Ebene des Diskurses, den Text, auf der Seite der Sachreferenz verorten. Während Benveniste die Personalpronomen der ersten und zweiten Person als selbstreferentielle (deiktische) Partikel beschrieb, welche die Äußerungssituation reflektieren, ordnete er die Personalpronomen der dritten Person (die „Nicht-Person“, wie Benveniste sagt) dem Bereich der Fremdreferenz zu. Im Gegensatz zur Selbstreferenz verweisen die Partikel der Fremdreferenz nicht auf die Äußerungssituation sondern auf andere Partikel. Karl Bühler beschrieb die Sprache als eine Operation zweier Felder: des Zeigefeldes und des Symbolfeldes (Bühler 1999[1934]). Dem Zeigefeld gehören die deiktische Partikel der Origo „ich“, „hier“, „jetzt“ an, wohingegen die Nomen („Pferd“, „Begriff“) dem Symbolfeld 32 angehören. Während die Partikel des Zeigefeldes räumlich, zeitlich und personal referieren, verweisen die Symbole auf „Dinge“ und „Bedeutungen“. Eine Zwitterstellung zwischen dem Zeigefeld (bzw. der Origo) und dem Symbolfeld (den Nomen) nimmt Bühler zufolge die Anaphora ein. Die Besonderheit der Anaphora besteht darin, dass sie sich sowohl im Zeigefeld als auch im Symbolfeld bewegt. „Man weist mit dieser und jener (...) auf soeben in der Rede Behandeltes zurück, man weist der (...) und anderen Zeigwörtern auf sofort zu behandelndes voraus“ (Bühler: 1999[1934]: 121, Herv. i.O.). Während also die Elemente der Origo ohne Sach- und Bedeutungsreferenz operieren, bleiben die anaphorischen Elemente als Zeigepartikel auf die Sach- und Bedeutungsreferenzen des Symbolfeldes angewiesen. Dem ersten (deiktischen) Fall entspricht also ein Satz wie „Ich ging nach Hause, als ich dort ankam...“, während dem zweiten (anaphorischen) Fall ein Satz wie „Peter ging nach Hause. Als er dort ankam...“ entspricht. Während „er“ auf „Peter“ anaphorisch zurückverwiest, operiert „er“ nach wie vor mit dem sachreferentiellen Nomen „Peter“, wohingegen die beiden Personalpronomen der ersten Person „ich“ im ersten Satz jeweils den bezeichnen, der spricht. Mit der selbstreferentiellen („ich“/„du“, „hier“, „jetzt“ usw.) und der sachreferentiellen Ebene („er“, „diese“ usw.) bezeichnen wir also zwei unterschiedliche Dimensionen des Diskurses. Während selbstreferentielle (deiktische) Partikel auf den Kontext verweisen, verweisen die sachreferentiellen (anaphorischen) Partikel intertextuell auf Nomen und extratextuale Sachverhalte. Texte operieren hiernach ebenso wie diskursive Äußerungen mit Referenzen (vgl. Brown/Yule 1989). Während im Saussure’schen Strukturalismus Texte aber durch spezifische Operationen von Differenzen Bedeutung (Signifikant und Signifikat) erzeugen, können wir ausgehend von Bühler einen Textbegriff einführen, der vor allem anaphorisch, das heißt mit Referenzen operiert. Während Bühler noch das Symbolfeld vom Zeigefeld unterscheidet, betont die angelsächsische Pragmatik, dass auch Nomen mit Referenzen operieren (vgl. Yule 2003, Brown/Yule 1989). Aussagen wie „Peter geht nach Haus“ werden nicht hinsichtlich ihrer Bedeutung untersucht. Vielmehr wird danach gefragt, welche Präsuppositionen, Inferenzen, Implikaturen und anaphorischen und deiktischen Referenzen diese Aussage organisieren. Für unsere Analyse sind vor allem die Präsuppositionen und die Inferenzen von Interesse und weniger die Implikaturen, die sich auf allgemeine Diskursregeln beziehen. Präsuppositionen bezeichnen Sachverhalte, die von Hörer und Sprecher als notwendig unterstellt werden müssen, z.B. dass „Peter“ ein Mensch ist, während Inferenzen nahe liegende, aber nicht notwendige Sachverhalte bezeichnen. So könnte es sein, dass „Peter“ 33 „obdachlos“ ist, nicht „geht“ sondern „fährt“ usw. Die Referenz auf Sachverhalte außerhalb des Textes kann aber auch über die anaphorischen Referenzen verlaufen. Brown/Yule unterteilen die anaphorische Referenz in zwei Grundfunktionen. Exophorische Partikel verweisen auf etwas außerhalb des Textes („Schau’ dir das an“, einen Sonnenaufgang), wohingegen endophorische Partikel auf Elemente im Text verweisen. Die endophorischen Partikel können ihrerseits noch in anaphorische, die auf bereits Gesagtes zurückverweisen, und cataphorische Partikel, die auf im Text Kommendes hinweisen. Wir werden im Folgenden von anaphorischer Referenz sprechen, wenn wir uns allgemein auf die Demonstrativpronomen, Artikel usw. der Anaphora beziehen, von deiktischer Referenz, wenn wir die Selbstreferenz meinen und von Nomen, um die Elemente des Symbolfeldes zu bezeichnen. Für unsere Interpretation wollen wir uns vor allem auf die Rolle der Nomen und anaphorischen Referenzen in Verbindung mit der Frage nach Präsupposition und Inferenz konzentrieren. Die Fremd- bzw. Sachreferenz bezeichnet also im weitesten Sinne Text bzw. Intertextualität, wobei unser Textbegriff, Bühler und Brown/Yule folgend, aus zwei formalen Elementen besteht: Nomen mit Gegenstandsreferenz und anaphorischer Referenz. Nach Bühler können wir zwei Formen von Nomen unterscheiden, die durch ihre spezifische Beziehung zum Artikel charakterisiert sind (Bühler 1999[1934]: 303-315). Nomen können entweder von einem bestimmten oder einem unbestimmten Artikel geführt werden. Der bestimmte Artikel bringt das Nomen mit einen Gegenstand in Verbindung, wohingegen der unbestimmte Artikel das Nomen mit einem Begriff versieht. Der Satz „Das Pferd“ kann demnach zwei unterschiedliche Referenzen aufweisen. Einerseits das konkrete Pferd und andererseits die Gattung oder den Begriff des Pferdes. Die Frage, welche Referenz gemeint ist, hängt also von der Ziel- oder Zeigerichtung des anaphorischen Partikels „das“ ab. Als bestimmter Artikel zeigt „das“ auf einen Gegenstand im Text oder außerhalb des Textes (exooder endophorisch), als unbestimmter Artikel zeigt „das“ dagegen auf das Nomen selbst. Der Unterschied zwischen diesen beiden Referenzen liegt darin, dass das Nomen im ersten Fall auf weitere Text- oder Extratextpartikel angewiesen ist. Hier ist der Referent des Nomens Teil des Textes und seiner Umgebung. Im zweiten Fall dagegen trägt das Nomen seinen eigenen Referenten „in sich“: Nomen und Referent gehen durch die spezifische Operation des anaphorischen Partikels ineinander über. Benveniste bezeichnet diese Form von Nomen als Nominationen. Nominationen sind vor allem deswegen für uns interessant, weil sie eine unbestreitbare „Existenz“ einfordern. Nominationen sind weder „wahr“ noch „falsch“, weder „hier“ noch „dort“, weder „gut“ noch „schlecht“. Sie sind einfach nur existent. 34 Während also der Satz „Dieses Pferd ist weggelaufen“ einen weiteren Partikel (ein Wort oder Gegenstand) erfordert, muss die Existenz von „Pferd“ in „Das Pferd ist weggelaufen“ immer schon akzeptiert werden. Nominationen sind also Nomen die einen spezifischen Sachverhalt präsupponieren, wohingegen andere Nomen mit Inferenzen operieren. Inferenzen sind für unsere Analyse vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie ganz unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten, die von einem Nomen oder einem ganzen Satz ausgehen, für weitere diskursive Oparationen bereithalten. So kann von der Aussage „Peter ging zur Schule“ nicht fortgefahren werden mit „als sie dort landete, flog ein Buch in sie hinein“, weil „Peter“ „männlich“ präsupponiert und „ging zur Schule“ spezifische Anschlussoperationen erfordert, aber nicht beliebige. Inferenzen bezeichnen dagegen die Sachverhalte, die von dieser Aussage ermöglicht werden, aber keinen notwendigen Charakter haben. Um im obigen Beispiel zu bleiben, könnten Sätze folgen wie „als er dort ankam“, „plötzlich fiel ihm ein, dass...“ oder „damals war es üblich...“ usw. Inferenzen stehen also einerseits für die prinzipielle Offenheit des Diskurses für weitere Anschlussoperationen, und ermöglichen gleichzeitig die Herstellung einer Beziehung zwischen der nachfolgenden Sequenz und der vorangegangenen. Dabei ist für die Analyse interessant, auf welche der inferierten Optionen von Aussage 1 durch Aussage 2 zurückgegriffen wird. [Heterogenität] Zudem können wir fragen, ob und wie eine bestimmte Option von Aussage 1 durch Aussage 2 retrospektiv präsupponiert wird, wodurch sich im Zuge weiterer diskursiver Akte Inferenzen zu Präsuppositionen verdichten und umgekehrt, ob und wie Präsuppositionen wieder optional werden. Ausgehend von Bühlers Unterscheidung zwischen der bestimmenden und der unbestimmten Rolle des Artikels sowie zwischen Inferenz und Präsupposition wollen wir im Folgenden solche Symbole, die eine reine Existenz einfordern, als Nominationen bezeichnen und optionale Symbole als Nomen. 2.2.4. Rahmen. Einzelne diskursive Aussagen sind keine isolierten Entitäten sonder Teil eines umfassenden Äußerungsfeldes. Für die Analyse bedeute dies, dass wir nicht nur den Äußerung/AussageKomplex und die Rolle der Nomen und Nominationen beschreiben, sondern darüber hinaus den umfassenderen Kontext in den Blick nehmen. Zu diesem Kontext gehören sowohl unterschiedliche institutionelle Arrangements (Ministerien, Kulturföderalismus, Rituale, Normen etc.) als auch andere Aussagen und Diskurse (z.B. Debatten zur 35 „Wettbewerbsfähigkeit“ und „Qualität“ etc.), die nicht Teil des geäußerten Aussagekomplexes sind (vgl. Kapitel 2.2.2). Da dieser Kontext, an den der Diskurse ebenso gebunden ist wie der Kontext an den Diskurs, nicht in der Form materialisiert ist wie der Äußerungskontext, können wir ihn auch nicht mit den Mitteln der Äußerungsanalyse (vgl. Kapitel 2.2.1) beschreiben. Andererseits können wir uns diesen Kontext jedoch nicht als eine präsente und kompakte Matrix vorstellen, die unabhängig von den Diskursen existiert (vgl. Kapitel 2.1.3 und 2.1.4). Für die Diskursanalyse hat dieser weitere Kontext, der ausgehend von einzelnen Diskursfragmenten wie „Herzlichen Dank!“ ins Spiel gebracht wird, den Status von Hintergrundinformationen (vgl. Brown/Yule 1989: 236-256). Nach Minsky werden ausgehend von solchen Diskursfragmenten Rahmen mobilisiert, die aus unterschiedlichen Terminals (oder slots) bestehen, die mit den durch die Situation zur Verfügung gestellten Symbolen nicht besetzt oder gefüllt werden müssen. Ein Rahmen ist demnach eine die Einzelsituation umfassende Struktur, die dem spontanen Ereignis durch die Rahmeneinbettung Bedeutung verleiht. Eine reine Rahmenanalyse ist demnach eine Bedeutungsanalyse. Sie fragt danach, welche Bedeutung(en) ein singulares Ereignis durch die Verortung in einen (oder mehrere) Rahmen erhält. In unserer Analyse wollen wir auf Minskys Rahmenbegriff zurückgreifen, um damit zu zeigen, wie einzelne Diskursfragmente auf den weiteren Kontext zurückgreifen. Dabei interessieren wir uns weniger für die Bedeutung der einzelnen Nomen, Sätze oder Satzfragmente noch für die Beschreibung der Debatten und institutionellen Positionen, sondern vielmehr für die Vielschichtigkeit unterschiedlicher kontextueller Arrangements, die ausgehend von einzelnen Diskursfragmenten mobilisiert werden. Wie wir oben bereits ausgeführt haben, liegt der Vorteil von Minskys Rahmen-Theorie für die Darstellung solcher weiterer Kontextvariablen darin, dass wir erstens keinen kompakten und fix strukturierten Kontext annehmen müssen, wo jedes Element seinen Platz hat. Vielmehr kann eine Aussage bzw. ein Diskursfragment mehrere, teilweise ganz unterschiedliche, sich mitunter wechselseitig ausschließende Rahmen mobilisieren. Zweitens sind Rahmen zwar stereotype (und damit kohärente) Gebilde. Jedoch können die Terminals, die einzelnen Positionen, die einen Rahmen konstituieren, unausgefüllt bleiben. Ein Terminal kann drüber hinaus zu unterschiedlichen Rahmen gehören. Nicht zuletzt können durch den diskursiven Verlauf über die Verkettung unterschiedlicher Aussagen immer wieder neue Rahmen mobilisiert werden und andere zurücktreten 36 Der Rahmenbegriff ermöglicht es uns also nicht nur, das Äußerungsfeld in seiner Heterogenität, Offenheit und Vielschichtigkeit zu analysieren, sondern ist durch seine semantische Ausrichtung an die anderen sprachwissenschaftlichen Analyseinstrumente anschließbar, ohne die soziologische Bedeutung des Wissens und der Institutionen nur sprachwissenschaftlich zu paraphrasieren. 37