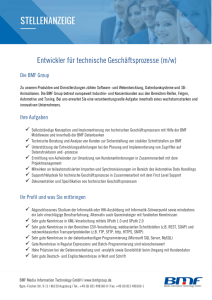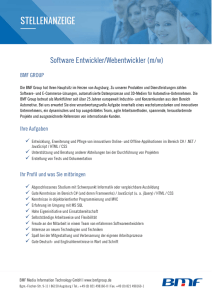“Sand in die Augen oder ins Getriebe?”
Werbung

BLUE 3 21 “Sand in die Augen oder ins Getriebe?” Kritik der Vorschläge der Bundesregierung für eine Stärkung der internationalen Finanzarchitektur Berlin, Juni 2001 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Inhalt 1. Vorwort ............................................................................................................................................ 3 2. Umwertung der Werte: Die Metamorphose des IWF ...................................................................... 4 3. Das Dogma des liberalisierten Kapitalverkehrs .............................................................................. 6 3.1 Kapitalverkehrskontrollen ......................................................................................................... 6 3.2 Devisentransaktionssteuern ..................................................................................................... 7 3.3 Währungskooperation............................................................................................................... 8 4. Einbeziehung des Privatsektors oder Sozialisierung der Verluste? ............................................... 9 4.1 Einbeziehung von Gläubigerbanken......................................................................................... 9 4.2 Einbeziehung von Anleihehaltern ........................................................................................... 10 4.3 Umschuldungsklauseln........................................................................................................... 11 5. Finanzmarkt-Aufsicht: Die Lücke als Programm?......................................................................... 13 5.1 Die Revision des Baseler Akkords.......................................................................................... 13 5.2 Kontrolle von Hedge Fonds .................................................................................................... 15 5.3 Offshore-Zentren und Steueroasen ........................................................................................ 17 5.4 Der blinde Fleck: Steuerflucht................................................................................................. 18 6. Verschuldung: Nebelkerzen als Dauerbrenner (Philipp Hersel) ................................................... 21 6.1 HIPCs und Nicht-HIPCs.......................................................................................................... 21 6.2 Internationales Insolvenzrecht ................................................................................................ 23 7. Fazit: “Kontinuität statt Wandel” .................................................................................................... 25 8. Literatur ......................................................................................................................................... 26 Impressum: Herausgeber Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung – BLUE 21 e.V. Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin Tel: 030-694 61 01 Fax: 030-692 65 90 [email protected] www.berlinet.de/blue21 Berlin, Juni 2001 Autoren Thomas Fritz Kapitel 6: Philipp Hersel Gefördert mit Mitteln der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion Entwicklung 2 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 1. Vorwort Im Anschluss an die südostasiatische Krise konnte der Eindruck aufkommen, eine Phase der ReRegulierung der immer schwächer kontrollierten internationalen Finanzmärkte würde anbrechen. Die offizielle Gemeinschaft beteuerte ihren Willen zur Stärkung der internationalen Finanzarchitektur, um Krisen sowohl besser vorzubeugen, als auch deren Management zu effektivieren. Kaum drei Jahre später scheint der Reformeifer aber verflogen. Nachdem sich herausstellte, dass die Zusammenbrüche nicht auf die wohlhabenden Zentren des Nordens übergriffen, konnte zum Alltag fortgesetzter Liberalisierung und Deregulierung zurückgekehrt werden. Die sozialen Folgen dieser Politik bleiben dabei weitestgehend unberücksichtigt. Wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) ernüchtert feststellt, zeige sich anhand der jüngsten Krisen in Argentinien und der Türkei, dass das Krisenmanagement der internationalen Gemeinschaft, allen voran dasjenige des Internationalen Währungsfonds (IWF), unverändert geblieben ist (UNCTAD, 2001, S. 71). Wie positioniert sich nun aber die rot-grüne Bundesregierung zur Frage der Reform der internationalen Finanzarchitektur? Anläßlich von Beratungen und Anhörungen im Deutschen Bundestag legte das Bundesfinanzministerium im März dieses Jahres eine Sammlung von drei Papieren vor, die sich mit der “Stärkung der internationalen Finanzarchitektur”, der “Internationalen Verschuldung” und mit der “Schaffung eines Internationalen Insolvenzrechts zur Bewältigung von Verschuldungskrisen von Staaten” auseinandersetzen. Nachfolgend werden die darin vertretenen Positionen einer umfassenden Kritik unterzogen. Dabei werden ebenfalls erste Erfahrungen mit den offiziellen Reformmaßnahmen, wie die Einbindung des Privatsektors, die Stärkung der Bankenaufsicht oder die Kontrolle von Offshore-Zentren, ausgewertet. Messlatte sind dabei Reformvorschläge zur Kontrolle der Finanzmärkte, wie sie vor allem von Seiten sozialer Bewegungen und der kritischen Wissenschaft vorgebracht werden. Thomas Fritz 3 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 2. Umwertung der Werte: Die Metamorphose des IWF Der Internationale Währungsfonds (IWF) war aufgrund seines Verhaltens während der Asienkrise stark unter Druck geraten. Insbesondere die makroökonomischen Strukturanpassungsauflagen wurden, wie schon so oft seit Ausbruch der Schuldenkrise der Dritten Welt, als krisenverschärfend kritisiert. Den Anpassungsprogrammen wurde vorgeworfen • via rigider Inflationsbekämpfung die Konjunktur der Schuldnerländer zu strangulieren, • mittels Kapitalverkehrsliberalisierung die Anfälligkeit für externe Schocks zu erhöhen, • Währungsabwertungen zur Exportsteigerung zu empfehlen, damit aber Abwertungswettläufe zu stimulieren und den Import von Vorprodukten zu verteuern, • mittels strenger Sparvorgaben die Sozialhaushalte zu belasten und daher unter dem Strich krisenverschärfend und armutssteigernd zu wirken. Vor diesem Hintergrund überrascht das im März 2001 vom Bundesfinanzministerium vorgelegte Papier “Stärkung der internationalen Finanzarchitektur - Überlegungen zur Reform des IWF und der Finanzmärkte”1 durch die guten Noten, die dem Fonds erteilt werden. Das BMF betont den “universellen Charakter” des IWF, der ihn zum Beispiel auch als qualifizierten Berater und Finanzier seiner ärmsten Mitglieder ausweise. Ferner werden “beachtliche Fortschritte” des Fonds ausgemacht, z.B. bei der externen Transparenz, bei der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche und bei der wirtschaftspolitischen Überwachung. Auf der Habenseite könne ferner eine Reihe von Pilotprojekten verbucht werden, so die Veröffentlichung der Berichte über die wirtschaftspolitischen Konsultationen des IWF mit seinen Mitgliedern (sog. Artikel IV-Konsultationen), die Verbreitung internationaler aufsichtsrechtlicher Standards oder die in einzelnen Ländern begonnenen Überprüfungsprogramme zur Finanzsektorstabilität. Die Absolution, welche das Finanzministerium dem IWF erteilt, erscheint jedoch kaum gerechtfertigt. Die eigene Zuständigkeit für den Fonds sollte einem nüchternen Urteil nicht im Wege stehen. Die zitierten Reformschritte des Währungsfonds sind zwar zu begrüßen, jedoch bedarf es wesentlich weitreichenderer Maßnahmen, um Krisen vorzubeugen, zu entschärfen und soziale Sicherheitsnetze aufzuspannen. Dort, wo derartige Maßnahmen u.a. greifen müssten, nämlich bei der Auflagenpolitik des IWF, übt das Ministerium Zurückhaltung. Zwar wird eingeräumt, dass die Überprüfung der IWFKonditionalität eine wichtige Reformaufgabe sei, grundsätzlich würden IWF-Kredite aber “auch weiterhin mit wirtschaftspolitischen Auflagen verknüpft”. Diese sollen sich “nach deutscher Vorstellung aber stärker auf makroökonomische Aspekte konzentrieren.” Nun ist es aber gerade die makroökonomische Ausrichtung der IWF-Strukturanpassungspolitik, die zurecht ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist. Die Weltbank, welche im Zuständigkeitsbereich des Entwicklungsministeriums angesiedelt ist, wird vom BMF dagegen mit harscher Kritik überzogen. Das Finanzministerium schreibt: “Während beim IWF wichtige Reformschritte eingeleitet und z.T. auch schon implementiert worden sind, stehen entsprechende Reformschritte bei der Weltbank noch aus.” Dies verwundert insofern, als mit dem 1 BMF (2001): Stärkung der internationalen Finanzarchitektur - Überlegungen zur Reform des IWF und der Finanzmärkte, VII C 5 - F 6424 - 52/01 (5. März) 4 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Amtsantritt von Präsident Wolfensohn die Weltbank anerkanntermaßen einen Reformprozess durchlaufen hat, der die Kritiker der Bank zwar nicht zu Begeisterungsstürmen hinreisst, aber dennoch den IWF wie eine neoliberale Trutzburg erscheinen lässt. Das BMF moniert ferner, die Weltbank habe zu Beginn der HIPC-Initiative (HIPCs: Highly Indebted Poor Countries), diese strebt Schuldenerleichterungen für 41 hochverschuldete arme Länder an, “keine in sich konsistente Armutsbekämpfungsstrategie für die einzelnen HIPC-Länder in Vorbereitung” gehabt. Die im Herbst 1999 beschlossene Ergänzung der IWF-Anpassungsprogramme für die 41 HIPCLänder um sog. Armutsbekämpfungsstrategien ist allerdings ein mit zahlreichen Widersprüchen belastetes Konzept. So müssen die unter Beteiligung der Zivilgesellschaft dieser Länder zu erarbeitenden Strategien von IWF und Weltbank genehmigt werden und bleiben somit eingebettet in die makroökonomische Orthodoxie der Strukturanpassungsprogramme. Wie weit der jetzt vom IWF begonnene Prozess eines “streamlining” der Strukturanpassungskonditionalitäten (siehe IMF, 2001) hier tatsächlich zu Verbesserungen führt, bleibt abzuwarten. Problematisch ist, dass mit den Armutsbekämpfungsstrategien eine doppelte Konditionalität eingeführt wird. Die unveränderten makroökonomischen Konditionen stehen in erheblichem Zielkonflikt mit der neuen Konditionalität der Armutsbekämpfung (z.B. Privatisierung öffentlicher Dienste vs. Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung). Auch können sie dem IWF zusätzliche Möglichkeiten liefern, die Auszahlung von Krediten hinauszuzögern oder ganz auf Eis zu legen, wenn Konditionen nicht erfüllt wurden. Dies erhöht die Gefahr, dass der IWF nicht nur problematische makroökonomische Auflagen durchsetzt, sondern überdies in für die Armutsbekämpfung zentrale innerstaatliche Sektoren eingreifen kann. Hinzu kommt, dass eine in Konsultation mit der jeweiligen Zivilgesellschaft zu erarbeitende Armutsbekämpfungsstrategie (ein sog. Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) durchaus Zeit in Anspruch nimmt, zugleich die Vorlage eines PRSPs aber Vorbedingung für mögliche Schuldenerleichterungen ist. Prinzipiell sind derartige Partizipationsprozesse jedoch zu begrüßen, vor allem wenn sie nicht völlig unverbindlich bleiben. Ein breite Mobilisierung zur Erarbeitung einer Armutsbekämpfungsstrategie, wie sie z.B. in Bolivien gelang, setzt auch die jeweilige Regierung unter Druck, konsequenter für die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung einzutreten. In denjenigen Ländern, die kaum über entwickelte zivilgesellschaftliche Strukturen verfügen, kann ein solcher Prozess aber auch zur Farce verkümmern. Die Einführung der neuen Konditionalität der Armutsbekämpfung rechtfertigt allerdings nicht, die Forderung vieler sozialer Bewegungen nach einer Entkopplung der Entschuldung von den Strukturanpassungsauflagen aufzugeben. 5 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 3. Das Dogma des liberalisierten Kapitalverkehrs Besorgnis erregend ist, dass die rot-grüne Bundesregierung die weltweite Liberalisierung des Kapitalverkehrs möglichst irreversibel gestalten will. Im Artikel VI der Articles of Agreement des IWF wird den Mitgliedern unter bestimmten Bedingungen die Einführung von Kapitalverkehskontrollen erlaubt. Diese Erlaubnis widerspricht aber der dominanten Liberalisierungsideologie und wurde in der Anpassungspolitik des Fonds selbst konterkariert. Entsprechend gab und gibt es immer wieder Versuche, das Mandat des IWF mit dem Ziel der Kapitalverkehrsliberalisierung zu erweitern. Dies ist auch das Ziel des BMF: “Eine Änderung des IWF-Abkommens mit dem Zweck der Aufnahme des Ziels der Kapitalverkehrsliberalisierung in das Mandat des IWF und entsprechender Verpflichtungen der Mitgliedstaaten steht derzeit zwar nicht auf der Tagesordnung, sollte aber als mittelfristiges Ziel weiterverfolgt werden.” 3.1 Kapitalverkehrskontrollen Entsprechend zurückhaltend verhält sich das BMF zu den aktuell diskutierten positiven Erfahrungen einzelner Länder mit Beschränkungen des Kapitalimports oder -exports und verweist auf Untersuchungen des IWF, die dazu angeblich keinen eindeutigen Aufschluss bieten. Faktisch bestätigt aber mittlerweile selbst der IWF, dass die umfassenden Kapitalverkehrskontrollen Indiens und Chinas diese Länder vor der Ansteckungsgefahr durch die Asienkrise haben schützen können. Das BMF hingegen räumt lediglich ein, “dass unter bestimmten Umständen vorübergehende Beschränkungen des Kapitalimports hilfreich sein können”. Damit schließt das BMF zum ökonomischen Mainstream auf, der vor allem die bis 1998 praktizierte Bardepotpflicht Chiles positiv bewertete, welche auf eine flexible Steuerung bestimmter Kapitalzuflüsse abzielte. Ausländische Kredite sowie Anleihen unterlagen einer Bardepotpflicht, dass heißt ein Teil der zufliessenden Mittel (1991 zunächst 20%, seit 1992 erhöht auf 30%) musste zinslos bei der Zentralbank hinterlegt werden und wurde erst nach einem Jahr zurückerstattet. Vor dem Hintergrund des Rückzugs internationaler Investoren aus den “emerging markets” infolge der Asienkrise wurde die chilenische Bardepotpflicht 1998 allerdings auf Null gesetzt (Dieter, 2000). Präventive Maßnahmen, wie eine Bardepotpflicht, sind im Fall einer akuten Finanzkrise jedoch unwirksam. Daher hat u.a. die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) wiederholt darauf hingewiesen, dass Entwicklungs- und Schwellenländern im Krisenfall die Rückkehr zu umfassenden Kapitalverkehrskontrollen möglich sein muss, um eben auch den abrupten Mittelabfluss unterbinden zu können.2 In diesem Zusammenhang ist es zu einer Neubewertung der im September 1998 während der Asienkrise eingeführten und von interessierter Seite heftig gescholtenen strengen Devisenkontrollen Malaysias gekommen. Die malaysischen Maßnahmen umfassten das Verbot für ausländische Portfolio-Investoren, ihre Mittel für die Dauer eines Jahres abzuziehen. Grenzüberschreitende Kapitaltransfers bedurften der staatlichen Genehmigung, Ex- und Importe von 2 So fordert UNCTAD-Chef-Ökonom Akyüz für akute Finanzkrisen: ...”standstills and exchange controls need to be imposed rapidly, and ... the decision to do so should rest with the country concerned” (Akyüz 2001: 14). 6 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Ringgit-Banknoten wurden beschränkt und die internationale Vergabe oder Aufnahme von RinggitKrediten wurde gänzlich verboten. Entgegen allen Horrorszenarien kam es nicht zu der vielfach beschworenen Kapitalflucht als die Kontrollen im September 1999 wieder aufgehoben wurden. Vielmehr wurde die Kreditwürdigkeit Malaysias durch die internationalen Rating-Agenturen umgehend heraufgesetzt und die Beziehungen zu den Kapitalmärkten normalisierten sich rasch. Der schärfste Kritiker Malaysias, der IWF, musste zerknirscht einräumen, die malaysischen Devisenkontrollen “scheinen keinen signifikanten Langzeiteffekt auf das Investorenverhalten gehabt zu haben” (IMF, 2000a, Übers. T.F.). 3.2 Devisentransaktionssteuern Gänzlich lehnt das Finanzministerium schließlich Kapitalverkehrsbeschränkungen ab, die auf eine “Verteuerung” bestimmter Transaktionen abzielen. Angesprochen, wenn auch nicht explizit erwähnt, ist hier natürlich die von vielen PolitikerInnen, Wissenschaftlern und sozialen Bewegungen geforderte Steuer auf Devisengeschäfte, die nach ihrem Erfinder benannte Tobin-Steuer. Die ablehnende Haltung versucht das BMF mit dem wenig überzeugenden Argument zu begründen, die damit erhoffte Eindämmung kurzfristiger spekulativer Finanzströme könne nicht erreicht werden, “weil ‘spekulative’ Kapitalbewegungen nicht von anderen kurzfristigen Kapitalbewegungen zu unterscheiden sind”. Nun besteht der Vorschlag einer Devisentransaktionssteuer nicht darin, Motivforschung zu betreiben und Spekulation von Nicht-Spekulation zu scheiden, sondern in der Erhebung eines bestimmten Steuersatzes (in der Diskussion sind aktuell 0,1% bis 0,5%) auf jedes Devisengeschäft. Dieses hätte den durchaus gewollten Effekt, die Rentabilitätsschwelle für Devisengeschäfte um den entsprechenden Steuersatz zu erhöhen, sodass die Ausnutzung minimaler Kursschwankungen solange unterbleibt, wie die zu erwartende Rendite niedriger als der jeweilige Steuersatz wäre. Da die Ausnutzung niedrigster Kursschwankungen nur bei sehr kurzer Anlagedauer von oftmals nicht mehr als einem Tag möglich ist, würden insbesondere kurzfristige Devisengeschäfte unterbleiben. Über 80% der Devisengeschäfte haben eine Anlagedauer von acht Tagen oder weniger. Die mit einer Devisentransaktionssteuer einhergehende Dämpfung von Kursschwankungen (der sog. Volatilität) könnte zu einer gewissen Stabilisierung der Wechselkurse beitragen, wovon wiederum kleinere Volkswirtschaften profitieren würden. Attraktiver Nebeneffekt der Steuer wäre die Generierung von Einnahmen, die bei entsprechender Einigung z.B. für Umwelt- oder Entwicklungsprojekte verwendet werden könnten (Wahl/Waldow, 2001). Leider bleibt bei den Überlegungen des BMF auch die Veränderung der Zusammensetzung der Kapitalflüsse in Entwicklungsländer unberücksichtigt. Dies ist insofern problematisch, als erwartet wird, dass sich die Volatilität der Finanzströme zukünftig noch vergrößert. So ist schon seit Beginn der 80er Jahre der Anteil vor allem längerfristiger Bankkredite kontinuierlich gesunken, während kurzfristige Kredite und Portfolio-Investitionen (Aktien, Anleihen, Derivate etc.) angewachsen sind (Akyüz/Cornford, 1999). Zwar entfällt der größte Anteil der Finanzströme bei Schwellenländern auf ausländische Direktinvestitionen, die aufgrund ihrer Bindung in Infrastrukturprojekte oder Unternehmensbeteiligungen relativ stabil sind. Jedoch wird im Gefolge der Asienkrise auch bei Direktinvestitionen ein Rückgang verzeichnet, der Schwellenländer nötigt, sich zukünftig vermehrt über die wesentlich schwankungsanfälligeren Anleihen zu finanzieren (IIF, 2001). Vor dem Hintergrund noch zunehmender Volatilität der Finanzströme erweist sich also die effektivere Regulierung des Kapitalverkehrs sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene als 7 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? dringend geboten. Gänzlich kontraproduktiv ist daher die Absicht des Finanzministeriums, mittelfristig die Kapitalverkehrsliberalisierung in das Mandat des IWF aufzunehmen. 3.3 Währungskooperation Zu den von Ex-Finanzminister Lafontaine vorgeschlagenen und u.a. von Japan positiv aufgenommenen Wechselkurszielzonen für die bedeutendsten Währungen Dollar, Euro und Yen bezieht das Finanzministerium nicht direkt Stellung, sondern verweist auf die existierenden erheblichen Vorbehalte. Diese gründen sich u.a. auf die im Konfliktfall unvermeidliche Einschränkung staatlicher Souveränität zugunsten eines stabilen Wechselkurses. Das BMF merkt an: “Erfahrungsgemäß sind dazu insbesondere die USA nicht bereit.” Tatsächlich gibt es auch von ökonomischer Seite gewichtige Einwände gegen Zielzonen, verstanden als Bandbreite um einen Gleichgewichtskurs, bei welchem die Leistungsbilanzen der beteiligten Länder sich mittelfristig ausgleichen. Dieses Konzept ist solange problematisch, wie es erhebliche Leistungsbilanzungleichgewichte zwischen den USA mit ihrem eklatanten Defizit, und Europa und Japan mit ihren Leistungsbilanzüberschüssen gibt. Gleichgewichtskurse, die zumindest auf einen kurzfristigen Ausgleich der Leistungsbilanzen abzielen, könnten drastische Veränderungen der Wechselkurse (Abwertung des Dollar, Aufwertung des Euro) sowie der Handelsströme nach sich ziehen und destabilisierend wirken.3 So ist der hohe Dollarkurs gepaart mit einem vergleichsweise hohen Zinsniveau Garant dafür, dass die USA ihr Leistungsbilanzdefizit mittels ausländischer Kapitalzuflüsse ausgleichen können. Allerdings bleibt trotz der z.T. berechtigten Einwände gegen eine kurzfristige Etablierung von Zielzonen die dahinter stehende Absicht einer Stabilisierung der Währungsrelationen unverändert sinnvoll, insbesondere bei Berücksichtigung des hohen Schadens abrupter Wechselkursveränderungen für Entwicklungsländer. Sie sind in besonderem Maße von den Schwankungen zwischen den Leitwährungen betroffen, was bei den Überlegungen des BMF leider unberücksichtigt bleibt. Koppeln sich Entwicklungsländer an eine der Leitwährungen oder an einen Währungskorb an, so wie häufig durch den IWF empfohlen, kann dies zu realer Aufwertung führen und eine spekulative Attacke gegen die eigene Währung auslösen. Lassen sie dagegen ihren Wechselkurs frei schwanken, bleiben sie ebenfalls verwundbar. Insofern ist eine Stabilisierung der Wechelkursrelationen zwischen den Leitwährungen schon allein aus entwicklungspolitischen Gründen einzuklagen. Zudem können stabilere Währungsrelationen auch in den industrialisierten Ländern – im Gegensatz zu den Annahmen des BMF – größere binnenwirtschaftliche Spielräume, zum Beispiel hinsichtlich einer konjunkturförderlichen Zinspolitik, schaffen. Eine intensivierte währungspolitische Kooperation zwischen den USA, Europa und Japan sollte daher angestrebt werden. Geprüft werden könnte auch, ob ein Übereinkommen zur Vermeidung abrupter Wechselkursschwankungen (vgl. Huffschmid 1999: 200f.) sinnvoll wäre. Aufgrund des mangelnden politischen Willens, eine ReRegulierung auf globaler Ebene zu erzielen, kommt daneben der im Gefolge der Asienkrise erneut diskutierten regionalen währungspolitischen Kooperation ein wichtige Funktion zu. Die 3 Die asiatischen Exporte in die USA schlagen sich zwar in dem hohen US-amerikanischen Handelsdefizit nieder, sind aber für die Schwellenländer Asiens von hoher Bedeutung. Wären die USA als “byuer of last resort” ausgefallen, hätte die Asienkrise noch verheerendere Auswirkungen haben können. 8 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Wechselkursstabilisierung und der Schutz vor Währungsspekulation würde dabei durch regionale Währungsverbünde – möglichst angelehnt an eine der drei Leitwährungen –- in Asien, Amerika und Europa (unter Einschluss afrikanischer Währungen) angestrebt (UNCTAD, 2001, S. 65f.). 4. Einbeziehung des Privatsektors oder Sozialisierung der Verluste? Die umfangreichen Kreditpakete, die der IWF und einige Gläubigerregierungen bei den vergangenen Finanzkrisen für Mexiko (40 Mrd. $), Südostasien (insgesamt 120 Mrd. $) oder Brasilien (41,5 Mrd. $) aufgebracht haben, sind erheblich kritisiert worden, da die Schuldnerländer diese Mittel teilweise unmittelbar zur Begleichung der Forderungen privater Investoren verwendeten, mithin private Verluste durch öffentliche Gelder aufgefangen wurden. Die Gewinne aus den teilweise hochriskanten Anlagen konnten die privaten Investoren hingegen ungeschmälert einstreichen. Die Bereitstellung der Rettungspakete wird geradezu als Anreiz für institutionelle Investoren (Banken, Versicherungen, Investmentfonds) angesehen, unter Vernachlässigung angemessener Risikoabschätzungen riskante, aber eben deshalb besonders rentierliche Engagements einzugehen. Die Erwartung, im Verlustfall durch öffentliche Kredithilfe für die Schuldner herausgehauen zu werden (das sog. “bail-out”), stimuliert geradezu leichtsinniges Investorenverhalten; ein Fehlanreiz, der mit dem Terminus “moral hazard” belegt wird. Die Wahrscheinlichkeit umfangreicher Rettungspakete ist dabei besonders groß, wenn die internationale Gemeinschaft ein hohes Systemrisiko durch die mögliche Übertragung einer nationalen Krise auf weitere Länder erwartet. Ein solches Systemrisiko wird meist bei den Finanzkrisen größerer Schwellenländer angenommen. Aufgrund der Kritik an der Sozialisierung privater Verluste sahen sich der IWF und Gläubigerregierungen genötigt, der Einbeziehung des Privatsektors bei der Krisenbewältigung (Private Sector Involvement - PSI) größere Aufmerksamkeit zu schenken. Nach Ansicht des BMF solle der Privatsektor “grundsätzlich” bei allen Krisenfällen in die Krisenbewältigung einbezogen werden, d.h. entsprechende Finanzierungslasten mittragen. Andererseits ist die Beteiligung des Privatsektors für das BMF aber nicht zwingend: “Bei jeder Krise insbesondere mit großem Finanzbedarf sollte der Verzicht auf PSI und nicht die Forderung nach PSI begründet werden.” An praktischen Maßnahmen mit präventiver Wirkung empfiehlt das BMF den Dialog zwischen Gläubigern und Schuldnern sowie zwischen IWF und privaten Finanzinstituten, die Bildung von Gläubigerausschüssen und die Einführung von Umschuldungsklauseln in die Staatsanleihen der Schwellenländer. Allerdings stimmen die jüngsten Beispiele einer veränderten Politik gegenüber Privatgläubigern, vor allem Banken und Anleihehaltern, skeptisch, ob durch sie eine nachhaltige Verbesserung der Situation für die Schuldnerländer erzielt werden konnte. 4.1 Einbeziehung von Gläubigerbanken Ende 1997 kam es zu einer vielbeachteten Einbeziehung der internationalen Bankgläubiger Südkoreas. Deren ausstehende Forderungen auf kurzfristige Interbanken-Kredite – die hauptsächliche externe Finanzierungsquelle koreanischer Banken – beliefen sich auf mehr als 26 Mrd. $. Zugleich waren die Devisenreserven der koreanischen Zentralbank auf 6 Mrd $ zusammengeschmolzen. Vor 9 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? diesem Hintergrund verweigerten die Geschäftsbanken die sonst übliche Verlängerung ihrer kurzfristigen Kredite, das sog. “roll over”, sodass deren Bedienung binnen zweier Monate fällig geworden wäre. Aus Angst, die bevorstehende Zahlungsunfähigkeit Südkoreas könne sich zu einer Krise des Weltfinanzsystems ausweiten, beriefen die Zentralbanken u.a. der USA, Japans, Deutschlands und Großbritanniens Treffen mit ihren jeweiligen Geschäftsbanken ein, um diese zur Verlängerung ihrer Kredite zu bewegen. Die Banken willigten schließlich ein und verlängerten die Fälligkeiten um einige Monate. Bedenklich sind dabei aber die Konditionen, zu denen das Einlenken der Banken erkauft wurde. So wurde zum einen die Bereitstellung weiterer öffentlicher Ressourcen der internationalen Geber in Aussicht gestellt. Zum anderen einigte sich Korea mit den Privatgläubigern auf eine Umschuldung der Kredite in neue Kontrakte mit Laufzeiten von ein bis drei Jahren, die mit deutlichen Zinsaufschlägen gegenüber dem Vor-Krisen-Niveau versehen waren. Die Attraktivität dieser Restrukturierung wurde zudem durch die Gewährung einer Staatsgarantie der koreanischen Regierung auf die Neu-Kredite erhöht. Damit verwandelte sich die Forderung gegenüber einer koreanischen Bank in eine Forderung gegenüber dem koreanischen Staat, mithin eine erfolgreiche Sozialisierung privater Verluste (IMF, 2000, 130). Die koreanische Staatsgarantie erlangte schließlich hohe Glaubwürdigkeit durch das bis dahin größte Rettungspaket des IWF in Höhe von 57 Milliarden $. 4.2 Einbeziehung von Anleihehaltern Auch die jüngeren Beispiele für die Einbeziehung der Anleihegläubiger bei der Krisenbewältigung erweisen sich bei näherer Betrachtung als problematisch. Mit dem bei Schwellenländern seit den 80er Jahren zu beobachtenden Trend, die externe Finanzierung zunehmend auf die Emission von Staatsanleihen – also weniger auf die Aufnahme von Bankkrediten – abzustellen, wächst die sehr breit gestreute Gruppe der Anleihegläubiger beständig an. Dieser Trend steigert aber die Schwankungsanfälligkeit der Finanzflüsse, da im Fall von Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerländer Wertpapiere leichter abgestoßen werden können als z.B. faule Kredite. Zugleich wurden Anleihen noch bis vor Kurzem bei Umschuldungsverhandlungen nicht erfasst, sodass die Halter dieser Papiere ungeschoren davon kamen. Während gewisse – allerdings unzureichende – Prozeduren für die Umschuldungen der Forderungen offizieller Geber (diese Rolle übernimmt der sog. Pariser Club) wie auch für die Restrukturierung der Kredite von Privatbanken (Londoner Club) existieren, gibt es keine entsprechenden Mechanismen für die Anleihegläubiger. Die offiziellen Geber, der IWF und einige Privatbanken üben daher seit wenigen Jahren Druck aus, dass im Falle von Zahlungskrisen der Schwellenländer auch die Anleihegläubiger bei der Krisenbewältigung einbezogen werden sollen. Die veränderte Politik gegenüber Anleihehaltern konnte bei den Zahlungskrisen der Ukraine, Pakistans, Ecuadors und Perus beobachtet werden. Pakistan gilt es erstes Land, bei dem der Pariser Club der bilateralen öffentlichen Geber sein Prinzip der Gleichbehandlung sämtlicher Gläubiger auch auf Anleihehalter ausweitete. In seinem Umschuldungsübereinkommen vom Januar 1999 verlangte der Pariser Club von Pakistan, dass nicht nur die im Londoner Club zusammengeschlossenen Bankgläubiger in vergleichbarer Weise zur Kasse gebeten werden, sondern auch die Besitzer pakistanischer Staatsanleihen. Nachdem sich Pakistan mit seinen Bankgläubigern im Juni 1999 auf neue Zahlungskonditionen einigte, zwang es daher im November des Jahres auch die Anleihebesitzer zu einem Schuldentausch. Nach anfänglichen Protesten nahmen schließlich aber 99% der 10 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Anleihehalter, zumeist institutionelle Investoren und Privatpersonen, an dem vorgeschlagenen Tausch teil, denn die Konditionen waren äußerst lukrativ. Das Übereinkommen sah den Tausch dreier in USDollar denominierter Anleihen gegen eine sechsjährige Anleihe mit 10% Zins vor. Der Effekt dieser großzügigen Umschuldungen für den zukünftigen Schuldendienst Pakistans ist jedoch ernüchternd. Es wird geschätzt, dass die Übereinkommen mit dem Pariser und Londoner Club zusammen mit dem Anleihetausch die Schuldendienstzahlungen Pakistans schon 2001 wieder auf das Vor-Krisen-Niveau treiben und für die Restlaufzeit der sechjährigen Anleihen noch weiter steigen werden (IMF, 2000, 144). 4.3 Umschuldungsklauseln Aufgrund der Attraktivität des Tauschangebots der pakistanischen Regierung an die Anleihegläubiger war es nicht nötig, die in den Kontrakten enthaltenen Umschuldungsklauseln, die sog. Collective Action Clauses, anzuwenden. Derartige Klauseln sollen die Koordination von Anleihegläubigern bei Krisen der Schuldnerländer erleichtern, insbesondere durch Begrenzung der Möglichkeit abtrünniger Gläubiger, ein Umschuldungsabkommen zu behindern oder zu unterlaufen. Das Problem ist, dass die Gläubiger als Gesamtheit besser fahren, wenn sie einem Umschuldungsabkommen zustimmen, dennoch der einzelne Gläubiger versucht ist, seine Forderungen individuell durchzusetzen. Das individuelle Vorgehen kann ihnen z.B. durch die Beschlagnahme der Auslandsguthaben von Schuldnerländern, durch Klagen oder durch Klauseln in Anleiheverträgen ermöglicht werden, die ihnen Ansprüche auf zukünftige Kapitalzuflüsse oder Exporterlöse der Schuldner verschaffen. Collective Action Clauses sollen es dagegen erleichtern, eine gemeinsame Regelung für sämtliche Anleihegläubiger zu erreichen. Sie können Bestimmungen über die gemeinsame Interessenvertretung der Gläubiger, über Mindestquoren für die Veränderung der Anleihekonditionen sowie über die Aufteilung der Einkünfte nach einer Umschuldung enthalten (Group of Ten, 1996). Insofern können Umschuldungsklauseln, wie auch die in diesem Zusammenhang vorgeschlagenen Gläubiger-Komitees, durchaus hilfreich sein, das Zustandekommen von Umschuldungsabkommen zu erleichtern. Allerdings greift der Vorschlag des BMF, Umschuldungklauseln in internationale Staatsanleihen “insbesondere der Schwellenländer” zu integrieren, zu kurz. Da Schwellenländer befürchten, ihre Anleihefinanzierung könne durch diese Klauseln verteuert werden, ist es selbstverständlich sinnvoll, dass auch die Anleihen der Industrienationen derartige Klauseln verpflichtend enthalten. Noch 1999 hat das BMF in dieser Frage eine fortschrittlichere Position vertreten. Beim IWF-Interim-Komitee-Treffen im September 1999 verkündete Finanzminister Eichel: “Emerging markets economies cannot be expected to introduce CACs (Collective Action Clauses, T.F.) in their own government bonds unless the major industrial countries are prepared to take the lead. Germany is prepared to work towards achieving progress on this issue in close collaboration with other industrial countries” (Eichel, 1999). Das heutige Zurückrudern muss als Beleg des abflauenden Reformeifers interpretiert werden. Allerdings sollten die Wirkungen von Collective Action Clauses auch nicht überbewertet werden, denn wie der pakistanische und andere Fälle zeigen, muss das Schuldnerland auch bei gelungener Einbeziehung der Anleihegläubiger keineswegs besser dastehen. Insofern erscheinen Umschuldungsklauseln, die Pakistan im Unterschied z.B. zur Ukraine gar nicht anwenden brauchte, als zwar sinnvolle, aber keineswegs hinreichende Maßnahme. 11 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Fazit: Zwar wurde der Privatsektor seit der Asienkrise einige Male bei der Krisenbewältigung beteiligt (das sog. “bail-in”), unter dem Strich hat dies für die betroffenen Länder aber zu keiner nachhaltigen Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation geführt. Ganz im Gegenteil, sind die Staatshaushalte durch die unvorteilhaften Umschuldungskonditionen häufig mit höheren Zinszahlungen belastet worden, so geschehen in Südkorea und Pakistan. Hinzu kommt, dass die Übernahme staatlicher Garantien für die Schulden privater Unternehmen, welche sich noch als zukünftige Belastungen erweisen können, zur weit verbreiteten Praxis in den Krisenländern wurde. Die öffentliche Verschuldung stieg entsprechend in den Krisenländern drastisch an, was wiederum erhebliche Restriktionen für z.B. Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsausgaben bedeutete (vgl. Chomthongdi, 2000). Die bisherigen Beispiele für die Privatsektor-Beteiligung legen daher den Schluss nahe, dass es eher zu einem bail-out als zu einem bail-in gekommen ist, denn die privaten Gläubiger standen nach den Umschuldungen zumeist noch besser da. Die Privatsektor-Beteiligung bei der Krisenbewältigung dient offenbar eher dazu dient, die Lastenteilung zwischen öffentlichen und privaten Gläubigern, denn die zwischen Gläubigern und Schuldnern neu zu ordnen (Akyüz, 2001). Die bisherigen ernüchternden Erfahrungen sprechen allerdings nicht gegen die Beteiligung privater Gläubiger bei der Krisenbewältigung – selbstverständlich müssen risikofreudige Investoren ihre Verluste selbst tragen. Von der Bundesregierung ist hier zu fordern, nicht nur die Einbindung des Privatsektors zu propagieren, sondern konkrete Vorschläge zur ihrer effektiven Umsetzung zu unterbreiten, welche vor allem die notorische Sozialisierung privater Verluste verhindern. Die geschilderten Erfahrungen offenbaren zudem die Notwendigkeit einer grundlegenden NeuOrdnung des Schuldner-Gläubiger-Verhältnisses, welche das gängige gläubiger-dominierte Schuldenmanagement z.B durch die Internationalisierung insolvenzrechtlicher Verfahren überwindet (s.u.). Eine Forderung, der sich die Bundesregierung bisher aber noch verschließt. 12 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 5. Finanzmarkt-Aufsicht: Die Lücke als Programm? In den offiziellen Reformvorschlägen, so auch beim BMF, spielt das Bekenntnis zur Stärkung der Aufsicht über die Finanzmärkte traditionell eine wichtige Rolle. Jedoch muss sich das Bekenntnis zur Finanzmarkt-Aufsicht nicht unbedingt in einer strengeren Regulation der internationalen Finanzmärkte niederschlagen. Noch unmittelbar nach der Asienkrise entstand vielfach der Eindruck, dass gerade mit der Stärkung der Finanzmarkt-Aufsicht eine neue Phase der Re-Regulierung vormaliger Deregulierungen der Finanzmärkte anbrechen würde. Diese Einschätzung muss heute allerdings mit Skepsis betrachtet werden. So lassen sich nach wie vor erhebliche aufsichtsrechtliche Lücken, gezielte Schwächungen staatlicher Aufsichtsbehörden und – besonders problematisch – seit einigen Jahren forcierte Übertragungen bestimmter Aufsichtsfunktionen auf die privaten Marktteilnehmer beobachten. Gerade die Tendenz zur Selbstregulation der Märkte und zur Entwicklung öffentlichprivater “partnerschaftlicher” Kooperationen lässt sich an der gegenwärtigen Revision der Baseler Eigenkapitalvorschriften beobachten. Das BMF geht zwar auf diesen Prozess ein, die mit ihm assoziierten Schwächen bleiben jedoch entweder unerwähnt oder es wird pauschal Entwarnung signalisiert. 5.1 Die Revision des Baseler Akkords Mit dem Baseler Akkord von 1988 wurde erstmals ein internationaler Mindeststandard für die Eigenkapitalausstattung international tätiger Banken festgelegt. Ausgearbeitet wurde dieser Standard von dem bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) angesiedelten Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, einem Expertengremium von Zentralbankchefs und Bankenaufsehern einer Gruppe von 12 wichtigen Industrieländern.4 Hintergrund war die Schuldenkrise der 80er Jahre, die die notorische Unterfinanzierung vor allem der US-amerikanischen Banken enthüllte, die in besonderem Maße vom Ausfall der lateinamerikanischen Großschuldner betroffen waren. Der Baseler Akkord von 1988 empfahl eine Standardeigenkapitalquote im Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiva von zumindest 8%. Diese Empfehlung ist laut BIZ in mehr als 100 Ländern angewendet worden und hat in der Folge auch zu einer Erhöhung der Eigenkapitalquoten internationaler Geschäftsbanken geführt. Im Juni 1999 legte der Baseler Ausschuss einen ersten Vorschlag für eine Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung vor (“Basel II” genannt), welcher den veränderten Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts Rechnung tragen und “risikogerechtere Regelungen” einführen solle. Im Januar 2001 veröffentlichte der Ausschuss ein modifiziertes zweites Konsultationspapier, das nach weiteren Beratungen mit relevanten Akteuren bis Ende 2001 endgültig verabschiedet und ab 2004 umgesetzt werden soll. Die Richtlinien beziehen sich dabei nicht nur auf international tätige Banken, sondern sollen auf sämtliche wichtigen Kreditinstitute Anwendung finden (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, 2001). Wesentliche Neuerungen sind die Einführung zweier neuer Säulen neben der ersten Säule der Mindesteigenkapitalanforderungen. Zweite Säule ist die Überprüfung bankinterner 4 Zu dieser Gruppe gehören Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Schweden, die Schweiz, die USA und Großbritannien. 13 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Risikobewertungsverfahren durch die Aufsichtsinstanzen. Die dritte Säule betrifft die Stärkung der Marktdisziplin duch vermehrte Offenlegungspflichten, denen Banken unterworfen werden sollen. Die Mindesteigenkapitalanforderungen werden dahingehend ergänzt, dass neben dem Kreditrisiko (Ausfall der Zahlungen eines Schuldners) und dem Marktrisiko (z.B. Veränderungen von Marktpreisen) auch das sog. operationelle Risiko (Computerfehler, mangelnde Dokumentation, Betrug etc.) in die Risikomessung einbezogen wird. Wesentlichste Neuerung ist, dass zur Messung des Kreditrisikos die Banken bei der Gewichtung ihrer eingegangenen Risiken entweder auf die externen Bonitätsbewertungen von Rating-Agenturen bzw. staatlichen Exportkreditversicherern oder auf interne Einschätzungen der Bonität eines Schuldners zurückgreifen sollen. Die auf internen Ratings basierenden Verfahren würden dann durch die Bankenaufsicht überprüft (die zweite Säule von Basel II). Diese Form der Selbstregulation ist dann besonders problematisch, wenn staatliche Aufsichtsinstanzen nur ungenügend in der Lage sind, die Qualität der internen Rating-Verfahren zu beurteilen (Lütz, 2000). Die Methoden internen Risikomanagements sind mitunter derart komplex, dass sie für Außenstehende schwer durchschaubar sind. Die Last der Regulierung wird sich daher erheblich erhöhen. Hinzu kommt, dass es kaum Kriterien zur Beurteilung interner Rating-Verfahren gibt. Schließlich wird vermutet, dass durch die Verwendung eigener Berechnungsmodelle die Eigenkapitalanforderungen inbesondere im Firmenkundengeschäft und im Investmentbanking niedriger ausfallen werden als unter den gegenwärtigen Verfahren. Vor allem europäische Banken setzten sich stark für die Anerkennung interner Ratings ein, da sie befürchteten, ihre Aktiva würden anderenfalls extern durch US-amerikanische Rating-Agenturen bewertet. Die Anerkennung privater Rating-Agenturen ist ebenfalls hoch problematisch. So nehmen die beiden US-Firmen Moody’s und Standard & Poor’s beim Kreditrating eine weltweit marktbeherrschende Stellung ein und ihre Bedeutung wird durch den neuen Baseler Akkord noch zunehmen. Hinzu kommt, dass diese Firmen schon jetzt durch Wettbewerbsdruck genötigt werden sollen, die Kriterien ihrer Bonitätsbewertungen zu lockern (vgl. Financial Times, 2001). Insofern erscheint es kaum verantwortlich, derartige Aufsichtsfunktionen auf Marktakteure zu übertragen. Außerdem haben sich Rating-Agenturen während der letzten Krisen nicht eben mit Ruhm bekleckert, da ihre Bewertungen genauso fehlerhaft waren wie die aller anderen Akteure. Mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit von Schwellenländerschuldnern folgten sie lediglich den ohnehin negativen Einschätzungen der Investoren und verschärften damit noch die Krise (UNCTAD, 2001, S. 98f). Aus entwicklungspolitischer Sicht besonders problematisch ist ein eklatanter Fehlanreiz des bestehenden Baseler Akkords, der auch in der jetzt vorgeschlagenen Revision nicht beseitigt wird, nämlich die Privilegierung kurzfristiger gegenüber langfristigen Bankkrediten. Die Baseler Eigenkapitalvereinbarung sieht vor, dass die Kreditrisiken je nach Schuldnerkategorie unterschiedlich gewichtet werden, entweder mit 0%, 20%, 50% oder 100%. Eine Risikogewichtung von 100% bedeutet, dass ein eingegangenes Risiko zum vollen Wert berücksichtigt werden muss und daher die empfohlene Eigenkapitalquote von 8% dieses Werts zu unterlegen ist. Entsprechend führt eine Risikogewichtung von 20% zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote von 1,6% (einem Fünftel von 8%). Der Baseler Akkord belegt nun aber Forderungen gegenüber Banken außerhalb der OECD (also in Entwicklungs- und Schwellenländern) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr mit einer sehr niedrigen Risikogewichtung von 20%. Hingegen werden Forderungen gegenüber Banken außerhalb der OECD mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr mit einer Risikogewichtung von 100% belegt (Basle Committee on Banking Supervision, 1988, Annex 2). Obwohl beständig auch von den Internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) auf die besonderen Risiken für Entwicklungsländer hingewiesen wird, die mit kurzfristigen Interbankenkrediten einhergehen, wird deren Privilegierung 14 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? gegenüber langfristigen Krediten auch bei Basel II beibehalten. Profiteure dieses eindeutigen Fehlanreizes sind natürlich die international tätigen Großbanken, die ein Interesse daran haben, möglichst kurze Kreditlaufzeiten zu vereinbaren, um nach eigenem Ermessen über deren mögliche Verlängerung (“roll-over”) entscheiden zu können. Ein Schelm, wer vermutet, die Kreditwirtschaft sei an diesen Bestimmungen nicht ganz unbeteiligt. Das BMF erwähnt leider keines der hier beschriebenen Probleme, die mit dem Baseler Akkord assoziiert werden, sondern beschränkt sich auf die Nennung einiger deutscher Forderungen, die in dem neuen Konsultationspapier berücksichtigt worden seien. Betont wird u.a., dass es durch Basel II zu keiner strukturellen Benachteiligung der kreditnehmenden Wirtschaft bzw. des Mittelstandes komme. Diese Entwarnung bezieht sich auf die in der bundesdeutschen Diskussion dominierende Befürchtung, der neue Akkord werde zu einer Verteuerung der Kreditkosten für die mittelständische Wirtschaft führen. Im Extremfall könnten die Kreditkosten untragbar werden, sodass vor allem stärker verschuldete Unternehmen in den Konkurs getrieben würden. Überdies wird befürchtet, dass sich aufgrund des Rückzugs der Großbanken aus diesem Segment, die als risikoreicher angesehenen Mittelstandskredite vor allem bei den öffentlichen Banken und Sparkassen konzentrieren werden. Hinzu kommt, dass kleinere, weniger modern ausgestattete Banken aufgrund höherer Betriebsrisiken mit einer erheblichen Kapitalunterlegung belastet werden könnten, was sich für deren klein- und mittelständische Kreditnehmer wiederum negativ auswirken könnte (Cameron, 2001). Eine überzeugende Entkräftung dieser Befürchtungen vermag das BMF nicht zu liefern. 5.2 Kontrolle von Hedge Fonds Auch die neuen Baseler Eigenkapitalvorschriften werden sich lediglich auf Banken und deren Holdings beziehen, Versicherungen, Investment- und Pensionsfonds bleiben ausgenommen. Dies ist besonders problematisch im Fall der hochspekulativen sog. Hedge Fonds. Im Prinzip haben nur institutionelle und vermögende Privatanleger Zugang zu dieser exklusiven Form von Investmentfonds. Ihre besondere Gefährlichkeit liegt in dem großen Hebeleffekt, d.h. über die Aufnahme von Bankkrediten und den Abschluss von hochriskanten “innovativen” Finanzinstrumenten, den sog. Derivaten, können Hedge Fonds das spekulativ investierte Gesamtkapital bis zum 250fachen ihres Eigenkapitals steigern. So auch beim US-amerikanischen Hedge Fonds LTCM (Long Term Capital Management), dessen Beinahe-Zusammenbruch 1998 als ernsthafte Bedrohung der Stabilität des Finanzsystems angesehen wurde. Da nämlich zahlreiche Großbanken, darunter auch Deutsche und Dresdner, z.T. unbesicherte Kredite an den Fonds vergaben, hätte der Zusammenbruch von LTCM auch sie mitreißen können. Daher zwang die US-Notenbank Federal Reserve 14 Großbanken dazu, ein Rettungspaket von 3,625 Mrd. $ zu schnüren und den Fonds teilweise zu übernehmen. Hinzu kommt, dass sog. Global Macro Hedge Fonds die jüngsten Finanzkrisen durch ihre Spekulationen gegen Währungen vor allem der Schwellenländer verschärft haben. Durch den Einsatz riesiger Summen können Hedge Fonds die Abwertung von Währungen erzwingen, was dem Quantum Fonds des Spekulanten George Soros und weiteren Hedge Fonds 1992 sogar gegen das britische Pfund und andere europäische Währungen gelang. Bei der südostasiatischen Finanzkrise mischten die Fonds ebenfalls mit spekulativen Attacken gegen den als überbewertet eingeschätzten thailändischen Baht mit. Nach der Freigabe des Baht-Kurses 1997 begann der Abwertungswettlauf, sodass auch die Währungen der Nachbarländer Malaysia, Philippinen, Indonesien und Südkorea nicht mehr zu halten 15 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? waren. Die sozialen Folgen, drastische Steigerung von Arbeitslosigkeit und Armut, waren beträchtlich (Chomthongdi, 2000). Die Zahl der Hedge Fonds wird weltweit auf ca. 5.500 geschätzt. Größtenteils haben sie ihren Sitz in den USA oder in den zahlreichen unregulierten Offshore-Finanzzentren, wo sie ihren äußerst klandestin gehandhabten Geschäften weitgehend ungestört von Aufsichtsbehörden nachgehen können. Gemananged werden die in Offshore-Zentren angesiedelten Hedge Fonds allerdings von den wichtigen Finanzplätzen wie London oder New York. Das BMF verweist im Zusammenhang mit der Regulierung von Hedge Fonds auf die Empfehlungen des Financial Stability Forum (FSF)5, dessen Arbeitsgruppe zu sog. Highly Leveraged Institutions (HLI) u.a. erweiterte Offenlegungspflichten sowie die Einhaltung von Risikomanagementstandards bei Hedge Fonds und kreditgebenden Banken forderte. Zu der von der Bundesregierung favorisierten direkten Beaufsichtigung von Hedge Fonds habe sich das FSF aber nicht durchringen können. Wie vom Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen bestätigt wird, waren es vor allem die USA, die sich gegen diese Forderung gesperrt haben. Sollten sich bei der im Frühjahr 2002 anstehenden Überprüfung der Empfehlungen des FSF die bisherigen Maßnahmen als unzureichend erweisen, “wird Deutschland erneut für die direkte Regulierung von HLIs eintreten”, so das BMF. Die Position der Bundesregierung geht in die richtige Richtung, eine direkte Beaufsichtungung von Hedge Fonds sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Allerdings gehen soziale Bewegungen, wie z.B. das ATTACNetzwerk, weiter und fordern ein Verbot der Hedge Fonds (ATTAC, 2000), denn mit ihnen wird keinerlei volkswirtschaftlicher oder sozialer Nutzen verknüpft, die angerichteten Schäden hingegen sind enorm. Für die Kohärenz der kritischen deutschen Haltung zu Hedge Fonds wäre es allerdings zuträglich, wenn Investment-Zertifikate wie Xavex Hedge-Select der Deutschen Bank nicht auf den Markt gebracht werden dürften. Obwohl Hedge Fonds in Deutschland nicht zugelassen sind, ermöglicht dieses im letzten Jahr von der Deutschen Bank angebotene Zertifikat deutschen Anlegern “den Zugang zur Welt der Hedge Fonds, der bisher nur einem kleinen exklusiven Personenkreis offen stand”, wie es im Prospekt heißt (Deutsche Bank, 2000). Die Deutsche Bank weist auf die Barrieren für Privatanleger hin, welche mit ihrem Instrument überwunden werden: “Die meisten Hedge Fonds sind im Ausland ansässig und unterliegen damit oftmals keiner aufsichtsrechtlichen Überwachung und können deshalb den Anlegern nicht öffentlich angeboten werden” (ebd.). Hedge Select schafft hier Abhilfe. Anleger kommen nun in den Genuss eines Anlageinstruments, das das attraktive Renditepotenzial von Hedge Fonds mit der Transparenz eines Zertifikats verbinde, welches zudem in den amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt wird. Das Hedge Select Portfolio werde über die gesamte Laufzeit von acht Jahren aus mindestens 15 Hedge Fonds bestehen, zu Beginn seien 22 Fonds enthalten. Darunter befinden sich auch die in der Devisenspekulation engagierten Global Macro Hedge Fonds. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Bundesregierung auf internationalem Parkett für eine direkte Beaufsichtung von Hedge Fonds eintritt, auf dem heimischen 5 Das Financial Stability Forum (FSF) ist ein im Februar 1999 gegründetes und bei der BIZ angesiedeltes Expertengremium, dem Finanzminister, Notenbankchefs, Vertreter von Aufsichtsbehörden und internationaler Finanzinstitutionen angehören. Aufgabe ist die Erarbeitung von Vorschlägen zur Reform des Finanzsystems sowie zur Vermeidung von Finanzkrisen. Im April 2000 legte das FSF drei Arbeitsgruppenberichte zu Highly Leveraged Institutions, Kapitalverkehr und zu Offshore-Finanzzentren vor (Financial Stability Forum, 2000). 16 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Markt aber die Investition in eben diese Instrumente ermöglicht. Derartige Zertifikate müssten konsequenterweise verboten werden. 5.3 Offshore-Zentren und Steueroasen Die Regulierung von Offshore-Finanzzentren (OFCs) und Steueroasen ist zweifellos einer derjenigen Bereiche, wo die Lücken der Finanzaufsicht am größten sind. Offshore-Zentren sind Finanzplätze, in denen übliche aufsichtsrechtliche Standards nicht eingehalten werden. Sie erlauben ausländischen Banken, Versicherungen, Industrie- und Handelsunternehmen sowie vermögenden Einzelpersonen Geschäftspraktiken, die in ihren Heimatländern nicht erlaubt sind. Typischerweise gelten die Sonderregeln in Offshore-Zentren nur für die Geschäfte “Nicht-Gebietsansässiger”. Neben geringen Auflagen bieten OFCs Steuervergünstigungen oder –befreiungen auf Vermögenserträge, Unternehmensgewinne und Handelsgeschäfte. Strikt gehandhabt wird hingegen das Bankgeheimnis. So verweigern die meisten OFCs jegliche Auskünfte über die bei ihnen getätigten Geschäfte, vor allem gegenüber ausländischen Steuer- oder Strafverfolgungsbehörden. Die bedeutendsten OffshoreZentren finden sich allerdings in Industrieländern sowie in Territorien, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ehemaligen Kolonialmächten stehen. Zu den wichtigsten OFCs zählen die City of London, die International Banking Facilities der USA, Staaten wie die Schweiz, Luxemburg, Singapore oder Hong Kong. Daneben die von Großbritannien abhängigen Territorien im Ärmelkanal (Jersey, Guernsey) oder in der Karibik (Cayman Islands, Bermudas). Hinzu kommen all die Länder, die Steuervergünstigungen oder –befreiungen für ganz spezifische Unternehmenskonstruktionen gewähren, wie z.B. Holdinggesellschaften in den Niederlanden, Koordinationszentren in Belgien oder Finanzdienstleistungszentren in Irland. Mit Offshore-Zentren und Steueroasen gehen vor allem drei Problemkomplexe einher (Fritz et. al., 2000): • • • Steuerdumping: OFCs verschärfen den internationalen Steuerwettbeweb und sind damit mitverantwortlich für beträchtliche Einnahmeverluste der Staatshaushalte, worunter Entwicklungsländer in besonderem Maße leiden. Destabilisierung der Finanzmärkte: Die laxen Regelungen in OFCs erlauben besonders ertragreiche, aber auch riskante Geschäfte (z.B. Handel mit hochspekulativen “derivativen” Finanzprodukten). Geht ein solches Geschäft schief, können dessen negative Auswirkungen (wie z.B. Firmenzusammenbrüche) auf die regulierten Finanzzentren übergreifen. Geldwäsche: OFCs bieten ideale Bedingungen, um die Herkunft kriminell erworbener Vermögen zu verschleiern. Via OFCs werden Gelder aus dem Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel, aus Bestechung und Betrug in den legalen Geldkreislauf eingespeist. Auch Diktatoren, die die Staatskasse veruntreuen, transferieren ihre Raubgelder über OFCs auf Bankkonten angesehener Finanzplätze. Das BMF bezieht sich auf die Arbeiten zweier internationaler Gremien, die Empfehlungen für eine konsequentere Regulierung von OFCs erarbeitet haben, nämlich die bei der OECD angesiedelte Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Arbeitsgruppe des Financial Stability Forum (FSF) zu Offshore-Zentren. Die von beiden Gremien vorgeschlagenen Maßnahmen werden von der Bundesregierung nach wie vor mitgetragen, was zu begrüßen ist. Die Arbeitsgruppe des Financial Stability Forums kommt in ihrem Bericht vom April 2000 zu dem Schluss, dass Offshore-Zentren aufgrund der zunehmenden Interdependenz der nationalen Finanzsysteme, 17 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? dem stetigen Wachstum der in OFCs gehaltenen Vermögenswerte, zunehmend riskanteren Kreditgeschäften sowie der mangelnden Aufsicht zu einer zukünftigen Gefahrenquelle für das Finanzsystem werden können. Ende Mai 2000 legte das FSF eine dreistufige Klassifizierung von OFCs hinsichtlich der Qualität ihrer Aufsichtsstandards und ihrer Kooperationsbereitschaft vor. Die Financial Action Task Force, der 30 Staaten angehören, legte 1996 ihre 40 Empfehlungen zur Geldwäschebekämpfung vor. Im Juni 2000 veröffentlichte das FATF schließlich eine “schwarze” Liste mit 15 sog. “nicht-kooperativen Jurisdiktionen” (u.a. Bahamas, Cayman-Islands, Liechtenstein und Russland), die zur Einhaltung der FATF-Standards aufgefordert wurden (FATF, 2000). Demnächst will die FATF darüber befinden, ob Sanktionen (wie z.B. das Verbot von Finanztransaktionen) gegen diejenigen Jurisdiktionen ergriffen werden sollen, die bis dato ihre Regulierungen nicht geändert haben. Einige Staaten haben aufgrund der Veröffentlichung der schwarzen Liste allerdings mittlerweile begonnen, die bemängelten Defizite zu beheben. Auf die u.a. von NGOs vorgebrachte Kritik, die Maßnahmen gegen OFCs würden sich eher gegen kleine OFCs, unter anderem in Entwicklungsländern, richten, wogegen entsprechende Praktiken in den Finanzzentren der Industrieländer kaum geahndet werden, reagiert das BMF mit der Beteuerung, dass es nicht das Ziel sei, sich der Konkurrenz kleiner OFCs zu entledigen. Vielmehr sollen diese zur Einhaltung wichtiger internationaler Standards bewegt werden. Es könne nicht hingenommen werden, “wenn kleinere Finanzplätze durch unzureichende Regularien Gefahren für die Finanzmärkte anderer Staaten oder im Extremfall gar für die globale Finanzstabilität darstellen”. Dem ist entgegenzuhalten, dass selbstverständlich aufsichtsrechtliche Standards in sämtlichen OFCs eingehalten werden sollen, jedoch kommen die Nutzer und Begünstigten von OFCs überwiegend aus den wohlhabenden Industrieländern, seien dies vermögende Privatpersonen oder transnationale Konzerne. Hedge Fonds sind lediglich formal in OFCs registriert, gemanaged werden sie aus New York. Offshore-Banken, sie verwalten nach Angaben des IWF ca. 85% der in OFCs verwalteten Vermögen, sind typischerweise Zweigstellen, Töchter oder reine Briefkastenfirmen von Onshore-Banken der Industrieländer (Errico/Musalem, 1999). Auch die deutschen Großbanken sind sämtlichst in OFCs präsent. Mit gutem Grund fordert daher die Arbeitsgruppe des Financial Stability Forum eine effektivere konsolidierte Aufsicht in den Ländern der Konzernmütter, um zu verhindern, dass die Aktivitäten von Offshore-Töchtern inländischer Banken oder Versicherungen der Kontrolle entzogen werden. Da üblicherweise die Geschäfte rechtlich unabhängiger Offshore-Töchter nicht in den Bilanzen der Konzernmütter auftauchen, werden z.B. Risikopositionen gegenüber der Bankenaufsicht verdeckt (Financial Stability Forum, 2000). Insofern bedarf es konsolidierter Konzernabschlüsse, um auch die Geschäfte der Offshore-Töchter der Heimatlandaufsicht zu unterwerfen. Ferner müssen die Aufsichtsbehörden in den Ländern der Konzernmütter die Möglichkeit bekommen, die Eröffnung und den Weiterbetrieb von ausländischen Offshore-Niederlassungen zu untersagen, wenn diese gegen internationale Standards verstoßen. In der Bundesrepublik ist ein Entwurf für eine entsprechende Regelung unter Mitwirkung des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen erarbeitet worden und schlummert seither im Bundesfinanzministerium. Diese Regelung muss endlich auf den gesetzgeberischen Weg gebracht und umgesetzt werden. 5.4 Der blinde Fleck: Steuerflucht 18 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Völlig unverständlich ist, weswegen das BMF die dritte relevante Problemdimension, die mit OffshoreZentren einhergeht, nämlich die Steuerflucht und das Anheizen des internationalen Steuerwettbewerbs völlig unerwähnt lässt. Vermögende Privatpersonen und international tätige Unternehmen nutzen bewusst die vielfältigen Möglichkeiten der Steuerersparnis oder –hinterziehung, die ihnen die über den Globus verstreuten OFCs eröffnen. International tätige Steuerberatungsfirmen stehen dabei mit entsprechenden “tax planning”-Angeboten hilfreich zur Seite. Das in OFCs gehaltene Vermögen wird auf 6-7 Billionen $ geschätzt, zu den lediglich durch sie hindurchgeschleusten Geldern existieren keine Angaben. Ebenso gibt es keine verlässlichen Zahlen über die Verluste für die Staatshaushalte. Für Entwicklungsländer werden die Verluste gegenüber transnationalen Konzernen und durch private Kapitalflucht auf jährlich 50 Mrd. $ geschätzt (Oxfam 2000). Deutsche Privatanleger horten schätzungsweise 800 Mrd. DM in Offshore-Zentren, größtenteils in Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Zwei Drittel der dort anfallenden Zinserträge werden nicht dem heimischen Fiskus gemeldet, sodass jährliche Steuerausfälle von mindestens 15 Mrd. DM vermutet werden. Um diesen Mißstand zu beheben, wird schon seit mehreren Jahren um die Einführung einer europaweiten Quellensteuer gepokert, deren Erfolgsaussichten sind allerdings höchst ungewiss (Handelsblatt, 2001). Die wichtigsten Steuerfluchtstrategien von multinationalen Konzernen sind die Verlagerung von Investitionen oder Gewinnen in Niedrigsteuerländer. Das oftmals heraufbeschworene Szenario der Verlagerung des Unternehmenssitzes spielt hingegen eine untergeordnete Rolle. Durch die Gründung von Tochterunternehmen in OFCs eröffnet sich die Möglichkeit der Manipulation von Verrechnungspreisen für konzerninterne Lieferungen und Leistungen, die sog. Transferpreis-Methode. So kann die Konzernmutter von eigenen Offshore-Einkaufsgesellschaften Vorprodukte zu höheren Preisen beziehen als beim Direktimport von ausländischen Produzenten. Damit steigen die Aufwendungen bei der Konzernmutter, die Gewinne sinken und die Besteuerung fällt entsprechend niedriger aus. Faktisch verbleibt ein Teil des Gewinns aber bei der Konzerntochter in der niedrigbesteuernden Oase. Ebenso können die Finanzbeziehungen mittels der sog. “thin capitalisation”-Methode steuersparend ausgestaltet werden. So kann ein Unternehmen seine inländischen Betriebsstätten als Tochtergesellschaften in eine Dachgesellschaft (Holding) einbringen, die ihren Sitz in einer Steueroase hat. Die Holding kann dann z.B. Kredite an die Töchter vergeben, deren Zinszahlungen den Gewinn im höher besteuernden Inland schmälern, wogegen er bei der Offshore-Holding steigt. Derartige Möglichkeiten bieten in Europa z.B. Holdinggesellschaften in den Niederlanden, Koordinationszentren in Belgien oder Finanzdienstleistungszentren in Irland. Auch deutsche Großunternehmen der Automobil- oder Chemieindustrie sowie des Bankgewerbes bedienen sich derartiger Konstrukte. Arbeitsplätze werden durch diese Offshore-Firmen allerdings kaum geschaffen. Oftmals handelt es sich um reine Treuhandfirmen mit minimalem Personalbestand. Auf internationaler Ebene gibt es eine wichtige Initiative zur Eindämmung derartiger schädlicher Steuerpraktiken, welche 1998 durch die OECD gestartet wurde. In einem im letzten Jahr veröffentlichten Bericht identifizierte die OECD 47 präferenzielle Steuerregime seiner Mitglieder6, die als potenziell schädlich angesehen werden. Entsprechende Praktiken sind nach diesem Bericht u.a in den USA, Kanada, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Australien und Deutschland anzutreffen. Die schädlichen Bestandteile dieser Steuerregime sollen nach dem Willen der OECD bis 2005 beseitigt werden. Daneben identifizierte die OECD 37 Offshore-Zentren, die nicht zu ihren Mitgliedern gehören und bestimmten Kriterien für Steueroasen (“Tax Havens”) entsprachen. Demnächst will die OECD 6 Der OECD gehören 29 Industriestaaten an. 19 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? darüber beraten, ob gegen die “nicht-kooperativen” Steueroasen Sanktionen verhängt werden sollen (OECD, 2000). Allerdings sind die OECD-Initiativen zu schädlichen Steuerpraktiken wie auch diejenige der FATF zur Geldwäschebekämpfung momentan akut durch den angekündigten Rückzug der USA aus wesentlichen ihrer Maßnahmen bedroht. Nach entsprechenden Äußerungen von US-Finanzminister Paul O’Neill erwarten die Profiteure des Offshore-Unwesens, dass der Druck auf OFCs und OECDMitglieder, Geldwäsche und schädlichen Steuerwettbewerb zu bekämpfen, erheblich nachlassen werde (Financial Times, 2001a). Umso wichtiger wäre es, dass von europäischer und eben auch deutscher Seite nicht nur die FATF, sondern auch die OECD-Intiative zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken weiter unterstützt und forciert wird. Als kontraproduktiv erscheint jedoch die vom BMF verteidigte Übertragung der Überprüfung von OFCs an den IWF. Auf Druck der USA schlug die Arbeitsgruppe des Financial Stability Forum den IWF als durchführende Organisation dieser Überprüfung vor. Dieses Vorgehen ist abzulehnen, da es der üblichen Praxis des IWF folgt, sich selbst immer neue Aufgaben zuweisen zu lassen, für die der Fonds oftmals keinerlei Kompetenz besitzt. Dies unterstreicht abermals die affirmative Weise, in der das BMF den Ausbau des IWF zu einer universalen Organisation abstützt. 20 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 6. Verschuldung: Nebelkerzen als Dauerbrenner (Philipp Hersel) 6.1 HIPCs und Nicht-HIPCs Im zweiten der vom Bundesfinanzministerium vorgelegten Papiere werden verschiedene Gruppen verschuldeter Länder vorgestellt, denen gegenüber mit unterschiedlichen Schuldenstrategien operiert wird (BMF, 2001a). Es wird unterschieden zwischen 1.) Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, 2.) den Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen und 3.) den hoch verschuldeten armen Ländern (Heavily Indebted Poor Countries - HIPCs). Diese Gruppierung ist allerdings missverständlich, weil alle HIPCs zugleich Länder mit niedrigem Einkommen sind, sich daher die Guppen 2 und 3 überlappen. Bei der Darstellung der Behandlung der Schulden von Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ,"(also nicht die am höchsten verschuldeten armen Länder HIPC)" (ebd., S. 1), wird so der Eindruck erweckt, dass auch die Nicht-HIPCs einen substanziellen Schuldenerlass im Pariser Club bekommen könnten. Dies ist aber eine (gewollte?) Irreführung. Zwar wurde vielen Ländern mit niedrigem Einkommen ein Teilschuldenerlass gewährt, dies waren aber fast alles HIPC-Länder. Mit der sich überlappenden Gruppierung in HIPCs einerseits und "Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen" andererseits, wie sie das BMF vornimmt, wird so die Zahl der Länder, die bisher in den Genus eines Teilschuldenerlasses kamen, schöngerechnet. Letztlich demonstriert diese Gruppierung nur die Willkür, mit der Gläubiger die Schuldner in vorgeblich objektive Kategorien einteilen. Faktisch ist aber die Einteilung in Schuldnergruppen vor allen von der mangelnden Bereitschaft der Gläubiger geprägt, tatsächlich auf Forderungen zu verzichten. Die von den Gläubigern konstruierten Kategorien von Schuldnerländern lassen sich daher besser aus der Perspektive von "billigen" und "teuren" Schuldnern verstehen, wobei "billige Schuldner" naheliegenderweise die Länder sind, deren Teilentschuldung die Gläubiger wenig kostet. Dies wird zunächst an der Unterscheidung zwischen Niedrig- und Mitteleinkommensländern deutlich. Per Definition der Gläubiger haben Mitteleinkommensländer, die absolut gesehen sehr viel höhere Schulden haben und insofern "teure" Länder sind, grundsätzlich kein Problem, dass eine Schuldenstreichung erfordern könnte. Die finanziellen Turbulenzen der letzten Monate in Argentinien oder der Türkei haben aber deutlich vor Augen geführt, dass auch diese Ländergruppe vor grundlegenden Schuldenproblemen steht. Aber auch bei den Niedrigeinkommensländern zieht sich die "Teuer-Billig"-Logik der Gläubiger durch. Diejenigen Länder mit niedrigem Einkommen, die auf Beschluss der Gläubiger nicht in die Gruppe der HIPCs aufgenommen wurden, sind bemerkenswerterweise gerade "teure" Länder wie z.B. Nigeria (gesamte Auslandsschulden 30 Mrd US-Dollar, Worldbank 2000). Auch Indonesien, das vor wenigen Jahren noch als “Tiger der 2. Generation” gefeiert wurde, wird seit der Asienkrise in die -Kategorie Niedrigeinkommensland eingeordnet. Obwohl von 1997-99 über 21 Millionen Menschen in Indonesien zusätzlich unter die Armutsschwelle gefallen sind, gab es bei den jüngsten Umschuldungsverhandlungen keinerlei Schuldenentlastung.Und dies bei einer Gesamtauslandsverschuldung von 147 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Die 41 21 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Niedrigeinkommensländer, die zur Gruppe der HIPCs gehören, schulden ihren ausländischen Gläubigern zusammen 214 Mrd. US-Dollar (alle Zahlen nach Worldbank, 2000). Bezüglich der hochverschuldeten armen Ländern (Heavily Indebted Poor Countries - HIPCs) stellt das BMF heraus, dass durch die Weiterentwicklung der 1996 beschlossenen HIPC-Initiative auf dem Kölner G7-Gipfel 1999 (HIPC II) eine größere Zahl von Ländern schneller zu einem höheren Erlass kommen könne. Darüber hinaus habe die Bundesregierung den vollständigen Erlass aller Entwicklungshilfeschulden beschlossen sowie den Erlass der "umschuldungsfähigen Handelsforderungen" auf 100% aufgestockt. Handelsforderungen gehen auf durch die HermesKreditversicherung verbürgte Auslandsgeschäfte deutscher Unternehmen zurück. Tritt der Schadensfall ein und werden z.B. Exporte deutscher Unternehmen nicht durch die Abnehmer bezahlt, springt der deutsche Staat ein, zahlt das deutsche Unternehmen aus und übernimmt die Forderungen. Hinsichtlich der HIPC-Initiative fällt die Bilanz vieler Beobachter sehr viel nüchterner aus als diejenige des BMF. Zwar werden etliche Länder in Zukunft auf dem Papier weniger Schuldendienst zu leisten haben. Dies entlastet sie in der Praxis aber kaum, da sie bisher schon nur einen Teil ihrer Schulden bedienen konnten. Damit sinkt zwar der Bedarf an Neukrediten, um alte Schulden zu überwälzen. Mehr Ressourcen für die Armutsbekämpfung stehen dadurch aber nur selten zur Verfügung. Vielmehr wird den HIPC-Ländern angesichts der doppelten Konditionalität von orthodoxen Anpassungsauflagen einerseits und Armutsbekämpfungsstrategien andererseits die Quadratur des Kreises abverlangt. Dennoch meint das BMF (2001b, S. 2): “Damit ist das Schuldenproblem dieser Ländergruppe gelöst.” Auch die vom BMF ins Feld geführten bilateralen Schritte haben Schwächen. Zwar ist es lobenswert, die Handelsschulden zu 100% zu erlassen, aber leider haben die “umschuldungsfähigen Handelsforderungen” den Haken, dass damit nur die sog. “pre-cut-off-date”-Schulden gemeint sind. Dies sind diejenigen Schulden, die vor den ersten Umschuldungsverhandlungen im Pariser Club aufgenommen wurden. Da dieses Datum für einzelne Länder bereits über 15 Jahre zurückliegt, wird dieser Teil der Schulden mit dem Fortschreiten der Zeit immer unbedeutender. Zudem wurden die Schulden dieser Kategorie schon in den vorangegangenen Umschuldungen im Pariser Club auf bis zu 90% reduziert. Der 100%-Erlass ist also praktisch ein Nachschlag in Höhe von 10 Prozent auf einen Forderungsbestand, der ohnehin für viele Länder kaum noch ins Gewicht fällt. Ähnliches gilt für den “Erlass aller Entwicklungshilfeschulden”. In Folge internationaler Vereinbarungen wird Entwicklungshilfe seit 1978 an die ärmsten Länder ohnehin nur als Zuschuss und nicht mehr als Kredit vergeben. In dem Maße, wie sich die verschiedenen Bundesregierungen seit dieser Zeit an diese Vereinbarung gehalten haben (und das ist weitgehend der Fall gewesen), ist ein solcher Erlass also praktisch gegenstandslos. 22 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 6.2 Internationales Insolvenzrecht Das dritte Papier des BMF versucht zu begründen, warum es des von vielen sozialen Bewegungen und Wissenschaftlern vorgeschlagenen insolvenzähnlichen Verfahrens zur Lösung staatlicher Überschuldungsprobleme nicht bedarf (BMF, 2001b). Bei einem solchen “Internationalen Insolvenzverfahren” (Raffer, 1990), in jüngerer Zeit überwiegend als “Faires und Transparentes Schiedsverfahren” bezeichnet, soll ein paritätisch zusammengesetztes Schiedsgericht die Funktionen der bisherigen Institutionen des Schuldenmanagements übernehmen. Statt des Pariser oder Londoner Clubs, wo allein die (öffentlichen bzw. privaten) Gläubiger die Modalitäten von Umschuldungen oder Teilerlassen bestimmen, soll diese Entscheidung in Zukunft durch die neutrale Instanz eines Schiedsgerichts gefällt werden. Dies würde einen deutlichen Fortschritt hin zu einem “faireren” Interessenausgleich zwischen Schuldnern und Gläubigern bedeuten. Zudem soll die Zivilgesellschaft des Schuldnerlandes an diesem Prozess beteiligt werden, sodass die beim orthodoxen Schuldenmanagement ignorierte Bereitstellung grundlegender sozialer Dienstleistungen künftig gewährleistet wird. Ein solches Verfahren würde neben der Erleichterung von akuten Schuldenproblemen auch eine präventive Wirkung entfalten, indem die Qualität der Kreditvergabe berücksichtigt und die Gläubiger dementsprechend an den Entschuldungskosten beteiligt werden. Schulden, die aus Krediten an diktatorische Regime entstanden, welche die Gelder zur Repression gegen die eigene Bevölkerung missbrauchten, sog. “odious debts”, könnten gänzlich als unwirksam erklärt werden (Adams, 1991). Das BMF sieht allerdings keinerlei Handlungsdruck: “Wir verfügen bereits heute über ein geordnetes Verfahren für einen gerechten Interessenausgleich bei der Lösung internationaler Verschuldungsprobleme”. Der Pariser Club habe sich als “leistungsfähiges Instrument erwiesen und in der Praxis bewährt”, überdies würden dessen Entscheidungen “im Konsens” getroffen. Die bittere Umschuldungsrealität sieht aber deutlich anders aus als in der rosaroten BMF-Welt. Dem Pariser Club gehören 19 ständige Mitglieder an, allesamt OECD-Länder. Fallweise können andere Länder zu den 1-2 Tage andauernden Umschuldunsverhandlungen hinzugezogen werden. Die Verhandlungen finden in den Räumen das französischen Finanzministeriums statt. Die Delegation des Schuldnerlandes legt ihren Fall dar und verlässt den Raum. IWF und Weltbank, als “unabhängige und sachverständige Institutionen” (BMF), geben Einschätzungen der zukünftigen Zahlungssituation des Schuldners ab und die Gläubiger entwickeln ein Umschuldungsangebot. Das Schuldnerland kann dieses zwar ablehnen oder Verbesserungen verlangen, in der Regel ist die Einigung aufgrund des erheblichen Machtungleichgewichts aber identisch mit dem Gläubigervorschlag (Kaiser, 2000). Aufgrund der völlig unzureichenden Ergebnisse dieser Verhandlungen haben viele Länder schon mehrfache Umschuldungen im Pariser Club durchlaufen müssen. Seit 1956 haben über 70 Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas mehr als 300 Verhandlungen geführt. Dass die Pariser Club-Mitglieder zugleich Mehrheitsanteile an Weltbank und IWF halten, hindert das BMF nicht, diese Institutionen als “unabhängig” zu bezeichnen. Aber auch das Verfahren sowie die Umschuldungskonditionen des Pariser Clubs werden ausschließlich von den Gläubigern aufgestellt und sind mehrfach nach verschiedenen G7-Gipfeln modifizert worden. Beides, das Verfahren und die Konditionen, wurden ohne Beteiligung der Schuldner allein von der Gläubigerseite entwickelt. Wie ein Verfahren, das vollständig von den 23 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Gläubigern dominiert wird, zu einem “gerechten Interessenausgleich” führen soll, bleibt das Geheimnis des BMF. Gegen ein internationales Involvenzverfahren spricht nach Ansicht des BMF auch der drohende Souveränitätsverlust der beteiligten Staaten, da sich Gläubiger wie Schuldner der Mehrheitsentscheidung eines Schiedsgerichts unterwerfen müssten. Warum es einen Souveränitätsverlust für die Schuldnerländer bedeuten soll, gleichberechtigt an einem Umschuldungsverfahren teilzunehmen, ist rätselhaft. Zugleich ignoriert das BMF, dass schon jetzt Streitschlichtungsverfahren auf internationaler Ebene existieren, wie z.B. dasjenige der Welthandelsorganisation (WTO), deren Entscheidungen sich Staaten unterwerfen. 24 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 7. Fazit: “Kontinuität statt Wandel” Alles in allem sind die Vorschläge der rot-grünen Bundesregierung zur Stärkung der internationalen Finanzarchitektur ungenügend. Sie berücksichtigen zu wenig den Stand der internationalen Reformdebatte, fallen teilweise hinter ihn zurück und ignorieren verfügbare empirische Erkenntnisse. Die grundlegende Orientierung auf eine forcierte Liberalisierung des Kapitalverkehrs ist in ihrem Dogmatismus geradezu erschreckend und verbaut strukturell die Möglichkeit, wichtige Reformoptionen, wie die Besteuerung von Devisentransaktionen oder andere Kapitalverkehrskontrollen, zu befördern. Teilweise ist auch die Halbwertszeit eigener Reformvorschläge überaus kurz, wie z.B. bei der Währungskooperation und bei den Umschuldungsklauseln. Es fehlen ferner Überlegungen, wie an sich sinnvolle Prinzipien, so die Einbindung des Privatsektors, effektiv umgesetzt werden können. Einzig bei der Kontrolle von Offshore-Zentren ist ein stärkerer Reformwille der Regierung erkennbar, allerdings unter Vernachlässigung des Steuerflucht-Aspektes. Auch sind nach wie vor nationale Maßnahmen einzuklagen, wie z.B. die Umsetzung des Vorschlags, die Offshore-Töchter deutscher Banken bei Verstößen gegen internationale Standards schließen zu können. Ebenfalls sollten Zertifikate verboten werden, die die Investition in Hedge Fonds ermöglichen. Der zunehmende Einfluss der Privatwirtschaft auf z.T. originär staatliche Aufsichtsfunktionen, wie z.B. beim Baseler Akkord, wird gar nicht erst als Problem wahrgenommen. Die andere Seite dieser Medaille ist, dass alle übrigen gesellschaftlichen Akteure, die sehr wohl durch die Liberalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte betroffen sind, Gewerkschaften, Verbraucherverbände, verschiedenste soziale Bewegungen, überhaupt nicht repräsentiert sind. Gerade Fragen der Regulierung bedürfen aber einer breiten gesellschaftlichen Diskussion unter Einschluss aller “stakeholder”. Diese Exklusion betrifft schließlich in besonderer Weise die Länder des Südens. Es entsteht der Eindruck, dass mit der Schuldeninitiative für die hochverschuldeten ärmsten Länder (HIPCs) das Ende der Fahnenstange erreicht sein solle. Etwaige Nachbesserungen, die Einbeziehung von Nicht-HIPCs, ein internationales Insolvenzrecht, die Entkopplung der Entschuldung von den Strukturanpassungsauflagen oder gar die bessere Repräsentanz von Entwicklungsländern in den internationalen Finanzinstitutionen stehen allesamt nicht auf der rot-grünen Agenda. Hingegen ist die Stärkung des europäischen Gewichts im IWF und dessen forcierter Ausbau zu einer universellen Institution ein wichtiges Anliegen für das BMF. Leider ist der vor der letzten Bundestagswahl propagierte Slogan “Kontinuität statt Wandel” traurige Realität geworden. 25 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? 8. Literatur Adams, P. (1991): Odious Debts. Loose Lending, Corruption, and the Thirld World’s Environmental Legacy. Probe International. London, Toronto. Akyüz, Y. (2001): Options in Crisis Management and Resolution. Involving the IMF or the Private Sector? Remarks made at the Deutscher Bundestag, Finanzausschuss, Berlin (14. März). Akyüz, Y./Cornford, A. (1999): Capital Flows to Developing Countries and the Reform of the International Financial System. UNCTAD Discussion Papers, No. 143 (November), Geneva. ATTAC (2000): Erklärung für eine demokratische Kontrolle der internationalen Finanzmärkte. www.attac-netzwerk.de. Basle Committee on Banking Supervision (1988): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basel (Juli). Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (2001): Konsultationspapier. Überblick über die Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung. Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel (Januar). BMF (2001): Stärkung der internationalen Finanzarchitektur - Überlegungen zur Reform des IWF und der Finanzmärkte. Bundesministerium der Finanzen, VII C 5 - F 6424 - 52/01 (5. März). BMF (2001a): Internationale Verschuldung. Bundesministerium der Finanzen, VII C 5 – F 6424 – 37/01 (28. März). BMF (2001b): Schaffung eines internationalen Insolvenzrechts zur Bewältigung von Verschuldungskrisen von Staaten. Bundesministerium der Finanzen, VII C 5 – F 6424 – 37/01 (6. März). Cameron, D. (2001): Privatkundengeschäft durch Basel II weniger attraktiv. In: Financial Times Deutschland (12. Juni). Chomthongdi, J.-C. (2000): The IMF’s Asian legacy. In: Prague 2000. Why we need to decommission the IMF and the World Bank. Focus on the Global South, Bangkok, S. 13-29 (September). Deutsche Bank (2000): Jetzt mit Private Banking in eine neue Anlageklasse einsteigen – und das starke Rendite-/Risikoprofil nutzen. Xavex HedgeSelect Zertifikate. Prospekt, Deutsche Bank Private Banking, Frankfurt. Dieter, H. (2000): Nach den Krisen der 90er Jahre: Re-Regulierung der internationalen Finanzmärkte? In: Prokla 118, Re-Regulierung der Weltwirtschaft, 30. Jg, Nr. 1 (März), S. 39-59. Eichel, H. (1999): Statement by Mr. Hans Eichel, Federal Minster of Finance, Federal Republic of Germany, to the Interim Committee Meeting. Washington (26. September). Errico, L./Musalem, A. (1999): Offshore-Banking: An Analysis of Micro- and Macro-Prudential Issues. International Monetary Fund, IMF Working Paper, WP/99/5 (Januar). FATF (2000): Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report, Annex A, Paris. Financial Stability Forum (2000): Reports of the Working Groups on Offshore Centers, Capital Flows and Highly Leveraged Institutions. Basel (5. April). Financial Times (2001): Agencies lobby Basle Committee on ratings disclosure. (1. Juni). 26 BLUE 21 – Sand in die Augen oder ins Getriebe? Financial Times (2001a): US may ease stance on money laundering (1. Juni). Fritz, T./Hahn, M./Hersel, P. (2000): Kapital auf der Flucht. Offshore-Zentren und Steueroasen. Über Steuerflucht, Finanzkrisen und Geldwäsche. Einblicke in die Praxis und mögliche Gegenmaßnahmen. BLUE 21 und Stiftung Umverteilen!, Berlin (Dezember). Group of 10 (1996): The Resolution of Sovereign Liquidity Crises. A report to the Ministers and Govenors prepared under the auspices of the Deputies (Mai). Handelsblatt (2001): Handelsblatt-Thema: Bankgeheimnis. (16. Mai). EU-Quellensteuer. Schweizer ringen um ihr Huffschmid, J. (1999): Politische Ökonomie der Finanzmärkte. Hamburg. IIF (2001): Capital Flows to Emerging Market Economies. The Institute of International Finance, Inc. (31. Mai). IMF (2000): International Capital Markets. Developments, Prospects, and Key Policy Issues. International Monetary Fund, Washington (September). IMF (2000a): Involving the Private Sector in the Resolution of Financial Crises – Standstills – Preliminary Considerations (5. September). IMF (2001): Conditionality in Fund Supported Programmes – Overview. International Monetary Fund, Washington (20. Februar). Kaiser, J. (2000): Schuldenmanagement á la Louis XVI - Ein kurzer Gang durch Programm und Praxis des Pariser Clubs. Erlassjahr 2000, Siegburg. Lütz, S. (2000): Globalisierung und die politische Regulierung von Finanzmärkten. In: Prokla 118, ReRegulierung der Weltwirtschaft, 30. Jg, Nr. 1 (März), S. 61-81. OECD (2000): Towards Global Tax-Cooperation. Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the Committee on Fiscal Affairs, Paris. Oxfam (2000): Tax Havens: Releasing the hidden billions for poverty eradication. Briefing Paper (Juni). UNCTAD (2001): Trade and Development Report. Global Trends and Prospects. Financial Architecture. United Nations Conference on Trade and Development, Genf. Wahl, P./Waldow, P. (2001): Devisenumsatzsteuer. Ein Konzept mit Zukunft. Möglichkeiten und Grenzen der Stabilisierung der Finanzmärkte durch eine Tobin-Steuer. WEED, Bonn (Februar). Worldbank (2000): Global Development Finance, Washington. 27