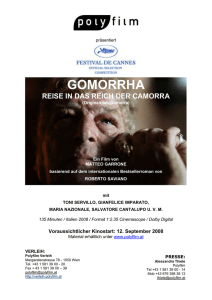KULTUR Warum Saviano jetzt vor der Camorra
Werbung

45 Tages-Anzeiger · Mittwoch, 22. Oktober 2008 KULTUR Kultur in Kürze: The Bad Plus in Zürich, Fotos von Luciano Rigolini Weltmusik: Ry Cooder und Taj Mahal bringen die Musik aus aller und ein Krimi von Tana French. Welt in den Pop und den Rock. 46 47 Leben: Wer im reifen Alter noch Vater wird, sieht die Welt plötzlich ganz neu. 54 Warum Saviano jetzt vor der Camorra fliehen muss Roberto Saviano schrieb mit seinem Buch über die Camorra einen Weltbestseller. Seither lebt der 29-Jährige im Untergrund. Jetzt will er Italien verlassen. Begegnung mit einem Gejagten. Von Kordula Doerfler, Rom In den Bunker dringt kaum ein Lichtstrahl. Im Dämmerlicht steht ein magerer Junge. Um seinen Körper schlottert eine kugelsichere Weste. Ein Schuss knallt, wirft Totò fast um. Später bewundert er den Bluterguss, den die Kugel des Capo hinterlassen hat, vor dem Spiegel. Noch später gerät er zwischen die Fronten eines blutigen Bandenkrieges, wird er sogar seine Tante verraten. Aber er gehört jetzt dazu, hat es geschafft. Jetzt ist der 13-Jährige jemand in Scampìa, einer trostlosen Vorstadt von Neapel. Sie könnte in Rio liegen oder in Johannesburg. Im Film «Gomorra» gleicht sie einem Vorhof zur Hölle. Szenenwechsel. Es ist einer jener strahlenden Herbsttage, an denen Rom von innen heraus zu leuchten scheint. Rund um die Via Veneto tost der Verkehr. Auf den breiten Bürgersteigen der Prachtstrasse geniessen die ersten Touristen in der milden Sonne einen Kaffee. Die Hölle von Neapel scheint auf einem anderen Stern zu liegen. Um die Ecke, vor einem hellbraunen Palazzo, liegt Nervosität in der Luft. Ein Streifenwagen der Carabinieri steht vor dem Römer Sitz des Verlages Mondadori. Hinein kommt nur, wer sich ausweisen kann. Er ist da, kein Zweifel. Drinnen herrscht aristokratische Eleganz in hohen Räumen. Auf die Minute pünktlich schiebt sich ein junger Mann mit schwarzer Lederjacke, Jeans und modischen Turnschuhen durch die Flügeltür. Er taxiert rasch den Raum mit den bukolischen Fresken an den Wänden, ehe er sich auf das rote Ledersofa fallen lässt. Alles in Ordnung, sagt sein Blick. Und: Machen wir schnell, wenn es geht. international bekannt. In 42 Sprachen wurde sein Buch über die skrupellosen Machenschaften der neapolitanischen Mafia übersetzt, mehr als eine Million Mal allein in Italien verkauft. Es ist, so scheint es, eine überwältigende Erfolgsgeschichte, gekrönt von der kaum minder aufsehenerregenden Verfilmung des Buches durch Matteo Garrone. Und doch ist es die Geschichte eines Erfolges, der einen sehr hohen, viel zu hohen Preis hat. Und ein Lehrstück über die Macht der Mafia und die Ohnmacht des italienischen Staates. Denn Saviano lebt seit zwei Jahren im Untergrund, an wechselnden Orten, meist in Polizeikasernen. Wegen ständiger Morddrohungen tritt er kaum noch in der Öffentlichkeit auf, und wenn doch, dann mit Polizeischutz. Die fünf Carabinieri, die Tag und Nacht über sein Leben wachen, nennt er heute seine Familie. Vor ein paar Monaten hat er darüber noch gelacht. Am Anfang fand er das alles gar nicht so schlimm. Konnte sich nicht vorstellen, dass das der Normalzustand werden würde. Dass er seine echte Familie, seine Freunde, seine Kollegen nicht mehr treffen kann. Dass er nicht mehr arbeiten, nicht mehr recherchieren kann. Und deshalb auch kaum noch schreiben. Ausser über sich selbst. Und das will er nicht mehr. In der vergangenen Woche brachte der berühmte Tropfen das Fass zum Überlaufen. Nachdem ein Kronzeuge vom Clan der Casalesi der Polimehr», sagt Saviano, und wiezei gesteckt hatte, dass die Cader irrt der Blick durch den morra bis Weihnachten einen Raum. «Ja, ich werde emigrieSprengstoffanschlag auf den ren», und das klingt dann noch Autor geplant habe, ging Saendgültiger. Von der Frankfurviano in die Knie. Er kündigte ter Buchmesse, wo ihm ein weian, Italien verlassen zu wollen. terer Preis verliehen wurde, ist «Ich will ein ganz normales er noch einmal zurückgekomLeben führen, in der Sonne sitmen. Aber er wird gehen. Vielzen und ein Bier mit meinen leicht für immer. Vielleicht in Freunden trinken können», ofdie USA oder nach Schweden. fenbarte er der Tageszeitung Roberto Saviano. Beide Länder haben ihm ihre «La Repubblica». Auch eine Gastfreundschaft angeboten. Woche später, beim Gespräch in Rom, Angst? Nein, er hat keine Angst, so steht sein Entschluss fest, und das, obwohl merkwürdig das klingen mag. Und dann eine Welle der Solidarität durch Italien und um die Welt ging. «Das ist kein Leben Fortsetzung Seite 47 Die Leibwächter sind seine Familie Der Blick bleibt unruhig. Es ist der Blick von einem, der sich nur schwer konzentrieren kann, der von Strapazen gezeichnet ist, die man in seinem Alter doch gar nicht kennen sollte. Roberto Saviano hat etwas Jungenhaftes, und zugleich umgibt ihn eine Düsternis, die nur schwer zu durchdringen ist. Aller Furor scheint ihn verlassen haben. Jene Wut, die ihn antrieb, ein Buch zu schreiben, mit dem er seinerseits für Furore sorgte. Als «Gomorrha – Reise in die Welt der Camorra» erschien, war Roberto Saviano ein unbekannter junger Journalist aus Casal di Principe im Hinterland von Neapel. Jetzt, zwei Jahre später, ist der 29-Jährige BILD PD ZUM FILM «Gomorra» Zwei grossmäulige Buben spielen «Scarface» im Jacuzzi einer Bauruine. Später, am Fluss, ballern sie in Unterhosen in der Gegend herum, mit Maschinenpistolen, die sie in einem Versteck der Camorra geklaut haben. Schnitt. In einem Nähatelier hantiert Schneidermeister Pasquale mit den edlen Stoffen, aus denen er die Haute Couture für die teuersten Mailänder Modehäuser schneidert. Schweres Geschütz und feinste Handarbeit: Das sind zwei der fünf Episoden, die Regisseur Matteo Garrone für seinen Spielfilm aus dem Buch von Roberto Saviano herausgelöst und vertieft hat. Mit seinem dokumentarischen Blick versucht Garrone gar nicht erst, dem Furor des Buches nachzueifern. Sein in Cannes preisgekrönter Film ist vielmehr ein ungeschöntes Fresko, das die Agglomeration um Neapel einfängt wie einen wüs- ten, fremden Planeten. Garrone sucht nicht den knalligen Plot, sondern lässt die Geschichten wuchern wie die Camorra selbst. Die glamouröse Ikonografie der Mafia, wie man sie vom Hollywood-Kino zwischen «The Godfather» und «Scarface» kennt, ist hier nur in der Nachahmung durch die halbwüchsigen Möchtegerns zu sehen. Ansonsten konzentriert sich Garrone darauf, den sozialen Boden zu schildern, auf dem die Camorra als ökonomisches Subsystem in allen Lebensberei- chen ihre Gewaltherrschaft durchsetzt. Die grausigsten Szenen aus dem Buch bleiben einem im Film erspart, aber in kurzen Momenten ist das brutal genug – und unerbittlich bis zum Abspann, für den Massive Attack einen dunkel pochenden Track beigesteuert haben. Florian Keller Gomorra (Italien 2008). 137 Minuten. Regie: Matteo Garrone. Mit Salvatore Cantalupo, Marco Macor, Ciro Petrone u. a. Ab Donnerstag in Zürich in den Kinos Arthouse Movie und Riffraff. «Die Menschen sind ganz im Räderwerk der Mafia gefangen» Die Statisten in Neapel waren sein erstes Testpublikum: Regisseur Matteo Garrone (40) über die Dreharbeiten zu seinem Film «Gomorra». Mit Matteo Garrone sprach Gerhard Midding Ihr Film zeigt präzise den Unterschied zwischen amerikanischen und italienischen Mafia-Filmen: Das italienische Kino interessiert sich für die Strukturen, aus denen das organisierte Verbrechen entsteht, Hollywood für dessen glamouröse Aspekte. Ich bewundere Regisseure wie Scorsese und De Palma sehr, aber diese glamouröse Dimension wäre in unserem Film völlig fehl am Platz gewesen. Obwohl sie natürlich den Träumen der Camorristi ent- spricht. Darin besitzen die amerikanischen Filme wiederum eine grosse Wahrhaftigkeit. Diese Leute träumen davon, luxuriöse Kleidung und teure Autos zu besitzen. Figuren wie De Palmas «Scarface» sind Vorbilder für sie. Aber mit ihrer Lebensrealität haben sie nichts zu tun. In Ihren früheren Filmen analysieren Sie persönliche Herrschaftsverhältnisse. Waren es die Machtstrukturen, die Sie nun für die Camorra interessiert haben? Nein, ich war zunächst einmal einfach nur fasziniert und geschockt von Roberto Savianos Buch. Es hat in Italien als wichtiges Korrektiv funktioniert, denn es hat unsere Vorstellung von der Camorra von Grund auf verändert. Es eröffnet eine Innenansicht, fast einen subjektiven Blick auf das organisierte Verbrechen. Mit meinem Film will ich das Gleiche erreichen, auch wenn das Buch natürlich ausführlicher und komplexer ist. Allerdings finde ich die thematische Verbindung, die Sie knüpfen, interessant. Natürlich geht es um Machtverhältnisse, aber bei der Verfilmung des Buches war mir von vornherein klar, dass es nicht um die Bosse, sondern um die unteren Ränge in der Hierarchie gehen sollte. Sie stammen aus Rom. Wie fremd war Ihnen die Welt, in die Sie da eingedrungen sind? Die Dreharbeiten waren in vieler Hinsicht eine äusserst verwirrende Erfahrung für mich. Die Welt, die wir schildern, ist mir sehr fremd. Es ist eine andere Kultur, man spricht eine eigene, unverständliche Sprache. Als wir das Drehbuch schrieben, konnten wir uns die Realitäten, die wir in Neapel vorfinden würden, noch nicht vorstellen. Es schien uns undenkbar, dass 200 Kilometer von Rom entfernt die Menschen in einem Kriegsgebiet leben. Sie werden von einem System beherrscht, das ihnen eine bestimmte Lebensweise aufzwingt und dessen Infamie ihnen gar nicht bewusst ist. Dieses mangelnde Bewusstsein dafür, was um sie herum passiert, hat mich ungeheuer schockiert. Zugleich habe ich mich den Menschen in der Region aber augenblicklich sehr nahe gefühlt. Wie meinen Sie das? Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dort auf eine grosse Verschlossenheit zu stossen. Aber die Menschen haben unser Team mit einer enormen Grosszügigkeit und Offenheit empfangen. Nach jedem Take wollten die Statisten aus der Gegend mit uns diskutieren, ihre Erfahrungen schildern. Sie waren praktisch unser erstes Testpublikum, und ihre Kommentare wurden zu einer Garantie der Realitätsnähe. Das mafiöse System erscheint in Ihrem Film als eigene, hermetisch abgeschlossene Welt. Dennoch gelingt es am Ende zwei Figuren, ihr zu entkommen. Wie realistisch ist das? Sie haben Recht, das ist sozusagen ein abgeschlossenes Ökosystem. Aber die beiden Figuren dienen nicht dazu, am Ende einen tröstlichen Hoffnungsschimmer zu eröffnen. Sie repräsentieren eine Lösung der Vernunft, der Zivilcourage. Das grösste Problem ist die Blindheit, die ich zuvor schon geschildert habe. Die Menschen sind ganz in ihren Mechanismen, in ihrem Räderwerk gefangen, weil sie unfähig sind, den sozialen Kontext zu sehen. Mir war deshalb wichtig zu zeigen, dass jeder Betroffene eine Verantwortung trägt. Man kann die Probleme der Region nicht von aussen lösen, indem man die Armee oder stärkere Polizeikräfte dorthin schickt. Man muss sie von innen heraus verstehen, aus dem fatalen Zustand des Bildungssystems und des Arbeitsmarktes. Der Staat spielt dabei eine sehr zweifelhafte Rolle, seine Institutionen sind entweder abwesend oder zu schwach. Statistiken zufolge zahlen 80 Prozent aller Geschäfte in Neapel und Kampanien Schutzgeld. Waren Sie auf die Camorra angewiesen, um Drehgenehmigungen zu bekommen? Davon hört man gelegentlich, aber wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Mein Bild der Camorristi hat sich im Verlauf der Dreharbeiten auch etwas gewandelt. Die Strukturen sind so komplex, dass man ihnen nicht gerecht wird, indem man in einem Film einfach nur vorgefasste Thesen illustriert. Die Grenze zwischen den Leuten, die innerhalb und ausserhalb des mafiösen Systems leben, ist schwer zu ziehen. Es gibt Grauzonen, die Bösen sind nicht einfach zu erkennen. In praktisch jeder Familie gibt es ein oder mehrere Mitglieder. Aber auch Leute, die einer ehrlichen Arbeit nachgehen, stehen unter dem Einfluss der Camorra. Mir wurde klar, dass ich die Verhältnisse nur schildern kann, wenn ich die Gesichter und Gesten der Menschen sprechen lasse. Ich will den Zuschauer in eine bestimmte Atmosphäre versetzen, damit er die Mechanismen emotional verstehen kann. Der Film formuliert keine fertige, unumstössliche Moral, der Zuschauer soll vielmehr seine eigenen Schlüsse ziehen.