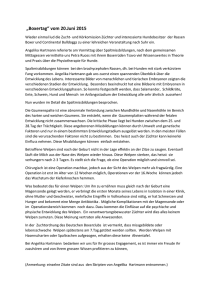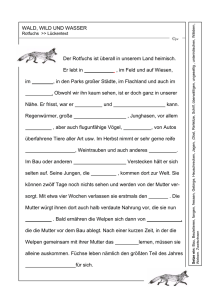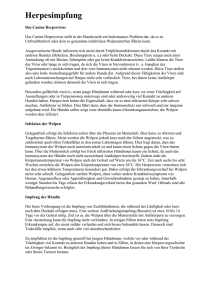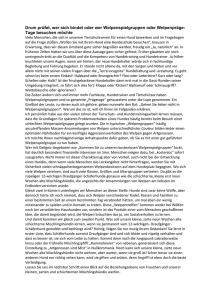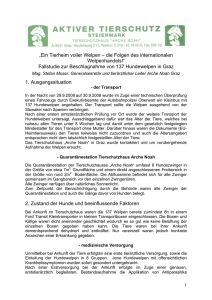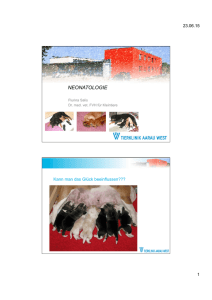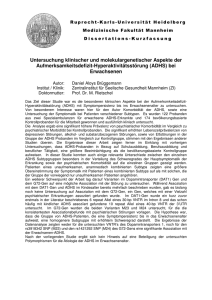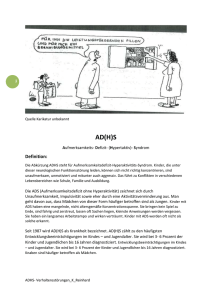Artikel in der SitzPlatzFuss 12 Von Madeleine Franck und Rolf C
Werbung
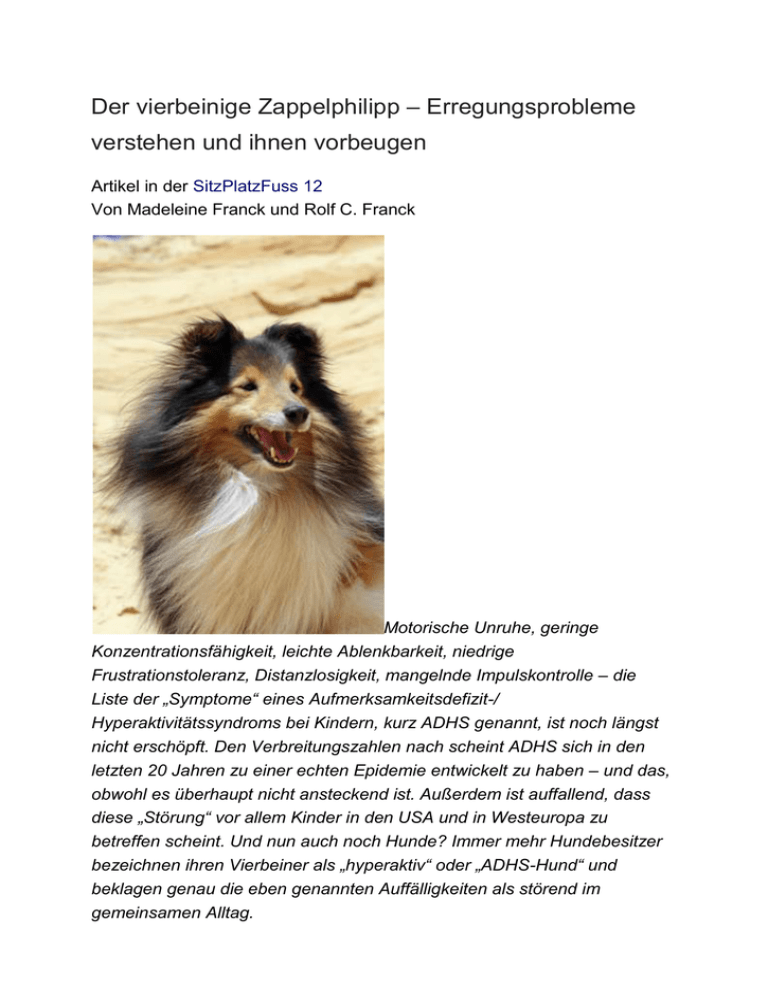
Der vierbeinige Zappelphilipp – Erregungsprobleme verstehen und ihnen vorbeugen Artikel in der SitzPlatzFuss 12 Von Madeleine Franck und Rolf C. Franck Motorische Unruhe, geringe Konzentrationsfähigkeit, leichte Ablenkbarkeit, niedrige Frustrationstoleranz, Distanzlosigkeit, mangelnde Impulskontrolle – die Liste der „Symptome“ eines Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätssyndroms bei Kindern, kurz ADHS genannt, ist noch längst nicht erschöpft. Den Verbreitungszahlen nach scheint ADHS sich in den letzten 20 Jahren zu einer echten Epidemie entwickelt zu haben – und das, obwohl es überhaupt nicht ansteckend ist. Außerdem ist auffallend, dass diese „Störung“ vor allem Kinder in den USA und in Westeuropa zu betreffen scheint. Und nun auch noch Hunde? Immer mehr Hundebesitzer bezeichnen ihren Vierbeiner als „hyperaktiv“ oder „ADHS-Hund“ und beklagen genau die eben genannten Auffälligkeiten als störend im gemeinsamen Alltag. Benutzt man Diagnosen wie ADHS oder Hyperaktivität, um das Verhalten eines Hundes zu klassifizieren, geht leicht der Blick für die Individualität der jeweiligen Lebenssituation des Hundes verloren. Ein solches Label erlaubt dem Besitzer einerseits, ein wenig Verantwortung abzugeben – der Hund hat eben eine Störung –, und andererseits ergeben sich „Schubladendenken“ und standardisierte Lösungswege. Ritalin scheint die Wunderlösung für verzweifelte Eltern hyperaktiver Kinder zu sein, warum sollte das nicht auch bei Hunden funktionieren? Wenn Sie jetzt vielleicht ungläubig den Kopf schütteln, ja, in den USA ist es bereits durchaus üblich, auch Hunde mit Methylphenidat (Ritalin) oder D-Amphetamin (Dexedrine, Adderall) zu behandeln. Das Zusammenleben mit einem „ADHS-Hund“ kann für die Besitzer ausgesprochen nervenaufreibend sein. Der Wunsch nach einer Verhaltensänderung des Vierbeiners ist also absolut nachvollziehbar. Leider sind jedoch die Ratschläge nicht immer hilfreich, die Betroffene erhalten, um das Problem anzugehen. Oft wird der Besitzer mit dem Vorurteil konfrontiert, er würde seinen Hund nicht ausreichend auslasten und beschäftigen. Natürlich gibt es genügend Fälle, in denen dies zutrifft und schon ein wenig mehr Bewegung dazu führt, dass ein vormals überaktiver Hund plötzlich müde und zufrieden in seinem Körbchen liegt. Doch vielfach scheint es umgekehrt zu sein: Je mehr der Besitzer sich um Auslastung und Action für den Vierbeiner bemüht, desto schlimmer wird sein Verhalten. Steht ein Hund scheinbar dauernd unter Strom, verstärken sich die Erregungsprozesse durch einen ständigen Rückkoppelungsprozess im Körper wie von selbst. Zu verstehen, wie es dazu kommen kann, ist die beste Voraussetzung zur Vorbeugung. Darf man Kinder und Hunde vergleichen? Zum Thema ADHS gibt es unzählige Studien, Bücher und ständig neue Forschungsergebnisse. Gemeint sind dabei fast ausnahmslos Publikationen, die sich auf Kinder (zum Teil auch auf Erwachsene) beziehen. Kann man das vorhandene Wissen über ADHS bei Kindern einfach auf Hunde übertragen? Teilweise ja, denn Hirnstrukturen und neurochemische Vorgänge sind bei Mensch und Hund in vielen Bereichen vergleichbar. Der Vergleich ist auch deshalb erlaubt, weil umgekehrt die Forschung ihre Theorien und Erkenntnisse zu einem großen Teil aus Tierversuchen gewinnt. Nur im Rahmen von Tierexperimenten ist es zum Beispiel möglich, die Auswirkungen von bestimmten Emotionen, wie Stress oder Angst, auf die Hirnentwicklung gezielt zu untersuchen, indem Umweltbedingungen entsprechend manipuliert werden. In den meisten Studien spielen Ratten die Hauptrolle, deren relativ einfaches Nervensystem zu Erkenntnissen über neurochemische Veränderungen geführt hat, die mit einzelnen Aspekten von ADHS in Verbindung stehen. Dabei lassen sich Ratten so manipulieren, dass sie tatsächlich die gleichen Verhaltensauffälligkeiten an den Tag legen wie ADHS-Kinder oder -Hunde: eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, erhöhte Reaktion auf Außenreize, motorische Impulsivität und Hyperaktivität, die auftritt, sobald Verstärker rar werden. Erkenntnisse und gegenteilige Interpretationen Aus der klinischen Praxis (sowie den entsprechenden Tierversuchen) weiß man, dass der Wirkstoff Methylphenidat (bekannt als Ritalin) die Symptome von ADHS unterdrückt. Dieses Amphetamin stimuliert die Freisetzung von Dopamin im Gehirn. Umgangssprachlich ist Dopamin als „Glückshormon“ bekannt, tatsächlich ist dieser Neurotransmitter verantwortlich für eine ganze Reihe lebenswichtiger Steuerungsprozesse. Die beobachtete Wirkung von Ritalin führte zu einem Erklärungsmodell für ADHS, das als „Dopaminmangelhypothese“ bekannt ist. Aktuell vertritt die Mehrheit der biologisch orientierten Kinder- und Jugendpsychiater diese Theorie, nach der ADHS, vereinfacht ausgedrückt, auf einer Störung im dopaminergen System beruht. Verantwortlich sei entweder eine verminderte Dopaminausschüttung oder eine zu rasche Wiederaufnahme, was insgesamt einen Mangel zur Folge habe. Die davon betroffenen Hirnregionen sind zuständig für die Regulation von Aktivität, Motivation, Emotionalität, Aufmerksamkeit, Reaktionsbereitschaft und Motorik. Als Ursache des fehlerhaften dopaminergen Systems wird ein genetischer Defekt angenommen, der nicht veränderbar sei, sondern höchstens durch die Gabe entsprechender Medikamente ausgeglichen werden könne. Dem gegenüber steht eine gänzlich andere Theorie, vertreten durch den Göttinger Neurobiologen Prof. Gerald Hüther, der statt eines Mangels einen Überschuss an Dopamin vermutet. Die hirnbiologisch nachweisbaren Fehlfunktionen seien demnach nicht die Ursache von ADHS, sondern die Folge von bestimmten krank machenden Umweltbedingungen. Wie man aus der neueren Hirnforschung weiß, ist die Entwicklung des Gehirns nicht unveränderlich vorgegeben. Im Gegenteil – Hirnstrukturen entwickeln sich je nachdem, wie das Gehirn genutzt wird. Neuere bildgebende Verfahren konnten zeigen, dass Anpassungsprozesse in den Hirnregionen vorkommen, die besonders häufig und intensiv genutzt werden. Dies betrifft zwar auch Erwachsene, dennoch scheinen besonders frühe Erfahrungen von entscheidender Bedeutung zu sein. Immer wenn etwas Neues oder Aufregendes wahrgenommen wird, für das es noch keine feste Verhaltensreaktion gibt, entsteht eine sich ausbreitende unspezifische Erregung. Es wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet, was einen antriebssteigernden Effekt hat. Besonders in Tiermodellen konnte gezeigt werden, dass die Entwicklung des dopaminergen Systems durch äußere Bedingungen enorm beeinflussbar ist und dass es überdies eine Phase erhöhter Anfälligkeit in der Zeit bis zu Beginn der Pubertät zu geben scheint. Konkret gibt es Studien mit Ratten zu den Auswirkungen von zum Beispiel stimulierenden versus deprivierenden Aufzuchtbedingungen, zu frühen Stresserfahrungen und unterschiedlich intensiven Fürsorgestile der Rattenmütter. Das alternative Modell zur Entstehung von ADHS geht davon aus, dass Kinder (genau wie in unserem Fall Welpen) sich von Geburt an in ihrer ursprünglichen Ausprägung des dopaminergen Systems unterscheiden und entweder neugieriger, aufgeweckter und leichter stimulierbar sind oder eben nicht. Für die weitere Entwicklung ist jedoch die Nutzung, also die Häufigkeit der Aktivierung des Systems durch die Wahrnehmung neuer Reize wichtiger als die ursprüngliche „Gundausstattung“. Und hier entsteht schnell ein Teufelskreis: Wer sowieso schon leichter durch Außenreize stimulierbar ist, dessen dopaminerges System wird wesentlich häufiger aktiviert und dadurch immer besser entwickelt, was zu einer noch größeren Ablenkbarkeit und Aktivität führt. Während also die Verschaltungen für ungezielte Aufmerksamkeit und ungerichtete Motorik immer intensiver ausgeprägt werden, bleiben die Verschaltungen für Impulskontrolle und Fokussierung ungenutzt und damit unterentwickelt. Befunde, nach denen die Konzentration des Neurotransmitters GABA (Gamma-AminoButtersäure) bei ADHS-Kindern im Vergleich zu einer Kontrollgruppe vermindert ist, stützen diese These zusätzlich. GABA ist im zentralen Nervensystem der wichtigste Botenstoff mit dämpfender Wirkung, der angstlösend, muskelentspannend, schmerzlindernd und ganz allgemein Stressreaktionen entgegenwirkt. Dass Ritalin zu einer verbesserten Impulskontrolle und verminderten Unruhe führt, lässt sich auch mit diesem Modell erklären: Methylphenidat wirkt hemmend auf die Rezeptoren für Wiederaufnahme von Dopamin. Somit entsteht ein kontinuierlicher Abfluss des (im Überschuss vorhandenen) Dopamins und neue Reize können keine zusätzliche Dopaminausschüttung mehr auslösen. Geht man also nicht von einem genetischen Defekt des neurochemischen Gleichgewichts aus, ist die entscheidende Schlussfolgerung, dass die Entwicklung von ADHS durch geeignete vorbeugende Maßnahmen verhindert werden kann. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Erkenntnisse zur Bedeutung sicherer emotionaler Bindungen sowie die Folgen von frühen Erfahrungen, insbesondere Angst- und Stresserlebnissen, für die strukturelle Hirnentwicklung. Ein Hundeleben beginnt Der genetische Anteil an einer von Anfang an erhöhten Stimulationsbereitschaft ist bei Hunden schon durch die Rassezugehörigkeit erkennbar. Bei bestimmten Rassen wurde gezielt auf leichte Erregbarkeit, schnelles Reaktionsvermögen und Orientierung auf Außenreize selektiert. Kein Wunder also, dass diese Rassen häufiger von den als ADHS bezeichneten Verhaltensauffälligkeiten betroffen sind als andere. Zusätzlich gibt es verschiedene Linien innerhalb einer Rasse und individuelle Unterschiede, die bekanntermaßen ebenfalls eine Rolle spielen. Weniger stark ist das Bewusstsein von Züchtern und Welpenkäufern für die Bedeutung der Auswirkungen vorgeburtlicher Erfahrungen, wie Stresserleben der Mutterhündin. Auch welch prägenden Einfluss die ersten Wochen beim Züchter auf die spätere Erregungsbereitschaft der einzelnen Welpen haben, findet in der Regel zu wenig Beachtung. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Wurfgröße: In kleinen Würfen mit drei bis vier Welpen entwickelt sich automatisch ein gemeinsamer Rhythmus aus Schlafen, Spielen, Schlafen, Fressen, Schlafen und so weiter. In großen Würfen mit acht, zehn oder sogar mehr Welpen ist dagegen so gut wie immer jemand wach. So gibt es für den einzelnen Welpen viel öfter Anreize zur Aktion und zum gemeinsamen Spiel, die sich schlecht ausblenden lassen, und es kommen häufiger Erregungsprozesse in Gang. In der Regel bleibt in großen Würfen weniger individuelle Betreuungszeit für jeden Welpen; räumliche Enge, Fütterung aus gemeinsamen Näpfen und Ähnliches kann den Stresspegel zusätzlich erhöhen. Ein weiteres Beispiel für die Auswirkungen auf die Entwicklung von Erregungs- und Hemmsystemen ist das Erziehungsverhalten der Mutterhündin. Längst nicht jede Hündin ist für diese Aufgabe tatsächlich geeignet; viele sind damit überfordert und zeigen übertriebene oder gar keine Erziehungsmaßnahmen gegenüber ihrem Nachwuchs. Im Idealfall macht die Mutter ein regelrechtes Frustrationstraining mit den Welpen während der Phase des Abstillens und fördert ihre Impulskontrolle durch ihre Reaktionen und das Etablieren eines Stillhaltesignals (wie das Überfassen der Schnauze). Spielt die Mutterhündin ihre Rolle nur unzureichend, ist der Mensch umso mehr gefordert. Für die frühen Bindungserfahrungen mit Menschen ist maßgeblich der Züchter verantwortlich. Während sich die Mutterhündin ab einem gewissen Punkt mehr und mehr zurückzieht und die Welpen öfter sich selbst überlässt, kann der Mensch zur wichtigsten Kontaktperson werden, oder der Fokus jedes einzelnen wird auf die Geschwister gelenkt. Die Tendenz vieler (der meisten?) Züchter ist es, dem Treiben der Hundekinder und damit der schrittweisen Festigung von Entwicklungstendenzen in der Persönlichkeit zuzuschauen, statt ihnen ausgleichend entgegenzuwirken. Sie beobachten, wie einzelne Welpen immer forscher und aktiver werden, während andere eher zurückhaltend bleiben – erregende oder hemmende Verschaltungen im Gehirn werden ohne Einflussnahme gefestigt. Über die Stärke der Bindungsbereitschaft gegenüber dem Menschen hinausgehend, bereitet der Züchter auch vor, welche Rolle der Zweibeiner für seinen Hund spielen wird. Erleben die Welpen ihre Bezugsperson als jemanden, der immer für Action sorgt, um den man kläffend herumspringt und bei dem man sich ins Hosenbein verbeißt? Oder machen sie die Erfahrung, dass dieser Mensch gleichermaßen ein Spiel- wie Schmusepartner und eine sichere Anlaufstelle zum Entspannen und Schlafen ist? „Guck mal, wie schön die spielen!“ Selbst ein engagierter Züchter mit den besten Absichten legt nicht selten bereits in den ersten acht Lebenswochen eines Welpen die Grundlage für spätere Erregungsprobleme. Zieht der kleine Vierbeiner dann in seine neue Familie, berichten diese von Schlafproblemen, hysterischen Anfällen beim Festhalten, Schnappen nach Kleidung und Händen, Jaulen, Fiepen, Kläffen und so weiter. Um alles richtig zu machen, nimmt man den Welpen überall mit hin, knüpft Kontakte auf der Hundewiese und geht in eine Welpenstunde. Gerade Besitzer von Arbeitsrassen, die sich bewusst für einen solchen Hund entschieden haben, starten sofort das Beschäftigungsprogramm und haben einen konkreten Plan, welche sportlichen Hobbys der späteren Auslastung ihres Vierbeiners dienen sollen. Die Mehrzahl von Welpenstunden besteht zu einem überwiegenden Teil aus Freispiel zwischen den Vierbeinern. Ein Welpe, der ein- bis zweimal pro Woche an einer Gruppenspielstunde teilnimmt, wird allein in dieser Situation einen ungünstigen emotionalen Erregungsprozess durchlaufen. Der Anblick anderer Hunde wird zum Auslöser der Aktivierung des dopaminergen Systems, mit jeder Stunde wird die Erregung höher und fester verknüpft. Gleichzeitig wird die Selbstkontrolle geringer und in der Situation auch die Schmerzunempfindlichkeit. Damit hat das Welpenfreispiel noch eine Reihe von anderen unerwünschten Nebenwirkungen: Feine kommunikative Signale werden nicht mehr beachtet, das Lernen einer Beißhemmung erschwert, grobe Umgangsformen werden eingeübt, rassetypische Verhaltensweisen an anderen Hunden ausgelebt. Der Mensch wird zur unwichtigen Randfigur (wenn nicht sogar zum Spielverderber), denn Bindung wird bei jungen Säugetieren hauptsächlich über Spielen und Toben gefestigt. Wird ein Welpe von anderen gemobbt und sucht Schutz bei seinem Menschen, bekommt der Besitzer meist den Rat, ihn zu ignorieren, weil er lernen solle, sich selbst zu wehren. Die Rolle als beschützende Elternfigur bekommt einen Knacks, der junge Hund durchlebt unnötige Angst- und Stresssituationen. Selbst wenn es im Spiel nur freundlich zugeht, hat das wiederholte aufgedrehte Toben negative Auswirkungen auf das Nervenkostüm des jungen Hundes. Das Gehirn stellt sich auf das Erleben hoher Erregungszustände ein, die Verschaltungen für Impulskontrolle werden unwichtig. Je stärker die „Grundausstattung“ des Welpen bereits die Aktivierung des dopaminergen Systems vorsieht, desto eher endet er als unkontrollierbarer Zappelphilipp. Fazit Vorbeugen ist leichter als heilen, dies sollte möglichst jeder Züchter und Welpenbesitzer beherzigen, denn die Weichen für die spätere Erregungsbereitschaft werden in den ersten Lebenswochen und -monaten gestellt. Der Alltag eines Hundes besteht aus vielen, vielen Situationen, in denen seine Selbstkontrolle erwünscht und nötig ist. Je gelassener ein Vierbeiner, desto unkomplizierter ist das Zusammenleben mit ihm, desto leichter meistert er die Anforderungen eines heutigen Hundelebens. Ganz konkret bedeutet dies, die „Gefährdung“ des eigenen Hundes für Hyperaktivitätssymptome einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, die genau die gegenteiligen neuronalen Hirnstrukturen verstärken. Einem aktiven Welpen einer leicht erregbaren Rasse muss man im ersten Lebensjahr vor allem das beibringen, was er nicht von selbst lernen würde: sich in aufregenden Situationen zu entspannen, genügend zu schlafen, Bewegungsreize zu ignorieren und sich unter Ablenkung zu konzentrieren. Jeder Welpe, egal welcher Rasse, wird davon profitieren, seinen Menschen als verlässlichen Beschützer zu erleben, der unangenehme Erlebnisse von ihm abschirmt und positiv mit ihm interagiert. Stress-Anker-Massage SAM Ein konditioniertes verbales Entspannungssignal ist eine Möglichkeit, SAM eine weitere, um die Fähigkeit des Hundes zur Entspannung gezielt zu fördern. Nutzen Sie gemeinsame Schmusestunden auf dem Sofa oder andere ruhige Momente zu Hause, um schon dem Welpen SAM zu vermitteln. Nehmen Sie dazu den Kopf des Hundes so zwischen die Hände, dass Ihre Handflächen seine Wangen umschließen. Während die Daumen zwischen Augen und Ohren liegen, kraulen Sie nun die Ohren direkt an der Ohrmuschel. Wenn Sie SAM als Entspannungsmethode konditioniert haben, lassen sich in einer kritischen Situation gleichzeitig akustische und optische Reize abschirmen, indem Sie beim Kraulen sanft die Augen des Hundes zuhalten. Viele Hunde, die SAM kennen- und lieben gelernt haben, verstecken zusätzlich ihre Nase zwischen den Beinen des Menschen. In jedem Fall werden Sie durch diese Übung Teil der Stressbewältigungsstrategie Ihres Hundes und können ihm in schwierigen Situationen aktiv helfen. Literatur & Weiterlesen: – Blanchard, R.J., McKittrick, C.R. & Blanchard, C., Animal models of social stress: Effects on behavior and brain neurochemical systems. Physiology & Behavior 73 (2001) 261-271. – Franck, M. & Franck, R.C. (2011), Das Blauerhund®-Konzept. Hunde emotional verstehen und trainieren, Band 1 & 2, Cadmos Verlag – Hüther, G. & Bonney, H. (2013/Lizenzausgabe), Neues vom Zappelphilipp: ADS verstehen, vorbeugen und behandeln. Beltz Taschenbuch – National Scientific Council on the Developing Child working papers. http://developingchild.harvard.edu/resources/reports_and_working_papers/ Viele weitere Ideen von TTouch, Clickertraining, konditionierte Entspannung, von Futterempfehlungen, über Homöopathie und Heilkräuter bis zur Wirkung verschiedener Farben, bietet übrigens das im August 2015 neu erschienen Buch „Entspannungstraining für Hunde. Stress, Ängste und Verhaltensprobleme reduzieren“ von unserer lieben Trainerkollegin Karin Petra Freiling. Karin ist Diplombiologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, NLP-Master, TTouch-Instructor, HundePhysiotherapeutin und Gesundheitsberaterin. Das Buch kann versandkostenfrei im Shop des Cadmos-Verlags bestellt werden.