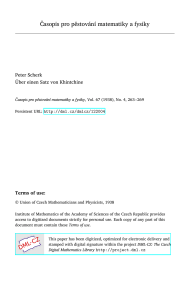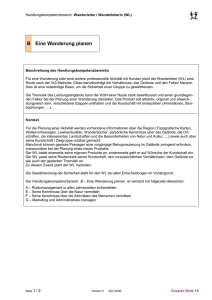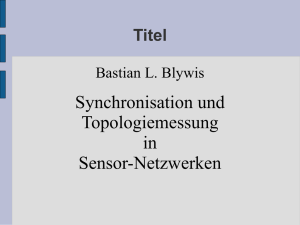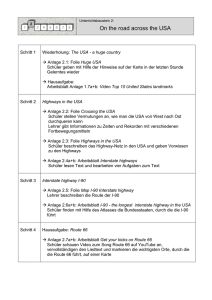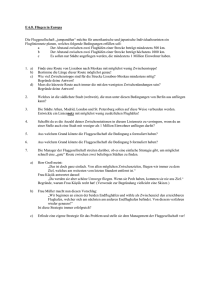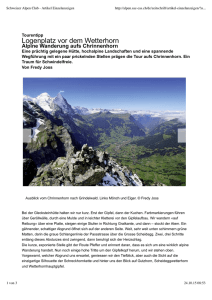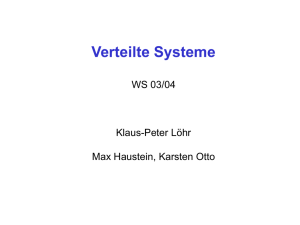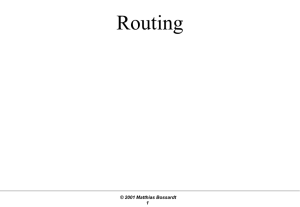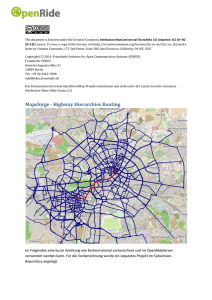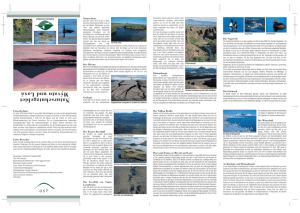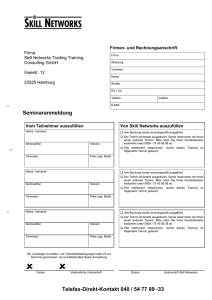Mobile Ad hoc Networking - Institut für Betriebssysteme und
Werbung
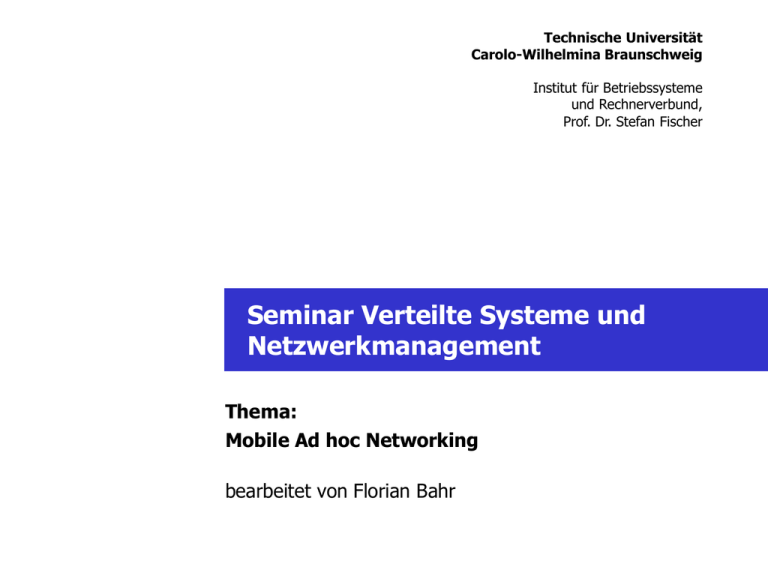
Technische Universität
Carolo-Wilhelmina Braunschweig
Institut für Betriebssysteme
und Rechnerverbund,
Prof. Dr. Stefan Fischer
Seminar Verteilte Systeme und
Netzwerkmanagement
Thema:
Mobile Ad hoc Networking
bearbeitet von Florian Bahr
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Gliederung
1 Einleitung
2 Charakteristika von Mobile Ad hoc Networks
3 Routing in Mobile Ad hoc Networks
4 Abschließende Bemerkungen
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
1 Einleitung
• die Vernetzung mobiler Informationstechnologien auf der Grundlage von Wireless LAN,
BlueTooth oder IrDA bildet die Grundlage für eine „neue Qualität“ spontaner Vernetzung
heterogener, mobiler Systeme
• Charakteristika:
Mobility, Self-Configuration, Peer-to-Peer-Communication und Cooperative Forwarding
Rahmenbedingungen
mobile Netzknoten
Abwesenheit stationärer Kommunikationsinfrastruktur
Unterstützung heterogener Kommunikationsszenarien
1
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Mobile Ad hoc Networks
RFC 2501 „Mobile Ad hoc Networking (MANET): Routing Protocol Performance Issues and
Evaluation Considerations“ [Network Working Group, Corson/Macker, 1999]
• autonomes System mobiler Plattformen, die isoliert in kooperativen Ad-hoc-Gruppen oder über
entsprechende Schnittstellen bzw. Gateways an eine stationäre Kommunikationsinfrastruktur
gekoppelt operieren
• gekennzeichnet durch dynamische, spontan mutierende „Multihop“-Topologien, die mobile
Endgeräte über i.d.R. bandbreitenrestringierte, „wireless“ Links zu einem lose gekoppelten
Netzwerk zusammenfassen
Einleitung - 2
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
2 Charakteristika von Mobile Ad hoc Networks
Eigenschaften stationärer Kommunikationsinfrastrukturen
Endgeräte sind über Vermittlungsstellen, sogenannte Router, an eine stationäre Netzinfrastruktur gekoppelt
Verkehrsleitungsmechanismen basieren auf proaktiven Konzepten, d.h. die möglichen Wege
durch das Netz werden vorgeplant und in Vermittlungsstellen i.d.R. in Form von Routing-
Tabellen hinterlegt
Eigenschaften (klassischer) mobiler Kommunikationsinfrastrukturen
zellular strukturiert
Kommunikationsteilnehmer befinden sich im Versorgungsbereich ortsfester Basisstationen,
die die Verwaltung des Aufenthaltsortes der Teilnehmer durchführen und ggf. die Kopplung
von mobilem Endgerät und Festnetz realisieren
3
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Eigenschaften von Ad-hoc-Netzen
charakteristisch ist die Abwesenheit stationärer Infrastruktur zur dedizierten Unterstützung
der Kommunikation mobiler Endgeräte, die Aufgabe der Nachrichtenvermittlung wird in den
Funktionsbereich der Endgeräte delegiert
d.h., Endgeräte müssen nicht nur eigenen Nachrichtenverkehr empfangen und senden,
sondern in einer Tandemfunktion auch den Verkehr anderer Stationen vermitteln können
infrastrukturlose, mobile Ad-hoc-Netze werden nicht fest konfiguriert, sondern bilden sich
selbständig, wenn Endgeräte in Kommunikationsreichweite gelangen
Prinzip der drahtlosen Peer-Kommunikation („back-to-back radio“)
Charakteristika von Mobile Ad hoc Networks - 4
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Zentrale Charakteristika (nach RFC 2501):
Dynamische Topologie
Bandbreitenbeschränkungen und variable Verbindungskapazitäten
Energiebeschränkungen
Begrenzte physikalische Sicherheit
Charakteristika von Mobile Ad hoc Networks - 5
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Abbildung: Auswirkungen von Mobilitätsszenarien von Netzknoten auf die Verkehrsleitung in
Ad-hoc-Netzen (Kommunikation zwischen Netzknoten 1 und 5 bei Mobilität von Knoten 2, 3, 4
und 6)
a)
b)
Senke
Senke
5
5
4
4
6
6
3
2
Quelle
1
Quelle
3
1
2
Mobiles Endgerät mit zugeordneter Kommunikationsreichweite
Drahtlose Verbindung
Charakteristika von Mobile Ad hoc Networks - 6
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
• zentrale Herausforderung im Kontext des Designs von Ad-hoc-Netzen:
- Entwicklung dynamischer Routing-Protokolle, die effizient Vermittlungspfade zwischen zwei
Kommunikationspartnern identifizieren (bei enger Kopplung der Kooperationsmodelle für Adhoc-Netze an das IP-Layer)
• zwei Kernanforderungen:
- Unterstützung von Mobilität der Netzknoten und
- effiziente Reaktion auf spontane Veränderungen der Netztopologie
• beide Eigenschaften verbieten den Einsatz statischer (proaktiver) Routing-Verfahren und legen
die Verbindung von Wegewahl und Verkehrsvermittlung nahe
Charakteristika von Mobile Ad hoc Networks - 7
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
3 Routing in Mobile Ad hoc Networks
The Dynamic Source Routing Protocol (DSR)
INTERNET-DRAFT „The Dynamic Source Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks“
<draft-ietf-manet-dsr-05.txt> [IETF MANET Working Group, Johnson/Maltz/Hu/Jetcheva,
2001]
• reaktives Routing-Protokoll, das auf eine effektive Unterstützung von Aktivitäten der
Verkehrsleitung in MANETs abstellt
• Ziel: Gewährleistung autonomer Verkehrsleitung unter den Nebenbedingungen von Mobilität der
Netzknoten, spontaner Netzfusion bzw. -partitionierung und interferierendem Input sich
überlagernder Transmissionen
• DSR ist ein reaktives Protokoll i.d.S., dass Routing-Aktivitäten on demand, d.h. in Abhängigkeit
eines konkreten Kommunikationsbedarfs zwischen zwei Netzknoten, initiiert werden
8
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
• DSR arbeitet nach dem Konzept des sogenannten source routing
• d.h., jedes von einer Nachrichtenquelle zu propagierendes Datenpaket wird in seinem IP-Header
mit einer vollständigen Wegeinformation (hop-by-hop route) bzgl. des Pfades von einer
Nachrichtenquelle zur spezifizierten Nachrichtensenke ausgezeichnet
• diese als source routes bezeichneten Sprungfolgen von einer Nachrichtenquelle zu einer
Nachrichtensenke im Ad-hoc-Netz über intermittierende Netzknoten werden dabei in lokalen
route chaches gespeichert
• zentrale Mechanismen:
- Wegewahl (route discovery) und
- Wegevalidation zum Kommunikationszeitpunkt (route maintenance)
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 9
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Der Route-Discovery-Prozess
zum Kommunikationszeitpunkt: sofern im route cache der Nachrichtenquelle keine source
route bzgl. der Nachrichtensenke vorliegt, Fluten des Netzes ausgehend von der Quelle mit
sogenannten route requests (RREQ-Paketen)
jeder Knoten, der ein route request empfängt, propagiert das RREQ-Paket an alle
benachbarten Knoten (d.h., an alle Netzknoten in unmittelbarer Kommunikationsreichweite)
Knoten, die ein an sie adressiertes route request empfangen bzw. eine source route zur
Nachrichtensenke im route cache verwalten, antworten mit einem route reply (RREP-Paket),
das entlang des Route-Discovery-Pfades zurück zur Nachrichtenquelle propagiert wird
• Ergebnis: der Route-Discovery-Prozess konstruiert einem Quelle/Senke-Paar zugeordnete
Routen entsprechend des Weges, entlang dessen RREQ-Pakete durch das Netz zur Senke
propagiert wurden
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 10
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Abbildung: Darstellung des Route-Discovery-Prozesses (Wegewahl zwischen zwei kommunizierenden Knoten 1 und 5) [Propagierung von route requests]
Route request (source, destination, hops)
Route cache
...
Senke
5
RREQ(1,5,{1,2,4})
Route cache
...
4
6
RREQ(1,5,{1,2})
RREQ(1,5,{1})
Quelle
1
Route cache
...
2
Route cache
...
RREQ(1,5,{1,2})
3
Route cache
(3,5) > {3,6,5}
...
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 11
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Abbildung: Darstellung des Route-Discovery-Prozesses (Wegewahl zwischen zwei kommunizierenden Knoten 1 und 5) [Propagierung von route replies]
Route cache
Route reply (source, destination, source route)
(5,1) > {5,4,2,1}
(5,2) > {5,4,2}
(5,4) > {5,4}
...
Senke
5
RREP(5,1,{1,2,4,5})
Route cache
...
4
6
RREP(5,1,{1,2,4,5})
RREP(5,1,{1,2,4,5})
Quelle
1
Route cache
(1,5) > {1,2,4,5},
{1,2,3,6,5}
...
2
Route cache
(2,1) > {2,1}
(2,4) > {2,4}
...
RREP(3,1,{1,2,3,6,5})
3
Route cache
(3,1) > {3,2,1}
(3,2) > {3,2}
(3,5) > {3,6,5}
...
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 12
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Route-Maintenance
Mechanismus zur Ermittlung des Gültigkeitsstatus einer source route zum Kommunikationszeitpunkt
sollte ein Link entlang des auf dem Wege des Route-Discovery-Prozesses ermittelten Pfades
unterbrochen sein, wird entlang der source route, ausgehend vom letzten erreichbaren
Knoten, in Richtung der Nachrichtenquelle ein route error (RERR-Paket) propagiert
die Nachrichtenquelle reagiert auf den Verbindungsausfall mit Entfernen aller source routes,
die über den ausgefallenen Link laufen, aus dem lokalen Route Cache, und initiiert ggf.
einen erneuten Route-Discovery-Prozess
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 13
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Optimierungsansätze
im Hinblick auf eine mögliche Minimierung von caching und routing load :
- Salvaging
- Gratuitous route repair
- Promiscous listening
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 14
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Zusammenfassende Bewertung
route discovery und promiscous listenening ermöglichen die Identifikation mehrerer
alternativer source routes zwischen möglichen Nachrichtenquellen und -senken
die Verfügbarkeit alternativer Routingpfade reduziert dabei die Notwendigkeit des
extensiven Rückgriffs auf Route-Discovery-Mechanismen und entspricht damit den
besonderen Erfordernissen hochgradig dynamischer MANETs
der Einsatz von DSR führt hin zu selbst-organisierenden und -konfigurierenden Netzen, die
fernab von vorgegebener Netzinfrastruktur und Netzadministration operieren
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 15
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Geographisches Routing
„Geographical Routing using partial information for Wireless Ad Hoc Networks“ [Jain/Puri/
Sengupta]
• alternativer Ansatz der Verkehrsleitung in MANETs unter Einbezug von Informationen über die
geographische Position von Netzknoten
• geographisches Routing basiert auf modifizierten (verteilten) Routing-Tabellen, die Netzknoten
approximativ eine geographische Position zuweisen (d.h., eine Routing-Tabelle ist eine Liste von
Tupeln der Form (N, posn) für Netzknoten N und ihre Position posn)
• die Nachrichtenvermittlung an eine Nachrichtensenke über intermittierende Knoten orientiert
sich dabei an minimalen Distanzvektoren bzgl. der erreichbaren Nachbarknoten und der
Nachrichtensenke
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 16
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
Abbildung: Darstellung eines Wegewahl-Prozesses auf Grundlage geographischer Informationen
(Wegewahl zwischen kommunizierenden Knoten 1 und 3)
dist(4,3) = 2,8284...
4
Senke
3
Quelle
2
Route table
1
(2,<2,1>)
(4,<1,4>)
(3,<3,2>)
dist(2,3) = 1,4142...
Routing in Mobile Ad hoc Networks - 17
Seminar Verteilte Systeme und Netzwerkmanagement: Mobile Ad hoc Networking
4 Abschließende Bemerkungen
• Ziel der diskutierten Kooperationsmodelle ist insbesondere die integrierte und effiziente
Unterstützung heterogener Kooperationsszenarien – von autonomer, kollaborativer Gruppenkommunikation bis zu weitspannenden, gekoppelten „Multihop“-Netzen
Was noch?
- Sicherheit und
- Energieverbrauch in MANETs
18