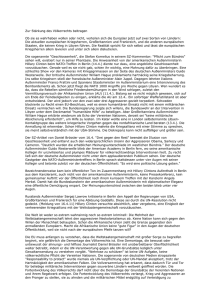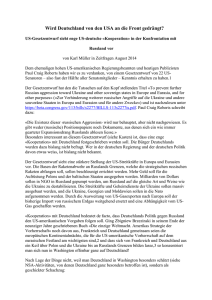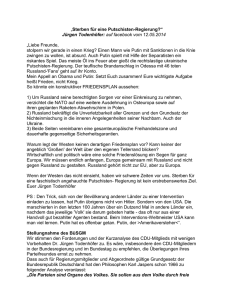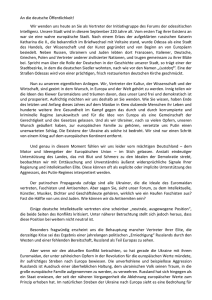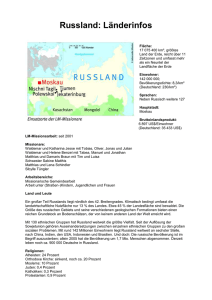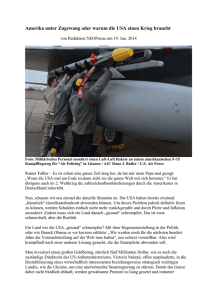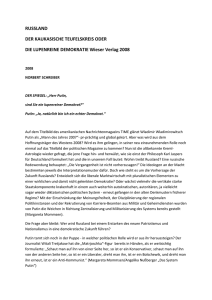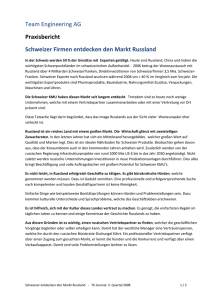DIE CHAOS-KöNIGIN: Hillary Clinton und die Außenpolitik der
Werbung
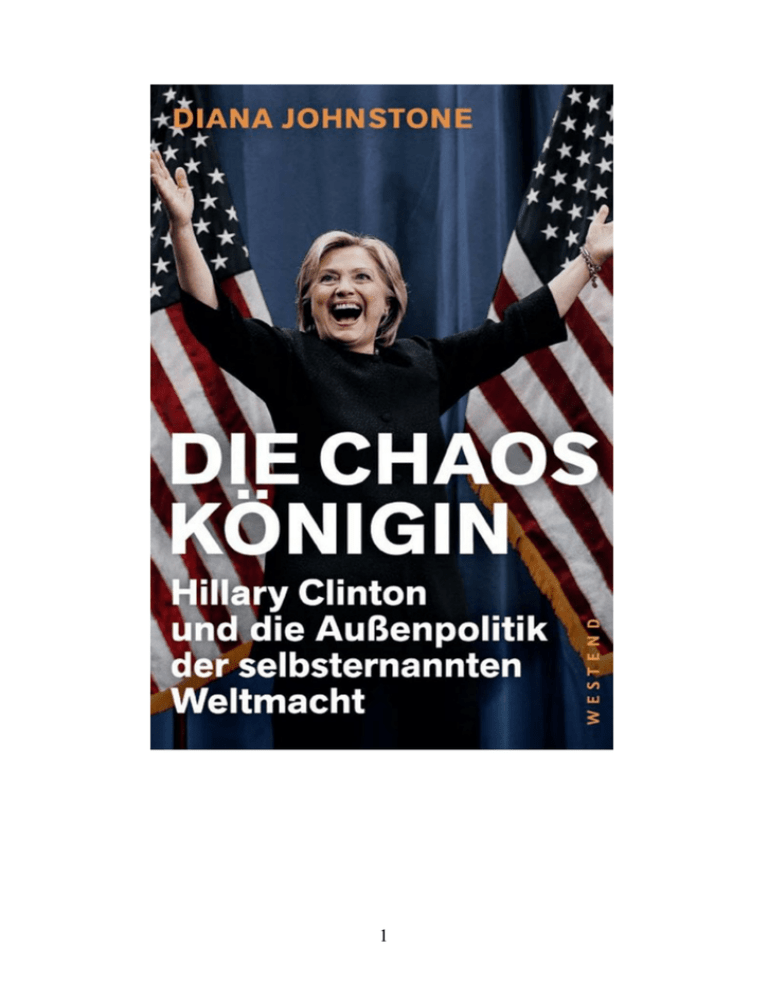
1 2 DIANA JOHNSTONE DIE CHAOS-KÖNIGIN Hillary Clinton und die Außenpolitik der selbsternannten Weltmacht Aus dem Englischen von Michael Schiffmann eBook Edition 3 Die Originalausgabe erschien im November 2015 unter dem Titel »Queen of Chaos. The Misadventures of Hillary Clinton«, Counterpunch 2015 © 2015 Diana Johnstone All rights reserved Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.westendverlag.de Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. ISBN 978-3-86489-636-1 © Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2016 Umschlagabbildung: Ullstein Bild – Reuters / Brian Snyder Satz: Publikations Atelier, Dreieich Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany 4 Inhalt Vorwort zur deutschen Ausgabe Einführung 1 Der Ritt auf dem Tiger: Hillary Clinton und der MilitärischIndustrielle Komplex 2 »Multikulturalismus« ä la Hillary: unsere einzigartigen »Werte« und »Interessen« 3 Die Zähmung durch die Widerspenstigen 4 Der Beginn des clintonschen Kriegszyklus 5 Libyen: Hillarys eigener Krieg 6 Russland verstehen? Nein, danke! 7 Die Kriegspartei Anmerkungen Namens- und Ortsregister 5 Mein besonderer Dank gilt Michael Schiffmann, dessen hervorragende Übersetzung und Hintergrundrecherche dazu beigetragen haben, dass die vorliegende deutsche Ausgabe dieses Buches besser ist als das englische Original. 6 Vorwort zur deutschen Ausgabe Es gibt ja in Deutschland eine breite Kontroverse zum Thema »Putin verstehen«, aber so, wie die Dinge derzeit liegen, ist das Thema »Hillary Clinton verstehen« eigentlich noch wichtiger. Zum Jahresanfang 2016 ist Hillary Rodham Clinton, trotz wachsender Opposition von Seiten ihres demokratischen Mitbewerbers Bernie Sanders und des republikanischen Exzentrikers Donald Trump, die Kandidatin, die im November 2016 mit größter Wahrscheinlichkeit zur Präsidentin der Vereinigten Staaten gewählt werden wird. Davon abgesehen verkörpert sie den Konsens zwischen den Neokonservativen und den liberalen humanitären Interventionisten, der das außenpolitische Establishment in Washington dominiert. Hillary Clinton hat ganz klar die Absicht, die Politik des »Regimewandels«, die sie als Außenministerin verfolgte, weiterzubetreiben. Sie war eine der Haupanstifterinnen des Krieges zum Sturz von Gaddafi in Libyen und immer eine der entschiedensten Verfechterinnen des Einsatzes aller notwendigen Mittel, um Baschar alAssad in Syrien zu stürzen. Das entstandene Chaos hat ihren Eifer keineswegs gemindert. Hillary Clinton setzte sich auch dann energisch für die »Bewaffnung der gemäßigten Rebellen« in Syrien ein, wenn Präsident Obama zögerte. Am 16. September 2015 gab General Lloyd Austin – der Offizier, der mit dem 500 Millionen Dollar teuren US-Programm zur »Ausbildung und Ausrüstung« beauftragt war, das der Stärkung »moderater« Anti-AssadRebellen dienen sollte – gegenüber dem Kongress zu, das Programm sei ein totaler Fehlschlag gewesen. Nur »vier oder fünf« der zum Kampf gegen Assad »ausgebildeten und ausgerüsteten« Kämpfer waren noch aktiv verfügbar. Der Rest dieser »guten« Rebellen war entweder desertiert oder war, samt ihrer US-Waffen, zu den »bösen« Rebellen übergelaufen. Dieser Fehlschlag änderte Hillary Clintons Meinung nicht. Ebenso wie 7 andere in Washington verkündet sie auch weiterhin, irgendwo zwischen dem »Islamischen Staat« und der Republik Syrien kämpften »gemäßigte« Rebellen gegen beide Seiten und verdienten unsere Unterstützung. Am 30. September begann Russland auf Einladung der syrischen Regierung mit der Bombardierung von Zielen der islamistischen Extremisten in Syrien. Clinton reagierte mit ihrer seit langem erhobenen Forderung nach einer »Flugverbotszone« in Nordsyrien – die sich indes logischerweise gegen syrische und russische Flugzeuge richten würde, da die islamistischen Rebellen über keine Luftwaffe verfügen. Das Weiße Haus lehnte diese Idee ab, was ein weiteres Mal zeigt, dass Hillary Clinton den aggressivsten Flügel der Kriegspartei innerhalb des politischen Establishments der USA repräsentiert. Typisch für Hillary Clinton ist, dass sie Außenpolitik im Stil einer persönlichen Vendetta praktiziert. Dabei richtet sich ihr selbstgerechter Zorn gegen Gaddafi, oder Putin, oder Assad. Von den Kommandohöhen der US-Macht stigmatisiert sie den »Diktator« und erklärt, er müsse »gehen«. Kontext und Resultate kümmern sie wenig. Hillary Clinton ist scharf dafür kritisiert worden, dass sie während ihrer vier Jahre als US-Außenministerin statt der offiziellen Kommunikationskanäle einen privaten E-Mail-Server genutzt hat. Dieser Skandal wurde vom Kongress untersucht, aber die überparteiliche Unterstützung für die US-Außenpolitik ist so groß, dass selbst ihre republikanischen Gegner im Kongress sich auf unwesentliche Details konzentrierten, statt sie für ihre führende Rolle bei der Zerstörung Libyens als lebensfähiger Staat anzugreifen.1 Diese Politik des chaotischen Regimewandels ist tatsächlich das Wahrzeichen des außenpolitischen Ansatzes Hillary Clintons – und zwar sogar so sehr, dass ihre engsten Ratgeber sich bereits darauf freuten, den US-»Sieg« in Libyen zur Basis einer »Clinton-Doktrin« zu machen, die dazu beitragen würde, ihr die Präsidentschaft zu sichern. In einer E-Mail an Hillary Clinton vom 22. August 2011 frohlockte ihr enger Berater Sidney Blumenthal über die erfolgreiche Bombardierung Libyens.2 »Erst einmal, Glückwunsch! Das ist ein historischer Augenblick, und man wird dir das Verdienst zuschreiben, ihn herbeigeführt zu haben«, schrieb er. »Wenn es am Ende zum Sturz von Gaddafi selbst kommt, solltest du natürlich, ganz gleich, wo du dich gerade befindest, und wenn es die Auffahrt zu deinem Ferienhaus ist, vor laufenden Kameras eine öffentliche Erklärung abgeben. […] Du musst vor die Kameras treten. Du musst dich in diesem Moment in der Geschichte verewigen. […] Die wichtigste Wendung dabei ist erfolgreiche 8 Strategien<.«3 Clinton leitete die Mail an ihren obersten Mitarbeiter im Außenministerium, Jake Sullivan, weiter und merkte an, wenn sie mit ihrer Erklärung bis direkt nach dem Sturz Gaddafis warte, werde dies »sie noch dramatischer machen«. Sullivan steuerte weitere Ratschläge bei: »Es könnte sinnvoll sein, dass du einen Gastkommentar schreibst, der direkt nach seinem Sturz veröffentlicht wird und in dem du diesen Punkt hervorhebst. […] Du kannst den Kommentar dann bei all deinen Auftritten nochmals bekräftigen, aber es ist sinnvoll, etwas Definitives niederzulegen, fast so etwas wie die Clinton-Doktrin.«4 Kurz, Hillary Clintons Berater fassten ins Auge, den gewaltsamen Sturz der Führer anderer Länder zur grundlegenden außenpolitischen »Doktrin« ihrer Kandidatin zu erheben. Das Chaos, das später in Libyen ausbrach, hat die Triumphstimmung etwas gedämpft, aber es hat den von ihren glühenden Unterstützern geteilten clintonschen Standpunkt, der Sturz von Diktatoren sei genau das, was man tun müsse, in keiner Weise geändert. Hillarys Nachfolgerin als Senatorin aus New York, Kirsten Gillibrand, tat den Hinweis auf »das Durcheinander« in Libyen mit dem Kommentar ab, Libyen sei »vorher ein Durcheinander« gewesen, »und jetzt ist es auch ein Durcheinander«. Wozu sich also aufregen? In ihrer Wahlkampagne setzt Hillary Clinton ihre Vendetta gegen »Diktatoren« fort. Ungeachtet des Vorrückens und der Gräuel des »Islamischen Staates« (Daesch), ungeachtet der Flut von Flüchtlingen, die aus von US-Militärinterventionen verwüsteten Ländern nach Europa drängen, ungeachtet der terroristischen Angriffe am 13. November 2015 in Paris, die viele Menschen in Frankreich und anderswo zu der Meinung gebracht haben, es sei wohl doch dringlicher, den Vormarsch des islamistischen Fundamentalismus zu stoppen als den syrischen Präsidenten loszuwerden, bleibt Hillary Clinton bei ihrem Mantra: Assad muss gegen. »Assad hat den letzten Zahlen zufolge an die 250 000 Syrer getötet«, proklamierte sie in einer Wahlkampfdebatte mit Bernie Sanders am 12. Dezember 2015. Der hier verwendete rhetorische Kniff demonstriert die Infantilisierung der politischen Debatte in den Vereinigten Staaten: Sämtliche Toten in einem fünf Jahre währenden Bürgerkrieg – einschließlich aller Soldaten der syrischen Armee, aller von Rebellen getöteten Zivilisten und aller Nicht-Syrer, die sich den islamistischen Kräften angeschlossen haben – sie alle werden einem »Diktator« angerechnet, der »sein eigenes Volk tötet«. 9 Gewisse wohlinformierte Beobachter im Westen sehen das etwas anders. Mitarbeiter der U.S. Defense Intelligence Agency (DIA) haben versucht, das Weiße Haus zu warnen, der Sturz Assads werde zum Sieg der islamischen Fanatiker führen – mit katastrophalen Auswirkungen. Aber, so der ehemalige DIA-Direktor Generalleutnant Michael Flynn: »Ich hatte das Gefühl, dass sie die Wahrheit nicht hören wollten.«5 Die politische Führung der USA scheint in einer imaginären Welt zu leben, in die unwillkommene Fakten nicht eindringen können. Hillary Clinton ist ein extremes Beispiel für diese Undurchlässigkeit. Führende Politiker der Vereinigten Staaten proklamieren immer wieder, wie sehr ihnen die »Werte und Interessen« ihrer Nation am Herzen liegen. Außerdem erachten sie es als selbstverständlich, dass ihre europäischen Verbündeten ihrer Führung folgen müssen, um diese »Werte und Interessen« zu verteidigen. Deren gelegentliches Zögern dabei wird von Washington als »Mangel an Mut« gebrandmarkt. Die Werte, um die es dabei angeblich geht, werden selten explizit genannt, aber man könnte ja davon ausgehen, dass kulturelle Modernisierung und eine säkulare Gesellschaft dazu gehören. Und doch haben die USA sich im Nahen Osten durchgängig mit den rückwärtsgerichtetsten sozialen Kräften verbündet, um nach Modernisierung strebende Staaten zu zerstören. Weit von jeder Dankbarkeit entfernt, wenden diese inhärent antiwestlichen Kräfte ihre Gewalt dann gegen den Westen, unter anderem, um als die wahren Befreier der muslimischen Welt von den »Kreuzfahrern« die Unterstützung der Massen zu gewinnen. In einigen Teilen der Welt war der Marxismus die Form der »westlichen Werte«, die die Modernisierung voranbringen konnte. In der arabischen Welt bedeutete Nationalismus die Bemühung, einen modernen Staat und eine säkulare Gesellschaft aufzubauen. Die Vereinigten Staaten haben sich entschieden, diese Experimente als etwas absolut Feindliches zu betrachten, das vernichtet werden muss. Dabei war und ist der Vorwand für die Zerstörung nach Modernisierung strebender Regimes immer wieder, sie würden von »Diktatoren« regiert – ein Wort, das, zumindest in meiner englischen Muttersprache, seine mythologische Macht dem Umstand verdankt, dass es als die gängige Bezeichnung für Adolf Hitler populär wurde. Die Denkweise Washingtons ist stark von einigen höchst vereinfachenden Analogien geprägt, die auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges zurückgehen. So ist etwa »München«6 ein Stichwort, das benutzt wird, um Diplomatie anstelle von Gewalt auszuschließen. Und die Bundesrepublik Deutschland wird in Washington als bestes Beispiel 10 dafür angeführt, dass eine Besatzung durch die USA die beste Art ist, eine frühere »Diktatur« zu »demokratisieren« – wobei die Geschichte Deutschlands vor Hitler einfach ignoriert wird. Diese ideologische Hegemonie befähigt die USA, ihre Verbündeten in immer gefährlichere Interventionen hineinzuziehen. Nur die USA – als einziges Land auf der Welt und in der Weltgeschichte, ein »Ausnahmeland« eben – würden nie auch nur auf eine Idee wie den Imperialismus kommen! Umgekehrt läuft dann jedes Land (außer den USA selbst), das ernsthaft über seine eigenen nationalen Interessen nachdenkt, Gefahr, als »nationalistisch« und damit auch als aggressiv und feindlich gegenüber Minderheiten stigmatisiert zu werden. Im Gegensatz dazu gilt Gefolgschaft gegenüber der US-Führung als Dienst für einen höheren Zweck. Wird die deutsche Bevölkerung, deren moralische Kultur nicht auf zwölf Jahre der Geschichte des 20. Jahrhunderts reduziert werden kann, es irgendwann wagen, sich vom Gedanken einer ewig währenden Kollektivschuld zu befreien und ihre eigenen Werte und Interessen zu definieren, auch wenn sie der Kriegspolitik der USA widersprechen? Könnte es sein, dass die unbestreitbare Schuld einer vor mehr als einem Jahrhundert geborenen Generation an Krieg und Völkermord die Bevölkerung Deutschlands zu einer Komplizenschaft mit einer heutigen Kriegspolitik verleitet, die von den USA betrieben wird? Alles wird sinnlos, wenn ein schlechtes Gewissen das Gewissen selbst tötet. Die heutige Generation der Deutschen trägt an der Vergangenheit keine Schuld, aber sie hat die Verantwortung für Gegenwart und Zukunft. Es bleibt zu hoffen, dass diese Verantwortlichkeit sich als Kraft für Frieden und Vernunft erweist. Diana Johnstone, Paris, Januar 2016 11 Einführung Hillary Rodham1 wurde 1947 in die Generation der Baby-Boomer hineingeboren, ein Jahr, bevor der Politikplaner des USAußenministerium George F. Kennan in einem internen Papier die berühmt gewordenen Sätze schrieb: »Wir verfügen über 50 Prozent des Reichtums dieser Welt, unsere Bevölkerung beträgt jedoch lediglich 6,3 Prozent der Weltbevölkerung. […] In so einer Situation müssen uns andere beneiden und Groll gegen uns verspüren. Unsere wichtigste Aufgabe in der nächsten Zeit wird sein, ein Muster von Beziehungen auszudenken, das es uns ermöglichen wird, diese Ungleichheit aufrechtzuerhalten.«2 Hillary, in ihrer Jugend eine Anhängerin des rechten republikanischen Senators Barry Goldwater, wuchs mit diesem Selbstverständnis eines reichen und dominanten Amerika auf, das die Pflicht hatte, seine Spitzenstellung in einer Welt voller Neid und Missgunst zu verteidigen. Das war die damalige Standardsicht. Diese Sichtweise war das Resultat des Zweiten Weltkriegs. Die Vereinigten Staaten hatten den Krieg im Pazifik gewonnen. In Europa gebührte der Sieg in überwältigendem Maß der Sowjetunion – eine Tatsache, die in Hollywoodfilmen und bei den häufigen D-Day-Feiern zur Landung in der Normandie außer Acht gelassen wird, wobei man geflissentlich übersieht, dass zu diesem Zeitpunkt die Rote Armee die Wehrmacht an der Ostfront schon fast besiegt hatte. Wirtschaftlicher Sieger des Zweiten Weltkriegs waren allerdings ganz klar die USA. In einer stark zerstörten und hochverschuldeten Nachkriegswelt hatten die Vereinigten Staaten auf einmal diesen gewaltigen Vorteil, den Kennan dann hervorhob. Leider haben die USA seit dieser Zeit kein anderes großes nationales Ziel entwickelt als das, an der Spitze zu bleiben. In den letzten Jahren sind die Vereinigten Staaten oft als »Imperium« bezeichnet worden. Aber sie sind kein Imperium wie jedes andere. Die 12 USA unterhalten Militärstützpunkte auf der ganzen Welt, deren Ziel jedoch eher die Erhaltung ihres Vorsprungs seit dem Zweiten Weltkrieg ist als eine Expansion, wie sie für frühere Imperien typisch war. Die ehemaligen europäischen Imperien übernahmen eine gewisse Verantwortung für die von ihnen eroberten Länder, um deren Reichtümer effektiver ausbeuten zu können. Neben der Ausbeutung der örtlichen Arbeitskräfte und dem Diebstahl von Ressourcen bauten frühere Imperien auch eine Infrastruktur auf und führten nützliche Neuerungen ein, um das reibungslose Funktionieren ihrer Kolonien sicherzustellen. Die USA sind ein verantwortungsloses Im-perium.3 Sie verwüsten Länder und hinterlassen sie in Trümmern, ohne dass dies durch einen Nutzen ausgeglichen würde. Ihr Vorgehen wird immer zerstörerischer, weil es gar nicht um den Aufbau eines Imperiums geht, sondern um die Ausschaltung tatsächlicher oder potentieller Rivalen, um die im Zweiten Weltkrieg errungene Vormachtstellung aufrechtzuerhalten. Die destruktive Natur dieser Kriege zeigt sich auch daran, dass die USA keinen ihrer jüngeren Kriege wirklich »gewonnen« haben. Flüchtige Illusionen, man habe »gesiegt«, sind stets mit dem Aufstieg feindseliger Extremisten zerstoben. Erst kürzlich hat der unerklärte US-Drohnenkrieg gegen die Islamisten im Jemen einen noch heftigeren revolutionären Aufstand ausgelöst, bei dem US-Waffen erbeutet wurden und die Vertreter der USA zur Flucht gezwungen waren. Trotz der verheerenden Resultate all ihrer Kriege im Nahen Osten scheint die Kriegspartei in Washington bereit, in der Ukraine einen weiteren Stellvertreterkrieg zu führen – gegen einen wesentlich mächtigeren Widersacher als im Nahen Osten. All das sind letztlich »Spielverderber«-Kriege, die zur Schwächung potentieller Rivalen geführt werden. Sie schaffen immer größeres Chaos und unversöhnliche Feinde, ohne dass jemand wirklichen Nutzen von ihnen hat. Wählt mich, ich bin eine Frau! Hillary Rodham Clinton hat viele Jahre auf den Versuch verwendet, Frauen in den USA die Idee zu verkaufen, ihre Träume, nicht die Hillarys, würden belohnt, wenn sie zur Präsidentin der Vereinigten Staaten gewählt wird. Die Idee scheint zu sein, dass, wenn nur Hillary »die gläserne Decke durchbricht«, andere Frauen nachströmen und die oberen Stockwerke, 13 den Speicher und sogar das Dach besetzen werden. Aber müssen wir »beweisen«, dass eine Frau Präsidentin sein kann? Wenn Frauen Ringerinnen sein können, wofür sie von der Natur nicht sonderlich qualifiziert sind, sollte klar sein, dass eine Frau auch Präsidentin sein kann. Es gibt nichts an den bedeutenden Anforderungen dieses Amtes, was Frauen ausschließen würde. Das Entscheidende an den nächsten Präsidentschaftswahlen ist sicher nicht, diesen trivialen Punkt zu beweisen. Im Raum steht nämlich auch noch die nicht unbedeutende Frage, ob die USA in einen Krieg mit einer anderen großen Atommacht geführt werden sollen. Die Vermeidung des Dritten Weltkriegs ist ja womöglich noch wichtiger als der »Beweis«, dass auch eine Frau Präsidentin der Vereinigten Staaten sein kann. Im Lauf der gesamten Geschichte sind auch Frauen Herrscherinnen gewesen, aber das hat auf das Alltagsleben von Millionen von Frauen sehr wenig Einfluss gehabt. Die Frauen an der Spitze waren, wie Hillary selbst, meist Töchter oder Ehefrauen männlicher Herrscher. Hillarys Biograf Carl Bernstein paraphrasiert sie während ihrer Südasienreise 1995 mit den Worten: »Pakistan, Indien, Bangladesch und Sri Lanka hatten bereits alle eine von Frauen geführte Regierung gehabt, doch gleichzeitig werden Frauen in diesen Kulturen so wenig geachtet, dass neugeborene Mädchen mitunter getötet oder ausgesetzt werden.«4 Die gesellschaftliche Situation von Frauen in einer Gesellschaft hängt nicht davon ab, ob ein Land eine Königin hat oder nicht. Frauen vollbringen in vielen Bereichen Herausragendes, und diese Leistungen sind oft wichtiger für die Schaffung inspirierender Rollenmodelle als die Politik. Ein Beispiel hierfür ist die Iranerin Maryam Mirzakhani, die im August 2014 als erste Frau mit der FieldsMedaille für exzellente Leistungen in der Mathematik ausgezeichnet wurde. Das könnte ein positives Zeichen setzen. Sowohl in der Politik als auch in anderen mit Macht verbundenen Gebieten lassen häufig die Frauen selbst die »gläserne Decke« unangetastet und begnügen sich mit einem Platz außerhalb des Rampenlichts, um anderen zu helfen. Daran ist nichts auszusetzen. Aber für Frauen, die politisch mächtige andere Frauen als Rollenmodell brauchen, bietet die Geschichte Cleopatra, Katharina die Große in Russland, Eleonore von Aquitanien, Königin Elisabeth I. und viele weitere Beispiele. Zahlreiche gewählte Staatschefs der heutigen Welt, vor allem in Lateinamerika, sind Frauen. In England regierte Margaret Thatcher von 1979 bis 1990, und in Deutschland ist Angela Merkel seit 2005 und mittlerweile in der dritten Legislaturperiode Kanzlerin. Die 14 Vereinigten Staaten haben den Zeitpunkt verpasst, als erste in der Welt eine Frau an die Spitze des Staates zu wählen, aber das ist kein Grund zur Sorge – irgendwann werden auch sie es schaffen. Haben die Frauen in den USA so große Defizite, dass sie Hillary Clinton als Präsidentin brauchen, um sich besser zu fühlen? Ganz bestimmt nicht. Die Frauen in den USA schaffen sich derzeit viele neue Wege, ein erfolgreiches, sinnvolles und erfüllendes Leben zu leben. Und wenn die erste Präsidentin des Landes die ganze Welt ins Desaster stürzt, wird es danach auch den Frauen in den USA nicht besser, sondern wesentlich schlechter gehen. Hoffen wir also, dass die erste Präsidentin dieses Landes eine Person sein wird, die sich durch ein tiefes Verständnis der Welt und echtes menschliches Mitgefühl auszeichnet statt durch unermüdlichen persönlichen Ehrgeiz. Hillary Clinton in Aktion: Heuchelei in Honduras Barack Obama versprach den Wandel. Dann, nach der Wahl, ernannte er Hillary Rodham Clinton zur Außenministerin. Das war ein frühes Signal, dass es in der Außenpolitik keine echte Veränderung geben würde – zumindest keine zum Besseren. Der erste echte Test für den »Wandel« in der US-Außenpolitik kam sechs Monate später, als der gewählte Präsident von Honduras, Manuel Zelaya, am 28. Juni 2009 durch die Streitkräfte seines Landes gestürzt wurde. Ein echter Wandel hätte in dieser Situation bedeutet: Die USA hätten den Putsch scharf verurteilen und die Wiedereinsetzung des legitimen Präsidenten fordern müssen. Vor dem Hintergrund ihres Einflusses und ihrer Militärpräsenz in Honduras hätten die USA mit einer »entschlossenen Haltung« den Protesten gegen den Putsch in Honduras selbst und in der gesamten Hemisphäre Biss verleihen können. Es geschah aber etwas ganz anderes. Man bekam hier einen ersten Vorgeschmack auf den Umgang Hillary Rodham Clintons mit dem Rest der Welt. Sie nennt das »smart power«.5 Übersetzen lässt sich dieser Begriff als »Heuchelei und Manipulation«. Anfang Juni 2009 flog Hillary zum Jahrestreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Honduras. Sie hatte ein wichtiges Ziel 15 im Sinn: eine Mehrheit der OAS-Staaten von der Aufhebung des vor 47 Jahren erfolgten Ausschlusses von Kuba abzuhalten. Die allermeisten von ihnen betrachteten diesen Ausschluss als »ein überholtes Werkzeug des Kalten Kriegs«.6 Erstaunlich für Hillary gingen Venezuela, Nicaragua, Bolivien und Ecuador sogar so weit, den Ausschluss als »Beispiel für die Tyrannei der USA« zu bezeichnen.7 Also lösten Hillary und ihr Stab das Problem, indem sie alten Wein in neue Schläuche füllten. Kein Kalter Krieg, keine »kommunistische Gefahr« mehr! »Nach Präsident Obamas Maßgabe, wir müssten die schalen Debatten des Kalten Krieges hinter uns lassen«, schrieb Hillary in ihren Memoiren Entscheidungen, »wäre es scheinheilig von uns gewesen, wenn wir weiterhin auf die Gründe gepocht hätten, wegen denen Kuba 1962 ursprünglich aus der OAS ausgeschlossen wurde – nämlich seinem Festhalten am >Marxismus-Leninismus< und seiner Parteinahme >für den kommunistischen Block<. Glaubwürdiger und zutreffender wäre es, sich auf Kubas gegenwärtige Menschenrechtsverletzungen zu konzentrieren, die mit der OAS-Charta unvereinbar waren.«8 Hillary hat eine seltsame Vorstellung von Scheinheiligkeit. Sie sieht nichts Scheinheiliges an der bloßen Auswechselung des Vorwands für den Ausschluss Kubas und sie erwähnt nie die historischen Gründe für die Feindschaft, die da sind: die Enteignung des Eigentums von USFirmen, um Ressourcen für wirtschaftliche Entwicklung, Sozialleistungen, Bildung und eines der besten freien Gesundheitssysteme der Welt zu gewinnen; und der intensive politische Druck der kubanischen Diaspora in den USA. Sie sieht auch nichts Scheinheiliges an der Erfindung eines fadenscheinigen Tricks, durch den Kuba ausgeschlossen bleibt, während man vorgibt, es wieder aufzunehmen: »Wie wäre es, wenn wir dem Ende der Suspendierung zustimmten, aber unter der Bedingung, dass Kuba seinen Sitz nur dann zurückbekäme, wenn es im Einklang mit der Charta demokratische Reformen durchführte? Und warum sollten wir, um die Verachtung der Brüder Castro für die OAS zu entlarven, nicht verlangen, dass Kuba selbst in aller Form die Wiederaufnahme beantragte?«9 Tatsächlich erwies sich dies als gerade scheinheilig genug, um die unentschiedenen Staaten, Brasilien und Chile, davon zu überzeugen, mitzumachen. So begann Hillary also in Lateinamerika ihre diplomatische Karriere. Kennzeichen waren erstens die heuchlerische Umbenennung der 16 Feindseligkeit gegenüber jeder unabhängigen sozio-ökonomischen Politik von »Antikommunismus« in von massivem Druck begleitete »Verteidigung der Menschenrechte« und zweitens die Durchsetzung der Monroe-Doktrin10 im Inneren wie in der internationalen Arena. Während ihres Besuchs in Honduras war Clinton sehr verdrossen über ihren Gastgeber, Präsident Manuel Zelaya. Ihr missfielen sein weißer Cowboyhut, sein schwarzer Schnurrbart und am meisten seine Vorliebe für Hugo Chávez und Fidel Castro. Aber auch hier übte sie sich in Heuchelei: »Ich nahm Zelaya in einem kleinen Raum beiseite und spielte seine Rolle und Verantwortlichkeiten als Gastgeber der Konferenz hoch. Wenn er unseren Kompromiss11 unterstützte, könne er dazu beitragen, nicht nur diesen Gipfel, sondern die gesamte OAS zu retten. Wenn nicht, würde er als der Staatschef in die Geschichte eingehen, der beim Zusammenbruch der Organisation den Vorsitz führte.«12 Hillary verließ Honduras mit einem Gefühl der Zufriedenheit, weil »wir eine überholte Begründung durch einen modernen Prozess [hatten] ersetzen können, der das Engagement der OAS für die Demokratie stärkte«.13 Kurz darauf wurde Präsident Zelaya gestürzt. Der Kontext dieses Putsches macht klar, wodurch er motiviert war. Manuel Zelaya hatte die Klasse, aus der er stammte, verraten. Als Grundbesitzer aus einer reichen, in der Holzindustrie aktiven Familie entwickelte Zelaya populistische Vorstellungen, sein Land aus seinem überkommenen Status als typische Bananenrepublik zu befreien. Honduras ist in eine kleine, eigennützige Klasse von Reichen und eine bettelarme Restbevölkerung gespalten, deren hauptsächliche Hoffnung auf Einkommen im Drogenschmuggel besteht. Die scharfe Konkurrenz in diesem Bereich trägt dazu bei, dass Honduras die höchste Mordrate der Welt hat.14 Der US-amerikanische Luftwaffenstützpunkt in Soto Cano war das Zentrum, von dem zwei der grausamsten »Regimewandel«-Operationen der Geschichte ausgingen: nämlich der Sturz des reformistischen Präsidenten Jacobo Arbenz im nördlich gelegenen Guatemala 1954 und die illegalen Sabotageaktionen der sogenannten Contras gegen den südlichen Nachbarn Nicaragua in den 1980ern. Unterdessen wurden in Honduras die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Nach seiner Wahl im Jahr 2005 wollte Zelaya es anders machen. Mit dem damals durch die Region wehenden Wind der Veränderung im Rücken dekretierte Zelaya trotz des Protestgeheuls der Arbeitgeber eine sechzigprozentige Anhebung des Mindestlohns. Er kritisierte den US17 gesteuerten »Anti-Drogen-Krieg« als Vorwand für ausländische Interventionen und schlug einen neuen Ansatz für das Drogenproblem vor, der sich auf Suchttherapie und Eindämmung der Nachfrage konzentriert. Zugleich war er der Meinung, Soto Cano solle in einen internationalen Zivilflughafen umgewandelt werden. 2007 machte Zelaya als erster honduranischer Präsident seit 1961 Jahren einen Staatsbesuch in Kuba, wo er mit Raúl Castro über politische Fragen diskutierte. Am unverzeihlichsten in den Augen der USA war jedoch, dass er der »Bolivarischen Alternative für die Völker unseres Amerikas« (ALBA) beitrat, die 2004 von Kuba und Venezuela gegründet wurde und auf eine Idee von Hugo Chávez zurückgeht.15 Diese Annäherung an Kuba und Venezuela versprach echte wirtschaftliche Vorteile für Honduras. 2008 schickte Washington Hugo Llorens als Botschafter nach Tegucigalpa. Dieser war während des von den USA unterstützten, fehlgeschlagenen Putschversuchs gegen Hugo Chávez 2002 Direktor des Nationalen Sicherheitsrats für Fragen der Andenstaaten gewesen. Llorens wurde 1954 in Kuba geboren und war 1961 eines von über 14 000 unbegleiteten Kindern, die im Rahmen der Operation »Peter Pan« von der revolutionären Insel in die Vereinigten Staaten gebracht wurden, um sie vor »kommunistischer Indoktrinierung« zu retten. Im Mai 2009 bildete sich eine »Demokratische Zivilunion von Honduras«, gegründet von »zivilgesellschaftlichen« Organisationen, von denen viele von der US-finanzierten Stiftung »National Endowment for Democracy« (NED) Zuwendungen zur »Förderung der Demokratie« erhielten, mit dem Ziel, Zelaya loszuwerden. Ihre Kampagne konzentrierte sich auf den Vorschlag Zelayas, bei den bevorstehenden Wahlen im November 2009 per Referendum abstimmen zu lassen, ob 2010 eine Versammlung zur Überarbeitung der Verfassung abgehalten werden sollte oder nicht. Nach den Vorstellungen Zelayas sollte diese durch ein Verhältniswahlrecht, die Möglichkeit, Abgeordnete abzuberufen und erweiterte Rechte für ethnische Minderheiten demokratisieren. Die Verfassung von 1982, die zwölfte des Landes in seiner 144-jährigen Geschichte, enthielt unter anderem das Verbot, mehrmals für das Präsidentenamt zu kandidieren. Obwohl sie seit 1982 schon über zwanzigmal vom Kongress geändert worden war, stellte die reaktionäre Oligarchie des Landes Zelayas Vorschlag als kriminellen Versuch zur Änderung von »in Stein gemeißelten Artikeln« hin, nur um den Weg für die eigene Wiederwahl freizumachen. Kurz: Der Vorschlag wurde als Mittel dargestellt, dass es Zelaya ermöglichen sollte, sich genau wie der gewählte »Diktator« Venezuelas 18 Hugo Chävez durch Wahlen zum »Diktator« aufzuschwingen. Am 23. Juni veröffentlichte die Zivilunion eine Erklärung, in der es hieß, man vertraue darauf, dass »die Streitkräfte Verfassung, Recht, Frieden und Demokratie verteidigen werden«. US-Botschafter Llorens fügte der Kampagne das Gewicht der offiziellen Unterstützung seines Landes hinzu, indem er erklärte, es sei unzulässig, »einfach die Verfassung zu verletzen, um eine andere an ihre Stelle zu setzen. Denn wenn wir die Verfassung nicht achten, leben wir alle unter dem Gesetz des Dschungels.«16 Das honduranische Militär verstand dies nur zu gut als grünes Licht dafür, die Verfassung zu verletzen, um sie zu retten. Am frühen Morgen des 28. Juni fiel eine Hundertschaft Soldaten in Zelayas Schlafzimmer ein und verschleppte ihn nach Costa Rica, ohne ihm auch nur zu erlauben, sich anzuziehen. Den Präsidenten im Schlafanzug aus dem Amt zu schleifen, war als besonderes Zeichen der Missachtung gemeint. Der Anführer des Militärputsches, General Romeo Väsquez Veläsquez, war Absolvent der berüchtigten School of the Americas in Fort Benning, Georgia, an der eine lange Liste weiterer Putschisten und Folterer Lateinamerikas ausgebildet wurde. Das honduranische Militär erklärte, es sei »verpflichtet« gewesen, Präsident Zelaya von der Macht zu entfernen, da er aufgrund seiner linken Ideologie und seines Bündnisses mit Venezuela und Kuba eine »Gefahr« darstelle. Hillary zufolge trafen sie die Ereignisse unvorbereitet und sie wusste von nichts, als ihr Abteilungsleiter für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, Tom Shannon, ihr von der Krise berichtete. »Er schilderte mir, was bislang bekannt war (nicht viel).«17 Das war eigenartig, da, wie sich später herausstellte, Shannon und der Staatssekretär im Außenministerium Craig Kelley eine Woche zuvor in Honduras gewesen waren und sich mit genau denjenigen Zivilisten und Militärs getroffen hatten, die den Putsch ausführten. Sie behaupteten später, sie seien dort gewesen, um »davon abzuraten«. Daneben konnte Hillary auf die Expertise von John Negroponte zählen, dem berüchtigten Ex-Botschafter der USA in Honduras während der Contra-Zeiten, den sie Berichten zufolge als Sonderberater angeheuert hatte. Negroponte war erst kurz zuvor in Tegucigalpa gewesen, um Zelaya zu drängen, den Status des wichtigen US-Luftwaffenstützpunktes unverändert zu lassen. Nun war es an Clinton, »smart power« einzusetzen – sie bezeichnete den Staatsstreich einfach nie als solchen. Stattdessen handelte es sich bei den Ereignissen um eine »Krise« oder das »erzwungene Exil« des Präsidenten, was die USA dazu veranlasste, »alle Parteien« zur Lösung ihrer Differenzen »friedlich und durch Dialog« aufzufordern.18 19 Während Zelaya seine Wiedereinsetzung forderte, betrieb Hillary eine Vermittlung zwischen den »beiden Seiten«, dem ins Exil in Costa Rica verschleppten, gewählten Präsidenten und dem »zeitweiligen Interimspräsidenten« Roberto Micheletti, der durch den Putsch ins Amt gelangt war. Es war letztlich ein Streit zwischen Kräften, die die Verfassung verletzt hatten, und dem Mann, den sie beschuldigten, er habe dies tun wollen. Am Ende behielten unbewiesene Beschuldigungen hinsichtlich böser Absichten gegenüber bekannten Tatsachen die Oberhand – ein Muster, das sich in Hillarys Karriere wiederholen sollte, besonders im Fall Libyens. In Entscheidungen stellt sich Hillary implizit hinter den Vorwand der Putschisten, wenn sie schreibt: »Ein weiterer Diktator wäre der Region sicher nicht dienlich gewesen – und viele kannten Zelaya gut genug, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu glauben. Aber er war der vom honduranischen Volk gewählte Präsident. […] Ich sah keine andere Wahl, als die Absetzung Zelayas zu verurteilen. In einer öffentlichen Stellungnahme rief ich alle Parteien in Honduras auf, sie sollten die verfassungsmäßige Ordnung und die Gesetze respektieren und sich verpflichten, politische Streitigkeiten friedlich und durch Dialog beizulegen.«19 Später lobte das Außenministerium das honduranische Militär dafür, dass es »während dieses Prozesses als Garant der öffentlichen Ord-nung«20 aufgetreten sei – wenn auch, nebenbei bemerkt, weder »friedlich« noch »durch Dialog«. Unterdessen pilgerten Vertreter der neuen Micheletti-Regierung nach Washington, um einem höchst empfänglichen Kongress und der USPolitikerkaste ihre Gründe für die »Rettung der Demokratie vor einem neuen Chávez« darzulegen. Kundige Unterstützung hatten die Verteidiger des Putsches dabei von dem Top-Lobbyisten und Anwalt Lanny Davis, einem Mitglied des inneren Kreises der Clintons, zu dessen langjährigen Klienten der honduranische Landesverband des »Business Council of Latin America« und Bill Clinton selbst gehören, für den er bei dem im Zuge des Monica-Lewinsky-Skandals gegen den Präsidenten eingeleiteten Amtsenthebungsverfahren als Sonderberater tätig gewesen war.21 Im Versuch, Zeit zu gewinnen, entwarf Hillary »eine Strategie, wie die Ordnung in Honduras wiederhergestellt und freie und faire Wahlen rasch und rechtmäßig abgehalten werden konnten, so dass der Konflikt um Zelaya irrelevant würde und das honduranische Volk eine Chance hätte, über die eigene Zukunft zu entscheiden«.22 20 Zelaya kam nie wieder ins Amt. Die Honduraner hatten nun die Chance, ihre Zukunft zu wählen – so lange diese in etwa genauso wie ihre Vergangenheit aussieht. »Honduras« ist das spanische Wort für »Tiefen«, und in politischer Hinsicht verdient dieses verarmte Land seinen Namen auch heute noch. Als Zelaya erst einmal weg war, zog sich Honduras rasch aus der ALBA zurück. Unsere »Mindestforderung«, so Hillary gegenüber dem costaricanischen Präsidenten Arias, »sind freie, faire demokratische Wahlen mit einer friedlichen Machtübergabe«.23 Und am 29. November 2009 gab es dann auch einen Wahlgang, um »den Konflikt um Zelaya irrelevant zu machen«. Ein Großteil des Wahlkampfes zu diesen »freien, fairen« Wahlen wurde durch ein befristetes Dekret Michelettis scharf beschränkt, mit dem er fünf Rechte genau der Verfassung außer Kraft setzte, die die Putschisten so begierig verteidigt hatten: nämlich die Rechte auf persönliche Freiheit, freie Meinungsäußerung, Bewegungsfreiheit, ein faires Gerichtsverfahren und Vereinigungsfreiheit. Zur »Neutralisierung« der neugebildeten »Nationalen Widerstandsfront«, die zum Wahlboykott aufrief, um gegen den Putsch vom 28. Juni zu protestieren, wurden über dreitausend Soldaten und Polizisten aufgeboten. Der Wahlkampf war durch Einschüchterung, Straßengewalt, mindestens einen Todesfall und das Verschwindenlassen politischer Gegner gekennzeichnet. Angestellte wurden vor die Alternative gestellt, zur Wahl zu gehen oder ihre Arbeit zu verlieren. Trotz all diesen Drucks ging mit 49 Prozent nur knapp die Hälfte der Honduraner zur Wahl. Aber »Ende gut, alles gut«: Der Gewinner war Porfirio »Pepe« Lobo Sosa, der Kandidat der National-Partei, der in der vorigen Wahl von Zelaya geschlagen worden war. Die Regierungen Argentiniens, Boliviens, Brasiliens, Chiles, Ecuadors, Guatemalas, Kubas, Nicaraguas, Paraguays, Spaniens, Uruguays und Venezuelas lehnten es ab, das Ergebnis anzuerkennen, aber Washington hatte nichts einzuwenden. Hillary Clinton pries Lobos Wahl als »Wiederaufnahme einer demokratischen und verfassungsmäßigen Regierungsform«.24 »Seit Porfirio >Pepe< Lobo im Januar nach einer Wahlfarce, aus der sich die Oppositionskandidaten zurückzogen, Präsident von Honduras wurde, hat er ausprobiert, wie weit er und die Eliten des Landes gehen können, und allmählich immer mehr Gewalt gegen die Opposition ausgeübt«, schrieb die Historikerin Dana Frank neun Monate später. »Paramilitärische Meuchelmorde und Todesdrohungen gegen oppositionelle Gewerkschafter, politisch aktive Landarbeiter und 21 Feministinnen sind weiter an der Tagesordnung und bleiben komplett straflos.«25 Bei den folgenden Wahlen im November 2013 hatten die Honduraner ein weiteres Mal die Freiheit, ihre triste Vergangenheit als ihre triste Zukunft zu bestätigen. Laut der Menschenrechtsgruppe Rights Action26 waren tatsächliche oder mögliche Kandidaten und ihre Familien oder Unterstützer in der Zeitspanne zwischen Mai 2012 und Oktober 2013 Opfer von 36 Morden und 24 bewaffneten Überfällen. 59 Prozent der befragten Honduraner gingen davon aus, dass das Wahlergebnis gefälscht würde. Inmitten von Vorwürfen über Fälschungen und Einschüchterungen gewann Juan Orlando Hernández mit 37 Prozent der Stimmen. Xiomara Castro, die Frau des abgesetzten Präsidenten Zelaya, wurde mit etwa 29 Prozent Zweite. Hier verpasste die große Feministin Hillary Rodham Clinton die Chance, auch in Honduras einen Beitrag zum »Durchbrechen der gläsernen Decke« zu leisten, indem sie für die Wahl einer charismatischen Frau warb. Juan Orlando Hernández dagegen, ein reicher Kaffeeplantagenbesitzer und Medienmogul, hatte nicht nur den Putsch gegen Castros Gatten enthusiastisch unterstützt, sondern außerdem auch die richtigen Freunde in Washington. Nachdem sie sich die Kontrolle über das Präsidentenamt wieder gesichert hatte, vollzog die herrschende National-Partei übrigens einen Sinneswandel im Hinblick auf die als Vorwand für den Sturz Ze-layas benutzten »in Stein gemeißelten« Verfassungsartikel. Auf Verlangen der Partei verletzte nun der Oberste Gerichtshof von Honduras selbst die Verfassung, indem er die Artikel, die eine zweite Präsidentschaftskandidatur untersagten, einfach strich. Bei einem Treffen mit Geschäftsleuten in Miami wischte Präsident Juan Orlando Hernández Einwände mit dem Kommentar beiseite, Wiederwahlen seien doch »in vielen Ländern der Welt längst die Regel«.27 Laut Dana Frank sind »Gangs in Honduras allgegenwärtig. Aber die allergefährlichste Gang ist die honduranische Regierung.« Seit dem Sturz Zelayas, so Frank, habe »eine Reihe korrupter Administrationen eine offen kriminelle Kontrolle über Honduras installiert, die den Staat von oben bis unten durchzieht.« Auch die Gerichte und Staatsanwälte sind oft korrupt: »Mörder und andere Gewaltverbrecher werden selten vor Gericht gestellt«, berichtet Human Rights Watch. »Im Resultat hat Honduras seit dem Putsch laut Zahlen der Vereinten Nationen die höchste Mordrate der Welt.«28 Viele der Opfer sind Kinder. In den beiden Jahren nach dem Coup sanken die Ausgaben für 22 öffentlichen Wohnungsbau, Gesundheit und Bildung, während extreme Armut um 26,3 Prozent zunahm. Im Mai 2014 wurde etwa die gesamte staatliche Einrichtung für Kinderinteressen geschlossen und ihr gesamtes Vermögen liquidiert. In der Huffington Post vom 7. September 2014 schreibt Frank dazu: »Vor dem Hintergrund der Arbeitslosigkeit und des Fehlens einer funktionierenden Strafjustiz haben sich wahrhaft furchterregende Gangs ausgebreitet und der Drogenhandel führt zu spektakulärer Gewalt, darunter immer mehr Massaker an Kindern. […] Laut Casa Alianza, der führenden unabhängigen Organisation für den Schutz obdachloser Kinder, wurden allein im Mai 2014 104 Kinder getötet; zwischen 2010 und 2013 wurden 458 Kinder unter fünfzehn Jahre ermordet. Am 6. Mai erhob Jose Guadelupe Ruelas, der Direktor von Casa Alianza, die Beschuldigung, die Polizei betreibe zur >sozialen Säuberung< 29 Todesschwadronen, die Kinder töten.« Die Lage für Kinder und Jugendliche ist so schlimm, dass der Zustrom unbegleiteter Jugendlicher aus Honduras für die USA zu einem zusätzlichen Einwanderungsproblem geworden ist. Im Sommer 2014 stellten Kinder aus Honduras das größte Kontingent der etwa 47 000 unbegleiteten Minderjährigen, die beim Versuch, in die Vereinigten Staaten zu kommen, festgenommen wurden.30 Als sie am 17. Juni 2014 bei einem von CNN übertragenen TownHall-Meeting gefragt wurde, was man mit den Tausenden von Minderjährigen aus Honduras und seinen Nachbarländern tun solle, die um Asyl in den USA ersuchten, räumte Hillary zwar ein, die Kinder seien auf der Flucht vor »exponentiell wachsender Gewalt«. Dennoch »sollten sie zurückgeschickt werden, sobald bestimmt werden kann, wer die sorgeberechtigten Erwachsenen in ihren Familien sind«, so Clinton. »Wo immer möglich, sollten sie wieder mit ihrer Familie zusammengeführt werden.«31 Und weiter sagte sie: »Wir müssen eine klare Botschaft senden: Nur weil dein Kind es über die Grenze geschafft hat, heißt das nicht, dass es bleiben kann.« Müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass Hillary ihre Karriere als Anwältin für »Kinderrechte« begann? Es ist interessant, den Feuereifer der USA in den 1960ern, Tausende von unbegleiteten Kindern zur Rettung vor »kommunistischer Propaganda« aufzunehmen, mit ihrem heutigen Unwillen zu vergleichen, Kinder ins Land zu lassen, die um ihr Leben fliehen. 23 Seit der unerfahrene Populist Manuel Zelaya, der den Versuch wagte, das Los seines Volkes zu verbessern, im Schlafanzug aus dem Amt gekarrt wurde, hat sich die Lage in Honduras beständig verschlimmert. Größere Armut, höhere Kriminalität, immer mehr Morde – so viele Morde und so wenige Festnahmen und Anklagen, dass es unmöglich ist, die Drogenmorde von den politisch motivierten Morden durch Polizei und Militär zu unterscheiden. Wenn an einem elenden Ort wie Honduras einmal ein »weißer Ritter« am Horizont auftaucht und seine Absicht verkündet, die Lage verbessern zu wollen – könnten da die reichen und mächtigen USA nicht vielleicht einmal anders reagieren als mit der Stigmatisierung des Anwärters als potentiellem »Diktator«? Statt einem Verfechter von Veränderungen wenigstens die Chance zu geben, es zu versuchen, trug Hillarys Außenministerium vielmehr aktiv dazu bei, ihn rasch aus dem Amt zu befördern. Der Normalzustand ist wiederhergestellt – allerdings auf einem Niveau noch unterhalb der vorherigen Zustände. Oberflächlich betrachtet handelt es sich beim Sturz Manuel Zelayas – verglichen mit anderen US-Operationen – um einen relativ milden »Regimewandel«. Dessen wahre Gewalt kam erst später, mit den ungesühnten Morden an Oppositionellen und Kindern, zum Vorschein. Aber wie im Fall anderer US-unterstützter Interventionen in das politische Leben schwächerer Länder war das Ergebnis Chaos, das Chaos von Armut, Kriminalität und Hoffnungslosigkeit. Unter dem Vorwand, den gewählten Präsidenten daran zu hindern, ein »Diktator« zu werden, leisteten Hillary und ihre Kollegen ihren Beitrag zur Festigung der langjährigen Diktatur der USA über die südliche Hemisphäre. Die Monroe-Doktrin, einst proklamiert zum Schutz des amerikanischen Kontinents vor äußeren Mächten, ist in der Praxis längst eine Lizenz für die Vereinigten Staaten, die Bewohner der Hemisphäre vor sich selbst und ihren »Irrtümern« zu schützen. Wie wir im Lauf dieses Buches immer wieder sehen werden, läuft die Außenpolitik Hillary Clintons auf die Anwendung einer erweiterten Version der Monroe-Doktrin auf die ganze Welt hinaus. 24 1 Der Ritt auf dem Tiger: Hillary Clinton und der MilitärischIndustrielle Komplex Im April 2014 kam eine für die Universitäten Princeton und Northwestern durchgeführte, wissenschaftlich geprüfte Studie zu dem Schluss, die USA seien keine Demokratie, sondern eine von »Wirtschaftseliten« geführte »Oligarchie«. Das ist für jeden, der solchen Themen Aufmerksamkeit schenkt, seit geraumer Zeit klar gewesen, aber eine akademische Studie kann dennoch zur endgültigen Klärung beitragen. Der Bericht trug den Titel »Theorien zur amerikanischen Politik auf dem Prüfstand: Eliten, Interessengruppen und Durchschnittsbürger«1 und verglich knapp 1 800 wichtige politische Entscheidungen zwischen 1981 und 2002. Er kam zu dem Ergebnis, dass dabei die Wünsche der Reichen und Mächtigen so gut wie immer erfüllt wurden. Konkret heißt das, dass die politischen Vorlieben der 10 Prozent der Bürger mit den höchsten Einkommen in die Tat umgesetzt wurden, während die Wünsche der Durchschnittsamerikaner, deren Einkommen im mittleren Bereich, liegt weitgehend ignoriert wurden. Die Wissenschaftler schrieben: »Unser zentrales Forschungsresultat besagt, dass ökonomische Eliten und organisierte Gruppen, die dieselben Interessen vertreten, erheblichen unabhängigen Einfluss auf die Politik der US-Regierung haben, während Interessengruppen der Bevölkerung und Durchschnittsbürger wenig oder keinen unabhängigen Einfluss haben. Wenn eine Mehrheit der Bürger etwas anderes will als die wirtschaftlichen Eliten und/oder organisierte Interessen, kann sie sich meist nicht durchsetzen. Außerdem sorgt die starke Fixierung des politischen Systems der USA auf den Status Quo dafür, dass selbst große Mehrheiten, sobald sie für Veränderungen eintreten, diese kaum je einmal bekom-men.«2 25 Nur wenn die weniger wohlhabende Mehrheit zufällig dasselbe will wie das oberste Zehntel, hat sie eine echte Chance, es auch zu bekommen, so die Studie. Diese Kluft ist nicht neu, da die Reichen schon immer durch persönlichen Kontakt und Einfluss auf die Politiker einwirken konnten, die die Gesetze beschließen und den Staat führen. Durch einige der jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes der USA, die das Limit für Wahlkampfspenden erhöhen, sowie durch die Verlängerung der Vorwahlen zum Präsidentschaftswahlkampf, die die Auswahl der Kandidaten angeblich »demokratischer« machen soll, ist diese Kluft wohl noch größer geworden. Tatsächlich bieten die verlängerten Vorwahlen jetzt noch mehr Möglichkeiten zur Beeinflussung der Kandidatenwahl durch Geld, während gleichzeitig der Einfluss der Parteimitglieder darauf und auf die Festlegung des politischen Programms weiter reduziert wird. Das Zweiparteiensystem der USA bietet den Wählern alle vier Jahre lediglich die Wahl zwischen zwei Kandidaten, die sorgfältig von Milliardären und Lobbyisten der Großkonzerne und Finanzinteressen geprüft wurden. Dabei gibt es einen »bösen Cop«, die Republikanische Partei, und einen »guten Cop«, nämlich die Demokraten. Alle spielen ihre Rollen. Aber ganz unabhängig davon, wie sie bei den Wählern ankommen, besteht die wichtigste Aufgabe aller Politiker, die sich für einen der beiden exklusiven Kandidatenposten bewerben, darin, sich als die beste Anlagemöglichkeit für Spender zu präsentieren. Diese wiederum erwarten für ihr Geld, dass sie das bekommen, was sie wollen. So ist im Inneren des Landes keine wirklich progressive oder egalitäre Politik möglich. So viel sie auch streiten mögen, beide Parteien haben akzeptiert, dass die Innenpolitik den Interessen des Finanzkapitals (»der Märkte«) entsprechen muss. Ein perfektes Beispiel dafür ist die Gesundheitsreform: In den USA wurde die einheitliche staatliche Krankenversicherung, die in etlichen anderen Ländern gut funktioniert, nie ernsthaft in Erwägung gezogen, sondern automatisch als »sozialistisch« verdammt. Stattdessen gab man einem komplizierten und extrem teuren System den Vorzug, von dem hauptsächlich die privaten Versicherungsgesellschaften profitieren. Kurz, die innenpolitische Macht des Präsidenten ist heute sehr begrenzt. Die internationale Bühne hingegen bietet ihm die Gelegenheit, große Macht auszuüben – oder zumindest diesen Anschein zu erwecken. Dieser Kontrast ist an Hillary Rodham Clintons erster Zeit im Weißen Haus als Ehefrau und »Co-Präsidentin« Bill Clintons gut zu sehen. Ihr mit großem Pomp angekündigter Plan zur Reform des Gesundheitssystems 26 erwies sich am Ende als Fiasko. Abgesehen von ihren eigenen Fehlern war dieses Scheitern letztlich das zwangsläufige Ergebnis des Versuchs, ein staatliches Gesundheitssystem zu schaffen, das zugleich den Anteilseignern privater Versicherungsgesellschaften große Profite bringen sollte. Obama-Care leidet unter genau demselben Widerspruch. Angesichts der gegenwärtigen finanziellen und ideologischen Kräfteverhältnisse bleiben progressive Reformen im Inneren meist ohnmächtige Versuche. Aber in der Außenpolitik verfügt der Präsident der USA über enorme Macht. Auch und vor allem über die Macht zur Zerstörung. Dennoch macht sie erheblichen Eindruck, besonders auf amerikanische Wähler. Wenn man sich der Präsidentschaft Bill Clintons nicht ausschließlich wegen Monika Lewinsky erinnert, dann vor allem wegen der destruktiven Gewalt, mit der Clinton den Irak, den Sudan und den Balkan überzog. Die Sanktionen und Bombenangriffe gegen diese Länder mussten nur noch mediengerecht als »Verteidigung der Menschenrechte« oder »Widerstand gegen Diktatoren« verpackt werden, und schon verschwanden die innenpolitischen Pleiten hinter der Grandeur des Kampfes gegen das Böse in der restlichen Welt. Wie es dazu kam Um das Jahr 1950 herum haben die USA sich selbst eine ökonomische Falle gebaut, aus der ein Entkommen mittlerweile kaum noch möglich scheint. In seiner Abschiedsrede als Präsident am 17. Januar 1961 gab Dwight D. Eisenhower dieser Falle einen Namen: Er sprach vom »Militärisch-Industriellen Komplex« (MIK).3 Die Geburt dieses Monstrums kann auf die Resolution des Nationalen Sicherheitsrats S. 68 (NSC-68) zurückgeführt werden, die Präsident Harry S. Truman am 14. April 1950 vorgelegt wurde. Das Dokument war hochgeheim und wurde erst 1975 freigegeben. Hauptautor war der in der Öffentlichkeit unbekannte, wohlhabende und hochgebildete Investmentbanker Paul Nitze. Er fasste darin einen Konsens der USamerikanischen herrschenden Elite zusammen, der eine einschneidende Abwendung von den Sozialprogrammen des New Deal zugunsten einer Politik endloser Aufrüstung bedeutete. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs standen die USA vor allem wegen der kriegsbedingten Verarmung ihrer Handelspartner in Übersee vor der Gefahr, wieder zurück in die Depression zu rutschen. Also war ein keynesianischer 27 Stimulus nötig, aber die Elite lehnte eine Rückkehr zu zivilen öffentlichen Ausgaben ohne weitere Diskussion ab und zog stattdessen Militärausgaben vor. Um den Kongress und die Bevölkerung hierfür zu gewinnen, musste man die »sowjetische Bedrohung« übertreiben. In Wirklichkeit war der Kommunismus in Westeuropa, also westlich der sowjetisch besetzten Pufferzone, nicht einmal politisch eine ernsthafte Gefahr. Und auch militärisch war das nicht der Fall, da die Sowjetunion unter Stalin (unter Ignorierung der Proteste Trotzkis aus dem Exil) die Doktrin der »permanenten Revolution« längst aufgegeben hatte und sich nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs auf den Wiederaufbau und die Schaffung von Verteidigungskapazitäten gegen eine befürchtete Aggression des kapitalistischen Westens konzentrierte. NSC-68 aber behauptete, die UdSSR sei immer noch »von dem fanatischen Willen geleitet, […] der übrigen Welt ihre absolute Macht aufzuzwingen«.4 Danach wurden Verträge mit dem Pentagon zum Lebenselixier der USWirtschaft, was Auswirkungen auf alle Wahlbezirke und praktisch sämtliche Lebensbereiche hatte, besonders auch auf die Universitäten, die den Zustrom von Drittmitteln begrüßten, ohne sich um die weitreichenden Auswirkungen zu kümmern. So legte NSC-68 ohne jede öffentliche Diskussion auf Generationen den politischen Kurs der USA fest. Der »Kalte Krieg« war schon 1947 von dem US-Börsenbroker Bernard Baruch verkündet worden, der in einer Rede vor dem Kongress South Carolinas die angebliche kommunistische Gefahr als Argument gegen die Forderungen der Arbeiterbewegung in der Nachkriegszeit einsetzte: Baruch verlangte die »Einheit« von Arbeitern und Unternehmern, längere Arbeitszeiten und Anti-Streik-Versprechen der Gewerkschaften, da »wir heute inmitten eines Kalten Krieges sind«.5 Die weitgehend erfundene und sicherlich übertriebene »sowjetische Gefahr« wurde dann sowohl zur Überredung des Kongresses, Mittel für das Pentagon zu bewilligen als auch zur Zähmung der Arbeiterbewegung benutzt. Dieser lastete man ihre Verbindungen zur Kommunistischen Partei der USA an, die in Wirklichkeit aber nie für etwas anderes eine Gefahr war als für die Rassentrennung im Süden – die sie auch weiterhin, oft unter anderem Namen, beharrlich bekämpfte. Wir sollten nicht vergessen, dass dieser historische Wendepunkt im Verborgenen von einer Elite bewerkstelligt wurde, die düstere Warnungen vor »Gefahren« einsetzte, um jede demokratische Debatte über den künftigen Kurs des Landes von vornherein abzuwürgen. Mit an Bord waren die Medien, deren Auslandsberichte die Welt als nicht enden 28 wollenden Wettstreit zwischen Freiheit und Kommunismus darstellten. Der in NSC-68 fixierte Kalte Krieg war die praktisch unhinterfragte Leitlinie der US-Außenpolitik, bis Michail Gorbatschow den entscheidenden Schritt zu seiner Beendigung tat. Die »sowjetische Gefahr« war allerdings so wichtig für die US-Politik geworden, dass ein Großteil des herrschenden Establishments darauf mit Skepsis, Argwohn oder sogar Feindseligkeit reagierte. Was sollen wir ohne sie bloß machen? Der Anstoß für den Frieden kam aus Moskau. Die sowjetische Elite war ganz offensichtlich zu dem Schluss gekommen, es sei besser für sie, ihr Machtsystem zu lockern und ihre Pufferzone in Osteuropa aufzugeben, um so eine friedliche Partnerschaft mit dem Westen zu erreichen. Zu diesem Glauben veranlasst hatte sie vor allem die deutsche Friedensbewegung Anfang der 1980er Jahre, die den Eindruck erweckte, die Nachkriegsgenerationen des Landes hätten sich von aggressiven deutschen Absichten gen Osten verabschiedet. Die westlichen Medien haben diesen bedeutenden russischen Friedensschritt praktisch aus der Geschichte radiert, indem sie das Ende des Kalten Krieges auf ein einziges Symbol reduzierten: den »Fall der Berliner Mauer«. Dabei war er mehr ein Bühnenstück als ein historisches Ereignis. Das entscheidende Ereignis fand weit früher statt: Es war Gorbatschows Besuch in der westdeutschen Hauptstadt Bonn im Juni 1989, bei dem Moskau die Deutsche Demokratische Republik fallenließ. Die Schnüffelei der Stasi gegen viele Ostdeutsche, vor allem Intellektuelle, einmal beiseite genommen, war die DDR zweifellos das authentisch sozialistischste und wirtschaftlich erfolgreichste aller Mitglieder des Warschauer Pakts gewesen.6 Nach Moskaus Beschluss zur Zulassung einer Wiedervereinigung Deutschlands war die Berliner Mauer überholt und ihr »Fall« im November war nur das unvermeidliche Resultat. Die Fixierung auf »den Fall der Berliner Mauer« erweckt den Eindruck, die Veränderungen in Osteuropa gingen vor allem oder sogar ausschließlich auf die Volksbewegungen gegen den Kommunismus zurück. Diese Interpretation unterschlägt die historische Bedeutung der Entscheidung der sowjetischen Führer. Vom Kalten Krieg zur globalen Führung Der von innen herbeigeführte Kollaps der Sowjetunion öffnete die 29 Aussicht auf eine neue Ära der internationalen Zusammenarbeit, der Abrüstung und des Friedens. Gerade Moskau forderte Washington dringlich auf, einer gegenseitigen nuklearen Abrüstung zuzustimmen. Aber der MIK hatte inzwischen längst nicht nur das ganze Land, sondern auch dessen Mentalität in einem eisernen Griff. Es hätte ungewöhnlicher Ereignisse – oder ungewöhnlicher Führer -bedurft, um die Wirtschaft der USA vom MIK zu befreien und ökonomische Mittel in konstruktive zivile Aktivitäten im Innern des Landes umzuleiten. Das wäre am leichtesten während der Präsidentschaft Bill Clintons möglich gewesen. Aber statt auf eine Politik des Friedens umzuschwenken, begann die Clinton-Administration eine neue Periode des endlosen Krieges. Das geschah vermutlich nicht mit Absicht oder auch nur bewusst. Ein Präsident ohne klare außenpolitische Vorstellungen wird, wenn er auf unerwartete Ereignisse an unbekannten Orten reagieren muss, unvermeidlich von Beratern manipuliert, die sehr wohl eine Agenda haben. In der US-Oligarchie ist der Präsident der zeitweise Vorstandsvorsitzende, der die öffentliche Verantwortung für gemeinsame Entscheidungen übernimmt. Seine Funktion ist eher, Entscheidungen zu verkaufen, als sie zu treffen. Große Machtkonzentrationen wie der MIK benötigen eine gewisse Kontinuität. Der MIK kann sich nicht alle vier Jahre zum Spielball opponierender Kräfte machen. Eine Verringerung der Militärausgaben würde die Frage aufwerfen, welche profitablen Alternativen es zu den MIK-Verträgen mit ihren enormen staatlich garantierten Gewinnen gibt. Aber der MIK braucht nicht nur Profite. Zu seiner weiteren Vorherrschaft bedarf er ständiger ideologischer Rechtfertigungen, und sei es nur, um seine Hauptakteure – besonders im Militär, wo der Glaube an eine Mission eine vitale Notwendigkeit ist – zufriedenzustellen. Kongressabgeordnete und Wirtschaftsmagnaten mögen mit Stimmen beziehungsweise Profiten zufrieden sein, aber von Offizieren und Soldaten erwartet man die Bereitschaft, für die Sache zu sterben. Sie und ihre Familien brauchen also eine Inspiration. Die bloße Existenz der enormen militärischen Macht des Pentagon hat eine ganze Gemeinde von »Verteidigungsexperten« hervorgebracht, die sich mit genau dieser Aufgabe beschäftigen. Diese »organischen Intellektuellen« des MIK sind immer auf der Ausschau nach »Gefahren« und »Missionen«, um die Existenz dieses aufgeblähten Destruktionspotentials rechtfertigen zu können. Nach dem Verschwinden der »kommunistischen Gefahr« fiel diese 30 Aufgabe vor allem den Washingtoner Denkfabriken zu, privat finanzierten Politikinstituten, die seit den 1970er Jahren immer zahlreicher wurden. In der Ära nach Gorbatschow wurden sie kreativer und gewannen an Einfluss. K Street und Dupont Circle heißen die Zentren, wo außenpolitische Ideen erarbeitet werden, und sie sind eng mit den Meinungsseiten der großen Zeitungen verbunden. Diese Privatisierung der Formulierung von Politik war eine gute Gelegenheit für reiche Spender, Einfluss zu gewinnen. Die Herkunft der Spenden sorgt wiederum für einen starken Rechtsdrall der führenden Denkfabriken. Letztere stehen mittlerweile in gewaltigem Maß unter dem Einfluss großzügiger pro-israelischen Spender und aktiv pro-israelischer Intellektueller. Die berüchtigtsten Vertreter der aktiv pro-israelischen Kräfte sind die »Neokonservativen« oder »Neocons«, die zur Hauptkraft bei der Definition der US-Außenpolitik geworden sind. Der Begriff »Neocon« selbst kann getrost als Euphemismus betrachtet werden, da dieses engmaschige Netz von Aktivisten in Wirklichkeit alles andere als »konservativ« ist. Im Gegenteil, das Ziel dieser Leute besteht darin, die Militärmacht der USA zu nutzen, um einschneidende Veränderungen in der Welt herbeizuführen. Sie agieren parteiübergreifend und finden sich immer dort, wo die Macht ist. In den 1970ern hatten sie sich im Büro des demokratischen Senators des Staates Washington, Henry »Scoop« Jackson, eingenistet, der den Spitznamen »Senator Boeing« trug, weil er dem großen Vertragspartner des Pentagon in seinem Heimatstaat so ergeben war. Die weitaus wichtigste von den frühen Neocons erreichte Gesetzesmaßnahme war der von Jackson im Senat und von Charles Vanik im Repräsentantenhaus eingebrachte »Jackson-Vanik-Zusatz« von 1974. Dieser verweigerte Ländern des Sowjetblocks, in denen es aus Angst vor »Braindrain« auch für Juden geltende Ausreisebeschränkungen gab, normale Handels-beziehungen.7 Der Jackson-Vanik-Zusatz führte wichtige neokonservative Themen zusammen, die bis heute relevant sind: den Einsatz der Macht der USA, um anderen Ländern ihre Innenpolitik zu diktieren, die Feindseligkeit gegenüber Russland, die Ergebenheit gegenüber Israel und die Nutzung von »Menschenrechts«-Forderungen als Grund für Sanktionen oder andere Formen der Intervention. Während der Präsidentschaft George W. Bushs wurden die Neocons als Architekten der verheerenden Invasion des Irak berüchtigt. Wichtigster Kopf hinter diesem Krieg war Bushs Staatssekretär für Verteidigungspolitik Paul Wolfowitz, dessen Doktrin sich auf einige simple Annahmen reduzieren lässt. Ihr Kernpunkt ist wohl die irrige 31 Auffassung, Demokratien »führ[t]en keinen Krieg gegeneinander«8 -eine Meinung, die ihre Plausibilität nur dadurch behält, dass wir unsere Widersacher automatisch als »Diktaturen« bezeichnen. Das wiederum führt zu dem trügerischen Schluss, Kriege gegen Diktatoren seien der Weg zur Sicherung des Friedens. Ob es einem gefällt oder nicht, Serbien war 1999 mindestens ebenso »demokratisch« wie jedes andere Land in der Region und Slobodan Milošević war mehrere Male in völlig »demokratischen« Wahlen gewählt worden.9 Dennoch war er ein »Diktator«, weil die USA und die NATO sein Land bombardierten. Jedenfalls konnte Wolfowitz mittels dieses Zirkelschlusses, der mittlerweile Teil der Demokratiedoktrin der US-Außenpolitik ist, George W. Bush überzeugen, dass auch in der Palästinenserfrage der einzige Weg zur Lösung der festgefahrenen Situation die Beseitigung der »Diktatoren« in den Nachbarländern Israels sei. Damit würden diese zu »Demokratien« werden und als solche natürlich Frieden mit dem »demokratischen Israel« schließen. Soweit zum Nahen Osten. Das andere Hauptthema der Neocons ist Russland. Hier fordert die Doktrin, die USA müssten den Aufstieg einer großen rivalisierenden Macht in Eurasien verhindern, oder mit anderen Worten: Russland niederhalten. Versteckt in dem gesamten Ansatz ist eine Rechtfertigung »präventiver« Kriege, das heißt unprovozierter Aggressionskriege – ganz gleich ob es darum geht, den Aufstieg eines Rivalen zu verhindern, einen Diktator loszuwerden oder eine angebliche Gefahr wie (nichtexistente) Massenvernichtungswaffen abzuwehren. In der Bush-II-Ära beherrschten die Neocons das einflussreiche American Enterprise Institute und agierten außerdem noch über ihre eigenen Denkfabriken, vor allem über das »Project for a New American Century«10 (PNAC). Das PNAC löste sich zwar 2006 auf, nachdem sich sein größer politischer Triumph, die Invasion des Irak 2003, letztlich als Blamage herausgestellt hatte. Aber der Einfluss der Neocons begann vor der Amtszeit George W. Bushs und wirkte über sie hinaus. Tatsächlich wurde das PNAC zu Beginn der zweiten Amtszeit Clintons gegründet. In seiner »Prinzipienerklärung« von Juni 1997 wird die Frage gestellt, ob die Vereinigten Staaten »die Entschlossenheit besitzen, ein neues Jahrhundert zu gestalten, das den amerikanischen Prinzipien und Interessen entgegenkommt«. Hier wird einfach vorausgesetzt, die USA hätten die Fähigkeit, »das Jahrhundert zu gestalten«, und daher könne es hierzu ausschließlich an »Entschlossenheit« fehlen. Das PNAC forderte eine Außenpolitik, »die dort kühn und zielgerichtet amerikanische Prinzipien fördert«, und fügte hinzu, es sei »wichtig, Umstände zu 32 gestalten, bevor es zu Krisen kommt, und Gefahren zu begegnen, bevor sie fatal werden«. Die Kriege gegen Serbien, den Irak und Libyen illustrieren diesen Grundsatz, wurden doch alle drei Kriege zur Abwehr künftiger Bedrohungen begonnen, die in Wirklichkeit imaginär waren. Das ist der unverfrorenste Trick der Doktrin vom »Präventivkrieg«: Wir können einen Krieg anzetteln, um etwas zu verhindern, das sowieso nie passiert wäre – aber da es dann nicht passiert, können wir es uns als Verdienst anrechnen, es verhindert zu haben. Kurz: Das PNAC forderte eine Doktrin des Präventivkriegs, die dann auch übernommen und angewendet wurde – mit dem einzigen vorweisbaren Resultat, dass bestehende Regimes und weitgehend auch die von ihnen regierten Länder zerstört wurden. Die PNACPrinzipienerklärung endete mit vier Forderungen: signifikante Anhebung der Verteidigungsausgaben; Festigung der Bindungen an demokratische Verbündete (besonders Israel) und »Konfrontationskurs gegenüber Regimes, die unseren Interessen und Werten feindlich gegenüberstehen« (gemeint sind Regimewandel, angeblich zur Gestaltung einer »demokratischen« Welt); Förderung der politischen und wirtschaftlichen Freiheit im Ausland (Öffnung von Märkten und Intervention in die inneren Angelegenheiten der betroffenen Länder); Akzeptanz der Verantwortung für Amerikas einzigartige Rolle bei gleichzeitiger Erhaltung und Erweiterung einer internationalen Ordnung, die unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Prinzipien begünstigt.11 Der letzte Punkt weist schon auf die heutigen Bemühungen hin, eine »Gemeinschaft der Demokratien« zu schaffen, die sich im Wesentlichen aus der englischsprachigen Welt und Westeuropa sowie Israel zusammensetzt und die mit den Vereinten Nationen rivalisieren und sie letztlich dominieren soll. Sie wird als legitimere Weltautorität als die UN angesehen, da sie »demokratisch« ist, und soll die NATO als globale Polizeimacht einsetzen. Im Februar 1998 schickte ein Ableger des PNAC namens »Commit-tee for Peace and Security in the Gulf«12 einen »Offenen Brief« an Präsident Clinton, in dem er aufgefordert wurde, »freundlich gesinnten« irakischen Oppositionsgruppen beim Sturz Saddam Husseins zu hel-fen.13 Bill 33 Clinton war damals bekanntlich mit anderen Dingen beschäftigt, aber sein Nachfolger sollte genau dieser Politik folgen und hierfür den 11. September 2001 als Vorwand nutzen. Zu den Unterzeichnern des Briefs gehörte ein repräsentatives Spektrum prominenter Neocons wie Elliott Abrams, Robert Kagan, Donald Rumsfeld und Paul Wolfowitz.14 Diese »neokonservative« Linie (die man, als Rückfall in die radikale Anwendung des uralten Gesetzes »Macht ist Recht«, vielleicht besser als »archäo-radikal« bezeichnen sollte) hat mittlerweile die überwältigende Zustimmung der politischen Klasse der USA gewonnen, weil sie ein Vakuum füllt: das Vakuum eines Zwecks für den Militärisch-Industriellen Komplex. Für die Vereinigten Staaten von Amerika, die letztlich eine riesige Insel ohne reale oder auch nur potentielle Feinde sind, besteht keinerlei Notwendigkeit, bis an die Zähne bewaffnet und allzeit bereit zu sein, in Selbst-»Verteidigung« den ganzen Planeten auszulöschen. Besonders seit der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Pakts hatten die USA jede Möglichkeit, die Führung einer Bewegung für die weltweite Abrüstung vor allem von Kernwaffen zu übernehmen; eine Bewegung, der sich die zweite große Nuklearmacht Russland nur zu gerne angeschlossen hätte. Durch die Umlenkung von Ressourcen von destruktiven zu konstruktiven Zwecken hätten die USA zur treibenden Kraft einer Bewegung zum Kampf gegen Analphabetismus und Krankheit sowie zur Schaffung einer verbesserten Infrastruktur etwa mittels neuer Bewässerungskonzepte werden können. Die USA hätten so zur Lösung lokaler Konflikte und zum Näherrücken einer friedlichen Welt beitragen können. Doch die Voraussetzung hierfür wäre eine radikale Umstrukturierung der derzeitigen US-Ökonomie gewesen. Statt Ingenieure und Wissenschaftler zu beauftragen, herauszufinden, wie sich ein so dramatischer Wandel bewerkstelligen ließe, sind die politischen Führer lieber den billigen Sirenengesängen redegewandter Neocons gefolgt, die immer neue Vorwände für die Beibehaltung und Erweiterung der zerstörerischen heutigen »Ordnung« finden. Der Ausdruck »Neocon« ergibt nur dann wirklich Sinn, wenn man damit das neue betrügerische Spiel15 meint, das die Hirne der politischen Führungskaste in den USA vernebelt hat. Die Neocons verdanken ihren Aufstieg ihrer Fähigkeit, eine klare Weltsicht zu propagieren, die den Militärisch-Industriellen Komplex, die äußerst einflussreiche Israel-Lobby und einen großen Sektor der »liberalen« Meinungsführer (vor allem in der Medien- und Unterhaltungsindustrie) zufriedenstellt. Sie alle akzeptieren nur zu gern die weltweite Verteidigung der »Menschenrechte« als legitimen Grund 34 für US-Interventionen in anderen Ländern. Selbst als die Neocons sich durch desaströse Interventionen wie im Irak diskreditiert zu haben schienen, blieb diese Ideologie vorherrschend. Sie verleiht der Militarisierung der US-Gesellschaft durch den MIK, die ansonsten nicht zuletzt auf bürokratischer Trägheit beruht, einen höheren Zweck. Die Idee, die weltweite Führungsrolle der USA sei »notwendig« zur Erfüllung der einzigartigen globalen »Verantwortung« dieser Nation, liefert die Rechtfertigung für die endlose Steigerung der sogenannten »Verteidigungs«-Ausgaben, die in Wirklichkeit der Aufrechterhaltung der Fähigkeit zur militärischen Intervention überall auf der Welt dienen. In Ermangelung eines kommunistischen Schreckgespenstes sagt man nun, wir müssten unsere amerikanischen »Interessen« und »Werte« fördern, wobei die beiden Begriffe als komplementär, wenn nicht sogar als identisch betrachtet werden, kreisen doch beide stark um die Idee der »freie Märkte«. In der von Rüstungskontrakten, AI-PAC16 und der Angst vor der Niederlage bei der nächsten Wahl dominierten Treibhausatmosphäre des außenpolitischen Establishments in Washington liefert diese neokonservative Formel einen simplen Weg, sowohl an die Wahlkampfspender als auch an den ungebildetsten Teil der Wählerschaft zu appellieren. Der Gedanke, die USA seien eine »Ausnahme«, eine Nation, die über allen anderen (und über dem Recht) stehe, ist ein Echo der traditionellen, quasi-religiösen Auffassung von den USA als »Gottes eigenem Land«. »So viel wie nötig« Auf die Selbstauflösung des PNAC folgte einige Jahre später die Wahl Barack Obamas und hinterließ bei vielen den Eindruck, der neokonservative Einfluss auf die US-Außenpolitik sei nun – vor allem aufgrund der Desillusionierung über das Desaster des Irak-Kriegs – gebrochen. In Wirklichkeit hat Obama allmählich die Linie des PNAC übernommen. Allerdings geschah das offenbar widerstrebend. Seine erste Außenministerin Hillary Clinton hingegen hat sich aktiv als neue Favoritin der Neocons positioniert. Im Juli 2014 erklärte der Milliardär Haim Saban in einem Interview auf Bloomberg TV, er werde für die Wahl Hillary Clintons »so viel wie nötig« spenden. Das ist von einiger Bedeutung, weil offenbar sowohl Sabans 35 Vermögen als auch sein Eifer unerschöpflich sind. Saban erklärt unverhohlen, sein Hauptanliegen sei der Schutz Israels durch die Stärkung der Beziehungen zwischen Israel und den USA. »Ich bin ein Ein- ThemaTyp, und mein Thema ist Israel.«17 Während die meisten US-Bürger sich keinen Einsatz der gewaltigen Militärmacht ihres Landes wünschen, ist das für jemanden wie Saban, der sowohl US- als auch israelischer Staatsbürger ist, ganz klar richtig und dient der Stärkung der Position Israels im Nahen Osten. Saban sieht drei Einflussmöglichkeiten auf die US-Politik: Spenden an die politischen Parteien, die Etablierung von Denkfabriken und die Kontrolle über Medienunternehmen. Während sein Versuch, die Los Angeles Times zu kaufen und so deren »pro-palästinensische« Linie zu korrigieren, scheiterte, beglückte Saban das Nationalkomitee der Demokraten 2002 mit sieben Millionen Dollar und spendete fünf Millionen Dollar an Bill Clintons Präsidenten-Bibliothek. Aber vor allem gründete er seine »ganz eigene« Denkfabrik, das »Saban Center for Middle East Policy« innerhalb der Brookings Institution, die früher als politisch neutralste unter den großen Washingtoner Denkfabriken angesehen wurde. Erreicht wurde dies mit einer Rekordspende von dreizehn Millionen Dollar an Brookings. Das Saban Center fördert den Dialog – aber natürlich nicht den zwischen Israelis und Arabern, sondern zwischen den Israelis und prominenten US-Politikern. Während Saban generell auf Seiten der Demokraten steht, hat er dort, wie folgende Anekdote illustriert, auch eine Favoritin: »Man stellte Obama und Hillary dieselbe Frage: >Wenn der Iran Israel mit Atomwaffen angreifen würde, was würden Sie tun?< Hillary sagte, >Wir werden ihn auslöschen.< […] Vier Worte, ganz leicht zu verstehen. Obama sagte nur drei Worte: Er werde >angemessene Schritte ergreifen<. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll.« Sabans Tirade ging in ähnlichem Stil weiter; unter anderem nannte er den Iran »einen Schurkenstaat, […] der Hisbollah unterstützt, die mehr Amerikaner getötet hat als jede andere terroristische Or-ganisation«.18 Kurz, Hillary hatte seinen Test bestanden, während Obama für ihn durchgefallen war. Keiner von ihnen würde zu sagen wagen, was der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac vor Jahren auf dieselbe Frage antwortete. Er sagte, dass, sollte der Iran es wagen, Israel mit Atomwaffen anzugreifen, Teheran von israelischen Nuklearwaffen dem Erdboden gleichgemacht würde, was für sich schon die ganze Absurdität 36 der Idee eines solchen iranischen Angriffs enthüllt. Aber natürlich geriet Chirac damit ins Visier von Attacken der pro-israelischen französischen Presse. Ein Risiko, das kein führender US-Politiker je eingehen würde – jedenfalls nicht, solange reiche Finanziers wie Saban hinter den Kulissen stehen.19 Noch kurz vor ihrem eigenen Eintritt in die Arena der Wahlkampfpolitik hatte Hillary Clinton ihre Lektion in Risikovermeidung gelernt. Als sie als First Lady während eines Besuchs von Präsident Clinton bei Jassir Arafat in Ramallah im November 1999 Arafats Frau Suha höflich auf die Wange küsste, löste das einen Sturm der Empörung aus. »Schäm dich, Hillary!«, titelte die New York Post.20 Jüdische Führer verlautbarten, dies könne das Ende der Pläne für ihre Wahl als Senatorin für New York im nächsten Jahr sein. Laut Jason Horowitz von der New York Times veranlasste dies Hillary, Unterricht an der »politischen Hebräisch-Schule« zu nehmen: »Unter Anleitung des langjährigen New Yorker Senators Chuck Schumer erwarb sie enormes Geschick im Gewinnen des Vertrauens von Zielgruppen mit einer extrem proisraelischen Position.«21 Im Februar 2007, kurz vor dem nahenden Präsidentschaftswahlkampf, beging sie bei einem AIPAC-Abendessen einen kleinen Fauxpas, als sie sagte, man solle »mit dem Iran sprechen«22. Die Bemerkung wurde kühl aufgenommen. Aber während einer Debatte mit Obama im Juli 2007 leistete sie Abbitte für ihre kleine Sünde, indem sie sich von der Bereitschaft ihres Konkurrenten distanzierte, selbst die Führer von »Paria«-Nationen, ja sogar die des Iran zu treffen.23 In einem Positionspapier von September 2007 spielte Hillary dann ihre Trumpfkarte aus, indem sie die Überzeugung äußerte, Israels Existenzrecht »als jüdischer Staat« mit »Jerusalem als seiner ungeteilten Hauptstadt« dürfe nie in Frage gestellt werden.24 Mit diesem extremen Standpunkt überholte sie sogar noch die Bush-Administration, und das war auch einer der Gründe für Obama, den Vizegeschäftsführer der »Conference of Presidents of Major Jewish American Organizations« Malcolm Hoenlein zu bitten, Hillary zur Annahme des Angebots zu bringen, Außenministerin zu werden und so der Pro-Israel-Lobby Vertrauen einzuflößen. Am 2. Juli 2015, zu einem Zeitpunkt, als die USPräsidentschaftskampagne von 2016 allmählich näherrückte, schrieb Hillary Clinton einen an ihren Wohltäter Haim Saban und die Organisation Hoenleins gerichteten öffentlichen Brief, in dem sie 37 versprach, sie werde es zu einer »Priorität« machen, der internationalen BDS-Kampagne für Palästina entgegenzutreten, die sich zum Ziel gesetzt hat, Druck auf Israel auszuüben, damit es Frieden mit den Palästinensern schließt. BDS, so schrieb sie, wolle »Israel bestrafen und diktieren, wie die Israelis und die Palästinenser die Kernfragen ihres Konflikts lösen sollen. Das ist nicht der Weg zum Frieden.«25 Auf einer Wahlkampfveranstaltung einige Tage später sagte die Kandidatin, sie unterstütze Obamas Nuklearabkommen mit dem Iran, fügte aber hinzu, der Iran bleibe ein Problem. »Sie sind weltweit die Hauptsponsoren des Terrorismus«, sagte sie. »Sie setzen Stellvertreter wie Hisbollah ein, um Zwietracht zu säen und Aufstände zur Destabilisierung von Regierungen anzufachen. Sie übernehmen mehr und mehr die Kontrolle über eine Reihe von Ländern in der Region und stellen eine existentielle Bedrohung Israels dar.«26 Am 4. November ging sie in einem regelrechten Liebesbrief an Israel noch weiter: »Ich bin während meiner gesamten Karriere für Israel eingetreten«, erinnerte sie sich, und zählte ihre Leistungen auf, darunter die Ablehnung des parteiischen Goldstone-Reports27. »Als Präsidentin werde ich diesen Kampf fortsetzen. […] Ich werde alles tun, was ich kann, um unsere strategische Partnerschaft zu verbessern und die Verpflichtung Amerikas gegenüber der Sicherheit Israels zu stärken sowie dafür zu sorgen, dass es immer die qualitative militärische Übermacht hat, um sich zu verteidigen. Dazu gehört die sofortige Entsendung einer Delegation der Vereinigten Stabschefs zu einem Treffen mit hohen Kommandeuren der israelischen Armee. Außerdem würde ich den israelischen Premierminister noch in meinem ersten Monat im Amt ins Weiße Haus einladen. […] Ich würde unsere Partnerschaft intensivieren, um dem Iran und seinen Stellvertretern überall in der Region entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass keine gefährlichen russischen und iranischen Waffen in den Händen der Hisbollah enden oder Israel bedrohen. Außerdem werde ich gegen die wachsenden Bemühungen kämpfen, Israel international zu isolieren und seine Zukunft als jüdischer Staat zu untergraben, Bemühungen, zu denen auch die BDS-Bewegung gehört.«28 Als Unterstützerin Israels ist sie wohl schwerlich zu übertreffen. Hillary Clinton hat sich die Unterstützung Sabans redlich verdient. Saban ist nicht die einzige derartige Figur. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums haben wir als Unterstützer republikanischer Kandidaten Sheldon Adelson, der ebenfalls sowohl US-Amerikaner als 38 auch Israeli ist und sein Milliardenvermögen in den Spielkasinos von Las Vegas und Macao verdient hat. Adelson ist ein enger Freund Benjamin Netanyahus und ein Unterstützer des AIPAC; er hasst Obama und strebt ebenso sehr danach, das Amt des Präsidenten für einen Republikaner zu kaufen, wie Saban im Hinblick auf Hillary. Somit könnte der Präsidentschaftswahlkampf 2016 derzeit zu einem Rennen zwischen Haim Saban und Sheldon Adelson werden. In beiden Fällen hieße der Gewinner Israel. Nicht jeder betrachtet diese Situation als gut für Israel. So schreibt der bekannte israelische Journalist Gideon Levy: »Hillary Clintons Wahl zur US-Präsidentin würde sicherstellen, dass der Niedergang und die Entartung Israels weitergehen. […] Aber sie und ihresgleichen – die falschen Freunde Israels – sind schon seit vielen Jahren einer der Flüche unseres Landes. Wegen ihnen kann Israel sich weiterhin so gesetzlos aufführen wie es will und der Welt eine Nase zeigen, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Wegen ihnen kann es ungehindert sein Zerstörungswerk fortsetzen. […] Man könnte natürlich diese honigtriefende Erklärung mit der Notwendigkeit erklären, mehr Geld von Juden sammeln zu können. […] Die meisten amerikanischen Juden werden sie unterstützen, einige davon, weil sie glauben, dass Hillary gut für Israel ist. Nun, liebe Brüder und Schwestern, dem ist nicht so. Eine Person, die die fortgesetzte Besatzung unterstützt, ist genau wie jemand, der immer weiter Drogen für einen süchtigen Verwandten kauft. Das hat nichts mit Sorge oder Freundschaft zu tun; es ist zerstörerisch. Vielleicht wäre es am Ende besser, irgendeinen ignoranten Republikaner im Weißen Haus zu haben. Doch genau betrachtet würde auch das nichts nützen, denn dieser würde dann bestimmt von Sheldon Adelson finanziert.«29 2009 gründeten die PNAC-Veteranen William Kristol und Robert Kagan zur Bereitstellung von Personal und politischen Ideen für zukünftige Präsidenten, wer immer diese sein mögen, die »Foreign Policy Initiative« (FPI). Robert Kagan ist heute der führende Neocon-Theoretiker und Ehemann der Ex-Sprecherin von Außenministerin Hillary Clinton, Victoria Nuland, die Anfang 2014 eine führende Rolle bei der Initiierung des Putschs in der ukrainischen Hauptstadt Kiew spielte. Simpel ausgedrückt besteht der Hauptzweck der FPI genau wie der früherer Neocon-Gruppen darin, dafür zu sorgen, dass die USA sich ständig im Krieg befinden. Die leider viel zu wenigen Politiker, die sich ihrer Kriegspolitik offen entgegenstellen, stigmatisieren sie dann als »Isolationisten«. Der Militärisch-Industrielle Komplex hat kein eigenes Ziel, keine 39 Philosophie und keine Werte. Er ist einfach da, ein Ungeheuer, das, wenn wir diesen Planeten retten wollen, gezügelt und zerstört werden muss. Aber statt danach zu forschen, wie dies möglich wäre, erfinden unsere politischen Vordenker neue Daseinsberechtigungen für ihn. Am erfolgreichsten sind natürlich diejenigen, die leidenschaftlich einer bestimmten Sache dienen, etwa der unbedingten Unterstützung Israels. Und besonders erfolgreich sind sie dann, wenn viel Geld da ist, um ihre Lobbytätigkeit zu finanzieren. Da ist all diese Macht, und wie Madeleine Albright bekanntlich einmal sagte, stellt sich die Frage: »Wozu haben wir eigentlich dieses tolle Militär, wenn wir es nicht einsetzen können?«30 Für Politiker, die sich Macht wünschen, ist diese Militärmacht der Tiger, auf dem sie reiten müssen. Diejenigen, die in den Sattel wollen, behaupten dann, der Tiger sei eine unbesiegbare Kraft des Guten, während er in erster Linie eine enorme Zerstörungskraft hat. Er hat bereits Vietnam, den Irak, Afghanistan und Libyen verwüstet – und es gibt keine Grenze für das Chaos, das er noch anrichten kann. 40 2 »Multikulturalismus« à la Hillary: unsere einzigartigen »Werte« und »Interessen« Unsere politischen Führer werden nie müde uns zu versichern, unsere Außenpolitik sei durch »unsere Werte« und »unsere Interessen« bestimmt. Aber wessen Interessen genau? Das bleibt unklar. Und was »unsere Werte« betrifft: »Demokratie«, »Freiheit« und »Menschenrechte« sind Konzepte, die, wenn man erst einmal über sie nachdenkt, mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Aber Nachdenken ist ja genau das, was mit solcherlei Abstraktionen verhindert werden soll. Hillary Clinton wiederholt diese leeren Standardphrasen immer wieder, als seien »unsere Interessen« und »unsere Werte« Gebote Gottes, die uns wie Eisbrecher durch eine widerspenstige Welt leiten: Aus dem Weg mit euch, hier kommen wir mit unseren Werten und Interessen! Die USA sind ideologisch geprägt wie kaum ein zweites Land – und das ist ein Schlüssel zum »Ausnahme«-Charakter der Vereinigten Staaten. Keine Gesellschaft kommt ohne Ideologie aus, aber die heutigen politischen Führer und Meinungsmacher der USA leben in einem dichten Nebel ideologischer Selbstrechtfertigung. Die Ideologie vom »Ausnahmestatus« der USA wurde jahrzehntelang erfolgreich sowohl von Hollywood als auch von einer gewaltigen offiziellen Propagandamaschine verbreitet, die in zahllosen Ländern »Nichtregierungs«-Organisationen finanziert. Die Idee, die USA seien »das beste Land der Welt« und das probate Modell für alle anderen Länder, hat jungen Menschen in aller Welt eine Art von kulturellem Minderwertigkeitskomplex eingeimpft. Auch die politischen Führer Westeuropas haben diese Vorstellung seit dem Zweiten Weltkrieg so sehr verinnerlicht, dass sie die nationale Souveränität ihrer Länder der »politischen Steuerung« durch die Europäische Union – einer abstrusen 41 und alles in allem funktionsunfähigen Imitation der Vereinigten Staaten – geopfert haben. Das schafft eine instabile Lage, trägt aber dazu bei, Washington in seiner Illusion zu bestätigen, es könne die Welt beherrschen. Wir Menschen sind immer sehr gut darin, die Massenillusionen anderer Zeiten und anderer Länder zu durchschauen, besonders diejenigen des letzten Jahrhunderts. Unsere eigenen Illusionen bleiben für uns so unsichtbar wie die Luft, die wir atmen. Wir betrachten Hitler und das Naziregime als irrsinnig, weil sie glaubten, die Deutschen seien »die Herrenrasse«. Über die Politiker von heute, die verkünden, die USA seien »die unentbehrliche Nation« und eine Ausnahme im Hinblick auf alle für den Rest der Welt geltenden Regeln, steht ein Urteil noch aus. Diese Ideologie wird von Männern und Frauen geteilt, die über die größte je dagewesene Zerstörungsmacht verfügen, und daher stellt sie heute für die Menschheit und die anderen höheren Lebensformen auf unserem Planeten die Gefahr Nummer eins dar. Sie führt zum Risiko eines Nuklearkriegs und damit totaler Zerstörung. Das hängt nicht mit unseren »Interessen« zusammen, denn Interessen sind schon ihrem Wesen nach nicht selbstmörderisch. Es sind unsere »Werte«, die gefährlich sind. Es ist der Glaube an unsere gewaltige Überlegenheit und die Überlegenheit »unserer Werte«, der uns auf den Weg der Vernichtung unserer selbst und anderer führt. Hillary Clinton ist die Personifizierung dieses überheblichen Glaubens an die Einzigartigkeit der USA. Sie scheint unfähig, auch nur daran zu zweifeln, dass die USA »die letzte Hoffnung der Menschheit« sind. Vor allem ist sie fest davon überzeugt, dass die US-Bevölkerung ebenfalls an den Ausnahmestatus der USA glaubt und ihn immer wieder bestätigt und gefeiert sehen will. Solange die Bürger der USA tatsächlich genau das hören wollen, ist Hillary Clinton weder das einzige noch das größte Problem. Viel wichtiger ist der betäubende Nebel dieser Ideologie selbst. Die US-amerikanische Globalisierung Wenn die Bewohner der USA im Lande bleiben und sich schlicht um sich selbst kümmern würden, wäre ihr Glaube an den »Ausnahmecharakter« ihrer Nation nichts weiter als eine merkwürdige volksspezifische Marotte. Aber heute steht all das im Kontext der »Globalisierung«, und 42 für US-Bürger, die vom Ausnahmecharakter der Vereinigten Staaten überzeugt sind, heißt Globalisierung die Amerikanisierung der ganzen Welt. Unsere Interessen und Werte müssen überall das Sagen haben. Globalisierung bedeutet letztlich eine Weltwirtschaft, deren Kennzeichen die universale Öffnung der nationalen Wirtschaften für die Finanzmärkte ist. So wird dem internationalen Kapital erlaubt, durch seine Investitionsentscheidungen überall über Produktion, Handel und sogar viele Dienstleistungen zu bestimmen. Das hat gravierende politische Konsequenzen. Von den Nationalstaaten wird dabei erwartet, dass sie sich bemühen, mobiles Kapital anzuziehen, und dass sie dazu abschreckende Steuern senken und durch Privatisierung selbst essentieller Bereiche wie Bildung und Grundversorgung ein besseres Investitionsklima schaffen. Dadurch verlieren die Nationalstaaten die Ressourcen, um für das Gemeinwohl zu sorgen, Industrie und Landwirtschaft zu entwickeln und durch öffentliche Dienstleistungen den Reichtum umzuverteilen. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auf und die Befugnisse der nationalen Regierungen reduzieren sich immer mehr auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Und auch dieser Bereich wird mittlerweile oft privatisiert. Darüber hinaus ist die Globalisierung ein ideologisches Konstrukt. Sie wird mittlerweile weithin als unvermeidliches Stadium der menschlichen Geschichte, als Produkt der Kommunikations- und Transporttechnologien akzeptiert, die die Welt angeblich in ein »globales Dorf« verwandeln. Letzterer Begriff, der die gewaltigen subjektiven und materiellen Unterschiede ignoriert, die in der Menschheit immer noch bestehen, liegt der Anmaßung der USA zugrunde, »wir« hätten das Recht, uns in die Angelegenheiten aller anderen einzumischen. Während die »Globalisierung« als unausweichliches Schicksal präsentiert wird, ist sie in ihrer real-existierenden Form Resultat eines bestimmten Kräfteverhältnisses. Sie wird zwar als »Freihandel« verkauft, aber dieser Slogan bedeutet keineswegs, was die Worte darin nahelegen könnten: nämlich den freien Kauf und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen. In der Praxis handelt es sich um ein komplexes System internationaler Abkommen zur Erleichterung des internationalen Zustroms und Abflusses von Investitionen auf Kosten nationaler Regelungen. Bei der Erarbeitung dieser Abkommen sind die USA aufgrund ihrer Kontrolle über den Dollar als Weltwährung, aufgrund des Einflusses ihrer Ideologie und nicht zuletzt aufgrund ihrer weltweiten militärischen Präsenz in einer extrem vorteilhaften Verhandlungsposition. Sie verfügen (je nachdem, was alles mitgezählt wird) über 662 bis über tausend militärische 43 Stützpunkte oder Einrichtungen in 148 Ländern, und in vielen dieser Länder haben sie durch »Hilfe« und »Ausbildung« effektiv die Kontrolle über deren Streitkräfte. Dabei nutzen die USA nicht nur erfolgreich ihren Einfluss, um Handelsabkommen zu erreichen, die ihren eigenen Konzernen und Banken nutzen, sondern die US-Regierung findet auch nichts dabei, sowohl gegen den Geist als auch gegen den Buchstaben des Freihandels zu verstoßen, wann immer sie es für nötig befindet, ein Land durch Wirtschaftssanktionen zu »bestrafen«. Die US-dominierte Globalisierung ist ein Prozess. Die dahinterstehende Absicht ist, einen immer größeren Teil der Welt in die Sphäre der »freiheitlich-demokratischen Marktwirtschaft« zu überführen. Tatsächlich handelt es sich um eine neue Form der Welteroberung. Anders als bei den Imperien der Vergangenheit geht es dabei nicht mehr um die Schaffung von Kolonien und die Eroberung von Territorien durch Gewalt, sondern um die Herstellung von Bedingungen für die sukzessive Absorption einer Region nach der anderen in ein einziges System, in dem das freie Unternehmertum beziehungsweise das private Kapital nach dem heutigen US-Modell sowohl die Wirtschaft als auch den politischen Prozess beherrscht. Man beachte dabei, dass die »freien Wahlen« der USA frei durch Geldspenden beeinflusst werden können. Unsere moderne, gern als »bürgerlich« bezeichnete Demokratie begann mit einem Wahlrecht, das auf begüterte Männer beschränkt war. Diese Güterschranke wurde dann schrittweise abgesenkt, und während einer kurzen Zeitspanne gab es in den USA (wie in einigen anderen Ländern bis heute) ein gleiches Wahlrecht. Aber mit der Zulassung unbeschränkter Wahlkampfspenden sind die Vereinigten Staaten wieder umgekehrt – und zwar nicht zu einer »bürgerlichen« Demokratie, sondern zu einer Demokratie der Milliardäre. Das Schöne an einer solcherart umgemodelten Demokratie ist, dass man sie kaufen kann – vorausgesetzt, man hat die dafür nötigen Mittel. Als Exportartikel sieht diese »Demokratie« ganz nach einer bequemen, gewaltfreien Methode aus, mittels derer unsere freundlich gesonnenen Finanzinteressen die Kontrolle über fremde Regierungen übernehmen können. Eine »freiheitlich-demokratische Marktwirtschaft« kann sowohl politisch als auch wirtschaftlich durch das internationale Finanzkapital beeinflusst werden. Die USA geben bereits Hunderte von Millionen Dollar für »Demokratie«-Förderung aus, meistens als Zuwendungen für »Nichtregierungs«organisationen (NGO) in anderen Ländern über die Stiftung National Endowment for Democracy (NED). Solche 44 Subventionen dienen der Auswahl von Führern und dem Aufbau von Karrieren. Diese Bemühungen werden von etlichen mehr oder weniger staatsnahen Verbänden und Privatstiftungen unterstützt, unter denen die Open Society Foundation von George Soros die berühmt-berüchtigtste ist. Die Europäische Union ist beispielgebend für diesen Expansionsprozess. Unter dem starken Einfluss der USA, die nach der Niederlage Nazi-Deutschlands effektiv Besatzungsmacht in Westeuropa waren, begannen sechs Länder – Frankreich, Deutschland, Italien, Holland, Belgien und Luxemburg – 1957 mit dem Vertrag von Rom ihren Integrationsprozess. Die EU ist seitdem immer weiter gewachsen. Diese Expansion steht in enger Beziehung zur Ausweitung der NATO, auch wenn beides nicht ein und dasselbe ist. Paradoxerweise wird die EU mit ihrer ständigen Erweiterung immer undemokratischer, da die Schlüsselentscheidungen zunehmend von einer zentralisierten Bürokratie getroffen werden. Der Begriff der »freiheitlich-demokratischen Marktwirtschaft« wird immer mehr zum Widerspruch in sich. Nach ihrem künftigen Zusammenschluss in der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)1 werden die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zusammen mit der NATO den Kern einer geplanten »Weltgemeinschaft der Demokratien« bil-den.2 Diese »internationale Gemeinschaft« wird dann zweierlei Gründe für den Anspruch auf eine höhere Legitimität in der weltweiten Arena ins Feld führen: die angebliche moralische Überlegenheit der »Demokratie« und die Streitkräfte der NATO. Wie aktuell in der Ukraine, werden sich die bewaffneten »Demokratien« unter Führung der USA anheischig machen, überall im Rest der Welt zu intervenieren, und sich dabei auf R2P3 (»Verpflichtung zum Schutz«) oder irgendwelche sonstigen moralischen Vorwände berufen. Im Juni 2014 wurden in der Normandie verschwenderische Zeremonien zum siebzigsten Jahrestag der Invasion der Westalliierten abgehalten, die als die Befreiung Europas gefeiert wurde. Natürlich wurde die Ankunft der US-Truppen 1944 als Befreiung empfunden. Allerdings wäre es nach siebzig Jahren fortgesetzter militärischer Besatzung und politischer Vorherrschaft der USA vielleicht angebrachter, statt Feiern »zur Befreiung« vielmehr Feiern »zur Eroberung« zu veranstalten. Die EU ist ein Paradigma für eine Welt, in der die Nationalstaaten ihre Souveränität an ein allumfassendes Wirtschaftsregime abgeben, das auf »freien Märkten« und »Wahlen« basiert, die ebenfalls »frei« sind – frei, 45 aber oft teuer. Scharfer Gegenwind für »Whistleblower« »Sicherheit« ist ein weiterer Vorwand zur Missachtung von Souveränität. Staaten, die der NATO beitreten, geben damit bewusst ihre militärische Souveränität auf, um die angeblichen Vorteile »kollektiver Sicherheit« zu genießen – was bedeutet, dass sie ihre Streitkräfte so umstrukturieren müssen, dass sie als Elemente eines internationalen »Werkzeugkastens« unter US-Kommando dienen können. Darüber hinaus wurde aber versehentlich noch ein weiterer Aspekt individueller und nationaler Souveränität an die US-amerikanische Nationale Sicherheitsagentur (NSA) abgetreten, die danach trachtet, weltweit jedes Detail persönlicher, politischer oder geschäftlicher Kommunikation aufzuzeichnen, zu sammeln und zu speichern. Für Hillary Clinton ist dieser gravierende Eingriff ebenfalls ein Imperativ der »Sicherheit«, der notwendig ist, um »unsere Freunde und Verbündeten zu schützen«. Aus diesen Gründen verurteilte sie auch die Enthüllung von NSA-Dokumenten durch Edward Snowden vehement. »Als Amerikanerin«, so Hillary gegenüber Phoebe Greenwood in einem Interview für The Guardian, »glaube ich aufrichtig, dass unsere Informationsbeschaffung Leben rettet und nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch unsere Freunde und Verbündeten schützt.«4 Nach Auffassung Hillarys ist die NSA-Spionagetätigkeit ein großzügiger Dienst an der Öffentlichkeit, die dafür dankbar sein sollte: »Ich glaube, die meisten Leute wären schockiert, wenn die USA aufhören würden, diese Informationen aufzuzeichnen, und wenn wir einfach sagen würden: OK, jeder ist ab jetzt auf sich gestellt. Wir können dann unseren Verbündeten in Asien nicht mehr sagen, was vor sich geht, und wir können keine Informationen mehr mit unseren Verbündeten in Europa teilen. Wir hören einfach auf. Aber so läuft es in der realen Welt einfach nicht.« Für Hillary »wäre es hinsichtlich des Informationswettlaufs zwischen dem Westen und dem Rest eine Verweigerung unserer Verantwortung, nicht die Informationen zu sammeln, die wir zum eigenen Schutz, aber auch dem unserer Freunde und Verbündeten nutzen können«. Demnach sollte Angela Merkel der NSA auch noch dankbar dafür sein, dass diese ihr privates Handy abgehört hat. Laut Hillary ist die »reale Welt« immer noch so bedrohlich gespalten 46 wie im Kalten Krieg. Heute besteht die Spaltung zwischen dem Westen und dem Rest, oder, nach ihrer Bewertung, zwischen dem Guten und dem Bedrohlichen. Als Außenministerin bezeichnete Hillary Clinton die massive Dokumentenveröffentlichung durch WikiLeaks im November 2010 als »Angriff auf die Vereinigten Staaten und die internationale Gemeinschaft«, der »Menschenleben in Gefahr gebracht hat« und »unsere nationale Sicherheit bedroht«.5 Im Namen der Obama-Regierung verkündete sie: »Wir werden offensive Schritte unternehmen, um die, die diese Informationen gestohlen haben, zur Verantwortung zu ziehen.« Das geschah auch, und Bradley/Chelsea Manning zahlt nun einen hohen Preis, unter anderem für das Publikmachen der brisanten Videoaufnahme, die zeigt, wie eine US-Hubschrauberbesatzung in Bagdad eine Gruppe von Zivilisten, darunter einen BBC-Fotografen, auf offener Straße ermordet und dann einen weiteren Mann tötet, der mit seinen Kindern im Auto unterwegs ist und anhält, um den immer noch auf der Straße liegenden Opfern des ersten Angriffs zu Hilfe zu kommen.6 Hillary war schon gegenüber WikiLeaks feindselig, bezeichnete die Veröffentlichung der NSA-Dokumente durch Edward Snowden im Mai 2013 aber als noch »viel ernsteren Geheimnisverrat«.7 Da sie die weltweite US-Spionage im von ihr imaginierten Wettstreit zwischen »dem Westen« und allen anderen als notwendig erachtet, sollten Ausländer nicht einmal etwas davon wissen dürfen. »Ich bin nicht überrascht, dass Hillary Clinton denkt, dass Menschen, die formal keine US-Bürger sind, keinerlei Rechte haben«, kommentierte Julian Assange, der Hillary Clinton als »Gefahr« für die Lösung des Problems der Whistleblower sieht.8 Was die Bürger der USA betrifft, gewährt Hillary ihnen das Recht auf Teilnahme an einer artigen Debatte »über das Spannungsverhältnis zwischen Privatsphäre und Sicherheit«. Sie ist Snowden »nicht dankbar« für die Stimulierung einer Debatte, die ihr zufolge »bereits lief«, denn es gebe »andere Wege, so etwas zu machen«. Sie fand es »seltsam«, dass Snowden geflohen war, da die USA doch »all diese Schutzmechanismen für Whistleblower« hätten. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Die »anderen Wege, so etwas zu machen« führten lediglich zu Schwierigkeiten für die kühnen Wahrheitskünder. Früheren NSA-Whistleblowern, die sich minutiös an die Regeln des Intelligence Community Whistleblower Protection Act9 von 1998 hielten, gelang es weder bei ihren Vorgesetzten noch im 47 Kongress, Interesse für laufende schwere Gesetzesverstöße zu wecken. Als einer von ihnen, der dekorierte Luftwaffen- und Marineveteran Thomas Drake, nach Ausschöpfung aller Dienstwege 2005 Informationen für einen später preisgekrönten Artikel an die Baltimore Sun weitergab, überfielen und plünderten bewaffnete FBI-Agenten seine Wohnung; außerdem wurde er 2010 von einer Grand Jury in Baltimore nach dem Spionagegesetz von 1917 wegen »vorsätzlicher Aufbewahrung von Informationen über die nationale Verteidigung« angeklagt.10 Das setzt den Versuch zur Aufklärung der US-Öffentlichkeit mit dem Verrat vitaler Informationen an den Feind zu Kriegszeiten gleich. In den USA werden die nationale Sicherheit betreffende Fälle in Alexandria, Virginia, verhandelt, wo, wie Julian Assange bemerkt, »die Bevölkerung, aus der die Jury ausgewählt wird, die US-weit größte Dichte an Regierungs- und Militärangestellten aufweist. Ein faires Verfahren ist unmöglich, weil die US-Regierung immer wieder auf dem Privileg des Staatsgeheimnisses beharrt, um die Verteidigung an der Nutzung von Material zu hindern, dessen Geheimhaltung die Anklage begünstigt.« Nur weil es Snowden gelang, seiner Verhaftung zu entgehen, könnten »wir über die Sache selbst reden« statt über die Frage seiner Schuld oder Unschuld. Allein durch die Veröffentlichung der offiziellen Dokumente, so Assange, habe Snowden zeigen können, »wie komplex die Vorgänge waren. Jetzt haben wir Beweise. Es gab schon zuvor alle möglichen Versuche auch unter Beteiligung von Ex-NSA-Whistleblowern, eine Debatte zu starten, aber wahrscheinlich können nur große Massen von Originaldokumenten eine Debatte über ein so komplexes Thema wie die flächendeckende Überwachung in Gang bringen.«11 Hillary Clinton dachte eindeutig an das drakonische Spionagegesetz von 1917, als sie sinnierte, es sei »merkwürdig«, dass Snowden erst in das »von China kontrollierte Hongkong« geflohen sei, um dann in einem »von Putin regierten Russland Zuflucht« zu suchen -wobei sie geflissentlich vergaß, dass Snowden nur darum am Ende in Russland landete, weil das US-Außenministerium seine Ausreise nach Lateinamerika verhinderte, indem es ihm am 22. Juni 2013 den Pass entzog. Hillary Clinton gibt vor, das Überwachungsthema als Balanceakt zwischen »Privatsphäre und Sicherheit« zu betrachten, und vertritt die Meinung, die Bürger sollten bereit sein, einen Teil ihrer Privatsphäre zu opfern, um sicher zu sein – vermutlich vor Terroristen und all den anderen Übeltätern im Rest der Welt. Für den Durchschnittsbürger ist Privatsphäre eine Form der Sicherheit. Die Privatsphäre, um die Hillary 48 sich sorgt, ist die des Staates, dessen Privatsphäre durch WikiLeaks verletzt wurde, weil die Plattform der Meinung war, die Bevölkerung habe das Recht zu wissen, was ihre Regierung tut. Im Gegensatz dazu verletzt die Schnüffelei der NSA die Privatsphäre von Einzelpersonen und bedroht ihre Sicherheit. Die, die meinen, staatliche Überwachung sei kein Problem, »weil ich ja nichts zu verbergen habe«, begreifen diesen Punkt nicht. Für den Augenblick mag diese gewaltige Anhäufung persönlicher Daten für Bürger, die »nichts zu verbergen haben«, tatsächlich harmlos sein. Für künftige Terroristen gilt allerdings vermutlich dasselbe. Der Informationsüberfluss kann sogar ein Hindernis dabei sein, die geringe Zahl gefährlicher Personen ausfindig zu machen, die es natürlich vermeiden werden, Spuren ihrer Aktivitäten zu hinterlassen. Andererseits durchleben wir gerade einen negativen sozialen Trend: Reichtum und Macht werden immer konzentrierter, und aufgrund dieser zunehmenden Schieflage könnten die Mächtigen es immer verführerischer finden, Proteste und Bewegungen für Veränderung, die diese wachsende Kluft zwischen sehr wenigen und sehr vielen unvermeidlich erzeugt, einfach zu unterdrücken. Dabei können völlig harmlose persönliche Informationen genutzt werden, um jeden beliebigen, der aktiven Widerstand gegen ein ungerechtes System leistet, unter Falschanklage zu stellen, zu einer Straftat zu verleiten oder sonstwie zu eliminieren. Eine staatliche Überwachungsmaschinerie wie diese ist eine wichtige Waffe im Arsenal der Repression. Es könnte die Zeit kommen, in der der Staat zum Schutz der Macht der 0,01 Prozent ganz nach Madeleine Albright die Maxime ausgibt: »Wozu haben wir diese ganze Repressionsmaschinerie, wenn wir sie gar nicht benutzen?«12 Wie bei jeder wirksamen Waffe kann ihre bloße Existenz für die, die über sie verfügen, ein Argument werden, sie auch einzusetzen. Umgekehrt ist die Möglichkeit ihres tatsächlichen Einsatzes für die, die sie nicht besitzen, ein gutes Argument für ihre Abschaffung. Befürworter der Staatssicherheit wie Hillary Clinton sehen offenbar nicht, dass die umfassende Überwachungsmaschine der NSA eine ernsthafte mögliche Gefahr für die »Zivilgesellschaft« ist, die ihnen angeblich so am Herzen liegt – und wenn doch, kümmert es sie nicht. Die Vereinnahmung der Zivilgesellschaft 49 Am 16. Februar 2011 präsidierte Außenministerin Hillary Clinton über die feierliche erste Sitzung des »Strategic Dialogue with Civil Society«13, eines neuen Instruments der US-Intervention in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Dabei wiederholte sie das übliche Mantra, die USA unterstützten »demokratischen Wandel«, weil das »unseren Werten und unseren Interessen« entspreche. Als Frage »des Einstehens für universale Prinzipien« würden die Vereinigten Staaten »unseren Partnern« dabei helfen, Schritte »zur Öffnung ihrer politischen und wirtschaftlichen Systeme« zu unternehmen – sodass Onkel Sam direkt zur Tür hereinspazieren kann.14 Diese Sitzung fand im Außenministerium statt, wo über interaktive Videotechnik »Tausende« von Teilnehmern in fünfzig US-Botschaften rund um die Welt zugeschaltet waren. Hillary benutzte ihr Lieblingsbild, in dem stabile Gesellschaften wie bei einem Schemel von drei Säulen gestützt werden: »einer ansprechbaren, verantwortlichen Regierung, einer kraftvollen, effektiven Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft, die für alles andere steht, was im Raum zwischen Staat und Wirtschaft geschieht, und die die Werte und Wünsche der Menschen verkörpert und repräsentiert.« Dieser »Schemel« ist in Wirklichkeit das Bild für eine anonyme »Führung« einer konzerndominierten Gesellschaft: einer den Forderungen des Finanzkapitals verpflichtete Regierung, einer kapitalistischen Wirtschaft und privater, nicht gewählter, aber umso besser finanzierter Organisationen, die »unsere Werte« bestimmen. Man beachte, was fehlt: ein kraftvolles politisches Leben, absolut unabhängige Medien und ein Bildungssystem, das intellektuell wache und kritische Bürger hervorbringt. Hillary sagte, sie sei »sehr erfreut, verkünden zu können, dass wir unsere finanzielle Unterstützung für Bemühungen, auf Gefährdungen der Zivilgesellschaft zu antworten und verhafteten Menschenrechtlern, bedrohten Aktivisten und zensierten Journalisten zu helfen, verdoppelt haben. Wir haben einen internationalen Fonds eingerichtet, der staatlich verfolgten NGOs rasche Hilfe wie Kommunikationsgeräte und rechtliche Unterstützung bietet.« Kurz, in ihrer Funktion als Außenministerin leitete HRC eine Intensivierung der US-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von fünfzig Ländern ein. Schon zuvor, so Clinton, habe sie die Botschafter der USA angewiesen, »sich um die Zivilgesellschaft zu kümmern, da sie der Schlüssel unserer Diplomatie ist«. Sie ernannte drei hohe Beamte des Außenministeriums zu Leitern von Arbeitsgruppen zu Führung und 50 Verantwortlichkeit, zu Demokratie und Menschenrechten sowie zur Stärkung der Frauenrolle. Damit beschleunigte Hillary eine bereits laufende Verlagerung der US-Diplomatie weg von der traditionellen Praxis des Umgangs mit Regierungen und hin zum Handeln mit der »Zivilgesellschaft« gegen Regierungen, die als ungeeignet betrachtet werden, die genannten Themen zur Zufriedenheit Washingtons zu behandeln. Natürlich wären die USA selbst kaum begeistert, wenn andere Länder der US-»Zivilgesellschaft« solche »Hilfe« anbieten und ihr sagen würden, was zu tun ist – etwa im Hinblick auf die hohe Kindersterblichkeit, die höchste Häftlingsrate der Welt, die Erschießung unbewaffneter »Verdächtiger« durch die Polizei, die gewalttätigen Drogengangs, die Korrumpierung des demokratischen Prozesses durch gigantische Wahlkampfspenden oder auch so relativ milde Übel wie ein Bildungssystem, das den meisten US-Amerikanern nicht einmal die rudimentärsten Tatsachen über die Geschichte und Geografie einer Welt beibringt, mit deren Umgestaltung ihre Regierung permanent beschäftigt ist. Das Konzept der »Zivilgesellschaft« ist natürlich dehnbar, aber eines steht fest: Die Exponenten der Zivilgesellschaft handeln aus eigenem Entschluss und sind nicht repräsentativ für andere. Oft ist es auch so, dass die NED Gruppen, derer sie sich annimmt, zu »unterdrückten Dissidenten« erklärt, die die wahre Demokratie vertreten. Der Fokus des US-Außenministeriums auf die Zivilgesellschaft legt den Schluss nahe, die echten Werte einer Gesellschaft würden nicht durch ihre Regierung ausgedrückt, egal ob sie demokratisch gewählt wurde oder nicht, sondern durch freiwillige, außerhalb des politischen Prozesses organisierte Zusammenschlüsse. Indem die USA ihre Unterstützung für die »Zivilgesellschaft« proklamieren, versuchen sie sehr offen, alle Formen von Unzufriedenheit, wie es sie in Dutzenden von Ländern gibt, zu kooptieren und sich als Vorkämpfer einer Lösung zu präsentieren. Das Außenministerium ermutigt solche Gruppen, die USA hierbei um Hilfe zu bitten, statt in ihrer eigenen Gesellschaft politisch für ihre Anliegen zu arbeiten. Hillary zählt auch darauf, dass die »Zivilgesellschaft« zur Prävention von Völkermorden beiträgt, indem sie die Tendenzen dazu erkennt und ihnen Widerstand leistet. Das ist eine merkwürdige und abwegige Erwartung. Die aktive »Zivilgesellschaft« wird von Minderheiten betrieben, die relativ privilegiert sind. Ganz gleich wie aufrichtig sie sein mögen, man 51 kann in den gebildeten, westlich orientierten, in Menschenrechtsorganisationen aktiven Minderheiten leicht die Keime einer weltweit dominierenden Managerklasse in der globalisierten Welt erkennen, die die USA zu schaffen und zu lenken trachten. Der »Strategische Dialog mit der Zivilgesellschaft« ist eines unter anderen Mitteln zur Festigung der ideologischen Hegemonie, die die USA seit dem Zweiten Weltkrieg errungen hat. Auch wenn diese Ideologie aufgrund der zahlreichen militärischen Aggressionen der USA auf wachsende Skepsis und sogar Feindseligkeit stößt, steht ihr bisher keine kohärente Alternative gegenüber. In einem Großteil der Welt übt die »Amerikanisierung« auf bestimmte privilegierte Schichten immer noch große Anziehungskraft aus. Die Zivilgesellschaft ist eine Sache für Minoritäten, und daher ist die Verteidigung ethnischer, religiöser oder sexueller Minderheiten ein fruchtbares Feld für Bewegungen, die das Potential haben, die Basis der Zentralregierungen zu schwächen. Aufgrund ihrer emotionalen Wirkung können Identitätsbewegungen Regierungen destabilisieren, ohne an der wachsenden Macht des Finanzkapitals über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu rühren -ganz im Gegensatz zu auf konkreten wirtschaftlichen Forderungen basierenden Bewegungen. Die Zivilgesellschaft ist ein fruchtbarer Boden für die Herausbildung selbsternannter Eliten, die als Partner der US-gesteuerten Globalisierung rekrutiert werden können. Von der Gleichheit zur Vielfalt In den letzten dreißig Jahren hat die westliche ökonomische Linke auf beiden Seiten des Atlantiks eine vernichtende Niederlage erlitten. In Großbritannien und den USA war diese Niederlage hausgemacht und Resultat der Politik Thatchers und Reagans in den 1980er Jahren. Auf dem europäischen Kontinent ist dafür vor allem die EU-Bürokratie verantwortlich, deren Direktiven und Budgetregeln das »europäische Sozialmodell«, in Vorbereitung auf die transatlantische Partnerschaft TTIP, immer mehr zerstören. Die gewählten Politiker kollaborieren mit diesem Prozess und täuschen Hilflosigkeit vor. Die »Arbeiterparteien Europas kümmern sich nicht mehr um die Arbeiter und die »sozialistischen« Parteien haben mit Sozialismus nicht das Geringste mehr im Sinn. In den USA hat die Demokratische Partei den 52 Sozialreformismus des New Deal längst aufgegeben. Eine bestimmte Sorte von »Linken« besteht zwar weiterhin und geriert sich als weitherzig und progressiv, aber es ist nicht mehr die alte sozialdemokratische Linke, die für Maßnahmen zur Förderung wirtschaftlicher Gleichheit eintrat. Statt mit Gleichheit befasst sich die neue soziale Linke lieber mit Vielfalt und dem »Recht auf Anderssein«. Natürlich ist es so, dass Menschen verschieden sind. Es gibt keinen Grund, das als ein »Recht« zu betrachten. Es ist einfach eine Tatsache. In einer anständigen, gerechten und vernünftigen Gesellschaft wären die Menschen einfach ganz selbstverständlich verschieden und niemand würde darum großes Aufheben machen. Aber heute ist »Identität« zu einer Hauptsorge geworden. Die alte Spaltung zwischen rechts und links, zwischen konservativ und progressiv (oder, in den USA, »liberal«) hat sich in vielerlei Hinsicht zu einem historischen Kompromiss zwischen wirtschaftlichem Dogma und sozialer Doktrin entwickelt. Das wirtschaftliche Dogma der Rechten ist nicht konservativ in irgendeinem bedeutsamen Sinn. Es konserviert gar nichts, sondern ist zerstörend für jede stabile Form von Existenz. Es postuliert die Herrschaft der Märkte, womit natürlich die Finanzmärkte gemeint sind. Aber selbst die politischen Parteien Europas, die sich als »links«, »liberal«, »progressiv« oder gar »sozialistisch« bezeichnen, haben ihre Programme inzwischen weitgehend auf die Forderungen der »Märkte« abgestimmt, vorgeblich, um »Investitionen anzulocken und Arbeitsplätze zu schaffen« (nur dass die Arbeitsplätze nicht realisiert werden). Die bestehende Wirtschaftsordnung wird als logisch, wissenschaftlich fundiert und unausweichlich betrachtet. Obwohl die herrschende Wirtschaftslehre alles andere ist als eine exakte Wissenschaft, wird so der Eindruck vermittelt, die gegenwärtige Wirtschaftsordnung folge einem Naturgesetz. Aber für die Linke gibt es einen Trostpreis, nämlich die ideologische Hegemonie im emotionaleren Bereich der menschlichen Beziehungen, besonders dem der »Menschenrechte«. Nach ihrer kompletten Niederlage in der wirtschaftlichen Arena darf die Linke nun die dominante gesellschaftliche Doktrin definieren, die auf den Konzepten Multikulturalismus, Sorge um Minderheiten und Antirassismus basiert. In den USA hält man die Bürger an, Regierungen anderer Länder fast ausschließlich danach zu beurteilen, wie sie prowestliche Dissidenten oder ausgewählte Minoritäten behandeln. Andere Vorzüge oder Mängel, zum Beispiel im Hinblick auf die Bildung und die materielle Versorgung der Bevölkerungen, sind nur von nebensächlichem Interesse. Die US53 Unterhaltungsindustrie schafft eine imaginäre Welt, die diese Doktrin zelebriert und die Revolte im eigenen Land in künstlerische Sackgassen bugsiert. Ein Großteil der Rap-Musik etwa stachelt junge afroamerikanische Männer zur Auflehnung gegen die Autoritäten auf, aber in der realen Welt muss ein junger Afroamerikaner sich nicht einmal auflehnen, um zum Opfer tödlicher Polizeigewalt oder lebenslang ins Gefängnis gesperrt zu werden. Seit die westlichen Führer sich der Illusion verschrieben haben, die Prosperität ihrer Länder auf Dienstleistungen statt auf materieller Produktion aufzubauen, hat selbst die Linke die industrielle Arbeiterklasse vergessen. In den 1970ern verloren viele radikale Linke allmählich das Interesse an der Arbeiterklasse als »revolutionärem Subjekt«, da sie nicht die sozialistische Revolution gemacht hatte, die damals eine schwelgerische Massenillusion war. So verlagerte sich ihr Fokus auf – zunächst als effektivere »Subjekte der Revolution« angesehene – Identitätsgruppen wie Studenten, Frauen oder Schwule. Daraus ist seitdem eine generelle Konzentration der Linken auf »Identitätsgruppen« aller Art geworden. Der Multikulturalismus sieht die Gesellschaft als Mosaik von »Identitäten« statt von Klassen. Aber diese Klassen existieren dennoch weiterhin. In den meisten westlichen Ländern und besonders in den USA hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich enorm erweitert. Die politische Macht ist mehr denn je ganz oben, bei den Ultrareichen, den Großkonzernen und den Banken, konzentriert. Es gibt keine einzige etablierte politische Kraft, die die Interessen der Unterschicht verteidigt und versucht, der wachsenden Ungleichheit zwischen den Klassen entgegenzuwirken. Die Occupy-Bewegung definierte die herrschende Klasse als das oberste Prozent und behauptete, die restlichen 99 Prozent zu repräsentieren. Sie wurde am Ende ins Abseits gedrängt. Die sozial akzeptierte Linke dagegen ist in erster Linie um die Achtung von Minderheiten, nicht um das Wohlergehen der Mehrheit besorgt. Als die Clinton-Administration in den 1990er Jahren begann, das Erbe des New Deal zu zerstören, entstand der Multikulturalismus als soziales Ideal. Er ist im Wesentlichen eine Mischung aus europäischer Ideologie und amerikanischer Realität. Die politische Integration Europas hat sich in ein Musterbeispiel für wirtschaftliche Globalisierung verwandelt. Aber sie hat als etwas anderes begonnen: Sie wurde seinerzeit als endgültige Ablehnung von Nationalismus und Krieg präsentiert und kam in erster Linie durch die Versöhnung und Partnerschaft von Frankreich und Deutschland zustande – 54 Länder, die einander in etlichen Kriegen immer wieder zerstört hatten. Dass die nationale Souveränität an europäische Institutionen übergeben wurde, wurde als notwendiges Heilmittel gegen den Nationalismus gerechtfertigt, den man für die Kriege verantwortlich machte, und so wurde Westeuropa wie selbstverständlich zum Zentrum der antinationalistischen Ideologie, die sich aus der Feier des »Multikulturalismus« speiste. Die Propagierung des Multikulturalismus hat viel mit der nicht enden wollenden Fixierung des Westens auf das lange, von Hitler beherrschte Jahrzehnt der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun. Es scheint, als seien alle Werte für immer in den Jahren zwischen Hitlers Aufstieg zur Macht 1933 und seinem Fall 1945 verankert worden, und als müsse diese Periode auf ewig für alles, was vor sich geht, der entscheidende Referenzpunkt bleiben. Der Multikulturalismus ist der rechtschaffene Pol eines säkularen Manichäismus. Der böse Pol gruppiert sich um den ideologischen Kern des Nazismus: um Nationalismus, Rassismus und den Ausschluss anderer. Unter dem Einfluss eines zunehmend religiösen Gedenkens an den Holocaust, das die Tendenz hat, alle anderen Aspekte des Zweiten Weltkriegs in den Hintergrund zu drängen, wird der Antisemitismus der Nazis vor allem einem mehr oder weniger spontanen »Hass auf alle, die anders sind« zugeschrieben. Das ist sehr fragwürdig, da Hitlers Antisemitismus in erster Linie eine extreme, hysterische Reaktion auf sehr spezifische Ereignisse war, nämlich Deutschlands demütigende Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Aufstieg des Bolschewismus in Russland. Diese Folge von Ereignissen erlebte Hitler als für Deutschland katastrophal. Aufgewachsen im Milieu des politischen Antisemitismus Österreichs, schrieb er sie den feindlichen Machenschaften des internationalen Judentums zu. Wenn man dafür sorgen möchte, dass die Geschehnisse der Hitlerzeit sich nicht wiederholen, sind Mahnreden wider den »Hass auf alle, die anders sind«, keine wirkliche Hilfe. Sie sind vielmehr Ausdruck einer Angst vor Wirkungen, die die Ursachen übersieht. Schuldgefühle wegen der Behandlung der Juden während des Zweiten Weltkriegs bilden den emotionalen Kern der westeuropäischen Tendenz, jede nationale Mehrheit permanent zu verdächtigen, sie unterdrücke die Minderheiten oder wolle dies zumindest tun. Und beinahe jeder Machthaber über eine widerspenstige Minderheit kann in Verdacht geraten, einen »Genozid« in Erwägung zu ziehen.15 Das neben Umweltthemen wie dem Widerstand gegen Gentechnik praktisch einzige Thema, das in Europa zu einer aktiven Mobilisierung 55 der Linken führt, ist die Verteidigung illegaler Einwanderer. Für einige kleine, ultralinke anarchistische Gruppen besteht das langfristige Ziel in einer Welt ohne Grenzen, in der jeder frei ist, überall hin zu gehen und in der die nationalen Grenzen ebenso wie die Nationalstaaten verschwunden sind. Diese Gruppen betrachten sich selbst als radikal antikapitalistisch, doch leider ist ihr Ideal identisch mit dem der kapitalistischen Globalisierer, denen viel klarer ist, dass bei einem Wegfall der Nationalstaaten die privaten Konzerne und Finanzinteressen den Rest der Welt gänzlich ungehemmt beherrschen würden. Der Unterschied zwischen den Anarchisten und den kapitalistischen Globalisierern liegt in der Wahrnehmung der Kräfteverhältnisse, die von Ersteren ignoriert werden, während Letztere sie aktiv gestalten. Das multikulturelle Ideal der Globalisierung würde jedes Land in einen Mix von Identitätsgruppen verwandeln, von denen jede sich über die Grenzen hinweg erstrecken und mehr Loyalität zu sich selbst und ihrem Umfeld empfinden würde als zu irgendeinem Staat. Dieser Zustand wird nicht eintreten und wird nicht einmal bewusst geplant, entspricht aber der inhärenten Logik etlicher kapitalistischer Strategien und vieler anarchistischer Träume. Kurzfristig würde dies zur Untergrabung der nationalen Loyalität durch verschiedene Gruppenloyalitäten und zur Schwächung der Legitimität der Mehrheiten durch privilegierte Aufmerksamkeit für Minderheiten führen. Kulminationspunkt wäre ein Weltreich aus vielen geografisch zerstreuten Stämmen, das ein wenig wie eine gigantische Kopie früherer Imperien wie der multiethnischen Reiche der Habsburger oder der Osma-nen aussehen würde. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass ein solches Modell früher oder später zu Konflikten zwischen den Gruppen führt, weil einige von ihnen die anderen einer unfairen Dominanz beschuldigen oder die Bräuche und die Religionen zu unterschiedlich sind. Dies führt dann zu Abspaltungsbewegungen, die sich in separate Territorien absondern wollen. Doch der Kern des Ideals besteht darin, die ganze Welt gleich zu machen, indem jedes Land in eine Mischung von Unterschieden verwandelt wird. Der Export der sexuellen Identitätspolitik Während in den letzten Jahrzehnten die Mitgliedschaft in Gewerkschaften und politischen Parteien dahingeschmolzen ist, sind Identitätsgruppen mit jeweils einem einzigen Anliegen gewachsen und gediehen. Der 56 Multikulturalismus lenkt die Aufmerksamkeit von wirtschaftlicher und rechtlicher Gleichheit auf psychologische Haltungen, die schwer zu definieren und unmöglich zu kontrollieren sind. Einige Aspekte der Propagierung des Multikulturalismus in anderen Ländern durch die USA können als Export der US-Identitätspolitik betrachtet werden. Das gilt besonders für Geschlechterfragen. Die wichtigste neue Erscheinung war die Ausbreitung sexueller Identitätsgruppen, angefangen mit der Bewegung zur »Schwulenbefreiung«. Ursprünglich strebte sie nach sozialen Reformen zur Abschaffung der Diskriminierung und Kriminalisierung sexueller Orientierungen. Das war für die westlichen Länder ein echter zivilisatorischer Fortschritt, auch wenn es kein Schritt zu einer sozialen Revolution war, wie es sich einige Aktivisten erhofft hatten. Das Problem der Identitätsbewegungen ist: Was soll man tun, wenn gleiche Rechte erst einmal erkämpft sind? Hier könnte es klug sein, die Erfolge zu konsolidieren und dafür zu sorgen, dass es keine Rückschläge gibt. Stattdessen hat der Erfolg der »Schwulenbefreiung« die Schaffung neuer »Identitäten« begünstigt, die sich zu Interessengruppen organisieren und beanspruchen, eine bestimmte Klientel zu vertreten, und die so nach öffentlicher Anerkennung und politischem Einfluss streben. Die heute politisch aktivste auf Genderfragen basierende Gruppe ist unter dem Namen LGBT (für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) bekannt, was in manchen Kreisen noch durch ein Q für »Queer« ergänzt wird. Aber es gibt weder LGBT-Individuen, noch gibt es eine »LGBTGemeinschaft«. Lesbische Frauen und schwule Männer bilden nur selten eine einzige Gemeinschaft, was im Übrigen bei Heterosexuellen nicht anders ist. Dafür gibt es innerhalb jeder sexuellen Orientierung schlicht zu viele individuelle Variationen, und neben dieser Orientierung definiert sich jede Person auch noch durch weitere soziale Aktivitäten und Interessen (etwa beruflicher, politischer oder religiöser Natur), mit denen sie sich identifiziert. Sehr wahrscheinlich haben Transsexuelle viele besondere Probleme gemeinsam, aber diese sind sehr verschieden von denen der Ls, Gs und Bs. Dennoch gibt es Organisationen, die behaupten, die Interessen dieser hypothetischen Gemeinschaft zu vertreten, und die als politische Lobbygruppen auftreten. Sie haben sich etwa erfolgreich für die Legalisierung der Schwulenehe eingesetzt, was in Frankreich eine neue Kontroverse über deren Bedeutung für die Frage der Leihmutterschaft ausgelöst hat. Ferner setzen sie sich für eine härtere Bestrafung von sogenannten »Hass«-Verbrechen ein, was man jedoch als 57 Sonderbehandlung gegenüber Opfern betrachten kann, die aus einem sonstigen Grund angegriffen wurden. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts haben die Forderungen der LGBT-Lobby die der organisierten Arbeiterbewegung als wichtigstes »progressives« oder »linkes« Anliegen weitgehend ersetzt. Da sie es nicht schaffen, etwas für die wirtschaftlichen Verlierer zu tun, feiern progressive Kräfte die Neuerung, dass schwule Männer und lesbische Frauen jetzt ebenso wie heterosexuelle Paare heiraten und sich scheiden lassen dürfen, als gewaltigen gesellschaftlichen Fortschritt. Dieser revolutionär daherkommende Konformismus bezieht seine Glaubwürdigkeit aus der Empörung vieler Traditionalisten, die wiederum nicht begreifen, dass diese »Fortschritte« mehr ein Nachäffen der Tradition sind als eine echte soziale Innovation. Davor war die reale soziale Neuerung das Zugeständnis, dass Paare ohne die Erlaubnis des Staates oder der Kirche zusammenleben konnten. Was persönliche Freiheit angeht, erscheint das Bestehen auf der Schwulenehe als ein Schritt zurück gegenüber wirklich neuen Institutionen, die langjährigen Paaren gleich welcher sexuellen Orientierung einschließlich adoptierter Kinder soziale Sicherheit gewähren.16 Die Schwulenehe ist nicht unbedingt ein probater Exportartikel, am wenigsten an Orten, wo die Ehe immer noch eher als Sache der Familie denn als die der Einzelperson betrachtet wird und dazu dient, für die Sicherheit und Identität der Kinder eines bestimmten Paares zu sorgen. Die Schwulenehe spiegelt eine historisch sehr junge Sicht der Ehe als »Happy End« einer Liebesgeschichte wider. Erst die Zeit wird zeigen, ob die Schwulenehe ein universeller Fortschritt oder eine vorübergehende Mode in westlichen Ländern ist, die bald neuen Institutionen und Bräuchen Platz machen könnte. Die Sexualität ist wohl der irritierendste Teil des menschlichen evolutionären Erbes und so unumgehbar, so konträr zur Vernunft und so emotional gefährlich, dass der Versuch, sie unter gesellschaftlicher Kontrolle zu halten, nicht zuletzt in den monotheistischen Religionen die Basis verschiedenster sozialer Bräuche und permanenter Obsessionen ist. Sexuelle Bräuche sind nicht nur ein hochgradig sensibles, oft von Tabus umgebenes Thema, sondern meist auch Gegenstand von Geheimnissen. Erinnern wir uns daran, dass entweder die berühmte Anthropologin Margaret Mead oder ihr wichtigster Kritiker, Derek Freeman, der ihren Darstellungen in Kindheit und Jugend in Samoa17 widersprach,18 oder alle beide von den Samoanerinnen, die ihnen von ihren Sexualpraktiken als Teenager erzählt hatten, hinters Licht geführt wurden. 58 Homosexualität hat schon immer existiert, wird aber von Gesellschaft zu Gesellschaft sehr unterschiedlich behandelt, und der tatsächliche Umgang kann für Außenstehende sehr undurchsichtig sein. Wie viele andere zitiert etwa Hillary Clinton den Ex-Präsidenten des Iran, Mahmoud Ahmadinedschad, mit der Aussage: »Anders als in Ihrem Land haben wir im Iran überhaupt keine Schwulen«19 – auf den ersten Blick eine lächerliche Behauptung. Nicht erwähnt wird jedoch die damit zusammenhängende Tatsache, dass der Iran weltweit führend bei kostenlosen Operationen zur Geschlechtsumwandlung ist – was wiederum, ob einem das gefällt oder nicht, die Antwort der Islamischen Republik auf die Forderungen lokaler Aktivisten ist.20 In verschiedenen muslimischen Gesellschaften wie bei den Paschtunen Afghanistans wiederum findet sich als Gegenstück zum abgeschotteten Leben der Frauen der Brauch erwachsener Männer, sich jugendliche »Liebhaber« zu nehmen. Gesellschaften wie Saudi-Arabien, die Homosexuelle mit Körperstrafen belegen oder sogar hinrichten, sind zutiefst heuchlerisch und bösartig grausam. Wie solchen barbarischen Praktiken entgegengetreten werden kann, ist eine komplexe Frage, die jedenfalls nicht gelöst werden kann, indem man überall Schwulenparaden erzwingt. Die Vereinigten Staaten, die ursprünglich für ihren repressiven Puritanismus bekannt waren, haben sich erst sehr spät offiziell zur sexuellen Befreiung bekannt, aber wie man weiß, gibt es keinen größeren Eifer als den der Neubekehrten. In der Atmosphäre nach 1968 war der Umgang mit sexueller Befreiung und vor allem mit Schwulenrechten in den USA durch politischen Protest charakterisiert. Hinzu kamen glitzernde Paraden und die Forderung an jedermann, sich zu »bekennen«. Inzwischen haben sich die USA innerhalb kürzester Zeit zum Missionar ihrer gerade erst entdeckten universellen sexuellen Werte entwickelt und verlangen von anderen Ländern, denselben Umgang und dieselben Formen einschließlich der Schwulenparaden zu übernehmen. Diese Umgangsformen sind in westlichen Ländern wie Deutschland zu Hause – aber sonst eben nicht überall. Hillary Clinton ist besonders stolz auf ihre Rede vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen am 6. Dezember 2001,21 in der sie auseinandersetzte, dass »LGBT-Rechte Menschenrechte sind«22, aber die Verwendung dieser Abkürzung scheint unangebracht, wenn man sich an die ganze Welt wendet. Es sollte auch in ganz normalem Englisch möglich sein zu erklären, dass kein Mensch wegen seiner sexuellen Orientierung grausam behandelt werden sollte. 59 Ende 2013, als die USA schon intensiv mit Plänen beschäftigt waren, die Ukraine aus ihrer traditionellen wirtschaftlichen Partnerschaft mit Russland herauszulösen und sie als Basis für eine antirussische Offensive zu benutzen, war Russlands Präsident Wladimir Putin fast ausschließlich mit seiner Rolle als Gastgeber der Olympischen Winterspiele in Sotschi befasst. Die Teilnehmer der Spiele sprachen später mit Begeisterung davon, doch die westlichen Medien konzentrierten sich vor und sogar während der Spiele auf alles, was vielleicht kritikwürdig sein könnte, besonders auf die angebliche Gefahr für schwule Athleten. Die Weltmedien lieben normalerweise Sport, aber diesmal war das nicht der Fall. Neben der akribischen Untersuchung von Hoteltoiletten betrieben die Medien eine Angstkampagne, in der sie die Frage aufwarfen, ob es in Sotschi zur Verhaftung von Schwulen kommen würde. Diese imaginäre Gefahr trug zur wachsenden Dämonisierung des russischen Präsidenten bei. Die Anti-Putin-Kampagne konzentrierte sich auf einen Zusatz zum russischen Kinderschutzgesetz, der im Juni 2013 mit überwältigender Mehrheit von der Duma angenommen wurde und der die Propagierung »nicht-traditioneller sexueller Beziehungen« in Gegenwart Minderjähriger verbietet. Diese Maßnahme verbietet keineswegs die Homosexualität, verfolgte aber sehr wohl die Absicht, »Schwulenparaden« zu verhindern, die von vielen Russen als vom Westen gesponserte Provokationen betrachtet werden. Das Gesetz beruht auf der fragwürdigen Annahme, dass öffentlich zugängliche Informationen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen als normal darstellen, Kinder auf sexuelle Abwege führen könnten. Indem es Homosexualität implizit mit Pädophilie in Verbindung bringt, hat dieses Gesetz, vor allem zu einer Zeit konservativer Gegenreaktionen nach dem Fall des Kommunismus, einen negativen Einfluss auf Bemühungen zur Überwindung der Vorurteile gegen Homosexuelle. Bürger im Westen, die sich wirklich um dieses Problem sorgen, sollten sich darüber klar werden, dass das Insistieren des Westens auf der Abhaltung von Schwulenparaden in Russland zwar sicher nicht, wie von russischen Kirchenführern behauptet, die Absicht verfolgt, »Kinder zu korrumpieren«, aber dass es sehr wohl dazu dienen soll, Unruhe zu erzeugen, und Putin und die russische Führung in Verlegenheit zu bringen. Im heutigen Russland ist die christlich-orthodoxe Kirche nicht das einzige Hindernis für eine tolerantere Haltung gegenüber Homosexualität. Der auf das Ende der UdSSR folgende Zusammenbruch der russischen Gesellschaft in den 1990ern war begleitet von einem dramatischen 60 Sinken der Bevölkerungszahl.23 Ein Aspekt der Bemühung Putins zur Wiederbelebung der Nation ist der Versuch, eine Geburtenrate zu erreichen, die Russlands demografischen Fortbestand ermöglicht. Die Bemühungen feindseliger westlicher Mächte zur Förderung von Homosexualität werden daher leicht als Versuche interpretiert, das Überleben des Landes überhaupt in Frage zu stellen. Wer gute Absichten verfolgt, sollte sich auch fragen, wie diese wahrgenommen werden. Hinzu kommt, dass die internationale Kampagne für LGBT-Rechte von Anfang an durch die Doppelmoral der USA vergiftet war. Wenn SaudiArabien Homosexuelle hinrichtet, bleibt der Protest zahnlos und ist nicht von Boykott- oder Sanktionsdrohungen begleitet. Das steht in starkem Kontrast zu dem Wutgeheul über die nichtexistenten Probleme für Schwule in Sotschi. Die unverfrorene politische Ausschlachtung des Themas für Angriffe auf den russischen Präsidenten erzeugt in Russland – genau wie beabsichtigt – Spannungen zwischen den Verteidigern der Tradition und Kräften, die ihr Land ihrem Idealbild vom Westen angleichen wollen. Für Erstere, die gegenwärtig wohl die Mehrheit bilden, bestätigt der ganze Lärm den Eindruck, die westlichen Forderungen nach Schwulenparaden seien Teil einer vielfältigen Kampagne zur Schwächung und Niederringung Russlands, bei der es schlicht darum gehe, »Dekadenz« zu verbreiten. Wenn der Westen sich ansonsten Russland gegenüber freundlich verhielte, lägen die Dinge vielleicht anders. Aber im gegenwärtigen Klima werden diese Predigten von vielen in Russland als feindseliger Akt verstanden – und das sind sie auch. Wie russische Aktivisten für Schwulenrechte Journalisten während der Sotschi-Spiele erklärten, könnte ihr Anliegen unter der aggressiven westlichen LGBT-Agitation tatsächlich leiden – denn so wurden vor allem Verdächtigungen entfacht und Schwule mit einem aggressiven Westen in Verbindung gebracht. Wenn es Washington wirklich um die sexuellen Rechte in Russland ginge, wäre eine diskretere Herangehensweise wesentlich hilfreicher. Indem man Schwule und Lesben in die Frontlinie eines bedrohlichen »Konflikts der Zivilisationen« rückt, leistet man ihnen, vorsichtig ausgedrückt, keinen Dienst. So ändern sich die Zeiten. Es ist fast komisch, daran zurückzudenken, dass J. Edgar Hoover und Senator Joe McCarthy zu Beginn des Kalten Krieges Homosexualität und Kommunismus gemeinsam als die Hauptbedrohung Amerikas ausmachten. Doch während die USA seitdem sexuell freier geworden sind, wurde Russland konservativer, christlicher 61 und puritanischer. Der Westen wetterte jahrzehntelang gegen den »gottlosen Kommunismus« Russlands. Jetzt ist Russland ein Land, in dem die christlich-orthodoxe Kirche nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erneut an Einfluss gewonnen hat. Nach den Demütigungen und der Verwirrung der zehn Jelzin-Jahre wird diese Rückwendung zur Religion von vielen als die Wiederherstellung von Würde und Moral empfunden. Außenstehende, die aufrichtig zum Wohl der Schwulen in Russland beitragen wollen, sollten das alles in Betracht ziehen und zu dem feindseligen Gezeter der US-Propagandamaschine Abstand wahren. Doch was Hillary Clinton angeht, scheint sie völlig überzeugt, der Fortschritt der Welt hänge davon ab, dass die USA allen anderen sagen, wie sie sich zu verhalten haben – vom Betstuhl bis ins Schlafzimmer. Schwulenrechte – oder besser gesagt LGBT-Rechte – sind heute der eine Bereich der Menschenrechte, in dem die USA beanspruchen können, »vor« den meisten anderen Ländern der Welt zu liegen. Damit kann das Thema genutzt werden, um andere Länder zu diskreditieren und in Verlegenheit zu bringen – zu einer Zeit, in der die USA auf vielen anderen Gebieten wie Kindersterblichkeit, Einkommensungleichheit, Lebenserwartung, Elementarschulbildung und industrielle Produktivität immer weiter zurückfallen, aber dafür mit weitem Abstand die Nummer eins in der absoluten und relativen Zahl ihrer Strafgefangenen sind. Und das ist sicherlich ein wichtigeres Kriterium für »Menschenrechte« als die Schwulenehe. Machtgewinn durch Religion Westlich des Atlantiks ist Multikulturalismus schlicht ein Begriff für die naturwüchsige Zusammensetzung einer Einwanderungsgesellschaft wie die der Vereinigten Staaten oder Kanadas. Aus Sicht der USA jedoch bedeutet die Propagierung des Multikulturalismus auch Reklame für eine Form von weltweiter Amerikanisierung. Die USA können sehr gut mit einer Mischung von Religionen leben, weil die offizielle Religion der Vereinigten Staaten die Vereinigten Staaten selbst sind. In den Schulen des Landes wird »Amerika«, die »eine Nation unter Gott«, jeden Tag mit ultrakonformistischen Hommagen an Flagge und Streitkräfte gefeiert – was in Europa als unheilvoll nationalistisch betrachtet würde. Hillary Clinton hat übrigens ihre Loyalität gegenüber dieser Staatsreligion demonstriert, indem sie als Mitsponsorin einer Gesetzesvorlage fungierte, 62 die die Verbrennung der US-Flagge zu einem Bundesverbrechen gemacht hätte. In Einwanderungsgesellschaften ist »Multikulturalismus« keine Gefahr für den Zusammenhalt des Landes: Die Vereinigung verschiedener Identitäten ist sogar grundsätzlicher Teil seiner Identität. Für US-Bürger kann das Wort »multikulturell« kaum mehr bedeuten als die freie Wahl zwischen Pizza, Burritos oder Sushi, bevor sich alle um die Flagge scharen. In den USA ist Religion im Wesentlichen Geschmackssache. Jede Religion ist in Ordnung, weil Religion an sich als etwas Gutes gilt. Das Land hat ein pragmatisches Verhältnis zur Religion, das sich in über zweihundert Jahren bewährt hat. Aber das ist nicht notwendigerweise auf die ganze Welt übertragbar, besonders nicht auf Orte, wo der Glaube bestimmte Formen des Verhaltens verlangt, die stark das Alltagsleben bestimmen. Tatsächlich ist Religion in den USA sehr weitgehend etwas Praktisches und außerdem, wie der eigene Stil, ein Faktor der persönlichen Identität. Während theologische Begriffe eher vage bleiben, bringen Amerikaner gern religiösen Glauben mit Moral in Verbindung und sind der Meinung, Menschen, denen das Konzept der göttlichen Bestrafung fehlt, könnten auch kein Gewissen haben. Es scheint in der Bevölkerung keine echte Anerkennung einer rationalen, sozialen oder angeborenen Grundlage für Gewissen und Moral zu geben. Das führt dazu, dass Leute – darunter besonders solche mit politischen Ambitionen, die andere von ihrem moralischen Charakter überzeugen wollen – ihren religiösen Glauben gern zur Schau stellen. Es kommt nur darauf an, überhaupt religiös zu sein, und dafür ist jede Religion recht. Dabei verhindert die Trennung zwischen Staat und diversen Einzelkirchen keineswegs die wachsende Symbiose zwischen Staat und einer Art von »Einheitsreligiosität«. Hillary Clinton hat eine typisch amerikanische Haltung zur Religion. Als Methodistin aufgewachsen, sagt sie, sie beziehe immer noch Inspiration aus der Bibel – aber offensichtlich nicht aus folgender Passage aus dem Matthäus-Evangelium: »Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten öffentlich.«24 63 Seit 1993 pflegt Hillary die Gewohnheit regelmäßiger öffentlicher Betstunden, sei es in Gruppen zum Bibelstudium, beim hochkarätigen jährlichen Washingtoner Gebetsfrühstück oder beim wöchentlichen Gebetsfrühstück im Senat. Man scheint in Washington vergessen zu haben, dass ostentatives Beten in weiseren Zeiten als unseren immer als etwas betrachtet wurde, das in der Politik nichts zu suchen hat – und zwar aus dem simplen Grund, dass nichts leichter vorzutäuschen ist als Frömmigkeit oder eine spezielle Beziehung zum Allmächtigen. Solche Art Beten wurde früher allgemein als offensichtlichstes Zeichen für Heuchelei angesehen. Bei den Gebetsveranstaltungen in Washington geht es vor allem um Macht. Sie werden von einem konservativen Netzwerk veranstaltet, das sich »Gemeinschaft« oder »Familie« nennt und an dessen Spitze der höchst überkonfessionelle, 1928 geborene Presbyterianer-Priester Douglas Coe steht. Seine Mission besteht darin, Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt in einer Art Gemeinschaft der Führer zusammenzubringen, in der sie das Privileg, »von Gott« für eine Führungsrolle erwählt worden zu sein, miteinander teilen und Gott um Rat bitten, wie sie diese Rolle ausfüllen sollen. Hillary beschrieb Coe als »eine einzigartige Gestalt in Washington: einen wahrhaft liebevollen spirituellen Mentor und Wegweiser für jedermann ungeachtet von Partei oder Glauben, der seine Beziehung zu Gott vertiefen möchte«25. Aber leider kann beim Nationalen Gebetsfrühstück nicht jeder dabei sein; die Teilnahme kostet über vierhundert Dollar und die Gäste werden sorgfältig auswählt. Das Ziel ist nichts Geringeres als die Gemeinschaft der Mächtigen, die zusammenarbeiten, um »Gottes Werk zu tun« – was immer das sein mag. Dabei ist die Verteidigung dieser Macht natürlich erste Priorität, um die guten Werke überhaupt erst möglich zu machen. Oder wie Doug Coe sagt: »Wir arbeiten mit der Macht, wo wir können, und bauen neue Macht auf, wo das nicht möglich ist.«26 Hillarys Religion baut auf ihrem früheren Studium der konservativen Schriften Reinhold Niebuhrs und Paul Tillichs während des Kalten Kriegs auf und ist ein extrem utilitaristischer Glaube, der dem eigenen Machtgewinn dient und kaum sozialen Gehalt hat. Das Werk für die Gemeinschaft ist ein erklärtes Ziel, dient aber vor allem zur Sicherung der eigenen Erlösung, da in dieser unvollkommenen Welt nun einmal wenig Hoffnung besteht, etwas zu erreichen. Wie sich der Pastor ihrer Methodistenkirche in Arkansas erinnert, ist Hillary überzeugt, sie sei »vom Herrn berufen, wo immer er es will, der Öffentlichkeit zu dienen«.27 Es ist durchaus möglich, dass sie glaubt, zur Präsidentin 64 auserwählt zu sein. Hillarys unübersehbare Religiosität hat die ursprüngliche Feindseligkeit der konservativsten rechten Republikaner ihr gegenüber gedämpft. Sie schloss sich dem fromm-katholischen Senator Rick Santorum an, als er vergeblich die Wiedereinführung des »Workforce Religious Freedom Act«28 vorschlug, das von zahlreichen religiösen Gruppen unterstützt, aber von der Amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU abgelehnt wurde. Dieses Gesetz hätte es Arbeitnehmern paradoxerweise erleichtert, die Mitarbeit bei gesetzlich erlaubten Maßnahmen wie etwa Abtreibung oder dem Verkauf von Verhütungsmitteln zu verweigern, sofern diese gegen ihre Überzeugungen verstoßen. Solch eine Religiosität, die kaum eine kohärente Theologie oder einem intellektuellen Gehalt hat, reduziert sich weitgehend auf Selbstermächtigung und ist zudem oft mit konservativen Haltungen zu Sexualität und Reproduktionsfragen gepaart. Die Gebetsfrühstücke sind die Religion einer unter sich bleibenden Machtelite – von Personen, die durch ihren persönlichen Ehrgeiz dahin gelangten, wo sie sind, aber lieber Gott dafür verantwortlich machen. Auch viele US-Politiker, die nicht an Doug Coes Gebetsfrühstücken teilnehmen, benutzen die Religion auf ähnliche Art: für den Gewinn an nationaler Macht. Die öffentlichen Gebete der Präsidenten und die Bezugnahme auf »unsere Werte« heben die Heuchelei persönlicher Bigotterie auf eine nationale und sogar internationale Ebene. Die Parole »Gott mit uns« im Ersten Weltkrieg bezog sich auf den christlichen Gott des deutschen Volkes, aber »Wir vertrauen auf Gott« hat absolut ökumenischen Charakter und ist genau wie der Dollar für alle da. Unter Fremdeinfluss Das ständige Denken in Begriffen ethnischer Identitäten und religiöser Gruppen wird oft als Zeichen von Toleranz in einer multikulturellen Welt betrachtet. In Wirklichkeit hat es jedoch das entgegengesetzte Resultat und schürt Konflikte, weil es unvermeidlich dazu tendiert, statt gemeinsamer Werte und Ziele die Unterschiede hervorzuheben. Als die Clintons mit den ersten Vorstößen zum Neuarrangement der Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches auf dem Balkan und im Nahen Osten begannen, hatten sie – religiös interessiert, wie sie es waren 65 – ihren Augenblick der Faszination durch den Islam. Sie ergriffen in Bosnien ja auch die Partei der Muslime gegen die christlichen Serben und im Nahen Osten die der (wie sie glauben) »moderaten« Muslime gegen »Diktatoren« wie Saddam Hussein. Dieses neue Engagement in einem ihnen unbekannten Teil der Welt ermutigte Hillary vermutlich, eine besonders enge Beziehung zu einer glamourösen jungen Muslimin namens Huma Abedin zu entwickeln. Huma wurde 1976 in Michigan geboren, aber ihre Familie übersiedelte schon zwei Jahre später nach Saudi-Arabien, wo ihr pakistanischer Vater Zyed Abedin von der Muslimischen Weltliga (MWL) angestellt worden war, um für das Institut für Angelegenheiten Muslimischer Minderheiten (IMMA) zu arbeiten. Das Institut war Bestandteil der saudischen Außenpolitik und hatte die Aufgabe, muslimische Minderheiten in nicht-muslimischen Ländern zu unterstützen und zu beeinflussen. Nach Zyeds Tod 1993 übernahm Humas Mutter Saleha Mahmood Abedin Führung und Zeitschrift des IMMA sowie wichtige Positionen in der MWL und im Internationalen Islamischen Komitee für Frau und Kind. Sie gründete die muslimische Schwesternschaft, eine Organisation, zu der auch die Frauen wichtiger muslimischer Führer wie die Gattin des 2013 abgesetzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi gehörten. Die ganze Familie war an der Arbeit für IMMA beteiligt, und so auch Huma. Kurz, ihre Familie war prominent in internationalen islamischen Angelegenheiten. 1994 kehrte Huma im Alter von achtzehn Jahren in die USA zurück, um an der George Washington University in der Hauptstadt zu studieren, und zwei Jahre später begann sie mit ihrer Arbeit als Praktikantin im Weißen Haus unter Clinton. Hillary adoptierte sie bald als engste Assistentin und Expertin für nahöstliche und muslimische Angelegenheiten. Die öffentlichen Äußerungen Hillarys machen klar, dass sie von Huma begeistert war: von ihrer Kompetenz, ihrer Selbstsicherheit und natürlich ihrer intimen Kenntnis einer Welt, die für Hillary Rodham Clinton exotische und sogar romantische Züge trug. In ihren schicken Designerkostümen wurde die aparte Huma in den nächsten fünfzehn Jahren zu einem höchst augenfälligen Bestandteil der Hillary-ReiseShow. Die beiden Frauen standen einander so nah, dass einige europäische Zeitungen sogar über die Art ihrer persönlichen Beziehung spekulierten. Wirklich interessant ist jedoch, dass Huma Hillarys Sicht auf den Islam und den Nahen Osten unzweifelhaft stark beeinflusst hat. Die Unterstützung Washingtons für die muslimischen Parteien im jugoslawischen Bürgerkrieg hat so auch eine persönliche Note 66 bekommen. Sowohl der Nahe Osten als auch die politischen Interessengeflechte unter Muslimen sind hochgradig komplex, und es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass ein derartiges Vertrauen in eine einzelne, anziehende junge Frau Huma Abedin unvermeidlich in eine »Frau mit Einfluss« verwandelte, auch wenn dies letztlich durch Zufall so gekommen ist. Angesichts des intensiven Engagements der Abedin-Familie für das IMMA ist es nicht überraschend, dass Hillary als eine ihrer ersten Amtshandlungen als US-Außenministerin das »Amt des US-Botschafters bei den Muslimische Gemeinschaften« einrichtete. Dieser Schritt wurde vermutlich durch das IMMA angeregt, dessen Rolle ja in der Erhaltung des Islams in den Diaspora-Gemeinden der nicht-muslimischen Länder besteht, während der US-Repräsentant auch das Ziel verfolgt, Brücken zwischen diesen Gemeinschaften und den Vereinigten Staaten zu bauen. Am 15. September 2009 vereidigte Hillary die erste Amtsträgerin, eine attraktive junge Frau und Freundin Humas namens Farah Pandith. Bei der Vereidigungszeremonie erläuterte Hillary, die Repräsentantin werde runde Tische mit Muslimen in Europa organisieren, die »pluralistischen Werte« der USA verbreiten und auf Basis dessen, was wir »als Menschen des Glaubens« gemeinsam haben, »starke Partnerschaften« mit muslimischen Gemeinschaften rund um die Welt aufbauen.29 Das scheint in Einklang mit diversen US-Initiativen zu stehen, »junge Führer« in anderen Ländern ausfindig zu machen und zu fördern – in diesem Fall junge Muslime in Europa. Was immer ihre sonstigen Fehler sein mögen, so kümmern sich ernsthafte Weltmächte doch in der Regel genügend um ihre nationalen Interessen, um dafür zu sorgen, dass eigene Experten darin ausgebildet werden, andere Teile der Welt zu verstehen und erklären. Als ein Land von Einwanderern beherbergen die USA militante Auslandsgemeinden, die solche Experten (wenn sie denn existieren) verdrängen und die Außenpolitik beeinflussen können, indem sie sich an Kongressmitglieder wenden. Die Israel-Lobby ist das extremste, aber nicht das einzige Beispiel für den Einfluss einer fremden Nation auf den Kongress. Ebenfalls berüchtigt ist die »kubanische« Lobby. Doch im Fall von wenig vertrauten Gebieten oder Ländern gelingt es manchmal schon einer Handvoll Personen, den größten Teil des Kongresses auf die eigene Seite zu ziehen, da die Abgeordneten meist zu beschäftigt mit innenpolitischen Themen sind, um mehr als eine völlig oberflächliche Vorstellung von internationalen Fragen zu haben. Natürlich hat Hillary Clinton – unterstützt von Senator McCain – 67 sämtliche Mutmaßungen, Huma Abedin könne eine ins Weiße Haus geschleuste saudische Agentin sein, scharf zurückgewiesen.30 Aber selbst wenn die Verdächtigungen völlig unbegründet sein sollten, ist es unseriös für eine Außenministerin, sich in ihrer Interpretation des Nahen Ostens so stark auf eine junge Frau mit diesem Hintergrund zu verlassen. Doch zu einer Zeit, als die USA die Unterstützung der Muslime in Bosnien und im Kosovo aus diversen Gründen als geostrategisch nützlich betrachteten, war eine sentimentale Neigung zum Islam ein möglicher Weg, »Interessen und Ideale« zu vereinen. Mit Huma an ihrer Seite konnte Hillary die Illusion verbreiten, Washingtons promuslimische Politik im Balkan baue tatsächlich eine echte Freundschaft zwischen den USA und der islamischen Welt auf. Im Juli 2010 heiratete Huma Abedin einen linksliberalen Kollegen Hillary Rodham Clintons, den Brooklyner Demokraten Anthony Weiner. Weiner legte in seiner Parlamentskarriere einen Schnellstart hin, als er im Vorwahlkampf der Demokraten seinen stark jüdisch geprägten Bezirk anonym mit Flugblättern bepflasterte, in denen er seine Gegner mit den führenden schwarzen Politikern Jesse Jackson und David Dinkins (damals Bürgermeister von New York) in Verbindung brachte.31 Zum Zeitpunkt seiner Hochzeit mit Huma schien Weiner eine aussichtsreiche Zukunft als möglicher neuer Bürgermeister New Yorks vor sich zu haben. Allerdings ging seine Karriere dann durch Enthüllungen über exhibitionistische Eskapaden auf Twitter zu Bruch.32 Weiner war immer ein glühender Anhänger Israels. Er unterstützte die Invasion des Irak 2003 und im Mai 2006 versuchte er, der palästinensischen Delegation den Zugang zu den Vereinten Nationen zu verwehren, indem er erklärte, sie »sollten schon mal anfangen, ihre kleinen palästinensischen Terroristenkoffer zu packen«33. Er bezichtigte selbst die pro-israelische New York Times der Voreingenommenheit gegen den jüdischen Staat. Nach den Angriffen auf die Twin Towers vom 11. September 2001 stellte sich Weiner an die Spitze von Bemühungen im Kongress, die US-Waffenverkäufe an Saudi-Arabien zu beenden. Er beschuldigte das Land, eine »Geschichte der Finanzierung des Terrorismus« zu haben und Kinder den Hass auf Christen und Juden zu lehren.34 So mag es paradox erscheinen, dass Huma Abedin mit ihrem explizit saudischen und muslimischen Hintergrund ausgerechnet einen zionistischen Juden wie Weiner heiratete. Und doch verkörpert ihre überraschende interkonfessionelle Ehe ein Kernmerkmal der clinton68 schen Außenpolitik: eine faktische Allianz zwischen Saudi-Arabien und Israel. Dieses Bündnis mag, ebenso wie die Abedin-Weiner-Ehe, seltsam und gewagt erscheinen, ist aber inzwischen ein wichtiger Faktor in der Weltpolitik. In beiden Allianzen gibt es sicher vieles, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß. Auslandsgemeinden und ihre Unzufriedenheit Als relativ junge Nationen, die durch Masseneinwanderung entstanden sind, sind die USA (und Kanada) schon ihrem Wesen nach multikulturell, und zwar auf eine Art, die im größten Teil der restlichen Welt nicht funktionieren würde. Die Vereinigten Staaten haben durch die Kraft ihrer sehr stark ausgeprägten und vereinenden Nationalideologie unzählige Menschen aus verschiedenen Kulturen absorbiert. Als Einwandererland sagen sie sich selbst, sie seien eine Ausnahme, weil so viele Menschen sie zum Ziel gewählt haben, was sie für die ganze Welt zum absoluten »Land der Wahl« mache. Als solches müssen sie verkörpern, was die Menschen wirklich wollen – es macht sie zum Modell, dem andere folgen sollten. Diese tiefsitzende Überzeugung hat manchmal böse Auswirkungen auf die Außenpolitik des Landes. So waren wohlhabende und einflussreiche Exilanten oft imstande, Politikern in Washington einzureden, die Menschen in ihren Heimatländern sehnten sich nach Amerikanisierung und bräuchten nur einen Anstoß des Pentagons, um die Exilanten an die Spitze einer wunderbar perfekten Demokratie zu stellen. Daneben wird auch noch die Rekrutierung sogenannter Vertreter der Zivilgesellschaft betrieben, die nicht nur zur Beeinflussung anderer Länder, sondern auch der US-amerikanischen Öffentlichkeit benutzt werden können. Das ist besonders im Nahen Osten der Fall gewesen, wo die Hauptbefürworter der US-Kriege immer wieder Einheimische in ihre Dienst nehmen, um Feindseligkeiten gegen deren Heimatländer zu rechtfertigen. Die USUnterstützung der Rebellen in Syrien etwa begann keineswegs erst mit den Unruhen des »Arabischen Frühlings« Anfang 2011. Schon im Februar 2006 verkündete die Bush-Administration, sie werde fünf Millionen Dollar in Form von Zuschüssen bewilligen, um »das Werk der Reformer in Syrien zu beschleunigen«. Offenbar zum Zweck, an dieses Geld heranzukommen, gründete daraufhin eine Gruppe syrischer Exilanten in Europa die »Bewegung für Gerechtigkeit und Demokratie«, die in – von 69 WikiLeaks veröffentlichten – diplomatischen Telegrammen der USA als »liberale, moderate Islamisten« beschrieben werden, in Wirklichkeit aber ehemalige Mitglieder der Muslimbruderschaft waren.35 Viele weitere solcher Dissidenten im Exil wurden durch eine Reihe verschiedener Kanäle gefördert und oft dazu benutzt, wohlmeinende Gruppen in den USA davon zu überzeugen, dass »die Menschen in ihren Heimatländern« eine US-Intervention gegen ihren »Diktator« und zu ihrer Unterstützung wünschten. Vielleicht der berüchtigtste dieser sehr erfolgreichen internationalen Betrüger war lange Zeit der im November 2015 verstorbene Iraker Ahmed Chalabi, ein schiitischer Exilant, der sich im Vorfeld der Invasion des Irak 2003 mit führenden US-amerikanischen Neocons anfreundete. Mit seinen Berichten überzeugte er das Pentagon, das Außenministerium, den Kongress und die New York Times davon, Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen und unterhalte Verbindungen zu al-Qaida. Chalabi betrieb einen profitablen Handel mit dem Verkauf der Fantasien irakischer Exilanten und stellte den Kontakt zwischen dem berüchtigten »Erfinder« irakischer Massenvernichtungswaffen namens »Curveball« und einem dankbaren und großzügigen Pentagon her. Nachdem die USA seinem Rat zur Intervention gefolgt waren, erhielt Chalabi die Befugnis, sämtliche Sunniten aus dem eroberten irakischen Staatsapparat zu entfernen – mit Folgen, die bis heute andauern. Auf den Knochen von Hunderttausenden von Toten hat Chalabi bis zum letzten Moment Geld verdient und sich erhofft, die verbliebenen schiitischen Trümmerstücke des Irak zum eigenen Nutzen aufzusammeln. Die französischen Nachrichtendienste waren der Ansicht, Chalabi sei ein iranischer Agent, aber in Washington liebte man ihn.36 Es ist einfach so, dass die Politiker in Washington nicht sehr gewitzt darin sind, die wirklichen Absichten schlauer Exilanten aus exotischen Regionen zu durchschauen. Das sollte ein Grund sein, mit außenpolitischen Abenteuern vorsichtig zu sein, aber diese Lektion wird offensichtlich ignoriert. Solche Diaspora-Lobbys können Kongressmitglieder, die wenig über die Welt außerhalb der USA wissen, noch wirksamer beeinflussen, wenn sie ihre Geschichten durch großzügige Wahlkampfspenden ergänzen. Selbst einer eher unbedeutenden Diaspora wie der der Albaner gelang es, sich Unterstützung im Kongress zu verschaffen, indem sie Einfluss auf einen einzelnen wichtigen Abgeordneten gewann. In den 1980ern entdeckte der republikanische Ex-Kongressabgeordnete Joe DioGuardi seine albanischen Wurzeln wieder und gründete ein pro-albanische 70 Lobby, die Wahlkampfspenden für den republikanischen Senator und Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei im Jahr 1996, Bob Dole, sammelte. Nachdem er von Mira Baratta, Enkelin eines Mitglieds der faschistischen kroatischen Ustascha-Bewegung und Mitglied seines Mitarbeiterstabs, über die Geschichte des Balkans aufgeklärt worden war, erklärte Dole 1993, die Serben seien »ungebildete Perverse, Kindermörder und Vergewaltiger«, die alle »in Konzentrationslager nach Art der Nazis gesteckt werden soll-ten«.37 (Tatsächlich hatten die kroatischen Ustaschen während des Zweiten Weltkriegs genau das getan.) Sein demokratischer Kollege Joe Biden teilte diese Art von »Identitätspolitik« im Umgang mit dem Balkan, die die Welt in »unsere Freunde« und eine Spezies von Untermenschen aufspaltet. US-Bürger serbischer Herkunft hatten nie eine derart effektiv organisierte Lobby und gaben sich stattdessen der naiven Erwartung hin, in den USA erinnere man sich daran, dass 1944 Hunderte von US-Piloten, die über dem Nazi-besetzten Serbien abgeschossen wurden, vom antifaschistischen serbischen Widerstand gerettet worden waren. Im Gegensatz dazu waren es gerade diejenigen jugoslawischen nationalen Gruppen, die Verbündete der Nazis gewesen waren, die sich nun begierig als die besten Freunde der USA präsentierten. Die wohlhabende Israel-Lobby hat es inzwischen durch Einladungen zu kostenlosen Inklusivreisen nach Israel und Wahlkampfspenden (begleitet von der stillschweigenden Drohung einer großzügigen Finanzierung des jeweiligen Gegners, falls man aus der Reihe tanzt) geschafft, praktisch den gesamten Kongress zu kaufen. Aber im Lauf der Jahre haben auch die chinesischen Nationalisten, die KubaLobby, ExilIraker, Exil-Iraner und jetzt die Lobby der Ukrainer ihre großen Augenblicke gehabt. Die antirussische ukrainische Diaspora mit ihren semi-nazistischen Wurzeln hat seit Beginn des Kalten Krieges immer beträchtlichen Einfluss in Washington gehabt. Immigranten und Exilierte, die die Macht der USA nutzen wollen, um den Kurs ihrer Herkunftsländer zu beeinflussen, können zu diesem Projekt beitragen, indem sie in den USA Stimmung gegen Führer machen, die sie gerne stürzen wollen. Umgekehrt können sie genutzt werden, wenn Washington missliebige Regierungen durch willfährige Regimes ersetzen möchte. Eine weitere Art, das Potential der Exilanten außenpolitisch zu nutzen, wurde gegen Ende des Kalten Krieges von dem ehemaligen USBotschafter und führenden Politiker Morton Abramowitz entwickelt, der 1991 bis 1997 Präsident der Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden war. Angesichts eines drastischen Mangels an »Bedrohungen« fand 71 Abramowitz eine neue Rechtfertigung für eine aktive Außenpolitik, die auf der Förderung nicht nur der US-Interessen, sondern auch der US-»Ideale« basierte. »Amerikanische Ideale und amerikanisches Eigeninteresse verschmelzen miteinander, wenn die Vereinigten Staaten die weltweite Ausbreitung der Demokratie unterstützen – oder dessen, was wir lieber >beschränkte< verfassungsmäßige Demokratie nennen, also die Herrschaft einer Regierung, die durch freie Wahlen legitimiert wurde«, war die Schlussfolgerung einer von Abramowitz geleiteten Studie, die in einer Publikation der Stiftung von 1992 mit dem Titel Self-Determination in the New World Order zusammengefasst wurde.38 Die Autoren dieser Studie machen keinen Hehl daraus, dass die »neue Weltordnung« von nun an »eine Welt mit nur einer Supermacht, den Vereinigten Staaten« sein werde, »in der die Herrschaft des Gesetzes an die Stelle des Gesetzes des Dschungels tritt, Streitigkeiten friedlich geregelt werden, Aggressionen fest durch kollektiven Widerstand zurückgewiesen werden und jedermann gerecht behandelt wird«. Dabei darf diese künftige »Herrschaft des Gesetzes« nicht mit dem heutigen internationalen Recht verwechselt werden. Stattdessen wird sie unter dem Einfluss der USA entwickelt werden. »Das internationale Recht wird – wie auch schon früher immer – auf das Verhalten der Nationen und das Handeln multilateraler Institutionen reagieren und sich ihnen anpassen.« Ein Hauptmerkmal dieser »neuen Weltordnung« wird die Schwächung, ja sogar Zerstörung, der nationalen Souveränität sein, die bisher die Basis des Völkerrechts darstellte. Die Souveränität der einzigen Supermacht kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, doch für andere Nationen könnte dieses Konzept veraltet sein. Die souveräne Nation wird von außen, durch den Druck der wirtschaftlichen Globalisierung zerstört. Aber sie kann auch von innen, durch Aufstände im Land selbst, untergraben werden. In der Welt nach dem Kalten Krieg, so die Carnegie-Studie, »fordern innerstaatliche Gruppen im Namen der Selbstbestimmung Unabhängigkeit, mehr Autonomie oder den Sturz der bestehenden Regierung«. Im Hinblick auf diese Konflikte »fordern die amerikanischen Interessen und Ideale eine aktivere Rolle«. Dies kann bis hin zu einer Militärintervention gehen, wenn Forderungen nach Selbstbestimmung oder die Unterdrückung solcher Forderungen zu einer »humanitären Krise« führen. In Zukunft, so die Autoren schon 1992, »werden humanitäre Interventionen immer unvermeidlicher werden«. Die USA werden das letzte Wort dabei haben, wo und wie interveniert wird: »Die Vereinigten Staaten sollten 72 versuchen, in regionalen und internationalen Organisationen einen Konsens für ihre Position zu erreichen, aber nicht die eigenen Urteile und Prinzipien opfern, wenn sich solcher Konsens nicht erzielen lässt.« Kurz: Wir sind offen für eine Koalition der Willigen – derer, die willig sind, uns zu folgen. So wurde das Konzept der »humanitären Intervention« vom Abramowitz-Team entwickelt, nur kurz bevor es in Jugoslawien dann in die Praxis umgesetzt wurde. Und die, die zur Praxis schritten, waren Mitglieder ebenjenes Teams. Selten hat die Realität die Fiktion so rasch imitiert. Unter den Abramowitz-Schülern, die die USA und die NATO in Jugoslawien in den Krieg führten, waren Richard Holbrooke, Madeleine Albright, der Sonderbotschafter für Kriegsverbrechen David Scheffer, der Planungsdirektor des US-Außenministeriums Mor-ton Halperin sowie der außenpolitische Experte von Vizepräsident Al Gore, Leon Fuerth, der später mit der Durchführung der Sanktionen gegen Serbien beauftragt wurde. Es scheint fast so, als habe dieses Team sein Stück in der CarnegieStiftung geprobt, bevor es daranging, es auf der Weltbühne aufzuführen. Jugoslawien war das Versuchslabor für die Verteidigung des »Multikulturalismus« – produziert wurde jedoch das genaue Gegenteil. Eine multikulturelle Nation wurde gewaltsam in ethnisch monokulturelle Ministaaten aufgespalten (obwohl zu Serbien immer noch ethnische Minoritäten gehören, die man dazu aufhetzen kann, weitere Teilungen des Landes zu fordern). Die linken Intellektuellen im Westen gaben ihr früheres Widerstreben auf, Kriege zu unterstützen, weil sie dem Trugbild erlagen, zur Rettung des kostbaren Ideals des Multikulturalismus in Jugoslawien sei nunmehr Gewalt erforderlich. Dieser Irrtum erklärte sich zu großen Teilen aus der geschickten Strategie der muslimischen Partei in Bosnien, die sich auf eine Art als absolut unschuldiges Opfer präsentierte, die perfekt in das Abramo-witzSzenario passte. Während sowohl bosnisch-serbische als auch bosnischmuslimische Armeen um die Kontrolle über Gebiete kämpften und irreguläre Milizen auf beiden Seiten grässliche Gewalt ausübten, hielt Alija Izetbegović, damals Präsident von Bosnien und Herzegowina, seine Truppen und von außen gelieferten Waffenarsenale sorgfältig außer Sichtweite der westlichen Medien (aber nicht der diverser islamischer Webseiten, wo die großen Siege ausländischer Mujaheddin für die Sache der Muslime stolz ins Rampenlicht gestellt wurden).39 Dies hinterließ den Eindruck eines einseitigen Krieges, bei dem serbische Invasoren unbewaffnete bosnische Zivilisten abschlachteten. Izetbegović verfolgte 73 die Strategie, die USA zu dem zu bringen, was sie offenbar ohnehin tun wollten: nämlich auf Seiten der Muslime zu intervenieren. So wurde ein junger Amerikaner aus einer wohlhabenden, Izetbegović nahestehenden Einwandererfamilie namens Mohammed Sacirbey zum bosnischen Botschafter bei den Vereinten Nationen ernannt. An den Vorabenden zweier wichtiger UN-Beschlüsse zu Bosnien kam es jeweils zu mysteriösen Sprengstoffexplosionen auf einem Marktplatz in Sarajewo, bei denen zahlreiche Zivilisten zu Tode kamen.40 Während internationale Forensikexperten beide Male zu dem Schluss kamen, bei diesen Explosionen handele es sich wahrscheinlich um muslimische Attentate »unter falscher Flagge«, beschrieben die internationalen Medien sie sofort als absichtliche serbische Gräueltaten. Das führte dann zu Sanktionen gegen Serbien und schließlich zu den nicht sonderlich effektiven NATO-Bombenangriffen auf bosnisch-serbische Positionen – dem Beginn der »humanitären Intervention«. Die Propaganda, die die muslimische Partei in Bosnien mit »Multikulturalismus« gleichsetzte, war unter westlichen Intellektuellen außerordentlich erfolgreich. Intellektuelle in Paris gründeten unter dem Slogan »Europa lebt oder stirbt in Sarajewo« eine kurzlebige politische Partei für die Wahlen zum Europaparlament. Bernard-Henri Lévy fungierte als führender Propagandist der Auffassung, in Bosnien stehe der Prozess der europäischen Vereinigung selbst auf dem Spiel, und legte einen Kampf um die politische Kontrolle von Gebieten als rassistische Ablehnung der Muslime als »anders« aus. Die Interpretation dieses tragischen Konflikts in Begriffen ethnischer Identitäten verstellte den Blick auf politische Ursachen, die das Erbe jahrhundertealter, noch auf die Reiche der Habsburger und Osmanen zurückgehender bitterer Konflikte waren. Kommentatoren im Westen betrachteten Bosnien nun als »unser Spanien«, die Schlacht einer Generation41 – wiewohl bei ihnen statt der Bereitschaft, selbst zu kämpfen, nur die Bereitschaft vorhanden war, die NATO vorzuschicken. Unterdessen hatten die großen Mächte ihre eigenen Ziele. Deutschland nahm Rache für die Ergebnisse zweier Weltkriege. Washington hatte geopolitische Motive für seine Unterstützung der von Alija Izetbegović geführten muslimischen Partei. Eines davon war, den Muslimen der Welt zu demonstrieren, dass die Vereinigten Staaten trotz ihrer beständigen Unterstützung Israels auch ihr Verteidiger sein könnten. Ein weiteres Motiv war die Nutzung Jugoslawiens als Versuchslabor für Methoden, die später recycelt werden könnten, um den großen nordslawischen42 Staat Russland zu schwächen und zu spalten, wobei besonders bei seinem 74 muslimischen »weichen Unterleib« in Mittelasien anzusetzen wäre. Viele Politiker in Washington sahen Jugoslawien als eine Miniaturversion der Sowjetunion und Serbien als eine Art Mini-Russland. Das Auseinanderreißen des kleinen Staates konnte als Übung für das Auseinanderreißen der großen Version betrachtet werden. Einer der Hauptpferdefüße bei der Intervention in Streitigkeiten in anderen Ländern liegt darin, dass die, die intervenieren, oft von falschen Tatsachen ausgehen, sei es absichtlich oder aus Inkompetenz. In Wirklichkeit war Bosnien nie ein »multiethnisches Paradies« gewesen. Im Zweiten Weltkrieg war es nach seinem Anschluss an den antiserbischen »unabhängigen Staat« Kroatien Schauplatz einiger der schlimmsten interethnischen Schlächtereien überhaupt.43 Nach dem Krieg wurde keine der Republiken der Jugoslawischen Föderation so hart regiert wie Bosnien, gerade um die aus vergangenen historischen Konflikten ererbten Spannungen zu unterdrücken.44 Die westeuropäischen Linken glaubten, die bosnischen Muslime müssten, wie die muslimischen Einwanderer in ihren Ländern, zwangsläufig unter Diskriminierung leiden. Aber in Bosnien hatten die Muslime seit der os-manischen Eroberung jahrhundertelang die vorherrschende Kaste gebildet. Alija Izetbegović war in seinem Heimatland als politischer Islamist bekannt, der von Pakistan und Saudi-Arabien unterstützt wurde und die Auffassung vertrat, ein Land mit muslimischer Mehrheit müsse durch islamisches Recht regiert werden. Diese Aussicht führte bei vielen bosnischen Christen zu der Angst, in einem Staat zu leben, in dem Muslime bald eine absolute Mehrheit darstellen wür-den.45 Da Izetbegović sich mit politischer Unterstützung der USA als permanenter Präsident etabliert hatte, obwohl die Präsidentschaft eigentlich unter den drei Volksgruppen rotieren sollte, war es keine Überraschung, dass er nun auch das gesamte Land – einschließlich der vorwiegend ländlichen, serbisch bewohnten Gebiete, die etwa die Hälfte des Territoriums ausmachten – kontrollieren wollte. Seine Unterstützer, darunter auch professionelle USamerikanische PR-Exper-ten, taten jeden Hinweis darauf, dass Izetbegović ein Islamist und keineswegs ein Verfechter des Multikulturalismus sei, als »serbische Propaganda« ab. Während islamische Länder Izetbegović unterstützten, weil er Islamist war, unterstützte der Westen ihn, weil er »multikulturell« war. Diese Unterstützung verlängerte den Bürgerkrieg und kostete viele Menschenleben, so auch die des Massakers in Srebrenica. Nachdem der Westen sich für eine Seite entschieden hatte, übernahm eine manichäische Weltsicht das Kommando. Die eine Seite wurde als 75 Opfer, die andere als der bösartige Täter hingestellt. Unter Einfluss der Erinnerung an den Holocaust wurden die Serben von Anfang an des »Völkermords« bezichtigt. Diese Anschuldigung verband sich dann untrennbar mit dem Srebrenica-Massaker kurz vor Ende eines Krieges, der vielleicht nie begonnen hätte, hätte der Westen Izetbegović nicht zur Ablehnung jedes Kompromisses ermutigt. Die Mudschaheddin, die aus Afghanistan gekommen waren, um die muslimische Sache zu unterstützen, fanden nichts dabei, ihre »Fußballspiele« mit den Köpfen enthaupteter Serben aufzunehmen, aber solche Videos waren im westlichen Fernsehen nie zu sehen.46 Gestützt auf das Argument, die Serben hätten ja in Bosnien gezeigt, dass sie des »Völkermords« fähig seien, zogen die USA die NATO 1999 in eine militärische Intervention in Jugoslawien hinein, mit der die »Kosovaren« (die albanischen Separatisten) in der serbischen Provinz Kosovo unterstützt wurden. Ein weiteres Mal bedeutete die angebliche Verteidigung des »Multikulturalismus« in Wirklichkeit, Partei für eine Kultur und gegen eine andere zu ergreifen. Die Verteidigung des »multikulturellen« Bosnien markierte eine Veränderung in einem Großteil der Linken und ihrem Prinzip der »internationalen Solidarität«. Früher einmal hatte das die gegenseitige Unterstützung von Gruppen mit derselben Ideologie und denselben langfristigen politischen Idealen bedeutet, wie Sozialismus oder Solidarität der Arbeiterklasse. Das ist vorbei. Seit dem Bürgerkrieg in Bosnien und dem Kosovokrieg haben viele linke Gruppen oft jede nur vorstellbare Minderheit unterstützt, die gegen die Regierung ihres Landes revoltiert – ganz gleich, was ihre Anliegen waren oder ob sie vernünftige Forderungen hatten oder nicht. Die Form – Revolte – zählt mehr als der Inhalt. So verwandelten sich die Überbleibsel der linken »internationalen Solidarität« in eine Jubelveranstaltung für die Abramowitz-Strategie und den US-Interventionismus. Die Lektion blieb anderen unzufriedenen ethnischen Minderheiten rund um die Welt, die vielleicht gern US-Unterstützung für ihren Kampf um lokale Macht hätten, nicht verborgen. Solche Gruppen gibt es auch an so entlegenen Orten wie der von Uiguren bewohnten Provinz Xinjiang in Nordwestchina. Die Stiftung National Endowment for Democracy vergibt Zuschüsse an Gruppen wie die »Uyghur American Association«, deren separatistische Exilführerin Rebiya Ka-deer von New York aus antichinesische Statements lanciert.47 Während die USA offiziell das Ideal der »Multiethnizität« predigen, sehen sie ethnische Minoritäten in 76 China und Russland sehr klar als Schwachpunkte dieser Länder, die man durch Subversion ausnutzen sollte, um diese großen Nationen zu destabilisieren oder sogar, nach dem Vorbild Jugoslawiens, in leichter lenkbare kleinere Stücke aufzuspalten. »Teile und herrsche« ist nun einmal die ewige imperialistische Maxime. So sorgen die USA sich weiterhin um ausgewählte Minderheiten -in Ländern, die die US-Führung zu destabilisieren hofft. Auf der Suche nach Völkermorden Einer der übelsten Aspekte der heutigen außenpolitischen Ideologie der USA ist ihre Obsession mit Völkermorden. Das Thema ist schon in sich verstörend. Noch beunruhigender ist allerdings die ideologische Ausgangsannahme, wir lebten in einer Welt voller Ungeheuer, die nur darauf warten, »Völkermord zu begehen«, und die lediglich durch die Androhung oder Anwendung militärischer Gewalt seitens der USA davon abgehalten werden können. Dabei sollte man sich darüber im Klaren sein, dass diese Obsession weder etwas mit nationaler Verteidigung noch mit humanitären Erwägungen zu tun hat. Es ist eine Ideologie und ihr Zweck ist politisch, selbst wenn dieser Zweck denen, die die machtvolle Waffe der Erinnerung an den Holocaust einsetzen, unbewusst sein mag oder Ergebnis einer Sublimierung sein sollte. Im November 2007 versammelten sich Vertreter des United States Holocaust Memorial Museum, der American Academy of Diplomacy und des United States Institute for Peace zur Gründung einer offiziellen »Genocide Prevention Task Force«. Den Vorsitz des Treffens führten ExAußenministerin Madeleine K. Albright und Ex-Verteidigungsminister William S. Cohen, zwei Personen, die sich nicht gerade durch ihre Bemühungen zur Friedenswahrung auszeichnen. Im Dezember 2008 veröffentlichte die Task Force den Bericht »Völkermordprävention: eine Blaupause für US-Politiker«48, in dem sie versicherten, Völkermord sei vermeidbar, und Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel fingen mit Führungsbereitschaft und politischem Willen an. Tenor des US-Ansatzes ist es, Völkermord so zu behandeln, als sei er eine Art Epidemie, die jederzeit unerwartet ausbrechen könne. Gleichzeitig scheinen nur die Vereinigten Staaten imstande, die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Das US-Präventivmittel ist die 77 rechtzeitige Entdeckung von »Symptomen« wie »Hassreden«, die dann unterdrückt werden müssen. Die Suche gilt subjektiven psychologischen Gründen statt Verhältnissen, die ganz naturgemäß Spannungen zwischen Gruppen mit sich bringen wie zum Beispiel die große Knappheit lebenswichtiger Ressourcen in Darfur, Probleme, für die praktische Lösungen gefunden werden könnten. Das entspricht letztlich einem religiösen Herangehen, das Völkermord als eine Manifestation des »Bösen« betrachtet: Hier wird »das Böse« (Satan) als die Ursache statt als Resultat gesehen. Und das das Böse liegt hier in der Absicht. Oder wie Hillary Clinton in ihrem Hauptreferat auf einer Konferenz namens »Die Imagination des Unvorstellbaren: Beendigung des Völkermords im 21. Jahrhundert«49 am 24. Juli 2012 sagte: »Genozid ist immer geplant.« Der erste, offensichtlichste politische Zweck der offiziellen USKampagne gegen Völkermord ist die Sicherung einer moralisch überlegenen Position. Es ist eine Art, der Welt, aber noch viel mehr den eigenen Bürgern zu sagen, dass Völkermord – das schlimmste aller Verbrechen, das Verbrechen, das alle anderen Formen des Tötens beinahe akzeptabel macht – etwas ist, was wir Amerikaner gar nicht tun können und niemals tun. Völkermord »ist immer geplant«, und das käme für uns nie in Frage. Wir machen vielleicht Fehler, aber das ist etwas anderes. Die Zahl der von den USA getöteten Vietnamesen geht in die Millionen, aber niemand darf hier je auf die Idee kommen, die USA hätten einen Genozid verübt. Subjektiv war es nie US-Absicht, die Vietnamesen auszurotten, und Genozid ist eben ein subjektives Verbrechen. Alles hängt hier von der Absicht ab, und unsere Absichten sind lauter. Wir meinten es gut, wir meinen es immer gut. Auch das Flächenbombardement Dresdens und die Brandbomben auf aus Holz und Papier gebaute japanische Städte waren kein Völkermord. Und doch wäre es während des Zweiten Weltkriegs nicht schwer gewesen, Amerikaner zu finden, die den Wunsch hatten, »all diese Deutschen zu töten«, und noch mehr, »die Japsen zu vernichten«. Solche Gefühle gedeihen im Krieg. Menschen wüten gegen den Feind und wollen ihm komplett den Garaus machen. Das macht der Krieg. Was muss also verhindert werden, »Völkermord« oder Krieg? Indem die US-Kampagne gegen Genozid diesen als schlimmer als Krieg und als etwas, das durch Krieg verhindert werden kann, einstuft, ist ihr Ergebnis am Ende eine Rechtfertigung von Krieg. Bei der erwähnten Konferenz führte Hillary Clinton Syrien als Beispiel an und beschwerte sich, Washingtons tugendhafte Anstrengungen zur Beendigung der Gräuel in diesem Land würden von »einer kleinen 78 Gruppe« blockiert: dem Iran, Russland und China. Weiter sagte sie: »Wir intensivieren außerdem unsere Bemühungen, der Opposition zu helfen«, und fügte hinzu, wenn diese unsere Hilfe Erfolg habe, werde »Assad noch gewalttätiger zurückschlagen«. Hier muss man sich fragen, ob ihr überhaupt klar ist, was sie sagt. Sie gibt zu, dass die US-Militärhilfe an die Opposition, die ja Gewalt verhindern soll, noch mehr Gewalt provozieren wird. Falls überhaupt die Gefahr eines Genozids besteht, was zweifelhaft ist, wird sie durch die von Hillary Clinton geforderte Hilfe an die Opposition vergrößert, da das Resultat noch mehr Gewalt sein wird. Dennoch erhielt sie für ihre Rede großen Applaus und stehende Ovationen. »Wir begegnen dem Hass mit der Wahrheit«, proklamierte Hillary. Das Gegenteil war der Fall. Hillarys Rede zielte wie die gesamte USKampagne gegen Genozid auf die Erregung von Hass gegen die derzeitigen Feinde Washingtons ab, die als potentielle Völkermörder denunziert wurden. Aber wenn man Washingtons ukrainische Verbündete auf Youtube sehen kann, wie sie für die Eliminierung »überschüssiger« Einwohner in der Ostukraine eintreten, um sich ihre Ressourcen aneignen zu können, während die offizielle ukrainische Armee Zivilgebiete mit Artillerie beschießt, verfallen die Alarmglocken des Washingtoner Establishments für Völkermordprävention auf einmal in völliges Schweigen. Während die Clinton-Administration in Bosnien eifrig nach den kleinsten Anzeichen für einen durch die Serben begangenen »Völkermord« suchte, weigerte sie sich hartnäckig, das große Massenmorden in Ruanda, das im Frühjahr 1994 stattfand, als »Genozid« zu bezeichnen. Der Unterschied lag darin, dass die Machtelite Washingtons nach einem Grund zur Intervention in Bosnien suchte, während sie in Ruanda absolut nicht eingreifen wollte. Am 6. April 1994 wurde ein Flugzeug, das die Präsidenten der zwei Nachbarstaaten Ruanda und Burundi, Juvénal Habyarimana und Cyprien Ntaryamira, an Bord hatte, während des Anflugs auf die ruandische Hauptstadt Kigali abgeschossen. Die Verantwortung für diesen außergewöhnlichen Terrorakt bleibt umstritten und wurde nie zureichend untersucht. Schon zuvor hatte es in Ruanda einen Bürgerkrieg gegeben, seit bewaffnete Tutsi Anfang 1990 von ihrem Exil in Uganda aus die Nordgrenze des Landes überschritten und ihren langen Kampf zur Rückeroberung des Landes von der Hutu-Mehrheit begannen, die durch Präsident Habyarimana repräsentiert wurde. Mit der Unterstützung der USA und Großbritanniens hatten die in der Ruandischen Patriotischen 79 Front (RPF) zusammengeschlossenen und von Paul Kagame geführten Tutsi-Invasoren ihre politische und militärische Position in Ruanda bereits gefestigt. Die dramatische Ermordung gleich zweier HutuPräsidenten löste ein furchtbares Blutbad aus, bei dem Hutu Männer, Frauen und Kinder der Tutsi massakrierten, während die RPF auf Kigali vorstieß, um dort die Macht zu ergreifen.50 Boutros Boutros-Ghali, der ägyptische Staatsmann, der zu dieser Zeit UN-Generalsekretär war, versuchte hektisch, die Großmächte zur Entsendung von Truppen zu bewegen, um eine Entwicklung zu stoppen, die er so gut wie sofort als »Völkermord« bezeichnete. Er schlug vor, die kleine, bereits in Ruanda befindliche, aber gerade im Abzug begriffene UN-Friedenstruppe namens UNAMIR, aufzustocken. Doch die ClintonAdministration lehnte es entschieden ab, von »Völkermord« zu sprechen oder irgendeiner Form der Intervention von außen zuzustimmen. Am 15. April wies ein Telegramm des US-Außenministeriums die USBotschafterin bei den Vereinten Nationen, Madeleine Albright, an, ihren UN-Kollegen mitzuteilen, die USA seien »der Ansicht, dass die erste Priorität des Sicherheitsrats darin besteht, den Generalsekretär anzuweisen, einen ordentlichen Abzug aller UNAMIR-Truppen aus Ruanda umzusetzen«51. Hier sprachen die US-Vertreter nie von »Völkermord«, weil dieser Begriff sie zu einer Intervention hätte verpflichten können, zu der sie auf keinen Fall bereit waren. Am 1. Mai 1994 mahnte ein Memorandum des Verteidigungsministeriums zur Vorsicht, da Rechtsberater des Außenministeriums gewarnt hätten, ein »Befund auf Völkermord« könne die US-Regierung »zum Handeln« verpflichten.52 Das Morden hatte sich schon etliche Wochen hingezogen, als Präsident Bill Clinton in einer Rede in Annapolis am 26. Mai Ruanda unter jenen zahlreichen blutigen Konflikten in der Welt auflistete, wo die Interessenlage keinen Einsatz des US-Militärpotentials rechtfertige. »Wir können nicht bei jedem Fall von Bürgerkrieg oder militantem Nationalismus eine Lösung bieten, indem wir einfach unsere Truppen schicken«, meinte er dazu.53 Diese Ablehnung einer Intervention hatte zwei Gründe, einen technischen und einen politischen. Der technische Grund, zu dem eine lückenlose Dokumentation vorliegt, war, dass die Clinton-Administration keine Kosten für irgendwelche weiteren internationalen Missionen zur Friedenssicherung mehr tragen wollte. Das teilte man UNGeneralsekretär Boutros-Ghali damals unmissverständlich mit. 80 Madeleine Albright folgte ihren Anweisungen, jede Intervention zu blockieren, weil Washington am Ende die Rechnung bekäme, aber nicht zahlen wollte. In einem Interview mit PBS im Januar 2004 erinnerte sich BoutrosGhali, wie die Amerikaner ihm, als er sie bat, wenigstens eine Friedenssicherungsoperation ohne die USA zuzulassen, geantwortet hätten: »Wir erlauben ihnen nicht einmal, eine Friedensoperation ohne die Vereinigten Staaten durchzuführen. Warum? Erstens, weil wir dann immer noch 30 Prozent der Kosten des Budgets dieser Friedenssicherungsoperation zu tragen haben, und zweitens – und seien wir doch einmal objektiv – weil Sie, falls es Probleme mit dieser Operation gibt, uns um Hilfe bitten werden, und wir dann gezwungen sein werden, sie Ihnen auch zu geben.«54 Der zweite Grund, warum die USA »sich abseits hielten«, statt einen international überwachten, von den UN getragenen Waffenstillstand zu unterstützen, war politisch. Und vielleicht war er der eigentliche Grund hinter den finanziellen Ausflüchten. Das Ausbleiben jeder internationalen Intervention55 machte für Paul Kagames RPF den Weg frei, nach der Ermordung des Präsidenten ihren Vormarsch auf Kigali zu vollenden und die Macht zu erobern. In dem bereits zitierten Interview wurde BoutrosGhali gefragt, ob er, ebenso »wie Top-Vertreter der ClintonAdministration«, gewusst habe, dass »die RPF bereits erklärt hatte, sie werde ihren Feldzug bis Kigali fortsetzen«. Boutros-Ghali antwortete: »Nein, nein, nein. Und das beweist ein weiteres Mal die Schwäche des Systems der Vereinten Nationen. Um eine Art Druckmittel gegen die UN zu haben, geben die Mitgliedstaaten ihr nicht alle Informationen weiter. Aber dadurch ist man, wenn eine Entscheidung getroffen wird oder wenn man versucht, eine Entscheidung zu verhindern, definitiv in einer schlechteren Position als die Mitgliedstaaten, weil diese besser über die Situation Bescheid wissen als man selbst. Wir haben ihnen Informationen gegeben, aber umgekehrt war das nie der Fall.« […] »Die Kontrolle der Supermacht über die UN ist stärker, als die ganze Welt je wissen wird. Sie kontrolliert die Gelder der Verwaltung, sie kontrolliert das Büro für Friedenssicherung, sie kontrolliert den Sicherheitsrat, und sie hat Informationen, die sie mit niemand anderem zu teilen bereit ist.«56 In Washington wusste man, dass Kagame in Ruanda die Macht ergreifen würde, und wollte nicht, dass noch irgendetwas dazwischenkam. 81 Die USA hatten Kagame schon seit langem stark unterstützt. Er wurde ein Jahr lang am U.S. Army Command and General Staff College in Fort Leavenworth, Kansas, militärisch ausgebildet, direkt bevor er dann kurz nach Beginn der Invasion der RPF 1990 deren Kommando übernahm. Aufgrund der früheren belgischen Kolonialherrschaft war die Zweitsprache der Hutu in Ruanda Französisch, während der Teil der Tutsi, der sich im Exil in der ehemaligen britischen Kolonie Uganda befand, meist Englisch sprach. Das verlieh dem Kampf zwischen ihnen eine Dimension von kolonialer, an den Sprachen orientierter Rivalität. In Brüssel, der Hauptstadt von EU und NATO, wurden im Frühjahr/ Sommer 1994 alle Tutsi als Helden und Märtyrer betrachtet, während man die Franzosen verachtete, weil sie die Hutu, also die Verlierer unterstützt hatten. Man musste dort nur einmal ein persönliches Gespräch mit US-Vertretern führen,57 um zu begreifen, dass sie, mit verblüffend offenem Rassismus, von den Tutsi schlicht hingerissen waren, die sie als groß, schön und intelligent bewunderten, wobei sie eine besondere Vorliebe für die »aristokratischen«, befreiten Frauen zeigten. Es war, als ob das verbreitete rassistische Vorurteil gegenüber allen Schwarzafrikanern nun auf einmal durch eine übertriebene Bewunderung für die Tutsi gesühnt würde. Und natürlich: Sie sprachen Englisch! Im Januar 1996 führte das Kagame-geführte Ruanda Englisch als eine der offiziellen Landessprachen ein. Die Tutsi waren in Ruanda eine Minderheit und konnten nicht erwarten, die Wahlen zu gewinnen, die 1993 in den unter Aufsicht ausländischer Mächte ausgehandelten Abkommen zur Beendigung des Bürgerkriegs versprochen worden waren. Die RPF brauchte einen militärischen Sieg, um an die Macht zu gelangen. So benutzte sie das Attentat auf das Präsidentenflugzeug am 6. April 1994, um den bestehenden Waffenstillstand mit der Regierung zu brechen und auf einen militärischen Sieg hinzuarbeiten – zur selben Zeit, als verzweifelte und panisch wütende Hutu in einen Amoklauf verfielen und eine gespenstische Mordorgie an allen begannen, die sie für Unterstützer der vorrückenden RPF hielten. Doch ungeachtet der Demografie war Paul Kagame nach seinem militärischen Sieg unschlagbar. Im August 2010 wurde er zum zweiten Mal für eine siebenjährige Amtszeit zum Präsidenten gewählt – mit 93 Prozent der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 95 Prozent.58 Wie fast immer, wenn die USA sich auf eine Seite gestellt haben, wurde auch hier ein blutiger Konflikt von den Mainstreammedien als einseitige Tötungsorgie dargestellt. Dabei hatte die RPF schon lange vor 82 den Ereignissen etliche Hutu-Zivilisten getötet und fuhr damit nicht nur im April 1994, sondern auch noch Jahre danach fort – und zwar nicht nur in Ruanda, sondern auch im benachbarten Kongo, wo die Zahl der Todesopfer mittlerweile sogar noch wesentlich höher ist als die der Tutsi, die 1994 von den Hutu hingemordet wurden.59 Die furchterregende Lektion all dessen ist, dass es sich, falls »Genozid« hier der angemessene Begriff ist, um einen gegenseitigen Völkermord mit schrecklichen Massakern auf beiden Seiten gehandelt hat. Das war mit Sicherheit das schlimmste und grausigste Blutbad in dieser Generation.60 Aber dennoch: Ist der Begriff »Völkermord« wirklich hilfreich? Woher sollen wir wissen, ob die Hutu, die sich mit Messern auf wehrlose Tutsi stürzten, wirklich die Absicht hatten, sie alle »auszurotten«, oder ob sie in einem wahnsinnigen Impuls aus Angst und Rache handelten? War dieser Irrsinn wirklich »im Vorhinein geplant«? Behauptungen der Kagame-Seite über einen vorsätzlichen Hutu-Plan zur Verübung eines Völkermords wurden nie zufriedenstellend bewiesen. Es gab die Leichen, die Verbrechen sind unzweifelhaft, und der Schrecken ist real. Aber was in solchen Fällen in den Köpfen der Menschen vorgeht, ist unergründlich. Davon abgesehen könnte der Grund dafür, dass die Massentötungen jenseits der ruandischen Grenze in der Demokratischen Republik Kongo nicht als »Völkermord« gelten, darin liegen, dass es hier einige weniger emotionale, dafür aber praktische Motive gibt.61 Im Mai 2001 klagte die Kongressabgeordnete Cynthia McKinney die Clinton-Administration, das Kagame-Regime in Ruanda und den Staat Uganda an, sie nutzten die angebliche Notwendigkeit, »schuldige« Hutu-Flüchtlinge aus dem Osten des Kongo zu vertreiben, in Wirklichkeit aus, um im Interesse USamerikanischer und europäischer Konzerne einen großangelegten Raubbau an den dortigen Rohstoffen zu betreiben. Unter diesen illegal geraubten Ressourcen befinden sich neben Tropenholz, Gold, Kobalt, Diamanten, Zink und Uran besonders auch das weltweit größte Vorkommen von Coltan, einem für die Computerindustrie entscheidend wichtigen Mineral.62 Es ist nicht leicht, aus einer derartigen menschlichen Katastrophe eine moralische Lehre abzuleiten. Aber so viel kann gesagt werden: Der Hintergrund für derart massive Schlächtereien ist fast immer Krieg – und besonders Bürgerkrieg. Er ist der Kontext, der nicht nur Hass auf die eigenen Nachbarn, sondern auch Angst vor ihnen erzeugt; Angst, die zu blindem Handeln führt, das wiederum darauf zielt, die Quelle der Furcht 83 zu beseitigen. Man kann ein ähnliches Verhalten bei Tieren beobachten: Auch hier sind mörderische Reaktionen eher durch Angst als durch »Hass« motiviert. Wenn das stimmt, sind Kampagnen gegen »Hass« nutzlos. Was wirklich nötig ist, ist die Vermeidung von Situationen, in denen Furcht ein solch irrationales Maß erreicht, dass blindes, unterschiedsloses Töten das Resultat ist. In diesem Fall wäre schon der Ansatz der Vereinigten Staaten zur »Bekämpfung des Völkermords« kontraproduktiv. Schon die bloße Tatsache, dass die Supermacht sich auf eine Seite stellt, kann zu Panikreaktionen verzweifelter Menschen auf der anderen Seite führen, während die Aussicht auf eine wirklich unparteiische Macht, die bereit wäre, weise und gerecht über den Konflikt zu urteilen, eine beruhigende Wirkung haben könnte. Leider gibt es derzeit keine solche Macht. Die Vereinten Nationen sind manipuliert. Zusätzlich ist es den USA mittels ihres »Supermachtstatus« gelungen, in vielerlei Hinsicht die Kontrolle über den Internationalen Strafgerichtshof zu übernehmen, obwohl sie diesem nicht einmal angehören. So haben sie jeden Anschein zerstört, er könne fair über die vor ihn gebrachten Angeklagten urteilen. Unter Berufung auf Samantha Powers Buch A Problem from Hell63 versuchen jetzt ausgerechnet die Vertreter der Clinton-Administration, die dafür sorgten, dass Washington sich heraushielt, während in Ruanda das Blut in Strömen floss, dies als Argument für zukünftige Interventionen zu nutzen. Jetzt auf einmal tut es ihnen so leid! Ihr tief empfundenes Bedauern, so meinen sie, beweise, dass die USA hinfort der große humanitäre Wächter sein müssen, der nach jedem möglichen Genozid am Horizont Ausschau hält, um dessen Realisierung zu verhindern. Tatsächlich beweist der vorliegende Fall das Gegenteil. Die Ereignisse in Ruanda zeigen, dass die USA ungeachtet aller Fensterreden über »Ideale« im Zweifelsfall nach ihren »Interessen« handeln und ihren Informationsvorsprung nutzen, andere im Dunkeln zu lassen, bis die Krise vorbei ist. Dass auf internationaler Ebene nicht gehandelt wurde, um die Katastrophe in Ruanda abzuwenden, ging weitgehend darauf zurück, dass jegliches Vorgehen von einer einzigen Supermacht abhing, die die Kontrolle über das UN-Budget, das UN-Personal und sogar das Wissen über die Ereignisse selbst innehatte. Diese unipolare Welt, die Samantha Power leidenschaftlich als angemessenes Resultat der einzigartigen Tugendhaftigkeit der USA verteidigt, ist ein Hauptgrund für das wachsende Chaos in der Welt. Das funktioniert nicht und kann auch nicht funktionieren. Der US-Ansatz ist stets manichäisch und behandelt Konflikte 84 dualistisch: Dabei muss man sich auf eine Seite stellen und dann der »bösen« Seite potentiellen »Völkermord« unterschieben, noch bevor die Opfer überhaupt tot sind. Das war definitiv in Jugoslawien der Fall. Hier wurde ein Internationaler Gerichtshof gegründet, der die erklärte Absicht verfolgte, serbische Führer wegen »Genozids« anzuklagen, noch bevor ein Verbrechen begangen worden war, das auch nur annähernd an Völkermord herankam. Ungeachtet des Fehlens jeglicher Beweise für Planung und Vorsatz wurde das Srebrenica- Massaker dann von diesem Gerichtshof als »Völkermord« eingestuft. Grundlage dafür war ein seltsames soziologisches Argument, laut dem die Serben aufgrund des »patriarchalen« Charakters der bosnisch-muslimischen Gesellschaft durch das Töten nur der Männer sicherstellten, dass die nicht getöteten muslimischen Frauen und Kinder nie wieder nach Srebrenica zurückkehren würden, und damit Genozid in einer einzigen Stadt verübten.64 Mit dieser Begründung wurde die Definition von »Völkermord« stark ausgedehnt, aber sie stellte die US-Sponsoren des Strafgerichtshofs zufrieden, die die Serben mit dem Stigma des »Genozids« belegen wollten, weil das der muslimischen Seite, die die USA nun sowohl in Bosnien als auch im Kosovo unterstützten, einen politischen Vorteil verschaffte. Ein Massaker ist ein Massaker. Es gibt Leichen, es gibt forensische Belege, es gibt materielle Beweise. Die Tötung von Gefangenen oder Zivilisten zu Kriegszeiten ist unrecht, wie immer sie bezeichnet wird. Ein Massaker wird nur »Völkermord« genannt, wenn man glaubt, es habe einen Vorsatz gegeben, für den es in Jugoslawien aber nie einen Beleg gab. Die Bezeichnung eines Massakers als »Völkermord« hat nichts mit der Zahl der Opfer zu tun; die Zahl der Opfer in Srebrenica war, ganz gleich ob es Hunderte oder Tausende waren, verglichen mit der Zahl der von den USA im Indochinakrieg getöteten Vietnamesen, Laoten und Kambodschanern gering.65 Doch ein als »Genozid« bezeichnetes Massaker wird als wesentlich schlimmer betrachtet als jeder sonstige Massenmord, weil der Begriff den Vorsatz einschließt, alle Angehörigen einer bestimmten Gruppe von Menschen zu töten. Das Wort ist ein moralischer Multiplikator. Es hat außerdem einen eminent politischen Charakter, weil es, sobald ein Führer einmal des »Völkermordes« bezichtigt wurde, keine Verhandlungen, keine Diplomatie, keinen Versuch zu einer friedlichen Lösung des ursprünglichen Konflikts mehr geben kann. Die schuldige Partei kann nur vor Gericht gestellt oder getötet werden. Ein Blick auf die Weise, wie die USA in den letzten zwanzig Jahren 85 den Begriff »Völkermord« verwendet haben, lässt darauf schließen, dass die gegenwärtige Fahndung nach möglichen Völkermorden – angeblich, um sie zu verhindern – tatsächlich eine Suche nach inneren Konflikten in Ländern ist, die man zum Regimewandel auserkoren hat; nach Konflikten, denen man ein »Völkermordpotential« nachsagen kann. Diese »Gefahr eines Genozids« kann dann genutzt werden, um Maßnahmen zur Destabilisierung des betreffenden Landes zu legitimieren: Propagandakampagnen, Boykotte, Sanktionen, die Androhung oder sogar den Einsatz militärischer Gewalt, was im Falle eines günstigen Kräfteverhältnisses auch eine bewaffnete Intervention bedeuten kann. Das Messen mit zweierlei Maß führt zur Maßlosigkeit. Die USA schreiben sich eine einzigartige Fähigkeit zu: das, was sie als Völkermord bezeichnen, zu erkennen und zu bekämpfen. Gerade dadurch schließen sie jedoch jede Möglichkeit einer koordinierten internationalen Bemühung aus, zu verhindern, dass ethnische Konflikte in eine Massenschlächterei ausarten. Im Fall des Bürgerkriegs in Syrien beschwerte sich Hillary Clinton, die wohlmeinenden US-Bemühungen zugunsten einer Intervention seien von einer »kleinen Gruppe«, darunter Russland und China, sabotiert worden. Es gab in Syrien keine echte Gefahr eines Völkermords, und davon abgesehen war Russland mehr als kooperativ bei der Beseitigung der syrischen Chemiewaffen. Aber als in Ruanda eine wirklich große Schlächterei im Gang war, blockierte tatsächlich eine »kleine Gruppe« – bestehend aus den USA und Großbritannien – jede Bemühung um ein internationales Eingreifen, nur um sicherzustellen, dass »ihre Seite« gewann. Nachdem ihr »Team« gewonnen hat, vergießen sie jetzt, über zwanzig Jahre später, immer noch Krokodilstränen – und zwar schlicht, um zukünftige Interventionen zu rechtfertigen, für die sie irgendwann ihre ganz eigenen Gründe haben könnten. 86 3 Die Zähmung durch die Widerspenstigen Wenn man als Frau im außenpolitischen Establishment der USA vorankommen will, ist es hilfreich, genauso aggressiv zu sein wie diese Politik selbst. Taffe Frauen sind der Beweis, dass es im Verhältnis der USA zum Rest der Welt keine Sentimentalitäten gibt. Tatsächlich sind in den letzten Jahren aggressive Frauen in Schlüsselpositionen zum Trend geworden. Eine Vorläuferin dieses Trends war Jeane Kirkpatrick, Präsident Reagans Botschafterin bei den Vereinten Nationen von 1981 bis 1985. Jeane Kirkpatricks Karriere erteilte uns dieselbe Lektion wie die ihrer Zeitgenossin Margaret Thatcher: Frauen an der Macht sind keineswegs weichherziger als Männer. Angesichts der Widerstände, die sie überwinden müssen, um sich in einer »Männerwelt« zu behaupten, bemühen sie sich vielleicht sogar besonders, Härte zu zeigen. Kirkpatrick, einer Neokonservativen der ersten Stunde, wurde in Washington die Doktrin zugeschrieben, es sei für die Vereinigten Staaten völlig in Ordnung, »autoritäre« Regimes zu unterstützen (womit meist US-gesponserte lateinamerikanische Militärdiktaturen gemeint waren), während Washington sich stets gegen »totalitäre« Regimes (gemeint waren kommunistische Staaten) stellen müsse.1 Als Mitglied des »Committee on the Current Danger«2 trug sie zur Anstachelung der nationalen Paranoia bei, die für die gute Konjunktur der Waffenindustrie sorgt. Jeane Kirkpatrick konzentrierte sich auf imaginäre Bedrohungen und Gefahren, hatte zugleich aber nur Verachtung für die Menschenrechte übrig und kümmerte sich wenig um die angebliche nationale Mission der weltweiten Verbreitung von Demokratie. Der Zusammenbruch der Sowjetunion machte ihre politische Linie dann zum Auslaufmodell. Während der Präsidentschaft Bill Clintons verlagerte sich der Fokus der Außenpolitik auf die Menschenrechte. Dabei berief man sich auf die 87 »Werte« und »Interessen« der USA, um Interventionen zum Schutz und zur Rettung von Opfern von Menschenrechtsverletzungen zu fordern. Das war ein Thema, bei dem die Sorge und Empörung gerade von Frauen besonders passend und überzeugend schien. Unter Ignorierung historischer, rechtlicher und politischer Komplexitäten wurde der Zerfall Jugoslawiens von den westlichen Medien und Regierungen in erster Linie als eine Menschenrechtskrise behandelt, in der eine der Parteien die Menschenrechte verletzte und die anderen die Opfer waren. Die CNNKorrespondentin Christiane Amanpour, die dem US-Außenministerium besonders nahestand, ging mit ihren einseitigen Berichten, in denen sie eine US-Intervention gegen die Serben verlangte, allen voran. Das Modell war so erfolgreich, dass es während der Präsidentschaft Obamas zum Standard wurde und, mit Frauen ganz an der Spitze, auf Libyen, Syrien und die Ukraine angewendet wurde. Während der Co-Präsidentschaft der Clintons war Hillarys Bereich die Innenpolitik, besonders die Ausarbeitung einer großangelegten Gesundheitsreform. Als diese fehlschlug, kehrte sie zu ihrem ursprünglichen öffentlichen Betätigungsfeld, den Kinderrechten zurück und schrieb unter dem Einfluss diverser New-Age-Gurus ein Buch über Kinderfürsorge, Eine Welt für Kinder.3 Berichten zufolge suchte sie eine Weile lang ihr Heil in der Kräftigung ihres Selbstbewusstseins ä la New Age, um über Religion und mystische Erfahrungen spirituelle Stärke zu gewinnen. Der Haken an dieser Art subjektiver Selbstermächtigung ist, dass sie manchmal mehr Selbstvertrauen erzeugt, als angesichts der Konfrontation mit besonders schwierigen Problemen einer komplexen Realität gerechtfertigt ist. Nach dem Debakel ihres Gesundheitsreformprojektes wurde Hillary Clinton zur Zielscheibe endloser feindseliger Schnüffeleien der Republikaner, bei denen es um ihre Vergangenheit als Anwältin in Arkansas und ihren konfliktreichen Umgang mit dem Personal im Weißen Haus ging. Um ihr ramponiertes Image aufzupolieren, wurde sie auf eine Reise nach Südasien und Südafrika geschickt, bei der ihr Engagement für Frauen und Kinder im Vordergrund stand. Im September 1995 führte Hillary die US-Delegation zur Vierten UN-Weltfrauenkonferenz in Peking. Dort hinterließ sie mit einer dramatischen Rede, in der sie die schlechte Behandlung von Frauen und Kindern anprangerte, großen Eindruck: »Es ist eine Verletzung der Menschenrechte, wenn Babys nicht gefüttert, ertränkt oder erstickt werden, ihr Rückgrat gebrochen wird, nur weil sie als 88 Mädchen geboren wurden. Es ist eine Verletzung der Menschenrechte, wenn Frauen und Mädchen in die Sklaverei der Prostitution verkauft werden. Es ist eine Verletzung der Menschenrechte, wenn Frauen mit Benzin übergossen, angezündet und verbrannt werden, weil ihre Mitgift als zu gering erachtet wird.«4 Hillary, die in den USA bei vielen in Ungnade gefallen war, wurde plötzlich als Heldin gefeiert. Die New York Times pries die Rede als den »Höhepunkt ihrer öffentlichen Karriere«5. Die politische Lehre daraus war stark und klar: Wenn Politiker an der Heimatfront in Schwierigkeiten kommen, können sie das im außenpolitischen Bereich wieder wettmachen, insbesondere mittels der Verteidigung von Menschenrechten. Bis dahin hatten sich Hillary Clintons Interessen und Expertenwissen auf Kinderrechte, Bildung und das Gesundheitswesen beschränkt. Das waren traditionelle Frauenthemen, die zwar von vitaler Bedeutung sind, aber keinen »Präsidentenbonus« haben, da sie zu weit vom traditionellen Zentrum der Männermacht entfernt sind: dem Krieg. Das ist die Festung, die die Frauen erobern müssen, um völlige Gleichberechtigung zu erlangen. Dabei wird es als Fortschritt für die Sache der Frauen betrachtet, dass sie zum Militär zugelassen werden, und zwar nicht nur in zweitrangigen Rollen, sondern im Kampf, wo wirklich getötet wird. Die Glorifizierung dieser speziellen Art, »die gläserne Decke zu durchbrechen«, kann für einen permanent kriegsbereiten Staat sehr nützlich sein. Die beste Art, Krieg akzeptabel und sogar populär zu machen, ist, zu zeigen, dass er gut für Frauen und Kinder ist, weil er ihrem Schutz dient. Wer könnte diese Botschaft besser verbreiten als eine Frau? So brachten gemeinsame Interessen Neokonservative, die Kriege wollen, und Frauen, die durch die gläserne Decke wollen, zusammen. Während die Neocons Frauen brauchen, um Krieg gut aussehen zu lassen, brauchen manche sehr ehrgeizige Frauen Krieg, um ihre Karrieren voranzubringen. Hillary war eine der einflussreichen Frauen, die Bill Clinton nach der Amtsaufgabe Warren Christophers6 eindringlich baten, ihre Freundin Madeleine Albright Anfang 1997 zu seiner zweiten Außenministe rin zu machen. Hillary und Madeleine waren beide Absolventinnen des Wellesley College, und HRC trat dafür ein, dass das Außenministerium diesmal an eine Frau ging. Anders als Hillary hatte Madeleine, die Bill Clinton bereits als UN-Botschafterin gedient hatte, weitläufige Erfahrungen mit der Außenpolitik. Ihr Vater, Josef Korbel, war Botschafter der Tschechoslowakei in Jugoslawien gewesen und emigrierte mit seiner Familie erst nach England, um dem Zweiten 89 Weltkrieg zu entkommen, und dann in die USA, um dem Kommunismus zu entkommen. Dort gründete er an der Universität Denver in Colorado die School of International Studies, wo Condoleeza Rice eine seiner Studentinnen war. Wie viele hoch politisierte Einwanderer aus Osteuropa betrachtete Korbel die große Macht der USA als Kraft, die eingesetzt werden sollte, um strittige Fragen im Rest der Welt zu lösen. Madeleine heiratete in die US-Pressearistokratie ein und behielt nach ihrer Scheidung ihren Ehenamen Albright bei, womit sie der Praxis ihrer Eltern folgte, die ihre jüdischen Wurzeln immer verborgen gehalten hatten. Im Alter von 57 Jahren, just als sie ihr Amt als Außenministerin antrat und die Neugier der Medien eine weitere Wahrung des Geheimnisses unmöglich machte, verkündete Madeleine der Öffentlichkeit die »Entdeckung«, dass ihre Großeltern im Holocaust gestorben waren.7 Während eine jüdische Herkunft zum Zeitpunkt der Ankunft der Korbels in den USA wahrscheinlich ein Hindernis für den Aufstieg in die Oberklasse der WASPs war, verleiht das Prädikat »HolocaustÜberlebender« heute seinen Trägern unvergleichliche moralische Autorität. Samantha Power schreibt dazu in ihrem Buch: »Albright sagte oft: >Meine Denkweise kommt von München.< Sie war die seltene Stimme im Clinton-Team, die unablässig für ein NATO-Bombardement warb und ihre öffentlichen Verurteilungen der serbischen Politik der Vertreibung und >Ausrottung< mit Hinweisen auf den Holocaust spickte.«8 Versessen auf Krieg Ein hervorstechender Zug der neuen Schule weiblicher Diplomaten ist ihr extrem undiplomatisches Auftreten. Tatsächlich war der größte diplomatische Erfolg Albrights ihre Verhinderung von Diplomatie. Als die europäischen Verbündeten der USA im Vorfeld des Kosovokrieges Vorbehalte dagegen äußerten, Serbien ohne auch nur den Versuch diplomatischer Schritte zu bombardieren, sorgten ihre Manöver bei einer im Februar und März 1999 im Schloss Rambouillet bei Paris abgehaltenen Sonderkonferenz dafür, dass es dort zu keiner Verhandlungslösung für die Krise in der serbischen Provinz Kosovo kam. Damit hatte die NATO einen Vorwand, die Gebiete zu bombardieren, die von Jugoslawien noch übrig waren, nämlich Serbien und Montenegro. 90 Montenegro trennte sich später auf westlichen Druck hin ebenfalls ab, ohne dass es zum Krieg kam. Das Kosovoproblem war letztlich ein Problem mit einer ethnischen Minorität, wie etliche vergleichbare Fälle auf der Welt. Die Albaner waren in ganz Jugoslawien eine anerkannte Minderheit, waren aber in der an Albanien grenzenden südserbischen Provinz Kosovo in der Mehrheit. Wie so häufig wurde der Konflikt durch einander widersprechende Versionen der gemeinsamen Geschichte verschärft, bei denen beide Seiten einander Vorhaltungen über vergangenes Unrecht machten, aber er war nicht schlimmer oder unlösbarer als Dutzende andere Probleme. Stimmen auf beiden Seiten sprachen sich für genau die Art Kompromiss aus, die angeblich auch das Ziel der USA war, nämlich eine großzügige Autonomie des Kosovo innerhalb Serbiens. Jan Oberg von der schwedischen »Transnational Foundation for Peace and Future Research«9 traf sich mit beiden Seiten, um nach einem Kompromiss zu suchen. Der bedeutendste Schriftsteller Serbiens und kurzzeitige Präsident Jugoslawiens Dobrica Ćosić ging sogar so weit, Verhandlungen für eine Unabhängigkeit des Kosovo vorzuschlagen.10 Gleichzeitig nutzte die Frau eines anderen Präsidenten, Danielle Mitterrand, diskret ihren Einfluss, um eine friedliche Lösung zustande zu bringen. Danielle, die in ihrer Jugend als Kontaktperson für die französische Résistance gearbeitet hatte, organisierte Treffen zwischen führenden serbischen und kosovo-albanischen Intellektuellen, wo über mögliche Lösungen diskutiert wurde. Hier wäre nichts weiter nötig gewesen, als die aktive Unterstützung der großen Mächte für solche echten diplomatischen Bemühungen, und der Krieg samt der Zerstörung, die er mit sich brachte, hätte vermieden werden können. Im Winter 1998/99 kamen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die sich im Kosovo aufhielten, zu dem klaren Schluss, dass bewaffnete Killer der »Befreiungsarmee des Kosovo« UÇK11 absichtlich gewaltsame Zusammenstöße provozierten, um die serbische Polizei zu Vergeltungsaktionen zu verleiten, die die Medien dann als »ethnische Säuberungen« oder »drohenden Völkermord« bezeichneten. Als Gefälligkeit gegenüber Washington nutzte der polnische Außenminister Bronistaw Geremek und zeitweilige Vorsitzende der OSZE seine Position, um die Kosovo-Mission der OSZE dem Kommando des US-Vertreters William Walker zu unterstellen. Walker, der in Zentralamerika höchst zweifelhafte US-Operationen geleitet hatte,12 leistete den Plänen der UÇK wichtige Unterstützung, insbesondere durch 91 seine Verurteilung einer serbischen Polizeiaktion gegen UÇK-Killer in dem Dorf Ratjak als »Massaker, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Mit wenigen Ausnahmen trugen die westlichen Medien begierig dazu bei, Walkers sensationslüsterne Anschuldigungen zu dem Kriegsgrund aufzubauschen, den die NATO brauchte.13 Madeleine Albrights Rolle als US-Außenministerin bestand darin zu verhindern, dass diplomatische Bemühungen eine friedliche Lösung erreichten, die dem ersten »humanitären Krieg« der NATO im Weg stehen würde. So sollte die bis dahin formal defensive Militärallianz in eine Offensivstreitmacht verwandelt werden, die auch zum Handeln außerhalb des Vertragsgebiets bereit ist. Die Kosovoaktion war der erste Schritt zum Aufbau einer potentiell weltweiten Polizeitruppe unter dem Kommando der USA. Die Vereinten Nationen mussten bei alldem herausgehalten werden. Als UN-Botschafterin der USA hatte Madeleine Albright aktiv dafür gesorgt, dass dem ägyptischen Diplomaten Boutros Boutros-Ghali eine zweite Amtszeit als UN-Generalsekretär verwehrt blieb. Die USA erwählten Kofi Annan zu seinem Nachfolger, und zwar genau darum, weil er die NATO-Bombardements in Bosnien im August 1995 unterstützt hatte.14 Nachdem sie ihm diesen Posten besorgt hatte, neigte Madeleine Albright dazu, ihn wie einen Laufburschen zu behandeln, den sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrief, um ihm Befehle zu geben. Am Ende beschwerte Kofi Annan sich, sie habe »nie wirklich verstanden«, dass man von ihm erwarte, auch für alle anderen UN-Mitgliedstaaten zu arbeiten. Während sich Albright auf die Konferenz in Rambouillet im Februar 1999 vorbereitete, wurde sie durch Berichte aufgeschreckt, Annan ziehe in Erwägung, eine Gruppe von Parlamentären zu ernennen, die mit Belgrad verhandeln sollten. Um das zu verhindern, rief sie ihn an und sagte ihm: »Kofi, wir brauchen keine Unterhändler, die überall dazwischenfunken«, nur um ihn dann noch einmal anzurufen, »um sicherzustellen, dass er nicht alle möglichen Unterhändler ernennt«.15 Tatsächlich aber handelten US-Vertreter hinter den Kulissen Abkommen mit der radikalsten Fraktion der kosovo-albanischen Nationalisten aus, deren Morde sich größtenteils gegen Serben, aber auch gegen Albaner richteten, deren Berufstätigkeit – wie etwa Briefträger – sie in den Augen der UÇK zu »Kollaborateuren mit den Serben« stempelte.16 Während Madeleine Albright die öffentliche Führungsrolle übernahm, zog ihr alter Mentor, Morton Abramowitz, in der Rolle des Beraters der 92 albanischen Delegation in Rambouillet im Hintergrund die Fäden. Madeleine Albrights Aufgabe bestand darin, die »Friedensverhandlungen« in ein Patt zu steuern, für das dann den Serben die Schuld gegeben werden konnte. Dabei wurde sie von ihrem persönlichen Berater James Rubin unterstützt, der später die Starverfechterin kriegerischer Maßnahmen gegen die Serben in den Mainstreammedien heiratete: die pro-interventionistische CNNKriegskorrespondentin Christiane Amanpour. Die Delegation Belgrads, in der alle ethnischen Gruppen des Kosovo repräsentiert waren, brachte ihre Kompromissbereitschaft zum Ausdruck. Während der Verhandlungen wurden die jugoslawische und die kosovo-albanische Seite getrennt gehalten und von der US-Delegation regelmäßig vor Ultimaten gestellt. Schließlich organisierten die US-Diplomaten überraschend einen Putsch in der kosovo-albanischen Delegation, bei dem Professor Ibrahim Rugova, der 1992 inoffiziell zum »Präsidenten des Kosovo« gewählt worden war, als Kopf der Delegation durch den dreißigjährigen UÇKFührer Hashim Thaçi ersetzt wurde. Im Februar 1999 trafen Rubin und Thaçi sich »in der überladenen Residenz des US-Botschafters [in Paris] zu einem Mittagessen mit Lammspießen und Rotwein«, und das war der Beginn einer großen Freundschaft.17 Thaçi, auch unter dem Namen »die Schlange« bekannt, wurde wegen verschiedenster Verbrechen von der jugoslawischen Polizei gesucht; noch im Jahr zuvor hatte der USSondergesandte der Region, Robert Gelbard, die UÇK als »terroristische« Organisation bezeichnet. Wie das Wall Street Journal berichtete, umwarb Rubin »während der gesamten Kosovokrise Hashim Thacj, den ehrgeizigen Führer der Kosovo-Befreiungsarmee, ganz persönlich«. Rubin sei sogar so weit gegangen, »scherzhaft zu versprechen, er werde mit seinen Freunden in Hollywood sprechen, um Thaçi eine Rolle in einem Film zu verschaffen«. Umhätschelt von Rubin und Albright, folgte Thaçi ihren Weisungen im sicheren Wissen, dass er so am Ende die Kontrolle über das Kosovo gewinnen würde. Fünfzehn Jahre später steht Thaçi immer noch an der Spitze des nunmehr »unabhängigen« – Kosovo, eines US-Satelliten, der am besten für den illegalen Handel mit Drogen, Prostituierten und menschlichen Organen bekannt ist. Etliche Verbrechen, ethnische Säuberungen und Morde sind seit 1999 trotz (oder wegen?) der Präsenz von NATOTruppen ungestraft geblieben. Das herausstechendste Kulturdenkmal in Pristina ist jetzt eine riesige vergoldete Kitsch-Statue von Bill Clinton. Eine lächelnde Hillary hat bereits davor posiert, um sich von Tochter Chelsea fotografieren zu lassen. 93 Die geschlossenen Sitzungen in dem französischen Schloss endeten mit dem sogenannten Abkommen von Rambouillet, das indes kein Abkommen war, da Belgrad sich weigerte, einen Vertrag zu unterzeichnen, der einen Zusatz enthielt, der es den Truppen der USA erlaubt hätte, sich unter Immunität vor Strafverfolgung frei in ganz Jugoslawien zu bewegen. Selbst Henry Kissinger bezeichnete das Nicht-Abkommen als »schreckliches diplomatisches Dokument« und als »Provokation und Vorwand, mit der Bombardierung zu begin-nen«18. Inoffiziell gab Madeleine Albright gegenüber Journalisten zu, dass »wir die Latte bewusst so hoch gelegt haben, dass die Serben nicht zustimmen konnten. Die brauchen ein paar Bombenangriffe, und die werden sie jetzt kriegen.«19 Als die NATO-Bomben zu fallen begannen, hatte der US-Missionschef Walker die OSZE-Beobachter bereits abgezogen, so dass es nur wenige Zeugen dafür gab, was vor Ort im Kosovo geschah. Es zirkulierten wilde Gerüchte über massive Tötungen, die sich dann als falsch herausstellten. Der Strom von Albanern, der die nahegelegenen Grenzen überquerte, um in Albanien oder in albanisch besiedelten Gebieten Mazedoniens das Ende der Bombardements abzuwarten, wurde als Ergebnis von »ethnischer Säuberung« oder gar Völkermord beschrieben, obwohl die Flüchtlinge gleich nach Ende der Bombenangriffe heim ins Kosovo eilten und andere Albaner mit sich brachten, damit diese die von verängstigten Serben verlassenen Häuser übernahmen. Die Serben, die geflohen waren, konnten nie zurückkehren.20 Berichten zufolge hatte Madeleine Albright Präsident Clinton, entgegen dem besseren Urteil des Pentagon, überzeugt, dass Milošević schon nach ein paar ersten Bomben zurückstecken würde. Als das nicht geschah und serbische Zivilisten sich Zielscheiben auf den Körper malten und sich auf den Brücken Belgrads versammelten, um deren Bombardierung zu verhindern, eskalierte die antiserbische Propaganda dramatisch. Tony Blair verkündete, der Krieg sei »eine Schlacht zwischen Gut und Böse, zwischen Zivilisation und Barbarei, zwischen Demokratie und Diktatur«21. Die Serben, behauptete Blair, seien eines »scheußlichen rassischen Genozids«22 schuldig. Am 7. April 1999 erklärte Madeleine Albright, Milošević schaffe in seinem »Bestreben, eine bestimmte Gruppe von Menschen auszurotten«, »einen Horror von biblischen Dimensionen«. Dabei sagte sie Larry King von CNN: »Wenn es ein reales Bestreben gibt, eine Gruppe von Menschen auszurotten oder als bloße Werkzeuge zu benutzen, erinnert das an die Art Dinge, die man 94 während des Zweiten Weltkriegs gesehen hat.«23 Das war reine Propaganda. Es gab weder »Ausrottung« noch die Gefahr einer Ausrottung, sondern einen Konflikt zwischen einer Regierung und einer bewaffneten sezessionistischen Gruppe, die vom Nachbarland Albanien unterstützt wurde. Der Exodus der Flüchtlinge wurde in den westlichen Medien als der tragische Grund des Krieges in Szene gesetzt, während er in Wirklichkeit dessen Resultat war. Albanische Flüchtlinge, die vor der Gewalt im Kosovo flohen, dienten sich den westlichen Medien bereitwillig mit erfundenen Geschichten von Mord und Vergewaltigung an. Reporter suchten die albanischen Flüchtlingslager nach Frauen ab, die »vergewaltigt wurden und Englisch sprechen«24. Doch praktisch niemand war an den Menschen interessiert, die von NATO-Bomben getötet wurden. Niemand kümmerte sich um die kleine serbische Stadt Varvarin, die keine militärische Bedeutung hatte, aber dennoch Ziel von Luftangriffen wurde – die dann Bewohner trafen, die sich zum Dreifaltigkeitstag versammelt hatten. Die Bomben töteten unter anderen den Pfarrer und die Bürgermeisterstochter, eine fünfzehnjährige Schülerin namens Sanja Milenkovic, die der Stolz der Stadt war, weil sie einen Mathematikpreis gewonnen hatte. Schulen, Krankenhäuser und Brücken wurden bombardiert, um die Bevölkerung gegen ihren Präsidenten aufzubringen. Auch ein Bus voller in den Kosovo zurückkehrender Albaner wurde von den NATO-Bomben getroffen. Die Infrastruktur, deren mühseliger Aufbau nach den Zerstörungen zweier Weltkriege eine ganze Generation gedauert hatte, wurde dem Erdboden gleichgemacht. In Washington nannte man den »Kosovokrieg« »Madeleines Krieg«25, und sie schien stolz darauf zu sein. Vielleicht beruhigte es ja das Gewissen einiger Männer, die Verantwortung für dieses beschämende Maskenspiel einer emotionalen Frau zuzuschieben. Madeleine Albright gab einem weitgehend von Männern geplanten und ausgeführten strategischen Unternehmen einen femininen Anstrich. Vielleicht sollte das die »humanitäre« Prätention des Ganzen unterstreichen. Abgesehen von diesem ersten Aggressionskrieg der NATO besteht Madeleine Albrights Vermächtnis in einigen Bemerkungen, die ernste Zweifel an ihrem humanitären Engagement wecken. Die berühmteste war ihre Antwort auf eine Frage nach den Sanktionen gegen den Irak in der Sendung »60 Minutes« vom 12. Mai 1996, als sie noch US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen war. Unter Verweis darauf, dass wegen dieser Sanktionen »eine halbe Million Kinder gestorben« seien, fragte Interviewerin Lesley Stahl Albright: »Ist es diesen Preis wert?« 95 Madeleine antwortete: »Wir denken, es ist den Preis wert.«26 Madeleine Albrights zweitberühmteste Bemerkung war ihre rhetorische Frage an General Powell, mit der sie sich für den Einsatz militärischer Gewalt aussprach: »Wozu haben wir eigentlich dieses tolle Militär, von dem Sie dauernd reden, wenn wir es nicht einsetzen können?«27 Sabotierte Diplomatie Man könnte die Präsenz von Frauen in hohen Ämtern des USAußenministeriums schlicht als Ergebnis ihrer wohlverdienten generellen Fortschritte auf der Karriereleiter betrachten. Aber die Rollen, die die betreffenden Frauen in der US-Außenpolitik spielen, bringen deren aggressive Aspekte beredter zum Ausdruck, als es Männer in ihrer Position gekonnt hätten. Sie alle nutzen ihre Persönlichkeit auf eigene Art, um die US-Außenpolitik noch aggressiver zu machen und die diplomatische Verständigung mit anderen zu erschweren. Früher einmal haben Feministinnen oft behauptet, Frauen in Machtpositionen könnten einen wichtigen Beitrag zum Weltfrieden leisten. Die militanten Frauen in der US-Politik konterkarieren die bis zur »Lysistrata« des Aristophanes zurückreichenden Hoffnungen, Frauen seien leichter gegen den Krieg zu mobilisieren. Das Geknurre Madeleine Albrights, die hämischen Predigten Hillary Clintons, die beleidigenden Ausfälle von Susan Rice, die herrischen Reden Victoria Nulands, die wortreichen Wutanfälle von Samantha Power und sogar die arrogante Ignoranz der Pressesprecherinnen des USAußenministeriums sprechen eine andere Sprache. Diese Scharfmacherinnen arbeiten alle für demokratische Administrationen, denen angeblich die Sache der Menschenrechte am Herzen liegt, stellen aber klar, dass diese Sache nichts mit Freundlichkeit und Sanftmut zu tun hat, sondern in erster Linie ein Motiv für die Bestrafung angeblicher Sünder in diesem Bereich darstellt. Die ObamaAdministration verstärkte den Einsatz von Frauen, um den Rest der Welt auf Linie zu bringen: Wir haben hier eine US-produzierte und -finanzierte weltweite Aufführung eines neue Stückes vor uns mit dem Titel »Die Zähmung durch die Widerspenstigen«. Die Frauen in der Außenpolitik Washingtons haben sich darauf spezialisiert, ausländische Politiker oder Diplomaten mit Strafpredigten zu überschütten, als seien sie nichts weiter 96 als ungezogene Kinder. Ihr tyrannisches Auftreten zeugt zugleich von der Gewissheit, dass sie sich, als Frauen, Grobheiten leisten können, die sich die meisten Männer in vergleichbaren Positionen nicht erlauben würden.28 Susan Rice war, bevor sie Präsident Obamas Nationale Sicherheitsberaterin wurde, UN-Botschafterin der USA und legte dabei keine große Sorge um die Feinheiten diplomatischer Sitten an den Tag. Für den Wiedereintritt der USA in den UN-Menschenrechtsrat setzte sie sich vor allem deshalb ein, um dort gegen den »anti-israelischen Mist« von Unterstützern der Palästinenser kämpfen zu können. Susan Rice war Ziehkind und Amtsnachfolgerin Madeleine Albrights, und genauso hört sie sich oft an. Während Madeleine die Abspaltung des späteren gescheiterten Staates Kosovo von Serbien unterstützte, schreibt man Susan allgemein eine große Rolle bei der Entstehung eines weiteren solchen Staates zu, nämlich des Südsudan. Susan Rice weiß, dass viele sie als »brüsk, aggressiv und grob« ansehen, aber das kümmert sie nicht. »Natürlich sagen mir die Leute das nicht ins Gesicht«, scherzte Susan Rice beim Ball des Klubs der UN-Korrespondenten, »weil sie wissen, dass ich ihnen in den Hintern treten würde.«29 Obwohl sie sich so »unweiblich« wie möglich aufführte, zog Rice doch heimlich ihren Vorteil aus einem weiblichen Vorrecht – der Gewissheit von Frauen ihres Schlags, dass die Männer, die von ihnen beleidigt werden, immer noch zu höflich sind, ihnen dafür umgekehrt ebenfalls »in den Hintern zu treten«.30 Nachfolgerin von Susan Rice als UN-Botschafterin in Obamas zweiter Amtszeit wurde Samantha Power, die bei gleicher Linie einen völlig anderen Stil pflegt. Im Vorwahlkampf der Demokraten 2008 musste Power im März aus Obamas Wahlkampfteam ausscheiden, weil sie Hillary Clinton öffentlich ein »Monster« genannt hatte, das vor nichts zurückschrecken würde, um gewählt zu werden. Aber diese Sünde war nun offenbar vergeben. Als Mitglied von Obamas Nationalem Sicherheitsrat schloss sich Samantha Power der Forderung von Hillary Clinton und Susan Rice an, Libyen zu bombardieren. Samantha Power hat eine sorgfältig geplante Karriere hinter sich. Ihre Biografien behaupten meist, ihre Karriere habe als »freie Journalistin in Bosnien« begonnen, wo sie Gräuel gesehen habe, die aus ihr eine Kämpferin gegen Völkermord gemacht hätten. Aber das ist nicht ganz aufrichtig. Samantha Power wurde 1970 in Irland geboren und bekam gleich nach ihrem Studium in Yale ein Stipendium bei der Carnegie Stiftung für 97 Internationalen Frieden, wo sie im Stab des Stiftungspräsidenten, des ExBotschafters Morton Abramowitz, arbeitete. Just zu dieser Zeit entwickelte Abramowitz seine Doktrin, die USA seien zur Intervention zum Schutz bedrängter Minderheiten in anderen Ländern verpflichtet. Samantha Power erwies sich hier als sehr gelehrige Schülerin. Laut Erinnerungen von Kollegen bei Carnegie war sie schmeichlerisch und extrem ehrgeizig und sah Bosnien schon damals als Karrieregelegenheit. Bereit, alles Nötige zu tun, um an die Schauplätze zu gelangen, wo »etwas los« war,31 schloss Samantha sich mit zweiundzwanzig Jahren dem Schwarm der Journalisten an, die für die große Story nach Bosnien eilten. Im Unterschied zu vielen anderen sicherten ihre Beziehungen zu Carnegie ihr die Aussicht auf Veröffentlichungen in großen Mainstreammedien. Im Alter von erst fünfundzwanzig wurde sie von der International Crisis Group als politische Analystin eingestellt, die die Umsetzung des DaytonAbkommens beurteilen sollte, das 1995 den Krieg in Bosnien beendete. Später wurden ihre Reisen ins Kosovo und nach Kambodscha vom Open Society Institute von George Soros finanziert. Schon seit Beginn des Konflikts in Bosnien-Herzegowina brachten die Unterstützer der muslimischen Partei den Begriff »Völkermord« in Umlauf, um den serbischen Gegner in dem dreiseitigen Krieg zwischen den dort lebenden Gemeinschaften der Muslime, Serben und Kroaten zu stigmatisieren. Die in Bosnien stationierte jugoslawische Armee brach zu Beginn des Bürgerkriegs auseinander und danach bildeten die beiden größten Gruppen, die Serben und die Muslime, einander bekämpfende örtliche Armeen. Daraufhin wurde Serbien fälschlich einer »Invasion« Bosniens beschuldigt. Unterdessen fiel die kroatische Armee tatsächlich nach Bosnien ein, um eine rein kroatische Region im Südwesten der Republik zu annektieren, die wegen ihres florierenden Tourismus am Ort angeblicher mystischer Erscheinungen der Jungfrau Maria in der Stadt Medjugorje bekannt ist.32 Niemand beschwerte sich über diese »Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität« BosnienHerzegowinas. Das ist nur eines der Beispiele für die extrem selektive Berichterstattung über den hochkomplexen Konflikt in Bosnien. Hier konnten journalistische Karrieren gemacht werden, indem man fand, was die Redaktionen haben wollten, und meistens wollten sie das Schlimmste: Vergewaltigung, ethnische Säuberung, Völkermord – begangen von Serben. Aber über die Nutzung muslimischer humanitärer Organisationen als 98 Deckmantel zum Waffenschmuggel für die muslimische Armee und über von muslimischen Freischärlern aus dem Ausland begangene Massaker wurde nicht berichtet. Als klar war, dass die USA sich auf die Seite der Muslime gestellt hatten, konnten die Handlanger Izetbegovićs darauf vertrauen, dass sie selbst mit solch extremen, unter »falscher Flagge« durchgeführten Gräueltaten davon kommen würden. Im Juli 1995, kurz vor Ende des Krieges in Bosnien, wurde der Begriff »Völkermord« schließlich erfolgreich mit den massiven Rachemorden an muslimischen Männern in Verbindung gebracht, die auf die serbische Einnahme Srebrenicas folgten. Weder Samantha Power noch das westliche Pressecorps waren Zeugen der Schrecken eines Völkermords. Nicht einmal die niederländischen UN-Soldaten sahen, was später im Brustton der Gewissheit behauptet wurde. Es dauerte lange, bis es »Zeugenaussagen« gab, und diese sind oft voller innerer und gegenseitiger Widersprüche. Es gab in Srebrenica ein oder mehrere Massaker an Gefangenen, aber niemand sah dort einen Völkermord, weil es keinen gab. Zu den Personen, die darüber am wenigsten zu sagen hatten, gehörte Samantha Power. Dennoch gab die bloße Tatsache, dass sie »in Bosnien gewesen« war, ihrem späteren Bestseller zum Thema Völkermord A Problem from Hell: America and the Age of Genocide33 die Aura der Authentizität. Vom Medien- und Politikestablishment enthusiastisch gelobt, war dieser Bestseller vor allem ein leidenschaftliches Plädoyer für Militärinterventionen der USA »zur Beendigung von Völkermorden« – eine dramatische und beredsame Populärversion der zuerst von Morton Abramowitz entwickelten trockenen, politischen Theorie. Samantha Power ging sogar noch weiter: Sie vertrat die Meinung, die USA sollten zur Verhinderung von Völkermorden militärisch intervenieren – wenn nötig, bevor diese überhaupt eintreten. Kurz: Sie argumentierte für Präventivkriege. Mit einem Flair fürs Dramatische, einer Gabe für erfundene Geschichten, literarischem Talent und einer starken Persönlichkeit ist es Samantha Power gelungen, sich in eine tragische Gravität einzuhüllen, die es dieser ehrgeizigen jungen Frau ermöglichte, als Verkörperung von Gewissen und Moral in Riesenschritten die Karriereleiter hochzueilen. Es ist ja eigentlich nichts Besonderes, gegen Völkermord zu sein. Wer ist schon dafür? Doch was Samantha Power auszeichnet, ist, dass sie etwas dagegen tun möchte. Oder besser gesagt, sie möchte, dass das USMilitär etwas dagegen tut, und das macht sie zu einem wertvollen Aktivposten der Kriegspartei. Das gesamte Establishment, von Morton Abramowitz über das Politikmagazin The New Republic, die 99 International Crisis Group, das Pulitzerpreis-Komitee, Harvard, Präsident Obama bis hin zu der langen Liste prominenter Figuren, die die späteren Auflagen von A Problem from Hell bewerben, hat dazu beigetragen, diese beeindruckende und talentierte junge Frau zum Symbol der humanitären Intervention zu machen. Sie ist die optimale Rollenbesetzung. Dabei zählt auch das Aussehen, und Samantha Powers lange Mähne roter Haare macht sie im UN-Sicherheitsrat zu einer dramatischen Figur, wenn sie ihren Platz verlässt und sich vor einer verblüfften russischen Delegation aufstellt, um sie mit Schimpfkanonaden einzudecken.34 Unter den Russen haben Powers antirussische Theaterinszenierungen sie längst zur Witzfigur gemacht. Aber ganz gleich, ob selbstgerechte Tiraden schlicht grob wie von Susan Rice oder melodramatisch wie von Samantha Power vorgebracht werden, haben sie nur das Ergebnis, vernünftige Diskussionen zu blockieren und diplomatische Bemühungen um Lösungen ohne Krieg zu verhindern. »Smart Power« in Aktion In Entscheidungen, ihrer eigenen Version ihrer Zeit als USAußenministerin, schreibt Hillary Clinton, Teil ihrer außenpolitischen Philosophie sei »das Konzept der Smart Power« gewesen. Für sie bedeute »Smart Power, in einer bestimmten Situation die Wahl zu haben zwischen diplomatischen, wirtschaftlichen, militärischen, politischen, gesetzlichen und kulturellen Instrumenten – oder diese miteinander zu kombinieren.«35 Diese Definition ist praktisch inhaltsleer. Die Demokraten machten sich diesen Begriff vor allem deswegen zu eigen, um sich von George W. Bushs einseitiger Orientierung auf »harte« Macht (also Militärmacht) abzugrenzen, mit der er vernachlässigte, was der Politologe Joseph Nye »weiche« Macht nannte (praktisch alles andere, besonders Propaganda und die als Multilateralismus bezeichneten Formen, Druck auf Verbündete auszuüben). »Smart Power« bedeutet schlicht beides. Besonders in Mode kam der Ausdruck nach einem Artikel von Suzanne Nossel in Foreign Affairs im Jahr 2004, der den Titel »Smart Power: die Rückbesinnung auf den liberalen Internationalismus« trug.36 Nossel schrieb, progressive Politiker sollten »sich dem großen Pfeiler der US-Außenpolitik des Zwanzigsten Jahrhunderts zuwenden: dem 100 liberalen Internationalismus, der postuliert, dass ein weltweites System stabiler liberaler Demokratien weniger zum Krieg neigt. Washington, so diese Theorie, sollte demnach eine feste – diplomatische, wirtschaftliche und nicht zuletzt militärische – Führung bieten, um ein breites Bündel von Zielen zu fördern: Selbstbestimmung, Menschenrechte, Freihandel, Herrschaft des Rechts, wirtschaftliche Entwicklung und die Eindämmung und Eliminierung von Diktatoren und Massenvernichtungswaffen. Im Unterschied zu den Konservativen, die militärische Macht als das Hauptinstrument der Staatskunst betrachten, sehen die liberalen Internationalisten Handel, Diplomatie, Auslandshilfe und die Verbreitung amerikanischer Werte als gleichermaßen wichtig an.« Sobald der Jubel einmal abgeebbt ist, sehen wir, dass dies ein Rezept für die massive Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder ist. Es beinhaltet die Zerschlagung von Staaten wie Jugoslawien oder des Sudan, die uns nicht gefallen (Stichwort »Selbstbestimmung«), die Erhaltung von Staaten wie der Ukraine und Georgien, die wir mögen (»Herrschaft des Rechts«), Sanktionen und Bomben gegen missliebige Staaten (»Verbreitung amerikanischer Werte«) und vor allem Regimewandel (»Eliminierung von Diktatoren«). Die Idee, »ein weltweites System stabiler liberaler Demokratien« neige »weniger zum Krieg«, basiert auf der völlig unbegründeten Annahme, Kriege entstünden durch die Unterschiede zwischen politischen Systemen und nicht durch die Konkurrenz um Ressourcen, Territorialdispute oder eine lange Liste völlig irrationaler Streitigkeiten. Sie schließt die Koexistenz zwischen Systemen aus und besagt letztlich, dass wir Krieg letztlich darum führen, damit alle anderen Länder so sind wie wir selbst. Und es gibt keinerlei Beweis dafür, dass »demokratische« Staaten weniger zu Krieg neigen als konservative – das Gegenteil könnte der Fall sein. »Smart Power« heißt schlicht, dass die USA jedes nur erdenkliche Mittel zur Förderung ihrer Welthegemonie einsetzen. In diesem Arsenal ist das wichtigste Konzept der »weichen« Macht mit Sicherheit das der Menschenrechte. Und auf diesem Gebiet ist Suzanne Nossel Spezialistin. Nossel wurde 1969 geboren und war Geschäftsführerin sowohl von Human Rights Watch als auch des US-Zweigs von Amnesty International. Im Januar 2009 holte Hillary Clinton sie von Human Rights Watch ins Außenministerium zurück, wo sie zuvor bereits einmal für Richard Holbrooke gearbeitet hatte. Als Ministerialrätin für Internationale Organisationen war sie nun für multilaterale Menschenrechte, humanitäre Angelegenheiten, Frauenfragen, öffentliche Diplomatie, Medienarbeit und die Beziehungen zum Kongress verantwortlich. Zum selben Zeitpunkt 101 traten die USA nach einer langen Periode des Boykotts wieder dem UNMenschenrechtsrat bei, vor allem, um ihn daran zu hindern, Kritik an Israel zu üben. Stattdessen wollte man ihn dazu bringen, sich auf die Sünden von den USA unliebsamen Ländern oder auf neue Themen, darunter besonders LGTB-Rechte, zu konzentrieren.37 Frau Nossel hat seitdem für ihren Einsatz für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen internationale Anerkennung gewonnen und so die USA als Vorhut für die Menschenrechte gegen die zahlreichen traditionellen Gesellschaften der Welt positioniert – besonders gegen die, deren Regimes die USA mittels »Smart Power« in Verlegenheit bringen, isolieren oder sogar stürzen wollen. Nossel spielte eine wichtige Rolle dabei, den Menschenrechtsrat aufgrund von falschen Berichten über bevorstehende Massaker in Libyen zum Handeln zu veranlassen, was dann zum NATO-Bombardement des Landes und zu seiner Zerstörung führte.38 Im Januar 2012 verließ Nossel Hillary Clintons Außenministerium, um als Geschäftsführerin von Amnesty International einen weiteren Dienst für »Smart Power« zu leisten. Es war das Jahr, das durch eine große Amnesty-Unterstützungskampagne für Pussy Riot gekennzeichnet war. Das ist vielleicht auch der merkwürdigste Aspekt der Projektion USamerikanischer »weicher« Macht in den letzten Jahren: die demonstrative Unterstützung von Gruppen junger Frauen, die sich der organisierten Provokation traditioneller moralischer, religiöser oder anderer Verhaltensstandards verschrieben haben. Es gab einmal eine Organisation namens Amnesty International, die sich der Verteidigung von Gewissensgefangenen überall auf der Welt widmete. Ihr Vorgehen war durch zwei Prinzipien gekennzeichnet, die stark zu ihrem Erfolg beitrugen: Neutralität und Diskretion. Im Kontext des Kalten Krieges achtete Amnesty in diesen frühen Tagen strikt darauf, die Kampagnen gleichmäßig auf drei verschiedene ideologische Regionen zu verteilen: den kapitalistischen Westen, den kommunistischen Osten und die Entwicklungsländer im Süden. Die Kampagnen blieben diskret, vermieden ideologische Polemik und konzentrierten sich auf die rechtliche und materielle Situation der Gefangenen. Ihr Ziel bestand nicht darin, die Gefangenen als Vorwand zu benutzen, um gegen eine »feindliche« Regierung zu wettern, sondern darin, Regierungen dazu zu bringen, von der Verfolgung gewaltfreier Dissidenten abzulassen. Amnesty bemühte sich erfolgreich, einen universell zivilisierenden Einfluss auszuüben. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Arbeit von Amnesty 102 International komplizierter und schwieriger geworden. Früher befanden sich die meisten »Gewissensgefangenen« entweder im Sowjetblock oder in den diktatorischen US-Satellitenstaaten Lateinamerikas, was die Symmetrie der Arbeit förderte, ohne allzu sehr den Zorn der USSupermacht zu erregen. Aber besonders seit der Reaktion der BushAdministration auf den 11. September 2001 sind die USA immer mehr zum notorischsten Kerkermeister der ganzen Welt geworden. Diese Tatsache hat Amnesty als Organisation, die im Kern angloame-rikanisch ist, in tiefe Konflikte gestürzt. Zwar protestierte sie gegen abscheuliche Rechtsverstöße wie Guantanamo und die von Folter begleitete Inhaftierung Bradley Mannings, aber diese punktuelle Kritik steht in keinerlei Verhältnis zur summarischen Verurteilung von Regierungen, die von den USA zum Regimewandel ausersehen sind. Im Fall der USunterstützten »Farbenrevolutionen« werden Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch dazu verleitet, nicht etwa bestimmte politische Gefangene zu verteidigen, sondern ganze Staaten als »Menschenrechtsverletzer« zu brandmarken. Suzanne Nossels Jahr an der Spitze von Amnesty International war ein Meilenstein bei der US-Machtübernahme in der Organisation. In dieser neuen Phase hat Amnesty (ebenso wie Human Rights Watch und andere westliche »humanitäre« Organisationen) aufgehört, irgendwelche Unterscheidungen zwischen echten Gewissensgefangenen und halbprofessionellen Provokateuren zu treffen, deren Aktionen den Zweck verfolgen, Probleme mit den Behörden zu bekommen, um diese dann der Repression zu beschuldigen. In ihren Bemühungen zur Schwächung und zum Sturz des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milošević setzte die ClintonAdministration systematisch Techniken ein, wie sie von dem Theoretiker gewaltfreier Aktion Gene Sharp in Massachusetts verfochten werden. So bildeten US-Vertreter in Budapest zum Beispiel eine serbische Jugendgruppe namens »Otpor« (Widerstand), der man die Destabilisierung der Regierung Milošević zur Zeit der von ihm verlorenen Wahl im Jahr 2000 zuschreibt, in diesen Techniken aus. Geboren 1928, ließ sich Gene Sharp vom zivilen Ungehorsam diverser Befreiungsbewegungen und antimilitaristischer Gruppen dazu inspirieren, genau die Art von Störaktionen zu systematisieren, die jetzt paradoxerweise Teil des »Soft-Power«-Arsenals der USA geworden sind. Otpor war der erste Stoßtrupp der sogenannten »Farbenrevolutionen«, die von den USA unterstützt wurden.39 Das simple 103 Thema dieser Kampagnen ist meist: Der gegenwärtige Führer des Landes »muss weg«, und es kümmert wenig, was danach kommt. Da die Kampagnen sich vor allem an die Öffentlichkeit richten, hängt ihr Erfolg von sympathisierenden Medien ab, die nur zu willig sind, provokativen Aktionen Publicity zu verschaffen – Aktionen, die überall sonst auf der Welt als Ruhestörung betrachtet würden, aber in diesem Fall als heldenhafte Herausforderung der Tyrannei gefeiert werden. Solche Gruppen vertreten keine definierbare politische Philosophie und kein Programm außer dem, die Person an der Macht »loszuwerden«, und zwar egal, ob diese Person demokratisch gewählt wurde oder nicht. Bei dieser Dissidenz scheinen weder Qualität noch Kontext eine Rolle zu spielen. Behörden stehen hier vor dem Problem des Umgangs mit Provokateuren, die absichtlich Rechtsverstöße begehen, um verhaftet zu werden. Verhaftet man sie, geht man in die Falle, verhaftet man sie nicht, kann das zu Beschwerden verärgerter Bürger führen, denen solcher Exhibitionismus nicht gefällt. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Gruppe namens Pussy Riot. Am 21. Februar 2012 stürmten fünf spärlich und in grellen Farben gekleidete Frauen, die zur Verhüllung ihrer Gesichter Skimasken trugen, in die Christ-Erlöser-Kathedrale im Zentrum Moskaus, stellten sich vor dem Hochaltar auf und begannen, Obszönitäten zu rufen, wobei sie den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche als »Hure« beschimpften und den Text von Kirchenliedern mit Fäkalausdrücken mischten. Begleitet wurden sie von Technikern, die den Auftritt filmten und später dessen Wortlaut änderten, um ihn gegen Putin zu richten. Die empörten Christen, die dem Auftritt beiwohnten, hörten antichristliche Obszönitäten, keine irgendwie geartete »politische« Botschaft. Obwohl die Frauen zunächst fliehen konnten, wurden im März drei Mitglieder der Gruppe verhaftet: Nadeschda Tolokonnikowa, Marija Aljochina und Jekaterina Samuzewitsch. Am 30. Juli 2012 wurden die drei Frauen wegen gruppenweise begangenen »Rowdytums« (Verletzung der öffentlichen Ordnung) vor Gericht gestellt. Das war die Gelegenheit, massiv und unter Mobilisierung der NGOs, der Medien und aller möglichen Berühmtheiten die »weiche Macht« der USA zu entfalten. Kein anderer Staat der Welt ist ähnlich effektiv darin, Agitatoren in Popstars zu verwandeln. Erzürnt durch irreführende Berichte, die behaupteten, die Frauen würden nur deshalb einem »Schauprozess« unterzogen, weil sie »in einer Kirche ein Lied gesungen« hätten,40 eilte ein Heer von westlichen Popstars von Paul McCartney, Madonna und Björk bis hin zu minderen 104 Größen zur Verteidigung von (angeblichen) Künstlerkollegen, die durch den »Diktator« Putin in Gefahr seien.41 Es ist nicht schwer, Musiker, die Millionen von Dollar verdienen, zu überzeugen, sie hätten die moralische Verpflichtung zur »Rettung der Welt« vor irgendwem oder irgendetwas. Pussy Riot war der neue Spross einer Gruppe anarchistischer Provokateure namens Woina (Krieg), die sich bereits mit öffentlichen Aktionen hervorgetan hatte, die die Akteure praktisch überall auf der Welt in Schwierigkeiten bringen würden. Nadeschda Tolokonniko-was Partner (und der Vater ihres Kindes) war einer der Anführer Woinas. Zu den Aktionen der Gruppe gehörten der öffentliche Geschlechtsverkehr im Timirjasew-Museum in Moskau (hieran war auch die sichtbar schwangere Tolokonnikowa beteiligt), das Bewerfen von Angestellten eines McDonald-Restaurants in Moskau mit lebendigen Katzen, Angriffe mit Molotow-Cocktails auf Polizeifahrzeuge und, vielleicht am seltsamsten, der Diebstahl eines Huhns in einem Supermarkt, bei dem die Diebin sich das Huhn in die Vagina schob. All das wurde für das Internet gefilmt.42 Merkwürdigerweise hatte keine dieser Aktionen, obwohl sie häufig von Slogans gegen Putin begleitet waren, zu Problemen der Gruppe mit der Staatsgewalt geführt. Die Kirche, nicht der Staat, reichte die Klage gegen sie ein, obwohl die Gruppe behauptete, gegen Putin zu kämpfen, der auch zugleich ihr Peiniger sei. Amnesty International verlieh den drei Pussy Riotern den Status von »Gewissensgefangenen« und widmete ihrem Fall, den sie als wichtige Menschenrechtskampagne behandelte, sehr große Aufmerksamkeit. Die brutale Behandlung Bradley/Chelsea Mannings, die drohende Strafverfolgung Julian Assanges durch die USA, die wiederholte Ermordung schwarzer »Verdächtiger« durch die US-Polizei, die weltweite Rekordzahl von Häftlingen in US-Gefängnissen oder selbst Guantanamo zogen nie vergleichbare Aufmerksamkeit auf sich. Der Ton der Pussy-Riot-Kampagne von Amnesty International war so weit wie nur möglich von einem diplomatischen Appell entfernt, der die Absicht verfolgt hätte, die Behörden davon zu überzeugen, die Frauen freizulassen. Tatsächlich war es der Ton der Provokation. Zum Beispiel: »Masha, Nadia und Maria, die wegen friedlichen Singens eines Protestsongs in einer Kathedrale in Haft gehalten werden, könnten leicht in ein Arbeitslager in Sibirien gekarrt werden, wo sie der Gefahr der Vergewaltigung und anderer Misshandlungen ausgesetzt wären. (Hervorhebung im Original, das von den erwähnten Organisationen weit verbreitet wurde.) 105 Das Verbrechen Pussy Riots? Sie sangen in einer Kirche ein Protestlied. Amnesty International organisiert eine starke weltweite Antwort, um den Fall Pussy Riot im Rampenlicht zu halten. Helfen Sie uns, Präsident Putin zum Protest eine Lastwagenladung bunter Skimasken zu schicken. Das heutige Urteil ist typisch für die wachsenden Bemühungen Präsident Putins und seiner Spießgesellen, die freie Rede in Russland zu ersticken. Daher schicken wir Präsident Putin so viele farbige, Balaklavas genannte Masken, wie wir können. Spenden Sie $ 20 oder mehr, um eine Maske an Putin zu schicken. […] Es ist klar, dass die russischen Behörden versuchen, diese Frauen zum Schweigen zu bringen und anderen Aktivisten Angst einzujagen – lassen Sie sie damit nicht durchkommen.«43 Das war ein Ton, der es für Präsident Putin politisch nur schwerer, nicht leichter machen konnte, Pussy Riot eine Amnestie zu gewähren, was er aber dennoch vor den Olympischen Spielen in Sotschi tat. Nach ihrer Freilassung setzten die Frauen ihre Anti-Putin-Kampagne in westlichen Ländern fort. Ebenso wie viele westliche Medien hat Amnesty International diesen Fall auf eine Art simplifiziert, die nahelegt, Russland sei gerade dabei, zur stalinistischen Herrschaftsform der 1930er Jahre zurückzukehren. Das französische Boulevardblatt Liberation brachte auf dem Titelblatt ein großes Foto der drei Frauen mit der Überschrift: »In den GULAG für ein Lied.«44 Die Online-Protestplattform Avaaz ging noch weiter: »Russland rutscht beständig weiter in den Griff einer neuen Autokratie ab. […] Jetzt liegt unsere beste Möglichkeit, Putin zu beweisen, dass er einen Preis für seine Repression zahlen muss, in Europa. Das Europäische Parlament ruft zu einer Einfrierung der Vermögen und zu einem Reiseverbot für Putins mächtigen inneren Kreis auf, der vielfacher Verbrechen angeklagt wird. […] Wenn wir die Europäer zum Handeln drängen können, wird das nicht nur hart für Putins Zirkel sein, da viele dieser Leute Konten und Wohnungen in Europa haben, sondern auch seiner antiwestlichen Propaganda begegnen und ihm zeigen, dass die ganze Welt bereit ist, für ein freies Russland aufzustehen.«45 Schon 2012, noch lange vor der Ukrainekrise, waren die »weichen« Machtinstrumente der USA am Werk, um die westliche öffentliche Meinung auf eine »Bestrafung« Putins vorzubereiten. Am 26. September 2012 erhielt ich ebenso wie Millionen weitere Empfänger eine »persönlichen Botschaft« Suzanne Nossels, die erklärte, 106 Amnesty arbeite »direkt mit den Anwälten und Familienmitgliedern von Pussy Riot zusammen, um ein helles Scheinwerferlicht auf diesen Fall zu werfen«.46 »Stehen Sie uns bei«, verlangte sie. »Verweigern Sie das Schweigen.« Als ob bis dahin jemand geschwiegen hätte. Zwischen Mitgliedschafts- und Spendenappellen kam Suzanne Nossel auf den Punkt: »Russlands Behandlung von Pussy Riot stellt eine Erdrosselung der Freiheit und einen Unwillen zur Respektierung der Menschenrechte dar, auf die wir reagieren müssen. Abgesehen von der Repression in Russland selbst unterstützt Präsident Putin auch weiterhin seinen Verbündeten Syrien, obwohl sich die Beweise häufen, dass die syrische Regierung Verbrechen gegen die Menschheit begeht. Wir müssen die Lautstärke aufdrehen.« Auch Avaaz machte klar, worum es eigentlich ging: »Was in Russland geschieht, geht uns alle an. Russland hat die internationale Zusammenarbeit zu Syrien und anderen dringlichen globalen Fragen blockiert, und eine russische Autokratie bedroht die Welt, die wir uns alle, wo immer wir uns befinden, wünschen.«47 Pussy Riot war eine sexy Art, um aus ganz anderen als den vorgegebenen Gründen, angefangen mit den US-Bemühungen um einen Regimewandel in Syrien, die öffentliche Meinung gegen Russland aufzuputschen. Bei einem Treffen sogenannter »Freunde Syriens« (gemeint waren Unterstützer der syrischen Rebellen) in Genf am 6. Juli 2012 wendete sich Hillary Clinton heftig gegen Russland und China, die sie beschuldigte, die US-gesponserten Initiativen bei den Vereinten Nationen für einen Regimewandel in Syrien zu blockieren. »Ich glaube nicht, dass Russland und China einen Preis – oder was auch immer – dafür zahlen, dass sie sich für das Assad-Regime stark machen. Das Einzige, was hieran etwas ändern wird, ist, wenn jedes hier vertretene Land direkt und dringlich klar macht, dass Russland und China einen Preis zahlen werden«, warnte sie.48 Hier haben wir also »Smart Power« in Aktion. Hillary sagt, Russland, müsse »einen Preis zahlen«, und schon machen sich zahlreiche »Menschenrechts«-NGOs an die Arbeit, um Russland eine schlechte Presse zu verschaffen. Die westlichen Medien spielten bei diesem Spiel begeistert mit. 107 Am Ende des Avaaz-Aufrufs hieß es: »Schließen wir uns zusammen, um Putin zu zeigen, dass die Welt ihn zur Rechenschaft ziehen und Veränderungen verlangen wird, bis Russland befreit ist.« Darüber sollte man einmal nachdenken. »Wir«, die Unterzeichner von Avaaz-Petitionen, wollen Putin, der immerhin der legal gewählte Präsident Russlands ist, »zeigen«, dass die Welt »Veränderungen verlangen wird, bis Russland befreit ist«. Befreit von wem und für wen? Pussy Riot? Wann haben sie eine Wahl gewonnen oder könnten sie eine gewinnen? Wie soll Russland also »befreit« werden? Durch eine Flugverbotszone? Durch US-Drohnen? Russland muss »einen Preis zahlen”, weil es den US-Plänen in Syrien im Weg steht. War Pussy Riot Teil des Preises? Der Chor der westlichen Medien, Popstars und anderen selbsternannten humanitären Kämpfer wiederholte die Beschuldigung, die Frauen von Pussy Riot seien nur wegen eines Liedes, das sie in einer Kirche gegen ihn gesungen hatten, »von Putin« eingesperrt worden. Aber wo gibt es Beweise, dass sie von Putin eingesperrt wurden? Allem Anschein nach wurden sie nach einer Beschwerde der christlichorthodoxen Kirche, der ihr ungezogener Auftritt vor dem Hochaltar missfiel, von der Polizei festgenommen. Kirchen neigen generell zu der Auffassung, dass die eigenen Räumlichkeiten für die eigenen Riten und Zeremonien reserviert sind. So riefen aus ähnlichem Anlass auch die Verwalter des Kölner Doms die Polizei und ließen sie eine Gruppe, die Pussy Riot kopierte, festnehmen.49 Es war auch nicht das erste Mal, dass Pussy Riot in eine orthodoxe Kirche eingedrungen war, und diesmal hatten die empörten Kirchenvertreter genug. Die Gruppe hatte zuvor schon oft »gegen Putin« demonstriert, ohne festgenommen zu werden. Wo ist also der Beweis, dass sie zur »Unterdrückung abweichender Meinungen« von Putin eingesperrt wurden? Putin hat gesagt, unter anderem vor laufender Kamera, er sei der Meinung, die Frauen sollten für ihren Auftritt nicht zu hart bestraft werden.50 Aber Russland hat auch ein Justizsystem. Gesetz ist Gesetz. Nachdem die Frauen auf die Beschwerde der Kirche hin erst einmal verhaftet waren, fingen die Mühlen des Gesetzes an zu mahlen, es kam zu einem Gerichtsverfahren und sie wurden auf der Basis der Klagen aufgebrachter Christen von einem Gericht für schuldig befunden und verurteilt. Interessanterweise hatte keiner der Zeugen vor Gericht irgendeine Erwähnung Putins gehört – sie waren schlicht von den Tänzen und den obszönen Worten der maskierten Sängerinnen abgestoßen. Videos auf Youtube zeigen, dass das Lied (wenn man es so nennen kann) und die 108 Anti-Putin-Lyrik (wenn man dies denn so bezeichnen kann) dem Video, das die Gruppe dann online stellte, erst später hinzugefügt worden waren.51 Warum war das also eine »Unterdrückung durch Putin«? Der Grund war offenbar dieser: Sobald der Westen das ungehorsame Oberhaupt eines Landes einmal als »Diktator« bezeichnet, kann dieser Staat per definitionem kein eigenes Justizsystem, keine freien Wahlen, keine unabhängigen Medien, keine freie Meinungsäußerung und keine zufriedenen Bürger mehr haben – nein, nichts davon, weil im kollektiven Gruppendenken des Westens jeder »Diktator« quasi Hitler und Stalin zugleich ist und alles Schlechte, was in seinem Land getan wird oder geschieht, auf seinen bösen Willen zurückgeht. Natürlich wäre es absurd zu glauben, die Bürger Russlands oder irgendeines anderen Landes seien alle mit ihren Führern zufrieden, selbst wenn sie diese mit überwältigender Mehrheit gewählt haben. Selbst demokratische Länder bieten ihren Wählern nur eine schmale Bandbreite an Präsidentschaftskandidaten. Aber trotz Jahrhunderten zaristischer Autokratie, der Invasionen der Mongolen, Napoleons und Hitlers, der bolschewistischen Revolution, der kommunistischen Einparteiendiktatur und dann des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruchs der Jahre unter Jelzin hat Russland jetzt weitgehend eine eigene Version der westlichen kapitalistischen Demokratie übernommen, zu der auch die Achtung vor der Religion gehört. Und hier finden wir etwas Merkwürdiges: Der Westen, der früher einmal seine Interkontinentalraketen gegen den »atheistischen Kommunismus« richtete, scheint jetzt alles andere als zufrieden über die Wiederauferstehung der christlich-orthodoxen Kirche als geachtetem Teil der russischen Gesellschaft. Doch unabhängig davon, ob es einem gefällt oder nicht, ist nichts Überraschendes daran, dass nach dem Zusammenbruch einer kommunistischen Ideologie, die in vielerlei Hinsicht eine Art Religion war, viele Menschen in Russland zu ihrem traditionellen christlichen Glauben zurückgekehrt sind. Der Fall Pussy Riot scheint die Botschaft zu bergen, dass das westliche Kriterium für eine freie Gesellschaft sich geändert hat. Es besteht nicht länger in der Freiheit, eine Religion auszuüben, sondern in der Freiheit, diverse Arten von sexuellem Exhibitionismus zu praktizieren. Man kann natürlich argumentieren, dies sei ein wichtiger Fortschritt, aber da der christliche Westen zweitausend Jahre gebraucht hat, um zu diesem Grad von Weisheit zu gelangen, sollte er nun ein wenig Geduld mit Gesellschaften haben, die hier noch ein oder zwei Jahrzehnte 109 hinterherhinken. Der Aufruhr um Pussy Riot fand zu Hillary Clintons Amtszeit als Außenministerin statt und wurde wohl von ihr hinter den Kulissen gefördert.52 Ihre Expertin für »Smart Power«, Suzanne Nossel, betrieb die Kampagne von Amnesty International, und diese Kampagne dominierte die Anti-Putin-Propaganda während Hillary Clintons letztem Jahr als Außenministerin. Später gefragt, welche Frauen sie »inspirierten«, nannte sie unter anderem Pussy Riot. Nachdem die beiden inhaftierten Frauen, Tolokonnikowa und Aljochina, von Putin vorzeitig entlassen worden waren, reisten sie nach New York, und am 7. April 2014 brachte Hillary ein Foto von sich selbst mit den beiden Riot Girls in Umlauf und twitterte dazu: »Toll, die starken und mutigen Frauen von #PussyRiot zu treffen, die sich weigern, ihre Stimmen in #Russland zum Schweigen bringen zu lassen.«53 Hillary ist sehr stolz darauf, »eine Frau des Glaubens« zu sein – tatsächlich jeden beliebigen Glaubens. Sie äußerte absolutes Verständnis für die Muslime, die wegen eines vulgären, in Hollywood produzierten Videos, das den Propheten verunglimpfte, im gesamten Nahen Osten gegen US-Botschaften wüteten. »Als religiöser Mensch kann ich nachvollziehen, wie verletzend die Herabsetzung des eigenen Glaubens sein muss.«54 Aber von ihr war nie auch nur das geringste Verständnis für die orthodoxen Christen zu hören, die sich durch die obszönen Possen Pussy Riots in ihrem Gebetshaus beleidigt fühlten. Moralisches Chaos Eine weitere Gruppe exhibitionistischer Frauen an der Frontlinie der USgeführten Kulturkriege ist die ukrainische Gruppe »Femen«, die mit Pussy Riot einen exhibitionistischen Hass auf Putin, wenn nicht Russland überhaupt teilt, aber von sich behauptet, der »neue Feminismus« zu sein, der drei Formen des Patriarchats attackiert: die sexuelle Ausbeutung von Frauen, Diktatur und Religion.55 Ihre Botschaft gegen die »sexuelle Ausbeutung von Frauen« ist besonders unscharf, da die Gruppe selbst, wie jeder sexistische Werbedesigner, die unverhüllten Brüste von Frauen einsetzt, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Nackte Brüste sind sogar ihr Markenzeichen, und das führt sie wie selbstverständlich dazu, ihre Aktivistinnen nach denselben »sexistischen« Kriterien auszusuchen, die 110 auch für die Einstellung von Showgirls im Nachtclub Crazy Horse verwendet werden. Was die »Diktatoren« betrifft, wird man es schon erraten haben: Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf einen »Diktator«, der in Wirklichkeit ein gewähltes Staatsoberhaupt ist: den Präsidenten Russlands, Wladimir Putin. Die religiösen Zielscheiben sind meist Christen oder Muslime. Die Frauen verschwenden ihre Zeit nicht mit theoretischen Diskussionen, denn bei ihren antireligiösen Angriffen scheint es primär um bestimmte Aspekte sexueller Sitten zu gehen. Im August 2012 floh die Femen-Führerin Inna Schewtschenko, nachdem sie in Kiew ein riesiges Holzkreuz umgesägt hatte, vor angeblichen Todesdrohungen aus der Ukraine und bat um politisches Asyl in Frankreich, das auch ungewöhnlich schnell gewährt wurde. Zudem gab man ihrer Gruppe rasch ein Hauptquartier in einem sozialen Zentrum, das sich mitten im am dichtesten von Muslimen besiedelten Viertel von Paris befindet. Die Frauen begannen sofort, die Nachbarn auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen, indem sie, sehr zum Befremden der Bewohner, barbusig durch die engen Straßen paradierten und auf Englisch Obszönitäten riefen. Wenn es ihre Absicht war, bei den arabischen und afrikanischen muslimischen Männern auf der Straße »sexistische« Reaktionen zu provozieren, scheiterten sie damit.56 Einmal in Paris, rekrutierte Inna Schewtschenkos Gruppe französische Frauen, um sie für Aktionen gegen die katholische Kirche auszubilden. Ihre Kämpferinnen störten eine konservative Prozession von Familien, die gegen die Schwulenehe demonstrierte, indem sie Kinderwagen samt den Kindern mit Farbe vollsprühten. Am 20. Dezember 2013 führte eine Femen-Gruppe, während Gemeindemitglieder der Madeleine-Kirche in Paris einen Choral übten, vor dem Altar ein Schauspiel der »Abtreibung Jesu« vor, wobei sie ein Stück Kalbsleber als Fötus benutzten, »Weihnachten ist abgesagt« riefen und auf die Stufen des Altars urinierten, um dann die Kirche zu verlassen.57 Französische Briefmarken tragen oft das Porträt des Symbols der Republik, der »Marianne«, aber das Gesicht wechselt regelmäßig, und dabei wird oft das Porträt einer berühmten Schauspielerin verwendet. Im Sommer 2013 wurde eine neue, von Präsident Francois Hollande ausgewählte Briefmarke vorgestellte, auf der Inna Schew-tschenko als Marianne fungiert. Der Künstler, Olivier Ciappa, erklärte, Inna repräsentiere »perfekt meine Werte von liberte, egalite and fratemite«.58 Es ist paradox, dass dieses neue »Symbol französischer Werte«, wenn sie 111 auf der Straße »kämpft«, nur Englisch spricht. Während Wladimir Putin sich 2014 zu den D-Day-Feiern in Frankreich aufhielt, gelang es einer Femen-Aktivistin, von Fotografen begleitet in den abgesperrten Bereich von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in Paris einzudringen und die Figur des russischen Präsidenten mit einem Holzkeil zu »ermorden«.59 Die ukrainischen Femen haben verkündet, dass sie der rechtsextremen, ukrainisch-nationalistischen Swoboda-Partei nahestehen60 und waren auch zur Unterstützung des rechtsgerichteten Angriffs auf föderalistische Aktivisten am 2. Mai 2014 in Odessa zur Stelle,61 bei dem mindestens 38 Menschen in einem von ukrainischen Nationalisten gelegten Feuer zu Tode kamen. Zu Femen zu gehören, ist ein Vollzeitjob und erfordert körperliches Training und Disziplin. Finanziert wird die Gruppe Berichten zufolge von »Geschäftsleuten«. Einer von ihnen ist Jed Sunden, ein US-Amerikaner, der nach dem Zerfall der Sowjetunion in der Ukraine auftauchte, um die wichtigste englischsprachige Zeitung der Hauptstadt, die KyivPost, zu gründen (die er später an einen anderen Geschäftsmann weiterverkaufte). Hauptinhalt der Zeitung war das Aufputschen der antirussischen Gefühle der Westukrainer, Gefühle, die schon seit Jahrhunderten von westlichen Imperien stimuliert und belohnt werden, um Russland zu schwächen. Frauen gegen Frauen Für einen Großteil der Welt kann die Tatsache, dass westliche Regierungen Pussy Riot und Femen als Heldinnen, wenn nicht sogar als Märtyrerinnen und Rollenmodelle feiern, nur den wachsenden Glauben erhärten, dass der liberale Westen dabei ist, in völlige Dekadenz zu versinken. Auch im Westen selbst gibt es ja eine wachsende Ablehnung der Werte der Aufklärung, der liberalen Gesellschaft und des Individualismus. Wenn die Bedeutung von »Freiheit« auf vulgären Exhibitionismus reduziert wird, wird sie nicht viele glühende Verteidiger finden. In Wirklichkeit führen diese exhibitionistischen Gruppen sowohl den Feminismus als auch die Freiheit ad absurdum; sie diskreditieren beide und stärken damit die traditionalistischen Haltungen, die sie anzugreifen vorgeben. Ihre Darbietungen können nur die frauenfeindlichsten Vorstellungen von »befreiten Frauen« als hysterischen Todesengeln bestätigen. Es ist schwer zu verstehen, was ihre westlichen 112 Unterstützer durch diese Art von Agitation anderes zu gewinnen hoffen, als die Verschärfung des »Konflikts der Zivilisationen«. Wenn Femen zu irgendeinem Trend beigetragen hat, dann zu dem der Rückkehr zur konservativen Tradition. Viele muslimische Frauen haben auf solche Zumutungen reagiert, indem sie den Schleier nunmehr umso mehr als die wahre »Befreiung« betrachten. Selbst in den westlichen Ländern konvertieren derzeit Hunderte von jungen Menschen zum Islam und eilen in den Nahen Osten, um sich, aus Revolte gegen einen Westen, der auf seine Dekadenz stolz ist, einem fanatischen Heiligen Krieg anzuschließen. Millionen von Frauen auf der Welt kämpfen für ihre grundlegendsten Rechte. Was sollen sie von westlichen Menschenrechtsorganisationen denken, die Millionen ausgeben, um einige privilegierte Frauen, die sich in öffentlichen Wutanfällen ergehen, auf den Schild zu heben? Nicht nur Frauen, sondern all jene, die ernsthafte Gründe haben, gegen echte Ungerechtigkeit zu rebellieren, leiden unter dem Rampenlicht, das auf diese sorgfältig choreografierten und undurchsichtig finanzierten »Proteste« gerichtet wird. Während die USA Pussy Riot feierten, walzten sie im eigenen Land die Occupy-Bewegung nieder. Die eine Gruppe repräsentiert einige Einzelpersonen, die andere vertrat die »99 Prozent«. Die westlichen Mächte nähren ihren Anspruch als weltweite Unterstützer der Freiheit, indem sie Pussy Riot und Femen hochloben, während authentischer sozialer Protest in wachsendem Maß ausspioniert, unterdrückt, marginalisiert und ignoriert wird. Die US-Dominanz im Bereich populärer Bilder schafft ein Paralleluniversum, das »unsere Werte« nachäfft, aber in wachsendem Maß einer großen Irrenanstalt ähnelt und zu einem immer größeren moralischen Chaos beiträgt. 113 4 Der Beginn des clintonschen Kriegszyklus Es begann alles in Jugoslawien. Während der Misserfolg des Krieges in Afghanistan immer mehr erkannt wird, das Desaster des Libyen- Krieges kaum zu übersehen ist und die Katastrophe der Invasion des Irak 2003 schon als notorisch gilt, wird der Krieg, mit dem dieser tödliche Zyklus begann, nämlich die unter dem Namen »Kosovokrieg« bekannte Bombardierung Jugoslawiens 1999, immer noch von vielen als Erfolg betrachtet. Er wird als gutes Beispiel eines »humanitären Krieges« angeführt und als Argument für weitere bewaffnete Interventionen ins Feld geführt. Solange die historische Bedeutung dieses Krieges so gut wie unbekannt bleibt, kann man ihn auch als perfektes Verbrechen betrachten: Er war erfolgreich und die Schuldigen kamen davon. Der Kosovokrieg markierte das Ende eines Zwischenspiels, das auf das Ende des Kalten Krieges und die große Waffenruhe folgte, nach der Michail Gorbatschow und die sowjetische Elite suchten, da sie dachten, nun sei der Augenblick für Frieden auf der Welt. Dies war die Zeit, in der US-Politiker, die angesichts des plötzlichen Verschwindens ihres »Feindes Nummer 1« überrascht, skeptisch und sogar frustriert waren, innehalten und über neue Strategien nachdenken mussten. Was sollte nun mit dem Militärisch-Industriellen Komplex, mit all den lukrativen Pentagon-Verträgen, den Militärstützpunkten auf der ganzen Welt und den namhaften Intellektuellen geschehen, die mit der Analyse der permanenten Bedrohung durch das kommunistische »Reich des Bösen« beschäftigt waren? Während Präsident Reagan glücklich über seinen Erfolg war, machte dieser einen Großteil des außenpolitischen Establishments zeitweise ratlos. Gorbatschow träumte offenbar von einer Art historischem Kompromiss zwischen den beiden Systemen, die einander im Kalten Krieg gegenübergestanden hatten. In Europa hofften die Menschen auf 114 eine sanfte sozialdemokratische Welt, die das Soziale am Sozialismus mit der Demokratie des Westens kombinieren würde. Fünfundzwanzig Jahre später sind beide Ideen schwer, ja vielleicht sogar tödlich verwundet. Wie sich herausstellte, waren soziale Maßnahmen leicht widerrufbar, sobald die kapitalistische Welt nicht mehr mit dem Kommunismus um die Loyalität der Arbeiter konkurrieren musste. Aber ohne diesen sozialen Aspekt reduzierte sich die Demokratie vor allem in den USA auf ein Milliardärs-Kasino. Mit dem sowjetischen Widersacher fiel auch der große Hemmschuh weg für das, was der erste Präsident Bush die »Neue Weltordnung« genannt hatte und was heute unter dem Namen »Globalisierung« bekannt ist. Das Ende des Zwischenspiels kam, als die Clinton-Administration die Gelegenheit beim Schopf ergriff, die NATO vor der Gefahr der Überflüssigkeit zu retten, indem sie sie zu einer internationalen Polizeitruppe umfunktionierte. Für die USA waren die Erhaltung und Stärkung der NATO nötig, um die Kontrolle über Westeuropa aufrechtzuerhalten, die Washington seit dem Zweiten Weltkrieg ausübte. Ferner bildete die NATO für sie den Kern eines erweiterbaren Instruments der eigenen militärischen Vorherrschaft. Die Gelegenheit kam mit der Krise Jugoslawiens. Die Clintons hatten diese Krise nicht geschaffen, aber dennoch waren sie es, denen es gelang, die NATOBombenkampagne im Frühjahr 1999 als etwas ganz Neues zu präsentieren: einen vollkommen »humanitären« Krieg.1 In den 1980ern hatte der Gehorsam der jugoslawischen Bundesregierung gegenüber den Forderungen des Internationalen Währungsfonds im Hinblick auf die Schulden des Landes zu Spannungen zwischen den Regierungen der Republiken geführt, aus denen die jugoslawische Föderation bestand. Die Territorien dieser Republiken deckten sich grob, aber keineswegs genau mit den ethnischen Identitäten dieser multikulturellen Nation. Jugoslawiens innere Schwierigkeiten wurden erstmals internationalisiert, als die Bundesrepublik Deutschland, die gerade erst ihr langgehegtes Ziel der Eingliederung Ostdeutschlands erreicht hatte, sich aggressiv für die einseitige Sezession Kroatiens und Sloweniens von Jugoslawien starkmachte.2 Beides waren ehemalige Provinzen des Österreichisch-Ungarischen Reichs, die nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Königreich Serbien zusammengelegt worden waren, um mit diesem zusammen Jugoslawien – das Land der Südslawen – zu bilden. Das Zerbrechen Jugoslawiens war sowohl eine historische Revanche der »germanischen« Welt an den Slawen als auch ein Mittel, den deutschen Einfluss auf wertvollen Grundbesitz an der Küste des 115 Mittelmeers sicherzustellen. Die historischen Verbündeten Serbiens, Frankreich und Großbritannien, die seinerzeit die Gründung Jugoslawiens unterstützt hatten, machten nun der europäischen Einheit halber und unter dem Druck einer koordinierten Propagandakampagne mit der antiserbischen Politik der Deutschen gemeinsame Sache. Serbiens anderer historischer Verbündeter, Russland, befand sich unter der US-gestützten Präsidentschaft Boris Jelzins im Dämmerzustand und agierte viel zu schwach und verwirrt, um eine Rolle zu spielen. Eine massive westliche Propagandakampagne, die in Deutschland begann und bald durch tendenziöse Presseerklärungen eigens zu diesem Zweck angeheuerter US-amerikanischer PR-Firmen unterstützt wurde, bediente sich weit hergeholter Analogien, um Serbien als ein zweites Nazi-Deutschland und seinen Präsidenten Slobodan Milošević als neuen Hitler hinzustellen. Milošević unsichere Bemühungen, Jugoslawien zusammenzuhalten oder wenigstens die Rechte der Serben in Landesteilen außerhalb der Serbischen Republik zu sichern, wurden auf absurde Art mit den Bestrebungen des Dritten Reichs verglichen, Europa zu erobern.3 Die gegensätzlichen Gebietsansprüche, die aus der ohne Verhandlungen vollzogenen Abtrennung mehrerer Republiken von der Jugoslawischen Föderation resultierten4, wurden als nackte serbische Aggression hingestellt. Als der Bürgerkrieg sich von Kroatien aus in das aus drei Nationalitäten bestehende Bosnien-Herzegowina ausbreitete, wurden die von den bosnischen Serben zeitweilig eingerichteten Gefangenenlager von den westlichen Medien mit Nazi-KZs verglichen, während ganz ähnliche, von den bosnischen Muslimen und Kroaten eingerichtete Lager ignoriert wurden.5 Der Erfolg, den diese Analogie mit Ereignissen des Zweiten Weltkriegs in der Dämonisierung der Serben erreichte, war umso bemerkenswerter, als die Auflösung Jugoslawiens in mancher Hinsicht eine Fortsetzung der beiden Weltkriege darstellte. Die Sezession Kroatiens wurde weitgehend von Nachfolgern der faschistischen Ustascha-Bewegung betrieben, die seinerzeit von der Invasion der Nazis profitiert hatte, um sich im Rahmen des Nazi-beherrschten Europas einen ethnisch reinen, unabhängigen kroatischen Staat zu schaffen. Der Führer der sezessionistischen muslimischen Partei in Bosnien, Alija Izetbegović, war in seiner Jugend Sympathisant der Nazis gewesen. Der Unterschied war nur, dass Serbien, das im Zweiten Weltkrieg sowohl die Westmächte als auch Russland als Verbündete hatte, diesmal alleine dastand. Fünfzig Jahre nach der Niederlage der Nazis war in Europa eine Generation an der Macht, die mit einer mythischen Vereinfachung des 116 Zweiten Weltkriegs aufgewachsen war und wenig oder nichts über die geschichtlichen Ursprünge des Konflikts auf dem Balkan wusste. Die historische Umkehr der Rollen blieb unbemerkt. Eine Generation, die nur Frieden gekannt hatte, schien beinahe gierig auf das Drama, »in aufregenden Zeiten zu leben«, und die Herausforderung, die »neuen Nazis« zu bekämpfen. Die Hitler-Analogie diktierte dann die Reaktion: Die »freie Welt« muss bereit sein, Gewalt gegen die Gefahr anzuwenden, um ein neues »München« zu verhindern. Die »München«-Analogie dient dabei immer zum Ausschluss jeder Suche nach einem Kompromiss, der von vornherein als grünes Licht für »Diktatoren« stigmatisiert wird. Und doch war dies ein rein lokaler Konflikt, in dem eine unparteiische internationale Vermittlung sehr wohl hätte helfen können, einen Kompromiss zu finden und Blutvergießen zu vermeiden. Statt dies entweder selbst zu versuchen oder eine unparteiische Vermittlung durch die UN zu fordern, schlug sich die im Januar 1993 ins Amt gekommene Clinton-Administration rasch auf eine Seite. Ein anfänglicher, von der Europäischen Gemeinschaft6 lancierter territorialer Kompromiss zwischen den Führern der muslimischen, serbischen und kroatischen Gemeinschaften in Bosnien-Herzegowina, der einen Bürgerkrieg vermieden hätte, brach zusammen, als Alija Izetbegović ihn ablehnte, nachdem der bosnische US-Botschafter ihm versichert hatte, er könne etwas Besseres bekommen, wenn er ihn zurück-weise.7 Der Bosnienkrieg endete 1995 mit Regelungen, die den 1993 von Izetbegović abgelehnten Vorschlägen ähnlich waren. Zwanzig Jahre später bleiben von den zwei Jahren Massenschlächterei nur bittere Ressentiments, Trauer, Hass und Misstrauen – Emotionen, die eine Versöhnung verhindern und die Abhängigkeit der feindlichen Brüder von äußeren Mächten verewigen. Hillary zieht in den Krieg Als die Wähler 1992 Bill Clinton zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wählten, stimmten sie damit auch für seine Frau. Bill erklärte den Wählern, wenn sie für ihn stimmten, bekämen sie »zwei [Clintons] zum Preis von nur einem«. Aber nach dem Misslingen ihres Plans zur Gesundheitsreform bestand Hillarys einziger politischer Erfolg in ihrer hervorragend gespielten Rolle als treue Ehegattin, die »zu ihrem Mann hält«.8 Die tapfere Art, wie sie ihren leichtfertigen Gatten verteidigte, 117 wurde weithin geschätzt, aber als Qualifikation für das höchste Amt im Land war das doch ein wenig dürftig. Ihre Mitwirkung an den Kriegen in Ex-Jugoslawien scheint da schon eher »präsidentiell«. Während des Vorwahlkampfs der Demokraten 2008 erinnerte Hillary Clinton an ihre politischen Erfahrungen als First Lady, indem sie ihr Publikum wiederholt mit aufregenden Berichten von ihrer Reise in das bosnische Tuzla 1996 ergötzte: »Ich erinnere mich sehr gut an diese Reise nach Bosnien. Es gab eine Maxime im Weißen Haus, die besagte, dass der Präsident, wenn ein Ort zu klein, zu arm oder zu gefährlich war, nicht dorthin gehen konnte und dass man dann die First Lady schicken sollte. Ich erinnere mich, dass wir unter Scharfschützenfeuer landeten. Eigentlich sollte es am Flughafen eine Art Begrüßungszeremonie geben, aber stattdessen rannten wir mit eingezogenen Köpfen los, um in die Autos zu kommen, die uns zu unserem Stützpunkt bringen sollten.«9 Nachdem ihre Prahlereien ein wenig die Runde gemacht hatten, wurde ihre Geschichte von zahlreichen Augenzeugen des Ereignisses sowie von Fernsehberichten widerlegt, die zeigten, wie Hillary Clinton mit ihrer Tochter Chelsea in Tuzla ankam und wie beide von kleinen Kindern mit Blumen begrüßt werden. Von der Redaktion der Philadelphia Daily News während eines Interviews im März 2008 zu Rede gestellt, war Hillary Clinton gezwungen zuzugeben, dass es keine Scharfschützen gegeben hatte, versuchte aber, sich herauszureden: »Ich denke, das war ein kleiner Lapsus, wenn ich da so etwas gesagt habe; ich sage ja eine Menge – Millionen von Wörtern – am Tag. Wenn ich mich also versprochen habe, habe ich einfach einen Fehler gemacht.«10 Sie hatte also nie Scharfschützenfeuer ausweichen müssen, aber sie wusste, wie man peinlichen Fragen ausweicht. Die Tatsache, dass sie jeden Tag Millionen von Worten spricht, erlaubt ihr ihrer Meinung nach einen großzügigen Anteil von »Fehlern«, oder einfacher ausgedrückt: Lügen. Ihre Behauptung, sie habe vor Scharfschützen flüchten müssen, war nicht nur absolut falsch, sondern auch historisch absurd und moralisch fragwürdig. Die Feindseligkeiten in Bosnien waren mit dem am 21. November 1995 unterzeichneten Daytoner Friedensabkommen schon vier Monate vor ihrem Besuch endgültig eingestellt worden. Es war unmöglich, dass sie das nicht wusste. Tatsächlich war es so, dass der gemeinsame Besuch der First Lady und ihrer Tochter in Tuzla nichts 118 damit zu tun hatte, dass sie an einen Ort geschickt wurden, der für den Präsidenten »zu gefährlich« war. Vielmehr sollte er unterstreichen, dass das Weiße Haus trotz Wiederherstellung des Friedens sein Interesse an Bosnien nicht verloren hatte. Hillarys Sprecher Howard Wolfson fügte zu ihren »falschen Darstellungen« noch hinzu, sie sei ja dort »an der Frontlinie […] einer möglichen Kampfzone« gewesen. Abgesehen davon, dass es keine »Frontlinie« oder »Kampfzone« mehr geben konnte, da der Krieg vorbei war, war Tuzla keines von beidem je gewesen. Es war eine relativ neutrale Industriestadt, die wahrscheinlich darum als USMilitärstützpunkt gewählt worden war, weil sie in einer besonders sicheren Gegend lag. Lügen über Bosnien waren alles andere als ungewöhnlich, aber diese war besonders dumm und selbstverherrlichend. Hillary meinte offenbar, die dumpfen Massen würden eine Konfrontation mit echtem Gefechtsfeuer als zusätzliche Qualifikation als Oberbefehlshaberin der Streitkräfte betrachten. Die Episode zeigte außerdem ihre beharrliche Tendenz, militärische Konflikte als Anlass zu verstehen, persönliche Härte zu demonstrieren – und nicht als Anlass, ein kluges Verständnis politischer Komplexitäten zu entwickeln. Ihre Behauptung, sie habe wacker einem Scharfschützenfeuer widerstanden, ist nicht gar so verschieden von Sarah Palins Meinung, sie verstünde Russland, da sie es ja von Alaska aus sehen könne. Hillary Clintons dokumentierte Äußerungen über das frühere Jugoslawien enthüllten eine Tendenz zur Effekthascherei in außenpolitischen Fragen, die sich für ihre Amtszeit als Außenministerin als charakteristisch erweisen sollte. Der Holocaust als Vorwand In ihrer von enormer Bewunderung geprägten Biografie der First Lady11 stellte Gail Sheehy Hillarys aktiven Einsatz für die Bombardierung Jugoslawiens 1999 als einen wichtigen Pluspunkt für sie dar. Laut Sheehys Buch überzeugte Hillary ihren widerstrebenden Gatten, die 78 Tage währende NATO-Bombenkampagne gegen die Serben zu entfesseln, indem sie argumentierte: »Am Ende eines Jahrhunderts, das den Holocaust gesehen hat, kannst du diese ethnische Säuberung nicht weiterlaufen lassen.«12 Dieser angebliche Satz Hillarys ist reines Theater und ist für den 119 Konflikt auf dem Balkan völlig irrelevant. In Wirklichkeit gab es zu diesem Zeitpunkt im Kosovo gar keine »ethnische Säuberung«. Stattdessen war es das NATO-Bombardement, das bald zur Flucht zahlloser Menschen in alle Richtungen führte – eine Reaktion, die die Führer der NATO dann als genau die »ethnische Säuberung« interpretierten, die sie mit dem Bombardement angeblich verhindern wollten. Aber was Hillarys Bemerkung sehr wohl illustriert, ist die Tatsache, dass der Jugoslawienkonflikt den Beginn einer Phase markiert, in der die Bezugnahme auf den Holocaust zum emotional mächtigsten Argument zugunsten von Krieg wurde. Das war nicht immer so. Am Ende des Zweiten Weltkrieges zogen sowohl die Überlebenden der KZ, die so lange gelitten hatten, als auch jene, die die Schrecken der Lager nachträglich entdeckten, daraus den Schluss, dass dies noch ein weiterer zwingender Grund sei, nie wieder Krieg zu führen. Aber mit den Jahren und aufgrund der merkwürdigen Wirkungen des Zeitgeistes hat sich die Erinnerung an den Holocaust in das stärkste rhetorische Argument für Krieg verwandelt. Es ist eine Art imaginärer Revision der geschichtlichen Ereignisse, die sich einem Verständnis der Gegenwart in den Weg stellt. Hillarys Satz ist eine andere Art zu sagen: »Ich hätte in München >Nein< zu Hitler gesagt«, oder: »Ich hätte Auschwitz bombardiert.« Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist in den letzten Jahrzehnten so sehr von der Tragödie des Holocaust überschattet worden, dass führende Politiker des Westens am Ende imaginäre Wiederholungen von Dramen der Vergangenheit ausagieren könnten, statt sich den Realitäten der Gegenwart zu stellen. Der Konflikt im Kosovo war für US-Amerikaner so undurchsichtig, so unvertraut und so entstellt durch Täuschungen und Selbsttäuschungen,13 dass es am leichtesten war, ihn sich als Variante des Konfliktes vorzustellen, den jeder kannte oder zu kennen glaubte. Der moralische Mehrwert hierdurch schien enorm – besonders angesichts der geringen Kosten, da hier ja nicht mehr erforderlich war, als ohne nennenswertes Risiko für uns selbst ein Land ohne taugliche Luftabwehr zu bombardieren. Hier muss bemerkt werden, dass Hillary Bill am Telefon zur Bombardierung der Serben aufforderte, als sie gerade auf einer Reise in Nordafrika mit Stationen in Ägypten, Tunesien und Marokko war. Als Reiseführerin fungierte ihre neue Assistentin Huma Abedin, die bald zur Expertin ihres Vertrauens für die muslimische Welt wurde. Viele säkulare arabische Nationalisten sympathisierten aufgrund der guten historischen Beziehungen aus der Zeit der Bewegung der Blockfreien Staaten mit den Serben. Hillary Clinton dagegen war damals eine Novizin, die gerade 120 erst lernte, die Perspektive der Muslime zu schätzen – und in der islamischen Welt genossen die Muslime in Bosnien und im Kosovo eine breite und oft sogar fanatische Unterstützung. Es ist gut möglich, dass Huma Hillary versicherte, Muslime überall in der Welt würden der Clinton-Administration für die Bombardierung der Serben Beifall spenden. Aber es gibt gute Gründe zu bezweifeln, dass Hillarys moralisches Drängen der einzige Grund für das NATO-Bombardement dessen war, was 1999 noch von Ex-Jugoslawien übriggeblieben war.14 Denn es ist außerdem klar, dass einige US-Strategen die Gelegenheit nutzen wollten, die NATO unter humanitärem Vorwand in eine globale Polizeitruppe zu verwandeln. Zugleich besteht wenig Grund zu bezweifeln, dass Hillary ihren Mann tatsächlich zu diesem Bombardement ermutigte, und gar kein Grund zum Zweifel, dass sie sich gegenüber ihrer ehrfürchtigen Biografin damit gebrüstet hat, um ihre »Entschlossenheit« zum Einsatz der Macht der USA für »humanitäre« Missionen zu demonstrieren. Das passt zu ihrem selbstgewählten Image als »strenge und fürsorgliche« Frau. Verbrechen zahlt sich aus Worum ging es im Kosovo wirklich? Mit der Holocaust-Analogie sollen heutige ethnische Konflikte rein dualistisch gesehen werden, wobei man dann teuflische, Völkermord planende Rassisten auf der einen und absolut unschuldige Opfer auf der anderen Seite hat. Aber so sieht die Welt selten aus. In Wirklichkeit standen sich im Kosovokonflikt auf beiden Seiten Menschen mit konkreten Beweggründen und Fehlern gegenüber. Die Serben und Albaner im Kosovo waren sprachlich und im Brauchtum sehr verschieden, was eine Koexistenz schwierig machte. Die Serben sahen sich als »Staatenbauer« und strebten nach modernen Institutionen. Die Kosovo-Albaner hingen immer noch an ihren Clanstrukturen und ihrem mittelalterlichen Ehrenkodex und hatten wenig für die moderne Idee von »Recht und Ordnung« übrig. Prominente Vertreter beider Seiten waren zu einem Kompromiss bereit. Warum hat man sie nicht daran arbeiten lassen? Und mehr noch: Warum hat man ihnen nicht dabei geholfen? Sie kannten einander wenigstens und wussten, worum es ging. Aber wenn Außenstehende sich in einen Konflikt hineindrängen, verändern sie nicht nur die Kräfteverhältnisse, sondern auch den Konflikt selbst. Die USA pickten sich eine kleine, in kriminelle Aktivitäten 121 verstrickte Gruppe bewaffneter »Kosovaren« heraus, die sich selbst als »Befreiungsarmee des Kosovo« (UÇK) bezeichneten.15 Sie waren fortan für die USA »die Guten«, und so setzten diese eine Version der Ereignisse in Umlauf, die für ihre Schützlinge schmeichelhaft war. Das Ergebnis ist, dass die offizielle westliche Geschichte des Kosovokonflikts ein Lügengewebe ist.16 Nebenbei bemerkt war die Selbstbezeichnung als »Kosovaren« eine Public-Relations-Idee ethnisch-albanischer Separatisten, die den Anschein erwecken wollten, es gebe ein Land namens Kosovo, dessen Einwohner Kosovaren seien – und das implizierte, dass die Serben dort eigentlich nichts zu suchen hatten. Dabei kommt das Wort »Kosovo« von der serbischen Bezeichnung »kosovo polje«, die für »Amselfeld« steht, und darin ist »Kosovo« nichts weiter als »Amsel« im Genitiv. Die Region selbst ist historisch gesehen ein serbisches Kerngebiet, in dem die albanisch-sprechende Bevölkerung aufgrund der Einwanderung aus dem Nachbarland Albanien und der höchsten Geburtenrate Europas in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat. Die »Kosovaren« waren albanische Nationalisten, die die albanische Nationalflagge schwenkten und von ihren albanischen Landsleuten auf der anderen Seite der Grenze intensiv unterstützt wurden. Die Öffentlichkeit im Westen glaubte bereitwillig, der Kosovokrieg sei nicht nur eine humanitäre Rettungsaktion, sondern darüber hinaus auch ein großer Erfolg gewesen, weil er keine Opfer auf unserer Seite forderte. Damit war der erste geopolitische Zweck dieses kleinen Krieges erreicht: Er diente als Werbung für den Krieg selbst. Diese Operation bewies, dass eine starke, auf angebliche »Opfer eines potentiellen Völkermords« konzentrierte Propagandakampagne sich erfolgreich über das nach dem Zweiten Weltkrieg von den Vereinten Nationen etablierte System der Friedenssicherung hinwegsetzen konnte. Die NATO bombardierte einfach ohne Autorisierung des UNSicherheitsrats und in offener Verletzung des Völkerrechts. Und doch war der Einfluss ihrer führenden Mitglieder groß genug, um für die Schaffung eines Internationalen Gerichtshofs unter der Ägide der UN zu sorgen, dessen Hauptaufgabe die Strafverfolgung serbischer Angeklagter wegen Kriegsverbrechen war. So bestand der Haupterfolg des »Kosovokriegs« darin, die USA und die NATO über Recht und Gesetz zu stellen, und dies ist ein Zustand, der bis heute andauert. Der Bombenkrieg dauerte vom 24. März bis zum 10. Juni 1999, zerstörte einen Großteil der Industrie und Infrastruktur Jugoslawiens und tötete, verwundete und demoralisierte unzählige Zivilisten.17 122 Während des Bombardements beschuldigten Sprecher der beteiligten NATO-Mächte die Serben der Abschlachtung von Zehn- oder sogar Hunderttausenden von unschuldigen Kosovo-Albanern, und die westlichen Medien verbreiteten begierig falsche Geschichten von Massenvergewaltigungen und Massengräbern.18 Die deutsche Propaganda verbreitete einen Bericht über eine angebliche serbische »Operation Hufeisen«, die das Ziel verfolge, die gesamte albanische Bevölkerung aus dem Kosovo zu vertreiben. All das war reine Erfindung.19 Nach dem Krieg fanden internationale Ermittler keine Beweise für die angeblichen Gräuel. Aber negative Befunde wie »es gab keine Massaker« konnten nie die vorherigen Berichte über »Massaker mit Völkermordcharakter« wettmachen, wie sie während des Bombardements überall verbreitet worden waren. Kriegspropaganda macht ihren Eindruck zu einer Zeit, zu der das Publikum interessiert ist. Die Widerlegungen kommen erst, wenn das Interesse längst nachgelassen hat. Und so werden die alten Lügen bis zum heutigen Tag weiter verbreitet.20 Ungeachtet der Heftigkeit der Kämpfe zwischen den Serben, die ihr Land verteidigten, und den Separatisten der UÇK (die sowohl von den Luftschlägen der NATO als auch von Kräften unterstützt wurden, die über die Berge aus dem benachbarten Albanien ins Kosovo einsickerten) kamen Forscher zu dem Schluss, es habe unter Einbeziehung aller Seiten und aller Todesarten im Kosovo während des Krieges nicht mehr als zwischen zwei- und viertausend Tote gegeben.21 Vielleicht waren es mehr, aber jedenfalls nicht genug,22 um dem von der NATO unterstützen Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY)23 die Möglichkeit zu geben, den jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milošević wegen »Völkermordes« anzuklagen, wie das zunächst geplant war. Stattdessen klagte das Gericht ihn dann aufgrund von Verbrechen in Bosnien an, die er nicht nur nicht begangen hatte und nicht nur gar nicht begangen haben konnte, sondern die er vergeblich zu verhindern versucht hatte.24 Er starb, offenbar aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung, im März 2006 in einem niederländischen Gefängnis, noch bevor er seine Verteidigung abschließen konnte. Unterdessen wurden die von der UÇK während des Konflikts begangenen Verbrechen von den Medien und vom ICTY ignoriert. Und auch die Forderung nach Untersuchung der Verbrechen der NATO-Aggressoren wies das Gericht als unbegründet zurück. Jugoslawien hatte keine Luftabwehr, die in der Lage gewesen wäre, die Flut der NATO-Bomben und -Raketen abzuwehren. Dennoch war das 123 Bombardement, was einen Sieg über die serbische Armee oder auch nur ihre ernste Beeinträchtigung anging, ein totaler Fehlschlag. Diese blieb weitgehend intakt und war darauf vorbereitet, eine Bodenoffensive zurückzuschlagen. Doch der Einsatz von US- Bodentruppen in Serbien gegen gut ausgebildete serbische Soldaten, die ihr Heimatland verteidigten, hätte aufgrund der dann anfallenden US-Opfer den »Erfolg« getrübt. Dessen ungeachtet waren die schwere Beschädigung der zivilen Infrastruktur, Brücken, Fabriken und selbst der Schulen und Krankenhäuser Serbiens sowie die von internationalen Unterhändlern übermittelten NATO-Drohungen von totaler Zerstörung für Präsident Milošević Grund genug, einem Abzug der jugoslawischen Truppen aus dem Kosovo zuzustimmen und internationalen Truppen unter Führung der NATO zu erlauben, die Provinz zu besetzen. Die Bedingungen für diesen jugoslawischen Abzug wurden in einem am 9. Juni 1999 in der mazedonischen Stadt Kumanovo geschlossenen und später als UNSicherheitsratsresolution 1244 formalisierten Abkommen festgelegt. Dieses Abkommen gestattete es fremden, als »KFOR« (Kosovo-Truppen) bezeichneten Streitkräften, das Gebiet des Kosovo zu besetzen. Im Gegenzug gab das Abkommen Jugoslawien und Serbien gewisse Garantien, die USA und NATO allerdings später weitgehend ignorierten. Resolution 1244 legte fest, das Kosovo solle »weitgehende Selbstverwaltung« und »weitgehende Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien« genießen, wobei »die Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien« berücksichtigt werden sollten. Sie sah außerdem die Entwaffnung der UÇK vor. Das war an sich keine bedingungslose Kapitulation, die USA behandelten das Abkommen jedoch sofort als solche. Die serbischen Truppen zogen wie vorgesehen ab, aber die Bestimmung, die serbischen Truppen die Kontrolle über wichtige Grenzübergänge gab, wodurch sie die unkontrollierte Einreise von Albanern aus dem angrenzenden Albanien ins Kosovo hätten verhindern können, wurde nicht respektiert. Russische Truppen, deren Beteiligung an der Besetzung des Kosovo ursprünglich vorgesehen war, wurden marginalisiert und spielten bald keine Rolle mehr. Am 29. Juni 1999, zehn Tage nach dem Waffenstillstandsabkommen, berichtete Chris Hedges in der New York Times, die UÇK habe weiträumig die Kontrolle über das Kosovo übernommen: »In Abwesenheit einer starken internationalen Polizeipräsenz etabliert sie ein Netz selbsternannter Ministerien und örtlicher Räte, beschlagnahmt 124 Unternehmen und Wohnungen und treibt Steuern und Zölle ein.« Trotz eines Friedensabkommens, das eine von den Vereinten Nationen ernannte Verwaltung vorsehe, und trotz der Tatsache, dass die UÇK-Guerillas keinerlei rechtlichen Status hätten, hätten Letztere nun »vollendete Tatsachen geschaffen«.25 Der oberste UN-Verwalter für das Kosovo, der französische Anhänger humanitärer Interventionen Bernard Kouchner, fand nichts dabei und kommentierte: »So ist es nach Befreiungskriegen doch immer.«26 Statt, wie in Resolution 1244 vorgesehen, entmilitarisiert zu werden, wurde die UÇK schrittweise in eine Polizeitruppe und dann in eine mit der NATO verbündete Armee umgewandelt. Washingtons auserwählter Schützling Hashim Thaçi wurde so für eine lange Zeit an die Macht gehievt. Ibrahim Rugova, der Führer, den die KosovoAlbaner 1992 selbst gewählt hatten und der zu einem Kompromiss mit Milošević bereit gewesen war, wurde von der UÇK ins Abseits geschoben und starb 2006 an Lungenkrebs. Unmittelbar nach der Transferierung ihrer Besatzungstruppen in den Kosovo begannen die USA mit dem Bau einer über 400 Hektar großen US-Militärbasis namens Bondsteel auf gestohlenem Farmland. Nichts in irgendeinem internationalen Abkommen autorisierte die Errichtung dieses riesigen US-Stützpunkts, der aber dennoch bis heute existiert. Dann fand unter den Augen der NATO-Besatzer eine echte »ethnische Säuberung« von Nicht-Albanern statt, aber auch Albaner waren unter den Opfern der Machtübernahme Hashim Thaçis. Am 25. Juni 1999 berichtete ein Artikel auf der ersten Seite der New York Times unter dem Titel »Kosovo-Rebellen sollen eigene Leute hingerichtet haben«, hohe UÇKKommandeure hätten laut Mitgliedern der Rebellenarmee und westlichen Diplomaten »Morde, Verhaftungen und Säuberungen in den eigenen Reihen durchgeführt, um potentielle Rivalen zu erledigen«. »Die Kampagne, bei der bis zu einem halben Dutzend hohe Rebellenführer erschossen wurden, wurde von Ha-shim Thaçi und zwei seiner Stellvertreter, Azem Syla und Xhavit Ha-liti, geführt.«27 Nach seiner Machtübernahme ernannte Thaçi Syla zum Verteidigungsminister des Kosovo. »Thaçi war in den Jahren vor dem Aufstand von 1998 mit Haliti am Waffenschmuggel aus der Schweiz beteiligt«, hieß es in der New York Times weiter. »Thac.i, dessen Kampfname >Schlange< war, wird seit langem immer wieder mit Gewalt in Verbindung gebracht.« So sei der kosovo-albanische Journalist Ali Uka im Juni 1997 in seiner zuvor mit Thaçi geteilten Wohnung tot aufgefunden worden, wobei sein Gesicht 125 durch wiederholte Stiche mit einem Schraubenzieher und einer abgebrochenen Flasche entstellt gewesen sei.28 Ein berühmtes Foto vom 29. Juli 1999 zeigt Madeleine Albright, wie sie in Priština willkommen geheißen und dabei innig von keinem anderen als dem photogenen Hashim Thaçi umarmt wird. Hier Leute, das ist mein Baby.29 Am selben Tag spekulierte das Wall Street Journal: »In den kommenden Jahren besteht das Risiko, dass die Guerillas sich gegen die Nordatlantische Vertragsorganisation wenden, falls ihre Forderung nach einem unabhängigen Kosovo nicht erfüllt wird. Aber US-Vertreter sagen, ein freundlicher Umgang mit Thaçi sei eine Garantie gegen diese Gefahr.«30 In der Tat, aber das lag wohl eher daran, dass Thaçi sich sicher war, dass er seinen Willen auch bekommen würde, ohne gegen die NATO revoltieren zu müssen. Als im März 2004 ein Mob von Zehntausenden ethnischen Albanern gegen serbisch-orthodoxe Kirchen und Klöster wütete, war die westliche Reaktion im Wesentlichen Verständnis für den Vandalismus, den man der »Ungeduld« im Hinblick auf die volle Unabhängigkeit des Kosovo zuschrieb. Auf Resolution 1244 basierende Verhandlungen mit Belgrad über die Zukunft des Kosovo erwiesen sich als sinnlos, da die Albaner keinerlei Motiv hatten, auch nur das kleinste Zugeständnis zu machen, wussten sie doch, dass sie die volle Unterstützung der USA genossen. Als Hashim Thaçis UÇK-Regime im Februar 2008 einseitig und in völliger Missachtung der Bestimmung in Resolution 1244, »die Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität« müssten respektiert werden, die Unabhängigkeit des Kosovo ausrief, gaben die USA und die meisten (wenn auch nicht alle) Mitglieder der EU rasch ihre Zustimmung. Nur Spanien, die Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern weigerten sich, die Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen. Ein krimineller Staat Obwohl das Kosovo im Februar 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärte, war es weit von einer wirklichen Unabhängigkeit entfernt. Zum einen war ein Teil seines Territoriums in den US-Militärstützpunkt Camp Bondsteel verwandelt worden, und zum anderen war es immer noch von ausländischen KFOR-Truppen besetzt, die die verbliebenen serbischen 126 Enklaven beschützten. Auch die Verwaltung befand sich immer noch unter Aufsicht der UN-Mission im Kosovo (UNMIK).31 Denn sämtlichen Besatzungsinstitutionen war klar geworden, dass ein unentbehrliches Attribut eines souveränen Staates im Kosovo auf dramatische Art fehlte: nämlich ein Justizsystem, das in der Lage wäre, das Recht durchzusetzen. Als die Serben aus der Provinz abzogen, nahmen sie Recht und Ordnung mit. Das Haupthindernis für Recht und Ordnung im Kosovo wurde erstmals offensichtlich, als der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien versuchte, ein Verfahren gegen den berüchtigten UÇKClanführer Ramush Haradinaj wegen Mordes an seinen Gegnern zu führen. Noch während seiner Amtszeit als Ministerpräsident des Kosovo wurde Haradinaj im Februar 2005 in 37 Fällen wegen Gräueltaten an Serben und Albanern, die der Unterstützung der Serben verdächtigt wurden, angeklagt – darunter Mord, Folter und Vergewaltigung. Etliche Zeugen der Anklage verweigerten die Aussage und gaben als Grund ihre Angst vor Rache an. Haradinaj wurde im April 2008 freigesprochen, aufgrund der Berufung der Staatsanwaltschaft erneut angeklagt und im November 2012 in Ermangelung glaubwürdiger Zeugenaussagen ein zweites Mal freigesprochen. Wann immer ein hohes Mitglied der UÇK vor Gericht kam, verflüchtigten sich die Zeugen der Anklage – sie wurden ermordet, widerriefen, verschwanden oder »begingen Selbstmord«. Und jede Anklage gegen prominente UÇK-Fi-guren führte zu Straßendemonstrationen in Pristina, die sich darüber beschwerten, das Kosovo werde »verleumdet«.32 Das Haupthindernis für Recht und Ordnung im Kosovo lässt sich auf ein Wort reduzieren: Omertä. Die albanische Bevölkerung ist so diszipliniert oder so eingeschüchtert, dass eine Verurteilung ihrer kriminellen Clanführer praktisch unmöglich ist. Hinzu kommt, dass nach albanischem Brauch das Recht häufig noch als eine persönliche oder Familienangelegenheit und nicht als Sache öffentlicher Anklagen oder Gesetzesinstitutionen gesehen wird. Die Zusammenarbeit mit der Polizei nimmt dann vorzugsweise die Form der Bestechung an. All das spielte sich zu weit weg vom eigenen Heimatland ab, um USPolitiker zu stören, die bis heute immer noch völlig zufrieden mit ihren Schützlingen scheinen. Aber viele Europäer waren über die Aktivitäten dieses kriminellen Ministaates vor ihrer Haustür beunruhigt. Daher startete die Europäische Union am 9. Dezember 2008 ihre bis dahin ambitionierteste Ziviloperation im Ausland, die EU-Mission für Rechtsstaatlichkeit im Kosovo, die unter dem Namen EU-LEX bekannt 127 ist.33 An der Mission waren neben Mitgliedsstaaten der EU auch die USA, die Türkei, die Schweiz und Norwegen beteiligt. EULEX war kein großer Erfolg beschieden. Zwar kam es innerhalb von drei Jahren zu etwas mehr als zweihundert Verurteilungen wegen Straftaten wie etwa organisiertem Verbrechen, Frauen- und Drogenhandel oder Mord. Aber für eine Mission mit annähernd dreitausend Angestellten, die noch viele weitere Verbrechen aufzuklären gehabt hätte, wurde das doch als etwas enttäuschend betrachtet. Es gibt weiterhin Massendemonstrationen von Albanern gegen jede Anklage gegen einen der »ihren«34 und die Zeugen der Anklage verschwinden auch weiterhin. Statt die Korruption vor Ort beseitigt zu haben, werden Vertreter von EULEX nun ihrerseits beschuldigt, korrupt zu sein.35 Der größte Skandal, in den die UÇK-Führer des Kosovo involviert sind, hat mit dem illegalen Handel mit menschlichen Organen zu tun. Diese Beschuldigung wurde zwischen dem ICTY, dem Europarat und EULEX wie eine heiße Kartoffel hin- und hergeschoben. Sie wurde erstmals 2008 erhoben, als die ehemalige ICTY-Anklägerin Carla Del Ponte in Italien unter dem Titel Die Jagd ihre Memoiren veröffentlichte, in denen sie behauptete, die Untersuchung von UÇK-Verbrechen sei »im Keim erstickt« worden, weil die NATO im Krieg mit der UÇK zusammengearbeitet hatte. Insbesondere habe man sie an der Untersuchung des angeblichen Handels der UÇK mit menschlichen Organen gehindert, die von (dabei getöteten) Zivilgefangenen entnommen wurden. Zeugen hätten berichtet, die Gefangenen seien in einem »gelben Haus« jenseits der Grenze in Albanien gefangen gehalten und dort operiert worden.36 Von einem serbischen Journalisten nach dem »gelben Haus« befragt, brach der erste UNMIK-Chef, der Franzose Bernard Kouchner, in ein hohles Pseudo-Gelächter aus und erklärte dem Frager, er solle sich auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen.37 Doch am 25. Januar 2011 billigte der Europarat einen von dem Schweitzer Staatsanwalt Dick Marty verfassten Bericht der aus gewählten Vertretern aus 47 Ländern gebildeten Parlamentarischen Versammlung des Rats, in dem die Existenz »glaubwürdiger, konsistenter Hinweise« auf den illegalen Handel mit menschlichen Organen über mehr als ein Jahrzehnt hinweg bestätigt wurde. Zu den Opfern gehörten Albaner, die gegen die UÇK waren, und eine kleine Zahl serbischer Gefangener. Der Bericht war allerdings juristisch nicht bindend, und so erhob Marty die Forderung, den Fall vor ein ordentliches Gericht zu 128 bringen.38 Unterdessen hatte die Polizei einen aktiven Organhandelsring entdeckt, der im Medicus-Krankenhaus in Pristina tätig war. Am 15. Oktober 2010 klagte ein EULEX-Gericht mehrere Personen, darunter einen ehemaligen Gesundheitsminister der Regierung des Kosovo, wegen nicht-letaler Nierentransplantationen an. Angeblich war der Organhandel zugunsten von israelischen Patienten eingefädelt wor-den.39 Diesmal gab es Gerichtsverfahren, aber bezüglich der Organentnahme bei Gefangenen in Albanien am Ende des Kosovokriegs wurde nie etwas unternommen. EULEX reichte das heiße Eisen an John Clint Williamson weiter, einen US-Ankläger, der als Prozessanwalt beim ICTY und als Experte beim Verfahren gegen die Führer der Khmer Rouge in Kambodscha tätig gewesen war. Am 29. Juli 2014 stellte Williamson in Brüssel einen Zwischenbericht der Sonderuntersuchungskommission der EU vor, der Martys Beschuldigungen bestätigte. Williamson machte »hohe Vertreter« der UÇK für »ungesetzliche Tötungen, Entführungen, illegale Haftlager im Kosovo und in Albanien, sexuelle Gewalt, weitere Formen unmenschlicher Behandlung, die gewaltsame Vertreibung von Personen aus ihren Wohnungen und Gemeinden sowie die Entweihung und Zerstörung von Kirchen und anderen religiösen Stätten« verantwortlich. Williamson sagte, diese Verbrechen seien »organisiert durchgeführt und von bestimmten Personen ganz an der Spitze der UÇK-Führung sanktioniert worden« und hätten »mit Ausnahme einiger weniger Enklaven von Minderheiten zur ethnischen Säuberung großer Teile der serbischen und der Roma-Bevölkerung aus Gebieten des Kosovo südlich des Flusses Ibar geführt«.40 Aber Williamson sah kaum eine Chance, dass die Verantwortlichen für die tödlichen Organtransplantationen jemals belangt würden. »Fünfzehn Jahre nach den Vorfällen haben wir solide Informationen darüber, dass diese Dinge geschehen sind, aber keine physischen Beweise. Es gibt keine Leichen und keine Opfernamen«, so Williamson gegenüber The Guardian.41 Abgesehen von diesem Bericht im Guardian wurde diese Enthüllung von den Mainstreammedien fast völlig ignoriert. Die Informationen über ein so grässliches Verbrechen wie das, Gefangene aufzuschneiden, um ihnen ihre Organe zu entnehmen, kamen so vereinzelt und über so lange Zeit verteilt ans Licht, dass die Sache am Ende wohl unbemerkt untergehen wird. Zum Einfluss des Aspekts der »Zeugeneinschüchterung« hieß es in 129 Williamsons Bericht: »Es gibt wahrscheinlich keinen sonstigen Faktor, der eine größere Gefahr für die Herrschaft des Gesetzes im Kosovo und das Fortschreiten des Landes in eine europäische Zukunft darstellt, als diese beständige Praxis.« Im Juli 2011 interviewte Der Spiegel einen namentlich nicht genannten deutschen Polizisten, der mehr als zehn Jahre lang im Kosovo gearbeitet hatte und meinte, wegen der traditionellen Clan-Strukturen hätte die internationale Aufsicht »so gut wie nichts erreicht«. Niemand wage es, den Mund aufzumachen. »Klar ist nur, dass das Kosovo sich fest in der Hand des organisierten Verbrechens befindet«, sagte er. »Das ist ein Land, in dem jahrhundertealte Traditionen weiterleben, und die Blutrache ist hier Teil der Kultur. Wir Mitteleuropäer haben es nicht geschafft, die Kosovaren von den Vorteilen eines neuen Rechtsund Wertesystems zu überzeugen, wie wir es im Westen haben.«42 War das nicht vielleicht genau das Problem, das auch die Serben mit dem Kosovo gehabt hatten? Doch im Unterschied zu den Angehörigen der multinationalen EULEX sprach die serbische Polizei Albanisch, wusste etwas über die Albaner und war vermutlich besser in der Lage zur Verbrechensbekämpfung als Fremde aus dreißig verschiedenen Ländern, die sich auf albanische Dolmetscher verlassen müssen, die alle erst einmal von Machthabern auf ihre Tauglichkeit überprüft werden. Seit seiner Abspaltung von Serbien ist die wirtschaftliche Situation des Kosovo schlimmer denn je. Es ist ein verarmtes Hinterland, in dem viele Menschen bitter enttäuscht darüber sind, dass die »Unabhängigkeit« nicht das erwartete goldene Zeitalter gebracht hat. Ohne Arbeit, Ausbildung oder Sicherheit versuchen mehr und mehr Koso-varen verzweifelt, in EU-Länder auszuwandern. Sieben Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo unternehmen Ungarn, Österreich und Deutschland alles zur Beschleunigung ihrer Prozeduren zur Abweisung der wachsenden Flut falscher »Asylbewerber«, die aus dem Kosovo fliehen, um irgendeinen Lebensunterhalt zu finden. Dessen ungeachtet verfolgen einige albanische Nationalisten immer noch das Ziel, ein, wie sie sagen, »natürliches Albanien« zu schaffen, für das sie weitere Gebiete in Südserbien, einen Teil Montenegros, ein Stück von Griechenland und etwa die Hälfte der Fläche Mazedoniens beanspruchen. Zugleich wachsen die Ressentiments gegen die wankelmütigen Bemühungen der EU, dem Land von außen eine Rechtsordnung aufzuzwingen. Das Kosovo ist weder völlig unabhängig noch ein echter Staat; es steht immer noch unter ausländischer Besatzung, es hat keine funktionierende 130 eigene Justiz, die Wirtschaft basiert auf jeglicher Art von Verbrechen, und statt den Frieden in der Region zu sichern, hat die Errichtung dieses Ministaates den Hunger frustrierter albanischer Nationalisten auf weitere Gebiete in den Nachbarstaaten angeheizt. Gelder aus den arabischen Golfstaaten fördern den islamischen Extremismus, und die noch verbleibenden serbischen Klöster bleiben weiterhin bedroht, obwohl sie von den UN zum historischen Erbe erklärt worden sind.43 Das Kosovo ist ein kleiner Kessel, der aber immer noch am Kochen ist. Das Kosovo-Experiment Während der Clinton-Präsidentschaft von 1993 bis 2001 wurde Jugoslawien vom außenpolitischen Establishment der USA als Versuchslabor benutzt, um Techniken der Kontrolle, der Subversion und des Regimewandels zu testen, die später auch anderswo angewendet werden sollten. Die Betrachtung Jugoslawiens als eine Miniaturversion der UdSSR mit Serbien in der Rolle Russlands (wobei erst Jugoslawien und dann, durch die Abtrennung des Kosovo, Serbien selbst zerstückelt wurden) war ein Probelauf für den Prozess, der später in der Ukraine in Gang gesetzt wurde und Russland als Zielscheibe hatte. Dabei sind immer wieder dieselben Techniken erkennbar: Hitlerisierung. Die Aggression beginnt als Propagandakrieg, der von Mainstreammedien mit geschmeidigen Verbindungen zu hohen politischen Entscheidungsträgern und Denkfabriken geführt wird. In der ersten Phase verschwindet das betroffene Land fast hinter dem Schatten seines Führers, der (selbst wenn er in fairen Wahlen gewählt wurde) als »Diktator« bezeichnet wird, aber nunmehr als Verkörperung alles Bösen der Welt porträtiert wird und daher »gehen muss«. Dabei wurde bisher so unterschiedlichen Leuten wie Slobodan Milošević, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Baschar al-Assad und nun Wladimir Putin die Rolle des neuen Hitler zugewiesen. Sanktionen. Wirtschaftssanktionen gegen diesen »Diktator« dienen der Stigmatisierung des Bösewichts, der Destabilisierung der Beziehungen und der Rekrutierung von Verbündeten, die noch Skrupel haben, zu militärischen Mitteln zu greifen, die aber bereit sind, diese vorgeblich »friedliche« Methode zu unterstützen, um den »Bösen« zur Umkehr zu bewegen. Wenn die Sanktionen nicht wirken, ist die öffentliche Meinung präpariert, nun auch den Einsatz militärischer Mittel als »notwendig« in 131 Betracht zu ziehen. Klienten vor Ort. Die USA haben eine langjährige Erfahrung darin, die schlimmsten Kräfte im Zielstaat ihrer Maßnahmen zu unterstützen; Kräfte, die vor nichts zurückschrecken. In Serbien liehen die USA rücksichtslosen Kriminellen ihre politische und militärische Unterstützung. In vielen muslimischen Ländern haben die USA islamische Fanatiker unterstützt und bewaffnet. In der Ukraine stützt sich die Kampagne gegen »russische Vorherrschaft« auf offen nazistische Milizen, die dort Straßenterror ausüben.44 Menschenrechts-NGOs. Nichtregierungsorganisationen, die in Wirklichkeit oft (etwa in Gestalt des National Endowment for Democracy und seiner Filialen) enge Verbindungen zur US-Regierung unterhalten oder sogar von ihr finanziert werden, spielen eine zentrale Rolle, indem sie behaupten, die wahre Demokratie zu repräsentieren, die vom neuen »Hitler« angeblich stranguliert wird, wann immer die Polizei gegen von den »echten Demokraten« provozierte Unruhen einschreitet. Die von dem US-Politikwissenschaftler Gene Sharp aus den Erfahrungen von Befreiungsbewegungen destillierten Szenarien werden dazu genutzt, um durch die Provokation von Repressionen Sympathien zu gewinnen. Doch außer der Gegnerschaft zu den jeweils Herrschenden gibt es kein Programm. Die Agitation der von US-Spezialisten in Budapest ausgebildeten serbischen Jugendgruppe »Otpor« war das Modell, das von den späteren »Farbenrevolutionen« übernommen wurde. Sabotage von Diplomatie. Um den Kosovokrieg vorzubereiten, dirigierte US-Außenministerin Madeleine Albright im Schloss Rambouillet in der Nähe von Paris nie ernst gemeinte Verhandlungen zwischen der jugoslawischen Regierung und albanischen Nationalisten. Dabei sprachen die Delegationen nie direkt miteinander. Professor Ibrahim Rugova wurde als Führer der albanischen Delegation durch Albrights kriminellen Busenfreund Hashim Thaçi ersetzt und die Serben wurden vor ein Ultimatum (die totale militärische Besetzung Serbiens) gestellt, das sie unmöglich akzeptieren konnten. Letzteres trug ihnen die Beschuldigung ein, sie »weigerten sich zu verhandeln«. Bei den Vereinten Nationen ist es üblich geworden, dass US-Vertreter durch Moraltiraden, Beleidigungen und Lügen Verhandlungen sabotieren. Kriminalisierung. Im Konflikt um Jugoslawien ermöglichte es ihr enormer Einfluss den USA, internationale Gerichtsverfahren zu nutzen, um ihre Feinde statt als politische Gegner als gewöhnliche Verbrecher zu behandeln. Das Konzept der »gemeinschaftlichen kriminellen Unternehmung«, das im US-Strafrecht gegen Mafiabanden verwendet 132 wird,45 wurde in den aus dem Nichts hervorgezauberten Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien eingeschleust und auf die angeklagten Serben angewendet – mit der Konsequenz, dass schon die bloße Verteidigung der serbischen Interessen im Kontext des Auseinanderbrechens des ehemaligen Jugoslawien als Verbrechen gilt. Danach gelang es den USA, den Internationalen Strafgerichtshof, dem sie selbst gar nicht angehören,46 dazu zu bringen, US-»Feinde« wie Muammar Gaddafi auf der Basis völlig unbewiesener Beschuldigungen anzuklagen. Diese Praxis trägt dazu bei, Friedensverhandlungen unmöglich zu machen, da sofort gesagt wird, Verhandlungen mit einem angeklagten Verbrecher seien unmöglich. Angstwort »Völkermord«. Wann immer die USA in einem ethischen oder politischen Konflikt irgendwo Partei ergreifen, wird die gegnerische Partei fast schon gewohnheitsmäßig der Planung eines »Genozids« bezichtigt.47 Damit ist die Sichtweise ausgeschlossen, dass beide Parteien für spezifische territoriale oder politische Ziele kämpfen könnten, über die, sobald sie einmal verstanden sind, verhandelt werden könnte. Bombardierung. Das ist das letzte Argument, das Damoklesschwert, das über jeder Streitigkeit hängt. Medien und Propaganda. Der Schlüssel zu diesem gesamten Aggressionssystem ist die Tatsache, dass die USA eine gewaltige Propagandamaschine zur Verfügung haben, deren Zentrum die Mainstreammedien sind. Dabei liefert die Unterhaltungsindustrie den Hintergrund, besonders Hollywood, wo die Anwendung von Gewalt zur Vernichtung des Feindes wieder und wieder verherrlicht wird. Auch Videospiele sind ein mächtiger neuer Faktor für die Normalisierung von Mordinstinkten. In der für die US-Bürger vorverpackten visuellen Fantasie endloser Kämpfe zwischen Gut und Böse gehen Fakt und Fiktion nahtlos ineinander über. Für das Pentagon, die NATO, die CIA, das NED, die Mainstreammedien und das außenpolitische Establishment der USA war der Kosovokrieg eine hervorragende Lernerfahrung, ein Übungsfeld, eine Vorbereitung auf künftige Abenteuer. Er war der Krieg, um neue Kriege zu beginnen. Für die Clintons war der Kosovokrieg eine willkommene Ablenkung von ihren Skandalen und die Gelegenheit, eine Rolle auf der großen Bühne der Weltpolitik zu spielen. Bill Clinton wird im Kosovo als Gründervater dieses kleinen, Serbien abgerungenen US-Protektorats verehrt. So winkt nun eine drei Meter große vergoldete Statue des 133 Wohltäters aus Arkansas den Bill-Clinton-Boulevard hinunter,48 und ganz in der Nähe befindet sich eine Boutique namens »Hillary«. Während die USA wegen ihrer militärischen Interventionen und ihrer ständigen Ausübung von Druck weltweit zunehmend gehasst werden, hat diese Intervention eine Enklave fanatischer US-Anhänger geschaffen. Bei ihrem Besuch in Priština 2010 konnte sich Außenministerin Hillary Clinton in einem Meer der Anbetung baden.49 Es spricht Bände über den Niedergang der USA in den Augen der Welt, dass das Kosovo und Albanien heute die proamerikanischsten Orte der Welt sind. Es ist nichts, worauf die USA stolz sein sollten. 134 5 Libyen: Hillarys eigener Krieg Während sich 2014 im Nahen Osten und in der Ukraine wachsendes Chaos ausbreitete, charakterisierte ein sichtlich desorientierter Präsident Obama seine vorsichtige Außenpolitik mit folgender Maxime: »Keine Dummheiten machen.«1 In einem Interview mit Jeffrey Goldberg in The Atlantik griff Hillary Clinton die Formulierung auf, um zu zeigen, dass sie aus härterem präsidentiellem Holz gemacht war: »Große Nationen brauchen organisierende Prinzipien, und >Keine Dummheiten machen< ist kein solches Prinzip.«2 Sie erklärte allerdings nicht, was ihre organisierenden Prinzipien als Präsidentin sein würden. Aber bis jetzt ist eines ihrer Lieblingsprinzipien das »Recht« beziehungsweise die »Verantwortung« zum Schutz gewesen, das im Englischen durch das griffige Kürzel »R2P«3 bezeichnet wird. In der Realität hat sich dieses Prinzip als ein desorganisierendes Prinzip erwiesen, das in der angeblich zu »schützenden« Region zur Zerstörung jeglicher Ordnung eingesetzt wurde. Nach dem Kosovokrieg hat Washington sich intensiv für R2P als neues UN-Prinzip stark gemacht, auf das man sich in jeder künftigen, der Kosovokrise ähnlichen Lage berufen kann, um eine perfekte Rechtfertigung dafür zu haben, das Prinzip der nationalen Souveränität zu unterminieren. R2P war auch das Prinzip hinter Hillarys ureigenem Krieg, nämlich dem Angriff auf Libyen 2011, der sich dann als eine der größten »Dummheiten« erwies, die je einem wehrlosen Land angetan wurden. Vorwand für diesen Krieg war eine Reihe großer Protestdemonstrationen, die am 18. Dezember 2010 in Tunesien begannen und von den Medien »Arabischer Frühling« getauft wurden. Diese Bezeichnung erwies sich als zu optimistisch, suggerierte sie doch, die gesamte Region schreite nun zu lichten, glücklichen und natürlich – im westlichen Sinn – demokratischen Zuständen voran. Die meisten Führer, die zu Zielen der Proteste des Arabischen Frühlings wurden, waren langjährige »Freunde« des Westens und US135 Schützlinge. Das war für Washington, Paris und London peinlich. Aber es gab eine bemerkenswerte Ausnahme. Im Februar 2011 demonstrierten in der ostlibyschen Stadt Bengasi zahlreiche Menschen gegen den Führer Libyens, Muammar Gaddafi. Heureka! Hier war die Gelegenheit, R2P gegen einen Mann zu praktizieren, der seit seiner Machtübernahme mehr als vierzig Jahre zuvor im Westen extrem verhasst war. Oberst Gaddafi betrat 1969 in einer revolutionären Zeit als aufrichtiger Revolutionär die Bühne. Er war Beduine und in einem Land Armeeoffizier geworden, das gerade erst zu existieren anfing. Einst wichtiger Kornlieferant für das römische Reich, wurde diese Region, die als erste den Namen »Afrika« trug, danach für weit über tausend Jahre zu einem rückständigen Hinterland, das aus Sand, arabisierten Berberstämmen, ein paar Städten und den beeindruckenden Ruinen einer reichen Vergangenheit bestand. Nach mehreren Jahrhunderten unter der Herrschaft des Osmanischen Reichs wurde das Gebiet Anfang des 20. Jahrhunderts von Italien erobert und in Cyrenaica im Osten und Tripolitanien im Westen aufgeteilt. 1934 gab Italien der Kolonie den offiziellen Namen Libyen. Mit seiner Niederlage im Zweiten Weltkrieg verlor Italien seine Kolonien, und 1951 erkannten die Vereinten Nationen den von Großbritannien unterstützten Emir von Cyrenaica, Idris al-Mahdi as-Senussi, der den bewaffneten Widerstand gegen Italien angeführt hatte, als König Idris I. von Libyen an. Die USA übernahmen den italienischen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Tripolis und benannten ihn in Wheelus Air Base um. 1959 wurden große Ölvorkommen entdeckt. König Idris folgte der üblichen Praxis arabischer Herrscher, den Ölreichtum für sich und seine Entourage zu behalten. Als junger Offizier, der vom arabischen Nationalismus des ägyptischen Präsidenten Nasser inspiriert war, führte Muammar Gaddafi 1969 einen unblutigen Putsch gegen König Idris an. Die USA mussten ihren Luftwaffenstützpunkt aufgegeben. Gaddafi baute dann ein originelles System namens »Libysch-Arabische Dschamahirija« auf, das aus einer Mischung von maßvollen muslimischen Moralvorstellungen, wohlfahrtsstaatlichem Sozialismus, direkter Demokratie und lokalen Bräuchen bestand. Die gegenüber König Idris und seinem traditionellen Islam loyale Opposition wurde unterdrückt; gleichzeitig wurden große Fortschritte in der Bildung, der Frauenemanzipation und im sozialstaatlichen Bereich gemacht. Ein »Allgemeiner Volkskongress« bestimmte die Regierung, während Gaddafi seine Macht als eine Art geistiger Wegweiser ausübte.4 136 In seiner Frühphase gab Gaddafi Revolutionären in anderen Ländern, wie der Palästinensischen Befreiungsorganisation, der IrischRepublikanischen Armee, dem Afrikanischen Nationalkongress und der POLISARIO-Front in der Westsahara generöse Unterstützung. Diese Großzügigkeit trug ihm die bleibende Dankbarkeit Nelson Mandelas, aber auch eine lange Liste unversöhnlicher Feinde ein. Nachdem viele seiner revolutionären Schützlinge mit ihren Feinden Frieden geschlossen hatten, fühlte sich der Führer Libyens offenbar im Stich gelassen und stellte diese Art von Unterstützung ein, um nun seinerseits zu versuchen, seinen Frieden mit dem Westen zu machen. Mit dem Verblassen des von Nasser inspirierten Traums von der arabischen Einheit wendete sich Gaddafi von der arabischen Welt ab, die er als heuchlerisch, korrupt und verräterisch verdammte. So lenkte er seine großzügigen Bestrebungen auf die antiimperialistische Einheit Afrikas um. Er definierte Libyen nun statt als arabisches als afrikanisches Land und finanzierte große Projekte, um zur Entwicklung des Kontinents beizutragen und ihm größere finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.5 Am denkwürdigen Datum des 9. September 1999 versammelten sich die Führer Afrikas in der mittellibyschen Küstenstadt Sirte, dem Heimatort Gaddafis, um die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) formell durch die Afrikanische Union (AU) zu ersetzen. Die bei diesem Anlass verabschiedete »Sirte-Deklaration« berief sich ausdrücklich auf Oberst Gaddafis Vision »eines starken und vereinten Afrikas, das imstande ist, sich den globalen Herausforderungen zu stellen und seiner Pflicht zu entsprechen, die menschlichen und natürlichen Ressourcen des Kontinents zu nutzen, um die Lebensbedingungen seiner Völker zu verbessern«.6 Im Februar 2009 wurde Gaddafi in Äthiopien zum Vorsitzenden der aus 53 Nationen bestehenden Afrikanischen Union gewählt und versprach, er werde »auch weiterhin darauf bestehen, dass unsere souveränen Nationen auf die Entstehung der Vereinigten Staaten von Afrika hinarbeiten«7. Seine Vision dabei war »eine einheitliche afrikanische Streitkraft, eine einzige Währung und ein einziger Pass für alle Afrikaner, damit sie sich frei auf dem Kontinent bewegen können«8. Während Gaddafis Herrschaft wurde die alte Fischerstadt Sirte stark modernisiert und verschönert, um vielleicht einmal als Hauptstadt eines Vereinten Afrikas dienen zu können. Am Ende des NATOKriegs zur »Rettung Bengasis« lag Sirte in Ruinen. Gaddafis Ruf im Westen war so schlecht, dass man ihm leicht jedes 137 ungelöste Verbrechen in die Schuhe schieben konnte. Typisches Beispiel hierfür ist der Bombenanschlag, der am 21. Dezember 1988 den PanAmFlug 103 über dem schottischen Ort Lockerbie zum Absturz brachte und damit 270 Menschen tötete. Ursprüngliche – und weiterbestehende – Verdachtsmomente ordneten den Anschlag einer Terrorgruppe zu, die der Iran angeworben hatte, um den Abschuss eines iranischen Zivilflugzeugs über dem Persischen Golf durch einen Kreuzer der US-Marine am 3. Juli 1988 zu rächen.9 Danach hatten die USA sich für dieses Vorgehen gegen einen regulären Linienflug der Iran Air von Teheran nach Dubai, bei dem 290 Zivilisten getötet wurden, nicht einmal entschuldigt. Gaddafi des Terrorakts von Lockerbie zu bezichtigen, weil »er genau diese Art von Taten begeht«, war für Washington zweifellos weniger prekär, als die Aufmerksamkeit auf einen möglichen Racheakt des Iran zu lenken. Die USA beschuldigten zwei Libyer, eine Zeitbombe in einem Koffer versteckt zu haben, der in Malta an Bord eines Flugs gegangen und dann nach zweimaligem Umladen in Frankfurt und London über Schottland explodiert sei. In der Hoffnung, den Westen zur Aufhebung der Sanktionen zu bewegen, mit denen Libyen für Lockerbie bestraft worden war, willigte Gaddafi schließlich ein, die beiden angeklagten Libyer vor ein schottisches Sondergericht stellen zu lassen, das in den Niederlanden tagte. Die USA übten heftigen Druck zugunsten eines Schuldspruchs aus; am Ende wurde einer der Angeklagten für schuldig befunden, während der andere freigesprochen wurde. Nach dem Verfahren kamen Beweise ans Licht, dass das Fragment eines in der Schweiz hergestellten Zeitzünders, das angeblich an der Absturzstelle gefunden und als einer der Hauptbeweise gegen die Libyer verwendet worden war, da es an Libyen gelieferten Zeitzündern täuschend ähnlich sah, unmöglich aus dieser Lieferung stammen konnte, da es eine komplett andere metallurgische Zusammensetzung aufwies. Das ist kaum anders zu erklären als daraus, dass dieses angebliche Fundstück den Angeklagten bewusst untergeschoben wurde.10 Als ich die Anwälte des verurteilten Libyers 2007 in Tripoli interviewte, waren sie der Meinung, die Beweise für eine Falschanklage seien so zwingend, dass die damals schwebende Berufung mit einem Freispruch enden müsse. Aber der Verurteilte, Abdel Baset al-Megrahi, litt bereits unter Krebs und wurde überredet, seine Berufung fallenzulassen, um vorzeitig entlassen zu werden und in seiner Heimat und im Kreis seiner Familie sterben zu können. So musste sich das Berufungsgericht nicht mit den Beweisen dafür auseinandersetzen, dass die USA den Libyern das Verbrechen vorsätzlich in die Schuhe geschoben hatten.11 138 Während er weiter auf der Unschuld Libyens bestand, zahlte Gaddafi Entschädigungen an die Angehörigen der Lockerbie-Opfer, verzichtete demonstrativ auf seine »Massenvernichtungswaffen« (die es möglicherweise nie gegeben hatte) und tat auf jede Weise sein Bestes, um seinen schlechten Ruf loszuwerden und die Beziehungen des Landes mit dem Westen zu normalisieren. Diese Zugeständnisse wurden größtenteils gemacht, um dem Wunsch vieler Angehöriger der libyschen Elite entgegenzukommen, in einem »normalen« Land zu leben. Gaddafis politisch ambitioniertester Sohn, Saif al-Islam al-Gaddafi, studierte in London und setzte sich für Verwestlichung und demokratische Reformen ein, was auch die natürliche Richtung der Evolution des Landes anzuzeigen schien.12 Bis 2011 hatte Gaddafi immer wieder versucht, mit seinen Feinden Frieden zu schließen, und so konnte der Westen ihn eigentlich unmöglich länger als Bedrohung betrachten. Er machte Geschäfte mit den USA und Europa und empfing hochrangige Besucher von dort. Er hatte sogar heimlich Geld für den Wahlkampf des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy gespendet, vielleicht um diesen dazu zu bringen, bei der Entschärfung der »Affäre um die bulgarischen Krankenschwestern« zu helfen – des letzten Skandals, der immer noch Libyens Ruf im Westen belastete. Fünf bulgarische Krankenschwestern und ein palästinensischer Arzt waren wegen der Vergiftung von über vierhundert Kindern im El-FatihKinderkrankenhaus in Bengasi, bei denen eine Infektion mit HIV festgestellt wurde, zum Tod verurteilt worden. Diese rätselhafte Epidemie wurde 1999 entdeckt und führte verständlicherweise zu einem öffentlichen Aufschrei und der Forderung, die Verantwortlichen zu finden und zu bestrafen. Der Verdacht fiel bald auf einige Krankenschwestern, die von der staatlichen bulgarischen Firma Expomed für die Arbeit in Bengasi angeworben worden waren, wo sie bessere Löhne erhielten als in Bulgarien. Am Ende wurden sie verhaftet und verurteilt. In Europa ging man wie selbstverständlich davon aus, die Anklagen seien falsch und erfunden und das Ganze stelle nur eine weitere kriminelle Tat Muammar Gaddafis dar. Dementsprechend überrascht war ich, als ich 2007 während eines Aufenthalts in Tripolis, wo ich an einer Konferenz zum Internationalen Strafgerichtshof teilnahm, erfuhr, dass sogar prowestliche und Gaddafi-kritische Juristen die bulgarischen Krankenschwestern für schuldig hielten. Diese Meinung basierte offenbar vor allem auf der Analogie zu anderen Fällen, die im Westen kaum bekannt sind und bei denen US-Amerikaner oder Europäer arglose 139 Afrikaner in medizinischen Experimenten als Versuchskaninchen benutzt hatten.13 Die libysche Öffentlichkeit war fest von der Schuld der Krankenschwestern überzeugt. Daher war es politisch schwierig, sie freiund zurück in ihre Heimat zu lassen, wie es die Regierungen Europas forderten. Aber Saif al-Islam, der den Prozess gegen die Krankenschwestern öffentlich kritisiert hatte, wollte deren Leidensweg offensichtlich ein Ende setzen, um die Aufnahme Libyens in den Kreis des Westens zu beschleunigen. Das Problem war, dies zu tun, ohne die öffentliche Meinung in Libyen gegen sich aufzubringen. Die Lösung war ein Szenario unter Beteiligung des französischen Präsidenten Sarkozy und besonders seiner Noch-Frau Cecilia, die im Juli 2007 eine breit publizierte Reise nach Libyen machte, um die Krankenschwestern vor dem Diktator zu »retten«. Das Schauspiel war begleitet von einer Zahlung von neuneinhalb Millionen Euro durch die Europäische Union, um »die Bedingungen im Krankenhaus in Bengasi zu verbessern«. Danach besuchte Gaddafi Paris, wo er seine Gastgeber stark verdross, indem er in seinem Beduinenzelt auf dem Rasen des Präsidentenpalastes kampierte. So wollte er der Bevölkerung in Libyen zu verstehen geben, dass ihr Wegweiser nun in Europa wohlgelitten war. Muammar Gaddafi war kein aktiver »Dämon« mehr, wurde aber immer noch als äußerst exzentrisch betrachtet. Der »Arabische Frühling« in Libyen Dann kam der Arabische Frühling. In Bengasi, dem Zentrum der traditionellen Unterstützung für König Idris und für islamische Radikale, hatte die Opposition gegen Gaddafi tiefe Wurzeln. So, wie Gaddafi in seiner Heimatstadt Sirte verehrt wurde, war er in Bengasi verhasst. Die Anti-Gaddafi-Aktivisten nahmen sich die Geschehnisse in Tunesien und Ägypten zum Vorbild und veranstalteten am 17. Februar 2011 ihren eigenen »Tag des Zorns«. Der Tag wurde zur Erinnerung an vierzehn Menschen gewählt, die am 17. Februar 2006 bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten, die gegen respektlose Karikaturen des Propheten Mohammed protestiert hatten, getötet worden waren. Unruhen breiteten sich aus, ebenso wie extrem übertriebene oder völlig falsche Berichte über die Ereignisse. 140 Libyen, das den höchsten Lebensstandard auf dem afrikanischen Kontinent genoss, litt weder unter den schweren ökonomischen Problemen, die einen jungen Tunesier zu der Selbstverbrennung getrieben hatten, die zum »Arabischen Frühling« führte, noch unter der Massenarmut Ägyptens. Die Revolte in Bengasi hatte politische und religiöse Motive, die nicht neu waren. Während die Krise eskalierte, wurden Gaddafis Erklärungen, er kämpfe in Bengasi gegen den islamischen Extremismus, darunter auch alQaida, im Westen als weit hergeholt abgetan. Doch Libyen war am 15. April 1998 die erste Regierung gewesen, die Osama bin Laden (wegen der Ermordung eines deutschen Spitzenexperten für die arabische Welt und dessen Frau in Sirte im Jahr 1994) bei Interpol angezeigt hatte.14 Gaddafi führte, was die Zukunft Libyens und Afrikas anging, seit langem einen harten Kampf gegen islamische Extremisten. Seine Strafanzeige bei Interpol wurde jedoch ignoriert. In diesem wie in anderen Fällen stellten sich die Mächte des Westens de facto mehr oder weniger auf die Seite der islamischen Extremisten. Der medienbewusste französische Agitator Bernard-Henri Levy eilte sofort nach Bengasi, um für die »Revolution« zu werben, und brachte einen hohen libyschen Beamten, Mahmud Dschibril, mit nach Paris, um den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy von der Notwendigkeit zu überzeugen, in Libyen Krieg zu führen. Dschibril war in der libyschen Regierung mit den Bereichen Privatisierung und wirtschaftliche Liberalisierung beauftragt, bevor er überlief und zu einem der Führer des Nationalen Übergangsrats wurde, der dann die chaotische Situation in Bengasi nutzte, um sich zur neuen legitimen Regierung Libyens zu erklären. Mit einem Doktortitel der University of Pittsburgh in politischer Wissenschaft konnte Dschibril im Westen als Führer einer »demokratischen Revolution« präsentiert werden. Der proisraelische Publizist Bernard-Henri Lévy brüstete sich offen damit, »als Jude« in die Angelegenheiten Libyens eingegriffen zu haben, und erweckte so den Eindruck, er sei der Meinung, Gaddafis Sturz werde gut für Israel sein. Vor laufenden Fernsehkameras bestritt der in Frankreich unter dem Kürzel BHL bekannte Lévy verächtlich alle Berichte, nach denen es unter den Protestierenden in Bengasi Islamisten gab. Er sei dort gewesen, sagte er, und bestand darauf, es gebe dort keine Islamisten, sondern nur Bürger, die sich nach westlicher Demokratie sehnen.15 Keine Islamisten? Am 22. Februar 2011 sprach der Führer der libyschen Muslimbruderschaft Scheich Yusuf al Qaradawi eine Fatwa aus, mit der er zur Ermordung Gaddafis durch dessen Soldaten aufrief. 141 »Wer immer in der libyschen Armee in der Lage ist, eine Kugel auf Gaddafi abzufeuern, sollte das tun«, sagte er gegenüber dem Fernsehsender Al-Dschasira.16 Die USA hatten Gaddafis Öffnung gegenüber dem Westen genutzt, um Beziehungen zu hochrangigen Funktionären wie Mustafa Abd al-Dschalil zu kultivieren, der als Justizminister zweimal die Todesurteile gegen die bulgarischen Krankenschwestern bestätigt hatte, aber nun als Vorsitzender des Nationalen Übergangsrats dennoch rasch die Unterstützung des Westens gewann. Das Überlaufen hochrangiger Mitglieder des GaddafiRegimes wie Dschalil und Dschibril erweckte den Eindruck, die Unruhen in Bengasi könnten von einer organisierten prowestlichen Fraktion genutzt werden, um mit nur ein wenig militärischer Hilfe ihrer USamerikanischen und europäischen Freunde eine recht reibungslose Palastrevolution durchzuführen. Die Realität war nicht so einfach. Sowie der Aufstand gegen Gaddafi in Bengasi als Menschenrechtsfrage und als Versuch klassifiziert wurde, einen Diktator zu stoppen, »der sein eigenes Volk tötet«, wurden die politischen Konflikte im Inneren Libyens unsichtbar. Gaddafis Befehle, die Rebellen müssten ihre Waffen niederlegen, wurden falsch als Drohung übersetzt, die ganze Bevölkerung Bengasis auszurotten, und als Anzeichen eines bevorstehenden Völkermords denunziert. In Wirklichkeit hatte Gaddafi allen Rebellen, die ihre Waffen niederlegten, eine Amnestie und die Möglichkeit angeboten, sich nach Ägypten zurückzuziehen.17 Wesentlich später erklärte Amnesty International, bei den Kämpfen mit bewaffneten Rebellen in Bengasi seien auf allen Seiten nicht mehr als einhundertzehn Menschen getötet worden – also wesentlich weniger etwa als bei den Protesten in Kairo. Doch zur fraglichen Zeit selbst basierte die vorherrschende Version der Ereignisse auf den emotionalen Behauptungen, die der Generalsekretär der Libyan League for Human Rights (LLHR)18, Dr. Sliman Bouchuiguir, während einer Versammlung prowestlicher NGOs am 21. Februar in Genf gemacht hatte. Danach wurde ein Brief, der die völlig unbewiesenen Behauptungen Bouchuiguirs, eines Experten für Ölpolitik mit engen US-Kontakten, als »Fakten« bezeichnete, von siebzig NGOs unterzeichnet und an USPräsident Obama, an die außenpolitische Hochkommissarin der EU Catherine Ashton und an UN-Generalsekretär Ban Ki-moon geschickt, um sie zu einem Vorgehen gegen Libyen aufzufordern. Der Brief rief die UN und die »internationale Gemeinschaft« dazu auf, »sofort zu handeln, um die massenhaften Gräuel zu beenden, die die libysche Regierung derzeit gegen ihr eigenes Volk begeht«. Ohne Beweise 142 zu verlangen, stellten sich die NGOs hinter die von Dr. Bouchuiguir gelieferten Behauptungen »nicht genannter Zeugen«, laut denen »eine Mischung von Spezialkommandos, fremden Söldnern und Loyalisten des Regimes Demonstranten mit Messern, Sturmgewehren und Waffen schweren Kalibers angegriffen hat«. Und der Brief fuhr fort, Alarm zu schlagen: »Scharfschützen schießen auf friedliche Demonstranten. Artillerie und Kampfhelikopter sind gegen Massendemonstrationen eingesetzt worden. Mit Hämmern und Schwertern bewaffnete Gangster haben Familien in ihren Wohnungen angegriffen. Krankenhausangestellte berichten von zahlreichen Opfern, denen in Kopf und Brust geschossen wurde, und von einem Opfer, das von einer Luftabwehrrakete am Kopf getroffen wurde. Berichten zufolge fahren Panzer durch die Straßen und überrollen unbeteiligte Zuschauer. Zeugen berichten, dass Söldner unterschiedslos aus Hubschraubern oder von Dächern auf Menschen schießen. Angeblich sprangen Frauen und Kinder von der Giuliana-Brücke, um zu entkommen. Etliche wurden durch den Aufschlag auf dem Wasser getötet, während andere ertranken.«19 Der Brief stellte jede nur vorstellbare Gräueltat als weitverbreitet und systematisch hin und berief sich dann auf die neue R2P-Doktrin, die »kollektives Vorgehen auf dem Weg über den Sicherheitsrat […] unter Kapitel VII« autorisiere. Mit anderen Worten: militärisches Vorgehen. Zu den Unterzeichnern gehörten der Präsident des National Endowment for Democracy Carl Gershman, Hillel C. Neuer von der proisraelischen Organisation United Nations Watch und andere, die vor allem für harsche Kritik an Regierungen außerhalb der Einflusssphäre der USA, der EU und Israels bekannt sind. Ohne erst nachzuforschen, verbreiteten die Mainstreammedien sensationelle Beschuldigungen, nach denen Gaddafi afrikanische Söldner und Luftangriffe gegen Zivilisten einsetzte, um »sein eigenes Volk zu töten«. Für die Luftangriffe kam nie ein visueller oder dokumentarischer Beweis zum Vorschein, und verlässliche Zeugen vor Ort bestritten, dass sie je stattgefunden hatten. Noch schlimmer stand es um die Beschuldigung des Einsatzes »afrikanischer Söldner«. Sie war nicht nur falsch, sondern erwies sich als Spitze eines Eisberges von Rassismus, der der gesamten Anti-Gaddafi-Operation zugrunde lag.20 Nun ist es so, dass Gaddafis Hinwendung zu Afrika ihm einen wichtigen Teil der libyschen Bevölkerung entfremdete, der nichts mit Afrika zu tun haben wollte und meinte, es sei vorteilhafter, dem Modell ölreicher GolfEmirate wie Katar zu folgen, deren Reichtum von einer arabischen Elite 143 monopolisiert wird, während die Arbeit von unterbezahlten, quasiversklavten und rechtlosen ausländischen Arbeitern verrichtet wird. Viele waren erzürnt über Gaddafis Vorschläge zu einer gerechteren Verteilung des Ölreichtums unter der gesamten Bevölkerung. Es war kein Zufall, dass Katars populärer Fernsehkanal Al-Dschasira die Medienattacken gegen Gaddafi anführte. Insgeheim nahmen auch katarische Soldaten an militärischen Bodeneinsätzen gegen das Regime teil.21 In seinen subsaharischen Nachbarstaaten wurde Gaddafis Libyen als eine Art Eldorado betrachtet. Libyens eigene schwarze Bevölkerung wurde ebenso wie Arbeitsimmigranten aus Schwarzafrika anständig behandelt. Gaddafi hatte mit einigen europäischen Regierungen Abkommen geschlossen, die verhindern sollten, dass Libyen als Korridor für illegale afrikanische Einwanderung nach Europa fungiert. Diese Abkommen wurden von europäischen Linken, deren Hauptanliegen offene Grenzen und die Verteidigung der Rechte illegaler Einwanderer sind, heftig kritisiert. Doch die Eindämmung einer massiven Migration von Afrika nach Europa war vereinbar mit Gaddafis langfristiger Politik, Entwicklungsbemühungen zu finanzieren, die es Afrikanern ermöglichen würden, in ihren Ländern zu bleiben und dort gut zu leben. Jetzt, nachdem er nicht mehr da ist, gerät die illegale Immigration über das Mittelmeer zunehmend außer Kontrolle. Im größten Teil Schwarzafrikas wurde Gaddafi als Held betrachtet. Die Mär von den »schwarzen Söldnern« war ein übler Kniff, um dieser Realität einen finsteren Anstrich zu geben und die schockierende Tatsache zu verbergen, dass die Rebellion gegen Gaddafi zu regelrechten Pogromen gegen Schwarze (sowohl libysche Bürger als auch »Gastarbeiter«) führte, bei denen ganze Städte von Schwarzen gesäubert und Tausende ins Exil getrieben wurden. Die Anti-Gaddafi-Revolte war ein schwerer Schlag für Schwarzafrika, weil sie Gaddafis Pläne zur Finanzierung einer unabhängigen Entwicklung Afrikas durchkreuzte, aber auch wegen der brutalen Behandlung schwarzer Menschen. »Gaddafi muss gehen« Hillary Clinton – die sagt, ihr politisches Erwachen in ihrer Jugend gehe auf die Reden Martin Luther Kings zur Verurteilung des Rassismus zurück – trat eifrig für den Einsatz des US-Militärs zur Unterstützung eines Aufstandes ein, der im Kern rassistisch und für die schwarzen Menschen 144 der Region eine Katastrophe war. Am 24. März 2011 erklärte sie: »Als das libysche Volk seine demokratischen Hoffnungen verwirklichen wollte, reagierte seine eigene Regierung mit extremer Gewalt.«22 Das ist genau die Art von schlichter Lüge, in der Hillary Meisterin ist und die auf dem Vertrauen beruht, dass die US-Bevölkerung ein völlig inhaltsleeres Klischee wie »die demokratischen Hoffnungen des libyschen Volkes« widerstandslos hinunterschlucken wird. Als sie drei Tage später in der Sendung »Meet the Press« nach den Bombenangriffen auf Libyen gefragt wurde, antwortete sie: »Seien wir fair. Sie haben uns nicht angegriffen, aber angesichts ihres Vorgehens und Gaddafis Geschichte und des Potentials von Unruhe und Instabilität war das eindeutig in unserem Interesse […] und wurde von unseren europäischen Freunden und unseren arabischen Partnern als äußerst vital für ihre Interessen betrachtet.«23 Kurz, die massive Bombardierung eines souveränen Landes, das uns nichts getan hat, ist völlig in Ordnung, solange wir der Meinung sind, es sei in unserem »Interesse« oder im »Interesse« unserer »europäischen Freunde« und unserer »arabischen Partner«. Und nicht nur das, auch die Bombardierung eines Landes, die Bewaffnung seiner Rebellen und der Sturz seiner Regierung sind das richtige Mittel, »Unruhen« und »Instabilität« zu verhindern. Und diese Frau möchte Präsidentin der Vereinigten Staaten werden! In einem Interview, das er vier Monate später mit dem unabhängigen investigativen Journalisten Julien Teil führte, gab Dr. Bouchuiguir – inzwischen neuer Botschafter Libyens in der Schweiz – freimütig zu, es habe nie Beweise für die Anklagen gegeben, die er in Genf erhoben hatte. Als Teil ihn nochmals danach fragte, antwortete Bouchuiguir erneut: »Es gab keine Beweise.«24 Das schien ihm keineswegs peinlich zu sein, vielleicht, weil er sich auf seine Beziehungen verlassen kann. Wichtig war nur, dass die Beschuldigungen als Basis dienten, die offiziellen Vertreter der Libysch-Arabischen Dschamahi-rija aus den Körperschaften der UN auszuschließen und Libyen zu sanktionieren, ohne dass es Gelegenheit hatte, sich zu verteidigen. In etlichen westlichen Ländern wurden die libyschen Botschaften geschlossen. Und als die libysche Regierung dem Ex-Außenminister Nicaraguas und katholischen Priester Miguel D’Escoto Brockmann das Mandat erteilte, am 31. März 2011 ihre Stellungnahme vor den Vereinten Nationen zu verlesen, wurde er dort von der US-Botschafterin Susan Rice unter dem Vorwand eines unzureichenden Visums daran gehindert. Den Angeklagten wurde keinerlei Verteidigung erlaubt. 145 Die westliche »Menschenrechts«-Gemeinde wird immer mehr zu einem Netz von Organisationen, deren Erfolg darauf basiert, dass sie Anklagen gegen Länder erheben, denen westliche Spender Schwierigkeiten machen möchten.25 Sie bestätigen sich gern ihre jeweiligen Berichte und folgen offenbar dem Prinzip: »Ich lobe dich und dafür lobst du mich.« Dr. Sliman Bouchuiguir hatte Freunde in Washington. Seine Doktorarbeit an der George Washington University wurde 1979 unter dem Titel The Use of Oil as a Political Weapon. A Case Study of the 1973 Arab Oil Embargo veröffentlicht.26 Er war weniger Menschenrechtler als vielmehr Strategietheoretiker, der die Meinung Washingtons teilte, wirtschaftliche Kriegführung sei notwendig, um zu verhindern, dass rivalisierende Mächte zur Bedrohung werden. Zwischen Dr. Bouchuiguirs Menschenrechtsliga LLHR und dem Nationalen Übergangsrat, der sich auf Basis der Behauptungen der LLHR und mit westlicher Anerkennung rasch zur legitimen Regierung des Landes erklärte, gab es beträchtliche Überschneidungen. Zur LLHR gehörten auch Mahmud Dschibril und Ali Tarhouni, ein Protege Washingtons, der vom Übergangsrat die Zuständigkeit für Öl und Finanzen erhielt und die Aufgabe hatte, Libyens Ölreserven zu privatisieren und sie den NATO-»Befreiern« zugänglich zu machen. Basierend auf den Anklagen Dr. Bouchuiguirs verhängte der UNSicherheitsrat Ende Februar 2011 Sanktionen gegen Gaddafi und seine Familie und erhob beim Internationalen Strafgerichtshof (ICC) Anklagen gegen sie. Hillary Clinton selbst trat vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf auf, um zu verkünden: »Es ist Zeit für Gaddafi, abzutreten.«27 Am 17. März 2011 traf der UN-Sicherheitsrat seine schicksalhafte Entscheidung zur Verhängung einer »Flugverbotszone« über Libyen. Der »Regimewandel« lag von Anfang an in der Luft und war immer die nur kümmerlich verhüllte Agenda hinter der Resolution zur »Flugverbotszone«. Russland und China enthielten sich der Stimme, statt die Resolution durch ihr Veto zu blockieren. Allerdings machten sie den USA damit ein Zugeständnis, dessen Wert sich letztlich als zweifelhaft erwies, da der Ausgang der Operation in Libyen R2P im größten Teil der restlichen Welt diskreditierte. Auch China und Russland selbst zogen daraus den Schluss, solchen Resolutionen in Zukunft nicht mehr so einfach zuzustimmen. Das zeigte sich dann später im Fall Syriens. Hillary Clinton war entzückt, dass die Resolution die Formulierung »alle nötigen Maßnahmen«28 enthielt. Diese Formulierung bedeutete den 146 Einsatz militärischer Gewalt durch die NATO, und sie prahlt damit, es sei ihre ureigene diplomatische Leistung gewesen, durch Druck im Sicherheitsrat dafür gesorgt zu haben, dass diese Worte in die Resolution Eingang fanden. »Gaddafi muss gehen«, erklärte sie erneut und ließ keinen Zweifel, dass Regimewandel Teil ihres Plans war. Gaddafi, so Clinton, sei »ein rücksichtsloser Diktator, der kein Gewissen hat und alles und alle, die ihm im Weg stehen, vernichten wird. Wenn Gaddafi nicht verschwindet, wird er weiter Unruhe stiften. Das ist einfach seine Natur. Es gibt nun einmal Kreaturen, die so sind.«29 Hillary sollte nun ihren eigenen Krieg haben. Nun, nicht ganz ihren eigenen, es gab zahlreiche Komplizen. Aber sie war sehr stolz auf ihre Schlüsselrolle bei der Orchestrierung des Massakers. Das gesamte Libyen-Verbrechen trägt ihre Fingerabdrücke. In der in dieser Frage gespaltenen Obama-Administration war sie wie Susan Rice und Samantha Power für die Jagd auf Gaddafi; sie alle meinten, es gehe um die »Aufhaltung« eines imaginären »Völkermords«. Verteidigungsminister Robert Gates und der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs Mike Muller waren dagegen. Das Widerstreben des Pentagon (und möglicherweise Obamas selber), einen weiteren Krieg im Nahen Osten anzuzetteln, mag erklären, warum Washington sich entschied, »von hinten her zu führen«, und es zumindest nach außen Frankreich überließ, den Krieg zu beginnen. Wobei sich Frankreich im Hinblick auf Logistik, Feuerkraft und Informationsbeschaffung stark auf die Unterstützung der USA verließ. Hillary brüstet sich damit, sie habe das Gewicht der USA genutzt, eine »Koalition der Willigen« zusammenzubringen, um den libyschen Führer loszuwerden. Am 12. März stimmte die Arabische Liga für die Forderung nach einer Flugverbotszone in Libyen. Wie Hillary schrieb, würde »ihre aktive Beteiligung […] sämtlichen Militäreinsätzen in der Region Legitimität verleihen«.30 Es war schlicht so, dass Hillary Clinton die Araber als Deckung brauchte. »Nach dem Irak und Afghanistan wollten wir nicht riskieren, den Eindruck zu erwecken, als würden wir erneut eine Intervention des Westens in einem muslimischen Land in Gang setzen.«31 Mit BernardHenri Levy und der Arabischen Liga in der vorderen Reihe konnten die USA das Ganze aus dem Hintergrund lenken. Die arabische Beteiligung sollte zeigen, dass Gaddafi selbst von seinen Standesgenossen abgelehnt wurde. Die Idee war wohl, diese mörderische Aktion als verdienstvoll, durch Konsens zustande gekommen und demokratisch legitimiert erscheinen zu lassen. Aber was für 147 Standesgenossen: eine Bande antidemokratischer Autokraten, deren Hass auf Gaddafi meistens die falschen Gründe hatte. Und Gaddafi selber hasste sie so sehr, dass er der arabischen Welt so gut wie den Rücken gekehrt hatte, um sich Subsaharaafrika zuzuwenden. Unter den arabischen Staaten, die sich an der Militäraktion beteiligten, tat dies Jordanien unter starkem Einfluss des Westens, während Katar seine eigene Agenda hatte. Tatsächlich war die Arabische Liga gespalten, weil einige Staaten offenbar die Konsequenzen einer »Flugverbotszone« nicht verstanden hatten. Dementsprechend beschwerte sich der Generalsekretär der Arabischen Liga Amr Moussa gleich am 20. März, die Bombardierung Libyens gehe zu weit.32 In Entscheidungen beschrieb Hillary Gaddafi als »einen der exzentrischsten, grausamsten und unberechenbarsten Autokraten der Welt. Mit seinen farbenprächtigen Outfits, den amazonenhaften Leibwächterinnen und der überspannten Rhetorik […] gab er auf der Weltbühne eine bizarre, manchmal auch schaudererregende Figur ab.«33 Das sind die Kennzeichen einer multikulturellen Welt: farbenprächtige Outfits, überspannte Rhetorik. Doch Gaddafis Rhetorik konnte manchmal sehr aufschlussreich sein, etwa in seiner bemerkenswerten Rede auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga im März 2008 in Damaskus.34 Gaddafi begann seine Rede, indem er die arabischen Führer ironisch an ihren heuchlerischen Verrat an der Sache Palästinas erinnerte. Er erklärte ihnen, wenn sie dem Iran den Besitz von Inseln im Persischen Golf streitig machen wollten, sollten sie sich einfach an den Internationalen Gerichtshof wenden und dessen Entscheidung respektieren. Dann wendete er sich der US-Invasion im Irak zu. »Was ist der Grund für die Invasion und Zerstörung des Irak? […] Könnten unsere amerikanischen Freunde doch bitte die Frage beantworten: Warum der Irak? Was ist der Grund? Ist Bin Laden Iraker? Nein, ist er nicht. Waren die, die New York angegriffen haben, Iraker? Nein, waren sie nicht. Waren die, die das Pentagon angegriffen haben, Iraker? Nein, waren sie nicht. Gab es Massenvernichtungswaffen im Irak? Nein, es gab keine. Und selbst wenn der Irak solche Waffen gehabt hätte – Pakistan und Indien haben sogar Atomwaffen! Und China, Russland, Großbritannien, Frankreich und die USA haben ebenfalls welche. Sollten all diese Länder zerstört werden? Schön, zerstören wir doch alle Länder, die Massenvernichtungswaffen haben.« Im Irak, so Gaddafi weiter, wurde eine ganze Riege von arabischen Führern durch den Strang exekutiert. »Aber wir schauten von der Seite aus zu und lachten.« Saddam Hussein sei ein Kriegsgefangener gewesen, 148 Präsident eines arabischen Landes, das Mitglied der Arabischen Liga war, aber als er gehängt wurde, hätten die arabischen Führer nichts getan. »Ich rede hier nicht über die Politik Saddam Husseins oder die Meinungsverschiedenheiten, die wir mit ihm hatten. Wir alle hatten politische Meinungsverschiedenheiten mit ihm. Und wir haben solche Meinungsverschiedenheiten auch hier unter uns. Wir haben nichts miteinander gemein als diesen Sitzungssaal.« Dann warnte er: »Jeder von euch könnte der nächste sein. Ja! Die USA kämpften mit Saddam Hussein gegen Khomeini. Er war ihr Freund. Cheney war ein Freund Saddam Husseins. Rumsfeld, der US-Außenminister zur Zeit der Zerstörung des Irak, war ein enger Freund Saddams. Am Ende verkauften sie ihn und hängten ihn. Ihr seid Freunde Amerikas – oder sagen wir, >wir< sind es, nicht >ihr<. Aber eines Tages könnte Amerika jeden von uns aufhängen.« Und er schloss: »Es tut mir Leid zu sagen, dass wir Feinde voneinander sind. Wir alle hassen einander, wir täuschen einander, weiden uns am Unglück des anderen und verschwören uns gegeneinander.« In Entscheidungen prahlt Hillary Clinton detailliert damit, wie großartig sie die arabischen Führer auf den Krieg zum Sturz Gaddafis eingestimmt habe. Tatsächlich war das nicht schwerer, als Kinder dazu zu bringen, ein Eis zu essen, denn die arabischen Führer, auf deren Rekrutierung Hillary so stolz ist, hassten Gaddafi ohnehin aus vollstem Herzen – aber nicht wegen ihrer Liebe zur Demokratie, sondern weil er ihnen immer wieder den Spiegel vorgehalten hatte. Damit wir erfahren, wie schwer sie es hatte, beschreibt Hillary in Entscheidungen einen »außergewöhnlich komplizierten« Aspekt ihrer Arbeit am Aufbau einer arabischen Koalition. Denn genau zu diesem Zeitpunkt unterdrückte das Emirat von Bahrein, wo die US-Kriegsmarine im Persischen Golf beheimatet ist, eine authentisch friedliche Protestbewegung im Stil des »Arabischen Frühlings«. Am 15. März schickte Saudi-Arabien Truppen nach Bahrein, um dort bei der Niederschlagung des Volksaufstandes zu helfen. Oh Gott, unsere wichtigsten arabischen Verbündete taten genau das, wofür wir gerade Libyen bombardieren wollten! Und das vor den Augen der ganzen Welt! »In genau diesem Moment standen wir in diplomatischen Verhandlungen über die Bildung einer internationalen Koalition zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung vor einem drohenden Massaker«, wobei den arabischen Golfstaaten eine Schlüsselrolle zufallen sollte, erinnert sich Hillary.35 149 Sie sah klar, dass »unsere Werte und unser Gewissen verlangten, dass die Vereinigten Staaten die Gewalt gegen Zivilisten verurteilten, die wir in Bahrein sahen«; aber auf der anderen Seite war die »arabische Führerschaft in der Luftkampagne« gegen Libyen »von entscheidender Bedeutung«. HRC stand vor einem moralischen Dilemma – oder zumindest einem scheinbaren Dilemma. Aber dieses konnte leicht durch leere Worte gelöst werden. Mit Hilfe ihrer Sprecherin Victoria Nuland, die später noch weit aus dem Schatten treten sollte, verfasste Hillary Clinton eine Erklärung. »Gewalt ist nicht und kann nicht die Antwort sein. Gefordert ist ein politischer Prozess.« Aber in Bahrein war auch weiterhin Gewalt die Antwort, während keinerlei politischer Prozess zugelassen wurde – was die US-Moralisten natürlich von vornherein gewusst hatten. Aber Hillary »war nun froh, dass wir weder unsere Werte noch unsere Glaubwürdigkeit geopfert hatten«. Jetzt, wo die »Werte« sicher in der Rumpelkammer verstaut waren, konnte das Bombardement beginnen. »Bald darauf kreisten arabische Jets über Libyen«, jubelte sie.36 Die Anwerbung arabischer Politiker für die Beseitigung Gaddafi war keine große Leistung. Sie war nützlich für die Kaschierung der Tatsache, dass andere, weitaus demokratischere Führer etwa aus Afrika und Lateinamerika angeboten hatten, in der libyschen Krise zu vermitteln. Nach Beginn des Militärangriffs auf Libyen spielte Hillary eine noch entscheidendere Rolle: Sie blockierte alle Bemühungen um einen Verhandlungsfrieden. Genau wie ihre Freundin Madeleine Albright benutzte sie das Außenministerium, um diplomatischen Lösungen den Weg zu versperren. Ironischerweise suchten einige Kräfte im Pentagon das Heil im Verhandeln, während Hillary im US-Außenministerium alle Verhandlungen sabotierte.37 Gaddafi dagegen war schon vor Beginn des NATO-Angriffs zum Kompromiss bereit. Bereits am 10. März 2011 hatte ein Vermittlungskomitee der Afrikanischen Union unter Führung des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma ein Friedensabkommen ausgearbeitet, das unter anderem einen Übergang zur Demokratie vorsah und über das Gaddafi mit der Opposition verhandeln wollte. Aber wie der Ex-Präsident Südafrikas Thabo Mbeki später sagte, lehnte der UNSicherheitsrat Zumas Friedensplan »total verächtlich« ab.38 Unabhängige Untersuchungen, Vermittlung, Verhandlungen – das waren die Schritte, die die Vereinten Nationen hätten unternehmen müssen, wenn sie noch in der Lage wären, als Organisation zur Wahrung des Friedens zu fungieren. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts sorgten die USA durch 150 ihren Nichtbeitritt mit für das Aus des Völkerbundes. Und Anfang dieses Jahrhunderts macht Washington sich daran, die Vereinten Nationen in einer tödlichen Umarmung zu ersticken. Vermittlung ist das, was die UN in Krisensituationen propagieren sollte, aber unter dem überwältigenden Einfluss der USA ist die Organisation zum Erfüllungsgehilfen der Pläne Washingtons geworden. Vorschläge zur friedlichen Vermittlung wie der vom demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas Hugo Chávez wurden als »Unterstützung für Diktatoren« denunziert. Als ob nur ein Land, das von Washington als »reine Demokratie« akzeptiert wird, darum bitten dürfte, nicht bombardiert zu werden … Am 18. März rief Gaddafi zu einem Waffenstillstand auf. Am nächsten Tag, an dem französische Bomber bereits begonnen hatten, Libyen anzugreifen, wurde sein Angebot von Hillary als »Gerede aus Tripolis über einen Waffenstillstand« abgetan. In Paris rechtfertigte sie die Angriffe, indem sie erklärte, Oberst Gaddafi fordere »weiterhin die Welt heraus«, indem er Zivilisten angreife.39 Tatsächlich aber gab es während des gesamten Angriffs auf Libyen Bemühungen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und der Zerstörung ein Ende zu bereiten. Gaddafis Sohn Saif al-Islam al-Gaddafi stand in Kontakt mit US-Beamten und bat sie eindringlich, eine Untersuchungskommission zu schicken, um sich selbst von den Tatsachen vor Ort zu überzeugen. Und das Pentagon hatte seine eigenen Informanten, die die melodramatischen Berichte bestritten, die als Vorwand für einen gewaltsamen Regimewandel in Umlauf gesetzt wurden.40 Nur einen Tag nach Beginn des NATO-Bombardements am 22. März 201141 bat die libysche Führung um einen 72-stündigen Waffenstillstand zwecks Ausarbeitung der Bedingungen für eine Einigung. Sie bot einen Abzug aller libyschen Truppen aus Bengasi und Misrata, den beiden großen Rebellenstädten an. Dieser Abzug hätte durch die Afrikanische Union überwacht werden können. Gaddafi sagte, er sei unter zwei Bedingungen bereit zurückzutreten und eine Übergangsregierung zu akzeptieren, nämlich dass es Libyen gestattet würde, Truppen zu behalten, um sich al-Qaida entgegenzustellen, und dass seine Familie und seine Loyalisten Schutz genössen. Der US-Marine-Admiral i. R. Charles Kubic, der in Libyen als Wirtschaftsberater arbeitete, wurde über diese Bedingungen informiert und leitete sie über die militärische Hierarchie an US-Army-General Carter Ham, den Chef des US-Afrika-Kommandos, weiter. Die Bedingungen schienen beiden Militärs vernünftig, und General Ham begann mit geheimen Verhandlungen. Aber zwei Tage später erhielt er von »außerhalb des Pentagon« den Befehl, »damit aufzuhören«. 151 Militärische Quellen sind der Meinung, dass die Order zum plötzlichen Abbruch der Friedensverhandlungen nur aus Hillary Clintons Außenministerium gekommen sein konnte.42 In einem Telefongespräch im Mai erklärte Saif al-Islam al-Gaddafi dem demokratischen Kongressabgeordneten Dennis Kucinich, die Anschuldigungen über bevorstehenden Völkermord würden genauso eingesetzt wie seinerzeit die falschen Berichte über »Massenvernichtungswaffen« im Irak. Er warnte die Amerikaner, die bewaffneten Rebellen seien keineswegs »Freiheitskämpfer«, sondern Dschihadis-ten, Verbrecher und Terroristen.43 Im August schrieb Kucinich an »Herrn Obama« und »Frau Clinton«, um ihnen zu berichten, er sei von einem Vermittler in Libyen kontaktiert worden, der die Bereitschaft Präsident Muammar Gaddafis signalisiert habe, »den Konflikt unter Bedingungen zu beenden, die der Politik der Administration entgegenkämen«. Kucinichs Brief blieb ohne Antwort.44 Gaddafi war vierzig Jahre an der Macht gewesen und war sichtlich müde. Seine Dschamahirija war ein Experiment besonderer Art, gerade weil es eine Form der Modernisierung war, die den Besonderheiten eines dünn besiedelten Wüstenlandes mit muslimischer Bevölkerung entsprechen sollte. Dazu gehörten eine Form der direkten Demokratie und ein Allgemeiner Volkskongress, der Vorschläge, die von Gaddafi kamen, ablehnen konnte und das auch immer wieder tat. Muammar Gaddafi war ein »Wegweiser« und kein »Diktator«, und die Wege, die er wies, wurden oft, vielleicht sogar in zunehmendem Maß von der Regierung zurückgewiesen. Die Dschamahirija war ein Produkt des revolutionären Zeitgeistes zu Ende des Vietnamkriegs und zeichnete sich durch eine radikale Umverteilung des Reichtums aus, die den Lebensstandard der Gesamtbevölkerung dramatisch erhöhte, aber den Eliten, die sich einen größeren Anteil der Öleinkünfte für sich selber wünschten, gar nicht gefiel.45 Angesichts des radikalen Wandels, den der Zeitgeist seitdem durchgemacht hatte, hätte sich Libyen ohne den NATO-Angriff 2011 wahrscheinlich – unter dem Einfluss seiner im Ausland ausgebildeten Eliten – in Richtung eines westlichen Kapitalismus entwickelt. Aber statt einer solchen langsamen Evolution bevorzugen die USA immer mehr das, was sie als »Revolution« bezeichnen, was im Falle Libyens in Wirklichkeit aber eine Konterrevolution und einen drastischen Rückschritt darstellte. Das Ziel war, die sozialen Errungenschaften der Revolution Gaddafis zu zerstören und zu revidieren und das Land der Kontrolle der üblichen Verdächtigen zu übergeben: Handlangern vor Ort 152 und den großen Spielern aus dem Westen, nicht nur den Ölge-sellschaften, sondern auch dem großen Baukonzern Bechtel46 sowie dem neuen USAfrika-Kommando AFRICOM, das in Afrika als Polizeitruppe fungieren soll. Aber selbst das gelang am Ende nicht. Eine US-gestützte »Revolution« kann nur zerstörerisch sein, ein Mittel, bestehende Strukturen abzuschaffen. Wir zerschlagen alles und vertrauen darauf, dass es »unseren Leuten«, mit ein wenig Hilfe von Söldnern und US-Special-Forces, gelingt, die Spitzenplätze des Wracks zu besetzen. Und wenn das fehlschlägt, zuckt die US-Führung mit den Achseln und sagt, sie hätte es nur gut gemeint. Wenn die Eingeborenen nicht reparieren können, was wir kaputt gemacht haben, ist das ihr Problem … Die Streitkräfte Libyens waren in Wirklichkeit schwach, denn Gaddafi misstraute einem starken Militär, von dem er fürchtete, es könne versuchen, sich an die Macht zu putschen. Wäre er allgemein so verhasst gewesen, wie seine Feinde behaupteten, hätte eine echte Volksrevolte der Mehrheit der Libyer ihn leicht zum Rücktritt zwingen können. Doch mitten während des sechsmonatigen NATO-Bombardements kamen am 1. Juli 2011 etwa eine Million Menschen – etwa ein Fünftel der Bevölkerung des Landes – zu einer Demonstration in Tripolis, um ihre Unterstützung für Gaddafi zu zeigen. Gaddafi war ein echter Populist und wurde von vielen einfachen Libyern immer noch unterstützt. Aber sie hatten keine Bombenflugzeuge auf ihrer Seite und verloren den Kampf. Die neidische Elite, die seinen Populismus hasste, hatte die Bomber auf ihrer Seite, aber auch sie siegte am Ende nicht wirklich. Der wirkliche Sieger war das Chaos. »Wir kamen, wir sahen, er starb« Am 30. April 2011 wurde der 29-jährige Gaddafi-Sohn Saif al-Arab alGaddafi zusammen mit drei kleinen Enkeln Muammar Gaddafis und einer unbekannten Anzahl weiterer Zivilisten bei einem NATO-Bomben- und Raketenangriff auf den Wohnsitz seines Vaters in einem Wohngebiet in Tripolis getötet. Saif, der an einer Technikuniversität in München studierte, war nur zu Besuch in seiner Heimat gewesen. Er war schon 1986 im Alter von vier Jahren bei einem US-Bombenangriff auf seine Familie verwundet worden. Nach der Attacke veröffentlichte der Bischof von Tripolis, Monsignore Martinelli, am 1. Mai einen Appell: »Ich bitte 153 inständig um eine Geste der Menschlichkeit gegenüber Oberst Gaddafi, der die Christen Libyens immer beschützt hat. Er ist ein sehr guter Freund.«47 Gaddafi sollte den Christen Libyens noch fehlen. Mitte Februar 2015 wurden einundzwanzig koptische Christen, die aus Ägypten gekommen waren, um in Libyen zu arbeiten, von islamistischen Fanatikern enthauptet.48 Am 18. Oktober 2011 traf Hillary Rodham Clinton zu ihrem ersten offiziellen Besuch in einem Land ein, von dem sie keine Ahnung hatte und das in rasendem Tempo in etwas verwandelt worden war, das niemand mehr wiedererkannte.49 Während man auf die Ankunft der Außenministerin Clinton wartete, erklärte ein »hoher Beamter des Außenministeriums« (dessen Name wie üblich nicht genannt wurde) Journalisten, die US-Besucher würden mit den Libyern darüber sprechen, wie man »Libyen auf transparente Weise so in die Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts integrieren kann, dass der Ölreichtum Libyens zum Nutzen aller Bürger des Landes verwendet wird« – ein zynischer Witz, wenn man bedenkt, dass gerade Gaddafis Bestrebungen, den libyschen Ölreichtum durch kostenlose Bildung, Wohnung und Gesundheitsversorgung an die Bürger weiterzugeben, mit Sicherheit ein sehr wichtiger Grund dafür war, dass die Führer der USA, Katars und der Arabischen Liga einen Regimewandel haben wollten. Ein solcher Egalitarismus schafft viele Feinde. Die Vereinigten Staaten, so hieß es weiter, planten jetzt, den Libyern dabei zu helfen, Englisch zu lernen, ganz so, als sei diese Sprache in Libyen unbekannt. Wie üblich war Hillary Clinton nicht etwa nach Libyen gekommen, um etwas über das Land zu lernen, sondern um seinen Bewohner zu sagen, was sie tun müssten. »Die Frauen in Libyen sollten gleiche Rechte genießen«, erklärte sie ihrem feministischen Image getreu. Das war ein weiterer hintergründiger Witz, waren doch die Frauen Libyens dank des NATO-Bombardements gerade dabei, die Rechte zu verlieren, die sie zuvor dank Gaddafi gewonnen hatten: nicht nur das Recht auf unverschleierten Aufenthalt in der Öffentlichkeit oder zur Bekleidung guter Posten, sondern auch das simple Recht, sich sicher auf der Straße zu bewegen oder überhaupt am Leben zu bleiben.50 Vielleicht zur Illustration amerikanischer Werte und Interessen nutzte Hillary ihren Besuch in Tripolis auch, um ihrer Befriedigung über die Befreiung des israelischen Soldaten Gilad Schalit im Rahmen eines Gefangenenaustausches Ausdruck zu verleihen. Vor ihrer Weiterreise nach Oman hatte Hillary ein letztes Wort zu 154 Muammar Gaddafi, der, obwohl das zu diesem Zeitpunkt unbekannt war, immer noch zusammen mit seinem Sohn Mutassim kämpfte, um seine Heimatstadt Sirte zu verteidigen. »Wir hoffen, dass er bald gefangengenommen oder getötet werden kann, damit ihr ihn nicht länger fürchten müsst«, erklärte Hillary vor einem ausgewählten Publikum in Tripolis. Zwei Tage später wurde Gaddafi sowohl gefangengenommen als auch getötet. Videoaufnahmen zeigen, dass der libysche Führer und sein Sohn lebend gefangen genommen, brutal gequält und dann ermordet wurden.51 Hillary Clinton hatte ihren Augenblick ewigen Ruhms, ihren Augenblick, der sie für die Geschichte definieren wird, im Moment von Gaddafis Tod. Als ihre Beraterin und Vertraute Huma Abedin ihr erklärte, Gaddafi sei gerade getötet worden, stieß Hillary ein albern mädchenhaftes »Wow!« hervor, bevor sie den Archetyp des Imperialisten Julius Caesar paraphrasierte: »Wir kamen, wir sahen, er starb!«, rief sie, bevor sie in herzhaftes Gelächter ausbrach.52 Hier konnte die Welt das Endergebnis des besessenen Wunsches sehen, an die Spitze der heutigen Machtstruktur der USA zu gelangen. Der Ritt auf dem Tiger des Militärisch-Industriellen Komplexes hatte die kurzsichtige Lieblingsschülerin der Lehrer aus einer Vorstadt Chicagos, das Mädchen, das am Seminar in Wellesley die selbstverständliche Anwärterin auf die Klassenbeste war, verwandelt; nun glich sie einer feixenden Mörderin, der noch dazu jeder Anflug der Reue einer Lady Macbeth fehlte. Nachbemerkungen zu einem Mord Wenn ein Mensch, der bereits gefangen ist, brutal ermordet wird, stört sie sich nicht daran, dass das Vorgehen grausam oder illegal oder auch einfach nur beschämend war. Es war ein Erfolg. Wenn der Gefangene ein »Bösewicht« ist, ist sie schadenfroh wie eine Cheerleaderin an der Highschool beim Sieg ihres Teams. Wenn der Gefangene zu ihrem eigenen Team gehört, ist sie am Boden zerstört. Das ist dann eine furchtbare menschliche Tragödie und könnte ihrer Karriere schaden. Ein Misserfolg, von dem sie nicht wirklich zugibt, dass es ihr Misserfolg ist. In Entscheidungen unterschlägt Hillary jede Erwähnung ihrer Reaktion auf den Tod Gaddafis, offenbar, weil man sie gewarnt hatte, das würde nicht den guten Eindruck machen, den sie erwartete. Stattdessen 155 widmet sie dem Tod des libyschen US-Botschafters Chris Stevens und dem zweier CIA-Beamter, Glen Doherty und Tyrone Woods, am 1. September 2012 in Bengasi ein Kapitel von über vierzig Seiten.53 »Dass ich als Außenministerin letztlich für die Sicherheit meiner Leute verantwortlich war, wurde mir nie stärker bewusst als an jenem Tag«, schrieb sie.54 Das ist zweifellos richtig. Aber dann ist sie sofort wieder die Anwältin, die weiß, dass man sich aus allem herausreden kann. Und schon fangen die Rechtfertigungen an: »Es liegt in der Natur der Sache, dass Diplomatie oft an gefährlichen Orten stattfindet, wo die nationale Sicherheit Amerikas auf dem Spiel steht.«55 Augenblick mal! Die »nationale Sicherheit« der USA steht in Bengasi auf dem Spiel? Wie kommt das? Und was immer Chris Stevens am 11. September 2012 in Bengasi tat, »Diplomatie« im strikten Sinn war es jedenfalls nicht. Den plausibelsten Berichten zufolge waren Chris Stevens und seine Kollegen in Bengasi, um zu helfen, auf dem Weg über die Türkei Waffentransporte an islamische Rebellen in Syrien zu arrangieren. Zusammen mit islamistischen Kämpfern aus Libyen geschmuggelte Waffen haben unter Mithilfe der USA inzwischen zum Tod zahlreicher Schiiten, Alawiten und Christen im gesamten Gebiet der uralten Wiege der Zivilisation in Mesopotamien beigetragen. Stevens betrieb keine »Diplomatie«, sondern imperialen Regimewandel und den radikalen Umbau eines Staats – ein Projekt das völlig scheiterte. Er operierte im Kontext der Traumwelt Hillary Rodham Clintons, einer Welt, die so umgemodelt werden sollte, dass sie den »universalen Werten und Interessen« der USA entspricht. »Ohne amerikanische Präsenz«, argumentiert sie in ihrem Verteidigungsantrag für sich selbst, »würde der Extremismus leicht Fuß fassen, setzten wir unsere Interessen aufs Spiel und gefährdeten die Sicherheit unseres Landes.«56 Das sind natürlich nur die rhetorischen Nebelkerzen einer Anwältin. Der Extremismus hat im Nahen Osten fast ausschließlich deshalb Wurzeln geschlagen, weil die USA, und mit ihnen das mit drei Milliarden Dollar im Jahr verwöhnte Israel, dort nur zu präsent waren. Das ist allgemein bekannt, aber ein Rückzug, so Hillary weiter, liegt »einfach nicht in den Genen unserer Nation«, weil die Amerikaner in allen Krisen »stets nur noch härtere und klügere Anstrengungen unternommen haben«. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt arbeiten »härter und klüger«, aber für HRC müssen alle menschlichen Tugenden als spezifisch »amerikanisch« definiert werden. Das ist die Art sinnloser Rhetorik, die »die selbstverständliche 156 Anwärterin« vor sich hin spinnt. Es ist die Rhetorik des Strebens nach oben. In ihren weitschweifigen Erklärungen, warum Stevens, Doherty und Woods getötet wurden, erklärt sie in Wirklichkeit nichts. Sie sympathisiert mit den Ergebnissen einer Untersuchung der New York Times, die zu dem Schluss kam, der tödliche Angriff sei »entgegen den Behauptungen einiger Kongressabgeordneter weitgehend durch die Wut auf ein in den USA hergestelltes Video inspiriert gewesen, das den Islam verächtlich machte«. Aber sie ist sich nicht ganz sicher und endet mit der pragmatischen Bemerkung, jetzt, wo der Schaden schon angerichtet sei, sei es weniger wichtig, herauszufinden, warum die Täter so handelten, als sie zu finden und der Gerechtigkeit zuzuführen. Sie finden und der Gerechtigkeit zuführen, ohne zu wissen, warum sie es taten? Die USA platzten in ein Land hinein, über das einige wenige Spezialisten aufgrund von Spionage aller Art sehr viel wussten, von dem die politischen Entscheidungsträger aber keine Ahnung hatten. Dennoch waren sie sich sicher, dass sie es nach ihrem eigenen Bild neu gestalten konnten – eine Aufgabe, die Gottes würdig wäre und die am Ende ein Inferno hervorbrachte. Hillary scheint nie auf die Idee gekommen zu sein, der Mord an Stevens, Doherty und Woods könne die normale und vorhersehbare Konsequenz eines mörderischen Projekts sein, das nie hätte begonnen werden dürfen. Wer seine Hand in ein Hornissennest steckt, wird gestochen. Christopher Stevens wusste eine Menge über Libyen. Seine von WikiLeaks veröffentlichten Telegramme an das Außenministerium zeigten, dass er wusste, dass Gaddafi kein »Diktator« war und dass er sich, stärker und schon länger als die USA, »im Krieg« mit dem islamischen Terrorismus und al-Qaida befand.57 Aber zugleich versuchte Gaddafi, so wie China, zu einer unabhängigen Entwicklung Afrikas beizutragen. Das stieß auf große Missbilligung des Westens, der, obwohl er die Entwicklung Afrikas jahrzehntelang vernachlässigt hatte, den privilegierten Zugang zu den Ressourcen des Kontinents für sich behalten wollte.58 In einer Nachricht an Washington von August 2008 berichtete Christopher Stevens: »Muammar Gaddafi hat kürzlich ein breit publiziertes Abkommen zwischen Stammesführern aus Libyen, dem Tschad, dem Niger, Mali und Algerien vermittelt, mit dem sie, im Tausch gegen Entwicklungshilfe und finanzielle Unterstützung, ihre separatistischen Ambitionen und ihren Schmuggel (von Waffen und transnationalen Extremisten) aufgeben würden.«59 Kurz, Gaddafi verwendete Libyens Ölreichtum dazu, den Frieden in 157 der Region zu fördern. Mit seinem Tod endete der Frieden und im Nachbarland Mali kam es zum Krieg, während in Libyen selbst Recht und Ordnung komplett zusammenbrachen. Ein friedliches und prosperierendes Land versank im Chaos. Vielleicht waren die »überspannte Rhetorik« und die bizarren Gewänder ebenso wie das autoritäre Gebaren Gaddafis in der Anfangsphase der Schaffung einer neuen Nation aus einer riesigen, nur spärlich von rivalisierenden Stämmen besiedelten Wüstenregion ja von Nutzen. Aus der Dschamahirija hätte sich noch etwas Originelles entwickeln können, genau wie aus Jugoslawien etwas Interessantes hätte entstehen können – unterschiedliche Systeme in einer mannigfaltigen Welt. Aber für »Amerika« gibt es nur ein einziges Modell. In seinem aufklärerischen Meisterwerk Slouching Towards Sirte: NATO’s War on Libya and Africa kommt Maximilian Forte zu folgendem Urteil: »Tatsächlich war Gaddafi eine bemerkenswerte und einmalige Ausnahme unter allen modernen arabischen Führern: weil er hartnäckig einen nationalen Altruismus praktizierte, weil er Entwicklungsprogramme in Dutzenden bedürftiger Ländern finanzierte, weil er nationale Befreiungsbewegungen unterstützte, die nichts mit dem Islam oder der arabischen Welt zu tun hatten, weil er eine Ideologie verfolgte, die originär und nicht einfach das Produkt überkommener Tradition oder des Nachäffens äußerer Einflüsse war, und weil er Libyen zu einer Präsenz auf der Weltbühne verhalf, die in keinem Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl stand (so haben die meisten der größeren Karibikstaaten eine größere Bevölkerung als Libyen). Man konnte ein scharfer Kritiker Gaddafis sein und doch die ehrliche Fähigkeit haben, diese objektiven Tatsachen anzuerkennen, oder zumindest, wenn einem die übliche dämonisierende Darstellung lieber war, >dem Teufel das Seinige zuzugestehen<.«60 Solch eine »ehrliche Fähigkeit«, die Qualitäten eines Gegners anzuerkennen, fehlt der Führungsriege der USA leider ganz und gar – ganz gleich, ob es sich um den zur Hälfte schwarzen (und afrikanischen) Barack Obama oder um die »hundertprozentige Amerikanerin« Hillary Rodham Clinton handelt … In der gesamten Geschichte war der »Friede der Tapferen«, der genau diese Fähigkeit erfordert, die Fähigkeit menschlicher Wesen also, im verzerrten Spiegel der anderen sich selbst zu sehen, Kennzeichen einer edlen Seele. Bei den heutigen Politikern des Westens ist davon nichts mehr zu spüren. Die Geschichte des Muammar Gaddafi ist eine epische Tragödie, und Gaddafi war ein tragischer Held, der früher einmal der Protagonist 158 großer Literatur gewesen und Mitgefühl wie Schrecken ausgelöst hätte. Wie alle großen Helden war er fehlbar. Er konnte grausam und großzügig sein. Er war menschlich und lächerlich. Er hatte große Fehler und große Verdienste, und sogar seine komischen Seiten. Seine Pläne überstiegen seine Möglichkeiten, sie zu verwirklichen, und sein katastrophaler Untergang war weniger seinen Makeln als seinen Tugenden geschuldet, vor allem seinem »hartnäckigen Altruismus«, der ihn vom Chor seiner einflussreichen Kritiker im eigenen Volk isolierte. Auf seine eigene Art war er so blind wie Ödipus und bedarf eines zukünftigen Sophokles oder Shakespeares. Aber ist das überhaupt möglich? Das »Amerika«, das heute das Kommando über die Welt beansprucht, tötet nicht nur andere Nationen, es tötet allen Adel des Geistes, und es tötet die Tragödie; jene Fähigkeit, die Wahrheit über die Verfasstheit des Menschen in seiner Niederlage zu begreifen, die Fähigkeit, die Toten mit Ehre zu begraben und der Renitenz des tapferen Narren, der fantasiert, er könne die Welt retten, wenigstens Achtung zu zollen. In Libyen dachten die Amerikaner an ihre »Interessen« – sie kamen, sie sahen nichts, und ihr menschliches Gewissen war bereits tot. 159 6 Russland verstehen? Nein, danke! »Manchmal habe ich das Gefühl, als säßen da drüben jenseits des großen Teichs in Amerika Leute in einem Labor und führten Experimente durch, als ginge es um Ratten – aber ohne die Konsequenzen ihres Handelns zu begreifen.« Wladimir Putin, 4. März 20141 Jede Nation hat ihre eigenen Werte und Interessen. Bei friedlichen internationalen Beziehungen sollte es daher um die Respektierung von Werten und den Ausgleich von Interessen gehen. Ein Blick auf die Beziehungen zwischen den USA und Russland im letzten Vierteljahrhundert zeigt jedoch, dass das Washingtoner außenpolitische Establishment es völlig unnötig findet, Nichtigkeiten wie russische Werte und Interessen zu achten, zur Kenntnis zu nehmen oder zu verstehen zu versuchen. Seltsamerweise scheint heute ein Haupterfordernis, um in Washington zum Russlandexperten zu werden, die Unfähigkeit zu sein, dieses Land zu verstehen. Autismus scheint das bevorzugte Qualifikationsmerkmal.2 Die Amerikaner sind offenbar unfähig zu begreifen, warum ein Land, das im letzten Jahrhundert zweimal Ziel massiver, zerstörerischer Invasionen aus dem Westen war, etwas dagegen haben könnte, dass die USA die größte Militärmaschine der Geschichte bis direkt vor Russlands Haustür ausfährt. Wenn Moskau hiergegen Einwände erhebt, reagieren die USA darauf mit der Unterstellung, die Russen litten unter Verfolgungswahn. Es ist den US-Führern gelungen zu vergessen, dass man Russland 1990 als Gegenleistung für die russische Erlaubnis eines NATO-Beitritts des wiedervereinigten Deutschlands versprochen hatte, die NATO nicht weiter nach Osten auszudehnen. Der Handel wurde von Gorbatschow, der 160 nicht einmal eine schriftliche Version verlangte, willig akzeptiert. Er war naiv genug zu glauben, wenn Deutschland innerhalb der US-geführten NATO bliebe, würde dies Russland schützen, indem es jedem neuen aggressiven deutschen Drang nach Osten einen Riegel vorschob. Es war dann die »nette« Clinton-Administration, die damit begann, zuerst den Geist der Vereinbarung zu verletzen, indem sie sich Deutschland bei der Zerschlagung Jugoslawiens anschloss, und dann mit der Erweiterung der NATO nach Osten auch gegen ihren Buchstaben zu verstoßen. Die Tschechische Republik, Ungarn und Polen wurden alle unmittelbar vor der Bombardierung Jugoslawiens 1999 in die NATO aufgenommen. Damit begann sich die »Partnerschaft« mit Washington, auf deren Etablierung die russische Führung gehofft hatte, in Luft aufzulösen. Statt auf die zahlreichen russischen Avancen zu einer friedlichen Partnerschaft zu antworten,3 beschloss die Clinton-Administration, Russland wie einen besiegten Feind zu behandeln. Die Folgen dieser Entscheidung zeigten sich erst 2014 in vollem Maße. Die Lehre für Russland war, dass die Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Pakts, nicht die Aussichten auf den Weltfrieden verbessert, sondern nur den USA das grüne Licht gegeben hatte, von der Zerstörung der UdSSR zur Demontage Russlands voranzuschreiten. Nicht lange nach der Demütigung Russlands im Kosovokrieg und im letzten Jahr der Clinton-Präsidentschaft trat Boris Jelzin 2000 als Präsident der Russischen Föderation ab. Das Land befand sich damals aufgrund des schockartigen Übergangs zum Kapitalismus, der sowohl den Lebensstandard als auch die Moral der Bevölkerung stark gesenkt hatte, in einem drastischen sozialen, wirtschaftlichen und sogar demografischen Niedergang. Putin hatte den größten Teil seines Lebens als Geheimdienstoffizier verbracht und war von Jelzin zunächst als Berater und dann als Nachfolger ausgewählt worden. Geheimdienste bieten oft eine ausgezeichnete Ausbildung in internationalen politischen und strategischen Gegebenheiten. Der Chor der US-Propaganda folgte dem üblichen Doppelstandard und denunzierte die Karriere Putins im KGB als Beweis für seine Bösartigkeit, vergaß dabei allerdings bequemerweise, dass Präsident Bush I. einst CIA-Chef gewesen war. Das Problem des Westens mit Putin bestand zweifellos von Anfang an darin, dass er zu viel wusste und nur zu gut verstand, was Washington hinter seinem netten diplomatischen Getue tatsächlich vorhatte. Das Dumme an Putin war, dass er wesentlich besser begriff, was vor sich ging, als der bemitleidenswerte Boris Jelzin. Vielleicht hatte Jelzin, in der vagen Ahnung, dass seine amerikanischen »Freunde« ihn hereingelegt hatten, 161 sich genau deswegen Putin als Nachfolger ausgesucht. Wladimir Putin hat wohl kaum versäumt, die 1997 erschienene Bibel der US-Eurasien-Strategie Die einzige Weltmacht von Zbigniew Brzeziński zu lesen.4 Als Präsident Jimmy Carters Nationaler Sicherheitsberater war Brzeziński der Guru hinter der Strategie, mit der die UdSSR 1979 in den Sumpf des sowjetischen Afghanistankriegs gelockt wurde. Auch danach blieb er der prominenteste US-Stratege mit Verbindungen zur Demokratischen Partei. Brzeziński erklärt in seinem Buch, das Ziel der US-Außenpolitik solle »letzten Endes von der Vision einer besseren Welt getragen sein: der Vision, im Einklang mit langfristigen Trends sowie den fundamentalen Interessen der Menschheit eine auf wirksamer Zusammenarbeit beruhende Weltgemeinschaft zu gestalten«. Kurz, die USA sollen, in der Gewissheit, dies sei »letzten Endes« gut für die Menschheit, die ganze Welt gestalten. »Aber bis es soweit ist«, fügt er hinzu, sei es im Hier und Jetzt zwingend erforderlich, »keinen eurasischen Herausforderer aufkommen zu lassen, der den eurasischen Kontinent unter seine Herrschaft bringen und damit auch für Amerika eine Bedrohung darstellen könnte«.5 Das läuft auf die Forderung nach einer präventiven Schwächung jeder neu entstehenden Macht hinaus – und zwar nicht wegen etwas, was sie tut, sondern einfach, weil sie da ist. Und Russland muss schon wegen seiner Größe und geografischen Lage zwangsläufig als potenzieller »Herausforderer« und daher Widersacher angesehen werden. Der Schluss aus alldem ist, dass die von Russland proklamierte Hoffnung auf einen Neuanfang als friedlicher und prosperierender Partner des Westens für die USEntscheidungsträger überhaupt kein Thema ist. »Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie: Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die >Barbaren<Völker sich nicht zusammenschließen.«6 Mit anderen Worten bedeutet dies die Wiederbelebung des klassischen divide et impera für unser eigenes brutales Zeitalter. Die »Vasallen« und »Tributpflichtigen« sind unsere lieben europäischen Verbündeten, abhängig, gehorsam und geschützt von der NATO, die zudem durch die Mitgliedschaft in einer Union von achtundzwanzig höchst verschiedenen Ländern, die gegen alles ein Veto einlegen und sich gegenseitig 162 paralysieren können, in einem Zustand permanenter Unentschlossenheit gehalten werden. Die »Barbaren« sind natürlich so gut wie alle anderen, nicht zuletzt die Russen, und die »Absprachen«, die verhindert werden müssen, sind alles, was auf stabile und friedliche Beziehungen zwischen der Europäischen Union (besonders Deutschland) und Russland hinausläuft. Das Ärgerliche an Putin war, dass er das verstand, als unannehmbar betrachtete und sogar wagte, es auch zu sagen. Die einzige Weltmacht wurde während Clintons zweiter Amtszeit veröffentlicht und gilt als wichtigstes Buch dieser Zeit über US-Strategie. Der Präsident und seine Frau haben es sicher gelesen, und seine Frau vielleicht aufmerksamer als der Präsident selbst. Tatsächlich vertraute Hillary Clinton, bevor sie beschloss, für den Senat zu kandidieren, ihrer guten Freundin Diana Blair an, sie »wäre gerne in einer Denkfabrik«. Sie wolle eine »politische Frau« sein. Damit meinte sie die Außenpolitik, besonders ihre aggressive, militärische Seite. Carl Bernsteins detaillierte Biografie Hillarys, Hillary Clinton. Die Macht einer Frau, der diese Zitate entstammen und die geschrieben wurde, bevor sie Außenministerin wurde, beschäftigt sich kaum mit Außenpolitik.7 Aber am Ende wird in Kapitel 18, das von HRC als frischgebackener Senatorin aus New York handelt, ihre Wandlung deutlich gemacht: »Aus Gesprächen mit ihren Beratern geht klar hervor, dass ihre Tätigkeit im Streitkräfteausschuss das zentrale Element war, mit dem sie ihre Befähigung zur Präsidentschaftskandidatin nachzuweisen gedachte. Sie wollte eine für ihre Entschlossenheit bekannte Verteidigungsexpertin werden, eine Meisterin der Geheimnisse von Politik, Waffen und militärischer Strategie. Im Fall eines Wahlsiegs sollten ihr diese Kenntnisse ebenso von Nutzen sein wie auf dem Weg dorthin, wo sie helfen konnten, die Befürchtungen der Wähler in Bezug auf einen weiblichen Oberbefehlshaber zu zerstreuen.«8 Hillary war sich über die »mangelnde Erfahrung ihres Ehemanns mit allem Militärischen« im Klaren und wollte es besser machen. »Sie ging stets davon aus, dass sie den progressiven Flügel der Demokratischen Partei in der Tasche ihres Hosenanzugs hatte«,9 und so bestand ihre Hauptaufgabe darin, Stimmen von anderen Wählern zu ergattern. Das ist ein nur zu normaler Weg für linksliberale Politiker. Zuerst erkannte sie, dass ihr Ziel einer großen progressiven Veränderung wie 163 der Gesundheitsreform im gegenwärtigen System aufgrund des kapitalistischen Profitsystems und der daraus resultierenden Kräfteverhältnisse nicht durchzusetzen war. In der Innenpolitik ist abgesehen von kleinen Korrekturen praktisch nichts zu machen. Aber auf der Weltbühne bietet die Militärmacht der USA enorme Möglichkeiten, »etwas zu tun«: zündende Reden gegen »Diktatoren«, Schikanierung ganzer Länder und ihre Bestrafung durch Sanktionen, Sturz von Regierungen – und schließlich große, kolossale Kriege. Geschichte kann gemacht werden. 2005 zeigte Hillary ihr nationalistisches Gesicht, indem sie ein Gesetz mit einbrachte, das das Verbrennen der US-Flagge zum Bundesverbrechen machte. Sie vertraute voll darauf, dass ihre liberalen Fans diese Geste, mit der sie dem chauvinistischen Mob imponieren wollte, geflissentlich ignorieren würden. Sobald eine Politikerin wie HRC die hilflosen Linksliberalen »in der Tasche« hat, können deren Gefühle und Überzeugungen getrost ignoriert werden. Sie werden sie sowieso als das kleinere Übel wählen, ganz egal, was sie tut. Für eine Welt der Gleichen Im Februar 2007 beging Wladimir Putin ein Delikt, das bedeutsamer war als eine Flaggenverbrennung: Er konfrontierte die Macht mit der Wahrheit. Auf der jährlichen Internationalen Sicherheitskonferenz in München sprach Putin sich freimütig gegen das Modell einer »monopolaren Welt« aus, einer Welt mit einem Herrscher und einem Souverän, einer Welt, die »mit Demokratie nichts zu tun« habe.10 Das monopolare Modell sei »für die heutige Welt nicht nur unannehmbar, sondern überhaupt unmöglich«, meinte er. Putins Punkt war, dass der extreme Einsatz militärischer Gewalt in internationalen Beziehungen, der »die Welt in die Tiefen einander ablösender Konflikte stößt«, und die »immer stärkere Vernachlässigung der grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts« durch die USA überall ein Gefühl der Unsicherheit erweckten und ein gefährliches Wettrüsten stimulierten. Im Gegensatz dazu, so Putin, sei Russland für alle Arten von friedensfördernden Maßnahmen: konventionelle Abrüstung in Europa, Reduktion von Nuklearwaffen, Initiativen zur Verhütung des Wettrüstens im äußeren Weltraum und UN-Autorität über die Anwendung von Gewalt. 164 Zur Lösung der iranischen Nuklearfrage hatte Russland die Etablierung internationaler Zentren zur Anreicherung von Uran unter strikter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde vorgeschlagen, um eine legitime Entwicklung ziviler Nuklearenergie zu ermöglichen. Indem er implizit auf die Behandlung Russlands durch die USA als »besiegtes Land« antwortete, erinnerte er daran, »dass der Mauerfall […] dank der historischen Wahl auch unseres Volkes möglich geworden ist, einer Wahl für Demokratie und Freiheit, Offenheit und aufrichtige Partnerschaft mit allen Mitgliedern der großen europäischen Familie«. Russland wurde nie militärisch besiegt, sondern entschied sich aus freien Stücken, den Kalten Krieg zu beenden und eine Partnerschaft mit dem Westen anzustreben. Vor allem anderen, schloss Putin, wolle Russland mit »verantwortungsbewussten und selbständigen Partnern […] eine gerechte und demokratische Weltordnung aufbauen, in der Sicherheit und Prosperität nicht nur Auserwählten, sondern allen garantiert sind«. Putins Rede wurde mit Schock, Ärger, Ablehnung sowie Gemurmel über einen neuen Kalten Krieg begegnet, weil er es gewagt hatte, offene Kritik an den USA zu üben. Die NATO stellte sich wie üblich geschlossen hinter Washington. Der damalige NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer gab nur die vorherrschende Reaktion in Washington wieder, als er sagte, die Rede sei »enttäuschend und nicht hilfreich«11. Senator John McCain entgegnete, die Welt sei nicht monopolar, verlangte aber gleichzeitig, Russland solle die »westlichen Werte« übernehmen, womit er nahelegte, dass die Welt, wenn sie schon nicht monopolar sei, es schleunigst werden sollte. »Moskau muss verstehen, dass es keine echte Partnerschaft mit dem Westen haben kann, solange sein Vorgehen im In- und Ausland so fundamental den Kernwerten der euroatlantischen Demokratien widerspricht«, sagte er, und tat Putins Rede als »überflüssige Konfrontation« ab.12 Während ihrer Zeit im Senat fand Hillary Clinton in Senator Mc-Cain, dem kriegslüsternen Republikaner, der von Obama in der Präsidentschaftswahl 2008 geschlagen wurde, einen Verbündeten. Die Senatoren McCain und Clinton waren beide besonders darauf aus, die Welt in Einklang mit »den Kernwerten der euroatlantischen Demokratien« zu vereinigen. Als Vorsitzender des International Republican Institute (IRI), einer Filiale des vom US-Kongress finanzierten National Endowment for Democracy (NED), bereiste McCain die ganze Welt, um Einzelaktivisten oder unzufriedenen Minderheiten, die ihre Länder unter die Obhut der USA bringen wollen, großzügig mit Ermutigung, 165 Ratschlägen und US-Dollar beizustehen. Wie bei McCain wimmeln die außenpolitischen Äußerungen Hillarys von Hinweisen auf »Prinzipien«, die vorwiegend mit den inneren Angelegenheiten anderer Länder, besonders mit »Demokratie« und »Menschenrechten«, und nicht mit Beziehungen zwischen Staaten zu tun haben. So zielt die US-Außenpolitik immer mehr darauf ab, sich in die Innenpolitik von Ländern einzumischen, deren Struktur den USA missfällt und die sie ihrer Kontrolle unterwerfen wollen. Die Mainstreammedien fungieren als verlässliche Wasserträger dieser Politik, indem sie oft verzerrt oder unrichtig berichten und vor allem regelmäßig den Kontext unterschlagen. Die ständigen Vorträge gegenüber anderen bestätigen den Eindruck, dass die Aufgabe des Außenministeriums nicht darin besteht, für reibungslose Beziehungen zwischen Staaten zu sorgen, sondern darin, sich in Beziehungen innerhalb fremder Staaten einzumischen. In Entscheidungen brüstete Hillary sich damit, sie habe als Senatorin »Putins Herrschaftsgebaren häufig kritisiert«13. Sie wird nicht müde, ihre Antipathie gegenüber Putin zu unterstreichen. Als man sie bei einer Versammlung in Winnipeg im Januar 2015 fragte, ob sie sich »entschieden habe, Präsidentin zu sein«, drehte sie sich um, äffte klobig Putin nach (»Entscheiden, Präsident zu sein«) und fügte mit einem selbstgerechten Feixen hinzu: »Wir haben einen Prozess.« Als ob die Tatsache, die zweite Clinton zu sein, die unterstützt von Milliardären für das Amt kandidiert, ein Prozess wäre, der den russischen Wahlen überlegen ist. Als sie noch Anwärterin auf die demokratische Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur war, erklärte sie im Januar 2008 auf einer Versammlung in Hampton, Massachusetts, Präsident George W. Bush habe falsch daran getan, eine freundschaftliche Beziehung zu Wladimir Putin zu entwickeln. Zu Bushs Behauptung, er habe Putin in die Augen geblickt und seine Seele gesehen, entgegnete sie: »Ich hätte ihm sagen können, dass er KGB-Agent war und schon allein deswegen keine Seele hat.«14 Als Hillary Clinton im Januar 2009 ihr Amt als Obamas Außenministerin antrat, war Dmitri Medwedjew Präsident Russlands. In einer oberflächlichen Geste, die dazu bestimmt war, Medienaufmerksamkeit zu erregen, zog sie bei ihrem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, einem echten Top-Diplomaten, ein Gerät hervor, das sie als »Reset«-Knopf bezeichnete, und überredete Law-row, gemeinsam mit ihr vor Fotografen den Knopf zu drücken. »Wir haben uns große Mühe gegeben, das richtige russische Wort zu finden. Glauben sie, es ist uns gelungen?«, fragte sie stolz. Nein, war die 166 Antwort, das russische Wort auf dem Gerät sage in Wirklichkeit »überladen«, nicht »reset«. In Wirklichkeit war dieser plumpe PseudoFototermin kein Zeichen einer echten Bemühung zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses. Wie Hillary später schrieb, war das nichts weiter als eine Übung in Opportunismus. Dieser Neustart habe es den USA ermöglicht, »die tiefer hängenden Früchte einer bilateralen Zusammenarbeit« zu pflücken15 – eine andere Art zu sagen, dass Washington Moskau erfolgreich einige wichtige Konzessionen abgenötigt hatte, wie die Erlaubnis für das Pentagon, russisches Gebiet für den Transport letaler Waffen nach Afghanistan zu nutzen, die Zustimmung zu Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea und Ähnliches mehr. Aber Russland bekam für sein Entgegenkommen keinen Dank. Moskaus Zugeständnisse, schrieb Clinton, seien »eine Tarnung für ganz andere Absichten« gewesen: »Auch wenn Russland den Transport amerikanischer Fracht durch sein Territorium zuließ, wollte es in ganz Zentralasien eigenes militärisches Profil zeigen. […] Es war gewissermaßen eine moderne Version des >Großen Spiels<, eines verwickelten diplomatischen Wettbewerbs im 19. Jahrhundert, in dem Russland und Großbritannien um die Vorherrschaft in Zentralasien rangen – nur mit dem Unterschied, dass Amerika in der Region nicht nach Dominanz strebte, sondern nur ein ganz spezifisches Anliegen hatte.«16 Oh, wie schön sind Großmachtspiele! Aber »Amerika« könnte natürlich nie so etwas Unfaires tun wie nach Dominanz zu streben. Was genau Russland unternahm, um »eigenes militärisches Profil zu zeigen«, bleibt ein Geheimnis. 2012 jedoch war Putin wieder im Amt, und Hillary agierte gegenüber Russland, als sei sie die Therapeutin, die den »seelenlosen« Präsidenten behandelt. Die US-Politik gegenüber Russland basierte demnach nicht auf einem Verständnis der grundlegenden Interessen und genuinen politischen Ziele des Landes, sondern eher auf einer amateurhaften Psychoanalyse. So schickte Außenministerin Clinton Präsident Obama ein warnendes Memorandum. Er habe es jetzt nicht mehr mit dem sanftmütigen Medwedjew zu tun und müsse sich bereit machen, eine härtere Linie zu fahren. Putin, schrieb sie, sei »zutiefst verärgert über die Vereinigten Staaten und misstrauisch gegenüber unseren Handlungen«, ohne dass sie einen Grund für diese Haltung angegeben hätte. Putin könne sein Projekt der Schaffung einer Zollunion als »regionale Integration« bezeichnen, warnte Hillary, doch das sei »nur ein Deckmantel für den Wiederaufbau eines untergegangenen Großreiches«.17 Man muss nicht eigens sagen, 167 dass die Zollunionen, die die Vereinigten Staaten unermüdlich schaffen und erweitern, natürlich nichts mit dem Aufbau von Imperien zu tun haben – Gott bewahre! Dafür könnte eine von Russland betriebene Zollunion ein erster Schritt zum Heranwachsen dessen sein, was Brzeziński für tabu erklärt hatte: einer neuen Macht in Eurasien. »Verhandeln Sie hart«, riet Hillary Clinton Obama.18 In Entscheidungen demonstriert sie ihre Fähigkeit, die Gedanken des russischen Präsidenten zu lesen: »Putins Weltbild ist geprägt durch seine Bewunderung für die mächtigen Zaren der russischen Geschichte und durch Russlands seit langem verfolgtes Bestreben, die Staaten in seiner Nachbarschaft unter Kontrolle zu haben. Hinzu kommt Putins persönlicher Vorsatz, Russland nie wieder schwach oder vom Westen abhängig erscheinen zu lassen, wie es in seinen Augen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Fall gewesen war. Putin will Russland zu alter Macht zurückführen und strebt dazu eine die Nachbarn beherrschende Stellung und die Kontrolle ihrer Energieversorgung an. Außerdem will er im Nahen Osten eine größere Rolle spielen, um Moskaus Einfluss in der Region zu stärken und die Bedrohung durch aufbegehrende Muslime diesseits und jenseits der russischen Südgrenze zu vermindern. Um diese Ziele zu erreichen, setzt Putin alles daran, den Einfluss der Vereinigten Staaten in Mittel- und Osteuropa sowie anderen Regionen, die er für Teile der russischen Einflusssphäre hält, zurückzudrängen und unseren Bestrebungen in den Ländern, die durch den Arabischen Frühling erschüttert wurden, entgegenzuarbeiten oder sie zumindest unwirksam zu machen.«19 Diese vorgebliche Analyse ist nichts anderes als eine Mischung von Projektion und grundloser Unterstellung. Die Möchtegern-»Verteidigungsexpertin« denkt in Stereotypen. So ignoriert HRC in ihrer »Analyse« schlicht und einfach Putins wiederholte Angebote20, mit den USA in der Abrüstung, in der Iranfrage, im Kampf gegen den islamischen Terrorismus oder in der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenzuarbeiten. Und so geht es weiter: »Für ihn [Putin] ist Geopolitik ein Nullsummenspiel: Wenn der eine gewinnt, muss ein anderer verlieren. Diese überholte, nichtsdestotrotz gefährliche Vorstellung erfordert, dass die Vereinigten Staaten sowohl Stärke als auch Geduld zeigen.«21 Falls die Berater des russischen Präsidenten ebenfalls Anhänger der Psychoanalyse sind, könnten sie Putin warnen, dass Hillarys Biograf Carl 168 Bernstein ihre Tendenz unterstrichen hat, sich auf einen »Bösewicht« und »Feind« zu konzentrieren, den sie dämonisieren kann.22 In der internationalen Arena hat sie offenbar Putin für diese Rolle auserkoren. Zur Zeit der Sowjetunion konzentrierten sich US-Analysen der Moskauer Politik meist auf Versuche, sich in der mysteriösen Hierarchie der Machtelite zurechtzufinden. Diese Tätigkeit wurde Kremlforschung genannt. Sie war ziemlich sinnlos, war aber immer nützlich, um von echten Fragen abzulenken, indem jedes Thema auf obskure Machtkämpfe unter einzelnen Politikern reduziert wurde. Folie für all das war das Bild der »feindlichen« Hauptstadt als finsterer Festung, die sich im Griff merkwürdiger Wesen befand, die gegeneinander um die Macht intrigierten. Die heutigen Bemühungen in den USA zur Psychoanalyse eines angeblich undurchschaubaren Putin sind ein Rest der nicht zu Unrecht »Kremlastrologie« genannten Pseudoforschung während des Kalten Krieges. Dass Wladimir Putin in Wirklichkeit sehr offen und freimütig ist, macht hier keinen Unterschied. So zahlte das Pentagon einer Gruppe selbsternannter Experten für die »Analyse von Bewegungsmustern« Hunderttausende von Dollar; sie kam in einem vertraulichen Bericht von 2008 zu dem Schluss, Putin leide unter dem Asperger-Syndrom, einer milden Form des Autismus. Dafür gab es keinerlei Beweis, doch die Experten zogen aus dem Studium der »Bewegungsmuster« Putins die Folgerung, die »neurologische Entwicklung« des russischen Präsidenten habe »in seiner Kindheit eine gravierende Unterbrechung erlitten«. Die »Chefexpertin« Brenda Connors behauptete, die »Schwierigkeit, zutreffende Echtzeitinformationen über Russland und seine Führer zu bekommen«, habe »die Verwendung der Analyse von Bewegungsmustern für die US-Behörden äußerst wichtig gemacht«. Offenbar hoffte das Pentagon, aus der »Körpersignatur« von Putins »Zusammenspiel von Haltung und Gestik« mehr über seine »Denkprozesse« zu erfahren als durch Aufmerksamkeit gegenüber dem, was er tatsächlich sagte.23 Das scheint Putins Aussage Recht zu geben, die Führer der USA behandelten den Rest der Welt, als würden sie mit Laborratten experimentieren. Die US-Politik gegenüber Russland bis zur Krise von 2014 war so widersprüchlich, dass es fast scheint, als hätte es gar keine klare Politik gegeben. Sie war kollegial, wenn es darum ging, »niedrig hängende Früchte zu pflücken«, und ansonsten feindselig. Insgesamt kann man diese Politik als Kombination von Einschüchterung und Subversion zusammenfassen, die in unterschiedlichem Maß und unterschiedlicher 169 Mischung nicht nur gegenüber Russland, sondern so gut wie gegenüber allen Ländern angewendet wird. Während des Kalten Krieges bezichtigten die USA Moskau der Unterstützung der Subversion durch Kommunisten, die angeblich versuchten, »die Regierung der Vereinigten Staaten durch Zwang und Gewalt zu stürzen« – etwas, das in Wirklichkeit weit jenseits der wildesten Träume der Kommunistischen Partei der USA lag. Heute tritt Russland für keine fremde politische Ideologie mehr ein und hat selbst eine freie Marktwirtschaft und ein Mehrparteiensystem eingeführt, während die Vereinigten Staaten aktiv diverse Gruppen fördern, die den Sturz des gewählten Präsidenten Russlands anstreben. Die Ironie, die in dieser Rollenumkehr liegt, ist weitgehend unbemerkt geblieben. Während die USA sich in grundlosen Anklagen ergehen, der äußerst populäre gewählte russische Präsident sei ein »Diktator«, und jeden exzentrischen Oppositionspolitiker als Inkarnation der wahren Demokratie betrachten, behandeln sie Russland außerdem als mögliches militärisches Ziel, indem sie ihre NATO-Spielfiguren immer weiter vorschieben, Militärmanöver an Russlands Grenzen durchführen und einen Raketenschirm aufbauen, dessen einzig plausibler Sinn darin besteht, den USA durch den Schutz des Westens vor einer russischen Vergeltung die nukleare Erstschlagkapazität zu geben. Man sollte sich erinnern, dass Washington im Gegensatz zu Moskau immer sein besonderes »Recht« verkündet hat, zuerst Atomwaffen ein-zusetzen.24 Der nur zu durchsichtige Vorwand, der Raketenschirm solle einzig der Verteidigung des Westens gegen den Iran dienen, wurde 2014 fallen gelassen, als die Ukrainekrise Washington den lange gesuchten Grund für eine offen feindselige Aufrüstung gegen Russland lieferte. Die meisten US-Bürger haben mit Sicherheit noch nie etwas von der militärischen Gefährdung Russlands durch die USA gehört, besonders, da die US-Führung dies immer wieder abstreitet und so tut, als könne nur Verfolgungswahn die Russen dazu bringen, sich durch ein nettes Land wie Amerika bedroht zu fühlen. Um etwas über die fast täglichen provokanten Militärübungen zu erfahren, die von diversen Mischungen aus NATOStreitkräften und ihren Partnern (wie Schweden und Georgien) rings um die russischen Grenzen abgehalten werden, muss man auf Quellen wie die von Rick Rozoff betriebene Internetseite »Stop NATO« zurückgreifen. Die Massenmedien ignorieren diese Operationen, obwohl sie offensichtlich Manöver zur Vorbereitung eines Krieges gegen Russland sind. Und wenn Russland schließlich auf die ständigen Drohungen reagiert, stellen dieselben Medien diese Reaktion als grundloses 170 Ausagieren paranoider Feindseligkeit hin. Die Rücksichtslosigkeit, mit der die Vereinigten Staaten ihre Militärallianz vor Russlands Haustür zur Schau stellen, kann den Eindruck erwecken, als plane Washington tatsächlich, Krieg gegen Russland zu führen. Aber in der Praxis haben die USA seit ihrer Niederlage in Vietnam immer dafür optiert, wesentlich schwächere Länder anzugreifen, die kaum Abwehrmittel gegen die Art von Luftangriffen haben, wie sie für die USA typisch sind. Dennoch waren die Resultate wenig beeindruckend. Es ist absurd zu glauben, dass ein Militär wie das der USA, das nicht in der Lage war, den Irak, Libyen oder Afghanistan zu »befrieden«, bei der Eroberung Russlands weiter käme als Napoleons mächtige Armeen oder die Wehrmacht. Historisch gesehen haben die Russen, vorsichtig und auf Verteidigung bedacht, immer gezögert, Kriege zu beginnen, obwohl sie die tatsächlichen Kriege meist gewonnen haben. Sehr wahrscheinlich zählt die US-Führung darauf, dass die Vorsicht der Russen ihnen erlauben wird, mit ihren Provokationen davonzukommen, und dass sie sogar lieber zurückzustecken werden, als einen Atomkrieg zu riskieren. Vielleicht sollen die militärischen Drohungen und Einschüchterungen eine psychologische Wirkung erzielen, indem sie die derzeitigen Führer schwächen und in Verlegenheit bringen, und der inneren Subversion – der wichtigsten Waffe im Arsenal der »Smart Power« – Beihilfe leisten. Aber die klare Gefahr veranlasst Russland natürlich auch zur Ergreifung defensiver militärischer Maßnahmen, was die Möglichkeit eines fatalen Zwischenfalls erhöht, der zum Krieg führt. Ziel der USA ist offensichtlich ein »Regimewandel«, eine Bewegung, die Putin stürzen und ihn durch gefügigere Führer ersetzt. Aber wozu? Russland hat unter Putin ohnehin versucht, als Partner mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Das Ziel, wenn es denn eines gibt, ist vielleicht, die Konflikte an den Rändern Russlands statt zur Eroberung zur Destabilisierung zu nutzen, also ein Chaos zu schaffen, das zum Zerfall des Landes führt; ganz so, wie es in anderen Ländern geschehen ist, die zu Opfern von US-Aggressionen wurden. Vielleicht hofft man darauf, dass schwächere Führer Russland genau wie einst Jugoslawien verwundbar für eine – kräftig unterstützte -Desintegration entlang ethnischer Linien machen würden. Dann würde das riesige Territorium des Landes leichter zu beherrschen sein, auch der Zugriff auf seine enormen Ressourcen wäre leichter. In Wirklichkeit wird jeder mögliche Nachfolger dem Westen sehr wahrscheinlich wesentlich feindseliger gegenüberstehen als der im Kern liberale Putin. Die krassen Drohungen aus dem Westen werden fast 171 mit Sicherheit zur Stärkung nationalistischer und autoritärer Tendenzen führen. Russland und der Nahe Osten Russland ist derzeit das bevorzugte Ziel zweier mächtiger Strömungen des außenpolitischen Establishments der USA: der Brzeziński-Schule und der Neokonservativen. Sie kommen aus sehr unterschiedlichen Richtungen, doch ihre Strategien stimmen letztlich überein. Zbigniew Brzeziński wurde 1928 in Warschau geboren und steht für einen traditionell russophoben polnischen Nationalismus. Die aristokratische Familie seines Vaters stammte aus Galizien, einer Region, die historisch »ständig wechselnden Staatsgebilden«25 angehörte, darunter Polen und das Habsburgerreich, und die jetzt das Zentrum eines extremen ukrainischen Nationalismus ist. Als ausgesprochener Kritiker des Einflusses der Israel-Lobby im US-Kongress hat Brzeziński einmal gesagt, er sehe keine »logische Verpflichtung der Vereinigten Staaten, wie ein dummes Maultier allem zu folgen, was Israel tut«26. Demgegenüber fühlen sich die Neocons gegenüber Israel sehr tief verpflichtet, und viele von ihnen sind Bürger sowohl der USA als auch Israels. Gemein haben die beiden strategischen Schulen ihre Bereitschaft, den sunnitisch-islamischen Extremismus als kleineres Übel auszubeuten – gegen Russland im Falle Brzezińskis, gegen den arabischen Nationalismus oder den Iran im Fall der Israel-Fans. Viele Neocons hegen einen alteingesessenen Groll gegen das zaristische Russland als Land der Pogrome.27 Brzeziński hatte lange voller Hoffnung auf ein Wachstum des militanten Islams entlang des »weichen Unterleibs« der UdSSR gewartet, der riesigen Region, die er den »eurasischen Balkan« nannte. Für ihn war es der perfekte Weg zur Schwächung Russlands: »Eine islamische Wiedererweckung, die bereits von außen her vom Iran, aber auch von Saudi-Arabien Unterstützung erfährt, wird wahrscheinlich aggressive Nationalismen beflügeln, die jeglicher Reintegration unter russischer – und mithin ungläubiger – Herrschaft entschiedenen Widerstand entgegensetzen.«28 Als Chefstratege Jimmy Carters spielte Brzeziński die Rolle des Geburtshelfers für Osama bin Ladens al-Qaida. Die CIA unterstützte die 172 islamischen Mudschaheddin als unverzichtbar für Brzezińskis Strategie, die Sowjetunion erst nach Afghanistan zu locken, nur um sie dann von dort wieder vertreiben zu können. »Je schlimmer, desto besser« hätte der Slogan dieser Art von US-Nahostpolitik lauten können, die mit der Bewaffnung der Mudschaheddin mit Waffen wie den Stinger-Raketen begann, damit sie sowjetische Flugzeuge abschießen konnten. Am Ende stand Afghanistan wesentlich schlechter da, als es unter sowjetischem Einfluss der Fall gewesen wäre. Besonders in der Frage, die für US-Politiker so überaus bedeutend wurde, als sie ihre eigene Invasion einige Jahre später zu rechtfertigen suchten: die Frauenrechte. Die Sowjets unterstützten Bildung und soziale Befreiung der Frauen – einer der Hauptgründe, weshalb die lokalen Schützlinge Brzezińskis sie vertreiben wollten.29 Hillary Clintons Feminismus reichte nie so weit, um diese Facette der sowjetischen Politik zu erfassen. Brzeziński betrachtete Afghanistan als Bindeglied zum muslimischen »weichen Unterleib« der Sowjetunion, einer potentiellen Quelle von Chaos, die sich nach Norden hin ausbreiten und Moskau destabilisieren könnte. Als das kommunistische Imperium dann zusammenbrach, blieb das Ziel dasselbe, nur das es nun einen alten Namen trug: Russland. Für die Neokonservativen war die wichtigste Aufgabe, die Interessen Israels und die der USA zu einer einzigen Strategie zusammenzuführen. Der historische Feind Israels war der arabische Nationalismus, der das Ziel verfolgte, die arabische Nation – zu der theoretisch auch Palästina gehörte – zu vereinen. Ursprünglich stand Washington dem arabischen Nationalismus gar nicht feindselig gegenüber. Im Mai 1948 erkannte Präsident Truman aufgrund innenpolitischen Drucks Israel an, doch das außenpolitische Establishment betrachtete die ölreiche arabische Welt als für die US-Interessen wesentlich wichtiger.30 Es dauerte lange, bis die Freunde Israels sich in den USA mit ihrer Auffassung durchsetzen konnten, Hauptpriorität in der Region müsse die Verteidigung Israels sein. Dabei arbeiteten sie hauptsächlich mit dem Mittel kultureller und ideologischer Identifikation. Erzählungen wie der Film »Exodus« 1960 untermalten die implizite Parallele zwischen der US-Besiedlung durch die Pioniere und der Geschichte Israels, was die Allianz mit Israel zu einer Sache »unserer Ideale« machte, die sogar noch höher stand als »unsere Interessen«. In den letzten Jahren hat der neokonservative Einfluss in Washington die Interessen der USA und Israels um das grandiose Projekt herum vereint, der Welt die Demokratie zu bringen, indem man »Diktatoren« stürzt – rein zufälligerweise solche, die die Palästinenser unterstützten. 173 Der vom Neocon-Veteranen Richard Perle 1996 verfasste Bericht für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu mit dem Titel »Ein klarer Schnitt«31 forderte den Sturz Saddam Husseins als ersten Schritt einer Serie von Regimewandeln, mit der die Regimes im Nahen Osten, die Israel als seine größten Feinde betrachtete, beseitigt würden. Obwohl die Neokonservativen meist mit der Administration George W. Bushs in Verbindung gebracht werden, die sie mit ihrer Propaganda erfolgreich zur Invasion des Irak brachten, lancierte das »Project for the New American Century« (PNAC)32 sein Programm schon während der zweiten Clinton-Administration. Das war die »Prinzipienerklärung« vom 3. Juni 1997.33 Sie forderte von den USA, »ein neues, für die amerikanischen Interessen und Prinzipien günstiges Jahrhundert zu schaffen«. Bei diesen »Prinzipien« handelte es sich um eine extrem aggressive Interpretation des US-amerikanischen Ausnahmestatus: »Amerikas einzigartige Rolle bei der Erhaltung und Ausdehnung einer internationalen Ordnung, die für unsere Sicherheit, Prosperität und Prinzipien günstig ist.« Das erforderte erhöhte Verteidigungsausgaben, die Festigung von Militärbündnissen und Regimewandel, Letzteres angeblich zur Förderung »politischer und wirtschaftlicher Freiheit im Ausland«. 1998 legte das PNAC noch einmal nach und forderte Präsident Clinton dazu auf, Saddam Hussein zu stürzen. Dies lief darauf hinaus, die USA zur Beseitigung der Feinde Israels aufzurufen, die als Gefahren sowohl für die USA als auch für den Rest der Welt porträtiert wurden. Als Senatorin übernahm Hillary Clinton die Linie der Neocons, indem sie 2003 für die Invasion des Irak stimmte. Nachdem dieser Krieg extrem unpopulär geworden war, äußerte sie Bedauern, aber diese neuen Zweifel veranlassten sie nie, sich gegen weitere US-Aggressionen im Nahen Osten auszusprechen. Im Gegenteil, nachdem sie selbst eine Schlüsselrolle bei der Zerstörung Libyens gespielt hat, brüstet sie sich nun damit, von Obama eine verstärkte Unterstützung für die Rebellen in Syrien verlangt zu haben, die dort versuchen, die Regierung zu stürzen. Zusammen mit Führern der Türkei und General David Petraeus unterstützte sie Pläne, »gemäßigte syrische Rebellen zu bewaffnen und auszubilden«, während Obama skeptisch war.34 Das Programm wurde dennoch versucht und endete in einem völligen Fiasko. Die nahöstlichen Kriege für »Regimewandel« haben sich genau die säkularen nationalistischen Regimes zum Ziel auserkoren, die Israel loswerden wollte. Der einzig vorstellbare Vorteil dieser Politik für die USA wäre gewesen, die Kontrolle über die Ölressourcen dieser Länder 174 zu gewinnen. Das ist die Erklärung, die verschiedene Anhänger des Wirtschaftsdeterminismus bevorzugen. Dazu muss gesagt werden, dass das Chaos, das diese Kriege erzeugten, eine normale Ausbeutung von Ölressourcen praktisch unmöglich gemacht hat. Unsere angeblichen »Werte« haben unsere Interessen besiegt. Der Bürgerkrieg in Syrien hat nun die proisraelischen und die antirussischen Züge der US-Außenpolitik zusammengeführt, da Russland der direkten US-Intervention in diesem Land im Wege stand. Russland unterhält seit vielen Jahren Beziehungen zu Syrien, die sich neben einer Marinebasis auch in vielen persönlichen Kontakten widerspiegeln. Nachdem die angeblich Verteidigungszwecken dienende »Flugverbotszone« dazu benutzt worden war, einen gewaltsamen Regimewandel anzustreben, stellten Russland und China klar, dass sie jeglichen Versuch, R2P als Vorwand für eine Zustimmung des UNSicherheitsrats zu einer US-Militärintervention zu verwenden, blockieren würden. Ihr gemeinsames Veto brachte die Kriegerinnen in der USRegierung zu ganz undiplomatischem Wüten und Geschrei. Die UN-Botschafterin Susan Rice bezeichnete das Veto Chinas und Russlands als »widerwärtig und beschämend«. Russland und China, so erklärte sie, »haben sich gerade statt mit dem syrischen Volk, den Völkern des Nahen Ostens, den Grundsätzen des Restes der internationalen Gemeinschaft mit einem aus dem letzten Loch pfeifenden Diktator verbündet«. Sie warnte diese Staaten, sie würden ihre Entscheidung noch bereuen, wenn es erst einmal ein »demokratisches Syrien« gäbe, das diese Entscheidung nicht vergessen würde.35 Auf einer Versammlung der für eine westliche Intervention werbenden »Friends of Syria« im Februar 2012 bezeichnete Hillary Clinton das Doppel-Veto als »erbärmlich«: »Es ist wirklich ekelhaft zu sehen, wie zwei Mitglieder des Sicherheitsrats ihr Veto einsetzen, während Menschen ermordet werden – Frauen, Kinder, mutige junge Männer – und Häuser zerstört werden. Das ist einfach erbärmlich, und ich stelle die Frage, auf welcher Seite sie stehen. Sie stehen mit Sicherheit nicht auf der Seite des syrischen Volkes.«36 Welchen syrischen Volkes? Die Rebellen, die von der syrischen Regierung bekämpft wurden, waren von Anfang an überwiegend Islamisten gewesen, denen Assads säkulares Regime nicht passte. Ihre Kontrolle über die Rebellion hat sich seitdem beständig gefestigt. Ohne starken Rückhalt auch in der syrischen Bevölkerung hätte Ba-schar alAssad sich in diesem stark von außen unterstützten internationalisierten Krieg gegen sein Regime kaum so lange halten können.37 175 Wessen »Nullsummenspiel«? Seit etlichen Jahren bemühen sich die russischen Führer, mit dem Westen gegen den »islamischen Terrorismus« zu kooperieren. Allerdings müsste eine solche Kooperation mit einer ehrlichen Definition von Terror und einer Untersuchung seiner tatsächlichen Gründe und Varianten beginnen. Wenn die US-Regierung einer solchen Zusammenarbeit zugestimmt hätte, hätte sie den Bombenanschlag beim Boston-Marathon von 2013 vielleicht verhindern können. Die Russen hatten damals Kenntnisse über die Täter, die sie gerne weitergegeben hätten. Russland war in jüngster Zeit Ziel einiger besonders schrecklicher Massaker, unter anderem bei der Besetzung einer Schule in der Stadt Beslan in Nordossetien durch tschetschenische Terroristen im Jahr 2004, bei der 186 Kinder und 148 Erwachsene, größtenteils Eltern und Lehrer, umkamen. Nachdem die USA zugegeben hatten, dass die bewaffnete syrische Oppositionsgruppe Jabhat al-Nusra aus islamischen Terroristen bestand,38 warnte Wladimir Putin den Westen vor der Bewaffnung solcher Gruppen. Wer könne wissen, wo Waffen, die an die syrische Opposition geliefert werden, landen? Oder wie sie am Ende benutzt würden? »Wenn Assad heute verschwindet, entsteht ein politisches Vakuum – wer wird es füllen? Vielleicht diese terroristischen Organisationen«, sagte Putin auf einer Pressekonferenz im Juni 2013. »Wie kann man das vermeiden? Schließlich sind sie bewaffnet und aggressiv.«39 Weit davon entfernt, alles als »Nullsummenspiel« zu sehen, wie Hillary Clinton behauptete, drängte Putin die Vereinigten Staaten, mit Russland bei der Suche nach einer friedlichen Lösung zusammenzuarbeiten. Kurze Zeit darauf waren die russischen Bemühungen, zum Nutzen aller eine Pause bei diesem Töten zu erreichen, vorübergehend so erfolgreich, dass viele Beobachter rund um die Welt schon hofften, Zeugen des Beginns eines echten diplomatischen Prozesses zur Beendigung des Krieges zu sein, der Syrien verwüstete. Am 21. August 2013 führten rätselhafte Chemiewaffenangriffe auf die von den Rebellen gehaltenen Vororte von Ost-Damaskus zu zahlreichen Ziviltoten. Wie üblich gaben die westlichen Politiker und Medien sofort den Truppen Assads die Schuld. Doch im Lauf der Zeit fand eine Reihe seriöser unabhängiger Untersuchungen überzeugende Hinweise darauf, dass die Sarin-Angriffe das Werk von al-Nusra-Rebellen waren.40 Diese hatten sowohl die Fähigkeit als auch das Motiv, unter »falscher Flagge« 176 eine Attacke mit Chemiewaffen durchzuführen, die dann just im Moment des Eintreffens internationaler Inspektoren in Damaskus Assad in die Schuhe geschoben würden. Da Obama zuvor den Einsatz von Chemiewaffen als »rote Linie« bezeichnet hatte, die Assad nicht »ohne Folgen« übertreten dürfe, brachte die Mär von der Verantwortung der syrischen Regierung Obama in eine Lage, in der er eigentlich mit einem Vergeltungsschlag reagieren musste. Und so bereiteten die USA, Großbritannien und Frankreich sich auf Luftangriffe zur Bestrafung der syrischen Regierung vor. Das Fehlen solider Beweise, offizielle Dementis aus Damaskus oder selbst konkrete Hinweise darauf, dass die Rebellen verantwortlich waren, waren nicht genug, um die Bombardierung durch die westlichen Alliierten abzuwenden. Aber ausnahmsweise reagierte die öffentliche Meinung im Westen diesmal heftig gegen die Pläne, einen weiteren Krieg im Nahen Osten zu führen. Am 30. August 2013 wies das britische Unterhaus nach einer lebhaften Diskussion die Vorlage der Regierung zur Autorisierung von Luftschlägen ab. Als Obama mit demselben Ansinnen an den Kongress herantrat, wurden die Abgeordneten mit Anrufen und Botschaften ihrer Wähler überflutet, die von ihnen verlangten, mit Nein zu stimmen. Obama verkündete trotzdem weiterhin, »wir« wüssten, »dass Assad verantwortlich war«, und müssten »handeln«, um weitere Chemiewaffenangriffe zu verhindern. Doch die Reaktion der Öffentlichkeit ließ darauf schließen, dass der US-Präsident genau wie vorher der britische Premierminister David Cameron im Parlament auf eine schwere Niederlage zusteuerte. Zu dieser Zeit veröffentlichte das Büro von Ex-Außenministerin Hillary Clinton eine Erklärung zur Unterstützung der Bemühungen Obamas, »den Kongress an einer starken und zielgerichteten Antwort auf den erschreckenden Einsatz von Chemiewaffen durch das Assad-Regime zu beteiligen«41. Ihre öffentliche Erklärung einige Monate zuvor, derzufolge Assads Chemiewaffen leicht in die Hände von Rebellengruppen fallen könnten, hatte Hillary scheinbar rasch vergessen.42 An diesem Punkt erinnerten sich die Russen, wie jemand, der einem Ertrinkenden mit einem hingehaltenen Ast hilft, dem Sturm zu entkommen, an eine Bemerkung, die Hillary Clintons Nachfolger John Kerry nebenbei hatte fallen lassen. Auf die Frage, was Baschar al-Assad denn tun könne, um westliche Luftschläge zu verhindern, antwortete Kerry rhetorisch, der 177 syrische Führer könne ja seinen gesamten Vorrat an Chemiewaffen der internationalen Gemeinschaft übergeben, fügte aber hinzu, das werde er »nicht tun, und es ist nicht machbar«.43 Nun nahmen russische Diplomaten schnell Kontakt mit den Syrern auf, und diese entgegneten, es sei sehr wohl machbar. Und es wurde gemacht. Nach raschen und reibungslosen Verhandlungen und mitten in einem Krieg übergab die syrische Regierung tatsächlich in Rekordzeit ihr gesamtes Chemiewaffenarsenal an internationale Inspektoren. Das zeigte, was bei russisch-amerikanischer Zusammenarbeit alles erreicht werden kann. Die US-Entscheidung, zusammen mit Russland für die Abschaffung der Chemiewaffen Syriens zu sorgen, statt die Regierung des Landes zur Strafe für den angeblichen Einsatz dieser Waffen zu bombardieren, weckte Hoffnungen, das Schlimmste sei nun vorbei und der Friede in greifbarer Nähe. Wladimir Putin nutzte diesen Moment, um seiner Gewohnheit zu frönen, der Macht der USA zu ehrlich gegenüberzutreten. Vielleicht meinte er tatsächlich, er würde diesmal verstanden. Am 11. September 2013 veröffentlichte die New York Times unter dem Titel »Ein Aufruf zur Vorsicht aus Russland« einen Meinungsbeitrag Putins. Darin sprach der russische Präsident die Warnung aus: »Syrien erlebt keinen Kampf für Demokratie, sondern einen bewaffneten Konflikt zwischen Regierung und Opposition in einem multireligiösen Land. Es gibt nur wenige Streiter für Demokratie in Syrien.«44 Und weiter: »Die Söldner aus arabischen Ländern sowie Hunderte Krieger aus westlichen Staaten und sogar aus Russland, die dort kämpfen, erfüllen uns mit großer Sorge. Könnten sie nicht mit den Erfahrungen, die sie in Syrien gemacht haben, in unsere Länder zurückkehren? Schließlich zogen Extremisten, die in Libyen gekämpft hatten, weiter nach Mali. Das ist eine Bedrohung für uns alle.« Als Putins Warnung sich dann durch die Entstehung des Islamischen Staates im Irak und in Syrien mit seinen Enthauptungen oder die terroristischen Morde an den Charlie-Hebdo-Karikaturisten vom 7. Januar 2015 bewahrheitete, war sie allerdings längst vergessen, und Putin selbst wurde noch heftiger dämonisiert als Assad. Russland, insistierte Putin in seinem Beitrag, schütze nicht irgendeine bestimmte syrische Regierung, sondern das Völkerrecht: »Es ist beängstigend, dass es für die Vereinigten Staaten zur Gewohnheit geworden ist, militärisch in innere Konflikte anderer Staaten einzugreifen. Ist 178 das in Amerikas langfristigem Interesse? Ich bezweifle das. Millionen in der ganzen Welt sehen in Amerika kein Modell der Demokratie, sondern ein Land, das ausschließlich auf brutale Gewalt setzt und unter der Parole >Wer nicht für uns ist, ist gegen uns< Koalitionen zusammenschustert.« Andere Länder, so Putin weiter, reagierten darauf mit dem Versuch, sich Massenvernichtungswaffen zu verschaffen, um sich verteidigen zu können. Um die Weiterverbreitung dieser Waffen zu verhindern, sei es nötig, »aufzuhören, die Sprache der Gewalt zu sprechen, und auf den Pfad zivilisierter diplomatischer und politischer Verständigung zurückzukehren«. Putin sagte vorher, ein »gemeinsamer Erfolg« in der Frage der Chemiewaffen könne die Tür für eine Zusammenarbeit bei anderen kritischen Themen öffnen. Er begrüßte das, was er als »wachsendes Vertrauen« in sein Verhältnis zu Präsident Obama beschrieb, wagte aber dann, sich von Obamas Erklärung abzugrenzen, es sei die Politik der USA, »die Amerika von anderen unterscheidet. Sie ist es, die uns zu etwas Außergewöhnlichem macht.« Im Gegensatz dazu schloss der russische Präsident: »Es ist extrem gefährlich, jemanden, aus welchem Grund auch immer, zu etwas Außergewöhnlichem zu machen. Es gibt große Länder und kleine, reiche und arme, jene mit langen demokratischen Traditionen und jene, die noch im Begriff sind, ihren Weg zur Demokratie zu finden. Auch ihre Politik unterscheidet sich. Wir sind alle verschieden, aber wenn wir um Gottes Segen bitten, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott uns alle gleich geschaffen hat.« Dieser Appell vom September 2013 für Gleichheit löste bei der politischen Klasse der USA kollektive Wut aus. Putin war hier viel zu optimistisch. Der russische Vorschlag zur Beseitigung der syrischen Chemiewaffen erwies sich tatsächlich als vollständiger Erfolg. Er verhinderte westliche Bombenangriffe auf Syrien im Jahr 2013. Er öffnete tatsächlich die Tür zu einer echten internationalen Kooperation, durch die das Blutvergießen in Syrien hätte beendet werden können. Aber kein einziger führender westlicher Politiker beschloss, durch diese Tür zu gehen. Ganz im Gegenteil. Das norwegische Nobelkomitee verlieh den Friedensnobelpreis für das Jahr 2013 an die internationale »Organisation für das Verbot von Chemiewaffen«, weil sie »die Anwendung chemischer Waffen unter internationalem Recht zu einem Tabu gemacht« habe.45 Das war ein 179 bequemer Weg, der russischen Diplomatie keinen Dank für ihre Leistung in Syrien zollen zu müssen. Im September 2013, als Russland Obama vor einer möglichen Niederlage im US-Kongress rettete und den Weg zu einer erfolgversprechenden Diplomatie aufzeigte, plante die westliche Elite bereits einen heftigen Schlag gegen Russland selbst. The Economist schrieb, die Zukunft der Ukraine und Europas werde »gerade in Echtzeit entschie-den«46, nämlich bei einer Versammlung in demselben Palast in Jalta auf der Krim, in dem Roosevelt, Stalin und Churchill sich 1945 trafen, um über die Zukunft Europas zu entscheiden. Bill und Hillary Clinton, Ex-CIA-Chef David Petraeus, Ex-Schatzminister Larry Summers, Ex-Weltbankpräsident Robert Zoellick, der schwedische Außenminister Carl Bildt, Schimon Peres, Tony Blair, Gerhard Schröder, Dominique Strauss-Kahn, Mario Monti und Polens einflussreicher, in Oxford ausgebildeter Außenminister Radek Sikorski waren unter den anwesenden Würdenträgern. Am 20. September stellte Gastgeber Viktor Pint-schuk, ein jüdischer Oligarch, der als zweitreichster Mann der Ukraine gilt und Gründer der Yalta-European-Strategy-Konferenz (YES) ist, Hillary Clinton vor ihrem Abendvortrag über »Führung« vor, indem er sich an ihren Mann Bill wendete: »Herr Präsident, Sie sind wirklich ein Superstar, aber Außenministerin Clinton – sie ist ein echter, echter Megastar.« Hillary nutzte die Gelegenheit zur Prophezeiung, dass »die Produkte der Ukraine, darunter ihre wundervolle Schokolade, überall auf der Welt empfängliche Märkte finden werden«. Der letzte Wink galt dem Schokoladen-Oligarchen und zukünftigen Präsidenten von Gnaden der USA, Petro Poroschenko, der ebenfalls anwesend war, genau wie der amtierende Präsident Viktor Janukowitsch, der keine Ahnung hatte, dass diese Konferenz Teil der Prozesse war, die ihn fünf Monate später aus dem Amt vertreiben würden. Besonders wichtig war die Anwesenheit des ehemaligen USEnergieministers Bill Richardson, der gekommen war, um über die Schiefergasrevolution zu diskutieren, die die USA zur Schwächung Russlands einzusetzen hofften, indem sie den Erdgasexporten Russlands Fracking entgegensetzten. Zentrum der Diskussion waren das Abkommen »Deep and Comprehensive Free Trade Area«47 (DCFTA) zwischen der Ukraine und der Europäischen Union und die Aussichten einer Integration der Ukraine in den Westen. Es herrschte allgemeine Euphorie angesichts der Aussicht, die Ukraine werde ihre Bindungen zu Russland zugunsten des Westens aufgeben. Ironisch daran ist, dass Präsident Januko-witsch, obwohl mit 180 Unterstützung der insbesondere in der Ostukraine stark vertretenen Partei der Regionen gewählt, die Hoffnung hegte, durch dieses Handelsabkommen mit der Europäischen Union seine politische Basis zu verbreitern. In einer für die Mittelmäßigkeit der politischen Klasse der Ukraine typischen Weise hatte Janukowitsch schlicht den Widerspruch zwischen den Bedingungen des DCFTA und dem Überleben der industriellen Basis der Ostukraine nicht verstanden, die völlig von Exporten nach Russland abhängig war. Ebenfalls anwesend war jedoch Putins Berater Sergei Glasjew, der warnte, das geplante Handelsabkommen werde einen negativen Einfluss auf die ukrainische Wirtschaft haben. Glasjew wies auf das enorme, durch Auslandsanleihen finanzierte Außenhandelsdefizit der Ukraine hin und erklärte, der im DCFTA vorgesehene erhebliche Anstieg westlicher Importe könne dieses Defizit nur vergrößern. Die Ukraine werde »entweder ihre Schulden nicht bedienen können oder eine umfangreiche Rettungsaktion brauchen«. Der berichtende For-bes-Reporter meinte, die russische Position sei »viel näher an der Wahrheit als die Fensterreden Brüssels oder Kiews«48. Glasjew warnte weiter vor den innenpolitischen Konsequenzen einer Westintegration. Die russischsprachige Bevölkerung des Donbass genannten Donezk-Beckens in der Ostukraine, das den industriellen Kern des ganzen Landes bildete, verdanke ihre anhaltende Prosperität dem Handel mit Russland. Da dieser durch die Regeln des DCFTA in Gefahr gerate, könne der Bevölkerung dort am Ende eine Trennung von der Ukraine lieber sein, als ihre besonders engen Beziehungen zu Russland in Frage zu stellen, so seine Warnung. Die Interventionsanhänger in den USA konnten kaum übersehen, dass ihre Pläne zur Westintegration der Ukraine Probleme schaffen würden, und offensichtlich war es genau das, was sie wollten: Probleme für Wladimir Putin. Carl Gershman, dessen Rolle als Präsident des NED in der demonstrativen »Förderung von Demokratie« auf der ganzen Welt besteht, jubelte, die Aufnahme der Ukraine in die westliche Welt werde ein Schlag gegen Russlands gewählten Präsidenten sein. In einem Kommentar in der Washington Post vom 26. September 2013 schrieb Gershman, die Entscheidung der Ukraine, sich Europa anzuschließen, werde »den Niedergang der Ideologie des russischen Imperialismus, den Putin repräsentiert, beschleunigen. […] Putin könnte sich bald nicht nur im benachbarten Ausland, sondern auch in Russland selbst auf der Verliererstraße wiederfinden.«49 Die Hauptbotschaft war: Der Verlust der Ukraine werde den Stand und die politische Popularität Putins in 181 Russland schwächen. Janukowitschs ehemaliger Premierminister Mykola Asarow beschrieb die Ukraine später als »Rammbock«50, der gegen Russland eingesetzt worden sei. Laut der Brzeziński-Doktrin kann Russland ohne die Ukraine kein wichtiges Imperium sein. Die Ukraine aus dem Einfluss Russlands zu lösen, war immer ein langfristiges Ziel des Westens. Dabei ging es insbesondere darum, das Land in die NATO zu bringen und so die Kontrolle über den russischen Marinestützpunkt am Schwarzen Meer in Sewastopol auf der Krim zu erlangen. Die traditionelle Feindschaft der Westukraine gegenüber Russland ist ein politisches Pfund, mit dem die USA und ihre Geheimdienste seit Ende des Kalten Krieges wuchern. Die Ukraine verstehen Die Ukraine, ein Wort, das übersetzt »Grenzland« bedeutet, ist ein Land ohne klar definierte historische Grenzen, das zu weit nach Osten und zu weit nach Westen ausgedehnt wurde. Sie wurde zu weit nach Osten ausgedehnt und umfasste dann Gebiete, die vorher russisch gewesen waren, offenbar um klarzumachen, wie sehr die UdSSR sich vom zaristischen Reich unterschied, und um zu zeigen, dass die Sowjetunion wirklich eine Union gleicher sozialistischer Republiken war. Solange die Sowjetunion als Ganzes von der kommunistischen Führung beherrscht wurde, waren diese Grenzen nicht von großer Bedeutung. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie zu weit nach Westen ausgedehnt. Die siegreiche Sowjetunion erweiterte die Grenzen der Ukraine so, dass nun auch neue westliche Gebiete dazugehörten, darunter besonders Galizien, dessen Zentrum eine Stadt mit sehr verschiedenen Namen ist: Lviv, Lwow, Lemberg oder Lvov, je nachdem, ob sie gerade zu Litauen, Polen, dem Habsburger Reich oder der UdSSR gehörte. Die Region war Brutstätte eines rassistischen ukrainischen Nationalismus, der von den polnischen und dann den habsburgischen Herrschern gefördert wurde, um jede Identifikation der Bevölkerung mit Russland zu verhindern. Dieser Nationalismus äußerte sich in neu geschaffenen sprachlichen und religiösen Varianten des russischen Originals51 und einer mehr oder weniger mythischen ukrainischen Geschichtsschreibung. Vielleicht haben die verworrenen Loyalitäten dieser Grenzregion zu einem übersteigerten Gefühl der Zugehörigkeit zu einer gerade erst 182 definierten ukrainischen Identität geführt, die ihre Anhänger jetzt der gesamten, soeben unabhängig gewordenen Nation aufzwingen wollen. Die Ukraine, so ein Kommentator »ist […] ein gespaltenes Land mit zwei unterschiedlichen Kulturen. Die kulturelle Bruchlinie zwischen dem Westen und der Orthodoxie verläuft seit Jahrhunderten durch ihr Herz«.52 Diese tiefe kulturelle Spaltung zwischen der Ost-und der Westukraine kann für die Entscheidungsträger der US-Politik kein Geheimnis gewesen sein. Sie wurde in exakt diesen Worten von dem bekannten außenpolitischen Berater Samuel Huntington formuliert, und zwar in seinem im Original 1996 erschienenen »bahnbrechenden« Buch Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, das im Washingtoner Politikestablishment als absolute Pflichtlektüre betrachtet wird. Die Ost-West-Spaltung der Ukraine, schrieb Huntington dort, habe sich »besonders dramatisch bei den Präsidentschaftswahlen von [Juli] 1994« ge-zeigt.53 Die Ukraine war damals erst seit zweieinhalb Jahren unabhängig von der Sowjetunion. In den dreizehn Provinzen der Westukraine gewann Leonid Krawtschuk, ein selbsternannter ukrainischer Nationalist, zum Teil mit über 90 Prozent. In den dreizehn Provinzen der Ostukraine gewann sein Widersacher Leonid Kutschma mit ganz ähnlichen Mehrheiten. Am Ende siegte Letzterer mit einer scheinbar ausgewogenen Mehrheit von 52 Prozent – in einem radikal gespaltenen Land. So hat es in der Ukraine seitdem immer ausgesehen. Besonders bedeutsam sind die Bemerkungen Huntingtons über die Krim. Im Mai 1992, nur Monate nach der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion, »votierte das Parlament der Krim […] für die Unabhängigkeit der Krim von der Ukraine, um danach auf Druck der Ukraine diesen Beschluss zu widerrufen«54. Auch das russische Parlament votierte dafür, die Abtretung der Krim an die Ukraine rückgängig zu machen, die Chruschtschow 1954 ohne Befragung der Bevölkerung vorgenommen hatte. Kurz, die Frage der Trennung der Krim von der Ukraine und ihrer Rückkehr nach Russland war nach der ukrainischen Unabhängigkeit schon wiederholt gestellt worden. Dass die Krim die alten Pläne, sich von der Ukraine zu trennen und zu Russland zurückzukehren, umsetzen würde, als der Putsch in Kiew ein antirussisches Regime an die Macht brachte, sollte und konnte für niemanden mit einer auch nur lückenhaften Kenntnis der Region eine Überraschung sein. Außerdem machte Huntington einige interessante Vorhersagen. Er hielt »Gewalt zwischen Ukrainern und Russen [für] unwahrscheinlich«, da das 183 zwei slawische, überwiegend orthodoxe Völker seien, die seit Jahrhunderten enge Beziehungen unterhalten hätten, zu denen häufige Mischehen gehörten. Das erwies sich leider als falsch. Huntington machte jedoch auch auf »die etwas wahrscheinlichere Möglichkeit« aufmerksam, »dass die Ukraine entlang ihrer Bruchlinien in zwei Teile zerfällt, deren östlicher mit Russland verschmelzen würde«.55 Offensichtlich stellte er sich das als friedliche Entwicklung vor. Im Lichte dieser wohlbekannten Fakten ist es grotesker Unsinn zu behaupten, das Referendum von 2014 zur Rückkehr der Krim nach Russland sei nur der erste Schritt eines strategischen Plans von Wladimir Putin zur Invasion der westlichen Nachbarn Russlands, also Polens und der baltischen Staaten. Und doch ist das die wilde Geschichte, die die NATO verbreitete, um weiter zu behaupten, der Ausbau ihres Militärs in diesen Ländern diene dazu, diese vor einer russischen Aggression zu »verteidigen«. All die Vertreter westlicher Machtstrukturen, die dieses Märchen wiederkäuen, sind entweder dreiste Lügner oder schlicht zu ignorant für ihre derzeitigen Posten. Als die Ukraine durch den Zerfall der Sowjetunion 1991 ihre Unabhängigkeit gewann, zeigte sich umgehend die Ost-West-Spaltung des Landes an den Wahlergebnissen. Die Präsidentschaftswahlen waren immer Kämpfe zwischen Ost- und Westkandidaten. Ende 2004 lagen die Resultate der Präsidentschaftskandidaten Viktor Juschtschenko, dessen Stimmen im Westen konzentriert waren, und Viktor Januko-witsch, der vorwiegend im Osten gewählt wurde, so eng beieinander, dass ein zweiter Wahlgang abgehalten wurde. Als danach Januko-witsch zum Sieger erklärt wurde, lösten Behauptungen über Wahlfälschungen Massendemonstrationen für einen dritten Wahlgang aus, den Juschtschenko gewann. Die USA unternahmen viel für diese Demonstrationen, die aufgrund ihrer Banner als »Orange Revolution« bekannt wurde.56 Die Amtszeit Juschtschenkos erwies sich als enttäuschend und war durch ständigen Streit mit seiner politischen Alliierten Julia Timoschenko gekennzeichnet, einer korrupten Geschäftsfrau, die für ihren folkloristischen blonden Kunstzopf berühmt war und später wegen Unterschlagung und Machtmissbrauch verurteilt und in Haft gesteckt wurde. Im Laufe seiner Amtszeit fiel Jus-chtschenkos Popularität in den Keller und 2010 wurde sein Rivale Janukowitsch mit einer komfortablen Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Die US-Einmischung in die »Orange Revolution« hatte nie etwas mit der Unterstützung von Demokratie gegen Diktatur zu tun. Wer immer durch Wahlen an die Macht kam, die Ukraine wurde letztlich von 184 »Oligarchen« beherrscht, inzwischen äußerst reichen Unternehmern, die sich während des Zusammenbruchs der staatlichen Kommandoökonomie große Teil der Wirtschaft unter den Nagel gerissen hatten. Zugleich haben die USA mit ihrer Einmischung immer den Westen des Landes gegen den östlichen Teil unterstützt. Gerade weil die Ukraine so tief gespalten ist, bestehen die ukrainischen Nationalisten im Westen so fanatisch auf einer erzwungenen Einheit. Sie glorifizieren »die ukrainische Sprache«57 und schwelgen in einer mythischen antirussischen Version der Geschichte, die Antagonismen schürt. Im Lauf der letzten Jahre haben ukrainische Nationalisten, nicht zuletzt mit offizieller Unterstützung von Juschtschenko, energisch einen neuen Mythos propagiert, der sich auf die tragische Hungersnot stützt, die die Bauern der Sowjetunion 1932 und 1933 wegen der staatlichen Zwangsrequisition von Getreide erlitten, die der Zahlung der für eine rasche Industrialisierung aufgelaufenen Auslandsschulden diente. Historiker streiten über die Opferzahlen der Katastrophe, die sicher im Millionenbereich liegen und die sowohl die russischen als auch die ukrainischen bäuerlichen Regionen betraf. Seit einigen Jahren beuten ukrainische Nationalisten diese Tragödie für politische Zwecke aus und behaupten nun, die Opferzahlen seien Teil eines bewussten Plans gewesen, die ukrainische Nation auszurotten.58 In offener Konkurrenz zum Holocaust gedenkt man des Ereignisses nun als »Holodomor« und sagt, durch diese Hungersnot seien absichtlich bis zu zehn Millionen Ukrainer getötet worden, was die Ukraine zum Opfer »des größten Genozids der Geschichte« mache. Die große ukrainische Diaspora in Kanada (etwa 1,2 Millionen Menschen, die höchste ukrainische Bevölkerungszahl außerhalb Russlands und der Ukraine selbst) ist besonders eifrig im Gedenken an diesen »Völkermord« und übt politischen Druck auf die Regierung in Ottawa aus, sich der Anti-Putin-Kampagne anzuschließen (obwohl Putin hier ganz offensichtlich einmal nichts damit zu tun hatte). Im November 2013 wurde Präsident Janukowitsch verspätet klar, dass die Ukraine sich die Unterzeichnung von DCFTA ohne äußere finanzielle Hilfe gar nicht leisten konnte. Tatsächlich stellte der Vertrag mit der EU die Ukraine vor ein echtes Dilemma. Offensichtlich wollte Janukowitsch sowohl das Handelsabkommen mit der EU als auch die bestehenden Handelsabkommen mit Russland, aber das hätte gemeinsame Verhandlungen mit Russland über Handelsbedingungen und -standards erfordert, was die Europäer ablehnten. Russland seinerseits konnte den Europäern nicht erlauben, ihre Güter und Dienstleistungen über (wie Putin es später ausdrückte) »die Hintertür« der Ukraine zollfrei nach 185 Russland zu exportieren. Außerdem musste Janukowitsch die Sorgen seiner Wähler im Osten berücksichtigen, besonders da sein Hauptunterstützer, die Partei der Regionen, rund ein halbes Dutzend der von der EU verlangten Gesetzespakete ablehnte, darunter die Entlassung Julia Timoschenkos aus dem Gefängnis und ihre Ausreise nach Deutschland. Hinzu kam, dass der Internationale Währungsfonds nun Austeritätsmaßnahmen verlangte, die so unpopulär waren, dass Janukowitsch bei ihrer Durchführung die auf 2015 angesetzten Wahlen mit Sicherheit verloren hätte. Ende November 2013 kam Premierminister Mykola Asarow zu dem Schluss, das Land benötige mehr Zeit zum Umgang mit diesen widersprüchlichen wirtschaftlichen Erfordernissen. Daher legte Präsident Janukowitsch das DCFTA auf Eis – zur großen Enttäuschung vieler Ukrainer, die sich danach sehnten, »zu Europa zu gehören«. Die ukrainische Bevölkerung, die nicht verstand, worum es ging, weil es ihr nie verständlich erklärt worden war, reagierte mit Straßenprotesten. Die westlichen Politiker und Medien brandmarkten Januko-witsch daraufhin als Marionette Moskaus. Die Proteste auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz, die bald den Namen »Euromaidan« trugen, wuchsen im Lauf des Winters immer mehr an. Sie speisten sich aus einer Reihe von Missständen in diesem chronisch schlecht regierten Land. US-Vertreter heizten das gegen Janukowitsch und Russland gerichtete Potential der Bewegung offen an. Die für Europa und Eurasien zuständige Staatssekretärin im Außenministerium Victoria Nuland, der Senator und Vorsitzende des International Republican Institute John McCain und der französische Publizist Bernard-Henri Levy besuchten die Besetzer des Maidan, um die Ukrainer anzufeuern, sich gegen Wladimir Putin zu stellen. Victoria Nuland war ein wichtiges Mitglied des Hillary-Teams im Außenministerium gewesen. »Toria Nuland, meine unerschrockene Sprecherin«59, wie Hillary Clinton sie nannte, hatte das E-MailMemorandum mit den »Kernthesen«60 geschrieben, das eine wütende, durch einen US-Film, in dem der Prophet Mohammed beleidigt worden war, aufgebrachte Menschenmenge für den Angriff in Bengasi verantwortlich machte, bei dem US-Botschafter Chris Stevens getötet wurde. Die UN-Botschafterin der USA, Susan Rice, wurde dann zum Sündenbock, weil sie diese fadenscheinige Erklärung im US-Fernsehen wiederholt hatte. Victoria Nulands Ernennung zur Federführerin eines aggressiven USVorgehens in der Ukraine beweist die dauerhafte Rolle der 186 Neokonservativen in der US-Außenpolitik. Von Juli 2003 bis Mai 2005 war »Toria« stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin von Vizepräsident Dick Cheney. In seiner Autobiografie Duty beschrieb der Ex-Verteidigungsminister Robert Gates Cheneys Auffassung von Russland, die sehr wohl auch die damalige und heutige Sicht Nulands sein könnte: »Beim Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 erhoffte sich Dick nicht nur die Auflösung der Sowjetunion und des russischen Imperiums, sondern auch die Russlands selber, damit es nie wieder eine Gefahr für den Rest der Welt darstellen könnte.«61 Victoria Nuland ist die Frau Robert Kagans, des heute aktivsten und einflussreichsten Neokonservativen. Kagan war Gründer sowohl des PNAC (»Project for the New American Century«; siehe oben) als auch seines gegenwärtigen Nachfolgers, der »Foreign Policy Initiative«. Er begann seine Umtriebe Mitte der 1980er im politischen Planungsstab des Außenministeriums, wo er, laut der New York Times, »tief in die Politik der Reagan-Administration hinsichtlich der Rebellen in Nicaragua verstrickt war«62. Falls es noch irgendeinen Zweifel an der überparteilichen Natur der neokonservativen US-Außenpolitik geben sollte, kann man darauf verweisen, dass Kagan während des Präsidentschaftswahlkampfes 2008 außenpolitischer Berater John McCains war, bevor er von Hillary Clinton in den »Foreign Affairs Policy Board« des US-Außenministeriums übernommen wurde. Von Robert Kagan stammt der berühmte Vergleich: »Die Amerikaner kommen vom Mars und die Europäer von der Venus.« Damit meinte er, dass die Europäer, die vor nicht allzu langer Zeit noch zerstörerische Kriege auf eigenem Gebiet erlitten hatten, den Geschmack an der Sache verloren haben – im Gegensatz zu den USA, die es gewohnt sind, Krieg auf den Territorien anderer Völker zu führen. Die Meinung ihres Gatten über die transatlantischen Beziehungen scheint sich auch in den vier Worten zu spiegeln, die Victoria Nuland öffentliche Aufmerksamkeit einbrachten: »Scheiß auf die EU.« Sie fielen während eines Telefongesprächs mit dem Botschafter der USA in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, am 6. Februar 2014, in dem sie diskutierten, wer in der Ukraine an die Macht gebracht werden sollte. Die Partei der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die CDU, hatte sich für den ExBoxer Vitali Klitschko als ihren Kandidaten stark gemacht. Nulands Bemerkung bedeutete schlicht, dass es Vorrecht der USA und nicht etwa Deutschlands ist, den nächsten Führer der Ukraine zu bestimmen – und das sollte nicht Klitschko, sondern der Mann sein, den sie »Jaz« nannte: Arsenij Jazenjuk. Und tatsächlich sollte Jaz den Posten als 187 Premierminister auch bald bekommen. Der in den USA ausgebildete Jazenjuk ist ein Mann von bedrückender Farblosigkeit und wurde zweifellos wegen seiner Ergebenheit gegenüber der Austeritätspolitik des IWF, seinem Wunsch nach einem NATO-Beitritt und einem fast pathologischen Hass auf Russland ausgewählt. Letzterer zeigte sich unter anderem in seiner erstaunlichen Erklärung vom 7. Januar 2015, in der er sagte: »Wir können uns alle sehr gut an den Anmarsch der sowjetischen Truppen in der Ukraine und nach Deutschland erinnern.«63 Da er 1974 geboren ist, kann »Jaz« sich natürlich an nichts derartiges erinnern, gehört aber offenbar zu jener Schule ukrainischer Nationalisten, deren Russenhass sie so weit bringt, die massive Invasion der Sowjetunion durch die Wehrmacht, die auch die Ukraine zerstörte, schlicht zu übersehen, und stattdessen jener Kraft die Schuld am Krieg zu geben, die sich zur Wehr setzte und am Ende siegte, nämlich der Roten Armee. Ein wichtiger Aspekt des Nuland-Pyatt-Gesprächs war, dass sie erwähnte, sie habe gerade mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moons Stellvertretendem Generalsekretär für Politik Jeffrey Feltman gesprochen, der sich bemühe, die Vereinten Nationen mit ins Spiel zu bringen – natürlich auf Seiten der USA. Sie meinte, das sei »großartig, um das Ganze zusammenzuschweißen und die UN dazu bringen, dabei mitzumachen und, du weißt schon, scheiß auf die EU«64. Jeff Feltman war erst kurz zuvor Nulands Kollege im Team des US-Außenministeriums gewesen. Als Vize-Staatssekretär für Nahostfragen hatte er gemeinsam mit Hillary Clinton daran gearbeitet, den nötigen Druck auszuüben, um eine »Koalition der willigen« Araber zum Sturz des libyschen Staatschefs Gaddafi zustande zu bringen. Am 2. Juli 2012 wurde Jeffrey Feltman dann nach über dreißig Jahren im US-Außenministerium wichtigster politischer Berater des UN-Generalsekretärs. Das bedeutete, dass nunmehr ein US-Beamter die Aufgabe übernahm, Krisen zu analysieren, Ban Ki-moon zu beraten und den UN-Sicherheitsrat über die Lage in Syrien, Israel, Palästina und natürlich in der Ukraine zu informieren. So wurde alles Nötige arrangiert, um die internationale Reaktion auf die Ereignisse in der Ukraine zu steuern und Russland zu isolieren. Die Erschaffung des russischen Feindes Für einen Außenstehenden ist unmöglich zu sagen, wann, wie und von 188 wem die Entscheidung getroffen wurde, die Ukraine als »Rammbock« zur Destabilisierung Putins und Russlands zu benutzen. Nach der Rückkehr von einem ihrer zahlreichen Besuche in Kiew erklärte Victoria Nuland auf einer von der »U.S.-Ukraine Foundation« in Washington gesponserten internationalen Wirtschaftskonferenz am 13. Dezember 2013, die USA hätten seit der Auflösung der Sowjetunion über fünf Milliarden Dollar investiert, um sicherzustellen, dass die Ukraine »die Zukunft [bekommt], die sie verdient«.65 Gemeint war, sie ins westliche Lager zu ziehen. Teil dieser großen Summe waren sicher auch die Ausgaben für die »Orange Revolution« und andere, weniger hervorstechende Operationen. Die rücksichtslose Verfolgung des Regimewandels 2014 und die Einstimmigkeit des Chors in NATO-Land, besonders bei der Verbreitung einer absurd parteilichen Darstellung der Ereignisse, machen klar, dass hier eine Art fertig vorliegender Plan zur Ausführung kann. Gegenüber der Öffentlichkeit wurde die ganze Operation durch monatelange AntiPutin-Propaganda vorbereitet, die sich auf sexy Themen wie Pussy Riot und Schwulenrechte einschoss. Dabei war der US-Ansatz die ganze Zeit, die durch das DCFTA entstehenden Probleme einfach zu ignorieren, obwohl durchaus Verhandlungen und Kompromisse möglich gewesen wären. Stattdessen interpretierte man den Konflikt als Zusammenstoß zwischen dem »guten« Westen und dem »bösen« Chef der Russen, Wladimir Putin. Im Februar 2014 war es dann so weit: Die proeuropäischen Demonstrationen in Kiew, angespornt durch (auf dem Maidanplatz verteilte) Snacks von Victoria Nuland, die Unterstützung John McCains und die rhetorischen Ergüsse Bernard-Henri Levys, riefen, begleitet von westukrainischen, militanten, faschistischen und sogar offen neonazistischen Gruppen, zum Regimewandel auf. Während des gesamten Winters waren die Maidan-Proteste immer mehr durch rechtsextreme Gruppen militarisiert worden. Andrij Pa-rubij, Mitbegründer der Vorläuferorganisation der aus Anhängern des faschistischen Helden Stepan Bandera bestehenden Swoboda-Partei,66 wurde »Kommandeur« des Maidan und war fortan für »Sicherheit« zuständig. Die Gewalt wuchs an, und am 18. Februar griffen Rechtsextremisten das Kiewer Büro der Partei der Regionen an und steckten es in Brand, wobei zwei Menschen zu Tode kamen. Am 20. Februar schließlich brach im Zentrum Kiews die Hölle los und die Krise erreichte ihren Höhepunkt. Der Morgen begann mit einem Schusswechsel zwischen vorwärtsdrängenden »Demonstranten« und Mitgliedern des »Berkut«, der Sicherheitseinheit des Innenministeriums. 189 Als den Berkut-Truppen klar wurde, dass sie das Ziel versteckter Scharfschützen waren und nachdem drei ihrer Männer tot und mehrere verwundet waren, zogen sie sich zurück. Dann wurden mit Schild und Knüppel bewaffnete Demonstranten, denen das Maidan-Kommando den Weitermarsch auf einer vom Maidan-Platz abführenden breiten Straße befohlen hatte, einer nach dem anderen von unsichtbaren Scharfschützen erschossen, die von Gebäuden in der Nähe, hauptsächlich dem Hotel Ukraina, dem Hauptquartier der Maidan-Protestbewegung, aus feuerten. Widersprüchlichen Quellen zufolge wurden bei diesem rätselhaften Massaker zwischen fünfzig und hundert Demonstranten getötet und viele weitere verwundet. Die Oppositionsführer beschuldigten sofort Präsident Janukowitsch, er habe seinen Sicherheitskräften befohlen, die Demonstranten niederzumetzeln, und das war dann die Basis für seinen Sturz nur wenige Stunden später. Inmitten der entstandenen hysterischen Atmosphäre vermittelten drei Außenminister der EU, Guido Westerwelle aus Deutschland, Laurent Fabius aus Frankreich und Radosław Sikorski aus Polen, ein Abkommen zwischen Regierung und Oppositionsführern, mit dem der durch die Ereignisse bereits angeschlagene Janukowitsch zustimmte, für auf 2014 vorgezogene Neuwahlen zurückzutreten und die Verfassung entsprechend zu ändern. Doch schon am nächsten Tag, dem 22. Februar, floh Janukowitsch, der nun mit gutem Grund um sein Leben fürchtete, aus Kiew. Zuvor befahl er seiner Polizei noch den Abzug, was es den faschistischen Milizen, dem Rechten Sektor und der Swoboda-Partei ermöglichte, die Kontrolle über wichtige Gebäude zu übernehmen. Viele Mitglieder der Pro-RegierungsParteien verschwanden oder wurden »überzeugt«, sich der Opposition anzuschließen. Rechtsextreme nationalistische Gruppen verübten gewaltsame Angriffe auf Mitglieder der Kommunistischen Partei. Die im Parlament verbliebenen Abgeordneten entzogen Janukowitsch das Amt und riefen eine Übergangsregierung aus, die von Washingtons Vorzugsmann als Premierminister, Arsenij Jazenjuk, geführt wurde. Von da an nahmen die Schützlinge Washingtons den Auftrag wahr, »freie und faire« Wahlen zu organisieren, bei denen der Sieg des Westens garantiert war, da die bevölkerungsreiche Ost-Region des Donbass, nachdem die weitgehend mit ihren Stimmen gewählte Regierung gestürzt worden war, eine Revolte gegen Kiew begann. Es war ein perfekt orchestrierter Regimewandel. Die Massen von Demonstranten, deren genaue Forderungen nie artikuliert oder erfüllt wurden, lieferten den »demokratischen« Vorwand für den Sturz einer 190 gewählten Regierung, während die mysteriösen Scharfschützen für die nötige Konfusion sorgten, um einen illegalen, verfassungswidrigen Staatsstreich zu ermöglichen. Der Scharfschützenangriff vom 20. Februar, der die Bühne für den Sturz Janukowitschs schuf, ist inzwischen längst als Operation unter »falscher Flagge« entlarvt worden. Sie wurde von rechtsextremen Milizen organisiert, um den glücklosen Janukowitsch beschuldigen zu können, er habe die Morde angeordnet. Die Wahrheit kam zuerst einige Tage später heraus, als das Protokoll eines Telefonats zwischen dem estnischen Außenminister Urmas Paet und der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton öffentlich wurde. Paet berichtete Ashton, er habe aus verlässlichen Quellen in Kiew erfahren, die Scharfschützen seien nicht von Janukowitschs Regierung, sondern von Gruppen losgeschickt worden, die bei den Maidan-Protesten aktiv waren. Am 10. April 2014 wurde dies durch eine Sendung des deutschen Fernsehmagazins »Monitor« bestätigt, die zu dem Ergebnis kam, die Scharfschützen hätten nicht, wie die Putschisten behaupteten, von Gebäuden unter Regierungskontrolle aus gefeuert, sondern vom Hotel Ukraina, das vollständig von der faschistischen Swoboda-Partei und der Miliz »Rechter Sektor« kontrolliert wurde.67 Die erste detaillierte akademische Studie des Vorfalls von Ivan Katchanovski von der Universität Ottawa kam zu dem Ergebnis, bestimmte Elemente der Maidan-Opposition, besonders die von Dmytro Jarosch geführte Miliz namens »Rechter Sektor«, hätten das Scharfschützenmassaker genau zum Zweck der Machtergreifung organisiert.68 Operationen unter falscher Flagge sind besonders erfolgreich, wenn die Öffentlichkeit, die damit beeinflusst werden soll, nicht glauben kann, dass es so etwas überhaupt gibt. Obwohl solche Aktionen seit jeher Standardrepertoire der Kriegsführung sind, wollen viele Menschen einfach nicht wahrhaben, dass jemand so niederträchtig sein könnte, die eigenen Leute anzugreifen. Aber besonders dann, wenn äußere Mächte als Vermittler fungieren, kann eine Aktion unter falscher Flagge eine festgefahrene Lage aufbrechen, indem sie der eigenen Seite den moralischen Bonus des »Opferstatus« verleiht. Die ukrainischen Nationalisten scheinen solche Aktionen mehr als einmal eingesetzt zu haben. Etliche Augenzeugen bestätigen Katchanovskis Schlussfolgerungen, darunter Ina Kirsch, eine deutsche Sozialdemokratin, die von 2011 bis 2014 Direktorin des »Europäischen Zentrums für eine moderne Ukraine« war, das für eine reibungslose Annäherung zwischen der Ukraine und der 191 EU sorgen sollte. In einem Interview mit der Wiener Zeitung vom 19. Februar 2015 deutete Ina Kirsch an, der Maidan-Kommandeur Andrij Parubij könne an der Organisierung des Massakers beteiligt gewesen sein.69 Kirsch sagte, der US-Milliardär George Soros, der den Maidan unterstützt habe, habe dort auch »Leute bezahlt – die haben in zwei Wochen auf dem Maidan mehr verdient als während vier Arbeitswochen in der Westukraine«. Kirsch meinte weiter, sie kenne Leute, die sowohl für ihre Teilnahme an Proals auch ihre Teilnahme an Anti-MaidanDemonstrationen bezahlt wurden. »Das ist in der Ukraine ja nichts Ungewöhnliches«, kommentierte sie, bezahlten doch in der Ukraine Oligarchen Milizen dafür, dass sie ihr Eigentum schützen und dafür ihren Konkurrenten Probleme machen. Die größtenteils russischsprechende Ostukraine war während des Aufruhrs um den Maidan ruhig geblieben. Aber dann begehrte die Region gegen den verfassungswidrigen Sturz der Regierung in Kiew auf, der Leute und Gruppierungen an die Macht brachte, deren Hass auf Russland pathologisch ist. So waren in der Westukraine auf Versammlungen oder im Fernsehen Sprecher zu hören, die zu einem Krieg zur »Tötung aller Russen«70 oder zur Vertreibung der Russen aus der Ostukraine sowie zur Beschlagnahme ihres Besitzes oder zum Verbot der russischen Sprache aufriefen – Letzteres eine Maßnahme, die die neue Regierung ursprünglich beschlossen hatte, aber dann auf den Druck ihrer EUUnterstützer rasch wieder zurücknahm. Eine Galerie für moderne Kunst organisierte eine bizarre Ausstellung, in der zwei (von Schauspielern dargestellte) betrunkene und verwahrloste Russen wie in einem Zoo im Käfig mit Schildern wie »Abstand halten« und »Bitte nicht füttern« zu sehen waren. Die Rebellen in der Ostukraine forderten Verfassungsänderungen für mehr lokale Autonomie, wurden aber von den neuen Machtha-bern in Kiew umgehend als »Terroristen« stigmatisiert. Das führte dann zum Bürgerkrieg. Die seit Jahrhunderten russischsprachige, multikulturelle Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa war das Zentrum der föderalistischen Forderungen. Im Frühjahr 2014 stellten Aktivisten auf einem Platz vor dem lokalen Gewerkschaftshaus Zelte auf, um Unterschriften für ein Verfassungsreferendum zu sammeln, das Regionen erlauben sollte, selbst ihre Regierungen zu wählen.71 Am 2. Mai griffen Milizen des Rechten Sektors die Föderalisten gewaltsam an. Diese flohen in das Gebäude, das dann in Brand gesetzt wurde. Etliche der Aktivisten verbrannten in den Flammen, während andere, die es schafften, aus den Fenstern zu springen, 192 von nationalistischen Aktivisten zu Tode geprügelt wurden. Die Zahl der Toten liegt bei mindestens achtundvierzig, ist aber in Wirklichkeit wahrscheinlich viel höher.72 Von den westlichen Medien wurde das Odessa-Massaker heruntergespielt, und bei den westlichen Menschenrechtsorganisationen, die zuvor zur Verteidigung von Pussy Riot alle Register gezogen hatten, erregte es nur milde Besorgnis. Die Heimkehr der Krim Der Putsch vom Februar brachte die Regierung in Kiew in die Hände von rechtsgerichteten ukrainischen Nationalisten, die darauf brannten, die Ukraine in die NATO zu führen. Das stellte für Russland, dessen Schwarzmeerflotte im Hafen von Sewastopol auf der Krim stationiert ist, eine unmittelbare strategische Bedrohung dar. Als Chruschtschow 1954 die Krim willkürlich an die Ukraine abtrat, schien das eine rein administrative Entscheidung ohne Bedeutung zu sein, da Russland und die Ukraine ja ohnehin beide zur Sowjetunion gehörten. Als dann beide Länder getrennte Wege gingen, verpachtete die Ukraine den Hafen von Sewastopol an Russland. Doch wenn die Ukraine der NATO beitreten sollte, wäre das für Russland eine unsichere Sache, vor allem angesichts der Tatsache, dass die US-Marine schon jetzt im Schwarzmeer patrouillierte, und angesichts des US-Hungers nach Militärstützpunkten. Indem sie die Machtübernahme extrem antirussischer Kräfte in der Ukraine unterstützten, provozierten die USA und deren europäischen Partner Russland bewusst zu einer irgendwie gearteten defensiven Reaktion. Hier ging es nicht nur um eine »Einflusssphäre« in der »engen Nachbarschaft« Russlands, sondern um eine Überlebensfrage für die russische Marine und eine schwere Bedrohung der nationalen Sicherheit direkt an Russlands Grenze. Die westlichen Staaten konnten sich nicht völlig sicher sein, wie Präsident Putin reagieren würde. Dass er reagieren würde, war klar. Damit war für Putin eine Falle gestellt. Egal, was er tat, es würde falsch sein. Er konnte zu wenig tun, womit er Russlands nationale Interessen verraten und feindlichen NATO-Kräften erlauben würde, eine ideale Angriffsposition einzunehmen. Das würde sein Ansehen im Inneren schädigen und vielleicht zu seinem vorzeitigen Sturz führen. Oder er konnte überreagieren und russische Truppen in die Ukraine einmarschieren lassen. Der Westen war darauf vorbereitet und hätte dann 193 im Chor geschrien, Putin sei der neue »Hitler« und plane, Europa zu überrennen, das (ein weiteres Mal) nur durch die USA gerettet werden könne. Letzten Endes war der russische Verteidigungsschritt ein sehr vernünftiger Mittelkurs. Aber der Aufschrei im Westen war so laut, als hätte Russland mit der Ukraine dasselbe gemacht wie die USA vor gar nicht langer Zeit mit Panama oder der winzigen Insel Grenada, wo sie mit Waffengewalt einfielen. Da die allermeisten Bewohner der Krim sich immer als Russen betrachtet haben und sich daher durch den antirussischen Putsch in Kiew bedroht fühlten, wurde rasch eine friedliche und demokratische Lösung gefunden. Das Krim-Parlament beschloss ein Referendum über den Austritt aus der Ukraine, mit der Option eines Beitritts zu Russland. Dies hatte seit der Auflösung der Sowjetunion, mit der die Krim von Russland abgetrennt wurde, immer in der Luft gelegen. Die westlichen Mächte weigerten sich, das Referendum anzuerkennen, aber freiwillige internationale Beobachter bewerteten die Prozeduren als korrekt. Am 16. März 2014 stimmten, bei einer Wahlbeteiligung von 82 Prozent, 96 Prozent der Krimbewohner für die Rückkehr nach Russland.73 Im Rahmen des Pachtvertrags für Sewastopol hatte Russland Truppen auf der Krim stationiert und entsendete nun zum Schutz Verstärkungen, aber ohne die legale Obergrenze von 20 000 Soldaten zu überschreiten. Nicht ein Schuss wurde abgefeuert, und es gab bei der Abstimmung keinerlei Gewalt. Dennoch verurteilte der Westen diesen demokratischen Prozess als »russische Invasion«. Dabei führte US-Außenminister John Kerry den Chor der selbstgerechten Empörung an und beschuldigte Russland genau desselben Vorgehens, das seine eigene Regierung regelmäßig einsetzt: »Man kann nicht mit erfundenen Vorwänden in ein fremdes Land einfallen, um die eigenen Interessen durchzusetzen.« Bei einer anderen Gelegenheit dozierte Kerry: »Das ist eine Aggression unter einem vollkommen falschen Vorwand. Es ist ein vom 19. Jahrhundert übernommenes Verhalten im 21. Jahrhundert.«74 Statt sich über diese Heuchelei lustig zu machen, sogen die Medien, Politiker und Meinungsmacher der USA das Thema der nicht zu duldenden expansionistischen Aggression Putins begierig auf. Die Europäer schlugen danach gehorsam denselben Kurs ein. Zur Rechtfertigung der Abspaltung der Krim von der Ukraine berief sich Russland auf das Urteil des Internationalen Gerichtshof in Den Haag von Juli 2010, nach dem »das allgemeine internationale Recht kein 194 anwendbares Verbot von Unabhängigkeitserklärungen ent-hält«75. Das war ironisch angesichts der Tatsache, dass das Urteil die Antwort auf eine Klage Serbiens gewesen war, das auf eine Entscheidung gegen die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo gehofft hatte, aber die Klage verlor. Am 26. März 2014 wies dann US-Präsident Obama höchstpersönlich das russische Argument zurück, indem er erklärte: »Kosovo hat Serbien auch erst nach einem Referendum verlassen, das nicht unter Verstoß gegen das Völkerrecht, aber dafür in sorgfältiger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen sowie den Nachbarn des Kosovo organisiert wurde. Auf der Krim ist nichts auch nur annähernd Ähnliches geschehen.«76 In Wirklichkeit war es das Kosovo, wo »nichts auch nur annähernd Ähnliches« geschah. Die abtrünnige serbische Provinz erklärte ihre Unabhängigkeit ohne Referendum und ohne Kooperation mit irgendjemandem – außer wahrscheinlich, insgeheim, mit Washington. Sie verdankte ihre Unabhängigkeit dem NATOBombardement und der NATO-Besatzung, während die Rückkehr der Krim nach Russland auf friedlichem und demokratischem Weg zustande kam.77 Die Entscheidung der Krim, sich von der Ukraine abzuspalten, verstieß offenbar tatsächlich gegen die Verfassung der Ukraine – die allerdings zuvor gerade erst auch durch den Putsch in Kiew verletzt worden war, was eine neue Situation schuf. Aber es gibt keine rechtliche Basis für die Beschuldigung, sie habe auch internationales Recht verletzt. So ganz nebenbei hatte Hillary bereits auf die unentbehrliche HitlerAnalogie zurückgegriffen: »Wem das bekannt vorkommt: Es ist das, was Hitler damals in den dreißiger Jahren tat«,78 behauptete sie und verglich damit die Sorge des russischen Führers um die ethnischen Russen in der Ukraine mit Hitlers kriegerischen Ansprüchen gegen Deutschlands Nachbarn. Das war indes nur der Beginn eines Crescendos von Schmähungen und Hitler-Vergleichen, das bald an das heranreichte, was seinerzeit über den Nazi-Führer selbst gesagt worden war. Putin verwendete in seiner Rede vor der Russischen Duma am 18. März 2014 zur Rechtfertigung des Referendums auf der Krim eine andere Analogie. Putin hoffte, die Deutschen würden sich daran erinnern, dass Moskau der Wiedervereinigung von Ost- und West- Deutschland 1990 vorbehaltlos zugestimmt hatte, und daher die Entscheidung der Krim als ähnliche Wiedervereinigung betrachten würden. Er stellte klar, dass keine weiteren Ansprüche bestünden: »Wir wollen keine Teilung der Ukraine, 195 das ist nichts, was wir nötig hätten.«79 Während er politisch nicht umhin konnte, die russischsprachigen Rebellen in Donezk und Luhansk zu unterstützen, hat Putin konstant immer beide Seiten aufgefordert, die Ukraine durch eine Einigung über ein föderales System mit einem gewissen Maß an lokaler Selbstbestimmung zusammenzuhalten. Wenn keine der beiden Seiten dem zustimmt, wird Putin dafür die Schuld gegeben. Tatsächlich verstehen in Deutschland viele Menschen den russischen Standpunkt sehr wohl, sodass der Ausdruck »Putinversteher« in politischen Auseinandersetzungen zu einem verbreiteten, halb ironischen Ausdruck geworden ist.80 Viele Deutsche, darunter auch führende Vertreter der Wirtschaft, betrachten die Europa von den USA aufgezwungene antirussische Politik als unrealistisch, ungerechtfertigt und nicht den deutschen Interessen entsprechend. Aber zur offenkundigen Überraschung und Enttäuschung der russischen Führung haben die politische Klasse und die Medien in Deutschland die von Washington festgelegte russlandfeindliche NATO-Linie fast unisono übernommen. Der russische Außenminister Lawrow gab zu, Russland habe Europas Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten überschätzt.81 Am 25. Mai wurde der prowestliche Oligarch Petro Poroschenko, der sein Vermögen mit Schokolade und Beerdigungsinstituten gemacht hatte, zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Da sich die Ostukraine unter Belagerung befand, stand der Sieg der antirussischen Westukraine von vornherein fest. Poroschenko ist ein schwankender Führer, der ständig zwischen seinen US-Unterstützern, die den Konflikt in der Ukraine als Vorwand zur Stärkung der NATO-Präsenz in den benachbarten EUStaaten begrüßen, und den Friedensanstrengungen deutscher und französischer Politiker, die ein Interesse an einer Beruhigung der Lage haben, hin und hergerissen scheint. Der neue eiserne Vorhang 1945 befreite die Sowjetunion Osteuropa, blieb dann dort zu lang, zog aber fast fünfzig Jahre später mehr oder weniger freiwillig wieder ab. Die Vereinigten Staaten befreiten Westeuropa und zogen niemals ganz ab.82 An irgendeinem Punkt sollte eine permanente »Befreiung« einmal in Eroberung umbenannt werden. Um die endlose Präsenz von US-Militärstützpunkten und natürlich 196 auch die Spionagetätigkeit der NSA sowie die NATO-Kontrolle über Europas eigene Truppen zu rechtfertigen, liegt es im Interesse Washingtons, die Europäer immer wieder daran zu erinnern, dass sie beschützt werden müssen. Gleichzeitig bedarf die Europäische Union immer mehr eines emotionalen Elements, um ihren inneren Zusammenhalt zu sichern. Dazu könnten gemeinsame Feinde ein probates Mittel sein: islamische Terroristen auf der einen und der russische Bär auf der anderen Seite. Die Ukraine ist nicht das einzige Gebilde, das »überdehnt« ist. Dasselbe gilt für die Europäische Union. Mit 28 Mitgliedern mit verschiedenen Sprachen, Kulturen, Geschichten und Mentalitäten ist die EU nicht in der Lage, sich auf irgendeine Außenpolitik außer der zu einigen, die Washington ihr aufzwingt. Unterdessen haben das große Einheitsinstrument, der Euro, und die von Brüssel durchgesetzte Austeritätspolitik zu wirtschaftlichen Härten und zu Zwietracht geführt. Die Wahlen zum Europaparlament vom 25. Mai 2014 offenbarten eine große Unzufriedenheit mit der Europäischen Union unter den Wählern. Die Ostexpansion der Union, mit der die ehemaligen sowjetischen Satelliten aufgenommen wurden, hat alles zerstört, was unter den Ländern der ursprünglichen EU – Frankreich, Deutschland, Italien und den Beneluxstaaten – je an echtem Konsens hätte möglich sein können. Polen und die baltischen Staaten sehen die EU-Mitgliedschaft als nützlich an, sind aber mit dem Herzen bei den USA, wo viele ihrer wichtigsten Führer ihre Erziehung und Ausbildung genossen haben. Außerdem kann Washington die antikommunistische, antirussische und sogar pronazistische Nostalgie ausnutzen, die in Teilen Nordosteuropas grassiert, um den absurden Schlachtruf »Die Russen kommen!« zu lancieren und so die wachsende wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Russland und der alten EU, besonders Deutschland, zu sabotieren. Ermutigt durch die USA und die NATO liefert diese am nordöstlichen Rand der EU verwurzelte endemische Feindschaft den psychologischen Impetus für einen neuen »eisernen Vorhang«, mit dem das Ziel erreicht werden soll, das Zbigniew Brzeziński 1997 in Die einzige Weltmacht formulierte: den eurasischen Kontinent gespalten zu halten, um die USHegemonie sicherzustellen. Der alte Kalte Krieg diente genau diesem Zweck, indem er die Militärpräsenz und den politischen Einfluss der USA in Westeuropa zementierte. Ein neuer Kalter Krieg kann verhindern, dass der Einfluss der USA durch gute Beziehungen zwischen Westeuropa und Russland geschmälert wird. Die USA haben ihre europäischen Verbündeten gezwungen, 197 Wirtschaftssanktionen über Russland zu verhängen, die kostspielig für Russland, aber auch für die europäischen Verbündeten selbst sind. Die europäischen Bauern, die ohnehin in Schwierigkeiten sind, waren die ersten, die durch die russischen Gegenmaßnahmen, zu denen ein Einfuhrverbot von EU-Agrarprodukten gehörte, bestraft wurden. Französische und deutsche Industrien verlieren profitable Märkte. Der erste Eiserne Vorhang war von einer ökonomischen Belohnung für Westeuropa, nämlich den Investitionen des Marshall-Plans, begleitet. Dieses Mal wird Europa nicht belohnt, sondern bestraft. Seit zwei Jahren vertritt der Finanzier Georges Soros die Meinung, die Europäische Union könne sich selbst nur retten, indem sie die Ukraine rettet.83 Soros kritisiert die Europäer, da sie unfähig seien zu erkennen, dass »der russische Angriff auf die Ukraine eine indirekte Attacke auf die europäische Union und ihre Regierungsprinzipien ist«. Somit befinde die Europäische Union sich selbst »indirekt im Krieg«, was eine Politik der staatlichen Sparpolitik »unangemessen« mache. Stattdessen mahnte er: »Alle verfügbaren Ressourcen sollten in die Kriegsanstrengung geworfen werden, selbst wenn das größere Haushaltsdefizite bedeutet.«84 Mit diesem Vorschlag versucht Soros, für die Europäische Union dieselbe Rolle zu spielen, wie Paul Nitze 1950 für die Vereinigten Staaten: Unter dem Vorwand, man müsse auf die »russische Gefahr« reagieren, möchte er einen keynesianischen »Kalten Krieg« in Gang bringen, der die Wirtschaft ankurbelt. »Sanktionen gegen Russland sind notwendig, aber ein notwendiges Übel«, da sie »einen dämpfenden Effekt nicht nur auf Russland, sondern auch auf die europäische Wirtschaft einschließlich der Deutschlands haben«. Im Gegensatz dazu, so Soros, »würde eine Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf Europa einen stimulierenden Effekt haben«. Die Parallele zu Nitzes NSC 68 ist bemerkenswert. Genau wie Nitzes Sowjethysterie das Ende des keynesianischen New Deal der Roosevelt-Periode, der sich auf soziale Projekte wie die Elektrifizierung der US-Agrargebiete konzentrierte, zugunsten von Militärausgaben rechtfertigte, würde Soros’ Vorschlag die weitergehende Absenkung der europäischen Sozialausgaben legitimieren, da die staatliche Defizitfinanzierung nun der Bezahlung eines Krieges der Ukraine gegen Russland vorbehalten bleiben muss. Genau wie Nitze die sowjetische militärische Bedrohung Europas aufbauschte, ergeht Soros sich in Fantasien, wenn er versichert, es sei »unrealistisch zu erwarten, dass Putin nicht über die Ukraine hinaus 198 drängen wird, wenn für ihn eine Aussicht auf die Spaltung Europas und seine Beherrschung durch Russland besteht. Nicht nur das Überleben der neuen Ukraine, sondern auch die Zukunft der NATO und der Europäischen Union selbst sind in Gefahr .«85 In diesem Wahnsinn steckt Methode, weil eine offizielle Kriegshysterie Großinvestoren Investitionsmöglichkeiten mit Gewinngarantie verschafft. Die Nebel des Krieges Die Mehrheit der russischsprechenden Bevölkerung im Südosten der Ukraine war ebenso beunruhigt über den Regimewandel in Kiew wie die Bevölkerung der Krim, aber für sie gab es keine so leichte Lösung. Oder besser gesagt, es hätte eine leichte Lösung geben können, wäre den neuen Behörden in Kiew daran gelegen gewesen. Die Ukraine wird trotz ihrer enormen regionalen Unterschiede auf eine extrem zentralistische Art regiert; so werden zum Beispiel die Gouverneure der Regionen von Kiew ernannt. Der Südosten, vor allem das industrielle Zentrum des Donbass, hatte eine klare Forderung, nämlich die nach einer Verfassungsänderung, die es den Regionen erlauben würde, ihre Regierungen selbst zu wählen. Diese Forderung nach Föderalismus wurde von den westlichen Medien von Anfang an als »prorussischer Separatismus« hingestellt, während Kiew die Föderalisten als »Terroristen« bezeichnete. Mitte April entsendete Kiew bewaffnete Truppen zur Unterdrückung des Donbass und die resultierende Gewalt führte dazu, dass der Separatismus unter den Föderalisten wesentlich an Boden gewann. Hunderttausende von Bewohnern des Donbass, besonders Frauen und Kinder, flohen nach Russland – eine Form der »ethnischen Säuberung«, die möglicherweise auch ein Ziel des Angriffs aus dem Westen war. Besonders in Deutschland hofften die »Putinversteher« auf die Wahrheit von Gerüchten, Angela Merkel und Wladimir Putin seien hinter den Kulissen dabei, eine friedliche Lösung der Krise in der Ukraine auszuarbeiten. Es gab sogar die Hoffnung, auch der neu gewählte Präsident Poroschenko werde einer friedlichen Lösung der Krise zugänglich sein – besonders, indem er seine Zustimmung zu einem föderalen System gab, wie es in vielen Ländern und natürlich nicht zuletzt in Deutschland besteht. Dann kam es am 17. Juli über der Südostukraine in der Nähe von 199 Donezk zum Absturz des Fluges 17 der Malaysian Airlines (MH17) von Amsterdam nach Kuala Lumpur, wobei alle 298 Passagiere und Besatzungsmitglieder starben. Ersten Vermutungen zufolge wurde das Flugzeug von einer radargesteuerten russischen Buk-Boden-Luft-Rakete abgeschossen. Kiew beschuldigte sofort die separatistischen Rebellen. Es wurde berichtet und dann wieder dementiert, die Rebellen hätten der ukrainischen Armee ein Buk-System gestohlen. Später gab es Hinweise darauf, ein oder mehrere Kampfjets hätten sich dem Flugzeug genähert, und Löcher in der Flugkanzel deuteten darauf hin, einer der Kampfflieger könnte die Maschine abgeschossen haben. Was tatsächlich geschah, war ein komplettes Rätsel, aber es genügte, um alle Aussichten auf Friedensverhandlungen zunichte zu machen. Die Ablehnung von Verhandlungen seitens der USA bezog jetzt moralische Unterstützung aus der Empörung über die Russen, die angeblich kaltblütig ein Flugzeug abgeschossen hatten. Irren ist menschlich, und nichts begünstigt schreckliche Fehler mehr als Krieg. Krieg liefert auch den perfekten Hintergrund für Propaganda und Fehlbeschuldigungen. Wer, wenn überhaupt jemand, hätte ein Motiv zum Abschuss eines Passagierflugzeuges über der Ostukraine haben können? Diese Frage wurde von der US-Führung, die sofort wusste, wo die Schuld zu suchen war, kaum je gestellt. Noch am selben Abend deutete Hillary Clinton an, Russland trage die Schuld. In einem einstündigen Interview in der »Charlie Rose Show« ging sie so weit, den Europäern Marschbefehle zu geben, wie sie dafür sorgen müssten, dass Russland »den Preis zahlt«. »Sollte es Beweise geben, die Russland hiermit in Verbindung bringen, sollte das die Europäer dazu bringen, in dreierlei Hinsicht viel mehr zu tun. Erstens müssen sie ihre eigenen Sanktionen verstärken. Und völlig klarmachen, dass hier ein Preis zu zahlen ist. Nummer zwei, […] Alternativen zu Gazprom finden. Und drittens, zusammen mit uns mehr unternehmen, um die Ukrainer zu unterstützen.«86 So machte sich HRC ohne zu zögern die Tragödie eines völlig unaufgeklärten Flugzeugabsturzes zunutze, um, nach dem Muster des Zwischenfalls im Golf von Tonkin 1964, Vergeltungsmaßnahmen Europas gegen Russland zu rechtfertigen.87 »In den europäischen Hauptstädten sollte Empörung herrschen« angesichts der russischen Aggression, so 200 Clinton weiter, worauf das Standardklischee folgte, Härte sei »die einzige Sprache, die [Putin] versteht«. Putin, erklärte HRC, versuche »so weit zu gehen, wie er kann« – womit sie andeutete, der russische Präsident habe ein Flugzeug abschießen lassen, nur um die Entschlossenheit des Westens zu testen.88 Aufgrund eines merkwürdigen Zufalls war auch Putin selbst zu fast genau dem Zeitpunkt, als MH17 abgeschossen wurde, über diesem Teil der Ukraine unterwegs. Er befand sich auf dem Rückflug von Brasilien, wo seine Bemühungen für eine Gleichbehandlung aller Länder von den anderen Führern der BRICS-Staaten (Dilma Rousseff aus Brasilien, Narendra Modi aus Indien, Chinas Xi Jinping und Jacob Zuma aus Südafrika) unterstützt worden waren. Einer wilden, kaum diskutierten Spekulation zufolge hatten die ukrainischen Nationalisten das malaysische Flugzeug versehentlich abgeschossen, da sie dachten, es sei Putins Flug. Am Tag nach der Tragödie teilte Jeffrey Feltman, der als Vizegeneralsekretär für Politik an die UN ausgeliehene Vertreter des USAußenministeriums, Ban Ki-moons scharfe Verurteilung »dieses offenbar absichtlichen Abschusses eines Zivilflugzeugs«89 mit. Wenn der Abschuss »offenbar absichtlich« geschah, muss es ein Motiv gegeben haben. Aber was hätte das sein können? Welche Gründe hätten die Rebellen im Osten haben können, absichtlich ein Zivilflugzeug abzuschießen? Ein versehentlicher Abschuss des Flugzeugs aufgrund einer Verwechslung mit einem Bomber der ukrainischen Luftwaffe ist denkbar, aber für einen absichtlichen Abschuss gibt es keinen vorstellbaren Grund. Man könnte sich vorstellen, dass das Motiv eine weitere Provokation der antirussischen ukrainischen Nationalisten war: noch eine Operation unter falscher Flagge, diesmal von monströsem Ausmaß. Aber auch das ist reine Spekulation. In Kriegen kommt es oft zu tödlichen Unfällen. Hier nur ein Beispiel: Am 3. Juli 1988 schoss die USS Vincennes, ein mit Marschflugkörpern bestückter, während des Irak-Iran-Krieges im Persischen Golf patrouillierender US-Kreuzer, ein auf einem Linienflug von Teheran nach Dubai befindliches iranisches Zivilflugzeug ab, wobei alle 290 Menschen an Bord umkamen, darunter 66 Kinder. Vorgeblich neutral, unterstützten die USA damals in Wirklichkeit den Irak. Flug 655 der Iran Air wurde im iranischen Luftraum über dem Seeterritorium des Iran von einer US-Lenkrakete abgeschossen. Der Vergleich mit Flug MH17 der Malaysian Airlines ist lehrreich. Im Fall des iranischen Flugzeugs gab es keinen internationalen Aufschrei, 201 die Vereinigten Staaten müssten für diesen »offenbar absichtlichen Abschuss eines Zivilflugzeugs den Preis zahlen«. Die USA entschuldigten sich zu keinem Zeitpunkt und George H. W. Bush, der damals Vizepräsident war, brüstete sich bei einer Veranstaltung im Präsidentschaftswahlkampf einen Monat später sogar, er werde »sich nie für die Vereinigten Staaten entschuldigen, niemals. Es kümmert mich nicht, was die Tatsachen sind. [..] Ich bin nicht die Art von Typ, der sich für Amerika entschuldigt.«90 Obwohl nie ein Zweifel an ihrer Verantwortung für das Unglück bestand, bekamen Kapitän und Besatzung der US-Vincennes für ihre Dienste allesamt Medaillen verliehen. Das ist die wahre Bedeutung des US-amerikanischen »Ausnahmestatus«: Einige können mit Mord davonkommen, andere nicht, nicht einmal, wenn sie unschuldig sind. Zehn Tage nach der malaysischen Flugzeugkatastrophe knüpfte Hillary Clinton auf CNN erneut an ihre vorherigen Verdächtigungen an: »Ich denke, falls es vorher Zweifel gab, sollten diese jetzt verschwunden sein: Wladimir Putin trägt, ganz gewiss indirekt – durch seine Unterstützung der Aufständischen in der Ostukraine, die Lieferung moderner Waffen und, um hier ganz klar zu sein, die Präsenz russischer Sondertruppen und Geheimagenten – Verantwortung für das, was passiert ist.« Und weiter: »Wir müssen die notwendigen Sanktionen verschärfen. Die Vereinigten Staaten sind hier weiter vorangeschritten, Europa war zögerlich«, insistierte sie. »Sie müssen begreifen, dass sie sich Wladimir Putin entgegenstellen müssen.« Ihr Hauptpunkt war, die Europäer dazu anzutreiben, »mehr zu tun«.91 Dieser Chor unbewiesener Anschuldigungen lenkte von den brutalen militärischen Angriffen auf die Ostukraine ab. Bei diesen Angriffen wurden weit mehr Menschen getötet als bei dem tragischen Flugzeugabsturz, und das Töten ging weiter, aber für Bürger im Westen ist es natürlich viel leichter, sich mit einem unschuldigen Fluggast aus Holland zu identifizieren als mit einer russischsprachigen Großmutter in der Ukraine, die sich in ihrem Keller versteckt. Cui bono? Diese Frage kann in einer von Irrtümern und Unfähigkeit geprägten Welt nicht alle richtigen Antworten liefern. Wir haben alle die Freiheit, uns mehr oder weniger wahrscheinliche Hypothesen vorzustellen, zum Beispiel Operationen unter falscher Flagge, und wir können dabei richtig liegen. Aber echtes Wissen beruht auf forensischen Untersuchungen durch Experten. Mittlerweile gibt es leider Grund zu glauben, dass nach Monaten unbegründeter Schuldzuweisungen, widersprüchlicher Beweise und vor allem langer Säumnisse keine 202 Erklärung am Ende je völlig überzeugend sein wird. Die Reaktion des Westens auf die Katastrophe war von Anfang an so parteiisch, dass begründete Zweifel bestehen, ob die Wahrheit je ans Licht kommen wird – besonders, da westliche Regierungen mit engen Verbindungen zu den USA schon früh die Kontrolle über die offizielle Untersuchung übernahmen. Obwohl es um ein malaysisches Flugzeug ging, wurde Malaysia zumindest anfangs von der Untersuchung ausgeschlossen. Mit der Begründung, der Flug sei in Amsterdam gestartet und die meisten Opfer seien Holländer gewesen, übernahm Holland zusammen mit der Ukraine, Belgien und Australien das Kommando über die ursprüngliche Untersuchung – die nun also von zwei NATO-Mitgliedern und zwei extrem antirussischen Staaten durchgeführt wurde. Berichten zufolge unterzeichneten diese vier Regierungen am 8. August 2014 ein Geheimabkommen, das besagte, dass ohne Zustimmung aller vier Länder keinerlei Resultate der Untersuchung veröffentlicht würden. »Das gab einem der Hauptverdächtigen bei der Gräueltat, der Ukraine, im Endeffekt ein Vetorecht gegen alle Untersuchungsergebnisse, die ihr eine Schuld zuwiesen. Das ist erstaunlich und in der Untersuchung von Flugzeugabstürzen in jüngerer Zeit beispiellos«, schrieb der australische Anwalt James O’Neill, der vergeblich versuchte, sich ein Exemplar des Abkommens zu verschaffen.92 Interessanterweise hielt die quasi-offizielle englischsprachige Zeitung Malaysias, die New Straits Times, die Theorie des Abschusses durch einen Kampfjet der Regierung in Kiew durchaus für glaubwür-dig.93 Liegt das vielleicht daran, dass Malaysia erst ganz spät, nämlich im Dezember 2014, zur Beteiligung an der offiziellen »gemeinsamen Untersuchung« eingeladen wurde?94 Seltsamerweise ignorierte der Westen nicht nur Russlands Leugnung jeder Beteiligung, sondern auch die Offenlegung der russischen Radarund Satellitendaten durch Russlands Militär, die zeigten, dass MH17 von seiner ursprünglichen Route abgelenkt worden war und während seines Flugs über das Kriegsgebiet von zwei Kampffliegern »beschattet« wurde. Die Russen behaupteten, zur fraglichen Zeit habe sich ein USSpionagesatellit direkt über dem Abschussort befunden, und forderten die USA auf, auch ihre Daten öffentlich zu machen – aber vergebens. Vor allem jedoch wurde die russische Forderung nach Beteiligung an einer echten, unparteiischen internationalen Untersuchung ignoriert. Es ist merkwürdig, dass der Inhalt der Flugschreiber des abgeschossenen Flugzeugs von den westlichen Regierungen unter Verschluss gehalten 203 wurde, und ebenso, dass Sprecher des Westens, die das ganze Thema nach dem Fund des Flugschreibers immer mehr fallen ließen, zu erklären begannen, man werde die Wahrheit wohl leider niemals herausfinden. Dennoch werden die antirussischen Beschuldigungen und die harten Sanktionen aufrechterhalten. Am 5. September 2014 wies der prominente Russlandexperte Stephen Cohen darauf hin, die Briten und die Niederlande hätten genügend Zeit zur Interpretation der Flugschreiberdaten gehabt, aber es scheine »ein Abkommen unter den großen Mächten gegeben zu haben, uns nicht zu sagen, wer das getan hat«95. Aus all diesen Gründen werden die Endresultate der Untersuchung mit Sicherheit auf Skepsis stoßen, ganz gleich, wie sie im Einzelnen aussehen. Wie dem auch sei, das Herangehen der USA an die Tragödie von Flug MH17 ist schon für sich genommen eine Lehre. Sobald sich Washington einmal auf einen »Feind« eingeschossen hat, kann jedes Ereignis als Vorwand für Verurteilungen, Sanktionen oder Krieg dienen. Was immer bei dieser Katastrophe die Wahrheit war, weder Hillary Clinton noch der restliche Anti-Putin-Chor kannten sie oder konnten sie auch nur kennen, als sie schon eilig mit dem Finger auf Putin zeigten. Aber sie behaupteten nicht nur sofort zu wissen, wer schuld war, sondern setzten ihre unbewiesenen Mutmaßungen auch sogleich dazu ein, nach Strafen zu verlangen und ihre »Verbündeten« zu zwingen, es ihnen gleich zu tun. Das ist genau die Art von vorschnellem Urteil, die, wie beim Tonkin-Zwischenfall, zu großen Kriegen führen kann. In Kriegsstimmung Die Tragödie von MH17 wurde genutzt, um eine Stimmung zu erzeugen, in der kein freundliches Wort über Russland oder seinen Präsidenten mehr möglich war. Der ehemalige US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, erklärte gegenüber CNN, Putin sei »ganz klar für die Probleme, die wir in der Ukraine sehen, und für den Abschuss dieses Zivilflugzeugs verantwortlich«. Putin sei »jetzt ein Paria«, so Taylor. Die prorussischen Rebellen seien »Gangster und Mörder; das sind die Leute, die dieses Flugzeug abgeschossen haben«.96 Und der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Anthony Blinken kommentierte: »Wir erwarten von der Europäischen Union, dass sie noch 204 diese Woche wichtige Schritte, darunter solche gegen Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft, unternimmt.« Dabei erklärte er, die Sanktionen seien nicht dazu gedacht, »Russland zu bestrafen, sondern klarzumachen, dass es seine Unterstützung für die Separatisten einstellen und mit der Destabilisierung der Ukraine aufhören muss«.97 Tatsächlich war die Situation klar: Indem die USA und die EU darauf bestanden, dass die Ukraine als Ganzes sich der atlantischen Allianz gegen Russland anschloss, und indem sie einen irregulären Regierungswechsel in Kiew unterstützten, der antirussische Nationalisten an die Macht brachte, hatten sie die bevölkerungsreichen DonbassProvinzen vom politischen Prozess ausgeschlossen. Deren Revolte war ursprünglich rein demokratisch: Sie forderten Selbstverwaltung innerhalb einer föderalen Ukraine. Als die Regierung in Kiew das ablehnte, sie als »Terroristen« bezeichnete und mit Waffengewalt reagierte, brach ein Bürgerkrieg um die Kontrolle des Ostens los. Dieser lokale Konflikt bringt äußere Unterstützung mit sich: Russland unterstützt die Kämpfer im angrenzenden Donbass (aber nicht, wie behauptet, durch eine »Invasion«, sondern durch Nachschub und Freiwillige), während die NATO Kiew unterstützt – ein Stellvertreterkrieg, der auch Freiwillige aus anderen Ländern anzieht. So kämpfen serbische Freiwillige für den Donbass, während es auf Seiten Kiews und der NATO kroatische Freiwillige gibt. Das ist ein irritierendes spätes Echo des Jugoslawienkonflikts. Die westliche Propagandalinie schreibt diesen Konflikt ausschließlich »russischer Aggression« zu und behauptet sogar, diese »Aggression« im Donbass sei nur symptomatisch für eine größer angelegte »russische Aggression«, die europäischen Mitgliedern der NATO und der Europäischen Union drohe – eine völlig haltlose Behauptung, die dennoch von den westlichen Medien größtenteils widerspruchslos nachgebetet wird. Da Russland an allem Schuld ist, besteht die einzige Lösung darin, dass Russland seine »Aggression« einstellt. Solange die Ukraine instabil bleibt, ist Putin daran schuld, und Russland muss bestraft werden. Manchmal hat man den Eindruck, die Kommentatoren der westlichen Medien stünden in einem Wettbewerb um den Preis für die absurdeste Attacke auf Putin. Bis dato gebührt dieser imaginäre Preis – nennen wir ihn den »Soros-Preis« – dem CNN-Luftfahrtanalysten Jeff Wise, der ein Buch geschrieben hat, in dem er behauptet, Flug MH370 der Malaysian Airline, der während eines Fluges von Kuala Lumpur nach Peking vom Radar verschwand, sei in Wirklichkeit von Wladimir Putin nach Kasachstan umgelenkt worden, vielleicht als »Demonstration von Stärke«.98 Doch der Wettbewerb geht weiter … 205 Es ist noch nicht lange her, dass Libyen als funktionierende Gesellschaft zerstört wurde, um eine Rebellion in Bengasi vor einer hypothetischen Unterdrückung durch die Regierung zu schützen. Heute verlangen die USA von der Regierung in Kiew, sie solle weiterhin ihre Truppen einsetzen, um eine Rebellion im Donbass niederzuhalten. Dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko wirft man nicht vor, »sein eigenes Volk zu bombardieren«, obwohl dies genau das ist, was hier vor sich geht. Ein Hauptzweck der zahllosen Schmähungen, mit denen Putin überhäuft wird, besteht darin, die Regierungen Europas zur Verhängung von Sanktionen gegen Russland zu drängen. Je länger diese in Kraft bleiben, desto wahrscheinlicher werden sie eine bleibende Barriere zwischen den westeuropäischen US-Verbündeten und Russland errichten. Unterdessen werden Geheimverhandlungen zum Abschluss des Transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP geführt, das die USDominanz über Europa zementieren wird – und zwar mit Zustimmung und Billigung wichtiger europäischer Großkonzerne, deren Hauptinteresse der Zugang zum US-Markt ist. Diese Dominanz zeigte sich bereits an der widerstrebenden Zustimmung Europas zu den Sanktionen gegen Russland. Der Handel der Vereinigten Staaten mit Russland ist minimal, und so kosten die Sanktionen die USA praktisch nichts. In Europa sieht das allerdings anders aus. Es war heftiger Druck des US-Präsidenten Obama und des britischen Premierministers David Cameron nötig, um den französischen Präsidenten Francois Hollande zum Stopp der Lieferung zweier MistralHubschrauberträger an Russland zu bringen. Die Russen hatten für die Schiffe bereits 1,2 Milliarden Euro gezahlt und ein weiteres Schiff in Auftrag gegeben. Die Streichung der Lieferung verpflichtet Frankreich nicht nur zur Rückzahlung des Kaufpreises sowie zu Strafzahlungen. Sie bedeutet auch den Verlust Hunderter von Arbeitsplätzen in der Werft Saint-Nazaire und eine Schädigung des Rufs der französischen Industrie, was ihre Verlässlichkeit angeht.99 Viele Vertreter der deutschen Wirtschaft haben offen gegen den Verlust von Märkten durch die antirussischen Sanktionen protestiert. Gewerkschaften, Bauern und Unternehmer beklagen die gravierenden Folgen für die Wirtschaft, aber die politische Klasse schenkt Washington mehr Aufmerksamkeit als ihren eigenen Bürgern. Zu der gestoppten Lieferung der Mistral-Schiffe erklärte USVizepräsident Joe Biden Zuhörern in Harvard: »Es stimmt – sie wollten 206 das nicht tun, aber wieder haben Amerikas Führung und das Insistieren des Präsidenten der Vereinigten Staaten sich durchgesetzt, wobei wir Europa manchmal beinahe blamieren mussten, damit es sich ermannt und wirtschaftliche Nachteile in Kauf nimmt …«100 Es ist schon merkwürdig, dass europäische Führer für ihren »Mut« gepriesen werden, auf Kosten ihrer eigenen Wirtschaften dem Druck der USA nachgegeben zu haben. Victoria Nuland verkündete: »Die Durchsetzung von Sanktionen ist nicht einfach und viele Länder zahlen einen hohen Preis. Wir wissen das. Aber die Geschichte zeigt, dass die Kosten von Untätigkeit und Uneinigkeit im Angesicht eines entschlossenen Aggressors am Ende höher sind.«101 Die Geschichte zeigt vor allem, dass »die Geschichte zeigt«, was immer man will – besonders wenn man selbst derjenige ist, der sie umschreibt. Heute wird sie bereits umgeschrieben, noch während sie geschieht, in Echtzeit also. Und diese Umschreibung der Geschichte ist voller Widersprüche. Zum einen wird Russland bezichtigt, das Äquivalent der mächtigen deutschen Kriegsmaschine Hitlers zu sein, während es andererseits als zu unbedeutend hingestellt wird, um ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Laut Senator McCain ist Russland »eine Tankstelle, die sich als Land aufspielt«. Er ist auf diesen Witz so stolz, dass er ihn ständig wiederholt.102 Russland sei eine Nation im Niedergang, sagte Obama dem Magazin The Economist. »Russland produziert gar nichts. Es drängen keine Einwanderer nach Moskau, um dort ihr Glück zu suchen.«103 Dann wieder listete Obama in der jährlichen Ansprache des USPräsidenten an die Vereinten Nationen Russland an zweiter Stelle der drei größten Bedrohungen der Welt auf, zwischen dem Ebola-Virus und den Fanatikern des »Islamischen Staates« im Irak und in Syrien.104 In derselben Rede bezichtigte Obama Putin einer Weltsicht, nach der »Macht vor Recht [geht] – es ist eine Welt, in der die Grenzen eines Landes von einem anderen geändert und zivilisierte Menschen daran gehindert werden können, die sterblichen Überreste ihrer Lieben zu bergen, weil dadurch die Wahrheit ans Licht kommen könnte. Die Vereinigten Staaten stehen für etwas anderes. Wir glauben, dass Recht vor Macht geht, dass größere Nationen nicht die Möglichkeit haben sollten, kleinere zu gängeln, und dass die Menschen die Möglichkeit haben sollten, ihre Zukunft selbst zu gestalten.« Am 20. Januar 2015 wiederum feixte Obama gegenüber dem Kongress: 207 »Letztes Jahr, als wir zusammen mit unseren Verbündeten hart an der Durchsetzung der Sanktionen arbeiteten, sagten einige, Herrn Putins Aggression sei eine meisterhafte Demonstration von Strategie und Stärke. Nun, heute ist es Amerika, das gemeinsam mit unseren Verbündeten stark und vereint dasteht, während Russland isoliert ist und seine Wirtschaft in Trümmern liegt.«105 Führende US-Politiker heben immer wieder hervor, »wir Amerikaner« würden, im Unterschied zu Russland und den Kolonialisten alten Stils, nicht »zur Eroberung von Gebieten oder Ressourcen« in andere Länder einmarschieren. So rief Obama ins Gedächtnis, die USA hätten bei ihrer Invasion des Irak »versucht, innerhalb des internationalen Systems zu arbeiten«, und sie hätten »sich keine Gebiete oder Ressourcen des Irak angeeignet«. Sie hätten den Krieg beendet und »den Irak seinem Volk überlassen«. Wenn schon der Irak ein inspirierendes Modell der uneigennützigen Großmut der USA ist, dann ist die Ukraine ein weiteres. Im Mai 2014 wurde Hunter Biden, der Sohn des besonders kriegslustigen USVizepräsidenten Joe Biden, Vorstandsmitglied des größten Gasproduzenten der Ukraine, Burisma Holdings. In der Ukraine werden beträchtliche Vorräte an Schieferöl vermutet. Außerdem verfügt sie, von Iowa einmal abgesehen, über die fruchtbarsten Böden der Welt. Der USAg-rargigant Cargill ist in der Ukraine sehr aktiv und investiert in Getreidesilos, Tierfutter, Eierproduktion und das Agrobusiness sowie in den Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Dem äußerst rührigen »U.S.Ukraine Business Council« gehören Manager von Monsanto, John Deere, Du-Pont, Eli Lilly und anderen Großfirmen an. Monsanto plant den Bau einer großen Zuchtanlage für genmanipulierte Produkte sowie für nicht genmanipulierte Kornsamen, vielleicht für den europäischen Markt, wo Genmanipulation unpopulär ist. Jetzt, wo die neue Ukraine den Vertrag mit der Europäischen Union unterzeichnet hat, der ihr freien Zugang zu EU-Märkten gibt, sollten die niedrigen Arbeitskosten in der Ukraine die dort ansässigen US-Unternehmen gegenüber ihren europäischen Wettbewerbern hochgradig konkurrenzfähig machen. Die USA haben eine gute Ausgangsposition für die Schaffung einer vorteilhaften Lage für US-Firmen in der Ukraine, weil sie die Regierung in Kiew so gut wie völlig kontrollieren. Im Dezember 2014 vereidigte Präsident Poroschenko drei Ausländer als Kabinettsminister, die allesamt für Deregulierung und Privatisierung eintreten. Eine US-Bürgerin, Natalija Jaresko, ist die neue Finanzministerin, der Litauer Aivaras 208 Abromavičius (der russisch, aber nicht ukrainisch spricht) ist Wirtschaftsminister und der in den USA ausgebildete Georgier Alexander Kwitaschwili, der ebenfalls kein Ukrainisch spricht, ist Gesundheitsminister. Eine weitere Georgierin, Ekaterina Zguladze, wurde einige Tage später stellvertretende Innenministerin. Noch seltsamer war, dass Poroschenko im Februar 2015 den diskreditierten Ex-Premierminister Georgiens, Michail Saakaschwili, zum seinem obersten außenpolitischen Berater ernannte. Mit einer durch Stipendien des US-Außenministeriums finanzierten Ausbildung in den USA wurde Saakaschwili nach der US-gesponserten »Rosenrevolution« 2003 in Georgien zum Präsidenten gewählt, aber nachdem er 2008 wegen Südossetien einen erfolglosen Krieg mit Russland provoziert hatte, war seine Popularität drastisch gesunken. Nunmehr auf der Flucht vor Forderungen der georgischen Staatsanwaltschaft nach seiner Auslieferung, um sich für eine ganze Reihe von Anklagen, darunter Unterschlagung von Staatsgeldern und Machtmissbrauch, zu verantworten, begann Saakaschwili eine neue Karriere als Vorsitzender von Poroschenkos »International Advisory Council for Reforms«. Die Medien spekulierten, Saakaschwili könne seine Stellung als Lieblingsschützling Senator McCains nutzen, um eine Lieferung von USWaffen an die Ukraine zu arrangieren. Am bekanntesten ist er wohl durch das BBC-Youtube-Video, auf dem er während der Südossetien-Krise an seiner roten Krawatte kaut.106 Drei Monate später, am 30. Mai 2015, erteilte Poroschenko seinem »alten Freund« Saakaschwili einen noch erstaunlicheren Auftrag, indem er ihn zum Gouverneur der Unruheregion Odessa ernannte. Nichts könnte die guten Gründe hinter der Forderung Odessas nach einem föderalen System besser illustrieren als diese willkürliche Einsetzung eines desavouierten ausländischen Autokraten als Gouverneur. Nur Minuten, bevor Saakaschwili seinen neuen Posten antrat, verlieh Poroschenko ihm die ukrainische Staatsbürgerschaft. Anonyme Aktivisten platzierten daraufhin rote Krawatten »für Mischa« (Michail) an Bäumen und Denkmälern in Odessa.107 Während sie Putin bösartiger Pläne beschuldigen, »die Sowjetunion wiederherzustellen«, verhalten sich die Vertreter der USA und ihre örtlichen Marionetten manchmal so, als würde die Sowjetunion irgendwie doch noch existieren, nur dass sie jetzt Washington gehört. Auf die eine oder andere Weise zimmern die USA sich so ihr eigenes kleines Imperium am korrupten Rand des untergegangenen Sowjetblocks zusammen. 209 Unterdessen ist die Korruption in der Ukraine laut Ina Kirsch jetzt noch weit schlimmer als unter Janukowitsch. »Ich kenne niemanden, der jetzt in der Ukraine investieren will. Die geplante große Investorenkonferenz zur Ukraine wird seit September [2014] immer wieder verschoben. […] Logisch: Es gibt keine Investoren. Und zwar nicht nur, weil in der Ukraine Krieg herrscht, sondern weil das System in Kiew noch korrupter und unberechenbarer geworden ist. Jeder mögliche Investor wird ihnen sagen, ohne glaubhafte Garantien investieren wir dort nicht.«108 So etwas mag Europäer zum Zögern veranlassen, aber in den USA kümmert es offenbar niemanden. Aus der Perspektive einer freien Marktwirtschaft könnte man die russischen Gasexporte nach Westeuropa als perfektes Beispiel für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage betrachten. Aber laut dem großen Fürsprecher des Freihandels, den USA, sind diese russischen Gasexporte nur eine weitere üble »politische Waffe«, die Putin aus irgendwelchen bösen, wenn auch nie benannten Gründen einsetzt. Die USA wollen nun Europa vor dieser möglichen Tyrannei retten, indem sie stattdessen Produkte der neuen Frackingmethode liefern. Nun ja, nicht direkt. Stattdessen ist die Idee, dass das Fracking in den USA den heimischen Bedarf deckt und so anderweitige Energiequellen verfügbar werden, die dafür sorgen, dass die Wohnungen in Europa auch im Winter warm sind. Falls es mit dieser Katze im Sack nicht klappt, wird man die Europäer dazu auffordern, für das höhere Gut der Bestrafung Russlands für dessen angebliche Verbrechen »Opfer zu bringen«. Während die USA die Kontrolle über die Ukraine übernahmen, übten US-Vertreter Druck auf europäische Länder aus, aus dem Gas- PipelineProjekt South Stream auszusteigen. Das Abkommen dazu wurde 2007 zwischen Gazprom und dem italienischen Petrochemie-Unternehmen Eni unterzeichnet und sollte es Russland ermöglichen, unter Umgehung der Ukraine Gas an die Balkanländer sowie Österreich und Italien zu liefern. Die Ukraine hatte wiederholt ihre Rechnungen nicht bezahlt sowie überdies für Europa bestimmtes Gas abgezapft und sich so als unzuverlässiges Transitland erwiesen. Auch große deutsche und französische Energiegesellschaften hatten in das Pipeline-Projekt investiert. Diese Pipeline sollte das Schwarzmeer unterqueren und über Bulgarien die europäischen Märkte erreichen. Während der Ukrainekrise begannen die USA, Druck auf Bulgarien auszuüben. Die US-Botschafterin 210 in Sofia, Marcie Ries, warnte bulgarische Unternehmer vor Nachteilen, wenn sie mit Sanktionen unterliegenden russischen Unternehmen Handel trieben. Der scheidende Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso aus Portugal, drohte Bulgarien wegen angeblicher Regelverstöße in den South-Stream-Verträgen mit einem EU-Verfahren. (Zu einer Zeit, als »Maoismus« einer der Deckmäntel für die Gegnerschaft zu den sowjetisch unterstützten Befreiungsbewegungen in den afrikanischen Kolonien Portugals war, war Barroso »links« und »Maoist«.) Schließlich flog John McCain nach Sofia, um den bulgarischen Premierminister Plamen Orescharski zu beknien, aus dem Geschäft auszusteigen. Der Druck hatte Erfolg. Das ist ein schwerer Schlag für die Länder, die auf zuverlässige Erdgaslieferungen gesetzt hatten. Aber das macht nichts; alles, was Russland schadet, ist gut. Ein großer Schritt zu einem heißen Krieg mit Russland wurde am 4. Dezember 2014 getan, als das US-Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedete, mit der es Russland für eine imaginäre »bewaffnete Aggression gegen Verbündete und Partner der Vereinigten Staaten« verurteilte. Resolution 758 kombiniert eine lange Liste unverfrorener Lügen mit Forderungen zur Bewaffnung der Ukraine gegen eine angebliche russische Aggression. Sie ist letztlich eine potentielle Kriegserklärung an Russland. Der Text wurde ohne Debatte von einer überwältigenden Mehrheit von 411 offenbar gleichgültigen Abgeordneten, die gerade dabei waren, ihre Sitzung zu beenden, mit nur zehn Gegenstimmen beschlossen. Es ist erschreckend zu sehen, dass die engagiertesten Verurteilungen dieses beschämenden Dokuments von zwei mutigen Männern kamen, die nicht mehr Mitglieder des Kongresses sind, nämlich Dennis Kucinich und Ron Paul.109 Die fahrlässige Verabschiedung einer Resolution, die zur Rechtfertigung für einen Krieg gegen eine große Nuklearmacht genutzt werden könnte, ist ein alarmierendes Zeugnis für das Fehlen an Intelligenz, Aufrichtigkeit und Verantwortungssinn in dem politischen System, das Washington der gesamten Welt aufzuzwingen versucht. Weit entfernt davon, seine verfassungsmäßige Rolle als der Ort zu spielen, an dem Politik ernsthaft debattiert werden kann und an dem außenpolitische Verwicklungen aufgelöst und Kriege vermieden werden können, ist der US-Kongress zu einer Echokammer für Lobbys und Sonderinteressen verkommen und stimmt heute gedankenlos der Möglichkeit eines Nuklearkriegs zu, ohne mehr Gedanken darauf zu verschwenden als ein Sportstar auf den Werbeclip für einen Soft Drink. Diese Leichtfertigkeit zeigt, dass das Problem Hillary Rodham Clinton 211 weit über eine einzelne Person hinausgeht und eine tiefe Krise des USamerikanischen politischen Systems enthüllt. Russische Realitäten Die Kombination von enormer militärischer, wirtschaftlicher und ideologischer Macht auf der einen und tiefem Desinteresse am Rest der Welt auf der anderen Seite hat die US-Führer zu dem Glauben verleitet, ihre eigenen Illusionen könnten die Realitäten anderer ausradieren. Es kann einer eine Biene totschlagen und sich dabei vorstellen, es sei eine riesige giftige Stechmücke, oder er kann einen Frosch zertreten, den er für eine Tarantel hält – hinterher kann niemand mehr einen Unterschied erkennen. Don Quichotes Windmühlen sind nur harmlose Trugbilder verglichen mit den Feinden, die sich die Vereinigten Staaten ständig selbst an die Wand malen. Während Washington sich weiter auf seinem endlosen Kreuzzug zur Ausrottung des Bösen befindet, wird es von seinen unterwürfigen Verbündeten ungefähr so behandelt wie der »wahnsinnige König« Aerys II. Targaryen in der Serie »Game of Thrones«, dessen Fantasien ernstgenommen werden müssen: Die Führer Europas geben vor, all das zu glauben, in der Hoffnung, dass der Schaden in Grenzen gehalten werden kann. Opportunisten und Betrüger aus der ganzen Welt, ob religiöse Fanatiker, Faschisten oder schlichte Gangster, machen sich mit Treueeiden und Schwüren über ihre Liebe zur »Demokratie« an den umnachteten Monarchen heran und werden dafür mit modernen Waffen und einer maßgeschneiderten UN-Sicherheitsratsresolution belohnt. In völliger Missachtung der Fakten behauptet Washington auch weiterhin, die USA hätten in Grenada zur Rettung von USMedizinstudenten gekämpft, im Sudan eine Chemiewaffenfabrik bombardiert, im Kosovo einen Völkermord verhindert, in Afghanistan die Frauen befreit, im Irak die Massenvernichtungswaffen beseitigt und in Libyen das Volk davor gerettet, von einem gnadenlosen Tyrannen vernichtet zu werden. Aber indem sie sich nun Wladimir Putin als Inkarnation des Bösen ausgesucht haben, sind die Vereinigten Staaten auf eine russische Realität gestoßen, die nicht so leicht geleugnet werden kann. Seit Michail Gorbatschow den Kalten Krieg beendete, haben die russischen Führer die USA viele Jahre lang mit der Ehrerbietung 212 behandelt, wie sie im achtbaren Rahmen der »internationalen Gemeinschaft« gefordert wird. Die Antwort darauf war grobe Missachtung. So hätte es auf ewig bleiben können, wenn die USA das Spiel nicht immer weiter und weiter und am Ende – in der Ukraine – zu weit getrieben hätten. Die dortige Provokation, die ein an den Wunden seiner Vergangenheit tragendes großes Land isolieren und schwächen sollte, hat Russland aufgeweckt für seine Realität und Zukunft. Als letztlich langsames und defensives Land ist Russland immer dann in bester Form, wenn es angegriffen wird. Oder um ein gängiges Bild zu verwenden: Die USA haben den russischen Bären aus dem Winterschlaf geweckt. Wladimir Putin, der heute dieselbe Rolle spielt wie der kleine Junge, der ruft, dass der Kaiser ja gar keine Kleider anhat, machte diesen Wandel während einer informellen Rede am 24. Oktober 2014 im »Valdai International Discussion Club« in Sotschi besonders deutlich, bei der diverse internationale Persönlichkeiten wie der französische Ex-Premier Dominique de Villepin und der frühere Kanzler Österreichs Wolfgang Schüssel zugegen waren. Im Hinblick auf Sanktionen bemerkte Putin, sie stünden in Widerspruch zu dem freien Handel, den der Westen selbst zu seinem eigenen Vorteil immer propagiert habe. »Unserer Meinung nach sägen unsere amerikanischen Freunde schlicht an dem Ast, auf dem sie sitzen«, sagte er und unterstrich, dass »Russland nicht die Pose eines Beleidigten annehmen oder jemanden um etwas bitten wird. Russland ist ein Land, das sich selbst genügt. Wir werden unter den außenwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten, die sich ergeben haben, unsere Produktion und Technologien weiterentwickeln, entschiedener bei Umgestaltungen vorgehen, und der äußere Druck wird, wie das schon öfter der Fall war, unsere Gesellschaft nur konsolidieren. Er gibt uns keine Gelegenheit, uns zurückzulehnen – ich würde sagen, er zwingt uns dazu, uns auf unsere wichtigsten Entwicklungsrichtungen zu konzentrieren.«110 In internationalen Angelegenheiten werde Russland trotz aller Provokationen auch weiterhin Maßnahmen zur Verhinderung einer globalen Anarchie anstreben, die das Risiko in sich berge, ein von vielerlei Seiten betriebenes Wettrüsten sowie endlose ethnische, religiöse und soziale Konflikte anzuheizen. Für Putin ist »Achtung« der Schlüsselbegriff: Eine stabile Welt müsse auf gegenseitigem Respekt beruhen, einer Haltung, die dem Herangehen der USA an andere fehle. Da sie sich selbst zum Sieger des Kalten Krieges erklärt hätten, sähen die 213 USA keine Notwendigkeit zur Schaffung eines stabilen Systems: »So benehmen sich aber – ich bitte um Verzeihung – Neureiche, die urplötzlich zu großem Reichtum gekommen sind; in unserem Fall in Form der Weltvorherrschaft, der weltweiten Führungsrolle. Und statt dass sie diesen Reichtum intelligent und vorsichtig, und selbstverständlich auch zum eigenen Nutzen, einsetzen, haben sie, wie ich meine, eine ganze Menge zu Bruch gehen lassen.« Der Versuch, die eigenen Modelle anderen aufzuzwingen, führe zur Konflikteskalation. »Anstelle von souveränen, stabilen Staaten« gebe es »einen wachsenden Bereich des Chaos« und statt einer Förderung von Demokratie beobachte man die Unterstützung zweifelhafter Elemente »von offenkundigen Neonazis bis hin zu islamistischen Radikalen«. Der Bär, so Putin, ist »der Herr der Taiga, und ich weiß ganz sicher, dass er nicht die Absicht hat, in eine andere Klimazone umzuziehen – er würde sich dort nicht wohlfühlen. Er wird allerdings auch niemand anderem erlauben, ihm seine Taiga zu nehmen.«111 Oder mit anderen Worten: »Wir müssen keine Supermacht sein; das wäre nur eine Extralast für uns. Ich habe bereits die Taiga erwähnt. Sie ist riesig und grenzenlos, und schon um unsere Territorien zu entwickeln, brauchen wir eine Menge Zeit, Energie und Ressourcen. Wir haben kein Bedürfnis, uns in die Angelegenheiten anderer einzumischen oder ihnen Befehle zu erteilen, aber wir wollen auch, dass andere sich aus unseren Angelegenheiten heraushalten und aufhören, sich so aufzuführen, als regierten sie die Welt. Das ist alles. Wenn es irgendeinen Bereich gibt, in dem Russland ein Führer sein könnte, ist es die Bekräftigung der Normen des Völkerrechts.« Die US-Mainstreammedien haben eine massive Propagandakampagne betrieben, um die russische Realität verschwinden zu lassen, indem sie ihr eine fiktive Darstellung der Ukrainekrise überstülpen, bei der für alles einem hypothetischen Drang Putins, die Sowjetunion, das Zarenreich oder irgendetwas noch Schlimmeres wiederherzustellen, die Schuld gegeben wird. Aber die schnörkellosen Aussagen des russischen Führers werden im Rest der Welt gehört und sie ergeben Sinn. Selbst für Washingtons europäische Satelliten wird es immer schwerer werden, die russische Realität zu ignorieren. Die Führer der Vereinigten Staaten, an vorderster Front Hillary Clinton, verfolgen den Plan, das geografisch größte Land der Erde zu 214 »isolieren«. Vielleicht ist der nächste Punkt auf ihrer fantastischen Agenda die »Isolation« der bevölkerungsreichsten Nation, nämlich Chinas? Aber isoliert hier nicht eigentlich jemand sich selbst? Die große Frage ist: Kann irgendetwas außer einem katastrophalen Gewaltausbruch, wie etwa einem Atomkrieg, die USA aus ihrer Fantasie erwecken, sie seien die einzigartige Ausnahmenation, die für alle anderen die Gesetze festlegen kann und muss? 215 7 Die Kriegspartei »Führung kann man in der Welt nicht erreichen, indem man sich von der eigenen Exklusivität und gottgegebenen Pflicht überzeugt, für jeden verantwortlich zu sein, sondern nur durch die Fähigkeit und Kunst, einen Konsens zu bilden.« Sergej Lawrow, 22. November 20141 Die Bevölkerung der USA ist der Illusion verfallen, die »Ausnahmenation« zu sein, deren Auftrag die »Gestaltung« der Welt ist. Diese Illusion wird durch die vereinten Bemühungen der Massenmedien, der Intellektuellen des Verteidigungsestablishments, der Unterhaltungsindustrie und der mit Letzterer eng verbundenen Politiker und Kommentatoren aufrechterhalten. Hinter dieser Show steht eine Reihe von Sponsoren. Um zu wissen, wer diese Sponsoren sind, kann man sich die Liste der Spender der Clinton-Stiftung ansehen, die Millionen von Dollar angeblich für Wohltätigkeit gegeben haben – aber für eine Wohltätigkeit, die vor allem ihnen selber nützt. Zu den Spendern im zweistelligen Millionenbereich gehören Saudi-Arabien, der pro-israelische Oligarch Viktor Pintschuk und die Saban-Familie, zu den Spendern im einstelligen Millionenbereich Kuwait, ExxonMobil, die »Freunde Saudi-Arabiens«, James Murdoch, Katar, Boeing, Dow Chemical Company, Goldman Sachs, Walmart und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dann gibt es noch Geizhälse wie die Bank of America, Chevron, Monsanto, Citigroup und die unvermeidliche Soros-Stiftung, die lediglich Beträge im Bereich von etwa einer halben Million Dollar gespendet haben. Was haben die Clintons an sich, was sie so attraktiv macht, gerade für Saudi-Arabien?2 Mit Freunden wie diesen braucht man auch Feinde. Und Hillary Clinton weiß, wo diese zu finden sind – in Ländern, die jenen edlen Spendern verhasst sind. In ihrem verzehrenden Ehrgeiz, die erste Präsidentin der Vereinigten 216 Staaten zu werden, hat Hillary Rodham Clinton aus sich eine Figur der kollektiven Einbildung gemacht, indem sie in die Rolle der Topverkäuferin der Interessen der herrschenden Oligarchie geschlüpft ist. Sie verlegte ihr Interesse vom Eintreten für Kinderrechte, einem für das große Geld unattraktiven Gebiet, auf die Förderung militärischer Macht (»die einzige Sprache, die sie verstehen«). Sie verbreitete die Botschaft, die US-Einmischung in andere Länder sei durch den großzügigen Wunsch motiviert, »unsere Ideale« in die fernen Winkel der restlichen Welt zu bringen. Sie ist schnell bereit, andere Staatsoberhäupter mit entmenschlichender Verachtung zu behandeln, erklärt gern, sie hätten »keine Seele« oder »kein Gewissen«, und tut sie als Kreaturen minderer Art ab, die »gehen müssen«. Sie »verspricht sich«3, kann aber daran nichts Verkehrtes sehen. Wer in der Politik tut das nicht? Ihre Aufgabe besteht nicht darin, die Wahrheit zu sagen, sondern darin, eine Geschichte zu erzählen. Sie geriert sich immer noch als Frau, deren einziger Ehrgeiz darin besteht, »die Glasdecke zu durchbrechen« – aber zum Wohl aller Frauen, die danach endlich, Hillary sei Dank, Zugang zu all den TopPosten im Land haben werden. Kurz, sie hat auf ihrem Karriereweg an die Spitze sämtliche Stereotypen und Klischees über den »Ausnahmecharakter Amerikas« eingesetzt. Hillarys Amtszeit als US-Außenministerin war zumindest in einer Hinsicht ein großer Erfolg: Sie ist zur Lieblingskandidatin der Kriegspartei geworden. Und das ist offenbar auch ihr Hauptziel gewesen. Aber die Person Hillary Clinton ist keineswegs das ganze Problem. Das wirkliche Problem sind die Kriegspartei und der Würgegriff, in dem sie die US-Politik hält. Ein Grund, weshalb es so wenig Widerstand dagegen gibt, liegt darin, dass die von der Kriegspartei vom Zaun gebrochenen Waffengänge sich für die US-Amerikaner kaum wie Kriege anfühlen. Sie müssen nicht mit ansehen, wie ihre Häuser in Trümmer gelegt werden. Die DrohnenArmada macht Schluss mit der Unannehmlichkeit von Veteranen, die nach »Bodeneinsätzen« mit einem posttraumatischen Stresssyndrom nach Hause kommen. Der Krieg aus der Luft wird immer sicherer, ferner, unsichtbarer. Für die meisten US-Amerikaner sind die Kriege ihres Landes nur Teil der Unterhaltungsindustrie, etwas, das man im Fernsehen 217 mitbekommt, aber mit dem man selten direkt konfrontiert ist. Diese Kriege bringen einem etwas ernsthafte Unterhaltung für die Steuerdollar, die man zahlt, und sind nicht wirklich Sache von Leben und Tod. Tatsächlich scheint es kaum noch von Bedeutung, was in diesen Kriegen geschieht. Die USA führen nicht einmal mehr Krieg, um zu gewinnen, sondern nur, um dafür zu sorgen, dass die andere Seite verliert. Hillary Clinton warf Wladimir Putin einmal – durchaus zu Unrecht – vor, er sei Anhänger eines »Nullsummenspiel[s]: Wenn der eine gewinnt, muss ein anderer verlieren.«4 Die Vereinigten Staaten jedenfalls spielen ein noch schlimmeres Spiel, nämlich ein »No-Win«-beziehungsweise ein »Lose-Lose«-Spiel, bei dem die andere Seite verliert, bei dem aber auch die USA nicht gewinnen. Es sind letztlich die Kriege eines Spielverderbers, die geführt werden, um wirkliche oder eingebildete Feinde loszuwerden, und bei denen am Schluss alle schlechter dastehen als zu Anfang. Die US-Bevölkerung wird konditioniert, sich an diese negativen Kriege zu gewöhnen, deren erklärtes Ziel darin besteht, irgendetwas zu beseitigen – sei es ein Diktator, sei es der Terrorismus oder seien es Menschenrechtsverletzungen. Die Vereinigten Staaten streben die Vorherrschaft in der Welt an, indem sie die anderen Mitspieler vom Spielfeld werfen. Dabei sind »unsere Ideale« Teil des Kollateralschadens. Mit ihrem Durchgreifen gegen innere Feinde, der »Homeland Security« und dem »Patriot Act«5 opfern die USA nicht nur ihre eigene Freiheit. Sie untergraben damit auch den Glauben an die progressiven Werte selbst, und ebenso den an Demokratie, Fortschritt, Wissenschaft, Technologie und sogar an die Vernunft. Indem sie sich lauthals mit diesen Werten identifizieren, fördern die Vereinigten Staaten in Wirklichkeit deren Ablehnung, da sie in zunehmendem Maß nur noch als Feigenblatt für USAggressionen erscheinen. Was bringen demokratische und liberale Ideale, wenn sie zu Vorwänden reduziert werden, um Krieg führen zu können? Und doch ist sicher, dass zahllose US-Amerikaner Gegner der Kriegspartei sind – und zwar wesentlich mehr, als dem ProKriegsEstablishment klar ist. Aber zugleich fühlen sich diejenigen, die durch die Kriegsgefahr zunehmend alarmiert sind, außerstande, etwas dagegen zu tun. Das liegt daran, dass die Kriegspartei unser Zweiparteiensystem fest im Griff hat. Im März 2015 schrieb der Kolumnist und stellvertretende Finanzminister der Reagan-Administration Paul Craig Roberts: »Die Auslagerung von Arbeitsplätzen 218 hat die Industrie und die Branchengewerkschaften der USA zerstört. Ihr Niedergang und der gegenwärtige Angriff auf die Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes haben dazu geführt, dass die Demokratische Partei finanziell von denselben organisierten privaten Interessengruppen abhängig ist wie die Republikaner. Beide Parteien dienen nun denselben Interessengruppen. Wall Street, der Militärisch- und Sicherheitsindustrielle Komplex, die IsraelLobby, das Agrobusiness und die Rohstoffindustrien (Öl, Bergbau, Holz) üben die Kontrolle über die Regierung aus, egal, welche Partei an der Macht ist. Diese mächtigen Interessengruppen betrachten alle eine Hegemonie der USA als vorteilhaft für sich. Die Folge ist, dass diese Kräftekonstellation systeminternen politischen Wandel ausschließt.« Und er schloss: »Die Achillesferse dieser Hegemonie ist die US-Wirtschaft.«6 Wenn Roberts Recht hat – und es ist schwer erkennbar, wo er im Unrecht ist –, wäre das Einzige, was die Amerikaner von ihrer kriegerischen Fiktion befreien könnte, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch. Das ist keine schöne Aussicht, und es ist gar nicht angenehm, auf eine ökonomische Katastrophe als Ausweg setzen zu müssen, um eine nukleare Vernichtung zu verhindern. So bleibt nichts übrig, als zu hoffen, dass die US-Bevölkerung zur Vernunft kommt und einen Weg findet, der Kriegspolitik ein Ende zu setzen und zu einer konstruktiven Art des Umgangs mit der Welt zu gelangen. Ein solches gutes Ende ist theoretisch möglich, scheint aber aufgrund des politischen Systems der USA sehr unwahrscheinlich. Die US-Präsidentschaftswahlen sind im Wesentlichen ein großes Unterhaltungsdrama. Milliardenschwere Sponsoren schicken zwei sorgfältig geprüfte Wettbewerber in die Arena und sind sich sicher, so oder so zu gewinnen. Das intellektuelle Niveau des Streits zwischen Republikanern und Demokraten erinnert immer mehr an das der Zirkuswettrennen mit grünen Streitwagen auf der einen und blauen Streitwagen auf der anderen Seite, die das Byzantinische Reich spalteten. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 werden die Partei der guten Cops und die der bösen Cops sich heftig über Fragen der Innenpolitik streiten, bevor dann im Kongress sowieso alles wieder zum Stillstand kommt. Aber in Wirklichkeit ist das wichtigste Thema die Kriegsfrage. Da die Kriegspartei beide Zweige des Zweiparteiensystems dominiert, lässt die Erfahrung der letzten Jahre darauf schließen, dass die Republikaner einen Kandidaten nominieren, der so schlimm ist, dass Hillary Clinton sich neben ihm gut ausmacht. Aber nehmen wir einmal an, ein Wunder geschieht, und nach einer 219 echten Revolte der Bevölkerung nominiert eine der Parteien einen »Friedenskandidaten«. Das wäre ein gutes Zeichen, aber nicht genug. Wir erinnern uns, wie Obama »Veränderung« versprach und darin so überzeugend war, dass einige (angeblich) naive Juroren in Norwegen ihm sogar den Friedensnobelpreis verliehen. Danach ging er im Hinblick auf sinnlose, aggressive Kriegsaktionen sogar noch weiter als seine Vorgänger – wobei es aber auch Augenblicke des Zögerns gab, Augenblicke, die wir von Hillary Clinton nicht erwarten können. Selbst der aufrichtigste Friedenskandidat braucht ein Friedensteam, mit dem er bei seinem Machtantritt die Kriegspartei im Weißen Haus und im Außenministerium ersetzen kann. Trotz seiner Fensterreden hatte Obama kein Friedensteam und überließ daher die Macht derselben alten Kriegspartei. Es ist vielleicht noch nicht zu spät für einen radikalen Richtungswechsel der US-Politik. Die USA besitzen etliche hochgeeignete Kandidaten für ein solches Friedensteam. Um nur einige zu erwähnen, könnten wir mit Stephen Cohen7 als Botschafter in Moskau beginnen, unterstützt im Außenministerium von John Mearsheimer8, Stephen Walt9, Chas Freeman10 und vielen anderen. Ron Paul11 wäre ein ausgezeichneter Verteidigungsminister, der seinen eigenen Haushalt kürzt. Dennis Kucinich12 könnte ein neues Ministerium für den Übergang zum Frieden leiten, das nach Möglichkeiten zur Förderung friedlicher Beziehungen im Äußeren und einer Kultur des Friedens im Inneren forschen würde, auch das eine große Aufgabe. Cynthia McKinney13 sollte die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen sein. Die ehemalige FBI-Whistleblowerin Coleen Rowley14 ist sehr gut zur Beaufsichtigung der Sicherheitsdienste qualifiziert. William R. Pol15, Familiennachkomme des elften Präsidenten der USA, wäre ein guter Nationaler Sicherheitsberater des neuen Präsidenten dieser TraumAdministration. Und natürlich ist das alles ein Traum. Keiner dieser anständigen Menschen würde je von einem Senat bestätigt, dessen Mitglieder nicht nur alle den Wahlkampfspenden des AIPAC und verschiedener anderer, mit der Militärindustrie verbundener Lobbys verpflichtet sind, sondern mittlerweile auch selbst weitgehend an das Geschwätz glauben, das sie seit Jahren in den großen Zeitungen lesen. So sind Senat und Kongress nur zu oft selbst Teil oder gar Anstifter des großen Chors, der mit Verve die Mär von der »Ausnahmenation« verbreitet, die sich mutig der Bedrohung durch »die Bösen« 220 entgegenstemmt. Ein Friedenskandidat in letzter Minute wäre eine wunderbare Überraschung. Doch eine echte Alternative zur Kriegspartei muss langfristig aufgebaut werden. Das institutionelle Hindernis auf dem Weg dahin liegt auch im Kongress. Die Antikriegsbewegungen in den USA sind drastisch zurückgegangen, vielleicht deshalb, weil die Menschen nicht ganz grundlos das Gefühl haben, dass sie nutzlos sind. Tatsächlich ist die Art Antikriegs-bewegung, die zur Zeit des Vietnamkrieges populär war, heute nicht mehr angemessen. Ein Krieg, der wie der Vietnamkrieg mit einer Armee von Wehrpflichtigen betrieben wird, kann durch eine breite, von den Zentren der Macht unabhängige Antikriegsbewegung bekämpft werden, weil sie die Loyalität des Kanonenfutters bedroht. Außerdem standen die USA in Vietnam einem entschlossenen, erfahrenen Gegner gegenüber, dessen Sieg auch deshalb unvermeidlich war, weil das vietnamesische Volk nicht nur die Kolonialherrschaft, sondern auch die neokoloniale Herrschaft der Vereinigten Staaten ablehnte. Inzwischen hat die Kriegsmaschine gelernt, wie man ohne unwilliges Kanonenfutter Krieg führt. Tod und Zerstörung bleiben unsichtbar. Mit ihrem Versuch zur Wiederbelebung der Bewegung gegen den Vietnamkrieg verurteilen sich die wenigen Antikriegsbewegungen, die es noch gibt, fast mutwillig zur Marginalität. In ihnen versammeln sich inoffizielle Vertreter von Identitätsgruppen, die ein vages Gefühl der Entfremdung vereint und die sich offenbar stärker den Themen der Identitätspolitik verpflichtet fühlen als der Verhinderung von Krieg. Und die Mainstreammedien geben sich heute in der Regel völlig der Desinformation der Öffentlichkeit hin und beten den Diskurs der Kriegspartei nach. Kriege, die aus der Ferne, durch Söldner und durch Drohnen ausgefochten werden, müssen von oben gestoppt oder am Ende durch den Gegner oder den Zusammenbruch im eigenen Land beendet werden. Das heißt, eine Friedenspartei braucht also eine Strategie, den Krieg von oben her zu stoppen. Der Aufstieg Hillary Clintons sollte klarmachen, dass das Festhalten an der Demokratischen Partei als »kleinerem Übel« total gescheitert ist. Eine Friedenspartei muss unparteilich und überparteilich sein und alle Menschen zusammenführen, die von der gemeinsamen Kriegspartei der Neokonservativen und der humanitären Heuchler die Nase voll haben. Sie alle können sehr verschiedene innenpolitische Ansichten haben, aber trotzdem begreifen, dass Krieg eine Frage von Leben und Tod ist. 221 Die europäischen Verbündeten der USA, die bisher die ihnen zugewiesene Rolle der US-geführten »internationalen Gemeinschaft« spielen, könnten hier einen entscheidenden Unterschied machen. Wenn sie ihren Gehorsam gegenüber dem hegemonialen US-Projekt ablegen und versuchen würden, zusammen mit dem BRICS-Block und anderen Ländern eine echte internationale Gemeinschaft aufzubauen, könnten die Länder Europas einen entscheidenden Beitrag leisten für einen Wechsel weg vom Krieg und hin zur Diplomatie als Schlüssel der internationalen Beziehungen. Aber davon sind sie bisher weit entfernt. Also stellt sich die Frage: Was tun? Das können die Bürger erst herausfinden, wenn sie wissen, was auf dem Spiel steht. Soweit ist es leider noch nicht. Die USA können nicht weiterhin die ganze Welt in ihrem Griff halten. Die Frage ist: Können die USA sich selbst in den Griff bekommen? Die tiefsten Weisheiten sind uralt und einfach. »Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall.«16 Das ist eine Lehre, die hoffentlich fast jeder versteht. 222 Anmerkungen Vorwort zur deutschen Ausgabe 1 Robert Scheer, »An Idiotic GOP Is Looking at the Wrong Thing in Its Clinton Probe«, truthdig, 24.10.2015 2 Eine andere Meinung über diese Bombardierung äußerte der ehemalige britische Botschafter in Usbekistan Craig Murray in einem Interview am 28.8.2014 kurz vor der Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands. Murray bezeichnete Großbritannien als zutiefst unmoralischen, pathologischen Schurkenstaat und eine Gefahr für die Welt und führte zum Beweis die britische Beteiligung an den USgeführten Kriegen im Irak und in Libyen an: »Wenn man sich Libyen ansieht, ist es eine Katastrophe, jetzt, wo wir es bombardiert und 15 000 Menschen getötet haben, als die NATO Sirte bombardierte, etwas, was die BBC uns nie berichtet hat. Haben wir es zu einem besseren Ort gemacht? Nein.« RIA Novosti, 28.8.2014 3 Robert Parry, »Hillary Clinton’s Failed Libya Doctrine«, Consortium News, 22.10.2015 4 Ebd. 5 Seymour M. Hersh, »Military to Military«, London Review of Books, Vol. 38, Nr.1, 7.1.2016 6 In Anspielung auf das Münchener Abkommen von 1938 zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien, mit dem Letztere beide die Abspaltung der von Deutschen besiedelten Sudetengebiete von der Tschechoslowakei und ihren Anschluss an Hitlerdeutschland akzeptierten. Diese damalige Konzession an das Naziregime gilt nicht zu Unrecht als Signal an Hitler, dass weitere aggressive Schritte Deutschlands nicht auf nennenswerten Widerstand des Westens stoßen würden. Einführung 223 1 In diesem Buch werden für Hillary Clinton (wie in den USA üblich) verschiedene Benennungen gebraucht, so etwa Hillary Rodham (ihr Geburtsname), Hillary Rodham Clinton (ihre selbstgewählte öffentliche Bezeichnung), HRC (eine in den US-Medien oft verwendete Abkürzung) und, am häufigsten, einfach Hillary. Letzteres impliziert weder Herablassung noch unangemessene Vertraulichkeit; auch dieser Gebrauch ist in den US-Medien und sogar im USKongress üblich und unter Clinton-Biografen wie Carl Bernstein und Gail Sheehy sogar ganz selbstverständlich. Dass die ansonsten naheliegende fünfte Alternative, Clinton, nur selten verwendet wird, hat den simplen Grund, dass es einen anderen Clinton gibt, der lange Zeit so mächtig war, wie es die Frau, die Gegenstand des vorliegenden Buches ist, erst noch werden will. 2 George F. Kennan, Memo PPS23, 28. Februar 1948, freigegeben 17. Juni 1974, zitiert nach Noam Chomsky, Vom politischen Gebrauch der Waffen. Zur politischen Kultur der USA und den Perspektiven des Friedens, Wien 1987, S. 56 3 Also gibt es keine Straßennetze, pittoresken Gebäude, Museen, Eisenbahnlinien und so weiter, wie das nach dem Ende klassischer Kolonialherrschaft oft der Fall war. Hinzu kommt aber auch, dass die USA in ihrer Kriegs- und Nachkriegspolitik seit langem der puren Zerstörung verpflichtet sind. Während die USA nach dem Zweiten Weltkrieg großzügige internationale Hilfsprogramme (wie den Marshall-Plan) für die besiegten Angreifer wie Deutschland und Japan auflegten, sahen die von US-Aggressionskriegen komplett zerstörten Länder Indochinas (Kambodscha, Laos und Vietnam) nie einen Cent an Hilfe, geschweige denn Reparationen – und das ist nur ein Beispiel unter vielen. 4 Carl Bernstein, Hillary Clinton. Die Macht einer Frau, München 2007, S. 642 5 Auf Seite 69 ihres Buches Entscheidungen (München 2014) umreißt Hillary Clinton dieses Konzept als Durchbrechen von »alten, starren Kategorien von entweder >hard power< (militärische Stärke) oder >soft power< (diplomatischer, wirtschaftlicher, humanitärer und kultureller Einfluss)«, um »auf einer breiteren Basis darüber nachzudenken, wie wir all diese Elemente zugleich nutzen konnten«. Dabei kommt sie zu dem Schluss: »Diese Bestandsaufnahme bewog mich dazu, das Konzept der Smart Power aufzugreifen, das schon seit ein paar Jahren in Washington kursierte. Auch wenn ich es etwas anders auslegte als etwa der Harvard-Professor Joseph Nye und 224 Suzanne Nossel von Human Rights Watch. Für mich bedeutete Smart Power, in einer bestimmten Situation die Wahl zu haben zwischen diplomatischen, wirtschaftlichen, militärischen, politischen, gesetzlichen und kulturellen Instrumenten – oder diese miteinander zu kombinieren.« Für mehr zu Nossel, Nye und dem Begriff der »smart power« siehe Kapitel 3 dieses Buches. 6 Ebd., S. 394 7 Ebd. 8 Ebd., S. 402. Wie Hillary in Entscheidungen triumphierend beschreibt, hatten ihre Manöver letztlich Erfolg. 9 Ebd. 10 1823 erklärte der damalige US-Präsident James Monroe die gesamte westliche Hemisphäre, also Nord- und Südamerika, zu einer Zone, in der nur noch »Amerikaner«, nicht aber die alten europäischen Kolonialmächte etwas zu suchen hätten. Zugleich erklärte er die Nichtintervention der USA in europäische Angelegenheiten zum Prinzip der US-Außenpolitik. 11 Gemeint ist das mit Brasilien und Chile ausgehandelte Vorgehen gegenüber Kuba. 12 Ebd., S. 403–404 13 Ebd., S. 405 14 Siehe u.a. »Gewalt in Honduras: Tausende demonstrieren für Frieden«, Spiegel Online, 4. Juli 2013 15 ALBA steht für »Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America«. Die »Alternativa« wurde später in »Alianza« umbenannt. 16 Zitiert nach Eva Golinger, »Washington behind the Honduras coup: Here is the evidence. Repression intensifies«, Global Research Website, 15. Juli 2009 17 Hillary Clinton, Entscheidungen, S. 407 18 Ebd., S. 407 f. 19 Ebd., S. 407 f. 20 U.S. Department of State, »Background Briefing on the Situation in Honduras«, 1. Juli 2009, auf der Website des US-Außenministeriums http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125564.htm. 21 Matthew Pulver, »Hillary Clinton sold out Honduras: Lanny Davis, corporate cash, and the real story about the death of a Latin American democracy«, Salon, 5. Juni 2015 22 Entscheidungen, S. 408 23 Ebd., S. 409 24 U.S. Department of State, Hillary Rodham Clinton, »Honduras 225 Independence Day«, Press Statement, 13. September 2010, http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/09/147052.htm 25 Dana Frank, »Dinner With Obama: Repression’s Reward in Honduras?”, Coun-terpunch, 23. September 2010 26 Rights Action, »Killings and Attempted Killings in Honduras, from May 2012-to the Present, Linked to Electoral Process«, 21. Oktober 2013 27 Maurice Lemoine, »Au Honduras, le pays des coups d’Etat quotidiens«, Memoire des Luttes, 5. Mai 2015; siehe http://www.medelu.org/_Maurice-Lemoine 28 Dana Frank, »A High Stakes Election in Honduras«, The Nation, 25. November 2013; in diesem Artikel wird auch Human Rights Watch zitiert. 29 Dana Frank, »Who’s Responsible for the Flight of Honduran Children?«, Huffington Post, 7. September 2014 30 Ebd. 31 Elise Foley, »Hillary Clinton: Unaccompanied Minors >Should Be Sent Back<«, Huffington Post, 16. Juni 2014, mit Video unter http://www.huffingtonpost.com/2014/06/18/hillary-clintonimmigration_n_5507630.html. 1 Der Ritt auf dem Tiger: Hillary Clinton und der Militärisch-industrielle Komplex 1 Martin Gilens und Benjamin I. Page, »Testing Theories of American Politics: Eli-tes, Interest Groups, and Average Citizens«, Perspectives on Politics, Zeitschrift der American Political Science Association, September 2014, Vol. 12, S. 3 2 Ebd. 3 Für eine Zusammenfassung der Rede Eisenhowers siehe Ronald D. Gerste, »Ei-senhowers Warnung vor einem Staat im Staat«, Neue Zürcher Zeitung, 18. Januar 2011 4 Für Auszüge siehe http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm? smtID=3&psid=3630 5 Siehe u. a. Bernd Stöver, Der Kalte Krieg: 1947–1991. Geschichte eines radikalen Zeitalters, München 2011, S. 14 6 In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden, dass laut einer neuen Studie der Freien Universität Berlin (FU) 60 Prozent der 226 Ostdeutschen den Sozialismus oder Kommunismus für eine gute Idee halten. Auch 37 Prozent der Westdeutschen stimmen dem zu. Siehe dazu den Kurzbericht »Studie: Linksex treme Einstellungen sind weit verbreitet« (http://www.fuberlin.de/presse/informationen/fup/2015/fup_15_044-studielinksextremismus/index.html). 7 Jackson und sein Mitarbeiter Richard Perle setzten sich auch für eine Ausreisegenehmigung für den ukrainischen Wehrdienstverweigerer Anatoli (später Natan) Scharanski ein, der bald nach seiner Ankunft in Israel zu einem führenden ultranationalistischen Politiker wurde und sich heute der Aufgabe widmet, französische Juden zur Emigration nach Israel zu überreden. 8 Wer der Urheber dieser Formulierung ist, ist ungewiss, und sie ist im Lauf der Jahre sowohl von Bill Clinton als auch von G. W. Bush und vielen anderen verwendet worden, um die inhärente Friedfertigkeit von »Demokratien« zu unterstreichen. Für eine Studie zu den Auffassungen von Paul Wolfowitz siehe Bernd W. Kubbig, Wolfowitz’ Welt verstehen. Entwicklung und Profil eines »demokratischen Realisten«, HSFK-Report 7/2004, http://www.hsfk.de/downloads/report0704.pdf 9 Bei den Wahlen im Dezember 1990, die auch in der westlichen Presse als frei galten, wurde Milošević mit 65 Prozent der Stimmen zum Präsidenten Serbiens gewählt. Im Juli 1997 wählte ihn das – ebenfalls frei gewählte – jugoslawische Bundesparlament zum Präsidenten Jugoslawiens. 10 »Projekt für ein Neues Amerikanisches Jahrhundert« 11 https://web.archive.org/web/20050205041635/http://www.newamericancentury.or 12 »Komitee für Frieden und Sicherheit am Golf« 13 http://www.sourcewatch.org/index.php/Committee_for_Peace_and_Security_in_the 14 Sowie Richard Armitage, John Bolton, Stephen Bryen, Douglas Feith, Frank Gaffney, Fred Ikle, Zalmay Khalilzad, William Kristol, Michael Ledeen, Bernard Lewis, Peter Rodman, Gary Schmitt, Max Singer, Casper Weinberger, David Wurmser und Dov Zakheim 15 Das englische Wort »con« ist nicht nur eine Abkürzung von »Konservativer«, sondern heißt eigentlich »Betrüger«. 16 Das »American Israel Public Affairs Committee« (Deutsch: »Amerikanisch-israelischer Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten«) ist eine der einflussreichsten Lobbyorganisationen 227 in den USA mit über 100 000 Mitgliedern, die auch außerhalb der Wahlkämpfe unermüdlich für das wirbt, was sie als »die Interessen Israels« versteht. 17 Connie Bruck, »The Influencer«, The New Yorker, 10.5.2010 18 Ebd. 19 Siehe »Chirac verplaudert sich beim Thema Iran«, Focus Online, 1.2.2007, wo Chirac mit den Worten >Teheran würde dem Erdboden gleichgemacht, noch bevor sie [die hypothetische iranische Nuklearrakete] 200 Meter weit in die Atmosphäre gelangt wäre.< zitiert wird. Chirac ruderte unmittelbar nach den ersten Berichten über seine Aussagen rasch zurück. 20 Lynne Duke »First Lady Criticized After Palestinian’s Remarks«, Washington Post, 13.11.1999 21 Jason Horowitz, »Can Liberal Zionists Count On Hillary Clinton?«, The New York Times, 17.12.2014 22 Jennifer Siegel, »Hillary to Aipac: Talk to Tehran, But Keep All Options Open«, miftah.org, 6.2.2007 23 »Clinton: Obama is >naive< on foreign policy. Chicago senator accuses rival of standing with Bush on rogue nations issue«, NBCNEWS.COM, 24.7.2007 24 Ron Kampeas »Clinton: Undivided Jerusalem«, Jewish Telegraphic Agency, 12.9.2007 25 Annie Karni, »In letter, Clinton condemns Israel boycott movement«, Politico, 15.6.2015 26 Ebd. 27 Der Goldstone-Bericht über den Gazakrieg 2008/2009 für die Vereinten Nationen fand Beweise für »mögliche Kriegsverbrechen« und »mögliche Verbrechen gegen die Menschheit« sowohl durch Israel als auch durch Hamas. Unter dem Druck von »Freunden Israels« wie Hillary Clinton verwarf Richard Goldstone im April 2011 zum Teil seinen eigenen Bericht und erklärte: »Dass die angeblich von Hamas begangenen Verbrechen vorsätzlich waren, versteht sich von selbst ihre Raketen waren absichtlich und unterschiedslos auf zivile Ziele gerichtet.« Israel dagegen sei ein unklarerer Fall und versuche, seine Fehler zu korrigieren. Siehe Richard Goldstone, »Reconsidering the Goldstone Report on Israel and war crimes«, Washington Post, 1.4.2015 28 Hillary Clinton, »How I Would Reaffirm Unbreakable Bond With Israel – and Benjamin Netanyahu«, The Forward, 4.11.2015. Der Tenor der Rede ist gleich nach den ersten einleitenden Sätzen zu 228 erkennen: »Mein erster Besuch in Israel im Dezember 1981 schuf eine dauerhafte emotionale Bindung für mich – zu dem Land und seinem Volk – und Bewunderung dafür, wie die Israelis eine blühende Demokratie in einer Region voller Widersacher und Autokraten aufgebaut haben. […] Auf dieser ersten Reise verliebten Bill und ich uns, während wir durch die historischen Straßen der Altstadt liefen, in Jerusalem.« Und bereits vorher: »Das Bündnis zwischen unseren beiden Ländern geht über Politik hinaus.« 29 Gideon Levy, »Hillary Clinton Is No Friend of Israel«, Haaretz, 8.11.2015 30 Colin Powell, Mein Weg, München 1996, S. 603 2 »Multikulturalismus« ä la Hillary: Unsere einzigartigen »Werte« und »Interessen« 1 Früher TAFTA (»Trans-Atlantic Free Trade Agreement«). TTIP steht für »Trans-atlantic Trade and Investment Partnership«. 2 Derzeit werden intensive Geheimverhandlungen zum Abschluss von TTIP geführt. Das Abkommen wird ungeachtet wachsender Opposition in der Bevölkerung von den Großkonzernen und der politischen Klasse auf beiden Seiten des Atlantik enthusiastisch unterstützt. 3 Für »Responsibility to [daher kommt die im Englischen gleich ausgesprochene >2<] Protect« 4 Hier und im folgenden Phoebe Greenwood, »Edward Snowden should have right to legal defence in US, says Hillary Clinton«, The Guardian, 4.7.2014 5 »Statement by Secretary of State Hillary R. Clinton on Wikileaks«, Embassy of the United States, Pristina, Kosovo, 30.11.2010 6 Siehe »Collateral Murder – Wikileaks – Iraq«, https://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0 7 Hillary Rodham Clinton, Entscheidungen, München 2014, S. 827 8 Interview mit Amy Goodman auf Democracy Now!, 9.7.2014 9 »Gesetz zum Schutz von Whistleblowern in den Nachrichtendiensten« 10 Eine knappe Darstellung gibt Ellen Nakashima, »Ex-NSA manager accepts plea bargains in Espionage Act case«, Washington Post, 9.6.2011 11 Interview mit Amy Goodman auf Democracy Now!, 9.7.2014 12 Albright äußerte 1993 gegenüber dem Stabschef der US-Armee Colin Powell: »Wozu haben wir eigentlich dieses tolle Militär, von dem Sie 229 dauernd reden, wenn wir es nicht einsetzen können?« Siehe Colin Powell, Mein Weg, München 1996, S. 603 13 Deutsch: »Strategischer Dialog mit der Zivilgesellschaft« 14 Hier und im folgenden Hillary Rodham Clinton, »Remarks at the Launch of Strategic Dialogue with Civil Society«, http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/02/156681.htm (mit Video) 15 Es sei denn es handelt sich um befreundete Herrscher wie in SaudiArabien und Bahrain, die praktisch nie als »Diktatoren« bezeichnet werden, obwohl in beiden Staaten insgesamt die Mehrheit vom politischen Leben ausgeschlossen ist. 16 Wie zum Beispiel der französische »Zivile Solidaritätspakt« (»Pacte Civil de Solidarité«, abgekürzt PACS), der am 15. November 1999 zum Gesetz wurde. Er ermöglicht es, von nahen Verwandten abgesehen, jedem Paar von Erwachsenen mit demselben Aufenthaltsort ohne Ansehen des Geschlechts, Steuer- und Erbschaftsrechte in Anspruch zu nehmen, die denen einer Ehe ähnlich sind. Die Formalitäten sind gegenüber der Ehe vereinfacht, und der Pakt kann im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst werden, ohne dass ein Scheidungsverfahren nötig ist. 17 Margaret Mead, Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften, I. Kindheit und Jugend in Samoa, München 1970 18 Derek Freeman, Liebe ohne Aggression. Meads Legende von der Friedfertigkeit der Naturvölker, München 1983 19 Zitiert aus Entscheidungen, S. 864 20 Der repressive Charakter der Gesetze, die für viele dieser Geschlechtsumwandlungen der Grund sind, soll damit nicht in Abrede gestellt werden. Siehe Martin Gehlen, »Geschlechtsumwandlung oder Strafe«, Zeit Online, 24.2.2014 21 In Entscheidungen verwendet sie volle sieben Seiten (S. 862–869) auf diese Rede und die Umstände ihres Zustandekommens. 22 Für den vollständigen Text der Rede siehe http://www.odec.umd.edu/CD/LGBT/Clinton.pdf 23 In den Jahren von 1990 bis 1999, also im Wesentlichen denen unter Boris Jelzin, verzeichnete Russland gegenüber der vorherigen statistischen Prognose mehr als 2,5 Millionen zusätzliche Sterbefälle; gleichzeitig kam es in der kurzen Spanne zwischen 1989 und 2001 zu einem drastischen Rückgang der Lebenserwartung bei Frauen um 3,0 und bei Männern um 7,7 Jahre. Die Geburtenrate war schon zwischen 1980 und 1992 um fast 50 Prozent abgestürzt und sank auch danach 230 noch weiter. Siehe Michael Haynes und Rumy Husan, A Century of State Murder? Death and Policy in Twentieth-Century Russia, London 2003, S. 147, 148 und 145 24 Nach der Lutherbibel von 1912; siehe http://bibeltext.com/matthew/65.htm 25 Kathryn Joyce und Jeff Sharlet, »Hillary^ Prayer: Hillary Clinton’s Religion and Politics«, Mother Jones, 1.9.2007 26 Siehe dazu http://jeffsharlet.blogspot.de/2008/02/blog-post.html 27 Kathryn Joyce und Jeff Sharlett, »Hillary^ Prayer: Hillary Clinton’s Religion and Politics«, Mother Jones, 1.9.2007 28 »Gesetz für die religiöse Freiheit von Arbeitnehmern« 29 Hillary Rodham Clinton, »Swearing-In Ceremony for Farah Pandith Special Re-presentative to Muslim Communities«, http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2009a/09/129209.htm 30 Siehe u.a. Heiko Roloff, »Huma Abedin. Das ist Clintons engste Verbündete«, Bild Online, 31.10.2015; dieser Bericht versucht sich an einer umfassenderen Darstellung Huma Abedins und ihres Verhältnisses zu Hillary Clinton (http:// www.bild.de/politik/ausland/hillary-clinton/das-ist-ihre-schaerfstewaffe-43066894.bild.html) 31 Steve Kornacki, »The dirty trick that launched Anthony Weiner’s career «, Salon, 7.6.2011, und Steve Kornacki, »The woman Anthony Weiner smeared speaks out«, Salon, 10.6.2011 32 Mark Pitzke, »Skandal-Abgeordneter: Vom Weiner zum Würstchen«, Spiegel Online, 7.6.2011, und zwei Jahre später erneut: »New York: Bürgermeister-Kandidat Weiner räumt weitere Nacktbilder ein«, Spiegel Online, 24.7.2013 33 Oliver Burkeman, »Palestinian delegation attacked by congressman«, The Guardian, 25.5.2006 34 Hilary Leila Krieger, »Some Congressmen come out against US-Saudi arms deal«, The Jerusalem Post, 17.9.2010 35 Craig Whitlock, »U.S. secretly backed Syrian opposition groups, cables released by WikiLeaks show«, Washington Post, 17.4.2011; Original unter https://wikileaks.org/plusd/cables/09DAMASCUS185_a.html 36 Zu den Lügen Chalabis und anderer zu den Massenvernichtungswaffen siehe Nicholas J.S. Davies, Blood on Our Hands. The American Invasion and Destruc-tion of Iraq, Ann Arbor 2010, Kapitel 4: »Imagining Weapons of Mass Destruc-tion« 37 Siehe Julia Gorin, »My Letter Published in the Wall Street Journal: 231 Bob Dole’s Corrupted Opinion on Bosnia«, Huffington Post, 18.3.2010 38 Morton H. Halperin, David J. Scheffer und Patricia L. Small, SelfDetermination in the New World Order, Washington 1992 39 Nicht nur die Autorin selbst, sondern auch andere Beobachter können diese gespenstischen, inzwischen offenbar gelöschten oder anderswohin umgezogenen »Internetauftritte« bezeugen. Sie sind umso leichter unter dem Radar westlicher Medien geblieben, als sie oft arabischsprachig waren. 40 Das erste dieser Massaker, bei dem 68 Menschen ums Leben kamen, fand am 5. Februar 1994, das zweite mit 41 Todesopfern am 28. August 1995 statt. Siehe dazu u.a. Hannes Hofbauer, »Neue Staaten, neue Kriege«, in: Hannes Hofbauer (Hg.), Balkankrieg. Die Zerstörung Jugoslawiens, Wien 1999, S. 47–196; die beiden sogenannten »Markale-Massaker« werden unter der Überschrift »Zwei Massaker auf dem Marktplatz – und die Folgen« auf S. 103– 109 behandelt. Zur publizistischen Behandlung und propagandistischen Ausschlachtung des ersten dieser Attentate siehe Wolfgang Schneider, »Totaler Konsens. Ein Attentat in Schlagzeilen«, in: Wolfgang Schneider (Hg.), Bei Andruck Mord. Die deutsche Propaganda und der Balkankrieg, Hamburg 1997, S. 143–148 41 Vgl. dazu Noam Chomsky, A New Generation Draws the Line. Kosovo, East Timor and the Standards of the West, London 2000; deutsch: People without Rights. Kosovo, Ost-Timor und der Westen, Hamburg 2002 42 Der Name Jugoslawien bedeutet nichts anderes als »Süd-Slawien«. 43 Siehe hierzu mein Buch Fool’s Crusade. Yugoslavia, NATO and Western Delusions, London 2002 44 Siehe dazu Nora Beloff, Yugoslavia. An Avoidable War, London 1997 45 Auf Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien_und_Herzegowina#cite_note11) heißt es zur Frage der religiösen Aufteilung der Bevölkerung: »Die Volkszählung 1991 ergab 44 Prozent Muslime (größtenteils Bosniaken), 31,5 Prozent Serbisch-Orthodoxe (größtenteils Serben), 17 Prozent Katholiken (größtenteils Kroaten).« 46 Ich habe diese Videos, die inzwischen vermutlich gelöscht worden sind, seinerzeit selbst im Internet gesehen. Auszüge davon gab es in der nicht mehr existierenden, nach einer Propagandakampagne diverser Mainstreammedien durch hohe gerichtliche Strafandrohungen mundtot gemachten britischen Zeitschrift Living Marxism, siehe 232 http://www.yugofile.org.uk/pdfs/lm_heads.pdf. Siehe außerdem »American Official Shields Bosnian Muslim Generals from War Crimes Trial«, De[construct].net, 21.8.2009. Außerdem »E’ vero, i mujahidin tagliavano teste«, Il manifesto, 8.7.2007, ein Interview mit dem ehemalige General der muslimisch-bosnischen Armee, Hasan Efendić, der ein Buch über die islamistischen Kämpfer in seiner Armee schrieb und in diesem Gespräch über sie unter anderem sagte: »Es stimmt, dass sie Leuten den Kopf abhackten, aber nicht Frauen und Kindern.« Ein Beispiel für ein immer noch existierendes Video für die »Fußballspiele«, dessen Authentizität allerdings aufgrund seines Publikationsorts (eine Gruppe fanatisch-christlicher Sektierer) in Frage steht, findet sich hier: http://shoebat.com/2013/12/29/muslimsplay-soccer-heads-victims/. 47 Auf Deutsch siehe Rebiya Kadeer, Die Himmelsstürmerin: Chinas Staatsfeindin Nr. 1 erzählt aus ihrem Leben, München 2008. Auf der Website ihres Verlags wird Kadeer stolz als »einst reichste Frau im Reich der Mitte« gepriesen. 48 Madeleine K. Albright und William S. Cohen, Preventing Genocide: A Blueprint for U.S. Policymakers, Washington 2008. Als PDF unter http://www.ushmm.org/m/pdfs/20081124-genocide-preventionreport.pdf. Wie ein Blick auf die Website des United States Holocaust Memorial Museum zeigt, war die Task Force auch danach höchst aktiv: http://www.ushmm.org/confrontgenocide/about/initiatives/genocide-prevention-task-force. 49 »Imagine the Unimaginable: Ending Genocide in the 21st Century«, Symposium des US Holocaust Memorial Museums und anderer Veranstalter; das gesamte Symposium ist auf der Website des Museum als Video verfügbar. 50 Tatsächlich mehren sich die Anzeichen, dass eine der Dimensionen der blutigen Monate im Frühjahr und Sommer 1994 in Ruanda ein gegenseitiges Abschlachten von Tutsi und Hutu war. Hinzu kam innerethnische Gewalt vor allem unter den Hutu. Zu dieser weithin vernachlässigten Problematik siehe Edward S. Herman und David Peterson, The Politics of Genocide, New York 2010, S. 51–68, und das Buch derselben Autoren Enduring Lies. The Rwandan Genocide in the Propaganda System, 20 Years Later, Baltimore 2014. 51 Siehe http://www.taylor-report.com/Rwanda_1994/ch7.php; dort findet sich auch eine aufschlussreiche Erläuterung des Kontextes. 52 »Refusing to Call It Genocide: Documents Show Clinton Administration Ignored Mass Killings in Rwanda«, Democracy Now!, 233 7.4.2014. Eine weitere sehr interessante Quelle desselben Zitats ist Samantha Powers, »Bystanders to Genocide«, The Atlantic, September 2001. Ihr Artikel nutzt das damalige Verhalten der ClintonAdministration, um für vermehrte »humanitäre« Interventionen in der Zukunft zu werben. 53 William J. Clinton, »Remarks at the United States Naval Academy Commence-ment Ceremony in Annapolis, Maryland«, 25.5.1994; http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=50236 (auf der von John Woolley und Gerhart Peters betriebene Website »The American Presidency Project«). 54 Siehe den Interviewteil der PBS-Website Ghosts of Rwanda, »Interview Boutros Boutros-Ghali«, PBS Frontline, 21.1.2004, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/ghosts/interviews/ghali.html 55 Basierend auf einem von ihr selbst in Auftrag gegebenen Untersuchungsbericht hat die ruandische Regierung 2008 behauptet, Frankreich habe sich auf Seiten der Hutu aktiv am Massenmord beteiligt. An der Unabhängigkeit dieses Berichts sind allerdings Zweifel angebracht; er wurde erstellt, nachdem die ruandische Regierung im November 2006 die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich abbrach, »nachdem ein französischer Richter Haftbefehl gegen enge Mitarbeiter des Präsidenten wegen der Ermordung des damaligen Staatschefs Juvénal Habyarimana erlassen hatte«. Siehe »Ruanda: Frankreich war aktiv am Völkermord beteiligt«, Tagesspiegel, 5.8.2008 56 »Interview Boutros Boutros-Ghali«, PBS Frontline, 21.1.2004 57 Wie ich es selbst damals wiederholt getan habe. 58 Der Artikel von Thomas Scheen, »Vom Friedensbringer zum autoritären Herrscher«, FAZ.net, 9.8.2010, wirft ein interessantes Schlaglicht auf die Situation in Ruanda vor der Wahl; zum Wahlergebnis selbst siehe Horand Knaup, »Ruandas Wahlsieger Kagame: Erst der Wohlstand, dann die Moral«, Spiegel Online, 11.8.2010. Ebenfalls angemerkt werden sollte die bizarre Art, wie beide Artikel der Tatsache ausweichen, dass Kagame wohl kaum der favorisierte Kandidat der meisten Hutu gewesen sein dürfte, die 90 Prozent der Bevölkerung repräsentierten. Dennoch endete Knaups Artikel auf Spiegel Online mit den Sätzen: »Nun hat Kagame zwar eindrucksvoll die Wahl gewonnen, doch die Loyalität seines Volkes noch lange nicht. Allen Fortschritten zum Trotz.« 59 Die Massaker in der Demokratischen Republik Kongo gehen bis heute weiter, und die ruandische Regierung und ihr Hauptverbündeter, das 234 extrem homosexuellenfeindliche Regime Yoweri Musevenis in Uganda, sind nach wie vor maßgeblich beteiligt daran. 60 Abgesehen von der erwähnten, sich kurz darauf im Kongo ausbreitenden Tötungsorgie. 61 Als sie in Ruanda eingreifen konnten, aber nicht wollten, sagten die USA, es sei kein Völkermord, und später, als sie die »Lehren aus Ruanda« für sich nutzen wollten, sagten sie: Wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht, es war Völ kermord. Nie wieder! Gleichzeitig handelt es sich heute im Kongo wiederum um keinen Völkermord, denn dort wollen die USA ja wieder, wie seinerzeit in Ruanda, nicht eingreifen. 62 Charles Onana, Les Secrets de la Justice Internationale, Paris 2005, S. 367–370 63 Samantha Powers, A Problem from Hell. America and the Age of Genocide, New York 2002 64 Siehe u.a. Michael Mandel »The ICTY and Srebrenica«, in: Edward S. Herman (Hg.), The Srebrenica Massacre. Evidence, Context, Politics, http://resistir.info/livros/srebrenica_massacre_rev_3.pdf, S. 211–223 65 Eine gängige Schätzung der Zahl der Toten des US-amerikanischen Indochina-kriegs, dessen offizieller Beginn meist auf 1964 oder 1965 angesetzt wird, liegt bei vier Millionen getöteten Vietnamesen, Laoten und Kambodschanern. Im Fall Kambodschas gab US-Präsident Richard Nixon im Dezember 1970 gegenüber seinem berühmtberüchtigten Nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger die Devise aus: »Alles, was fliegt, auf alles, was sich bewegt« – eine Order, die dann auch in die Tat umgesetzt wurde. Siehe die Studie von Taylor Owen und Ben Kiernan, »Bombs Over Cambodia«, http://www.yale.edu/cgp/Walrus_CambodiaBombing_OCT06.pdf, die zu dem Schluss kommt, der Bombenkrieg in Kambodscha sei das schwerste Bombardement der Weltgeschichte gewesen. Aber aufgrund der Analyse der Gespräche zwischen Nixon, Kissinger und USVerteidigungsminister Alexander Haig, dem Kissinger Nixons Order weitergab, kommt sie auch zu einem weiteren hier relevanten Schluss: nämlich dem, dass das unterschiedslose Töten Hunderttausender Kambodschaner mit Absicht geschah. 3 Die Zähmung durch die Widerspenstigen 1 Zu Jeane Kirkpatrick siehe auch Noam Chomsky, Vom politischen 235 Gebrauch der Waffen. Zur politischen Kultur der USA und den Perspektiven des Friedens, Wien 1987, S. 16, wo sie mit folgenden Worten zitiert wird: »Angestammte Autokraten [wie wir sie nach Kirkpatrick unterstützen und unterstützen sollten] rühren nicht an die bestehende Verteilung von Reichtum, Macht, Ansehen und anderen Ressourcen, die in den meisten traditionellen Gesellschaften einige wenige Reiche bevorzugen und die Massen in Armut halten. Aber sie verehren die überlieferten Gottheiten und beachten die angestammten Tabus. Sie stören nicht die gewohnten Abläufe von Arbeit und Muße, die gewohnten Wohnorte, die gewohnten Strukturen von Familie und persönlichen Beziehungen. Weil das Elend des althergebrachten Lebens derart vertraut ist, können die einfachen Leute es ertragen. Diese lernen, wenn sie in so einer Gesellschaft aufwachsen, damit fertig zu werden, so wie die Kinder der Unberührbaren in Indien die Fähigkeiten und Einstellungen erwerben, um in der ihnen zugedachten armseligen Rolle zu überleben.« Das Zitat ist der Zeitschrift Commentary, November 1979, entnommen. 2 »Komitee zur gegenwärtigen Gefahr« 3 Hillary Rodham Clinton, Eine Welt für Kinder, Neuausgabe mit aktuellem Vorwort, Hamburg 2008 4 Hillary Clinton, »Frauenrechte sind Menschenrechte«, Botschaft an die Vierte Weltfrauenkonferenz in Peking, http://blogs.usembassy.gov/amerikadienst/1995/09/05/hillary-clintonfrauenrechte-sind-menschenrechte/ 5 »Mrs. Clinton’s Unwavering Words«, New York Times, 6.9.1995 6 Erster Außenminister der Clinton-Administration von Januar 1993 bis Januar 1997 7 Michael Dobbs, Madeleine Albright: Against All Odds, New York 2000 8 Samantha Power, A Problem From Hell: America and the Age of Genocide, New York 2002, S. 326 9 Transnationale Stiftung für Friedens- und Zukunftsforschung; http://www.transnational.org/ 10 Siehe hierzu mein Buch Fool’s Crusade. Yugoslavia, NATO and Western Delusions, London 2002, S. 227. Diese Vorschläge wurden während Ćosićs Amtszeit 1992 bis 1993 gemacht und sahen eine Abtrennung der überwiegend albanischen Gebiete des Kosovo vor. Im Sommer 1996 machte der Präsident der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste Aleksandar Despić ähnliche Vorschläge. Diese Initiativen stießen bei der albanischen Seite auf keine 236 Gegenliebe, da sie vorsahen, dass einige serbisch besiedelte Enklaven bei Serbien bleiben sollten. 11 Ushtria Çlirimtare e Kosovës 12 Unter anderem war Walker von 1988 bis 1992 US-Botschafter in El Salvador, wo er, wie Noam Chomsky schreibt, »die US-Hilfe verwaltete, die der salvadoriani-schen Regierung die Praktizierung eines extremen Staatsterrors erlaubte«. Nach einem besonders üblen Massaker rechtsextremer, dem Militär angehörender Todesschwadronen an sechs jesuitischen Priestern und deren Haushälterin im November 1989 stellte er sich schützend vor die salvadorianische Regierung und behauptete, wie Americas Watch seinerzeit angeekelt anmerkte, »es gebe keine Beweise, die auf eine Schuld des Militärs hinweisen würden, und stellte die Hypothese auf, dass vielleicht als Soldaten verkleidete linke Rebellen die Tat begangen hätten«. Siehe Noam Chomsky, Der neue militärische Humanismus. Lektionen aus dem Kosovo, Zürich 2000, S. 63–64 13 Zum Raçak-Massaker und William Walkers Rolle darin siehe u. a. Diana Johnstone, »Das Raçak-Massaker als Auslöser des Krieges«, in: Klaus Bittermann und Thomas Deichmann (Hg.), Wie Dr. Joseph Fischer lernte, die Bombe zu lieben. Die Grünen, die SPD, die Nato und der Krieg auf dem Balkan, Berlin 1999, S. 52–68; für einen Kommentar zu der Frage, wie die relativ kleine Zahl von Toten in Raçak zum Kriegsgrund werden konnte, siehe den Abschnitt »Das Raçak-Massaker. >Die ausschlaggebende Gräueltat, die das Räderwerk in Gang setzte<«, in: Chomsky, Der neue militärische Humanismus, S. 62–73, Zitat S. 63 14 Richard Holbrooke, Meine Mission, München 1998, S. 160, 166, 315, 317 15 Siehe das Kapitel »Madeleine’s War« in Walter Isaacson, American Sketches: Great Leaders, Creative Thinkers, and Heroes of a Hurricane, New York 2009, S. 70–76, hier S. 73. Ursprünglich erschienen als Walter Isaacson, »Madeleine’s War«, Time, 17.5.1999 16 Am 26. März 1997 berichtete AFP, seit Jahresanfang 1997 seien im Kosovo bereits zwölf dem Regime nahestehende Albaner erschossen worden. In »Terrorist Attacks on Civilians whose names sound Albanian and Muslim«, Dialogue not separatism and terrorism – Documents, Pristina, Serbien, Mai 1998 heißt es: »Am 12. Januar 1998 töteten Terroristen auf der Dorfstraße des zur Gemeinde Glogovac gehörenden Ortes Gradic den vierunddreißigjährigen Förster Mujo Sejdi. Er war in der Gegend als loyaler Bürger Serbiens 237 bekannt. Am 23. Januar 1998 töteten albanische Terroristen den Briefträger Mustafa Kurtai, während er auf dem Weg zur Arbeit war.« Siehe außerdem Sabdro Provvisionato, Uck: l’armata dell’ombra, Rom 2000, S. 74 sowie Kapitel 5 meines Buchs Fools’ Crusade. Yugoslavia, NATO and Western Delusions, London 2002, in dem all das ausführlich dokumentiert ist. Die seinerzeitigen Berichte Amnesty Internatio-nals belegen diese schweren Übergriffe gegen ethnisch albanische Bewohner des Kosovo ebenfalls. 17 David S. Cloud, »How James Rubin Shaped Pact with Hashim Thaçi of the KLA«, The Wall Street Journal, 29.6.1999 18 Boris Johnson: »Cold War warrior scorns >new morality<«, The Daily Telegraph, 28.6.1999, S. 34 19 Seth Ackerman, »What Reporters Knew About Kosovo Talks – But Didn’t Tell. Was Rambouillet Another Tonkin Gulf?”, FAIR Media Advisory, 2.6.1999 20 Letztere Bemerkungen basieren auf eigenen Beobachtungen vor Ort. Ein »serbenreines« Kosovo ist nach etlichen übereinstimmenden Presseberichten über die Jahre hinweg das Ziel der Mehrheit der Kosovo-Albaner, aber besonders natürlich das der aus der U(JK hervorgegangenen politischen Kräfte, die im Kosovo an der Macht sind. Für erste Anzeichen siehe Christoph Monzel, »Wer schützt die Serben im Kosovo«, Die Welt, 15.6.1999, und viele weitere Berichte aus diesem Jahr, stellvertretend siehe »Kosovo: Six months on, climate of vio-lence and fear flies in the face of UN mission«, Amnesty International, International Secretariat, 23.12.1999. Dort heißt es: »Die Gewalt gegen Serben, Roma, muslimische Slawen und gemäßigte Albaner ist im Lauf des letzten Monates dramatisch gestiegen, was auf ein Versagen der Mission der Vereinten Nationen hindeutet. […] Es kommt täglich zu Morden, Entführungen, gewalttätigen Angriffen, Einschüchterungen und dem Niederbrennen von Häusern.« Die Quellen zu diesem Thema würden sich beliebig vervielfachen lassen. Derselbe Trend zu einem »rein albanischen« Kosovo geht bis heute weiter; siehe »Kosovo: Pläne für mehr Rechte für Serben im Kosovo hat [sic] in Pristina zu schweren Krawallen geführt«, Frankfurt Rundschau Online, 10.1.2016, http://www.fronline.de/videos/1472414,1472414.html?bctid=4697485903001 21 Sunday Telegraph, 4.4.1999, zitiert nach Philipp Hammond, »Humanizing War. The Balkans and Beyond«, in: Stuart Allan und Barbie Zelizer (Hg.), Reporting War: Journalism in Wartime, London 2004, S. 174–189, hier S. 184 238 22 Nicholas Watt, »Blair plea to Serbs«, The Guardian, 5.5.1999 23 CNN World, 7.4.1999, »Albright: Milošević has created >horror of biblical pro-portions<« 24 Zur Rolle der Medien im Kosovokrieg insgesamt siehe Philipp Hammond und Edward S. Herman, Degraded Capability. The Media and the Kosovo Crisis, London 2000 25 Siehe Fußnote 15 26 Die Episode findet sich unter https://www.youtube.com/watch? v=4iFYaeoE3n4 auf Youtube. 27 Colin Powell, Mein Weg, München 1996, S. 603. Unmittelbar, nachdem er Albright zitiert, kommentiert Powell: »Mich hätte fast der Schlag getroffen. Ameri kanische GIs waren keine Zinnsoldaten, die man über ein globales Spielfeld schob.« 28 Dieses Augenmerk auf das US-Außenministerium lässt Heldinnen beim Durchbrechen der gläsernen Decke wie die CIA-Agentin Alfreda Frances Bikowsky außer Acht, die Advokatin der Folter, die als Vorbild für den – von einer Frau gedrehten – Film »Zero Dark Thirty« fungierte. 29 Colum Lynch, »Susan Rice as national security adviser? U.N. ambassador said to be front-runner«, 9.3.2013 30 Weiteres zu Susan Rice und ihrem Hintergrund findet sich in Abbey Martin’s kurzer Sendung »Exposing Susan Rice. Weapons of Mass Distraction«, https:// www.youtube.com/watch?v=Q-IoCAxWzpk. 31 Sie wollte aus Bosnien berichten, hatte aber keine Erfahrung und fand keine Nachrichtenagentur, die ihren Antrag auf einen UN-Ausweis für das Passieren der bosnischen Grenze unterstützte. Die CarnegieStiftung befand sich im selben Gebäude wie die Zeitschrift Foreign Policy, und eines Abends, als der FP-Redakteur gegangen war, schlich sie sich in sein Büro und stahl ein paar Blatt Briefpapier. »Ich schrieb diesen Brief, in dem es hieß, >Bitte versorgen Sie Samantha Power mit allen Ausweisen, die sie benötigt.<« Der Trick klappte. Siehe Evan Osnos, »In the Land of the Possible: Samantha Power has the President’s ear. To what end?«, The New Yorker, 22.11.2014 32 Für einen Hintergrundbericht siehe Walter Mayr, »Das hier ist altes Ustascha-Land. SPIEGEL-Redakteur Walter Mayr über den Machtkampf in der Herzegowina«, Spiegel Online, 17.7.1992. Ich selbst war 1996 zwei Tage lang in Medjugorje. Die Region war rein kroatisch, von der Verwendung von kroatischem Geld bis zu kroatischen Briefmarken. Ganz in der Nähe befand sich ein kroatischer Militärstützpunkt. 239 33 Siehe Fußnote 8 34 Eine derartige Szene gab es anlässlich der Diskussion der russischen Annexion der Krim im März 2014; siehe »US v. Russia in clash of diplomats: America’s ambassador to the UN berates her Russian counterpart saying his country stood alone and its actions were wrong«, Daily Mail, 16.3.2014. Der Artikel bringt auch drei recht eindrucksvolle Fotos des Vorfalls. 35 Hillary Rodham Clinton, Entscheidungen, München 2014, S. 69 36 Suzanne Nossel, »Smart Power: Reclaiming Liberal Internationalism«, Foreign Affairs, März/April 2004 37 Zu LGBT-Rechten siehe unter anderem U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, »Briefing on LGBT Resolution at U.N. Human Rights Council«, 17.6.2011. Eine kurze Zusammenfassung der Tätigkeit Nossels im Menschenrechtsrat findet sich in »Amnesty International USA Announces Leadership Transition: Suzanne Nossel Selected as New Executive Director of Human Rights Organization«, Amnesty International, 17.11.2011 38 Siehe vorige Fußnote und Chris Hedges, »The Hijacking of Human Rights«, truthdig, 7.4.2013, deutsche Übersetzung unter http://gegenmeinung2.rssing.com/chan-9317861/all_p3.html; außerdem Coleen Rowley, »Selling War as >Smart Power<«, Consortiumnews.com, 28.8.2012 39 Einen kurzen Überblick über Otpor gibt Ralf Schneider in »OTPOR/Ukraine – Revolution oder Verschwörung?«, Freitag, 29.1.2014 40 Siehe »Schauprozess in Russland. Putins Hatz gegen Pussy-PunkBand«, Abendzeitung (München), 30.7.2012, »Presseschau zu >Pussy Riot<: Russischer Schauprozess gegen Sängerinnen«, Stern Online, 31.7.2012, »Schauprozess gegen Pussy Riot. Putin lässt die Maske fallen«, n-tv.de, 17.8.2012 und unzählige andere Berichte in ähnlichem Tenor 41 Siehe »Prominente Unterstützer von Madonna bis Paul McCartney«, Süddeutsche Zeitung, 20.8.2012, und, aus kritischer Sicht, Leonid Bershidsky, »What Madonna Doesn’t Get About Russia’s Punk Protest«, BloombergView, 21.8.2012 42 Für Videomaterial dieser Aktionen, siehe https://www.youtube.com/watch?v=egQNqrRYtUw. Ein längerer, teilweise spekulativer Beitrag auf https://www.youtube.com/watch? v=VZT9ZzrdeUg enthält weiteres Material. 43 Amnesty International, »Tell Putin: Let punk rockers go«, August 2012 240 44 Veronika Dorman, »Les Pussy Riot, en prison pour une chanson«, Liberation, 2.8.2012 45 Avaaz.org, »Free Pussy Riot, Free Russia«, 22.8.2012 46 E-Mail Amnesty International, siehe http://osdir.com/ml/healthdiscussion-help/2012-09/msg02502.html 47 E-Mail von Avaaz, 22. August 2012, siehe https://gabrielconstans.wordpress.com/tag/russia/ 48 »Clinton: Russia and China will >pay price< for supporting Assad«, RT News, 6.7.2012 49 »Pussy Riot: Nachahmer stören Gottesdienst im Kölner Dom«, Spiegel Online, 19.8.2012 50 »Pussy-Riot-Prozess: Putin bittet um mildes Urteil«, n-tv.de, 2.8.2012. Dort heißt es: »Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich für ein mildes Urteil gegen die angeklagten Mitglieder der Punkband Pussy Riot ausgesprochen. >An dem, was sie getan haben, ist nichts Gutes […]<, zitierten ihn russische Nachrichtenagenturen. >Ich denke dennoch nicht, dass sie allzu hart dafür bestraft werden sollten<, fügte er hinzu. Zugleich betonte Putin, dass es Aufgabe des Gerichts sei, ein Urteil zu fällen.« Für ausführlichere Zitate Putins zu Pussy Riot siehe »Prozess gegen Punkband: Putin fordert Gnade für Pussy Riot«, Spiegel Online, 3.8.2012 51 In dem »offiziellen« Video (https://www.youtube.com/watch? v=ALS92big4TY) der Aktion ist deutlich zu hören, dass die Tonspur nachträglich hinzugefügt wurde. 52 Es besteht ein seltsamer Widerspruch zwischen HRCs öffentlichem Enthusiasmus für Pussy Riot nach deren Befreiung 2014 und ihrem totalen Schweigen über die Riot Girls in ihrer »Autobiografie« Entscheidungen im selben Jahr. Doch der Widerspruch ist wahrscheinlich nicht mehr so groß, wenn man bedenkt, dass Politiker sich heute sowohl als konservativ als auch als aufgeschlossen für jedermann präsentieren müssen – eben multikulturell. So oder so ist es wenig wahrscheinlich, dass nach Suzanne Nossels Wechsel vom USAußenministerium zu Amnesty International die Kontakte zwischen ihr und der US-Regierung abrissen. 53 Siehe https://twitter.com/hillaryclinton/status/452130729691201536 54 Entscheidungen, S. 606 55 Hierzu und zum Folgenden siehe u. a. den halbstündigen Dokumentarfilm von RT, »Femen: Exposed«, veröffentlicht am 20.11.2013, https://www.rt.com/shows/documentary/femen-protestsgender-inequality-000/ 241 56 Für einen Kurzbericht siehe Lorenz Eichhorn, »Exporting Naked Protest: Femen Opens First Office Abroad«, Spiegel Online International, 19.9.2012, ausführlicher Axel Veiel, »Nackt gegen Gewalt – Femen zieht nach Paris«, Badische Zeitung, 16.3.2013. Siehe auch das Video »LES FEMEN A LA GOUTTE D’OR A PARIS«, https://www.youtube.com/watch?v=AT7SSKog7v0. Einige der Frauen haben den Slogan »Muslim Let’s Get Naked« auf den Oberkörper gemalt; die Reaktionen der arabischen und schwarzen Bewohner des Nordpariser Viertels Goutte d’Or schwanken zwischen Amüsement, Unverständnis und Gleichgültigkeit. 57 Siehe u. a. den Protestbrief der Sprecherin der konservativen Organisation »Gemeinsam für das Gemeinwohl«, Julie Graziani, an den Präsidenten François Hollande, »Monsieur le président de la République, supprimez ce timbre à l’effigie d’une Femen!«, Le Figaro, 4.2.2014 58 Ebd. 59 »Eklat in Paris. Femen-Aktivistin zerstört Putin-Wachsfigur«, N24, 5.6.2014, siehe http://www.n24.de/n24/Mediathek/Bilderserien/d/4861528/femenaktivistinzerstoert-putin-wachsfigur.html. Neben sechs Bildern der Aktion, die zeigen, wie eine Frau mit den blutroten Worten »Kill Putin« auf dem Oberkörper der Wachsfigur den Kopf abschlägt und ihr »Herz« durchbohrt, findet sich dort der Text: »Randale in Paris: Eine FemenAktivistin hat eine Wachsfigur von Wladimir Putin in Paris zerstört. Die halbnackte Frau stach mit einem Holzpfahl auf das Abbild des russischen Präsidenten ein.« 60 Eine umfangreiche Dokumentation des ukrainischen Hintergrunds von Femen und der Verbindungen der Gruppe zum dortigen rechten und rechtsradikalen Milieu findet sich bei Olivier Pechter, »L’histoire cachee des FEMEN«, Le Grand Soir, 19.1.2014, http://www.legrandsoir.info/l-histoire-cachee-des-femen.html. 61 So postete die ukrainische Femen-Aktivistin Evgenia Krayzman auf ihrer Facebook-Seite ein Selfie, das sie mit triumphierend erhobener Faust vor dem Hintergrund des brennenden Gewerkschaftsgebäudes zeigt. Siehe Olivier Berruyer, »Caroline Fourest: >Les Femen ne sont pas nazies!< Bon, enquetons alors…«, Les-Crises.fr, 19.5.2014, https://www.les-crises.fr/caroline-fourest-les-femen-nesont-pasnazies-ah-bon/ 242 4 Der Beginn des clintonschen Kriegszyklus 1 Hierzu und zum Folgenden siehe mein Buch Fools’ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions, London 2002 2 Zur Politik Deutschlands bei der Sezession Sloweniens und Kroatiens siehe Misha Glenny, The Fall of Yugoslavia, 3. Auflage, London 1996, S. 188–194. Die zweite Ausgabe dieses Buches ist unter dem Titel Jugoslawien. Der Krieg, der nach Europa kam (München 1993) auch auf Deutsch erschienen. Siehe dort, S. 284–292. Dieses Buch macht außerdem klar, welch verheerende Rolle die Lostrennung dieser beiden Republiken für den Ausbruch des Bürgerkrieges in Bosnien spielte. Nicht umsonst heißt eines der Kapitel »Bosnien-Herzegowina, August 1991-Mai 1992: Das Paradies der Verdammten«. Glenny argumentiert überzeugend, dass die darauffolgende vorschnelle, ebenfalls maßgeblich durch Deutschland durchgesetzte Anerkennung Bosniens die Republik endgültig in das Chaos und die Gewalt des Bürgerkrieges stürzte. 3 Siehe dazu das Kapitel »Moral Dualism in a Multicultural World« in meinem Buch Fools’ Crusade, in dem ich zahlreiche Beispiele gebe 4 Nämlich Sloweniens, Kroatiens, Bosniens und Mazedoniens, die alle 1991 ihren Austritt aus der Föderation erklärten und jeweils 1991 (Slowenien und Kroatien) bzw. 1992 und 1993 international anerkannt wurden. 5 Siehe z.B. »Scharping: Hinweise auf serbische Konzentrationslager«, Spiegel Online, 31.3.1999, oder »Scharping: Starke Hinweise auf die Existenz von Konzentrationslagern im Kosovo«, Die Welt, 1.4.1999 6 Die »Europäische Gemeinschaft« war damals dabei, sich in die »Europäische Union« umzuwandeln. 7 Hier ist, was ich, basierend unter anderem auf Malte Olschewskis Von den Karawanken bis zum Kosovo: Die geheime Geschichte der Kriege in Jugoslawien, Wien 2000, in meinem Buch Fools’ Crusade schrieb (S. 43–44): »Der Vorschlag zur Kantonisierung wurde am 18. März 1992 von Izetbegović, Karadzic and Boban unterzeichnet, die jeweils die muslimische, die serbische und die kroatische Gemeinschaft vertraten. Er wurde von allen drei Parteien als Kompromiss zur Vermeidung eines Bürgerkrieges unterzeichnet. Die Serben und Kroaten akzeptierten die Anerkennung eines unabhängigen Bosnien-Herzegowinas innerhalb der bestehenden Grenzen, was ihnen missfiel, während die muslimische Partei im Gegenzug die von ihr ungeliebte >Kantonisierung< akzeptierte. Der Kompromiss stellte 243 Izetbegović nicht zufrieden, da er (in den Worten des US-Botschafters in Jugoslawien, Warren Zimmerman) >ihm und seiner muslimischen Partei eine dominante Rolle in der Republik verwehrt hätte<. Botschafter Zimmerman rief eilends Izetbegović in Sarajewo an, um das Lissaboner-Abkommen mit ihm zu diskutieren. >Er sagte, es gefiele ihm nicht, und ich sagte ihm, wenn es ihm nicht gefiele, solle er es doch einfach nicht unterzeichnen<, erinnerte Zimmer-man sich später. Und so machte Izetbegović, der offenbar nur zu froh war, dazu ermutigt zu werden, mehr zu verlangen, eine Kehrtwende und entzog dem Lissaboner Abkommen seine Unterstützung.« 8 Die Rede ist hier natürlich von der endlosen Affäre um Monica Lewinsky. 9 Einer der zahlreichen Berichte hierzu ist Richard Noyes, »Hillary Shot At in ’96? No Media Mention of Bosnia >Sniper Fire<«, Newsbusters, 18.3.2008. Dieser Bericht enthält auch ein Video der Ankunft Hillarys und der Clinton-Tochter Chel-sea in Tuzla. 10 David Usborne »Clinton >misspoke< over claims of sniper fire in visit to Bosnia«, The Independent, 26.3.2008; siehe auch »Clintons falsche Bosnien-Geschichte: >Ich habe einen Fehler gemacht<«, Spiegel Online, 25.3.2008 11 Gail Sheehy, Hillary, Reinbek 2000, erheblich gekürzte Übersetzung der Originalausgabe Hillary’s Choice, New York 1999 12 Die deutsche Ausgabe (ebd., S. 308) erwähnt lediglich, dass sowohl Verteidigungsminister Cohen als auch der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs Hugh Shelton gegen das Bombardement gewesen seien, da sich ein Territorium »nicht mit Flugzeugen kontrollieren« lasse, und zitiert dann Hillary mit der gegenteiligen Ansicht: »Ich drängte ihn zu bombardieren.« Die folgende interessante Passage des US-Originals fehlt dagegen: »In den folgenden Tagen stritten die Clintons in langen Telefongesprächen über dieses Thema. [Bill] Clinton hatte zahlreiche Bedenken anzumelden. Was ist, wenn das Bombardement zu noch mehr Tötungen führt? Was ist, wenn die NATO daran zerbricht?« Daraufhin wird Hillary mit den Worten über den Holocaust zitiert, gefolgt von den an Madeleine Albright erinnernden Worten: »Wozu haben wir die NATO, wenn nicht dazu, unsere Lebensart zu verteidigen?« Siehe Hillary’s Choice, S. 345; der Abschnitt, aus dem das Zitat stammt, trägt den Titel »Hillarys verborgene Hand im Kosovo«. 13 Siehe dazu ausführlich Fools’ Crusade (siehe Fußnote 1) 14 Nämlich die beiden Republiken Serbien und Montenegro. Im NATOKrieg von 1999 wurde auch die Republik Montenegro, die mit dem 244 Konflikt in der serbischen Provinz Kosovo überhaupt nichts zu tun hatte, unbarmherzig bombardiert. 15 »Ushtria Çlirimtare e Kosovës«; siehe Kapitel 3, Fußnote 11 16 Zu den zahlreichen Quellen, die dies belegen, gehören Hannes Hofbauer (Hg.), Balkankrieg. Die Zerstörung Jugoslawiens, Wien 1999; Klaus Bittermann und Thomas Deichmann (Hg.), Wie Dr. Joseph Fischer lernte, die Bombe zu lieben, Berlin 1999; Tariq Ali (Hg.), Masters of the Universe. NATO’s Balkan Crusade, London 2000 und Kurt Köpruner, Reise in das Land der Kriege. Erlebnisse eines Fremden in Jugoslawien, Berlin 2001 17 Der ehemalige DDR-Botschafter in Jugoslawien, keineswegs ein in der Wolle gefärbter Stalinist, Ralph Hartmann, schrieb über die Bilanz des Krieges in Jugoslawien einen langen Artikel: »Die NATO-Angriffe gegen Jugoslawien. Zehn Jahre nach der Schandtat« (junge Welt, 24.5.2009 und 25.5.2009). Seine Bilanz ist bedrückend und wirft noch einmal die Frage auf, warum nicht alles unternommen wurde, um diesen Konflikt friedlich zu lösen. Nach seiner Beschreibung begann mit dem NATO-Krieg »ein Massenexodus von nahezu biblischen Ausmaßen. Während zwischen dem März 1998 und dem März 1999 170 000 Bewohner vor den Auseinandersetzungen zwischen der UCK und den jugoslawischen Sicherheitskräften aus dem Gebiet geflohen waren, flüchteten allein im ersten Kriegsmonat 600 000 Menschen. Zum Kriegsende waren es 800 000, darunter 70 000 Serben und Roma, zum größten Teil aber albanische Bewohner des Gebietes. Sie verließen das Gebiet, flüchtend vor den NATO-Bomben, die Serben und Albaner töteten – allein Pristina wird 280 mal von der NATO angegriffen –, vertrieben von serbischen Paramilitärs, den Aufrufen der kosovo-albanischen >Befreiungsarmee< UCK folgend und ihren Terror gegen >Kollaborateure< fürchtend, Schutz suchend vor den Kämpfen zwischen der UCK und dem jugoslawischen Militär. [..] Zertrümmert oder demoliert wurden 60 Brücken, 19 Bahnhöfe, 13 Flughäfen, 480 Schulobjekte, 365 Klöster, Kirchen, Kultur- und historische Gedenkstätten. [..] Zerstört oder beschädigt wurden 110 Krankenhäuser, lebensnotwendige medizinische Geräte, Hilfs- und Arzneimittel. […] In Schutt und Asche gelegt wurden 121 Industriebetriebe, in denen 600 000 Jugoslawen in Arbeit standen. Rund 2,5 Millionen Menschen verloren damit ihre Existenzgrundlage. Über 2500 Menschen wurden getötet, mehr als 10 000 schwer oder leicht verletzt. 30 Prozent aller Getöteten und 40 Prozent der Verstümmelten und Verletzten waren Kinder.« Wie in jedem Fall in 245 diesem Konflikt sind auch hier sicher Einzelheiten strittig. Das Gesamtbild ist jedoch klar genug. 18 Siehe dazu Tobias Jaecker, »Die deutschen Medien und der KosovoKrieg«, 10. April 2003, http://www.jaecker.com/2003/04/diedeutschen-medien-und-der-kosovo-krieg/, und eine Reihe der anderen in diesem Kapitel zitierten Werke zum NATO-Krieg 1999 vor allem aus den »zeitnahen« Jahren 1999 und 2000. In den Jahren danach verschwanden die schlimmsten Gräuelbehauptungen der Medien ä la Bild (»Sie treiben sie ins KZ«, wenige Tage nach Kriegsbeginn) im Gedächtnisloch. Es ist, als hätte es sie nie gegeben, als hätten sie sich nie als haltlos erwiesen und als könne man sie deshalb in jedem neuen Krieg recyceln. 19 Siehe dazu neben vielen anderen Quellen Tino Moritz, »Einsame Zweifler«, tageszeitung, 6.4.2001 und Mathis Feldhoff und Volker Steinhoff, »Enthüllungen eines Insiders – Scharpings Propaganda im Kosovo-Krieg«, Panorama, ARD, 18.5.2000. Unerlässlich zum Thema »Hufeisenplan« ist vor allem das Buch des Brigadegenerals a.D. Heinz Loquai, Der Kosovo-Konflikt – Wege in einen vermeidbaren Krieg, Baden-Baden, 2000. Siehe insbesondere Kapitel VIII, »Der >Hufei-senplan<«, S. 138–144. Loquai schließt dieses Kapitel mit den Worten: »Das Beispiel >Hufeisenplan< zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie leicht es sein kann, erfolgreiche politische Kampagnen zur Rechtfertigung des politischen Handels zu führen, wenn der Nährboden bereitet ist. Kein Staatsanwalt würde es in einem Rechtsstaat wagen, mit einer in sich so widersprüchlichen Anklageschrift und mit so schwachen Beweisen Anklage zu erheben. Doch der Verteidigungsminister offerierte seine Anklage nicht nur den Parlamentariern, den Medien und der Öffentlichkeit. Noch bemerkenswerter ist, dass seine Behauptungen bereitwillig und nahezu kritiklos übernommen wurden. Allerdings – seine innenpolitische Funktion erfüllte der >Hufeisenplan<. Er schob die öffentliche Kritik an den NATO-Luftangriffen beiseite.« 20 Der WDR-Film »Es begann mit einer Lüge«, der im Februar 2001 von der ARD ausgestrahlt wurde, ist sowohl eine hervorragende Dekonstruktion der NATOPropaganda in Deutschland als auch eine Illustration des erwähnten Mechanismus. Die unter https://www.youtube.com/watch?v=RmvjEucnpkE verfügbare Youtube-Version ist ergänzt durch ein Interview mit dem Balkanexperten Wolf Oschlies in der ARD-Sendung »Vor 10 Jahren: Kosovokrieg«, in dem er auf die Ereignisse im Kosovo zwischen 1999 246 und 2009 eingeht. 21 Dazu Michael Parenti, »Where Are All the Bodies Buried?«, Z Magazine, Juni 2000, und zusätzlich Parentis Buch To Kill a Nation. The Attack on Yugoslavia, London 2000, das auch den genannten Artikel enthält. Kurt Köpruner berichtet in seiner lesenswerten Studie Reise in das Land der Kriege. Erlebnisse eines Fremden in Jugoslawien (Berlin 2001) in einem Abschnitt »Wer oder was tötete wen?« (S. 278–284), dass fünfzehn Expertenteams aus fünfzehn Ländern, die beauftragt waren, Massengräber im Kosovo zu finden, nach fünf Monaten Suche im November 1999 2108 Leichen in solchen Gräbern gefunden hatten. In weiteren Untersuchungen bis Sommer 2000 kamen dann noch einmal 680 Leichen hinzu. Fundstellen und Leichen gaben meist keinen Aufschluss über die ethni sche Identität und die Todesumstände der Getöteten. Sicherlich wurden bei dieser Suche auch nicht alle – auf außergewöhnliche Todesumstände hindeutende – Massengräber gefunden, aber da es sich hier um eine der intensivsten forensischen Untersuchungen der Geschichte handelte, kann man davon ausgehen, dass der größte Teil der so Begrabenen tatsächlich entdeckt wurde. Eine Schätzung von zwei- bis viertausend Toten, die unter den schrecklichen Umständen der 78 Tage des NATOKosovokrieges rasch und »kollektiv« begraben werden mussten, scheint daher nicht unrealistisch. 22 Eine in der medizinischen Zeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie über die Zahl der »außergewöhnlichen Sterbefälle« unter den Kosovoalbanern von Beginn des Bürgerkrieges im Februar 1998 bis Ende des NATO-Kosovokrieges im Juli kam zu der Schätzung, dass dort insgesamt zwölftausend Tote als »Kriegstraumaopfer« (alle Opfer, deren Tod in direktem Zusammenhang mit dem Krieg stand, etwa Gewehrfeuer, Artillerie, Erschießungen, zusammenbrechende Gebäude, etc.) zu bewerten seien. Siehe Paul B. Spiegel und Peter Salama, »War and mortality in Kosovo, 1998–99: an epidemiological testimony«, The Lancet, Vol. 355, Issue 9222, 24.6.2000, S. 2204– 2209. Das war im Juni 2000. Auf der Website »Balkan International Justice« berichtet Milka Domanovic in ihrem Artikel »List of Kosovo War Victims Published« (10.12.2014) über eine Datenbank des Belgrader »Humanitarian Law Centre« und des »Humanitarian Law Centre Kosovo«, derzufolge im Kosovo von Anfang 1998 bis Ende 2000 8661 kosovoalbanische, 1797 serbische und 447 Roma Zivilisten sowie außerdem 2612 Kämpfer auf allen Seiten getötet worden seien. Auch diese Zahlen, die sicherlich als Obergrenzen 247 gelten können, kommen im Kontext eines Bürgerkriegs kaum an das Szenario eines von einer Seite geplanten »Völkermords« heran. 23 »International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia« 24 Siehe David Owen, Balkan Odyssey, London 1995; ich zitiere nach der Paperback-Ausgabe. David (Lord) Owen, der europäische Hauptunterhändler während der drei Jahre des Bosnienkrieges, stand in engem Kontakt mit regionalen Führern und beschreibt die schwierigen Beziehungen Milošević zu den Führern der bosnischen Serben in beträchtlichem Detail. »Am 16. April [1993] sprach ich am Telefon mit Präsident Milošević über meine Befürchtung, dass die Armee der bosnischen Serben trotz wiederholter Versicherungen Dr. Karadžićs, er habe keine Absicht, Srebrenica einzunehmen, sich jetzt anschicke, genau das zu tun. Die Größe der Enklave war beträchtlich geschrumpft. Ich hatte Milošević noch selten so aufgebracht, aber auch besorgt erlebt: Er befürchtete, dass es, wenn die bosnischen Serben in Srebrenica einmarschierten, wegen des extrem bösen Blutes zwischen den beiden Armeen ein Blutbad geben würde. Die bosnischen Serben hielten den jungen muslimischen Kommandeur in Srebrenica, Naser Orić, für verantwortlich für ein Massaker in der Nähe von Bratunać im Dezember 1992, bei dem viele serbische Zivilisten getötet worden waren. Milošević war der Meinung, es wäre ein großer Fehler, wenn die bosnischen Serben Srebrenica einnähmen, und er versprach, dies Karadžić mitzuteilen.« (S. 143). Im Mai 1993 begaben sich Milošević und andere jugoslawische Führer nach Pale, um zu versuchen, Druck auf das bosnisch-serbische Parlament auszuüben, damit es den VanceOwen-Friedensplan ratifizierte. Als die bosnischen Serben den Plan ablehnten, war Milošević laut Owen »wütend, deprimiert und müde« an gesichts der Verzögerungstaktik der bosnischen Serben (S. 164). Owen schreibt, selbst kurz vor Ende des Krieges 1995 sei Milošević »immer noch nicht in der Lage gewesen, Pale zu beeinflussen« (S. 333). 25 Chris Hedges, »Whispers of New Tyranny in Kosovo. As a KLA Regime Fills Voids in Government, Evidence Mounts of an Intimidated Populace«, New York Times, 29.7.1999 26 Ebd. 27 Chris Hedges, »Kosovo’s Rebels Accused of Executions in the Ranks«, New York Times, 25.6.1999 28 Für einen Bericht aus jüngerer Zeit siehe »Westen wusste angeblich von Thaçis Mafiakontakten«, Zeit Online, 25.1.2011, wo Berichte über die Verwicklung »Hashim Thaçi[s] in den organisierten Handel 248 mit menschlichen Organen« zitiert werden und ein Bericht des Guardian angeführt wird, dem zufolge »Thaçi Teil eines kriminellen Triumvirats im Kosovo [ist], dessen eigentlicher Kopf Xhavit Haliti ist«. 29 Friends of Kosovo, »Washington’s Bizarre Kosovo Strategy Could Destroy NATO«, 12.4.2012. Dort findet sich auch ein ganz ähnliches Foto, auf dem Hillary Clinton und Thaçi zusammen zu sehen sind. Außerdem enthält der Artikel eine bemerkenswerte Beschreibung von Camp Bondsteel. 30 David S. Cloud, »How James Rubin Shaped Pact With Hashim Thaçi of the KLA«, Wall Street Journal, 29.7.1999 31 »United Nations Interim Administration Mission in Kosovo« 32 Die Angaben in diesem Absatz basieren auf eigenen Beobachtungen, außerdem auf Kapitel 11 des Buches der Ex-ICTY-Anklägerin Carla Del Ponte, Im Namen der Anklage, Frankfurt 2009, »Von den Zeugen – Kosovo 1999 bis 2007« (S.354–393). Zu den wütenden Straßendemonstrationen gegen Anklagen gegen U(JK-Führer, siehe »War crimes trial against KLA members sparks rally«, AP Archive, 22.11.2004. 33 Für »European Union Rule of Law Mission« 34 Siehe etwa »Police in Kosovo tear gas far-right protesters demanding release of opposition leader (VIDEO)«, RT, 13.10.2015. 35 Andreas Ernst, »EU-Mission in Kosovo im Zwielicht«, NZZ Online, 4.11.2014 und Micha! Kokot, »Die EU verspielt im Kosovo ihren guten Ruf«, Zeit Online, 21.11.2014 36 Del Ponte, Im Namen der Anklage, S. 359–361. Auf S. 361 beschreibt Del Ponte ihre »Ermittlungen gegen Teile der U(JK« im Kosovo als die frustrierendsten im Lauf des Jugoslawien-Tribunals. Das gesamte 11. Kapitel ihres Buches, »Von den Zeugen – Kosovo 1999 bis 2007« (ebd., S. 354–393) ist dieser Thematik gewidmet. 37 »Bernard Kouchner et les traffics d’organes – des journalistes Serbes l’accusent en direct!«, Video auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=12HXAlhFL0 38 Parliamentary Assembly, Committee on Legal Affairs and Human Rights: »Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo«, Draft Report. Berichterstatter: Dick Marty, Schweiz, Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa; siehe http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-ViewEN.asp?ID=964. Siehe auch Gaby Ochsenbein, »Europarat verabschiedet Marty-Bericht zu Kosovo«, swissinfo.ch, 25.1.2011 249 39 Siehe u. a. »Illegaler Organhandel im Kosovo: EU-Mission sucht Beweise«, n-tv. de, 28.1.2011; Stefanie Bolzen, »Schmutziger Organhandel vom Kosovo in die EU«, Die Welt, 1.5.2013 40 »Statement of the Chief Prosecutor of the Special Investigative Task Force«, siehe http://sitf.eu/images/Statement/Statement_of_the_Chief_Prosecutor_of_the_SITF_E 41 Julian Borger, »Senior Kosovo figures face prosecution for crimes against huma-nity«, The Guardian, 29.7.2014 42 »>We Have Achieved Almost Nothing<: An Insider’s View of EU Efforts in Kosovo«, Spiegel Online, englische Ausgabe, 7.11.2012. Der Artikel erschien ursprünglich auf S. 45, 2012 der Printausgabe des Spiegel vom 5.11.2012. Die Passage hier ist aus dem Englischen rückübersetzt. 43 »Serbische Kosovo-Klöster leiden unter albanischen Attacken«, Focus Online, 12.8.2014 44 Siehe hierzu unter anderem Julia Smirnova, »Ukrainische Rechtsradikale stellen sich gegen Kiew«, Die Welt, 15.7.2015; Paul Flückiger, »»Rechter Sektor< in der Ukraine: Rechtsextreme wollen Präsident Petro Poroschenko entmachten«, Tagesspiegel, 22.6.2015 und Ann-Dorit Boy, »Der >Rechte Sektor< gegen die Regierung«, FAZ.net, 23.7.2015 45 Das US-amerikanische Gesetz »Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act« (RICO) von Oktober 1970 richtet sich gegen erpresserische Bandenstrukturen wie die Mafia und enthält einige höchst zweifelhafte Bestimmungen zur Beweislast der Anklage sowie darüber, ab wann von einer Bande (»racket«) und einem gemeinschaftlich geplanten und begangenen Verbrechen die Rede sein kann. 46 Dazu unter anderem »Internationaler Gerichtshof: Washington beharrt auf Immunität von US-Soldaten«, Spiegel Online, 21.5.2004 47 Während die USA selbst in den 1980ern in Guatemala den Krieg des dort herrschenden Militärregimes gegen die Indios des Landes sponserten, klagten sie die neue sandinistische Regierung Nicaraguas des Völkermordes an den dortigen Miskito-Indianern an. Doch während in Nicaragua die Opferzahlen im zweistelligen Bereich lagen, wurden in Guatemala Zehntausende Indios getötet. Somalia, der Sudan und Libyen sind weitere Beispiele dafür, wie im Westen komplexe soziale und historische Probleme in ein simples Schema à la »böser Diktator« versus »gutes Volk« beziehungsweise »gute Minderheit« gezwängt werden. 250 48 »Bill Clinton unveils statue of himself in Kosovo. Thousands of ethnic Albanians braved low temperatures and a cold wind in Kosovo’s capital Pristina to watch Bill Clinton, the former US president, unveil a golden statue of himself on Sunday«, The Telegraph, 1.11.2009 49 Andrew Quinn, »Hillary Clinton stops to see Bill’s statue in Kosovo«, Reuters, 13.10.2010. Ein Foto von Hillary vor Bills Statue findet sich unter https://www.pinterest.com/pin/409616528584427300/. Interessant an dem Gebäude hinter Hillary und der Statue sind die kreuzweise durchgestrichenen Buchstaben EULEX. Dass dieses Graffito der Empörung über die Korruption von EULEX geschuldet ist, ist eher unwahrscheinlich. 5 Libyen: Hillarys eigener Krieg 1 Mike Allen, »>Don’t do stupid sh--< (stuff)«, Politico, 1.6.2014; Ian Bremmer, »Die USA bleiben auf Kurs«, Der Standard, 7.11.2014 2 Jeffrey Goldberg, »Hillary Clinton: >Failure< to Help Syrian Rebels Led to the Rise of ISIS«, The Atlantic, 10.8.2014 3 »Responsibility to Protect« (die 2 in der Mitte steht für das im Englischen gleichlautende »to«) 4 Als jemand, der sich – im Unterschied etwa zu Hillary Clinton – in Libyen auskannte und etwas über das Land wusste, war sich der im September 2012 in Bengasi getötete US-Botschafter in Libyen, Christopher Stevens, darüber klar, wie unangemessen es war, den libyschen Staat als »Diktatur« abzuqualifizieren. Schon die bloße Tatsache, dass es in der Dschamahirija auch Wahlen gab, wird im Westen meist unterschlagen. Wie frei und fair diese waren, ist eine andere Frage, die sich aber auch in Bezug auf etliche westliche parlamentarische Demokratien stellen lässt, nicht zuletzt die der USA. Eine sorgfältige Studie der Frühphase der libyschen Dschamahirija ist Hanspeter Mattes, Die Volksrevolution in der sozialistischen libyschen arabischen Volksgamahiriyya, Heidelberg 1982; siehe außerdem die in den Fußnoten 5 und 60 angegebenen Quellen. Für eine kritische Diskussion des Gaddafiregimes, der verschiedenen Schattierungen der Opposition gegen es und der Ereignisse von 2011 siehe Vijay Prashad, Arab Spring, Libyan Winter, Oakland 2012 5 Siehe hierzu vor allem Maximilien Forte, Slouching Towards Sirte. NATO’s War on Libya and Africa, Montreal 2013, besonders Kapitel 3, »Libyan Pan-Africaism and Its Discontents« 6 »Sirte Declaration: Fourth Extraordinary Session of the Assembly of 251 Heads of State and Government«, 8.-9.9.1999, Sirte, Libyen; siehe http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/sirte.htm 7 »Gaddafi vows to push Africa unity«, BBC News, 2.2.1999 8 »AU summit extended amid divisions«, BBC News, 4.2.1999 9 Im März 2014 bestätigte ein iranischer Überläufer, der Iran und nicht Libyen sei für den Absturz von PanAm 103 über Lockerbie verantwortlich gewesen. Gordon Rayner, »Lockerbie bombing >was work of Iran, not Libya< says former spy«, The Telegraph, 10.3.2014 10 Eine ausgezeichnete Website zu alldem ist http://lockerbiecase.blogspot.com/; sie wird von Robert Black betrieben, einem Anwalt, der maßgeblich zum Zustandekommen des Verfahrens im holländischen Camp Zeist gegen die beiden Libyer beigetragen hatte und dies später bitter bereute. 11 Siehe John Ashton & Ian Ferguson, Cover-Up of Convenience: the Hidden Scandal of Lockerbie, London 2001, und den Bericht des Prozessbeobachters Dr. Hans Koechler von 2001, http://i-po.org/lockerbie-report.htm. Seitdem sind drei weitere Bücher erschienen, die nicht nur den unfairen Charakter des Verfahrens gegen die beiden angeklagten Libyer, sondern auch die Unschuld des am Ende wegen Mordes zu zwanzig Jahren Haft verurteilten Angeklagten Abdel-Basset al-Megrahi demonstrieren: John Ashcroft, Megrahi. You Are My Jury, Edinburgh 2012; John Ashcroft, Scotlands’s Shame. Why Lockerbie Still Matters, Edinburgh 2013 und Morag G. Kerr, Adequately Explained by Stupidity? Lockerbie, Luggage and Lies, Leicestershire 2013 12 Siehe dazu Almut Besold, »Libyens gezielte Annäherung an den Westen«, in Fritz Edlinger und Erwin M. Ruprechtsberger (Hg.), Libyen. Geschichte – Landschaft – Gesellschaft – Politik, Wien 2010, S. 136–158. Dieses Buch bietet auch sonst einen guten Überblick über die komplexe Geschichte und moderne Entwicklung Libyens. Ich selbst konnte den Trend zur Verwestlichung 2007 im Rahmen einer internationalen Konferenz in Tripolis zum Internationalen Strafgerichtshof beobachten. Die Herangehensweise dieser Konferenz an das Thema entsprach ganz sicher nicht den Auffassungen Muammar Gaddafis, der sich auf keinerlei sichtbare Art einmischte. Zu dieser Zeit besuchten etliche hohe Politiker und Wirtschaftsleute aus dem Westen Libyen. Saif al-Islam verkörperte ganz offensichtlich diese neue Richtung. Ironischerweise scheint es heute, als habe die gewaltsame westliche Intervention das genaue Gegenteil bewirkt. 252 13 Für die Beschreibung zweier monströser Experimente mit tödlichen Folgen (an Afroamerikanern und in Guatemala) siehe »Die grausamen Menschenversuche der US-Amerikaner: In den 1940er-Jahren infizierte der amerikanische Gesundheitsdienst absichtlich Gefängnisinsassen und psychisch kranke Personen mit SyphilisErregern«, Die Welt, 7.11.2011. Zu Afrika siehe Senan Murray, »Anger at deadly Nigerian drug trials«, BBC News, 20.7.2007, und David Smith, »Pfizer pays out to Nigerian families of meningitis drug trial victims«, The Guardian, 12.8.2011. Dieser Fall des Pharmakonzerns Pfizer, bei dem afrikanische Kinder 1996 in Kano in Nigeria ohne ihre oder die Zustimmung ihrer Eltern zur Testung eines Antibiotikums gegen Meningitis benutzt wurden, war 2006 sogar Thema eines erfolgreichen, auf einem Roman von John Le Carré basierenden Films, »Der ewige Gärtner«. Siehe hierzu das Interview von Rüdiger Sturm »>Ich bin zorniger geworden<: John Le Carré über die Briten und den Terror, die Rolle der Pharmaindustrie in Afrika und die Verfilmung seines Bestsellers >Der ewige Gärtner<«, Die Welt, 3.1.2006, in dem Le Carré unter anderem sagt: »Die Hälfte der Medikamente, die in Afrika angeboten werden, sind Fälschungen. Und pharmazeutische Unternehmen, die andererseits mit allen erdenklichen Mitteln gegen Generika kämpfen, weigern sich, diese Fälschungen zu identifizieren, um die eigenen Medikamente nicht zu diskreditieren.« Berichte über die erwähnten Experimente haben einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung in Afrika, obwohl man im Westen kaum von ihnen hört und die Berichte manchmal übertrieben sein mögen. Siehe auch Sarah Boseley, »Doctors raise questions over drug trials in developing countries. Medical paper claims some trials of already licensed medicines are carried out to increase sales rather than improve drug«, The Guardian, 12.6.2012; außerdem »Non-consensual Medical Research in Africa: The Outsourcing of the Tuskeegee Project«, The Rebecca Project, 2011, http://www.rebeccaprojectjustice.org/images/stories/Fact%20Sheets/nonconsensua 14 »Bin Laden möglicherweise in Mord an Deutschen in Libyen verwickelt«, Handelsblatt, 13.11.2001 15 Auf Deutsch siehe hierzu Nathan Gardels und Sascha Lehnartz, »>Gaddafi wird gehen. Aber Westerwelle auch<«, Interview mit Bernard-Henri Lévy, Die Welt, 27.3.2011. Auf die Frage der Interviewer »Wer sind die Rebellen, mit denen der Westen sich gerade verbündet? Säkularisten, Islamisten? Und was wollen sie überhaupt?« antwortete Lévy: »Säkulare Kräfte, definitiv. Sie wollen ein 253 einheitliches Libyen mit einer Hauptstadt Tripolis und einer frei gewählten Regie rung.« 16 »Arab League head expresses support for no-fly zone over Libya«, The Free Library, wo The Middle East Reporter, 22.3.2011 zitiert wird. 17 »Gaddafi bietet Rebellen Amnestie an: Wenn sie Kämpfe einstellen & Waffen niederlegen«, News.at, 30.4.2011, und »Gaddafi fordert Verhandlungen«, n-tv. de, 30.4.2011 18 »Libysche Liga für Menschenrechte« 19 »Urgent Appeal to World Leaders to Stop Atrocities in Libya«, UN Watch, 20.2.2011. Erstunterzeichner des Briefs sind einundzwanzig Personen und Institutionen aus der Schweiz, Indien, den USA, Deutschland und anderen Ländern sowie die Libysche Liga für Menschenrechte Dr. Sliman Bouchuiguirs, von der die einzige Unterschrift aus Libyen stammt. Der Brief wurde offenbar schon vor der Rede Bouchuiguirs verteilt. 20 Alfred Hackensberger, »Die Mär von schwarzafrikanischen GaddafiSöldnern«, Die Welt, 31.8.2011, und Sebastian Range, »Zum Tod Muammar al-Gaddafis: Libyen ist alles andere als ein befreites Land«, Hintergrund, 21.11.2011. Beide Artikel beleuchten auch den Ausbruch eines wütenden antischwarzen Rassismus, der den Kampf zum Sturz Gaddafis begleitete. Siehe ferner Maximilian Forte, »The War in Libya: Race, >Humanitarianism,< and the Media«, Monthly Review, 20.4.2011 21 Ian Black, »Qatar admits sending hundreds of troops to support Libya rebels«, The Guardian, 26.11.2011 22 Hillary Rodham Clinton, »Clinton’s Update on Implementation of U.N. Libya Resolutions«, US Department of State, IIP Digital, 24.3.2011 23 Hillary Clinton et al., »Meet the Press Transcript for March 27, 2011«, Transcripts on Meet the Press, NBC News, http://www.nbcnews.com/id/42275424/ns/meet_the_presstranscripts/#.Vomb8LbhCUk 24 Siehe https://www.youtube.com/watch?v=7gJz45K4Q50 für eine Reihe freimütiger Äußerungen Dr. Bouchuiguirs. 25 Eine grundlegende Studie hierzu, die auch die historischen Wurzeln beleuchtet: James Peck, Ideal Illusions: How the U.S. Government Co-Opted Human Rights, New York 2011 26 Sliman Bouchuiguir, The Use of Oil as a Political Weapon. A Case Study of the 1973 Arab Oil Embargo, PhD Dissertation, Washington 1979, erhältlich als Dissertationsdruck der George Washington University 254 27 Andrew Quinn, »Clinton says Gaddafi must go« (mit Video), Reuters, 28.2.2011 28 So der Titel des Libyen-Kapitels in ihrem Buch Entscheidungen, siehe S. 549 29 Bob Dreyfuss, »Clinton Promises to Bomb Libya, Calls Qaddafi >Creature<« The Nation, 17.3.2011 (Bericht über die Debatte des UN-Sicherheitsrats über die Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen) 30 Entscheidungen, S. 541 31 Ebd. 32 Edward Cody, »Arab League condemns broad bombing campaign in Libya«, Washington Post, 20.3.2011 33 Ebd., S. 553 34 Muammar Gaddafi, »We All Hate One Another. The Americans Might Hang You All One Day Like They Hanged Saddam«, Rede auf der Gipfelkonferenz der Arabischen Liga in Syrien im März 2008, The Middle East Research Institute (MERI), 29.3.2008. Siehe dazu und zu allen folgenden Zitaten auch »Muammar al Gaddafi – Rede 2008 in Damaskus vor der Arabischen Liga. Video mit deutschen und englischen Untertiteln«, NOCH.INFO, gepostet am 16.12.2015, Link https://www.youtube.com/watch?v=-pPwePzZtrA 35 Hier und im folgenden Entscheidungen, S. 541f. 36 Ebd., S. 545 37 Siehe »Obamas Stabschef sieht Flugverbot über Libyen skeptisch«, Focus Online, 6.3.2011, und viele weitere seinerzeitige Presseberichte. Siehe auch Entscheidungen, S. 554: »Am 9. März war der Nationale Sicherheitsrat im Situation Room des Weißen Hauses zusammengekommen, um über die Krise in Libyen zu sprechen. Dort hatte es kein allzu großes Verlangen nach einem direkten Eingreifen der USA gegeben. Verteidigungsminister Gates vertrat die Ansicht, in Libyen seien keine wichtigen nationalen Interessen der Vereinigten Staaten tangiert. Und laut Auskunft des Pentagons würde die meistdiskutierte militärische Option – die Einrichtung einer Flugverbotszone, wie wir sie in den neunziger Jahren im Irak aufrechterhalten hatten –, wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Rebellen einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Dafür seien Gaddafis Bodentruppen einfach zu stark.« Ganz aktuell siehe außerdem Seymour Hersh, »Military to Military«, London Review of Books, Vol. 38 S. 1, 7.1.2016 38 Thabo Mbeki, »Reflections on Peacemaking, State Sovereignty and 255 Democratic Governance in Africa«, Thabo Mbeki Foundation Website, Rede vor dem Community Law Center Bellville/Kapstadt,16.2.2012 39 Hillary Clinton, »Remarks on the Situation in Libya and Resolution 1973«, American Rhetoric Online Speech Bank, 19.3.2011 40 Jeffrey Scott Shapiro und Kelly Riddell, »Secret Tapes Undermine Hillary Clinton on Libyan War«, The Washington Times, 28.1.2015 41 Der Krieg gegen Libyen begann am 19.3.2011 mit einem Angriff Frankreichs, an dem sich auch die USA, Kanada und Großbritannien beteiligten. Siehe Stefan Schultz »Operation Odyssey Dawn: Alliierte starten massive Luftschläge gegen Gaddafi-Regime«, Spiegel Online, 19.3.2011, ein langer Artikel, den man schwerlich anders denn als R2P-Propaganda bezeichnen kann. Die Operation der NATO begann dann am 22. März 2011. 42 Diana West, »Did the U.S. Choose War in Libya Over Qaddafi’s Abdication?«, Townhall.com, 25.4.2014 43 Ebd. 44 Ebd. 45 Siehe Almut Besold, »Libyens gezielte Annäherung an den Westen«, und Horace Campbell, Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya, New York 2013, Kapitel 5 (S. 55–62): »The Neoliberal Assault on Libya: London School of Economics and Harvard, Professors« 46 Siehe »US-Anlagenbauer Bechtel baut Kraftwerk in Lybien«, Chemietechnik Online, 5.1.2010, und »A Commercial Cautionary Tale: Bechtel’s Bid for Sirte Port Falls Flat. Passed to the Telegraph by WikiLeaks«, The Telegraph, 31.1.2011 47 »Bishop confirms Gaddafi son’s death. Appeals to NATO and UN to end the bombing of Libya«, AFP, 1.5.2011 48 Sami Moubayed, Under the Black Flag. At the Frontier of the New Jihad, London 2015, S. 206, und »ISIS releases video purporting to show beheading of 21 Egyptian Coptic Christians in Libya«, Youtube 49 Elise Labott, »Clinton makes unannounced visit to Libya«, CNN, 19.10.2011; die folgenden Zitate entstammen diesem Bericht. 50 Während ich in Libyen nie auch nur einen Tropfen Alkohol zu Gesicht bekam, genossen Frauen meiner Beobachtung nach im Hinblick auf Kleidung, rechtlichen Status und berufliche Möglichkeiten bemerkenswert viel Freiheit. Auch konnte man junge, unverschleierte Frauen sehen, wie sie in den Parks mit ihren Freunden Händchen hielten, etwas, das in islamistischen Staaten undenkbar ist. 256 51 Siehe https://www.youtube.com/watch?v=YD5sUCowUo&bpctr=1451852504 52 »We came, we saw, he died: What Hillary Clinton told news reporter moments after hearing of Gaddafi’s death«, Daily Mail, 21.10.2011. Video https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y. Ihre Äußerungen hierzu gegenüber Fox News finden sich unter https://www.youtube.com/watch?v=i1fJwS_SWD8; auf die spezifische Frage, ob sie bedaure, was sie gesagt habe, meinte sie, das werde sie nicht kommentieren. 53 »Bengasi: Unter Beschuss«, Entscheidungen, S. 577–622 54 Entscheidungen, S. 578 55 Ebd., S. 579 56 Ebd., S, 580 57 Für ein längeres Zitat siehe Maximilian Forte, »Libya: Empire or Dignity«, Teil sechs eines langen Artikels auf http://zeroanthropology.net/2012/09/22/libya-empire-or-dignity/; zu Beginn dieses Zitats heißt es auch: »Libyen ist ein starker Partner im Kampf gegen den Terrorismus gewesen, und die Kooperation über unsere Verbindungskanäle war ausgezeichnet.« Siehe auch https://search.wikileaks.org/plusd/, wo sich mittels der verschiedenen Suchfunktionen weitere Informationen über die Telegramme von Stevens finden lassen, sowie die Fußnoten in Fortes Artikel. 58 Siehe dazu Noam Chomsky, Deterring Democracy, London 1992, S. 239–241 59 Forte, Slouching Towards Sirte, S. 295 60 Forte, Slouching Towards Sirte, S. 73. Zwei weitere ausgezeichnete Werke zu Libyen und zum NATO-Krieg gegen dieses Land sind Cynthia McKinney (Hg.), The Illegal War on Libya, Atlanta 2002 und Horace Campbell, Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya, New York 2013. 6 Russland verstehen? Nein, danke! 1 Für die Pressekonferenz Putins vom 4. März 2014, auf der diese Bemerkung fiel, siehe das synchronübersetze Video »Wladimir Putin zur Lage in der Ukraine«, https://www.youtube.com/watch? v=3GwgpQJcW_g. Siehe auch »Putin-PK: So begründet er den Einsatz auf der Krim«, Focus Online, 4.4.2014; im Unterschied zu diesem neutralen Bericht waren viele andere Berichte in der deutschen Presse extrem tendenziös. 257 2 Daher kommt in Deutschland auch der ursprünglich verächtlich gemeinte Ausdruck »Putinversteher«, der von den Adressaten mittlerweile oft selbstbewusst und ironisch als Selbstbezeichnung verwendet wird. 3 1997 machte der Vater der »Politik der Eindämmung« gegenüber der Sowjetunion, George Kennan, seinen berühmte Kommentar, die Expansion der NATO wäre »der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der Ära nach dem Kalten Krieg«. Auch Henry Kissinger und diverse Militärexperten sprachen sich gegen die NATO-Erweiterung aus. Zu Letzterem siehe Eugene J. Carroll Jr, (Marinekonteradmiral i.R. und stellvertretender Direktor des Center for De-fense Information in Washington), »NATO Expansion Would Be an Epic >Fateful Error<«, Los Angeles Times, 7.7.1997. Zur Behandlung Russlands nach dem Kalten Krieg durch die ClintonAdministration, siehe Strobe Talbott, The Russia Hand, New York 2002 4 Zbigniew Brzezicnski, Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Frankfurt/Main 1999 5 Ebd., S. 16 6 Ebd., S. 65–66 7 Carl Bernstein, Hillary Clinton. Die Macht einer Frau, München 2007, Zitate S. 822 und 822–823 8 Ebd., S. 841 9 Ebd.; Übersetzung aus dem US-Original des Buchs hier leicht modifiziert. 10 RIA Novosti – »Präsident Putin: >Monopolare Welt ist undemokratisch und gefährlich««, München, 10.2.2007; http://de.sputniknews.com/meinungen/20070213/60672011.html. Alle Zitate von dort 11 Rob Watson, »Putin’s speech: Back to cold war?«, BBC News, 10.2.2007; siehe auch Sebastian Fischer, »Sicherheitskonferenz in München: Putin schockt die Europäer«, Spiegel Online, 10.2.2007 12 »Putin attacks >very dangerous< US«, BBC News, 10.2.2007 13 Clinton, Entscheidungen, S. 355 14 Ben Smith, Hillary: »Putin >doesn’t have a soul<«, Politico, 6.1.2008 15 Entscheidungen, S. 376 16 Ebd., S. 367 17 Ebd., S. 364 18 Ebd. 19 Ebd., S. 350 258 20 Beispiele hierfür finden sich an mehreren Stellen im vorliegenden Kapitel. 21 Ebd., S. 351 22 Bernstein, Hillary Clinton, S. 461 (über missliebige Teilnehmer an einem Treffen in Camp David Anfang 1993, auf dem die Strategie der Clinton-Administration für die nächsten vier Jahre festgelegt wurde. Diese seien als »Bösewichte« zu charakterisieren, während es gelte, Gegner der Clinton-Gesundheitsreform zu »dämonisieren). Siehe auch S. 464 (zu Hillary Clintons Absicht, Mitglieder des Kongresses und des medizinischen Establishments zu »dämonisieren«, falls sie versuchen sollten, Änderungen an ihren Plänen zur Gesundheitsreform vorzunehmen oder diese zu behindern). Senator Bradley, dem gegenüber sie diese Absicht geäußert hatte, wird von Bernstein mit den Worten zitiert: »Damit war Hillary Clinton für mich erledigt. Man sagt Senatoren nicht, dass man sie verteufeln wird. Dieses Verhalten war offensichtlich typisch für sie. Diese Arroganz. Die Annahme, dass jeder, der eine Frage zu stellen wagte, ein Feind war. Die Geringschätzung. Die Heuchelei.« Für Senator Daniel Patrick Moynihan, einen Veteranen im US-Senat, der bei dem Gespräch ebenfalls anwesend war, prägte Clintons Gebaren laut einem von Bernstein zitierten Zeugen »seine Meinung über Hillary und ihre Vorgehensweise für den Rest seines Leben«. Ebd. 23 Ray Locker, »Pentagon 2008 study claims Putin has Asperger’s syndrome«, USA Today, 4.2.2015, http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/02/04/putinaspergers-syndrome-study-pentagon/22855927/ 24 Ausführlich hierzu Noam Chomsky und Laray Polk, Nuclear War and Environmental Catastrophe, New York 2013, und Noam Chomsky, Hybris. Die endgültige Sicherung der globalen Vormachtstellung der USA, Hamburg 2003. Außerdem Jonathan Weisman und Peter Spiegel, »U.S. Keeps First-Strike Strategy«, Wall Street Journal, 6.4. 2010. Ferner heißt es in dem unter https://fas.org/irp/doddir/usaf/afdd2-12.pdf zugänglichen offiziellen Dokument »Nuclear Operations. Air Force Doctrine Document 2-12« vom 7.5.2009: »Bewaffneter Konflikt verbietet nicht ausdrücklich den Besitz oder den Einsatz von Nuklearwaffen. Nach dem Völkerrecht gelten für den Einsatz von Nuklearwaffen dieselben Regeln für die Zielauswahl wie für den Einsatz jeder anderen rechtmäßigen Waffe.« (S. 8) Auf S. 10 heißt es: »Der Zweck hinter dem Einsatz von Nuklearwaffen besteht darin, die politischen Zielsetzungen der USA zu 259 erreichen und einen Konflikt zu Bedingungen zu lösen, die für die USA günstig sind.« Auf S. 16 wird Folgendes gesagt: »Die Luftwaffe kann nukleare Optionen mit konventionellen oder nicht-kinetischen Operationen kombinieren, um die Effektivität zu erhöhen und Kollateralwirkungen zu minimieren. In einigen Szenarios kann der Gebrauch einer einzigen oder einiger weniger Nuklearwaffen konventionelle Unterstützung in Form von Luftüberlegenheit, Ausschaltung der [gegnerischen] Verteidigung, Luftbetankung und Lageeinschätzung nach dem Nuklearschlag erfordern.« 25 Siehe hierzu Annedore Smith, »Galizien: In weltverlorener Einsamkeit«, Spiegel Online, 19.9.2003 26 National Iranian American Council (NIAC), »Brzeziński: US Should Not Follow Israel on Iran Like a >Stupid Mule<«, Rede Brzezińskis auf einer Konferenz des NIAC am 27.11.2012 27 »Ich muss leider sagen, dass das, was wir hier in den USA sehen, der Aufstieg zweier Fraktionen in diesem Land ist, die gegen Russland und die Russen sind. Als Erstes haben wir Brzezicński, der Obamas Mentor war, als Obama Collegestudent in Columbia war. 2008 organisierte Brzezicński die gesamte Außen- und Verteidigungspolitik der Präsidentschaftskampagne Obamas und spickte Obamas Administration mit Russlandberatern im Nationalen Sicherheitsrat, die von Brzezicńskis Center for Strategic and International Studies in Washington kommen. Ich war in Harvard im selben Doktorandenprogramm, das vor mir Brzezicński hervorgebracht hat. Er ist ein in der Wolle gefärbter Russenhasser, er hasst Russland, er hasst die Russen, und er will Russland in seine Bestandteile zerbrechen. Unglücklicherweise hat er seine Leute, seine Schützlinge in der Demokratischen Partei und in dieser Administration. Die zweite Fraktion, die gegen die Russen in Stellung geht, sind die Neokonservativen, und das spiegelt sich z. B. in diesem letzten Bericht der Brookings Institution wider, der fordert, man müsse das ukrainische Militär, man müsse diese Naziformationen bewaffnen, der sich in der jüngsten Gesetzesvorlage wiederfindet, die gestern dem Kongress vorgelegt wurde. Und die Neokonservativen haben genau dieselbe Position gegenüber Russland und den Russen. Ich habe zusammen mit etlichen dieser Neokonservativen, Wolfowitz und dem ganzen Rest, an der Universität Chicago studiert. Viele von ihnen sind Enkel von Juden, die vor den Pogromen gegen die Juden [in Russland] flohen, und wurden einer Gehirnwäsche gegen Russland und die Russen unterzogen. So haben wir also zwei sehr mächtige Fraktionen 260 hier in den Vereinigten Staaten, die gegen Russland und die Russen sind und diese Art Politik anfeuern, und ich muss leider sagen, dass nur sehr wenige Stimmen dem entgegentreten.« Francis Boyle, »Brzezicnki wants to break Russia up into constituent units«, Pravda Report, 16.2.2015, http://english.pravda.ru/news/world/16-022015/129834-brzezinski_russia-0/ 28 Brzezicński, Die einzige Weltmacht, S. 194 29 Siehe William Blum, KillingHope. U.S. Military and CIA Intervention Since World War II, Montreal 1998, Kapitel 53, »Afghanistan: America’s Jihad 1979–1992« (S. 338–352), und William Blum, America’s Deadliest Export: Democracy. The TruthAbout U.S. ForeignPolicy andEverythingElse, London 2013, Kapitel 4, »Afghanistan« (S. 79–87) 30 Siehe Alison Weir, Against Our Better Judgment. The Hidden History of How the United States Was Used to Create Israel, North Charleston 2014 31 Richard Perle et al., »A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm«, auf Information Clearing House, http://www.informationclearinghouse.info/article1438.htm 32 »Projekt für ein Neues Amerikanisches Jahrhundert« 33 Einsehbar unter http://www.rrojasdatabank.info/pfpc/PNAC--statement%20of%20principles.pdf. Die Originalwebseiten des PNAC sind seit langem gelöscht. 34 Entscheidungen, S. 695–697; das Zitat ist auf S. 696. Im selben Kapitel berichtet HRC auch über ein Treffen in Genf am 30. Juni 2012, bei dem sie und der britische Außenminister mit einem Vertreter aus Katar und dem türkischen Außenminister Ahmed Davutoglu sprachen. Über Letztere heißt es dort: »Beide bestanden darauf, wir sollten in Betracht ziehen, die Rebellen unabhängig von dem Ergebnis [der sonstigen zu der Zeit stattfindenden Gespräche] in Genf mit Militärhilfe zu unterstützen.« Ebd. S. 686. Im Weißen Haus unterlagen Clinton und Petraeus zunächst, aber später wurden die Pläne durchgeführt und endeten in einem völligen Desaster (siehe Vorwort zu diesem Buch). Einen nützlichen Überblick über Hillary Clintons Darstellung ihrer Rolle im Syrienkonflikt in Entscheidungen ist Rick Sterling, »The Wicked War on Syria: Hillary Clinton in Her Own Words«, Counterpunch, 30.9.2015 35 »US ambassador defends calling veto of Syrian resolution >disgusting and shameful<«, The Telegraph, 6.2.2012 36 »Syria: Hillary Clinton calls Russia and China >despicable< for 261 opposing UN resolution«, The Telegraph, 25.2.2012 37 Das heißt natürlich nicht, dass die gesamte Bevölkerung Assad unterstützt, und auch nicht, dass nicht auch das Regime der BaathPartei in Syrien für etliche Gräuel verantwortlich wäre. Aber jüngste Meinungsumfragen scheinen zu zei gen, dass immer noch die Mehrheit der Syrer hinter Assad steht, was sicher auch mit den Hauptalternativen al-Nusra (der syrische Flügel von al-Qaida), ISIS und diversen weiteren islamistischen Rebellengruppen zu tun hat. Siehe Stephen Gowan, »Bashar Al-Assad Has More Support Than The Western-Backed Opposition«, 11.12.2015, http://www.informationclearinghouse.info/article43728.htm. Ein rascher Überblick findet sich unter »Western poll: Assad supported by most Syrians«, offguardian, 19.12.2015 38 Tatsächlich ist diese Gruppe der syrische Zweig der Terrororganisation al-Qaida. 39 »Putin slams West for plan to arm Syrian rebels«, The Times of Israel, 22.6.2013 40 Siehe den wenige Monate nach den Ereignissen erschienenen Artikel von Matthew Shofield, »New analysis of rocket used in Syria chemical attack under-cuts U.S. claims«, McClatchyDC, 15.1.2014, in dem eine Verantwortung der syrischen Regierung für die SarinAngriffe von August 2013 explizit verneint wird. Es heißt dort, die Autoren eines Berichts mit dem Titel »Possible Implications of Faulty U.S. Technical Intelligence« (https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/possible-implications-of-badintelligence.pdf), der frühere UN-Waffeninspekteur Richard Lloyd und der MIT-Professor für Wissenschaft, Technologie und Nationale Sicherheit Theodore Postol seien zu dem Schluss gekommen, »ihre Untersuchung der Bauweise der Rakete, ihrer mutmaßlichen Ladung und ihrer möglichen Flugbahnen zeige, dass diese Rakete unmöglich aus Gebieten unter Kontrolle der Regierung des syrischen Präsidenten Bashar Assad abgefeuert worden sein könne«. Siehe außerdem Seymour Hersh, »The Red Line and the Rat Line. Seymour M. Hersh on Obama, Erdoǧan and the Syrian rebels«, London Review of Books, Vol. 36, S. 8, 7.4.2014, außerdem weitere Berichte Hershs zu diesem Thema. Zur generellen Frage des Einsatzes von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg siehe auch Chris Tomson, »OPCW Report: Rebels Used Chemical Weapons – not Assad«, Al-Masdar News, 8.1.2016. Der fehlende Willen führender US-Politiker, derlei Berichte überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn zu diskutieren, ist 262 sehr besorgniserregend. 41 Andrea Mitchell und Carrie Dann, »Hillary Clinton supports president on Syria«, NBC News, 3.9.2013 42 Patrick J. McDonnell, »U.S., Israel worry Syria rebels could get chemical weapons«, Los Angeles Times, 5.12.2012 43 Harriet Alexander, »Syria: If Bashar al-Assad hands over chemical weapons we will not attack, says John Kerry«, The Telegraph, 9.9.2013; Amy Davidson, » Six Interviews Later, a Way Out for Obama on Syria?«, The New Yorker, 9.9.2013 44 Vladimir V. Putin, »A Plea for Caution From Russia«, New York Times, 11.9.2013. Deutsche, hier zitierte Übersetzung: »Wir müssen aufhören, die Sprache der Gewalt zu sprechen«, Junge Welt, 13.9.2013 45 Vincenzo Capodici, »Die Anwendung von C-Waffen zu einem Tabu gemacht«, Tagesanzeiger, 11.10.2013 46 »A global elite gathering in the Crimea«, The Economist, 24.9.2013 47 Die deutsche Bezeichnung lautet »Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union«. Für eine interessante Studie aus Sicht der EU, siehe Ina Kirsch van de Water, »Das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union (DCFTA)«, Friedrich-Ebert-Stiftung Kiew, August 2011, http://library.fes.de/pdf-files/id/08359.pdf 48 »Ukrainian Integration With The European Union: Economic Convergence Or Economic Collapse?«, 23.9.2013, siehe http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2013/09/23/ukrainianintegration-with-the-european-union-economic-convergence-oreconomic-collapse/#2715e4857a0b1dd923b212e5 49 Carl Gershman, »Former Soviet states stand up to Russia. Will the U.S.?«, Washington Post, 26.9.2013 50 Siehe http://www.politforums.net/eng/ukraine/1423090124_0.html; dort heißt es, die Antiregierungskräfte in der Ukraine seien nicht mit dem Rücktritt Asarows Anfang 2014 und anderen Konzessionen zufrieden gewesen und hätten keinen Kompromiss gewollt, sondern hätten das Land in einen Rammbock gegen Russland verwandeln wollen: »They needed a battering ram against Rus-sia.« 51 Die heutige Hauptstadt der Ukraine, Kiew, gilt als die Geburtsstätte des russischen Reichs. 52 Samuel P. Huntington, Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München 1998, S. 264 53 Ebd. 54 Ebd., S. 267 55 Ebd., S. 267–268 263 56 Siehe Ian Traynor, »Analysis US campaign behind the turmoil in Kiev«, The Guardian, 26.11.2004, wo es heißt: »Aber während die Errungenschaften der in orange gehüllten >Kastanienrevolution< die der Ukraine sind, handelt es sich bei der Kampagne um eine amerikanische Schöpfung, eine ausgeklügelte und brillant geplante Übung in westlichem Markenmanagement und Massenmarketing, das innerhalb von vier Jahren in vier Ländern eingesetzt wurde, um Wahlfälschungen zu begegnen und unappetitliche Regimes zu stürzen.« Siehe außerdem auch Andrew Osborne, »We Treated Poisoned Yushchenko, Admit Ameri-cans«, The Independent, 12.3.2005; Gerald Sussman, »The Myths of >Democracy Assistance<: U.S. Political Intervention in Post-Soviet Eastern Europe«, Monthly Review, Dezember 2006, und Paul Blumenthal, »U.S. Obscures Foreign Aid To Ukraine, But Here’s Where Some Goes«, Huffington Post, 3.7.2014 57 Das Ukrainische wurde früher als »Kleinrussisch« bezeichnet. Das heißt nicht, dass es keine gravierenden Unterschiede zum Russischen gibt. Aber den ukrainischen Nationalisten liegt an einer künstlichen Vertiefung dieser Unterschiede, um die Verständigung zwischen Sprechern des Russischen und Sprechern des Ukrainischen zu behindern. 58 Für eine Diskussion der Opferzahlen unter Stalin, sei es während der Hungersnot 1932/1933 oder überhaupt, ist hier nicht der Platz. Es verdient aber angemerkt zu werden, dass diese Zahlen oft gewaltig übertrieben werden, oft in der Absicht, zu suggerieren, Stalin und damit die Sowjetunion seien eigentlich noch schlimmer als Hitler gewesen. Siehe hierzu das Buch des trotzkistischen Autors Wadim S. Rogowin, Gab es eine Alternative zum Stalinismus? Artikel und Reden, Essen 1996, außerdem sein mehrbändiges, scharf kritisches Werk zur Geschichte der Sowjetunion. Zur Frage, ob es sich bei der tragisch hohen Zahl von Toten in der Ukraine Anfang der 1930er Jahre um einen Völkermord handelte, siehe Michael Haynes und Rumy Hasan, A Century of State Murder. Death and Policy in Twentieth Century Russia, London 2003, S.72–73, wo die Autoren zu dem Schluss kommen, eine Isolation des »ukrainischen Volkes« als spezielle ethnische Zielscheibe der Ereignisse erscheine »eher als Werkzeug des späteren ukrainischen Nationalismus, durch das die Geschichte verfälscht wird und das all den anderen, die ebenfalls während der Hungernot litten und starben, einen schlechten Dienst erweist«. Auf Deutsch siehe Mark B. Tauger, »War die Hungersnot in 264 der Ukraine intendiert?«, in Jens Mecklenburg und Wolfgang Wippermann (Hg.), Kritik des Schwarzbuchs des Kommunismus, Hamburg 1998, S. 158–167. Sehr ausführlich die Studie von Donald Tottle, Fraud, Famine and Fascism. The Ukranian Genocide Myth from Hitler to Harvard, Toronto 1987. 59 Entscheidungen, S. 526 60 Ebd., S. 616 61 Robert Gates, Duty. Memoirs of a Secretary at War, New York 2014 62 Washington Talk: Briefing; Departing Official, New York Times, 18.3.1988 63 »Jazenjuk bittet um Unterstützung« – Der ukrainische Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk im Gespräch mit Pinar Atalay, Tagesthemen, 7.1.2015, https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-jazenjuk101.html 64 Als Video mit deutschem Voice-Over: https://www.youtube.com/watch?v=fk6SvNzRDL8. Das Voice-Over ist nicht ganz akkurat, aber dennoch ist das hier zur Gänze auf Deutsch wiedergegebene Gespräch höchst aufschlussreich. Für das Original, siehe https://www.youtube.com/watch?v=8YSFNOaJupE. Zu den Reaktionen in Deutschland siehe Barbara Junge, »Angela Merkel empört über Nulands verbale Entgleisung«, Tagesspiegel, 7.2.2014 65 Victoria Nuland, »Remarks at the U.S.-Ukraine Foundation Conference«, U.S. Department of State, 13.12.2013. Für deutsche Kommentare, siehe Hans Springstein, »5 Milliarden Dollar für den Staatsstreich«, Freitag, 1.3.2014; Alice Bota und Kerstin Kohlenberg, »Haben die Amis den Maidan gekauft?«, Zeit Online, 17.5.2015 66 Die Vorläuferorganisation der Swoboda-Partei war die rechtsextreme »Sozial- Nationale Partei der Ukraine«. Parubij schloss sich später einer Reihe anderer Parteien an. An seiner politischen Haltung änderte dies wenig; in seiner Funktion als »Kommandeur des Maidan« arbeitete er eng mit dem Führer der paramilitärischen Organisation »Rechter Sektor«, Dmytro Jarosch, zusammen. 67 Philipp Jahn, Olga Sviridenko und Stephan Stuchlik, »Neue Hinweise auf Maidan-Schützen«, ARD-Monitor, 10.4.2014 (https://www.youtube.com/watch?v=kfN__DbkjNI); später auch Sonja Tjong, »Neue Hinweise: Schossen auch prowestliche Demonstranten in die Maidan-Menge?«, Focus Online, 16.2.2014, außerdem der BBC-Bericht, auf den dieser ausführliche Artikel sich stützt: https://youtu.be/Ib7EkJD08e4?t=11 68 »The >Snipers’ Massacre< on the Maidan in Ukraine« von Ivan 265 Katchanovski, Ph.D., University of Ottawa. Siehe https://www.academia.edu/8776021/The_Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_U Siehe außerdem einen der ersten deutschsprachigen Berichte über die Forschungen Katchanovskis, Stefan Korinth, »Aufklärung der MaidanMorde: >Ich bin nicht sicher, wann ich wieder in die Ukraine reisen kann<«, Telepolis, 12.12.2014, und das Video https:// www.youtube.com/watch?v=pxx5W--cymI (»Ivan Katchanovski: The >Snipers’ Massacre< on the Maidan in Ukraine«); ferner zuletzt: »Studie: Vom Westen un terstützte Opposition hat Maidan-Massaker verübt«, Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 2.1.2016 69 Gerhard Lechner, »Offene Fragen zu Ereignisse auf dem Maidan«, Wiener Zeitung, 19.2.2015. Zu möglichen Urhebern des Scharfschützenmassakers befragt sagt Kirsch: »Es gibt einen Untersuchungsbericht. Der wird aber nicht veröffentlicht, weil darin Unangenehmes über Andrij Parubij, den nationalistischen Kommandanten des Maidan, stehen könnte. Das würde sich auch mit dem decken, was die BBC jetzt veröffentlicht hat: dass nämlich die Schüsse aus dem Konservatorium und dem Hotel Ukraina gekommen sind. Das Konservatorium aber war unter vollständiger Kontrolle des Maidan. Und im Ukraina, das am 20. Februar zu einem MaidanLazarett wurde, nächtigten die westlichen Journalisten. Niemand kam ins Ukraina, ohne dass die Maidan-Leute das bemerkt hätten.« 70 So geschehen in mehreren vielfach geklickten Videos auf Youtube, die mittlerweile vermutlich gelöscht sind. In einem davon äußerte sich eine Frau auf den Stufen eines Gebäudes in dieser Richtung und in einem anderen wurde ein Mann interviewt, der sich dafür aussprach, die »Russen« in der Ostukraine zu vertreiben, um die dortigen Ressourcen nutzen zu können. Es ist indes nicht nötig, sich auf meine Erinnerung an diese Youtube-Videos zu verlassen. Denn die bekannte Ikone des »antirussischen Widerstandes« in der Ukraine, Julia Timoschenko, sprach sich höchstselbst in einem abgehörten und dann geleakten Telefongespräch dafür aus, »zu den Waffen [zu] greifen und diese verdammten Russen [zu] töten, zusammen mit ihrem Anführer«. Siehe »Timoschenko-Tonband aufgetaucht: Tötet die Russen!«, Deutsche Wirtschafts-Nachrichten, 25.3.2014. Über Wladimir Putin sagte sie: »Ich bin bereit, selbst eine Maschinenpistole zu nehmen und diesem Bastard in den Kopf zu schießen.« Timoschenko räumte die Echtheit des Mitschnitts ein, behauptete aber, dieser sei an einer Stelle manipuliert worden: Sie habe nie, wie in der veröffentlichten Aufnahme, über die acht Millionen »Russen« (gemeint sind russische 266 Muttersprachler) gesagt, »man sollte sie mit Nuklearwaffen erledigen«. Siehe Julia Smirnova, »>Bin bereit, dem Bastard in den Kopf zu schießen<«, Die Welt, 25.3.2014. Siehe auch Adam Taylor, »In latest wiretapping leak, Yulia Tymoshenko appears to say >nuclear weapons< should be used to kill Russians«, Washington Post, 25.3.2014, und die Youtube-Videos https://www.youtube.com/watch? v=m6t5PQ3rQ8U (englische Übersetzung) und https://www.youtube.com/watch?v=5vT_FMlstaQ (Deutsch). 71 Die mächtigen Gouverneure der Regionen der Ukraine werden bis heute von der Zentralregierung in Kiew ernannt. 72 Siehe http://stormcloudsgathering.com/the-odessa-massacre-whatreally-happened (»The Odessa Massacre – What REALLY Happened«), 12.5.2014 für eine schockierende und glaubwürdige Analyse der Ereignisse. Siehe außerdem das elfminütige Video https://www.youtube.com/watch?v=H4dJRnI-X8Q, das mit der vorgenannten Quelle verlinkt ist, und das umfassendere Video https://www.youtube.com/watch?v=QxcB0PI4ZLg. Interessant wäre auch ein Vergleich des fast völligen Schweigens, das auf das erwiesene Massaker in Odessa folgte, mit der Reaktion auf das – aller Wahrscheinlichkeit nichtexistente – Raçak-»Massaker«, das den Kosovokrieg auslöste. 73 Die internationalen Wahlbeobachter wurden in der deutschen Presse oft pauschal als Angehörige rechter europäischer Parteien diffamiert. Siehe hierzu »3sat Kulturzeit: Lügen über Wahlbeobachter beim KrimReferendum«, Propagandaschau (online), 14.3.2014 74 Für beide Zitate siehe »Kerry on Russia: «You just don’t invade another country on a completely trumped up pretext”, Salon, 2.3.2014 75 »The World from Berlin: >Belgrade Must Rethink Its Destructive Kosovo Policy<«, Spiegel Online International, 23.7.2010 76 »Unsere anhaltende Stärke spiegelt sich auch in unserer Achtung für die internationale Ordnung wieder«, Rede von US-Präsident Obama an die europäische Jugend (im Wortlaut), AG Friedensforschung, Veranstalter des Friedenspolitischen Ratschlags, http://www.agfriedensforschung.de/regionen/USA1/obama-bruessel.html 77 Der Artikel »Obama fordert stärkere Abgrenzung von Russland«, Zeit Online, 26.3.2014, lässt diesen peinlichen Patzer weg, ebenso Gregor Peter Schmitz, »US-Präsident Obama in Brüssel: Dank Putin wieder beste Freunde«, Spiegel Online, 26.3.2014 78 Gegenüber der Lokalzeitung Long Beach Press-Telegram. Siehe »Fragwürdiger Vergleich: Clinton zog Parallele zwischen Putin und 267 79 80 81 82 Hitler«, Spiegel Online, 5.32014 Rede mit deutschem Voice-Over auf https://www.youtube.com/watch? v=hTc4nU2QF5M; Zitat Benjamin Bidder, »Putin-Rede zur KrimKrise: Der Großmächtige«, Spiegel Online, 18.3.2014 Siehe hierzu unter anderem Matthias Bröckers und Paul Schreyer, Wir sind die Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren, Frankfurt/Main 2014 »Russischer Außenminister Lawrow: Sanktionen haben Machtwechsel in Moskau zum Ziel«, n-tv.de, 16.12.2014 Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich der Schwerpunkt der US-Kontrolle von den US-Truppenstützpunkten auf die NATO verlegt, in der die USA gegenüber allen anderen Staaten nach wie vor der militärische Gigant sind. Auch heute noch sind mehr als 60 000 US-Soldaten in Europa stationiert, vorwiegend in Deutschland, Italien und Großbritannien, aber auch in neu errichteten Stützpunkten wie Camp Bondsteel im Kosovo. Theoretisch unterliegen sie dort den jeweiligen nationalen Gesetzen, aber de facto sind diese Militärbasen kleine US-Kolonien auf fremdem Boden. Siehe unter anderem »US military to close 15 bases in Europe«, BBC News, 8.1.2015. Ferner haben die USA bereits mit der Stationierung neuer Atomwaffen in Deutschland begonnen; siehe hierzu Eric Zuesse, »U.S. Will Station New Nuclear Weapons in Germany Against Russia«, Washington’s Blog, 21.9.2016. Dort heißt es: »Der deutsche öffentliche Fernsehsender ZDF bringt am morgigen Dienstag, dem 22. September, die Schlagzeile >In Deutschland sollen neue Atomwaffen stationiert werden<, und berichtet, die USA würden zwanzig neue Atombomben nach Deutschland bringen, von denen jede das Vierfache der Destruktionskraft der Hiroshimabombe hat. […] Ein früherer parlamentarischer Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium, Willi Wimmer, der Merkels eigener konservativer Partei angehört, warnte, diese >neuen Angriffsoptionen gegen Russland< stellten >eine bewusste Provokation unserer russischen Nachbarn< dar.« Auch die Deutschen WirtschaftsNachrichten berichteten am selben Tag (»Merkel einverstanden: USA stationieren neue Atombomben in Deutschland«) kurz darüber: »Die USA beginnen mit der Stationierung neuer Atomwaffen in Deutschland. Der Bundestag hatte erst im Jahre 2009 mit Mehrheit beschlossen, die USA sollten ihre Atomwaffen abziehen. Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist offenkundig untätig geblieben. Stattdessen müssen nun die deutschen Steuerzahler die 268 Modernisierung der Flughäfen für die US-Air Force bezahlen.« Im Hinblick auf die US-Hegemonial-politik gegenüber Europa gilt das Sprichwort »plus ca change plus c’est la meme chose« – die Formen mögen sich ändern, aber das Ziel wird mit derselben Konsistenz wie immer weiterverfolgt. Einer der Aspekte dieser zielstrebigen USPolitik ist natürlich, dass US-Truppen nun auch in Osteuropa stationiert sind, so etwa im bulgarischen Luftwaffenstützpunkt Besmer und natürlich im Kosovo. 83 George Soros, »Wake Up, Europe«, The New York Review of Books, 20.11.2014 (für eine deutsche Zusammenfassung siehe Christoph Sackmann, »George So-ros: >Wach auf, Europa!<«, Finanzen100, 24.10.2014) und »A New Policy to Res-cue Ukraine«, The New York Review of Books, 5.2.2015. Siehe auch Soros langen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, »Helft der neuen Ukraine!«, FAZ. net, 8.1.2015 und die Kurzreportage »Georges Soros: >Rettung der neuen Ukraine muss oberste Priorität Europas sein<«, Wallstreet Online, 17.9.2015 84 Soros, »Wake Up, Europe« 85 Ebd. 86 Siehe u. a. Katy Barnato, »Russia sanctions may get >much worse< after crash«, CNBC, 18.7.2014 87 Bei diesem Zwischenfall im August 1964 erhoben die USA die Beschuldigung, Kampfboote Nordvietnams hätten im vietnamesischen Golf von Tonkin ein US-Kriegsschiff angegriffen. Die Beschuldigung, die sich später als haltlos erwies, diente den USA als Vorwand zum Beginn der Bombardierung Nordvietnams, was dann der Auslöser des weitere elf Jahre währenden Indochinakriegs der USA war. 88 Sasha Goldstein, »Hillary Clinton to Charlie Rose on Malaysia Airlines Flight MH17: >Should be outrage in European capitals< if Russia shot down plane over Ukraine«, New York Daily News, 17.7.2014 89 »Downing of Malaysian jet highlights urgency of resolving Ukraine crisis – UN official«, mit Video, UN News Centre, 18.7.2014 90 Für Bushs Rede siehe https://www.youtube.com/watch? v=10qatUWwIeg 91 »Fmr. Sec. Hillary Clinton to Fareed Zakaria: Putin indirectly responsible for MH17«, CNN, 27.7.2014 92 James O’Neill, »Why the Secrecy on the MH17 Investigation«, Counterpunch, 19.-21.12.2014 93 Haris Hussain, »US analysts conclude MH17 downed by aircraft«, 269 New Straits Times Online, 7.8.2014. Der Artikel bezieht sich auf Robert Parrys Bericht »Flight 17 Shoot-Down Scenario Shifts«, consortiumnews.com, 3.8.2014 94 O’Neill, »Why the Secrecy on the MH17 Investigation« 95 »Did Major Countries Agree Not to Disclose Key Details in Downing of Malay-sian Airlines Flight 17?«, Interview mit Stephen Cohen, Democracy Now!, 5.9.2014 96 http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1407/26/ndaysat.03.html (Transkript CNN News, 26.7.2014) 97 »Ukraine in the White House Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest and Deputy National Security Advisor Tony Blinken«, Embassy of the United States, Kyiv, Ukraine, 28.7.2014 98 Jeff Wise, The Plane That Wasn’t There: Why We Haven’t Found Malaysia Airlines Flight 370, Kindle 2015 99 Gesche Wüpper, »Frankreich wegen Rüstungsdeal in der Zwickmühle«, Die Welt, 30.10.2014; inzwischen hat Russland auf Strafzahlungen verzichtet: »Kreml einigt sich mit Paris im Kriegsschiff-Streit«, Die Welt, 15.8.2015 100 Joe Biden, »Remarks by the Vice President at the John F. Kennedy Forum«, The White House, 3.10.2014 101 Victoria Nuland, »Keynote at the 2014 U.S.-Central Europe Strategy Forum, U.S. Department of State«, 2.10.2014 102 Laut dem britischen Satiriker John Oliver mindestens sechs Mal; siehe Tim Molloy, The Wrap, »John Oliver’s New HBO Show >Last Week Tonight< Is Getting Mixed Reviews«, Business Insider, 28.4.2014 103 »The president on dealing with Russia«, The Economist, 2.8.2014 104 »US-Präsident: >Russland wird für seine Aggressionen bezahlen««, Focus Online, 24.9.2014; für die vollständige Rede siehe »Gegen das >Geschwür des gewalttätigen Extremismus««, AG-Friedensforschung, 25.9.2014 105 »Remarks by the President in State of the Union Address«, The White House, 20.1.2015 106 »Saakashvili eats his tie«, https://www.youtube.com/watch? v=Kid379OjuC0. 107 »Flashmob in Odessa – Ties for Mikhail Saakashvili May 30th«, https://www.youtube.com/watch?v=A81SMesWWLk 108 Lechner, »Offene Fragen zu Ereignisse auf dem Maidan«, 19.2.2015 109 Siehe den Kommentar von Ron Paul: »Reckless Congress >Declares War< on Russia «, Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, 4.12.2014. Auf Deutsch siehe Sandra Tjong, »Republikaner Ron Paul 270 klagt an: >US-Kongress erklärt Russland den Krieg<«, Focus Online, 9.12.2014, und Gert Ewen Ungar, »Resolution 758 / Ukraine Freedom Support Act«, Freitag, 26.12.2014 110 »Die Waldai-Rede«, Freitag, 25.10.2014, https://www.freitag.de/autoren/mopperkopp/das-waldai-forum. Diese Übersetzung ist hier teilweise etwas geglättet und modifiziert. Für ein Video der Rede mit deutschem Voice-Over siehe https://www.youtube.com/watch?v=Sx9G8X5aHfA 111 Aus der Diskussion nach Putins Rede (dieser Teil ist in der deutschen Version nicht enthalten). Siehe Vladimir Putin, »New Rules or a Game Without Rules?«, Counterpunch, 27.10.2014 7 Die Kriegspartei 1 »Remarks by Foreign Minister Sergey Lavrov at the XXII Assembly of the Council on Foreign and Defence Policy«, Moskau, 22. November 2014, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Official Site. 2 Siehe dazu unter anderem »Millionen-Spenden: Clinton-Stiftung veröffentlicht Liste ihrer Geldgeber«, Spiegel Online, 18.12.2008. Für aktuellere Daten, siehe Henry Paul, »Die Clinton Foundation im Zwielicht«, Contra Magazin, zu finden unter http://politik-imspiegel.de/die-clinton-foundation-im-zwielicht/, 24.3.2015 3 David Usborne »Clinton >misspoke< over claims of sniper fire in visit to Bosnia«, The Independent, 26.3.2008; siehe Kapitel 4, »Jugoslawien: Der Beginn des clin-tonschen Kriegszyklus«, Fußnoten 9 und 10 4 Hillary Rodham Clinton, Entscheidungen, München 2014, S. 351 5 Ein am 26.10.2001 nach den Anschlägen des 11. September verabschiedetes, Hunderte von Seiten umfassendes Gesetz, das unter dem Vorwand der Bekämpfung des Terrorismus und der nationalen Sicherheit die bürgerlichen Freiheiten in den USA stark einschränkt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung darüber hatten etliche Kongressabgeordnete das Gesetz noch nicht einmal gelesen. 6 Paul Craig Roberts, »The Neoconservative Threat to International Order«, Counterpunch, 4.3.2015 7 US-amerikanischer Russlandgelehrter, Redakteur der linksliberalen Zeitschrift The Nation und Autor zahlreicher Bücher über Russland, zuletzt Soviet Fates and Lost Alternatives. From Stalinism to the New Cold War, New York 2011 271 8 US-Politikwissenschaftler, der in Deutschland vor allem durch sein gemeinsam mit Stephen Walt verfasstes Buch Die Israel-Lobby. Wie die amerikanische Außenpolitik beeinflusst wird (Frankfurt am Main 2007) und seine Kritik an der westlichen Politik während der Ukrainekrise 2014 bekannt wurde. 9 US-Politikwissenschaftler und Publizist; Mitverfasser von Die IsraelLobby (siehe Fußnote 8) 10 Ex-US-Diplomat im Nahen und Fernen Osten und engagierter Gegner der US-»Antiterror«-Politik nach den Anschlägen vom 11. September 2001 11 Langjähriges Mitglied des Repräsentantenhauses für die Republikaner und unabhängiger Präsidentschaftskandidat 1988. Paul vertritt innenpolitisch wirtschaftsliberale Positionen, ist aber ein entschiedener Gegner des Militärisch-Industriellen Komplexes und aller gegenwärtig geführter US-Kriege. 2013 gründete er mit Dennis Kucinich (siehe Fußnote 12) und anderen das »Ron Paul Institute for Peace and Prosperity«. 12 Als langjähriges Mitglied des US-Repräsentantenhauses und Anwärter auf die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten 2004 und 2008 hat Kucinich sich immer für Frieden, Abrüstung, Bindung der US-Politik an das geltende Völkerrecht sowie für die Belange der Arbeiter, Frauen und sonstigen Unterprivilegierten der US-Gesellschaft eingesetzt. 13 Mit kurzer Unterbrechung Mitglied des Repräsentantenhauses für die Demokraten von 1993 bis 2007, gehörte McKinney dem linken Flügel ihrer Partei an, mit der sie 2007 brach, nachdem ihre erneute Kandidatur zum Kongress offenbar maßgeblich von der USamerikanischen Israel-Lobby verhindert wurde (dazu Hanan Chehata »Cynthia McKinney, Former US Presidential candidate, blames the pro-Israel Lobby for ruining her political career«, Middle East Monitor, 8.12.2011). 2008 war sie Präsidentschaftskandidatin der US-Grünen. 14 Colleen Rowley war 24 Jahre lang FBI-Agentin und deckte nach dem 11. September 2001 massives Fehlverhalten ihrer Kollegen bei Ermittlungen gegen »Terrorverdächtige« auf. Sie quittierte 2004 ihren Dienst und ist seitdem als Publizistin und Friedensaktivistin tätig. 15 William R. Polk, geboren 1929, hat eine lange Karriere als Politikberater hinter sich und ist bis heute als Publizist tätig. Er ist scharfer Kritiker der US-Kriege im Irak, in Afghanistan und Libyen und hat auf Deutsch zuletzt das Buch Aufstand. Widerstand gegen 272 Fremdherrschaft, Hamburg 2009, veröffentlicht. 16 »Die Sprüche Salomos«, Sprichwörter 16:18; siehe http://www.diebibel.de/bibelstelle/Spr16,18/ 273 Namens- und Ortsregister Abedin, Huma 72-75, 132, 251 Abedin, Saleha 72 Abedin, Zyed 72 Abramowitz, Morton 78–80, 83, 101, 106, 108, 251 Abrams, Elliott 37 Abromavičius, Aivaras 229 Adelson, Sheldon 42f. Afghanistan 43, 64, 83, 125, 161, 177, 182, 187, 189, 233, 273, 283 Afrikanische Union 149, 165 Ägypten 132, 153, 155, 168, 189 Ahmadinedschad, Mahmud 64 al-Assad, Baschar 7–10, 86, 117, 144, 192–195, 257, 259, 273f. al-Dschalil, Mustafa Abd 151 al-Megrahi, Abdel-Baset 151, 267 al-Nusra 193 al-Qaida 76, 153, 165, 171, 189 al-Qaradawi, Scheich Yusuf 154 ALBA 19, 22 Albanien 99, 102f., 134–136, 140f., 143, 146 Albright, Joseph 98 Albright, Madeleine 43, 54, 80, 84, 87f., 97f., 100–105, 138, 145, 164, 250, 252, 254, 256, 261 Algerien 172 Amanpour, Christiane 96, 101 Amnesty International 111f., 115f., 120, 155, 256–258 Annan, Kofi 100f. Arabische Liga 160–162, 168 Arafat, Suha 40 Arafat, Jassir 40 274 Asarow, Mykola 199, 204 Ashton, Catherine 155, 209 Assange, Julian 52, 115 Australien 222 Avaaz 116f. Bahrein 163 Ban Ki-moon 155, 206, 220 Bandera, Stepan 207 Bangladesch 15 Bank of America 237 Baratt, Mira 77 Barroso, José Manuel 231 Baruch, Bernard 30 Belgien 49, 222 Bengasi (Libyen) 148, 150, 152–155, 165, 170, 204, 225, 266, 270 Bernstein, Carl 178, 184 Biden, Hunter 228 Biden, Senator Joseph 77, 226, 228, 280 Bildt, Carl 197 Bin Laden, Osama 153, 162, 189, 267 Björk 114 Blair, Diane 178 Blair, Tony 103, 197, 256 Blinken, Anthony 224, 280 Bolivien 17, 23 Bonaparte, Napoleon 119, 187 Bosnien 72, 74, 80–82, 86f., 93, 100, 106–108, 127–130, 132, 135, 252, 257, 260, 263 Bouchuiguir, Dr. Sliman 155, 158f. Boutros-Ghali, Boutros 87–89, 100 Brasilien 18, 23, 220 Brzezińscki, Zbigniew 177, 183, 188f., 199, 216, 272f. Brockmann, Miguel D’Escoto 158 Bulgarien 152, 231 Burundi 87 Bush, George H.W. 126, 176, 221 275 Bush, George W. 34f., 76, 109, 112, 182, 190, 248f. Cameron, David 194, 226 Cargill 228 Carter, Jimmy 177, 189 Casa Alianza 25 Castro, Fidel 18 Castro, Raúl 18f. Chalabi, Ahmed 76f. Chávez, Hugo 18–20, 22, 164 Cheney, Richard (Dick) 162, 205 Chile 18, 23 China 53, 83f., 86, 94, 117, 159f., 162, 172, 191f., 220, 235, 252, 258, 273 Chirac, Jacques 40 Christopher, Warren 97 Chruschtschow, Nikita Sergejewitsch 201, 211 Churchill, Winston 197 CIA 146, 170, 176, 189, 197, 257, 273 Ciappa, Olivier 122 Cleopatra 15 Clinton-Stiftung 237, 281 Clinton, Bill 22, 29, 32, 36, 39, 88, 95, 97f., 102, 126, 129, 132, 146, 176, 178, 191, 197, 248, 261, 265 Clinton, Chelsea 102, 129 Coe, Douglas 70f. Cohen, Stephen 223, 241, 279 Cohen, Williams 84 Connors, Brenda 185 Costa Rica 20–22 Darfur 85 Davis, Lanny 22 Del Ponte, Carla 140 Demokratische Republik Kongo 90f. Deutschland 7, 11, 16, 32, 49, 60, 65, 81, 126–127, 143, 175f., 178, 205f., 208, 214–219, 245f., 259f., 262, 268, 270, 276, 278f., 281 276 Dinkins, David 74 DioGuardi, Joseph (Joe) 77 Doherty, Glen 170f. Dole, Bob 77 Donbass 198, 209, 218, 224f. Donezk 198, 214, 219 Drake, Thomas 52 Dschalil, Mustafa Abd al- 154 Dschibril, Mahmud 154, 159 Dubai 150, 221 Ecuador 17, 23 Eisenhower, Dwight D. 29 Elisabeth I. 16 Europäische Union 45, 49, 140, 152, 215–217 FBI 52, 242, 281 Feltman, Jeffrey 206, 220 Forte, Maximilian 172 Frank, Dana 23–25 Frankreich 9, 49, 60, 63, 121f., 127, 154, 160, 162, 194, 208, 216, 226, 245, 253, 269, 280 Freeman, Chas 241 Freeman, Derek 64, 250 Fuerth, Leon 80 Gaddafi, Muammar 7–9, 144f., 148–170, 172f., 206, 266–270 Gaddafi, Mutassim 169 Gaddafi, Saif al-Arab 167 Gaddafi, Saif al-Islam 151f., 165, 267 Gates, Robert 160, 205, 267, 269, 276 Georgien 110, 186, 229 Gershman, Carl 156, 199, 275 Goldberg, Jeffrey 147, 266 Goldwater, Barry 13 277 Gorbatschow, Michail 31, 125, 233 Gore, Al 80 Greenwood, Phoebe 50, 249 Griechenland 138, 143 Großbritannien 57, 87, 94, 127, 148, 162, 183, 194, 245, 269, 278 Guatemala 19, 23, 265, 267 Habyarimana, Juvénal 87, 253 Haliti, Xhavit 137, 264 Ham, Carter 165 Haradinaj, Ramush 139 Hedges, Chris 137, 257, 265 Hernández, Juan Orlando 24 Hitler, Adolf 11, 46, 60, 119, 127, 132, 144, 212, 214, 245 Hoenlein, Malcolm 41 Holbrooke, Richard 79, 111, 255 Hollande, François 122, 226, 259 Honduras 16–26, 246f. Hoover, J. Edgar 67 Horowitz, Jason 40, 248 Huntington, Samuel 200 Hussein, Saddam 36, 72, 76, 144, 162, 190f. Idris, König von Libyen 148f., 153 Indien 15, 162, 220, 254, 268 Irak 29, 34–36, 38, 43, 74, 76–78, 104, 125, 161f., 166, 187, 190f., 195, 221, 227f., 233, 245, 269, 282 Iran 15, 64, 77f., 96, 150 161, 180, 182, 184, 186, 188f., 221, 248, 266, 272 ISIS 266, 270, 274, 279 Israel 34–37, 39–43, 74f., 78, 91, 111, 154, 156, 171, 188–191, 206, 240, 248f., 272–274, 281 Italien 49, 140, 148, 216, 231, 278 Izetbegović, Alija 80–83, 107, 128, 260 Jackson, Henry 34 Jackson, Jesse 74 278 Jalta 197 Janukowitsch, Viktor 197–199, 202–204, 208 f., 230 Jaresko, Natalja 229, Jarosch, Dmytro 209, 276 Jazenjuk, Arsenij 206, 209, 276 Jelzin, Boris 67, 119, 127, 176 f. Jugoslawien 79–81, 83 f., 92 f., 96, 98 f., 102, 110, 125 f., 129, 131 f., 134–136, 139, 143, 145, 172, 176, 188, 225, 248, 251 f., 259 f., 262, 264, 281 Juschtschenko, Viktor 202 f. Kadeer, Rebiya 94, 252 Kagame, Paul 88–91, 97, 253 Kagan, Robert 37, 43, 205, Kambodscha 93, 107, 141, 246, 254 Kanada 68, 75, 203, 269 Kasachstan 225 Katar 156 f., 161, 168, 237, 273 Katchanovski, Ivan 209 f., 277 Katharina II. 15 Kelley, Craig 21 Kennan, George 13, 246, 271 Kerry, John 194, 213, 274, 278 KGB 176, 182 Khomeini, Ayatollah Ruhollah 162 Kiew 43, 121, 198, 201, 204, 207–212, 214, 218 f., 223–225, 229 f., 265, 274 f., 277 King, Larry 103 King, Martin Luther Jr. 157 Kirkpatrick, Jeane 95, 254 Kirsch, Ina 210, 230, 274, 277 Kissinger, Henry 102, 254, 271 Klitschko, Vitali 205 Korbel, Joseph 98 Kosovo 74, 93, 99–105, 107, 125, 131–147, 176, 213, 233, 249, 252, 255 f., 260–264, 277 Kouchner, Bernard 137, 141, 264 279 Krawtschuk, Leonid 201 Krim 197, 199, 201, 211–214, 218, 257, 270, 278 Kristol, William 43, 248 Kroatien 77, 82, 107, 126–128, 225, 252, 257, 259 f. Kuba 17–19, 21, 23, 78, 246 Kubic, Charles 165 Kutschma, Leonid 201 Kucinich, Dennis 165 f., 232, 241, 281 Kwitaschwili, Alexander 229 Kuwait 237 La Madeleine 121 Lawrow, Sergej 182, 215, 237, 278, 280 Lévy, Bernard-Henri 81, 154, 161, 204, 207, 267 f. Lewinsky, Monica 22, 29, 260 Libyen 147–173, 187, 191, 195, 225, 233, 245, 265–267, 269 Litauen 200, 229 Llorens, Hugo 19 f. Lobo Sosa, Porfirio 23 Luhansk 214 Luxemburg 49 Madonna 114, 258 Malaysia 219, 221–223, 225, 279 f. Mali 172, 195 Mandela, Nelson 149 Manning, Bradley/Chelsea 51, 112, 114, Marokko 132 Martinelli, Giovanni 167 Marty, Dick 141, 264 Mazedonien 102, 136, 143, 260 Mbeki, Thabo 164, 269 McCain, John 74, 181, 204 f., 207, 227, 229, 231 McCarthy, Joseph 67 McCartney, Paul 114, 258 McKinney, Cynthia 91, 242, 270, 281 Mead, Margaret 64, 250 280 Mearsheimer, John 241 Medwedjew, Dmitri 182 f. Merkel, Angela 16, 51, 205, 219, 276, 279 Milosević, Slobodan 249, 256 Mirzakhani, Maryam 15 Mitterrand, François 99 Modi, Narendra 220, 271, 280 Montenegro 99, 143, 261 Monti, Mario 197 Muller, Mike 160 Murdoch, James 237 Mursi, Mohammed 72 Muslimbrüder 76, 154 Nasser, Gamel 148 f. NATO 34, 36, 49 f., 79, 81, 83, 89, 98–100, 102–104, 111, 126, 131 f., 134–138, 140, 146, 150, 159 f., 164–168, 172, 175 f., 178, 180, 186 f., 199, 201, 206 f., 211 f., 214–216, 218, 222, 225, 245, 252, 255 f., 259, 261–264, 266, 269–271, 278 Negroponte, John 21 Niebuhr, Reinhold 70 Netanyahu, Benjamin 42, 249 Neuer, Hillel 156 Nicaragua 17, 19, 23, 158, 205, 265 Niederlande 49, 122, 150, 222 f., 266 Nitze, Paul 217 f., 30 Nossel, Suzanne 109–112, 116, 120, 246, 257 f. Ntaryamira, Cyprien 87 Nuland, Victoria 43, 105, 163, 205–207, 226 f., 280 Nye, Joseph 109, 246 O’Neill, James 223, 279 OAS 17 f. OAU 149 Oberg, Jan 99 Oman 169 OPCW 274 Orescharski, Plamen 231 281 OSZE 99 f., 102 Paet, Urmas 209 Pakistan 15, 72, 82, 162 Palästina 41, 161, 190, 206 Palin, Sarah 130 Pandith, Farah 73, 251 Parubij, Andrij 207, 210, 277, 276 Paul, Ron 232, 241, 280 f. Peres, Schimon 197 Perle, Richard 190, 248, 273 Persischer Golf 143, 150, 156, 161, 163, 221, 248 Petraeus, David 191, 197, 273 Pintschuk, Wiktor 197, 237 PLO 149 Polen 176, 188, 197, 200 f., 208, 216 Polk, William R. 282 Poroschenko, Petro 197, 215, 219, 225, 229, 265 Portugal 231 Powell, Colin 104, 249 f., 256 Power, Samantha 92, 98, 105 f., 108 f., 160, 253–255, 257 Putin, Wladimir 7 f., 53, 65 f., 113–122, 144, 175–185, 187 f., 193, 195 f., 198 f., 201, 203 f., 207, 212–214, 218, 220–222, 224 f., 226–228, 230, 233, 234 f., 239, 258 f., 271 f., 274, 276–280 Pyatt, Geoffrey 205 f. Reagan, Ronald 57, 95, 125, 205, 240 Rice, Susan 105 f., 109, 159 f., 192, 204, 257 Richardson, Bill 198 Ries, Marcie 231 Roberts, Paul Craig 240, 281 Roosevelt, Franklin D. 197, 217 Rose, Charlie 219, 279 Rousseff, Dilma 220 Rowley, Coleen 242, 257, 281 Rozoff, Rick 187 Ruanda 87–92, 94, 252–254 282 Ruandische Patriotische Front 97 Rugova, Ibrahim 101, 137, 145 Rumänien 138 Rumsfeld, Donald 37, 162 Russland 8, 34 f., 37, 53, 60, 65–67, 81, 84, 86, 94, 115–122, 127 f., 130, 143 f., 159 f., 162, 175–178, 180–221, 223–231, 233–235, 250, 258, 270–272, 275, 278 f., 280 f. Saakaschwili, Michail 229 Saban, Haim 39 f., 237 Samuzewitsch, Yekaterina 114 Santorum, Rick 71 Sarajevo 81, 260 Sarkozy, Nicolas 151 f. Sarkozy, Cecilia 152 Saudi-Arabien 64, 66, 72, 75, 82, 163, 189, 237, 250 Schalit, Gilad 169 Scharanski, Anatoly 248 Scheffer, David 80, 251 Scheffer, Jaap De Hoop 180 Schottland 150, 245 Schröder, Gerhard 197 Schweden 99, 186, 197 Schweiz 137, 140, 150, 158, 268 Serbien 34 f., 77, 80 f., 93, 98–100, 103, 105, 107 f., 113, 126 f., 134 f., 138–146, 213 f., 225, 252, 255, 260 f., 263, 265 Sewastopol 199, 211–213 Shakespeare, William 173 Shannon, Tom 21 Sharp, Gene 113, 145 Sheehy, Gail 131, 245, 260 Schewtschenko, Inna 121 f. Sikorski, Radosław 197, 208 Slowakei 138 Slowenien 126, 259 Snowden, Edward 50 f., 249 Soros, George 49, 107, 210, 217 f., 225, 237, 279 283 Sotschi 65–67, 115, 233 Spanien 22 f., 81, 138 Srebrenica 82 f., 93, 108, 263 Sri Lanka 15 Stahl, Lesley 104 Stalin, Josef 30, 116, 119, 197, 275 Stevens, Christopher 170–172, 204, 266, 270 Strauss-Kahn, Dominique, 197 Südafrika 96, 164, 220 Sudan 29, 106, 110, 233, 265 Südossetien 229 Summers, Lawrence 197 Sunden, Jed 122 Swoboda 122, 207–209, 276 Syla, Azem 137 Syrien 7–10, 76, 86, 94, 96, 117 f., 120, 160, 170, 191–197, 206, 227, 251, 266, 269, 273 f. Tarhouni, Ali 159 Taylor, William 224 Teil, Julien 158 Thaçi, Hashim 101 f., 137 f., 145, 256, 264 Thatcher, Margaret 16, 57, 95 Tillich, Paul 70, Tolokonnikowa, Nadeschda 114, 120 Truman, Harry S. 29, 190 Tschechische Republik 172 Tunesien 132, 147, 153 UdSSR (Sowjetunion) 13, 30–32, 37, 66, 81, 95, 122, 125 f., 143, 176 f., 184 f., 189, 200–206, 212, 215–218, 230 f., 235, 271, 275, 278 Uganda 87, 89, 91, 253 Ukraine 14, 43, 49, 65, 78, 86, 96, 110, 116, 120–122, 144, 147, 186, 188, 197–235, 248, 257, 259, 265, 270, 272, 275–277, 279, 280 f. UN (Vereinte Nationen) 24, 36, 65, 74, 80, 87, 89, 95, 98, 100, 104, 117, 134, 137, 145, 148, 159, 164, 206, 213, 227, 242, 249, 256 Ungarn 126, 143, 176 Ustascha 77, 127, 257 284 Vanik, Charles 34 Venezuela 17, 19–21, 23, 164 Vereinigte Arabische Emirate 156, 237 Villepin, Domenique de 234 Walker, William 100, 102, 255 Walt, Stephen 241, 281 Weiner, Anthony 74 f., 251 Williamson, John C. 141 f. Wise, Jeff 225, 280 Wolfowitz, Paul 34, 36, 248, 273 Wolfson, Howard 130 Woods, Tyrone 170 f. Xi Jinping 220 Zelaya, Manuel 16, 18–24, 26 Zguladze, Ekaterina 229 Zoellick, Robert 197 Zuma, Jacob 164, 220 Zypern 138 285 Inhaltsverzeichnis Titel Urheberrecht Inhalt Vorwort zur deutschen Ausgabe Einführung 1 Der Ritt auf dem Tiger: Hillary Clinton und der Militärisch-Industrielle Komplex 2 »Multikulturalismus« ä la Hillary: unsere einzigartigen »Werte« und »Interessen« 3 Die Zähmung durch die Widerspenstigen 4 Der Beginn des clintonschen Kriegszyklus 5 Libyen: Hillarys eigener Krieg 6 Russland verstehen? Nein, danke! 7 Die Kriegspartei Anmerkungen Namens- und Ortsregister 286 3 4 5 7 12 25 41 87 114 135 160 216 223 274