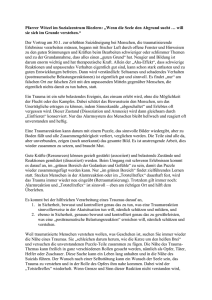36. Reden über Trauma
Werbung

PSYCHO-NEWSLETTER NR. 36 E IN KLEINER L ITERATURRUNDFLUG Im Auftrag der DGPT von Michael B. Buchholz und Karla Hoven-Buchholz email: [email protected] Mitte Oktober 2005 REDEN M ÜBER TRAUMA – LITERATUR anchmal ist es gut, sich noch einmal ältere Artikel zu einem Thema durch zu lesen. Angesichts der weiter anschwellenden Debatte über das Trauma und die Notwendigkeit, dafür unbedingt spezielle Trauma-Therapeuten auszubilden, empfiehlt es sich erst recht. An dieser Forderung, spezialisierte Therapeuten für eine spezialisierte Störung mit spezialisierten Ausbildungsgängen und spezialisierten Kompetenzen an spezialisierten Instituten auszubilden und alle diese Spezialisierungen anzuerkennen, wird unschwer erkennbar, wie sehr sich inhaltliche, praktisch-klinische Perspektiven und Behandlungsstrategien mit außerklinischen Interessen von durchaus handfest ökonomischer Härte unentwirrbar verlöten. Diese Melange von Theorie und Durchsetzungsstrategie am Markt findet man nicht nur in Verbindung mit dem Thema „Trauma“, sondern auch in Verbindung mit der Auseinandersetzung um die Tiefenpsychologie oder früher um Gruppen- oder Familientherapie. Sie durchzieht ja auch die Auseinandersetzungen in der vergleichenden Psychotherapieforschung. Sage mir, in welcher schulischen Richtung Dein Experte ausgebildet ist und ich sage Dir, welche Ergebnisse seine Studie ausweisen wird. Ironischerweise wurde dieses Phänomen selbst wiederum recht gut von renommierten Psychotherapieforschern wie etwa Luborsky empirisch untersucht; in den PNL ist mehrfach davon die Rede gewesen. Ach, wenn man Theorie und Durchsetzungsstrategie nur immer reinlich voneinander scheiden könnte! Wie verhält sich das denn im Fall des Traumas? Entsetzlichkeiten, die Soldaten im Krieg erlebt haben; Vergewaltigungen einer Frau durch entfesselte Soldateska; ein Verkehrsunfall; der Tod eines Kindes; der frühe Verlust eines Elternteils oder beider Eltern – dies alles, so verschieden es auch ist, wird als „Trauma“ verstanden. Hinzu kommen aber noch ganz andere Erfahrungen: In einem der afrikanischen Kriege wird ein 14jähriger Junge zusammen mit seinen Eltern gefangen genommen. Die Soldaten erklären, wenn seine Eltern ihn überreden könnten, sie zu erschießen, dürfe er überleben; wenn nicht, würden alle drei erschossen. Die Eltern überreden ihn, der Junge kommt auf schwierigsten Wegen in einer westlichen Klinik an – worin unterscheidet sich dies Trauma von anderen? In einer Schweizer Fallgeschichte wird beschrieben, daß ein |2 PNL – 36 Mann die Analyse wegen einer traumatischen Erfahrung aufsuche; er hatte jahrelang seine Frau mit zahllosen anderen Frauen betrogen; als sie es ihm gleichtat, habe er, so der Fallbericht, einen traumatischen Zusammenbruch erlitten. Es gibt auch Fallgeschichten, in denen der Tod eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Berentung als Trauma beschrieben wird. Gibt es einen gemeinsamen Nenner solcher Sprachregelungen? Kann es Sinn machen, dies alles als „Trauma“ unter einen einheitlichen Begriff zu fassen? Wir meinen ja und dieser Sinn liegt nicht in der Erfahrung und nicht in der Theorie, sondern in der Strategie – weil so diese Menschen als Traumatisierte einer Behandlung zugeführt, weil so zusätzliche Gelder für deren Behandlung, für die Einrichtung spezialisierter Institutionen, für weitere besonders ausgebildete Mitarbeiter rekrutiert werden können. Trauma – dieser Begriff wirkt wie eine Art sprachlicher Staubsauger (akademischer gesagt: als „semantischer Attraktor“), der alles in sich aufnimmt, um es am anderen Ende der Therapeutik zuweisen zu können. Nichts jedoch ist ohne seinen Preis. Sind solche Institutionen erst einmal etabliert, entwickeln sie eine erhebliche Eigendynamik; sie müssen auch (!) aus Selbsterhaltungsgründen ihr Klientel finden. Mehr und mehr sehen sie sich daher in einem selbst erzeugten Zwang, ihr Klientel als Traumatisierte auszuweisen. Die Anzahl der Traumatisierten wächst so – und das erzeugt unvermeidlich Glaubwürdigkeitsprobleme. Aus dieser Logik heraus entstehen Nachweiszwänge, in die dann neurowissenschaftliche Verfahren eingebunden werden mit der Folge, daß jene Klienten, bei denen keine Trauma-Areale im Gehirn aufleuchten, abgewiesen oder, wenn es um Flüchtlinge geht, ausgewiesen werden. Das bringt nicht geringe Konflikte mit dem therapeutischen Ethos der Fürsorglichkeit mit sich. Innerhalb der therapeutischen Beziehung wird eine Art Unterscheidung zwischen Trauma und Person nahe gelegt. Man behandelt das Trauma; betont wird in zahllosen Publikationen, daß die Person mit Respekt behandelt wird. Das muß nicht, kann aber dazu führen, daß Therapeuten sich einer diffusen moralischen Erpressbarkeit anheim gegeben sehen, die schwer überhaupt nur wahrzunehmen ist. Und eine besonders schwierige Folge dürfte sein, daß wer von „Trauma“ redet, nicht mehr die Entsetzlichkeiten in ihrer szenischen Gewalt darstellen oder sich vergegenwärtigen muß. Man hat ja dann ein Wort dafür. Das Reden vom Trauma könnte so in Gefahr geraten, Teil einer Empathie-Abwehr zu werden – das muß nicht, kann aber so sein. Am sichtbarsten wird dies, wenn die Rede vom Trauma - aus den Chatrooms des Internet oder durch andere Medien - in die Selbstdeutungsmuster von Patienten eingewandert ist; sie bilden dann verengte Opfer-Identitäten mit entsprechend regressiven Ansprüchen. Verloren sind dann manchmal unwiederbringlich andere Entwicklungsmöglichkeiten. Von diesen Ambivalenzen im Reden über Trauma versucht dieser PNL zu reden. EIN BLICK ZURÜCK – DAS TRAUMA IN DER BEHANDLUNG Im inzwischen 5 Jahre alte PsycheSonderheft über Trauma, Gewalt und kollektives Gedächtnis gibt Werner Bohleber einen wohl informierten Überblick über die Entwicklung der Trauma-Theorie in der Psychoanalyse (Psyche 9/10, 2000). Sein überzeugend dargebotener Schluss lautete, die Traumatheorie brauche zu ihrer Beschreibung beide Modelle: das hermeneutisch-objektbeziehungstheoretische, wie es von Freud, Ferenczi, Balint u.a. ebenso vertreten wurde wie auch das psychoökonomische Modell, ebenfalls von Freud, aber dann v.a. von Fenichel vertreten. Bohleber zeigt uns kenntnisreich die Probleme einer Definition des Traumas auf: es ist kein präziser, sondern ein elastischer Begriff, wie bereits in den 80er Jahren Joseph Sandler das Ergebnis einer Projektgruppe am Frankfurter Sigmund-Freud-Institut-SFI formuliert hatte. Dabei waren Psychoanalytiker dazu interviewt worden, wie sie den Begriff benutzten, wie sie mit ihm arbeiteten und mit welchem klinischen Material sie ihn illustrierten. Die Untersuchung ergab, dass die verschiedenen Dimensionen des Trau- |3 PNL – 36 mas und deren Wechselspiel wenig präzise unterschieden wurden. Bohleber zieht eine heute noch hilfreiche Schlussfolgerung: es müsse differenziert werden zwischen dem - Prozess der Traumatisierung, - traumatischen Zustand und - bleibenden pathologischen Veränderungen. Abgesehen von massiven oder Extremtraumatisierungen wirke nicht jede traumatische Situation auf alle Menschen gleichartig. Im August-Heft des Int.J. Psychoanal. (2005) erinnert Carl Nedelmann an den 1985 verstorbenen Hillel Klein. Beide kannten einander gut, eine Beziehung, die von großem Respekt und Freundschaftlichkeit getragen gewesen sein muß, wie man aus Nedelmanns Darstellung persönlicher Begegnungen schließen darf. Hillel Kleins Beitrag bestand darin, daß er Hoffnung als unverzichtbar für die Wiederannäherung an die Geschichte der Vernichtung ansah, um wieder frei werden zu können, einerseits; daß er andererseits nachdrücklich davon abriet, Traumatisierte – auch schon durch diesen Begriff – zu pathologisieren. „The core of Klein’s contribution to research on the Holocaust therefore lies in a change that he brought about in the assessment of the pathology of survivors. He was opposed to the tendency to treat them as pathological.”, schreibt Nedelmann (S. 1135). Und ein dritter Beitrag dürfte gewesen sein, daß Hillel Klein den Antisemitismus beinah „gerochen“ zu haben scheint, wenn man sich so ausdrücken darf. Die Empfindlichkeit dafür kann nicht als „Überempfindlichkeit“ aufgefaßt werden, so will Nedelmann vielleicht sagen, wenn man Hillel Kleins Wendung gegen die Pathologisierung als grundsätzlich richtig anerkennt. Dieselbe Situation – aber höchst verschiedene Effekte? Ein „Situationsansatz“ ist deshalb nur beschränkt hilfreich. Es kann nicht genügen, von einer bestimmten Situation zu sagen, sie sei „traumatisch“. Das gilt sogar, so wollen wir hier gleich vorweg einfügen, für jene Erfahrung von Überlebenden der KZs. Hillel Klein und Henry Krystal und ebenso Anna Ornstein beharren darauf, dass es gewaltige Unterschiede in der Verarbeitung der „gleichen Situation“ – etwa der Erfahrung des KZ - gebe und mehr noch, dass es eine Entwürdigung der Opfer bedeuten kann, diese Unterschiede, in der sich ihre individuelle Subjektivität äußert, über einen Kamm zu scheren. Hier müssen also situati- ve, ethische und theoretische Aspekte subtil auseinander gehalten werden. Denn die Annahme von der Gleichheit der Situationen kann von Menschen auch als entwürdigend empfunden werden. Bohleber folgert: „Das bedeutet, dass ein Trauma, was seine Wirkung betrifft, in der Regel nur retrospektiv von seinen seelischen Folgen her definiert werden kann. Dabei sind auch prädisponierende Faktoren mit zu berücksichtigen. Das Trauma ist ein Konzept, das ein äußeres Ereignis mit dessen spezifischen Folgen für die innere Realität verknüpft, es ist insofern ein relationaler Begriff (Fischer und Riedesser 1998). Diese doppelte Bezogenheit macht auch die Unschärfe des Begriffs aus.“ (Bohleber S. 829) Bohleber plädiert für eine enge Definition des Traumabegriffes, doch finden sich Autoren, die das eine oder andere Glied der Kette besonders akzentuieren. Cooper betont das Ereignis, „das die Fähigkeit des Ichs, für ein minimales Gefühl der Sicherheit und integrativen Vollständigkeit zu sorgen, abrupt überwältigt und zu einer überwältigenden Angst oder Hilflosigkeit oder dazu führt, dass diese droht, und es bewirkt eine dauerhafte Veränderung der psychischen Organisation.“ (1986, S. 44, z. n. Bohleber S. 830) Krystal betont das Erlebnis: Die „Überwältigung der Abwehrfunktion und der Ausdrucksfunktion der Angst sowie deren Hemmung [ist] das eigentlich traumatische Ereignis.“ (S. 830) Fischer und Riedesser sehen im Trauma das Urvertrauen zerstört, es bewirke eine „dauerhafte Erschütterung des Selbst- und Weltverhältnisses“. (1998, S. 79) Eine „haltende grundlegende Objektbeziehung“ (Bohleber S. 830) breche zusammen. Man sieht schnell, daß die verschiedenen Akzentsetzungen durchaus ihre Schwächen haben. Dass ein Ich hilflos reagiert, kann auch konfliktbedingt sein; daß die Abwehrfunktion überwältigt wird, kann auch, etwa im Fall narzisstischer Größenphantasien, Beginn heilsamer Selbstkonfrontation sein. Die Beschreibungen treffen das mit Trauma Gemeinte nicht genau genug, sie treffen dafür zu viel. Bohleber hält es deshalb für unabdingbar, die individuelle Erfahrung und ihre Erinnerung, ihre subjektive Verarbei- PNL – 36 tung sowie die historische Realität gleichermaßen in ein integrales Traumakonzept einzuarbeiten. Gerade in der Frage jedoch, ob die gestochen scharfen, emotionslosen Erinnerungen an traumatische Situationen genaue Abbilder der Ereignisse oder deren subjektive Verarbeitung seien, gibt es unterschiedliche Auffassungen. „Vor allem in der PTSD-Forschung wird betont, dass die primären Symptome weder symbolisch noch das Produkt einer Abwehr sind, sondern ihr realistischer Charakter ein Zeichen für die Unmöglichkeit ist, diese Erfahrung zu integrieren.“ (S. 831) Marion Michel Oliner hatte in ihrem Beitrag im November-Heft der „Psyche“ von 1999 dazu die genau gegensätzliche Position vertreten: Die nackte Realität dieser Erinnerungen werde für Abwehrzwecke benutzt, vor allem als Abwehr gegen Schuldgefühle. Oliner bestreitet nicht, dass schwere Traumatisierungen abgespalten von normalen Erinnerungen registriert werden. Weil solche Erinnerungen nicht dem normalen Prozess des Verblassens erlägen, erkenne man nur schwer, dass auch sie im Dienst der verzerrten, durch das infantile Drama gefärbten Bedeutung genutzt würden. Die Abspaltung bedeute auch die Abschottung von Realitätskontrolle, und so finde eine Regression zur infantilen Omnipotenz und einem archaischen Über-Ich statt. Infantile Wut aus der traumatischen Situation werde gegen sich selbst gewandt – eine Phantasie der eigenen Schuld verschaffe ein übermächtiges Schuldgefühl, aber gebe der sinnlosen Situation auch Sinn. Klärungen dieser Gegensätzlichkeiten ergeben sich aus zwei weiteren Beiträgen durch Franziska Henningsen über „Destruktion und Schuld. Spaltungs- und Reintegrationsprozesse in der Analyse eines traumatisierten Patienten“ (Psyche 9/10, 2000 ) und „Traumatisierte Flüchtlinge und der Prozess der Begutachtung“ (Psyche 2/2003). Ein ausführliches Fallbeispiel zusammen mit der Behandlungstechnik ist ebenso selten wie daß sich Psychoanalytiker mit Fragen der Begutachtung auseinandersetzen. Beide Artikel zeigen auf unterschiedliche Weise, dass |4 das traumatische Element in der Geschichte der behandelten Patienten nicht das äußere Ereignis, sondern die individuelle Verarbeitung auf dem Hintergrund der lebensgeschichtlichen Entwicklung der Patienten war. Um dem Eindruck zu begegnen, hier würde dann doch wieder alles den Betreffenden selbst aufgebürdet, soll der Fall hier dargestellt werden: Der erste Aufsatz behandelt eindrücklich und ausführlich die Analyse eines Mannes, dessen Mutter sich erhängte, als er 8 Jahre alt war. Der Bericht lässt dabei nachvollziehen, welche verschiedenen Gefühle, Konflikte und Verarbeitungsmöglichkeiten dieses Ereignisses eine Rolle spielten: der tödliche Schrecken beim Entdecken der erhängten Mutter im Keller; der Objektverlust; das familiäre Ungleichgewicht und die Schuld: denn der Junge hatte vom Vater die Aufgabe zugewiesen bekommen, auf seine depressive Mutter aufzupassen, während dieser selbst sich in seine Arbeit stürzte; die intergenerationelle Verwicklung mit dem Täter- und Opfer-Thema aus den Großeltern-Familien; das Schuldgefühl, weil er den Tod der Mutter nicht verhindert hatte; die Aggression gegen sie, die ihn nicht eingreifen ließ, als er ihre Schritte auf der Kellertreppe hörte, die perverse Verarbeitung von Schuld, Destruktion und Allmacht in einem „montierten Objekt“... all das kommt in der Analyse ans Licht und in die Übertragung, wo das ineinander Verwobene durchgearbeitet werden kann. Der zweite Aufsatz gibt aus der reichen Erfahrung der Autorin als Gutachterin traumatisierter Flüchtlinge praktische Anleitungen und Hilfen für solche Gutachterverfahren, die in der Regel 5–6 Sitzungen beanspruchten und oft mit Hilfe eines Dolmetschers durchgeführt werden müssen. Interessanterweise sieht Henningsen in dieser Situation, die oft als größtes Hindernis einer psychotherapeutischen Behandlung gilt, auch ein positives Moment. Die Vermittlerrolle des Dolmetschers führe in der Darstellung des Traumas zu einer verzögernden Aufteilung von Mimik, Affekt und Verständigung über die Inhalte des erzählten Traumas. Diese Verzögerung mildere die Wucht PNL – 36 des Traumas, schütze alle Beteiligten vor Reizüberflutung und erneuter Traumatisierung: „Die Gefühle der Erschütterung und oder die Ausdrucksstarre werden direkt vermittelt, den erschreckenden Inhalt erfährt der Analytiker jedoch etwas später. Er nimmt also das traumatische Ereignis in Etappen wahr, kann sich vorbereiten, sich selbst auch vor dem Erschrecken und einer möglichen inneren Einfühlungshemmung schützen. Umgekehrt kann auch der Patient die zweiphasige Wahrnehmung des Analytikers beobachten: Während er spricht, sieht er, wie sich der Analytiker einfühlt, später, wenn der Übersetzer spricht, kann der Patient erkennen, ob der Analytiker in seiner Vorahnung dessen, was erzählt wurde, schon das wesentliche Gefühl erfasst hat, wie viel Neues, vielleicht auch Entsetzliches hinzukommt. Es entsteht in dieser Latenzzeit eine besondere Atmosphäre des Verarbeitens auf präverbaler Ebene. Analytiker und Patient sind in gleicher Weise, nur in umgekehrter Wahrnehmungsrichtung, damit befasst, Emotionen und Inhalt zusammenzusetzen, auf diese Weise können Mentalisierungsprozesse (Varvin 2000) initiiert werden.“ (S.108) Am Anfang der Beziehung erlebe der Patient nicht die konstruktive Möglichkeit, die in der sukzessiven Wahrnehmung liege, sondern eher den Kontaktabbruch, worauf er mit Rückzug und Starre reagiere. Das ändere sich aber, wenn seine Hoffnung auf Verstandenwerden gewachsen sei. Dann nutze er den entstehenden Raum stückweise, was integrative Prozesse fördere. Hennigsen bezieht sich hier auf den sehr lesenswerten Artikel des norwegischen Psychoanalytikers Sverre Varvin (Psyche 9/10, 2000) über die Psychotherapie von Folteropfern im Exil. Traumatisierte Flüchtlinge stünden vor einer doppelten Anpassungsaufgabe: „an eine äußere Realität [...], die fremd und oft verwirrend ist, und an eine innere Realität, deren quälende Erinnerungen und überwältigende Affekte Angst machen.“ (S. 895) Varvin erachtet in der Behandlung „weniger die Konzentration auf die Traumageschichte an sich als heilsam [...] als vielmehr die Aufmerksamkeit auf die Verschiebungen in den mentalen Zuständen und deren Interpretation“ (S. 916f), was er mit Ausschnitten aus Therapie-Transkripten nachvollziehbar illustriert. |5 Zurück zu Henningsen, die auch für die Begutachtung zwei Fallbeispiele anführt: Im ersten Beispiel geht es um eine Frau, die bei einer Massenvergewaltigung in einem Keller als einzige verschont wurde, weil der Anführer der Täter ihr früherer Klassenkamerad gewesen war: das schuf ein geheimes Band gemeinsamer Schuld zwischen ihr und den Tätern. Das zweite Beispiel handelt von einem jungen Mann, durch dessen politische Betätigung sein Vater zu Tode kam. Ist es also Zufall, dass in beiden Beispielen die Frage der Schuld für den traumatischen Zusammenbruch und ständig weiter wirkenden verstörenden Schmerz der begutachteten Flüchtlinge eine so große Rolle spielte? Bemerkenswerterweise stellten sich Schuld und Schmerz s z e n i s c h in der Begutachtungssituation dar: Im ersten Fall durch die von Seiten der Behörden gefallene Bemerkung, dass die Frau „nicht vergewaltigt“ worden – also ihre Traumatisierung zweifelhaft - sei. Im zweiten Fall durch das pubertär-provokatente Auftreten des Flüchtlings der Gutachterin gegenüber. Hätte sie in beiden Fällen kein analytisches Gespür für die unbewusste Bedeutung dieses szenischen Angebots gehabt, wären diese Flüchtlinge als „nicht traumatisiert“ abgeschoben worden. Sinnvoll erscheint somit, die Frage der Schuld im Zusammenhang mit dem Reden über Trauma in jedem einzeln Fall genau zu analysieren. Obwohl im gesellschaftlichen Trauma-Diskurs die Schuldfrage eine kaum zu überschätzende Rolle spielt, wird sie dort weniger thematisiert als inszeniert. Im öffentlichen Reden über Trauma ist sofort eine Täter-Opfer-Konstellation imaginiert: Ein Schaden ist eingetreten, eine Wiedergutmachung auf politischer, moralischer, emotionaler oder medizinischer Ebene soll erfolgen. Die Differenz in der Behandlung der Schuldfrage zwischen individuellem und öffentlichem Reden über Trauma könnte selbst nachdenklich machen. Gertrud Reerink hat aus der KatamneseStudie der DPV (Psyche 2, 2003) trotz der Verschiedenheit der von Patienten und Analytikern unabhängig in Interviews berichte- PNL – 36 ten Behandlungen traumatisierter Patienten gemeinsame Elemente herausgefiltert, die für eine Traumabehandlung unerlässlich scheinen; sie aber scheinen tendenziell für alle Behandlungen zu gelten: - „Analytiker bemerken Zeichen und Handlungen, durch die Patienten ihren traumatisierten Zustand darstellen - und sprechen mit ihnen darüber.“ (S.135) Patienten entwickeln so allmählich wieder ein restituiertes Selbst-Gefühl. - Analytiker lassen Handlungen derer, von denen Patienten traumatisiert wurden, als ungerecht, fragwürdig oder unberechtigt erscheinen und machen so die Identifikation mit dem Aggressor rückgängig. Analytiker werden auf diese Weise manchmal nachträgliche Zeugen der Traumatisierung, indem sie anerkannt wird. - Sie „berücksichtigen das Ausmaß der Abwendung der Patienten von anderen Menschen und können ihrerseits als menschlich wahrgenommen werden; Kriterien sind nicht Milde und ‚Zimperlichkeit’, sondern Aufrichtigkeit, Einfühlung und die Bereitschaft, die Gefühle der Patienten ohne Korrektur oder gar Gegenaggression zu ertragen.“ (S. 135) - Sie halten sich bereit, den Hass der Patienten auf ihre Traumatisierer oder die, die ihre Traumatisierung zugelassen haben, auf sich zu nehmen. - Sie „verstehen aber auch, wie unverzichtbar es für einige Patienten ist, sie als ‚gutes Objekt’ sehen und erhalten zu können.“ (S. 135) In den untersuchten Rückblicken auf Behandlungen wurde auch deutlich, dass Analytiker oft weit mehr von der negativen Übertragung wahrnahmen, als Patienten selbst schilderten. Manchmal, wenn eine Behandlung im Nachhinein unvollständig erschien, war es weniger der Analytiker, der die aggressive Auseinandersetzung gescheut hatte, als der Patient, der eine solche tiefere Auseinandersetzung vermieden hatte, um sich den Analytiker als gutes Objekt zu erhalten. Dori Laub sieht die komplizierten Verhältnisse wieder andersherum, er hat ein anderes Bild für das Trauma. Sein Thema ist „Eros |6 oder Thanatos? Der Kampf um die Erzählbarkeit des Traumas“. (Psyche 9/10, 2000) Er sieht im Trauma die Abkömmlinge des Todestriebes in reiner Form reaktiviert, die durch die Triebentmischung frei geworden sind. Die vernichtende Erfahrung des Holocaust, in dem keine Liebe mehr erkennbar ist, sondern nur Negierung der Opfer, führe bei ihnen zu einem Streben nach Erreichen eines leblosen Zustand. Das entspricht Freuds Definition des Todestriebes „Das Ziel alles Lebens ist der Tod“ (1920 g, S. 40, z. n. Laub S. 861), aber, so möchte man hinzu fügen, dieser Todestrieb wird durch äußere Einwirkungen geschaffen: er erwächst also einer Beziehung, wenn auch einer komplett negierenden und nähert sich so eher Ferenczis Todestrieb-Konzept (s. weiter unten in diesem PNL) . Das Trauma führe zu einem „leeren Kreis“ – (andere haben es „schwarzes Loch“ im Sinnzusammenhang genannt), es handele sich um Objekte, die nicht verdrängt, sondern verworfen wurden. Laub führt hierzu ein Beispiel von Kinston und Cohen (1986, S. 186f, z. n. Laub, S. 864) an von einer Mutter, deren Baby ihr bei einer KZ-Rampen-Selektion weggenommen wurde – und die sich kurze Zeit später nicht mehr an ihr Kind erinnern konnte - es blieb nur Leere. Laub meint, Erinnerungen und Phantasien Überlebender und ihrer Kinder seien oft durchmischt mit schrecklichen Urszenen-Phantasien – aber all das werde benutzt, um den „Rand des leeren Kreises“ zu bevölkern, damit man nicht davon aufgesogen werde. Das darf man sich wohl wie eine manische sexualisierte Depressionsabwehr vorstellen. Laub spricht auch von der Unmöglichkeit, das Trauma zu historisieren, d.h. es in einen geschichtlichen Zusammenhang zu integrieren, damit es seine zeitlose Wirkung verliere. Er sieht eine Übertragung des „leeren Kreises“, d.h. des schrecklichen, unbegreiflichen, sinnlosen Verlustes in die Nachfolge-Generation, auch dort breite er sich aus. Das erinnert an Greens Konzept der „toten Mutter“. Doch wird damit auch die Frage aufgeworfen, wie sich eine solche Übertragung von dem a l l g e m e i n e r e n , e h e r sozialpsychologischen Phänomen unterscheidet, dass sich die Span- PNL – 36 nung einer offenen Frage in einer Gruppe fortsetzt? In der Intensität? Gibt es also einen qualitativen Unterschied? Laubs Beitrag erinnert an frühere Diskussionen in der politischen Öffentlichkeit über die Darstellung der Holocaust-Gedenkstätten. Hier war eine der Fragen, ob sie vor allem den Schrecken, den Verlust der Sicherheit, den Abgrund vermitteln solle, etwa durch die unebenen Wege im Berliner jüdischen Museum oder indem wie im Walter-Benjamin-Memorial von Dani Caravan in Port Bou an der französisch-spanischen Mittelmeerküste ein Weg treppabwärts abrupt über dem Meer endet und der Besucher nur durch eine Glasscheibe geschützt wird, hinunter zu stürzen. Oder sollen in den Gedenkstätten die verlorenen und getöteten Personen erinnert und dokumentiert werden? Der Streit um diese Alternativen hat selbst wiederum etwas Bestürzendes an sich, denn beides wäre doch wichtig. Schrecken allein vermittelt auch jeder Horror-Film, Personen erinnert jeder Friedhof. In den Fallbeispielen seines Beitrags macht Laub auf einen wichtigen Unterschied bei der Weitergabe von unbegreiflichem NichtWissen aufmerksam: Auch die Kinder von Nazi-Tätern leben mit einem Nicht-Wissen, aber nicht, weil ihre Eltern sie vor der Konfrontation mit der Grausamkeit schützen wollen, der sie selbst ausgesetzt waren. Die Täter schweigen vielmehr vor ihren Kindern, um eigene Schuld zu verbergen. Die Kinder der Täter übernehmen nach Laub das Nicht-Wissen, weil sie befürchten, „durch weiteres Nachfragen den mörderischen Zorn ihrer Eltern zu erregen und wegen des Verrats an den Eltern, wegen ihrer Schwäche und ihrer Verletzlichkeit getötet zu werden. Man könnte sie als lebensuntauglich verurteilen und damit als Menschenopfer der grausamen Ideologie ihrer Eltern darbringen.“ (S.890) Angesichts dieser so wichtigen Unterscheidung zwischen dem Schweigen der Überlebenden und dem der Täter fragt man sich aber, ob es nicht gerade hilfreich wäre, sich hier klar zu machen, wer wen in den Tod getrieben hat, statt auf das Konstrukt des Todestriebes zu rekurrieren, das in gewisser Weise diese Unterschiede verwischt und die |7 Verantwortlichkeit für grausames Tun eher unscharf verblassen läßt? Henry Krystal befasst sich mit der psychischen Widerständigkeit, mit Anpassung und Restitution bei Holocaust-Überlebenden. (Psyche 9/10 , 2000). Er plädiert gegen die „Ereignis-Betonung“ und für individuelle Unterschiede in der Verarbeitung. Die Reizschranke, die im Trauma überflutet wird (in einer Metaphorik der Überschwemmungskatastropen) ist für ihn weder passiv noch konstant, sondern variabel angelegt als „Gesamtheit aller potentiell mobilisierbaren Abwehrmechanismen“. (S. 846) Auch Krystal äußert sich über die Funktion traumatischer Deckerinnerungen: sie seien „eine wichtige lebenserhaltende Operation zum Schutz vor dem Undenkbaren. (...) Informationen, die mit dem Überleben des Ich unvereinbar sind, werden gar nicht erst aufgezeichnet und führen so zu einem ‚schwarzen Loch’ im Informationsverarbeitungssystem.“ (S. 850) Wir sehen also, wie unterschiedlich das „schwarze Loch“ verstanden werden kann. Nach Krystals Erfahrung halfen den Holocaust-Überlebenden die Stabilität innerer wie äußerer Objektbeziehungen, das Gefühl der Menschlichkeit aufrecht zu erhalten. Die Fähigkeit, kurzfristige Überlebensbündnisse einzugehen, half zu dem Gefühl, „ein guter Mensch zu sein“. Der Glaube an ein transzendentes Wesen half. Nach der Shoa führte der Verlust des Vertrauens in einen helfenden Gott manchmal zu der Lösung, die Schuld für das Erfahrene bei sich selbst zu suchen. Hier gibt es eine Gemeinsamkeit mit der Auffassung von Oliner. Krystal schließt seinen Artikel mit den Worten: „Vor allem aber gibt es klare Anzeichen, dass die psychische Widerständigkeit des einzelnen und die Fähigkeit, die Macht der Liebe zu mobilisieren, im gleichen Verhältnis zu einander stehen und einander bedingen. Verletzte Liebe wird als Wut oder Hass erlebt, hilflose Liebe manifestiert sich als Scham usw. Doch immer repräsentiert die Liebe die Kraft des Überlebenden zur ReIntegration und Heilung des Selbst.“ (S. 856f) Damit wird eine Selbstverantwortlichkeit auf Seiten der Opfer angesprochen, die schnell wieder so verstanden werden könnte, als würden ihnen damit die Schuld aufgebürdet; |8 PNL – 36 aber was Krystal wohl meint, findet sich auch bei Tzvetan Todorov in seiner Studie „Angesichts des Äußersten“ (1993). Dieser nicht-psychoanalytische Autor findet Formulierungen, die man fast als methodische Hinweise für das schwierige Thema lesen kann. Die Opfer waren weder „Helden noch Heilige“, die Täter weder „Monster noch Bestien“ (so seine Kapitelführungen). Täter waren nicht einfach Getriebene, von Kräften des Bösen oder des Staates. Hier schreibt Todorov einprägsam: “Aber der Staat existiert nicht außerhalb der Individuen, die ihn verkörpern. Die dunklen Kräfte brauchten Menschenhände, um ihren Willen durchsetzen zu können. Sie für so sehr unterworfen zu halten, heißt, eine armselige Meinung von ihnen zu haben. [...] Nein, die Menschen waren nie vollständig der Möglichkeit beraubt, zu wählen. Die Person war für ihre eigenen Handlungen verantwortlich, welchem Druck auch sie immer ausgesetzt war, sonst verzichtete sie auf ihre Zugehörigkeit zu den Menschen. Wenn aber der Druck wirklich groß war, dann muß ihn das Urteil berücksichtigen. In dem Maße, wie es keinen inneren Menschen unabhängig von seinen äußeren Ausdrucksformen gibt, sondern der Mensch selber aus der Gesamtheit seiner Handlungen besteht, ist es dieser Mensch selber, den man als vom Bösen befallen einschätzen muß, und nicht bloß seine Handlungen“ (S. 148) Die methodische Warnung heißt hier, daß wer die Opfer nur hinsichtlich ihres passiven Erleidens thematisieren kann, ihnen dadurch Würde nimmt, die, gewählt haben zu können – natürlich nicht, ob sie sich im KZ aufhalten oder nicht. Aber ob sie so oder so verarbeiten. Eben diese Reduktion auf den Nur-Opfer-Status hatte auch schon Primo Levi zur Verzweiflung gebracht. Er wußte aus direkter Anschauung, wer selbst unter den Bedingungen des Lagers die kleinen Kultivierungen aufrechterhielt, etwa sich morgens wusch (wie dürftig das auch immer sein mochte), wer nachts nicht einfach einnässte, sondern aufstand, wer Verse erinnerte, sprach, wer sich nicht aufgab – der überlebte eher als jene, die sich dem „Schicksal“ ergaben. Und Levi verzweifelte, weil er bei seinen Besuchen in Deutschland, v.a. in München merkte, daß man ihm gerne als passives Opfer begegnete (dann konnte man „helfen“, bedauern und sich selbst dabei edel fühlen), nicht aber als aktives Subjekt, das seine Geschichte verarbeitete und das Gespräch auch mit dem Volk der Täter suchte. NEUERE ÜBERLEGUNGEN Mathias Hirsch wendet sich in seinem Buch „Psychoanalytische Traumatologie – das Trauma in der Familie“ (2004) anderen Aspekten zu. Als Antwort auf die vielfältigen und unberechtigten Angriffe moderner Traumatherapeuten, Psychoanalyse sei für Traumabehandlungen ungeeignet, weist er auf die lange Erfahrung der Psychoanalyse mit traumatisierten Patienten hin. Die neuen Methoden, so seine Auffassung, hätten bei Akut-Traumatisierten durchaus ihr Gutes, könnten aber psychoanalytische Langzeitbehandlungen nicht ersetzen. Er konzentriert sich vor allem auf Traumatisierungen in der Familie durch Vernachlässigung, Gewalt, sexuellen, emotionalen und narzisstischen Missbrauch, deren Folgen aus seiner Sicht zu dem führen, was man Persönlichkeitsstörungen nennt. Hirsch hält es aus einer wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive für bemerkenswert, dass solche Störungen u.a. von Kernberg (1975) als Krankheit der übermäßigen Aggressivität verstanden wurden, „lange Zeit aber deren Ursache in einer besonders triebhaften Konstitution gesehen und erst spät [...] das regelmäßige Vorkommen traumatisierender Einflüsse anerkannt“ habe (S.4). PNL – 36 Und man sieht so: Schon die in den 70erund 80er Jahren geführte Kontroverse zwischen Kohut und Kernberg drehte sich um die alte Frage: angeborene Destruktivität versus Beziehungserfahrung? Sie war ursprünglich von Ferenczi in der Form aufgeworfen worden, ob der Todestrieb eines Kindes nicht davon abhängig ist, ob es willkommen ist oder nicht? Hirsch macht deutlich, wie lange Ferenczis klinische Erfahrungen in der Behandlung familiär Traumatisierter schlicht übergangen worden sind. Vieles aber, was uns heute als „neu“ erscheine, könne man schon bei ihm, der immer eine Beziehungstheorie vertreten habe, nachlesen. Hirsch zitiert Ferenczis Arbeit von 1929 über „Das unwillkommene Kind und seinen Todestrieb“, darüber, dass ein Kind nur leben wolle und könne „unter den ganz besonders günstigen Bedingungen des Keimund Kinderschutzes“ – das, so möchte man ergänzen, hat Winnicott später die „fördernde Umwelt“ genannt. Deren Fehlen resultiert in Vernachlässigung, die Schäden der familiären Umwelt „spiegeln“ sich in der späteren Störung. Das von Ferenczi kreierte Bild des „gelehrten Säuglings“ sieht Hirsch als forcierte Progression, in die Kinder durch ihre Familien getrieben werden, ein Vorgang, der von Familientherapeuten als „Parentifizierung“ genau beschrieben worden ist. In vielen Fallbeispielen aus Einzel- und Gruppenbehandlungen zeigt Hirsch, wie Patienten ihre familiäre Erfahrung im weiteren Leben und der Behandlung selbst reinszenieren – mal identifiziert mit dem Aggressor, mal geduckt unter der Wucht des introjizierten elterlichen Schuldgefühls. Beide Arten der Identifikation hatte Ferenczi schon Anfang der 1930er Jahre herausgestellt, als Reaktion auf zu strenge Erziehung und die „Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind“. Es ist erfrischend und ermutigend, in Hirschs Fallgeschichten zu lesen, wie lange und intensiv sich der Therapeut dabei zum Beispiel mit der „Außenwelt“ des Patienten beschäftigt, sich auch nicht scheut, eine Zeitlang in der Rolle des Supervisors oder Coach für dessen beruflichen Konflikte zu schlüp- |9 In einem Beitrag des „Int.J. Psychoanal.“ vom August 2005 versucht sich Shmuel Gerzi erneut an einer Aufklärung zweier „heillos verhedderter Konzepte“, wie es in der deutschen Zusammenfassung schön heißt, nämlich von Trauma und Narzißmus. Während der Narzißmus eine triebtheoretische Formulierung einer bestimmten Interaktion (die das Selbstgefühl reguliert) mit dem Objekt ist und dabei einen „Schutzschild“ aufrecht erhalte, sieht der Autor im Trauma einen Angriff auf eben diesen Schutz, der ein „Loch“ enthalte. Das Loch wirke wie ein Attraktor, sauge den Patienten gleichsam in sich hinein in die Leere von Nicht-Erinnerbarkeiten und emotionaler Leere, während ein anderer Attraktor, die „narzisstische Hülle“ verletzt sei. Das Loch schaffe auch beim Analytiker in der Gegenübertragung einen „empty space“ (S. 1040). Der Beitrag basiert auf den klinischen Erfahrungen des Autors mit HolocaustÜberlebenden und ist zugleich, das darf man doch sagen, ein Beispiel für die immense Verwirrung, die jeder Versuch hinterlässt, hier theoretische Klarheit zu erreichen. Das Fallbeispiel (S. 1046) etwa will zeigen, wie elementar die Anerkennung des Traumas durch den Therapeuten ist und wie der Therapeut den Patienten verfehlt, indem er eine platte Parallele zwischen einem Vorkommnis im Behandlungszimmer und dem Trauma zur Grundlage seiner Deutung nimmt. Aber solche Empathiestörungen sind eben nicht nur durch Traumata induziert; sie kommen vermutlich so häufig vor, daß man diese Annahme fallen lassen muß. Die Verwirrung bleibt deshalb sowohl theoretisch als auch klinisch unaufgelöst – was nicht dem Autor, sondern dem Thema zugeschrieben werden muß. fen, um sich dann der subjektiven Verarbeitung im introjektiven (masochistischen) Modus (S.134) nach dem Motto „ich bin eben unfähig, also selbst Schuld an meinem Außenseiterdasein“ zurück zu kehren. Die Realität des Traumas wird, entgegen mancher Legendenbildungen, von psychoanalytischen Therapeuten durchaus anerkannt. Hirsch setzt sich darüber hinaus mit manchen Auffassungen der spezialisierten Traumatherapeuten auseinander, von denen einige behaupten, Psychoanalyse schade bei der Behandlung dieser Störungen, und weist umgekehrt darauf hin, daß bestimmte traumatherapeutische Techniken ihrerseits schaden können, wenn sie einem Patienten angeboten werden, der dafür nicht „bereit“ sei oder der an einem anderen Thema „dran“ ist. Kurz, auch „Technik“ braucht Einbettung in Beziehung und Kontext. Und man kann anfügen, eine alleinige Schwerpunktsetzung auf „richtige“ Technik wäre, wie immer auch | 10 PNL – 36 hier, von Übel, nämlich dann, wenn über der Behandlung des Traumas andere Dimensionen ignoriert werden; junge Mädchen, die missbraucht wurden, müssen nicht nur ein Trauma aufarbeiten, sondern brauchen oft Unterstützung in ganz anderen Bereichen, etwa beim Aufholen von Schulabschlüssen, ÖFFENTLICHES REDEN THERAPEUTISCHE Hans Keilson schuf 1979 mit der Veröffentlichung seiner großangelegten Langzeitstudie über jüdische Kriegswaisen in den Niederlanden den Begriff der „sequenziellen Traumatisierung“. Er gliederte die langandauernde extreme Belastungssituation der Kinder in unterschiedliche Phasen auf: - die feindliche Besetzung und der beginnende Terror durch die Nazis - die einsetzende Verfolgung, Trennung von den Eltern, Aufenthalt in Verstecken oder KZ - die Nachkriegsperiode. Bei seinen Untersuchungen über die Auswirkungen dieser verschiedenen Perioden auf die spätere Entwicklung der Kinder 25 Jahre danach kam er zu dem interessanten Ergebnis, dass die Nachkriegsperiode, die Zeit also, als das Schlimmste vorbei war und die Kinder bei Pflegeeltern lebten, ungleich größere Auswirkungen auf die spätere Entwicklung der Kinder hatte als angenommen: Die mangelhafte Fähigkeit von Pflegeeltern, die Bedeutung des Traumas für das Kind zu verstehen und damit umzugehen, erwies sich als traumatogener Faktor von großer Bedeutung! Keilson bestätigt hier die Macht der Nachträglichkeit – der sekundären Bedeutungen, die einer Erfahrung gegeben werden. Diese Erkenntnis darf vielleicht verallgemeinert werden; auch für die seelische Bewältigung sexueller Gewalterfahrung etwa ist die Reaktion von Polizei, Gericht und anderen Zeugen von immenser Bedeutung, nicht nur die Tat selbst. Auch wenn Mütter schwer beschädigte Kinder auf die Welt bringen, ist die Reaktion der Ärzte und der Gebärhelfer von entscheidender Bedeutung dafür, wie diese Erfahrung verkraftet werden kann. Nicht nur das Trauma selbst, sondern seine Berufsplanung, Definition neuer Rollen in der Familie und Stützung eigener Identität außerhalb der Familie – kurz, in all dem, was auch sonst in Therapien Thema ist. Das zeigt, manche Diskussionen setzen selbst einseitige Akzente. ÜBER TRAUMA UND RESONANZEN Deutung und Verarbeitung durch andere wirkt. Dieses Wissen wurde erhärtet und ausgeweitet in der Behandlungen von Folteropfern: Mangelnde Anerkennung angetanen Unrechts ist eine Fortführung der Traumatisierung - das schließt auch die politische und gesellschaftliche Anerkennung mit ein. Das frühere Trauma färbt nicht nur die aktuelle Wahrnehmung ein, es wird auch von ihr eingefärbt, bearbeitet. Kaum jedoch gibt es hier konvergente Erkenntnisse, zeigt sich die Zwiespältigkeit an anderer Stelle. Seit der Einführung der PTSD in die diagnostischen Register ist „Trauma“ gesellschaftsfähig geworden. Das hat mächtige Konsequenzen. Der sekundäre Krankheitsgewinn durch die Anerkennung als TraumaOpfer ist ausbeutbar geworden und das hat durchaus die Öffentlichkeit erreicht. Erinnert sei an Binjamin Wilkomirski, der sich eine falsche Identität als KZ-Opfer schuf, darüber ein mit Preisen bedachtes Buch schrieb und erst „aufflog“, als andere darin haarsträubende Detailfehler entdeckten, die deutlich machten, daß er nie in einem KZ und nie Nazi-Verfolgter gewesen war. Andere, Psychotherapeuten und Literaturwissenschaftler machten sich nun daran, diese Täuschung selbst als Folge einer anderen Traumatisierung darzustellen – mit unterschiedlich eingeschätztem Erfolg. Wilkomirski bildet eine Parallele zu gefälschten Identitäten der Täterseite; prominent war Ende der 1980er Jahre Hans Schwerte alias Schneider. Ein ehemaliger SS-Mann hatte sich unter so geändertem Namen eine Bilderbuchkarriere als geachteter Wissenschaftler an der Aachener Universität und als Sozialdemokrat PNL – 36 aufgebaut. Wie viele sich ihr Überleben Gestern berichtete die FAZ (19.10.2005) von einem historischen Vorläufer des Falles Willkomirski: Im Jahre 1354 wurde der angesehene Kaufmann Giovanni di Guccio von dem römischen Tribun Cola die Rienzo (man darf an Wagners „Rienzi“ denken) aufs Capitol bestellt, wo ihm erklärt wurde, er, der kleinwüchsige Kaufmann sei in der Wiege mit dem König von Frankreich vertauscht worden. Mächtige dynastische Interessen spielten eine Rolle, was Tommaso di Carpegna Falconieri, Historiker an der Universität Urbino, nun detailliert recherchiert hat. Insbesondere der Wechsel von den Kapetingern zum Hause Valois mit mächtigen Auswirkungen auf den Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England spielten eine Rolle, weil nämlich Johannes Postumus schon 1316 gestorben war und nur vier Tage regierte – man munkelte, er sei ermordet worden. Aber auch Cola di Rienzo wurde wenige Tage nach seinem Treffen mit dem „Re Giannino“ (= der kleine König Hans, „Hänschen Klein“) ermordet. Der kleine König Hans aber wurde von mächtigen Geldgebern unterstützt, versuchte mit Söldnerheeren seinen Thronanspruch geltend zu machen. Nachdem er seine angesehen Kaufmannsexistenz aufgegeben hatte, zog er zum Papst, um sich seinen Identitätswechsel bestätigen und sich als König salben zu lassen – erfolglos, und er starb doch unter ungeklärten Umständen. Es gab Zeiten, in denen das möglich war. Die Verwüstungen durch die Pest spielten eine Rolle, die Niederlage der französischen Ritterheere durch die englischen Langbogenschützen 1346 in der Schlacht bei Crécy, der weitverbreitete Glauben an mörderische Verhältnisse in den Herrschaftshäusern – kurz, da muß einer nicht nur was erfinden, es muß auch andere geben, die ihm das glauben und als Wirklichkeit abnehmen. Das ist die Analogie mit dem Fall Wilkomirski. durch öffentliche Mimikry sicherten, kann kaum geschätzt werden; aber daß man die Verfolgung literarisch ausbeuten kann, darin hatte Wilkomirski neues Terrain betreten. Marius Neukom untersucht die „Rhetorik des Traumas“ im ersten Heft von „Psychotherapie und Sozialwissenschaft“ (2005). Er hat sich auch bei anderen Gelegenheiten mit | 11 Wilkomirskis Drama beschäftigt und will nun wissen, was ein Heer von fähigen Literaturwissenschaftlern, Psychotherapeuten, Historikern, aber auch ein breites Publikum dazu gebracht haben kann, eine falsche Geschichte so unkritisch zu glauben; das interessante Thema ist also, wie „Glaubwürdigkeit“ in einem solchen literarischen Text – kommunikativ erzeugt wird. “Wenn von einem Trauma die Rede ist, wird in der Regel auf Ereignisse Bezug genommen, von denen jemand glaubt – und das kann sowohl ein Sprecher oder Autor als auch ein Hörer oder Leser sein – sie hätten eine traumatische Wirkung gehabt. Obschon der allgemeine Sprachgebrauch dies suggeriert, ist ein Trauma kein objektivier- und messbares Konzept“ (S. 82, Kursivierung i.O.) Das ist eine klärende Feststellung und verschiebt die Frage, was ein Trauma i s t dahin, wie Erzähler und Hörer den Glauben, daß ein Trauma vorliege, koproduktiv erzeugen. Gerade weil Wilkomirski ein Fall der zweifelsfreien Täuschung ist, muß die Analyse die Seite des Hörers einschließen, weil hier „spezifische Rezeptionsmechanismen“ in Gang gesetzt werden. Neukom nennt „die Unterdrückung einer kritische Haltung“, den „latenten Zwang, sich gegenüber dem Opfer grundsätzlich solidarisch verhalten zu müssen“ und nach einer eingehenden Analyse des Beginns von Wilkomirskis Buch auch die voyeuristischen Neigungen eines Publikums. Eine Verwirrung kommt hinzu, weil die Markierung des Textes als „authentisch“ häufig zur „Verwechslung der Tatsache der eigenen Betroffenheit mit den Fakten der äusseren Wirklichkeit“ (S. 84) verführt. Diese Kombination verbindet sich dazu, Leser „davon abzuhalten, sich mit diesen Fragen überhaupt kritisch auseinander zu setzen“ (S. 103) Auf seiten des Textes ist eine besondere Leistung zu bemerken, weil der Erzähler seine Leser emotional und moralisch in das Spannungsfeld der Täter-Opfer-Themen einbezieht und sich selbst dabei auf der Seite der Opfer positioniert, was sogleich erhebliche Sympathiegewinne abwirft. Der Leser aber wird unter moralischen Zwang gesetzt, der sich als Denkverbot auswirkt: Wer würde wagen zu zweifeln? Aber das wiederum PNL – 36 darf im Text auch nicht zu „schlicht“, nicht zu unverblümt geschehen, „denn der Autor darf nicht offensichtlich um das Wohlwollen des Gegenübers werben, und dieses soll sich auch nicht vereinnahmt fühlen“. Hier ist also eine beträchtliche kommunikative Leistung der Leser-Steuerung zu bestaunen und dies umso mehr, als der gleiche Text völlig anders gelesen wird, seitdem bekannt ist, daß Wilkomirski die Geschichte erfunden hat. “Bemerkenswert ist dabei, daß die unterschiedlichen Rezeptionsvoraussetzungen (autobiographisch/authentisch versus fiktional/gefälsch) zu ausgesprochen gegensätzlichen Beurteilungen ein und desselben Textes führten” (S. 88). Neukom kann durch seine Analyse der Erzählstrategie des Buchanfangs plausibel zeigen, wie sich eine unbewußte „Szene“ zwischen Autor und Leser einstellt; der Autor überspielt geschickt die Fragen, die sich an seine Glaubwürdigkeit stellen und mobilisiert einerseits empathische Rettungsemotionen, andererseits Idealisierungen, weil er sich als unschuldiges Opfer und zugleich als „Empfänger höchster Gnade“ (S. 94) durch die Tatsache seines Überlebens zu stilisieren weiß. Doch – wer jetzt glaubt, man könne solchen Texten in Zukunft das Täuschende ansehen, wäre nur erneut getäuscht. Denn Neukom zeigt gerade, daß der Glaube an das Trauma hier das Entscheidende war. Ein solcher Glaube muß sich dann als Definitionsmacht durchsetzen mittels der beschriebenen Textstrategien und kann dem Hörer/Leser durch dessen Rezeptionsbereitschaften die Definition verbindlich machen. Es lohnt sich also durchaus, das öffentliche, in diesem Fall literarische Reden über Trauma zu beobachten, denn was hier zwischen Autor und Leser analysiert wird, kann natürlich auch im Behandlungszimmer geschehen. Als Gefahr der Täuschung mit moralischer Parteilichkeit ist das Thema gerade hier präsent und das ist von großer behandlungstechnischer Bedeutung. Die Veränderung im öffentlichen Diskurs kann man an Literaturbeispielen verfolgen, die Hannes Fricke in einem Buch über Trauma, Literatur und Empathie anführt. Die Psychoanalyse hat längst in die Literaturwissenschaft Einzug gehalten, wo ihre | 12 Erkenntnisse souverän zur Freude und Erkenntnis der Leser angewandt werden – man denke an prominentester Stelle an die hinreißenden Bücher von Peter von Matt etwa über „Verkommene Söhne, missratene Töchter“ oder an das Buch „Liebesverrat“. Der Titel des Buches von Fricke „Das hört nicht auf“ (2004) ist ein Grass-Zitat, das auf die peinigenden Nachwirkungen, die Schwierigkeit der Integration und „Historisierung“ traumatischer Erfahrungen und ihre Weitergabe an die nächsten Generationen anspielt. Mit einer Fülle von literarischen Fallbeispielen werden verschiedene Arten traumatischer Erlebnisse und ihre Verarbeitung dargestellt: das geht von Fausts Gretchen – Opfer einer Verführung, die ihr Kind tötet -, über die Erfahrung und Verarbeitung des überwältigenden Momentes in der Entstehungsgeschichte von Batman weiter über den besessenen Versuch des Kapitäns Ahab, durch die Verfolgung von Moby Dick an der Natur Rache zu nehmen, zum Dilemma als traumaprovozierender Erfahrung in Arundhati Roys Roman „Der Gott der kleinen Dinge“. Die Folgen der Vernachlässigung – oft in ihrer schädigenden Wirkung vernachlässigt gegenüber dem skandalisierten sexuellen Missbrauch („the neglect of neglect“ ist die Formel dafür im amerikanischen Schrifttum) - werden ebenso beschrieben wie Krieg, Folter und organisierte Gewalt als Anlässe für Traumatisierungen. Am Beispiel von Wilkomirskis echter Biographie als Heimund Adoptivkind vertritt Fricke die These, dass Vernachlässigte aus Fragmenten ihrer erinnerten Geschichte eine zusammenhängende Phantasiewelt, eine daraus legierte phantasmatische Identität und neue Phantasie-Geschichte entwickeln können, in die sie sich flüchten und an die sie selber glauben. Das können wir Dissoziation nennen oder eine Variante vom Familienroman des Neurotikers. Wir erinnern uns an vergleichsweise harmlose literarische Beispiele. Auch in Astrid Lindgrens Kinderbuch der 50er Jahre „Rasmus und der Landstreicher“ erzählt ein Waisenhausjunge, er sei „Prinz Elof von edlem Geblüt“ und das ist eine ähnlich fikti- | 13 PNL – 36 onale Identitätsanmaßung wie bei Wilkomirski, hat aber nicht die gleichen sozialen und emotionalen Resonanzen – man versteht nämlich umstandslos beim Lesen, dass hier einer in eine andere Welt flüchtet, die er sich selbst erschafft. In einer anderen, in unserer heutigen Welt, in deren gesellschaftlichem Diskurs der Trauma-Begriff eine rasante Karriere machen konnte, gilt die Holocaust-Erfahrung als unbezweifelbares Beispiel eines leidvollen Schicksals, das unbedingte Anteilnahme beanspruchen darf. Hier hatte sich also jemand eine Opferbiographie geschaffen, die medial ungleich attraktiver war als die Vernachlässigung eines herumgeschubsten Niemand. Das unterstreicht noch einmal die resonante Rolle des lesenden/hörenden/therapeutischen Mitspielers und macht zugleich deutlich, wie schwierig im Grunde die Rede davon ist, ein Therapeut könne oder solle „nachträglicher Zeuge“ sein; das ist behandlungstechnisch oft von ergreifender Notwendigkeit, aber in anderen Zusammenhängen eine höchst problematisch Redeweise. Wir kennen die Attraktivität des „verbrieften Opferstatus durch das Trauma“ aus der therapeutischen Praxis, über die dazu präsentierten „false memories“ hat Ursula Mayr im „Forum der Psychoanalyse“ (März 2005) berichtet (siehe dazu auch PNL 33). Es ist, als ob die diskursive „Ausuferung“ der Trauma-Diskussion nun Rückwirkungen in der Fachliteratur zeigt. Jochen Lellau berichtet im „Forum der Psychoanalyse“ (Juni 2005) „Zum Problem des Traumabegriffes in der Psychoanalyse“. Er bringt uns zur Kenntnis und Wiedererinnerung Fenichels Trauma-Definition: der hatte gesagt, das Trauma bestimme sich durch das Verhältnis von Spannung und Ich-Stärke. WEGWEISER Lellau führt als „Verbündeten“ für seine kritische Betrachtung der Traumadiskussion den israelischen Psychoanalytiker Hillel Klein an, der sich wie auch andere Holocaust-Überlebende (zu erwähnen sind hier v.a. Krystal und Ornstein), massiv dagegen wehrt, die Erfahrungen des KZ in ihren Auswirkungen auf ihre Opfer allzu sehr pauschal zu betrachten. Imre Kertesz hatte in seinem „Roman eines Schicksallosen“ sich ebenso gegen diese pauschalisierende Betrachtung gewehrt, indem er das Lager literarisch sogar zu idealisieren wagte. Auch Hillel Klein fürchtet die Ansicht, von Erfahrungen sogleich auf „Trauma“ zu schließen, das entwürdige die Subjektivität der Opfer. Hillel Klein hatte sich gegen die Ausweitung des Trauma-Begriffes gewandt: Vieles davon gehöre, hierin ähnelt er Kertesz, einfach zur menschlichen Erfahrung – so gibt ihn Lellau wieder. Die lapidare Härte einer solchen Position kann man freilich nur von jemandem akzeptieren, von dem man ahnt, was er erlitten und geduldet haben könnte. Ist das KZ „menschliche Erfahrung“? In einem endgültigen Sinne fraglos Ja; aber etwas in uns weigert sich auch, das so hinzunehmen. Und dennoch: es könnte sein, daß die tiefe Menschlichkeit, die aus einer solchen Anerkennung selbst spricht, es leichter zu ertragen macht als die Fortsetzung der Kämpfe um Beseitigung von Schäden oder um moralische Bestätigung eines Opferstatus. Vielleicht, weil man dann, wenn nur endlich echte Anerkennung des Erlittenen und des verletzten Gerechtigkeitsgefühls erfolgt wäre, auch daran gehen kann, sich wieder freier aufzubauen. Aber die Entscheidung über eine solche Position kann nicht vorgegeben werden, auch sie muß frei bleiben. AUS DEN Könnte Hillel Kleins Position eine Erlösung wenigstens aus den theoretischen und schulischen Sackgassen sein? Wenn man so argumentiert, muß man einen Schutz aufbauen, um der Gefahr der Verharmlosung des Entsetzlichen zu entgehen. Der könnte darin bestehen, nicht mehr von Trauma zu spre- SACKGASSEN? chen und mit diesem Begriff eine Einheitlichkeit zu fingieren, die es nicht geben kann, sondern statt dessen die erlebten und erlittenen Szenen zu schildern mitsamt der Art ihrer Verarbeitung – das veranschaulicht, schützt die Individualität der Verarbeitung und damit die angesprochene Würde und PNL – 36 ermöglicht durch die „szenische Darstellung dessen was geschah“ Zuhörern und Lesern sowohl empathischen Nachvollzug als auch ein Urteil über das, wovon da die Rede ist. Selbst im Stammeln und Zögern würde eine literarische Form entwickelt, die mit zwanglosem Zwang aus der Notwendigkeit der Darstellung resultiert: man muß erzählen statt zu diagnostizieren. Empathie würde möglich, wo schulischer Streit um die richtigen „Methoden“ und Spezialisierungen die Wahrnehmung eher zu verdüstern droht. Leon Wurmser argumentiert ähnlich in seinem Beitrag: „Das Auge ist’s, was die Taten verwandelt. Das neugeborene Auge verwandelt die alte Tat“ (Forum der Psychoanalyse 2, 2005). Auch ihn treibt die Sorge, die Ausweitung des Trauma- und DefektDiskurses führe zu einer Vernachlässigung des Konflikt-Themas, und er zitiert Steven Reisner (2003) wonach das „Trauma in unserer Kultur und unserer Behandlung der Ort geworden ist, wo dem Narzissmus die Herrschaft überlassen wird.“ (Wurmser S. 135) Heißt das nun: zurück zur triebökonomischen Definition des Trauma-Begriffes nach Fenichel? Sollen wir Ferenczi wieder vergessen? Das kann fraglos nicht der einzuschlagende Weg sein. Wenn Bohleber für eine Art „doppelter Beschreibung“ des Traumas plädiert hatte (triebökonomisch und objektbezogen-hermeneutisch), dann muss man das aus heutiger Sicht methodisch erweitern. Das hieße, den Begriff der Nachträglichkeit, der Überformung des Alten durch das Aktuelle mit einzubeziehen, um die Ausbeutbarkeit des Redens über Trauma wenigstens mit ins therapeutische Gespräch einbringen zu können. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob wir den Todesfall eines nahen Angehörigen als „Trauma“ definieren oder aber mit Hillel Klein als „menschliche Erfahrung“, die beweint und betrauert, letztlich aber hingenommen werden muß. Wie wir etwas definieren, sowohl innerhalb der Therapeut-Patienten-Beziehung als auch im gesellschaftlichen Diskurs über das Trauma, bleibt nicht ohne Folgen. Die Erfahrung mit Wilkomirski muß den Blick frei machen zu untersuchen, wer eigentlich etwas als Trau- | 14 ma definiert, wie und wann es geglaubt wird, wie sich Beteiligte auf eine solche Definition einigen und welche Grade an Verbindlichkeit diese soziale Leistung beanspruchen kann. Die Verengung und Ausweglosigkeit der Debatte könnte überwunden werden, wenn das Interesse weniger der Frage gilt, was ein Trauma „ist“. Kurz, gerade in der Trauma-Diskussion könnte die Verschiebung hin zu einem relationalen Paradigma Lösungen anbieten, die sich einem nur individualistischen Blick verstellen müssen. Eben diesen Versuch unternimmt ein Beitrag von Gisela Thoma im ersten Heft von „Psychotherapie und Sozialwissenschaft“. Sie zeigt, daß traumatische Erfahrungen von sexuellen Übergriffen durchaus erzählt werden können, ja daß sich trotz des Traumas eine geordnete lineare und kohärente Erzählstruktur auffinden läßt. Das widerspricht dem von Brigitte Boothe im gleichen Heft beschriebenen Topos der „Fragmentierung im episodischen Gestaltungsprozeß“ mit Detail-Konkretismus und dem Fehlen einer dynamischen Erzählorganisation. Thoma zeigt bei den von ihr untersuchten, auf Aufforderung geschriebenen (also nicht im therapeutischen Gespräch mündlich erzählten) Geschichten von 5 Personen auf, daß sie sich zu einem „Geschichtentypus der Opferinszenierung“ verdichten lassen und sie fügt an, daß einseitige Parteinahmen für das Opfer eine genaue Wahrnehmung empfindlich einschränken können. „Die Reflexion eigener Betroffenheit und Erschütterung, die durch die Rhetorik des Traumas ausgelöst wird, ist unumgänglich“ (S. 27). Zu dieser kritischen Haltung gehört die Analyse der Erzählmittel, mit denen sich jemand als Opfer inszeniert und dazu gehört auch zu sehen, daß Holocaust-Traumatisierte die Leistung einer kohärenten Erzählung meist nicht zustande bringen. Bemerkenswert ist, daß Thoma den Einfluß des Mediums – Aufforderung zu einer schriftlichen Darstellung – durchaus kritisch sieht; erstaunlich aber auch, daß der von Fritz Schütze in die Diskussion gebrachte Begriff des „Gestaltschließungszwangs“ überhaupt nicht erwähnt wird. Schütze hatte als Sozialforscher die Technik des narrativen Interviews entwi- PNL – 36 ckelt und dabei beobachtet, daß allein die Tatsache, daß Interviewte aufgefordert sind, Erlebtes zu erzählen, bestimmte Zwänge mit sich bringt: die Geschichte muß (das ist der Zwang) zu einem Ende gebracht werden, weil sonst der Interviewer ja keine Chance hat, die nächste Frage zu stellen. Die Geschichte muß aber auch kohärenter erzählt werden, weil die Darstellung einer offenen Erzählgestalt gewissermaßen sofort die stille Frage danach mit sich bringt, „was wirklich los war“ (Zuhörer meinen, nicht „alles“ erfahren zu haben) oder aber Erzähler glätten die Geschichte, weil sie fürchten, daß Unvollständigkeit und offenes Ende ihnen persönlich zugerechnet wird (Zuhörer könnten meinen, „was ist mit dem los?“). Bekannt ist auch, daß solche Zwänge in Interviews durch geschickte Fragen aufgeweicht werden können, daß sie aber bei einer schriftlichen Form besonders zum Zuge kommen. Die Darsteller können sich noch weniger als in einer kommunikativen Situation an Hörersignalen orientieren, um abzuschätzen, wie das von ihnen Dargestellte aufgenommen wird und das erhöht den Zwang zur kohärenten Darstellung unvermeidlich. Wie Traumata in Interviews erzählt werden, welche „Verfahren“ bei der Darstellung traumatischer Erlebnisse genutzt werden, untersucht in großer Detailliertheit der Beitrag von Arnulf Deppermann und Gabriele Lucius-Hoene. Beide sind erfahrene Sozialwissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie Gesprächs“objekte“ durchs Gespräch selbst „hergestellt“ werden – welche stimmlichen, kommunikativen oder sprachlichen Ausdrucksmittel nutzt ein Erzähler? Grundlage sind 4 Transkripte von Traumadarstellungen, die aus einem größeren Textkorpus stammen, der zur Untersuchung von traumatischen Erlebnissen zusammengestellt wurde. Ein hier analysiertes Beispiel ist die Darstellung der Sekretärin Traudl Junge vom Tod ihres Führers im Bunker der Reichskanzlei. Auch sie benutzt dabei übrigens die Metapher vom „schwarzen Loch“, was in sich interessant ist und | 15 gewissermaßen die verschlungenen intertextuellen Spuren der Trauma-Diskussion ahnen läßt, ohne daß man in der Lage wäre, hier Genaueres zu formulieren. Penibel zeichnen die Autoren jeden Seufzer, jede Sprachverzögerung, jeden Glottisstop auf – aber, wenn man durch Neukom aufmerksam geworden ist, dann fällt einem auf, daß die Autoren mit ihrem Forschungssubjekt die Definition, hier handele es sich um ein Trauma, unbefragt vorab teilen – dieser Definition entziehen sie sich nicht. Ähnliche Fragen stellen sich, wenn man die Schilderung von der Kriegsverwundung eines Soldaten liest; ja, hier wird erzählt, hier wird eindrücklich, hier wird authentisch in großer subjektiver Betroffenheit erzählt und man kann prosodische Merkmale und stimmliche Besonderheiten notieren – aber als Leser und Beobachter öffentlicher Diskurse hat man durchaus auch das Gefühl, hier wird ein Format bedient, das man aus zahllosen Fernsehsendungen über das Kriegsende als auch aus privaten Kriegsschilderungen kennt. Erstaunlich, daß die stillschweigende Vorab-Definition als „Trauma“ weder diskutiert noch in Frage gestellt wird; sie wird einfach übernommen. Was würde sich ändern, wenn man mit Hillel Klein solche Erfahrungen als zum menschlichen Leben gehörig bezeichnen würde? Methodisch ist die umstandslose Übernahme der vorgegebenen Traumadefinitionen fragwürdig, stimmt aber mit dem Befund genau überein: „Im gegenwärtigen Stadium unserer Untersuchung wissen wir nicht, ob es spezifische Darstellungsformen gibt“ (S. 70). Man sollte, so darf man vielleicht schlussfolgern, diese Erwartung gar nicht haben. Denn der methodische Individualismus, der sich hier artikuliert, könnte das Problem nicht lösen. Man kann noch so umfangreiche Merkmalslisten von subjektiver Agency, Betroffenheitsmarker, stimmlicher Führung und vokaler Prosodie anführen – aber der sozialen KoProduktion des Trauma-Konzepts wird man so nicht auf die Spur kommen können. | 16 PNL – 36 R E L A T I O N A L I TÄ T A uch hier könnte sich die Umstellung auf ein relationales Paradigma als hilfreich erweisen. Das würde einschließen, das Elend und die Verzweiflung, die Bitterkeit und die Verletztheit ohne Vorbehalte anzuerkennen und dabei aber zu bedenken, daß eine solche Anerkennung wiederum Folgen haben kann, die bedacht sein wollen. Die Lehre aus dem Fall Wilkomirski ist unabweisbar zu ziehen. Eine relationale Psychoanalyse könnte für die sozialen Rechte und Bedürfnisse Überlebender und seelisch Versehrter vehement eintreten und dennoch zugleich die Rolle der Definitionsmacht analysieren. Bohlebers Vorschlag wäre um eine relationale Dynamik erweitert. Die Untersuchung von Definitionsmacht gehört im Grunde in das Gebiet einer psychoanalytischen Kulturkritik. Sie wäre kein verzichtbarer Luxus, sondern notwendige Hilfe zur therapeutischen Wirksamkeit der Psychoanalyse. Es gibt gute Aussichten, daß sich die Wirrnisse um das Traumakonzept mit einer paradigmatischen Ausrichtung auf die sozialen Resonanzen entwirren lassen könnten. Zugleich aber geht eine solche Orientierung nicht geringe professionseigene Risiken ein, weil natürlich die Mitbeteiligung unserer Profession an der Produktion sozialer Resonanzen selbst zur Diskussion stünde. Wäre es denkbar, darf man vermuten, ja überhaupt auszusprechen wagen daß die schulischen Streitigkeiten zwischen spezialisierten Traumatherapeuten und Therapeuten anderer Orientierungen wie ein kollusiver Ehestreit dynamisiert sein könnten? Daß wir uns lautstark über das eine streiten, um das andere in gemeinsamem Interesse bedeckt halten zu können? Zu hoffen bleibt, daß die Klärungsbedürfnisse im Umgang mit unseren Patienten hier letztlich mit leiser Stimme sich hilfreich Gehör verschaffen werden.