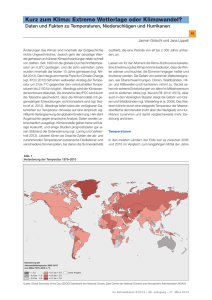Das Hurrikan-Rekordjahr 2005 - Naturwissenschaftliche Rundschau
Werbung

ÜBERSICHT Bericht, Lucia Kins, München Das Hurrikan-Rekordjahr 2005 – Eine Bilanz Die Hurrikan-Saison 2005 brach viele Rekorde. Unvergessen sind die Bilder vom überfluteten New Orleans, nachdem der Hurrikan Katrina über die Südküste von Louisiana hinweg gezogen war. Inzwischen ist die Hurrikan-Saison 2005 offiziell zu Ende gegangen. Zeit, Bilanz zu ziehen und sich mit dem Naturereignis eingehender zu beschäftigen, bevor die Saison 2006 beginnt. D ie offizielle Hurrikan-Saison beginnt am 1. Juni und endet am 30. November jedes Jahres. Die Saison 2005 brach gleich mehrere Rekorde seit Beginn der systematischen Beobachtungen 1944 (Tab. 1 und 2). Mit 13 Hurrikanen war es die aktivste Saison seit 1966 (12 Hurrikane). Drei Stürme erreichten die höchste Kategorie 5, so viele wie nie zuvor. Zum ersten Mal gab es bereits im Juli zwei Stürme der Kategorie 4, und zum ersten Mal reichte die alphabetische Namensliste nicht mehr, um alle tropischen Stürme zu benennen. Der Hurrikan Wilma, der sich am 18. Oktober bildete, war der stärkste jemals beobachtete Sturm im Atlantik und der einzige Kategorie 4-Sturm, dessen Luftdruck unter die 900 hPa-Marke fiel. Vermutlich war Wilma sogar weltweit der stärkste jemals beobachtete Kategorie 4-Sturm. Den größten Schaden in der amerikanischen Geschichte richtete jedoch Katrina an (Abb. 1), mit geschätzten 100 Milliarden Dollar Kosten. Tab. 1. Die Hurrikan-Saison 2005 im Überblick. Erster Sturm Stürme mit Namen Anzahl der Hurrikane Größere Hurrikane (Kategorie 3+) Stärkster Sturm Geschätzte Sachschäden Bestätigte Todesfälle 8. Juni (Arlene) 26 (Rekord) 13 (Rekord) 7 Wilma – 882 hPa (Rekord), 280 km/h über 100 Mrd. US-Dollar (Rekord) 2854 Tab. 2. Die Hurrikan-Saison 2005 im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Durchschnitt 2005 Benannte Stürme 10 26 Hurrikane 6 13 Hurrikane Kategorie 3+ 2 7 Hurrikane Kategorie 5 0,5 3 Naturwissenschaftliche Rundschau | 59. Jahrgang, Heft 3, 2006 Abb. 1. Hurrikan Katrina vom Weltall aus gesehen. Deutlich sichtbar sind das Auge und die spiraligen Regenbänder. [Photo Deutscher Wetterdienst] Entstehung und Struktur tropischer Wirbelstürme Hurrikane (engl. hurricanes) heißen die tropischen Wirbelstürme nur im Nordatlantik und in der Karibik. Die gleichen Stürme nennt man im westlichen Pazifik, etwa in China und Japan, Taifun. Tropische Zyklone heißen sie in Nord-Australien und dem südöstlichen Pazifik. (Verschiedentlich werden die Willy Willies Australiens auch als Äquivalent für Hurrikane genannt. Diese umgangssprachliche Bezeichnung bezieht sich aber auf Staubtromben im Inneren des Kontinents.) Die Stürme entwickeln sich nur, wenn das Wasser bis in etwa 50 m Tiefe mindestens 26 Grad warm ist. In der Atmosphäre muss es bereits eine Störung mit Gewittern geben, und die Atmosphäre muss labil geschichtet sein, das heißt, die Temperaturen sinken sehr schnell mit der Höhe. Zudem darf keine große Windscherung zwischen der Ober129 Übersicht fläche und den oberen Atmosphärenschichten bestehen. Mit Windscherung bezeichnet der Meteorologe die Änderung der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung mit der Höhe. Alle tropischen Stürme entwickeln sich über den Ozeanen im Bereich der Passatwindzonen zwischen dem 10. und 30. Breitengrad auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre. Bekanntlich weht der Wind im Bereich der Passate von Ost nach West (und zwar auf der Nordhemisphäre von NO nach SW, auf der Südhemisphäre von SO nach NW), doch handelt es sich nicht um eine glatte, gleichmäßige Luftströmung. Kleine lokale Störungen, zum Beispiel Luftdruckschwankungen, erzeugen Wellen in der Atmosphäre, gerade so, wie Steine am Boden Wellen in einem Fluss anregen. Innerhalb dieser Wellen wirbeln kleinere Luftpakete, die Keimzellen für tropische Gewitter. Nach Westen hin werden die atmosphärischen Wellen immer größer, und mit ihnen wachsen die Gewitterzellen, gespeist von großen Mengen feuchter, warmer Luft, die von der Meeresoberfläche verdunstet. So entsteht die Mehrzahl der tropischen Gewitter am westlichen Ende der Passatzone. Dies gilt gleichermaßen für Hurrikane, Taifune und Zyklone (Abb. 2). Als Faustformel gilt: Etwa eine Welle, das heißt etwa ein tropisches Gewitter oder maximal ein Hurrikan pro Woche erreicht die Karibik. Die Hurrikan-Saison ist im Prinzip eine Periode mit besonders rauhen atmosphärischen Wellenbewegungen. Der einzige Unterschied zwischen den harmlosen Gewitterstürmen und einem gefährlichen tropischen Wirbelsturm ist dessen Rotation. Nördlich des 20. Breitengrades trägt der Corioliseffekt merklich zur Rotation der Wirbelstürme bei. Doch kann auch der Wind selbst Wirbel erzeugen. Wenn zwei unterschiedlich schnelle Winde nebeneinanderher wehen, fängt der schnellere Wind an, sich um den langsameren zu wickeln. Wenn diese Wirbelenergie so groß ist, dass sie um einen Kern wirbelt, beginnt eine Kettenreaktion (Abb. 3): Warme feuchte Luft wird von der Strömung angezogen. Diese Luft steigt dann in die Höhe und kühlt ab, bis der Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Die Kondensation setzt die im Wasserdampf gespeicherte latente Wärme frei, worauf die Luft fast explosionsartig weiter nach oben steigt und von der Oberfläche neue Luft ansaugt. Dadurch gelangt noch mehr Wasserdampf von der Meeresoberfläche in die Atmosphäre, und allmählich bildet sich eine immer dicker werdende rotierende Wolkenwand um den ruhigen Kern, das Auge des Sturms. Die Kondensationswärme kann den Sturm-Kern plötzlich um bis zu 10 Grad erwärmen, daher sinkt im Auge trockene Luft ab. Auch diese trockene Luft nimmt viel Wasserdampf von der Meeresoberfläche auf und steigt wieder nach oben. Das rotierende System kann sich nun selbst erhalten und bis zu Hurrikanstärke heranwachsen, solange es sich über warmem Wasser bewegt. Wasserdampf ist also die Energiequelle jedes tropischen Wirbelsturms. Werden Wirbelstürme vom Feuchte-Nachschub abgeschnitten – etwa über Land oder kälteren Meeresströmen –, verlieren sie sehr schnell ihre Kraft. Hurrikane gibt es daher niemals im Südatlantik und im Südostpazifik, denn hier ist das Meer niemals warm genug, um genügend Wasser Abb. 2. Vorkommen von tropischen Wirbelstürmen und die großen Windsysteme. Im Bereich der jahreszeitlich schwankenden Tiefdruckrinne entlang des Äquators (Innertropische Konvergenz, ITC, Situation Januar) steigen Luftmassen auf, wandern in großer Höhe Richtung Wendekreise und sinken in den Hochdruckgebieten wieder ab. Von dort strömt die Luft in Bodennähe zurück zur ITC. Die Erddrehung gibt allen Winden nördlich der äquatorialen Zone eine Rechtsdrehung (Corioliseffekt). [Graphik Hammelehle] 130 Naturwissenschaftliche Rundschau | 59. Jahrgang, Heft 3, 2006 Kins: Das Hurrikan-Rekordjahr 2005 – Eine Bilanz Tab. 3. Die fünf Hurrikan-Kategorien. Abb. 3. Querschnitt durch einen Hurrikan. Die Pfeile markieren die Richtung, Stärke und Temperatur der Luftbewegungen. Dicke Pfeile = starker Wind; dünne Pfeile = schwacher Wind; rote Pfeile = warme Luft; blaue Pfeile = kalte Luft. Die äußeren Regenbänder markieren den Außendurchmesser des Hurrikans. zu verdunsten. Doch inzwischen gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel, wie weiter unten zu lesen ist. Die Entstehungsgeschichte der tropischen Wirbelstürme erklärt auch deren Struktur. Im Zentrum befindet sich das Auge. Es ist nahezu kreisrund, der Wind kann ganz aufhören, es regnet kaum noch, und manchmal sind sogar der blaue Himmel oder Sterne sichtbar. Das Auge ist der Bereich des Sturms mit dem niedrigsten Boden-Luftdruck und der wärmsten Temperatur in der Höhe. In zwölf Kilometer Höhe kann die Temperatur zehn Grad höher sein als in der Umgebung des Auges, nahe der Meeresoberfläche ist sie lediglich Null bis zwei Grad höher. Der Durchmesser des Auges misst meist 30 bis 60 Kilometer, er kann aber auch bis zu 200 Kilometer oder lediglich acht Kilometer betragen. Das Auge ist umgeben von der Augenwand, einem Ring mit starker Konvektion. Diese Wand ist der Bereich mit den höchsten Windgeschwindigkeiten. Bei Hurrikanen dehnt sich die Region mit den höchsten Windgeschwindigkeiten zwischen 45 und 270 Kilometer vom Zentrum aus. Daran schließen sich die spiraligen Regenbänder an. Der gesamte Hurrikan hat einen durchschnittlichen Durchmesser von 540 Kilometern, er kann sich aber auch nur 200 Kilometer oder bis zu 1000 Kilometer ausdehnen. Die Größe eines Hurrikans sagt nichts über dessen Stärke aus. So war Hurrikan Andrew (1992), bis Wilma der stärkste je beobachtete Hurrikan, mit rund 350 Kilometern Durchmesser ausgesprochen klein. Klassifizierung und Benennung von Hurrikanen Ein tropischer Sturm wird erst dann zu einem Hurrikan, wenn er die Windstärke 12 (ca. 118 km/h) übersteigt. Weil für seine Charakterisierung die 12-teilige Beaufort-Skala längst nicht mehr ausreicht, musste eine neue Skala geschaffen werden – die Saffir-Simpson-Skala. Sie wurde 1969 entwickelt und teilt die Hurrikane in fünf Kategorien ein (Tab. 3). Namensgeber und Entwickler waren Herbert Saffir und Bob Simpson, damals Direktor des National Hurricane Center in den USA. Das Maß für die Hurrikan-Skala ist die höchste mittlere Windgeschwindigkeit. Nach den Richtlinien der World Meteorological Organisation (WMO) muss diese Geschwindigkeit über 10 Minuten gemittelt werden, damit zufällige kurze Böen die Werte nicht verfälschen. Die mittlere Windgeschwindigkeit ist ein guter Indikator für die möglichen Schäden, für die Wellenhöhe auf dem offenen Meer und die Sturmfluten an der Küste. Naturwissenschaftliche Rundschau | 59. Jahrgang, Heft 3, 2006 Kate- Mittlere Wind- Luftdruck gorie geschwindigkeit 1 118–153 km/h >980 hPa 2 154–177 km/h 980–965 hPa 3 178–209 km/h 964–945 hPa 4 210–249 km/h 944–920 hPa 5 >250 km/h <920 hPa Fluthöhe (über Normal) 1,2–1,6 m 1,7–2,5 m 2,6–3,7 m 3,8–5,4 m > 5,5 m K a sten 1 : C oriolise f f ekt Für einen Beobachter auf der Erde wird jedes frei fliegende Objekt von seiner geraden Bewegung abgelenkt, und zwar auf der Nordhemisphäre nach rechts und auf der Südhemisphäre nach links. Der französische Physiker Gaspard Gustave de Coriolis erklärte 1835 diese Ablenkung. Er sagte, dass die gekrümmte Flugbahn nicht auf einer wirklichen Kraft beruht, sondern nur die Sicht des Beobachters auf der rotierenden Erde widerspiegelt. Die Corioliskraft tritt zusätzlich zur Zentrifugalkraft auf. Die Zentrifugalkraft ist die statische – nur vom Ort abhängige – Komponente, die Corioliskraft die dynamische – von der Geschwindigkeit abhängige – Komponente der resultierenden Scheinkraft. Zur Verdeutlichung: Eine Wolke befindet sich auf 60° nördlicher Breite in Ruhe bezogen auf die Erdoberfläche, d. h. sie dreht sich zusammen mit der Erde, hat also die gleiche Rotationsgeschwindigkeit wie die Erde auf diesem Breitengrad. Setzt sich diese Wolke nun in Richtung Süden in Bewegung, so bleibt diese Westost-Geschwindigkeitskomponente gleich. Je weiter die Wolke nach Süden gelangt, desto größer werden jedoch der Erdumfang und damit die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Die Wolke ist also im Vergleich zur Erdoberfläche zu langsam. Aus Sicht eines Beobachters auf der Erdoberfläche wird die Wolke aus ihrer Nordsüd-Bewegung nach Westen (rechts) abgelenkt. Bewegt sich eine Wolke umgekehrt von Süd nach Nord, so erhält sie bei ihrem Start eine Westost-Bewegungskomponente, die größer ist als weiter nördlich. Sie wird folglich aus ihrer Südnord-Richtung im Vergleich zur Erdoberfläche nach Osten (wieder rechts) abgelenkt. Bewegt sich die Wolke entlang der Breitenkreise, wird sie ebenfalls von ihrer geraden Zugbahn abgelenkt. Hierbei spielt die Zentrifugalkraft eine wichtige Rolle. Jedes Objekt in einem rotierenden System würde geradeaus fliegen, wenn keine gegensteuernde Kraft es auf eine Kreisbahn zwingt. Auf der Erde hält die Schwerkraft alle Objekte in ihrem Einflussbereich auf der Kreisbahn. Die Schwerkraft zieht genau zum Mittelpunkt der Erde, die Zentrifugalkraft wirkt im rechten Winkel zur Rotationsachse der Erde. Die Zentrifugalkraft wächst mit der Rotationsgeschwindigkeit. Wandert unsere Wolke nun von West nach Ost, so bewegt sie sich schneller als die rotierende Erde und hat daher eine größere Zentrifugalkraft als die Erde. Dadurch wird die Wolke in Richtung Süden (nach rechts) abgelenkt. Setzt sich die Wolke nach Westen in Bewegung, so wird sie langsamer als die Erde, folglich wird ihre Zentrifugalbeschleunigung kleiner und die Wolke wird nach Norden (wiederum nach rechts) abgelenkt. Am Äquator sind Gravitation und Zentrifugalkraft genau ausgeglichen, und daher verschwindet der Corioliseffekt am Äquator. Auch wenn sich die Wolke vertikal bewegt, wird sie durch die Corioliskraft auf der Nordhemisphäre nach rechts und auf der Südhemisphäre nach links abgelenkt. 131 Übersicht Gemeinhin nimmt man an, dass die größten Schäden eines Hurrikans von den sintflutartigen Regenfällen und den hohen Windgeschwindigkeiten ausgehen. Doch die größten Verwüstungen richten die Sturmfluten an. Die Sturmfluten branden bis weit in das Landesinnere, wo sie Straßen unterspülen, Brücken einreißen und nicht selten Erdrutsche auslösen. Die Sturmfluten haben ihren Ursprung in den hohen Windgeschwindigkeiten um das Auge des Hurrikans. Der Wind schiebt quasi das Ozeanwasser vor sich her und türmt es auf. Es entstehen Wasserkuppen, die in Küstennähe bis zu sechs Meter Höhe erreichen können. Weil der Druckunterschied zwischen dem Zentrum und dem Rand des Hurrikans die Windgeschwindigkeit bestimmt, ist der Luftdruck im Auge des Sturms ein gutes Maß für die Höhe der Flutwellen. Seit 1953 erhalten alle tropischen Wirbelstürme von der WMO einen Namen, wenn ihre mittlere Windgeschwindigkeit 72 km/h erreicht. Dafür gibt es sechs Listen mit abwechselnd männlichen und weiblichen Vornamen von A bis W. Alle sechs Jahre kehren daher die gleichen Namen wieder. Reicht die Namensliste – wie 2005 – nicht aus, um alle Stürme zu benennen, geht man zum griechischen Alphabet über. Hat ein Hurrikan großen Schaden angerichtet, so wird sein Name aus der Liste gestrichen. Daher wird es in Zukunft wohl keine Katrina mehr geben. Durch die Namen lassen sich die einzelnen Stürme gut unterscheiden, denn oft sind mehrere Stürme gleichzeitig unterwegs. Im 19. Jahrhundert wurden nur die besonders zerstörerischen Stürme benannt. Bekannt ist der Santa Ana, der 1825 Puerto Rico am Tag der heiligen Anna verwüstete. 1869 wurde ein Sturm Saxby’s Gale getauft, nach einem britischen Marineoffizier, der bereits ein Jahr zuvor in einer Londoner Zeitung vor möglichen zerstörerischen Stürmen gewarnt hatte. Im Jahr 1900 zerstörte der Galveston Gale die Stadt an der texanischen Küste vollständig. Ein Ereignis, an das man sich besonders erinnerte, als 2005 der Hurrikan Rita auf Galveston zusteuerte. Mit der systematischen Wetterbeobachtung zu Beginn des 20. Jahrhunderts bezeichnete man die Stürme nach den geographischen Koordinaten, an denen sie zum ersten Mal auftauchten. Doch das System war zu schwerfällig, vor allem im Funkverkehr. 1951 schließlich begannen amerikanische Meteorologen, die Stürme nach dem amerikanischen phonetischen Alphabet zu kennzeichnen – Able, Baker, Charlie. Zu Beginn der Namensgebung durch die WMO wurden leicht merkbare englische Frauenvornamen verwendet. Nach vielen Protesten von Frauen sind seit 1979 auch männliche Vornamen in Gebrauch, gleichzeitig nahm man auch nicht-englische Namen in die Listen auf. Steigt die Zahl der Stürme? Die Hurrikan-Saison 2005 war reich an Rekorden, doch schon 2004 war ein Jahr mit sehr vielen Hurrikanen. Das erweckt leicht den Eindruck, dass die Zahl der Stürme steigt. Wissenschaftlich nachgewiesen ist ein solcher Anstieg bisher aber noch nicht. Das liegt vor allem daran, dass die natürliche Schwankung der Zahl der Hurrikane sehr groß und mit 132 K a sten 2 : E l N i ñ o und N ord atl a ntische O szill ation Neben den täglichen Wetteränderungen gibt es Änderungen der großräumigen atmosphärischen Zirkulation, die große Gebiete betreffen. Zu diesen natürlichen Schwankungen der atmosphärischen Zirkulation gehören El Niño und die Nord-Atlantische Oszillation. El Niño: Das El Niño-Phänomen ist eng verknüpft mit der Southern Oscillation (Südliche Oszillation), daher spricht man heute im Allgemeinen vom El Niño/Southern Oscillation (ENSO)-Phänomen. Die Southern Oscillation ist eine Art Druckschaukel zwischen dem Tief in Südostasien und dem Hoch im Südostpazifik. Sie bestimmt die Stärke der Passatwinde längs des Äquators im Pazifik. Unter dem Einfluss der Passatwinde quillt entlang des Äquators vor der Westküste Südamerikas kaltes Wasser an die Meeresoberfläche. Ein El Niño-Ereignis beginnt mit einer Erwärmung des Ozeans entlang des Äquators vor der Westküste Südamerikas. Infolgedessen steigt der Luftdruck über dem westlichen Pazifik, während er über dem östlichen Pazifik sinkt. Das schwächt wiederum die Passatwinde und damit den Auftrieb kalten Wassers im östlichen Pazifik. Die Meerestemperatur steigt weiter an. Schließlich gipfelt diese Art von instabiler Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre in einem El Niño-Ereignis mit ungewöhnlich hohen Temperaturen im Ostpazifik und einem „Einschlafen der Passatwinde“. El Niño-Ereignisse wiederholen sich im Mittel alle vier Jahre und beeinflussen das Wetter weltweit. Was die tropischen Wirbelstürme betrifft, so wirken sich El Niño-Jahre am stärksten im Nordatlantik aus. Es gibt dann deutlich weniger Stürme als in normalen Jahren, und die Hurrikan-Intensität ist ebenfalls niedriger als üblich. In den Pazifikregionen ändern sich Zahl und Intensität der tropischen Wirbelstürme in El Niño-Jahren dagegen nur sehr wenig. Nordatlantische Oszillation (NAO): Unter der Nordatlantischen Oszillation versteht man die Schwankung des Druckverhältnisses zwischen dem Islandtief im Norden und dem Azorenhoch im Süden des Atlantiks. Maßeinheit ist der NAO-Index. Bei positivem NAO-Index herrscht über Island ein sehr tiefer und über den Azoren ein sehr hoher Druck. Negativ ist der NAO-Index, wenn nur geringe Luftdruckgegensätze herrschen, also sowohl Islandtief als auch Azorenhoch schwach sind. Der NAO-Index schwankt stark von Jahr zu Jahr, doch wechseln sich deutlich negative Phasen mit überwiegend positiven Phasen im Rhythmus von etwa 20 Jahren ab. In den letzten 30 Jahren ist der Index allerdings überwiegend positiv mit nur kurzen negativen Unterbrechungen. Die 1960er Jahre waren eine Phase mit ausgeprägtem negativem NAO-Index. Wie das ENSO-Phänomen bestimmt die Nordatlantische Oszillation die großräumigen Luftströmungen und – in einem Rückkopplungseffekt – die Oberflächentemperatur im Atlantik. In positiven NAOJahren sind die Winter in Mittel- und Nordeuropa ausgesprochen mild und feucht, in negativen NAO-Jahren hingegen trocken und kalt. Das Oberflächenwasser des Nordatlantiks im Bereich der Passatwinde ist in negativen NAO-Jahren deutlich wärmer als üblich, daher sind negative NAO-Jahre ausgeprägte Hurrikan-Jahre. natürlichen Variationen der Meeresströmungen verknüpft ist. So lassen El Niño-Ereignisse des tropischen Pazifik die Zahl der Hurrikane in kurzen Zeiträumen schwanken, und die Nord-Atlantische Oszillation überlagert diese Schwankungen mit Oszillationen von etwa zwei Jahrzehnten. Im Bereich des Nordatlantik gab es von 1950 bis 1969 eine Naturwissenschaftliche Rundschau | 59. Jahrgang, Heft 3, 2006 Kins: Das Hurrikan-Rekordjahr 2005 – Eine Bilanz Vorboten oder Folge des Klimawandels? Natürlich drängt sich bei gehäuft auftretenden starken Hurrikanen die Frage auf, ob deren Zunahme eine Folge des Klimawandels ist. Diese Frage ist heute noch nicht mit einem eindeutigen Ja oder Nein zu beantworten. Sicher ist, dass die Entstehung von Hurrikanen von der Temperatur der Meeresoberflächen abhängt und sicher ist auch, dass sich die tropischen Ozeane in den letzten 30 Jahren um rund 0,5 Grad erwärmt haben. Klimamodelle geben aber keine eindeutigen Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Stürme und den steigenden Wassertemperaturen. Das deckt sich mit den Analysen von Peter Webster und seiNaturwissenschaftliche Rundschau | 59. Jahrgang, Heft 3, 2006 100 Anzahl der Wirbelstürme Phase mit überdurchschnittlich vielen Hurrikanen, zwischen 1970 und 1994 traten dagegen ausgesprochen wenige auf, und seit 1995 ist die Zahl der Hurrikane pro Saison wieder höher als der Durchschnitt. Allerdings zeigen neueste wissenschaftliche Arbeiten, dass die Zahl der Kategorie 4- und 5-Stürme signifikant ansteigt. Eine Arbeitsgruppe um Peter Webster (Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA) zählte die Anzahl der tropischen Stürme seit Beginn der Satellitenbeobachtungen in den 1970er Jahren in den Regionen Nordatlantik, West- und Ostpazifik, Südwestpazifik, Nord- und Südindischer Ozean. Die Zeitreihen zeigen zwar die typischen Schwankungen, die auf El Niño-Einflüsse und die Nordatlantik-Oszillation zurückzuführen sind, aber keinen generellen Trend zu mehr und länger andauernden Wirbelstürmen (Abb. 4). Lediglich im Bereich des Nordatlantiks zeichnet sich seit 1995 ein Trend zu mehr Stürmen ab. Webster und seine Kollegen untersuchten ebenfalls die Veränderung der Hurrikan-Intensität, indem sie die Anzahl der Hurrikane der unterschiedlichen Kategorien zählten. Das Ergebnis zeigt, dass die Zahl der Kategorie 1-Hurrikane über die letzten 30 Jahre konstant blieb, doch nahm ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Hurrikane ab. Kategorie 2- und 3-Stürme blieben sowohl in der Zahl als auch dem prozentualen Anteil nach mehr oder weniger konstant. Die Zahl der Hurrikane der Kategorie 4 und 5 allerdings hat sich seit den 1970er Jahren nahezu verdoppelt und ihr prozentualer Anteil von 20% auf 35% erhöht (Abb. 5). Zu dem gleichen Ergebnis kommt Kerry Emanuel (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA), allerdings auf einem vollkommen anderen Weg. Er entwickelte eine Formel, mit der er die zerstörerische Wirkung der Wirbelstürme berechnete. In die Formel gehen die Windgeschwindigkeit, der Radius des Wirbelsturms sowie die Dauer des Sturms ein. Daraus schätzt Emanuel die Energiemenge ab, die ein Wirbelsturm freisetzt. Diese Analysen reichen im Nordatlantik bis 1930 zurück und im Nordpazifik bis 1950. Die Zeitreihen zeigen ebenfalls deutlich die hohe Variabilität der Hurrikane, die mit Veränderungen der Meeresströmungen verknüpft sind. Seit Mitte der 1970er Jahre ist allerdings die freigesetzte Energiemenge pro Wirbelsturm deutlich angestiegen: Sowohl im Nordatlantik als auch im Nordpazifik hat sich die zerstörerische Kraft der tropischen Wirbelstürme nahezu verdoppelt. 80 Hurrikane und Stürme 60 Hurrikane 40 tropische Wirbelstürme 20 0 70 75 80 85 90 95 00 05 Jahr Abb. 4. Zahl der tropischen Stürme weltweit seit 1970. Kurzperiodische Schwankungen werden dem Einfluss von El Niño zugeschrieben. Nach [1] Abb. 5. Die Zahl der stärksten Hurrikane steigt weltweit. Nach [3] nen Kollegen, die im Atlantik mehr Stürme bei wärmerem Wasser fanden, im Nordwestpazifik jedoch weniger Stürme bei ebenfalls steigenden Temperaturen. Andererseits sagen die meisten Modelle stärkere Stürme voraus, wenn sich das Klima erwärmt. Das würde sich mit den Analysen von Emanuel und Webster et al. decken, doch ist die bisher gemessene Erwärmung von 0,5 Grad zu gering, um schon heute einen Effekt zu zeigen. Nach den Modellen sollte die maximale Windgeschwindigkeit mit jedem Grad Temperaturzunahme um 5% steigen. Für die beobachteten 0,5 Grad Erwärmung folgen daraus eine Steigerung des Windmaximums von 2 bis 3% und eine Erhöhung der 133 Übersicht freigesetzten Energie um 8 bis 12%. Das ist weit weniger als von Kerry Emanuel beobachtet. Allerdings ist die Oberflächentemperatur nicht die einzige Größe, die den Hurrikan beeinflusst, hinzu kommen noch die Temperaturen der Atmosphäre. Analysen der Atmosphärentemperaturen ergaben, dass sie sich nicht im gleichen Maß erhöhten wie die Wasseroberfläche. Dadurch ist die Temperaturdifferenz zwischen Ozean und Atmosphäre größer geworden. Das bedeutet, dass mehr Wasser verdunstet, was wiederum die tropischen Stürme verstärkt. Doch damit dürften die Hurrikan-Energien auch nur um rund 40% ansteigen und sich nicht verdoppeln. Es ist deshalb anzunehmen, dass nur ein Teil der beobachteten stärkeren Stürme direkt mit der Erwärmung der Erde gekoppelt ist. Der Rest muss auf anderen Einflüssen beruhen, wie zum Beispiel der vertikalen Windscherung oder der Temperatur des Ozeans in größeren Tiefen. Die Windscherung scheint in den letzten 30 Jahren gleich geblieben zu sein, doch gibt es vereinzelt Hinweise, dass die tieferen Wasserschichten wärmer geworden sind. Wirbelstürme wirbeln ja nicht nur auf dem Land alles durcheinander, sondern auch das Meerwasser. Normalerweise gelangt dadurch kühles Wasser aus tieferen Schichten an die Oberfläche, was die Hurrikan-Intensität schwächt. Ist das tiefe Wasser wärmer, fehlt diese Bremse jedoch. Allerdings ist längst noch nicht genug über die HurrikanEntstehung bekannt. Das belegen deutlich zwei Wirbelstürme, die nach den heutigen Kenntnissen der Wissenschaft eigentlich „unmöglich“ sind. Am 28. März 2004 ging rund 800 km südlich von Rio de Janeiro der erste Hurrikan an der südamerikanischen Küste an Land. Einen Namen hat er nie erhalten, da niemand mit einem Wirbelsturm in diesem Teil der Welt gerechnet hat. Entwickelt hatte er sich aus einem Tiefdruckwirbel über dem Südatlantik, der nordwärts in tropische Regionen wanderte. Über nur 25 Grad warmem Wasser entwickelte sich dann das Tief zu einem Hurrikan der 134 Kategorie 1. Bereits im Jahr 2003 nahm ein anderer Hurrikan eine ungewöhnliche Route. Er wanderte von den Bermudas nach Norden bis in die kanadische Provinz Nova Scotia und richtete in Halifax große Schäden an. Er gilt heute als einer der schlimmsten Stürme der kanadischen Geschichte. Obwohl er lange über die kühleren Wasser des Nordatlantiks zog, wo er eigentlich seine Kraft hätte verlieren müssen, hatte er immer noch Hurrikan-Stärke, als er an Land ging. Die meisten Klimaforscher sehen die Rekord-Saison 2005 noch im Rahmen der natürlichen Schwankungen. Gleichzeitig warnen sie aber davor, die Folgen des Klimawandels zu unterschätzen, denn spätestens Ende des Jahrhunderts sollen dessen Auswirkungen deutlich zu spüren sein. Das heißt, die Zahl der besonders zerstörerischen Hurrikane sollte weiter steigen und die Regionen, die von tropischen Wirbelstürmen heimgesucht werden, sollten weiter zunehmen. Schon in den letzten 20 Jahren sind die Ozeanflächen, die wärmer als 26 Grad werden, um 15% gewachsen, was die Entstehungsregionen von Hurrikanen erweitert. Literatur [1] P. J. Webster et al., Science 309, 1844 (2005). – [2] K. Emanuel, Nature 436, 686 (2005). – [3] R. A. Kerr, Science 309, 1807 (2005). – [4] J. Travis, Science 309, 1656 (2005). – [5] www.noaa.gov (viele Links zu anderen Hurrikan-Seiten). – [6] www.nhc.noaa.gov. – [7] www.mpimet.mpg.de. – [8] http://severe.weather.org. – [9] www.g-o.de Dr. Lucia Kins (Jahrgang 1955) studierte Meteorologie in Frankfurt a. M. und promovierte an der Universität Köln in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich. Ihr Forschungsschwerpunkt bis heute ist die Atmosphärenchemie, speziell der Einfluss der Meteorologie auf Verteilung, Abbau und Trends reaktiver Spurengase in der Atmosphäre. Sie ist heute freie Mitarbeiterin in der Ozonforschungsgruppe des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeissenberg und wissenschaftliche Angestellte der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus GmbH. Winzererstr. 140, 80797 München. Naturwissenschaftliche Rundschau | 59. Jahrgang, Heft 3, 2006