Altern und Demenz bei Menschen m. intellekt. Beeintraechtigung
Werbung
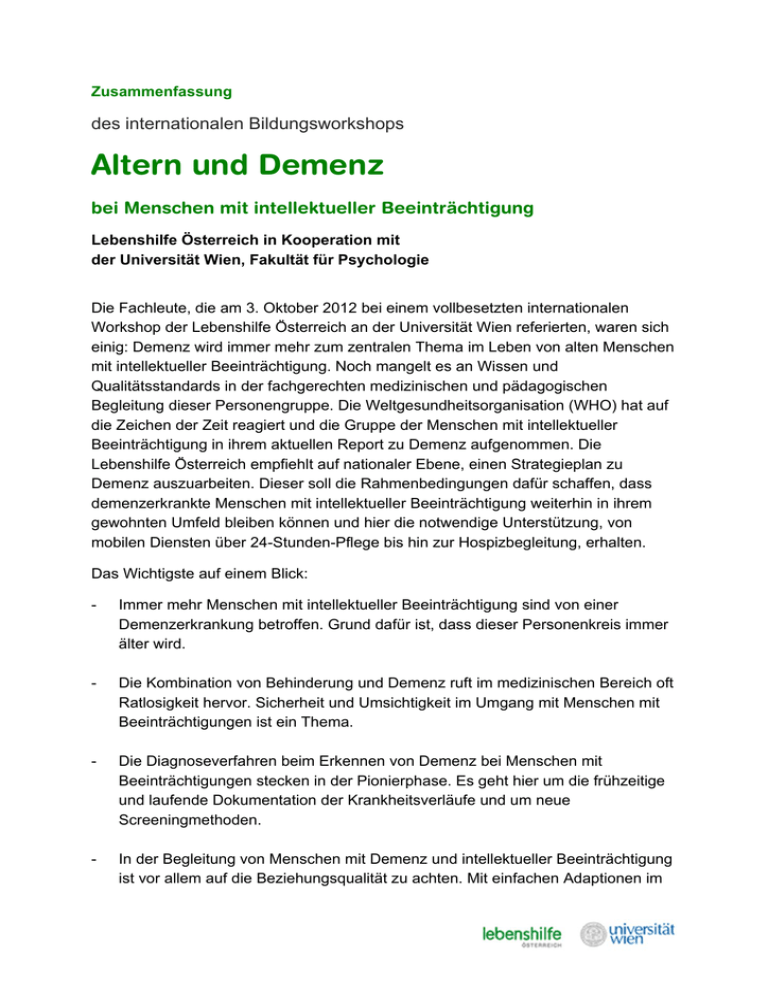
Zusammenfassung des internationalen Bildungsworkshops Altern und Demenz bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Lebenshilfe Österreich in Kooperation mit der Universität Wien, Fakultät für Psychologie Die Fachleute, die am 3. Oktober 2012 bei einem vollbesetzten internationalen Workshop der Lebenshilfe Österreich an der Universität Wien referierten, waren sich einig: Demenz wird immer mehr zum zentralen Thema im Leben von alten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Noch mangelt es an Wissen und Qualitätsstandards in der fachgerechten medizinischen und pädagogischen Begleitung dieser Personengruppe. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat auf die Zeichen der Zeit reagiert und die Gruppe der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in ihrem aktuellen Report zu Demenz aufgenommen. Die Lebenshilfe Österreich empfiehlt auf nationaler Ebene, einen Strategieplan zu Demenz auszuarbeiten. Dieser soll die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass demenzerkrankte Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und hier die notwendige Unterstützung, von mobilen Diensten über 24-Stunden-Pflege bis hin zur Hospizbegleitung, erhalten. Das Wichtigste auf einem Blick: - Immer mehr Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind von einer Demenzerkrankung betroffen. Grund dafür ist, dass dieser Personenkreis immer älter wird. - Die Kombination von Behinderung und Demenz ruft im medizinischen Bereich oft Ratlosigkeit hervor. Sicherheit und Umsichtigkeit im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen ist ein Thema. - Die Diagnoseverfahren beim Erkennen von Demenz bei Menschen mit Beeinträchtigungen stecken in der Pionierphase. Es geht hier um die frühzeitige und laufende Dokumentation der Krankheitsverläufe und um neue Screeningmethoden. - In der Begleitung von Menschen mit Demenz und intellektueller Beeinträchtigung ist vor allem auf die Beziehungsqualität zu achten. Mit einfachen Adaptionen im Wohnumfeld, wie z.B. stärkere Beleuchtung oder Orientierungshilfen, lässt sich die Lebensqualität deutlich verbessern. Zahlen und Fakten: - Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in einem Alter ab 60 Jahren an Demenz erkranken, liegt bei über 60 %. - Bei Menschen mit Down-Syndrom kann die Krankheit sogar schon in ihren Dreißigern oder Vierzigern ausbrechen. - Auswirkungen einer Demenzerkrankung sind grobe Verhaltensänderungen und eine radikaler Gedächtnisabbau. Gerade bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist eine treffsichere Diagnose äußerst schwierig. Meistens müssen zunächst andere Krankheiten ausgeschlossen werden, bis es zu einer eindeutigen Diagnose kommt. Statements: Matthew P. Janicki, Professor an der University of Illinois at Chicago, gab einen Überblick zur aktuellen Situation und verwies auf den Strategieplan des USGesundheitsministeriums „My Thinker´s not working“. Link zur nationalen Strategiegruppe www.aadmd.org Er trat für das „community based living“-Konzept ein, das dezentrale, kleine Wohnformen für die betroffene Personengruppe vorsieht, sogenannte „Small group homes“, wie sie in Japan, Kanada und in den Niederlanden bereits existieren. „Während die durchschnittliche Bevölkerung mit 60 oder 70 Jahren an Demenz erkrankt, können Menschen mit Down Syndrom schon in ihren Vierzigern davon betroffen sein. Viele Betreuungseinrichtungen sind nicht darauf vorbereitet, die Anzeichen einer beginnenden Demenzerkrankung richtig zu deuten. Demenz hat eine dramatische Auswirkung auf erwachsene Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung genauso wie auf deren Familien, Freunde, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in Wohngemeinschaften und natürlich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die wesentlichen Unterstützungs- und Pflegeleistungen erbringen.“ Prof. Dr. Michael Seidel, ärztlicher Direktor bei Bethel.regional v. Bodelschinghsche Stiftungen Bethel, zeigte die Versorgungsproblematik von Menschen mit Beeinträchtigungen in Krankenhäusern auf und sprach sich für mehr Beziehungsgestaltung in der Pflege aus. „Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben eine höhere Anfälligkeit für Demenz. Die Krankheit tritt häufiger als in der Durchschnittsbevölkerung und auch früher in Erscheinung, der Verlauf kann aggressiver sein. Es gibt auch andere Anforderungen für die Alltagsbegleitung und Umweltgestaltung dieser Personengruppe. Die zentrale Herausforderung sind die Verhaltensauffälligkeiten der erkrankten Menschen, wie wiederholtes Fragen, Wahnideen, Illusionen, Schreien etc. Wichtig ist hier, den Menschen die notwendige Wertschätzung entgegenzubringen und sie in ihren vorhandenen Kompetenzen zu ermutigen. Stichworte dazu sind Entschleunigung von Abläufen, Orientierung und Rückzugsmöglichkeiten geben, Überforderung vermeiden, einfache Kommunikation anbieten. Die Pflege ist nicht alleine Handwerk, sie ist vor allem Beziehungsgestaltung. Damit ist Wertschätzung, Geduld, Einfühlungsvermögen und fachliche Kompetenz gemeint. Pflege muss als ein Bestandteil der Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung verstanden werden. Wir haben bei weitem noch keine ausreichende Qualität in der medizinischen Versorgung dieser Patientinnen und Patienten und stehen vor riesigen versorgungspraktischen Problemen – zu wenig spezialisierte Abteilung in den großen Krankenhäusern. Die wenigen Strukturen, die es gibt, sind finanziell bedroht.“ Dr. Sylvia Carpenter, Psychiaterin aus Bristol, referierte über die Tücken der diagnostischen Abklärung und Qualitätsstandards zur Demenzversorgung in Großbritannien. „Menschen mit Down Syndrom können schon ab 30 Jahren an Demenz erkranken. Was sind die ersten Anzeichen? Die Diagnose ist eine sehr komplexe Angelegenheit, wir haben medizinische und psychiatrische Aspekte zu berücksichtigen. Bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind es die Verhaltensstörungen, die Persönlichkeitsveränderungen, die überhöhte Reizbarkeit, die zuallererst auffällt. Erst später bemerkt man den Gedächtnisverlust. „Nicht was man nicht mehr tun kann ist wichtig, sondern was man noch tun kann. Der Blick richtet sich auf die Ressourcen und die Fähigkeiten. Eine umfassende, systematische medizinische Abklärung ist zentral, so früh wie möglich damit beginnen, ab den 30. Lebensjahr, und über einen längeren Zeitraum.“ Schlüsselpunkte bei der Diagnose: - Die Pfleger, Behindertenbetreuer und nahe Angehörige sind die ersten, die die Anzeichen erkennen. Sie sind für die Diagnoseerstellung von enormer Bedeutung, denn sie kennen den Menschen am besten. - Die Abklärung ist multiprofessionell und mehrdimensional: medizinisch (Ausschließungsmechanismus), psychiatrisch (Depressionen, Angstgefühle, Wahnideen, Psychosen, Persönlichkeitsveränderung), sozial (Veränderungen in der Arbeit oder beim Wohnen, Verlust der Eltern oder naher Angehöriger können Verhaltensänderungen auslösen). - Diagnose ist schwieriger, weil sich die Menschen in der Regel weniger gut ausdrücken können und die Medizinerinnen und Mediziner mehr ins Detail gehen müssen. - Die Dokumentation sollte im Alter von 30 Jahren beginnen, um Veränderungen im Zeitablauf zu erkennen. Eine exakte Diagnose kann erst nach Jahren erstellt werden. Kernpunkte für eine verbesserte Lebensqualität: - gute Frühdiagnostik - Maßgeschneiderte Hilfe, Würde und Respekt, den Mensch sehen und nicht die Erkrankung - Qualitätsstandards: Aufklärungskampagnen und Training für Angehörige, Menschen mit Beeinträchtigungen und Helfer Primar Univ.-Prof. Dr. Josef Marksteiner, ärztliche Leiter Psychiatrie und Psychotherapie, Landeskrankenhaus Hall in Tirol, plädierte dafür, dass Demenz bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zum zukünftigen Thema für den europäischen Alzheimer-Kongress wird und betonte die Problematik der unterschiedlichen Kostenträgersituation in den Bundesländern. Er setzte den Schwerpunkt seines Referates auf die Diagnose. „Die Aufenthaltsdauer in der Psychiatrischen Klinik beträgt 10 Tage, das ist für eine gute Diagnoseerstellung ein großes Problem. Die Zeit, um gut abklären zu können, geht verloren. Damit besteht die Gefahr, dass sich die Psychiatrie in diesem Bereich zurückzuzieht. Gute Diagnosezentren wären Memory Kliniken, das sind spezialisierte Einheiten mit einem multiprofessionellen Team. Der Anteil der hier behandelnden Menschen mit Beeinträchtigung liegt unter 5%, also eine Minderheit. Es gibt kein etabliertes, standardisiertes Protokoll und keine Basisdokumentation wie in England, hier muss man weiterarbeiten und einen österreichweiten Aufruf starten, dass es notwendig ist, damit zu beginnen. Die Alzheimer Gesellschaft könnte hier als Partner eingeschaltet werden. Es dauert lange, bis es zur Diagnose kommt, weil viele Aspekte sind abzuklären sind, meist im Ausschlussverfahren. Die Forschung widmet sich bereits mit dem Thema.“ Dr. Michael Splaine, Berater bei Alzheimer Disease International, brachte den menschenrechtlichen Aspekt in die Diskussion mit hinein. „Demenz betrifft weltweit 115 Millionen Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrem Report über Demenz erstmals die Zielgruppe der Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen erwähnt. Auch in der Politik bekommt dieses Thema immer mehr Relevanz. So gibt es bereits in einigen europäischen Ländern nationale Alzheimer Pläne. Es haben sich sogenannte „Friendly Communities“ gebildet, die sich auf gemeindenahe Unterstützung für ältere und kranke Menschen spezialisieren. Praxisbeispiele in der Begleitung von Menschen mit Alzheimer und intellektueller Beeinträchtigung: Das schottische Modell von Karen Watchman wurde von Mag. Elisabeth Zeilinger und Mag. Andreas Kocman, beide von der Universität Wien, präsentiert. Sie gaben den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in die Welt von Menschen mit Beeinträchtigungen und Demenz und brachten Anregungen für den Arbeitsalltag in der Behindertenhilfe. Wichtige Faktoren im Umgang mit demenzerkrankten Menschen mit Beeinträchtigungen sind: Sich immer vor Augen zu halten, dass die Betroffenen sich nicht anders verhalten können Alle Personen im Betreuungsteam verfolgen das gleiche Konzept in der Realität der Person bleiben Biographiearbeit - Kommunikation vor dem Hintergrund der persönlichen Vergangenheit. Hintergrundwissen ist notwendig, das sonst die Gefahr besteht, traumatische Erfahrungen auszulösen Für jedes herausforderndes Verhalten gibt es einen Grund, die betreffende Person sieht darin einen Sinn. Zu einer Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten führt eine entsprechende Gestaltung des Umfelds: Hinweise, Schilder, Piktogramme, Tischtücher ohne ablenkende Muster, klare Kontraste bei Tellern, damit das Essen gut sichtbar ist, Vermeiden von zu lauter Musik und zu viel akustische Einflüsse Das Wohnhaus für Seniorinnen und Senioren der Lebenshilfe Wien wurde von Mag. Werner Trojer, Heilpädagogischer Geschäftsführer, vorgestellt. 19 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung werden in der Nauschgasse im 22. Bezirk in Wien von einem multiprofessionellen Team in einem 2:1 Betreuungsschlüssel begleitet. 2 Personen leben mit einer Demenz und sind gut in das Gruppengeschehen integriert, sie brauchen keine zusätzliche Assistenz. Der Bau des Wohnhauses wurde notwendig, da die anderen Häuser teilweise die Kriterien zur Barrierefreiheit nicht erfüllen und eine Unterbringung im Pflegeheim abgelehnt wurde. Daten und Details zum pflegerischen Konzept können der Präsentation entnommen werden. Das Wohnhaus Söding der Lebenshilfe Graz und Umgebung Voitsberg wurde von Gertraud Fließer, der Wohnhausleiterin, präsentiert. Sie betonte folgende Aspekte: Durch bauliche Adaptierungen, wie eine stärkere Beleuchtung, sind die Stürze um 70% zurückgegangen. Flexible Strukturen in der Tagesbegleitung und auch im Nachtdienst sind notwendig. Mitarbeiter müssen kleine Zeichen im Verhalten erkennen können, sollen in ihrer Haltung Ruhe, Sicherheit und Gelassenheit vermitteln. Die Kommunikation erfolgt oft nur über Blicke, Gesten, stabile Berührungen Die Begleitung setzt hohe fachliche Kompetenz, Flexibilität und Kreativität voraus Einige Stimmen zur Diskussion rund um die Zusammenarbeit von Medizin und Behindertenhilfe: „Es war nicht einfach, einen Hausarzt für die Klientinnen und Klienten zu finden, das ist eine Erfahrung, die wir generell machen. Da steckt dahinter, dass die Ärzte zu wenig Wissen über Behinderung haben, und sie werden mit dem Unwissen alleine gelassen.“, Werner Trojer „Die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern ist schwierig, Menschen mit Behinderungen werden nicht so gerne aufgenommen. Wir suchen aktiv und bewusst eine Kooperation mit einem Krankenhaus.“, Gertraud Fließer „Die Kundinnen und Kunden sollen aufgeklärt werden, damit sie den Verlauf ihrer Erkrankung nachvollziehen können. Wir sollten sie in das Wissen und in die Verantwortung holen.“, Martin Hochegger „Es ist wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte mit beeinträchtigten Menschen gut umgehen und das gerne machen. Das Problem besteht darin, dass sie für die Untersuchung des Personenkreises zu wenig ausgebildet sind. Der Verein VUP Austria wurde gegründet, um hier entgegenzuwirken“, Dr. Maria Bruckmüller Univ.-Prof. Dr. Germain Weber, Präsident der Lebenshilfe Österreich und Hauptinitiator des Workshops, fasste die Ergebnisse zusammen und betonte, wie wichtig es ist, die Ärzteschaft in die Diskussion mit einzubeziehen und die Berufsgruppe der Neurologen für dieses Thema zu gewinnen. Die Lebenshilfe hat ein großes Interesse daran, sich an der Weiterentwicklung von Untersuchungsmethoden und Instrumentarien zu beteiligen und mit der Gesellschaft für Down-Syndrom und der Alzheimer- Gesellschaft zusammenzuarbeiten. Gesundheit ist eines der Schwerpunktthemen für das nächste Jahr und es laufen bereits einige Forschungsprojekte dazu in Kooperation mit der Universität Wien. Weber lobt die Pionierarbeit in der Begleitung von älteren Menschen mit Demenz und intellektueller Beeinträchtigung, die in der Steiermark und in Wien geleistet wird und streicht einmal mehr den Aspekt der Beziehungsarbeit in der Pflege hervor. Kontakt: Eva Schrammel Lebenshilfe Österreich Telefon 01 812 26 42 79 Email [email protected]
