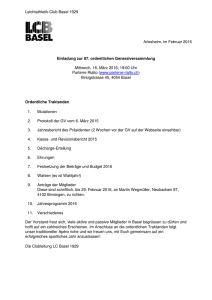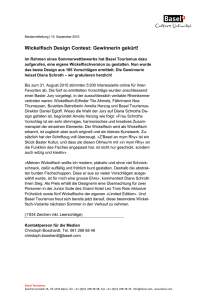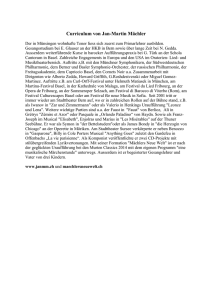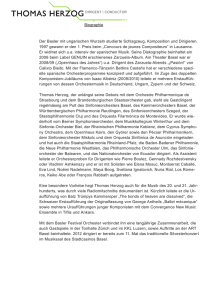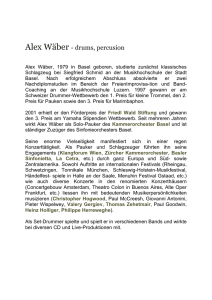Die Tür zur Nanowelt - Swiss Nanoscience Institute
Werbung

NeuöZürcörZäitung FORSCHUNG UND TECHNIK Mittwoch, 9.August 2006 Nr. 182 7 Silizium 7x7 (111) Aufgenommene Kurven Kartonmodell Computer-bearbeitetes Bild NZZ Eine der ersten Rastertunnelmikroskop-Aufnahmen zeigt einzelne Atome einer Siliziumoberfläche (links). Das Rasterkraftmikroskop ermöglicht auch die Abbildung von biologischen Proben. Im Bild (Mitte) in Reihen angeordnete Rhodopsin-Moleküle aus der Netzhaut einer Maus. Mit dem Rastertunnelmikroskop kann man Xenonatome gezielt auf einer Nickeloberfläche placieren (rechts). BILDER IBM / UNIVERSITÄT BASEL / IBM Die Tür zur Nanowelt Erfindung des Rastertunnelmikroskops vor 25 und des Rasterkraftmikroskops vor 20 Jahren Mit dem Rastertunnelmikroskop stiessen Heinrich Rohrer und Gerd Binnig vor 25 Jahren die Tür zur Nanowelt auf. Dieses Jubiläum wurde vergangene Woche in Basel mit einer Konferenz gewürdigt. Eigentlich suchten Gerd Binnig und Heinrich Rohrer vom IBM-Forschungslabor in Rüschlikon bloss nach einem geeigneten Instrument, um Unregelmässigkeiten in dünnen Oxidschichten auf Metalloberflächen zu studieren. Und weil sie keines fanden, beschlossen sie, kurzerhand selbst eines zu bauen. Dies gipfelte 1981 in einem Gerät, mit dem man sogar einzelne Atome sichtbar machen kann – dem Rastertunnelmikroskop. Damit war der Grundstein für die Erforschung von Strukturen im Nanometerbereich gelegt. Schon 1986 wurden die beiden Wissenschafter mit dem Nobelpreis für Physik belohnt; im selben Jahr entstand auch das konzeptionell ähnliche Rasterkraftmikroskop. Zur Feier dieser Jubiläen fand vergangene Woche in Basel eine grosse internationale Konferenz zu Nanowissenschaften und -technologie statt, begleitet von einer Fachmesse und einer Ausstellung für die Öffentlichkeit. Eine experimentelle Meisterleistung Das Grundkonzept des Rastertunnelmikroskops ist einfach: Eine sehr scharfe Spitze rastert die Oberfläche eines Materials Zeile für Zeile ab, ähnlich wie die Nadel eines Plattenspielers. Der Abstand zwischen Spitze und Probe ist dabei so gering, dass die Elektronenwolken der Atome sich berühren. Liegt zwischen der Probe und der Spitze eine geringe elektrische Spannung an, so können Elektronen aus den Atomen an der Oberfläche der Probe aufgrund quantenmechanischer Gesetzmässigkeiten in die Spitze «tunneln». Es fliesst ein schwacher, aber messbarer Strom, der umso grösser ist, je näher die Spitze der Oberfläche kommt. Meist wird das Mikroskop so betrieben, dass die Distanz zwischen Oberfläche und Spitze konstant gehalten wird. Diese zeichnet auf ihrem Weg die Topographie der Probenoberfläche nach. Aus den einzelnen Linien kann man dann ein dreidimensionales Bild von der Oberfläche zusammensetzen. Was im Prinzip simpel klingt, ist experimentell äusserst anspruchsvoll. Schon kleinste Vibrationen können die Messung empfindlich stören. Eine der Hauptaufgaben von Binnig, Rohrer und ihrem Mitarbeiter Christoph Gerber war es deshalb, das Instrument vor Erschütterungen zu schützen. Zudem entwickelten und erprobten sie für die genaue Positionierung der Spitze eine Steuerung aus Piezokeramik und verbesserten die Form und Schärfe der Spitze mehrfach. Schon 1981 gelang es ihnen, erste topographische Bilder aufzuzeichnen. Erst mit der Darstellung der Oberfläche von Silizium entlang einer bestimmten KristallgitterRichtung (von den Fachleuten 7×7 Si[111] genannt) im Jahr 1982 liessen sich aber auch die skeptischen Kollegen von der Kraft des neuen Mikroskops überzeugen (siehe Bild). Die Messung stimmte nämlich sehr gut mit der theoretischen Vorhersage überein. Um das Resultat auch dreidimensional erfassbar zumachen, bastelten die IBM-Forscher mit Schere, Nägeln und Karton ein Reliefmodell. Dieses erhielt an einem Fachkongress den Preis für die beste Gestaltung – eine humoristische Geste der Veranstalter. Die Resul- INHALT Forschung und Technik 9 Weiterer Versuch zur Entsorgung von CO2 9 Junge Weibchen wichtig für Orca-«Netzwerke» 9 Hinweise auf Weisswein im alten Ägypten Verantwortlich für «Forschung und Technik»: Redaktion Wissenschaft redaktion.wissenschaftnzz.ch tate aus Rüschlikon aber wurden ernst genommen. Und der Nobelpreis folgte auf dem Fuss. Biologische Proben sichtbar machen Was den Durchbruch des Rastertunnelmikroskops unterstützte, war laut Gerber die parallele Entwicklung des Computers, mit dem sich die Messungen zu gut interpretierbaren Bildern verarbeiteten liessen. Rasch sprangen nun viele andere Forscher auf den «RastermikroskopieZug» auf. Binnig, Gerber und ihrem Kollegen Calvin Quate von der Stanford University in Kalifornien gelang es schon 1986, ein weiteres, ähnliches Mikroskop zu entwickeln, das Rasterkraftmikroskop. Dieses misst nicht den Tunnelstrom, sondern die Kraft zwischen Spitze und Probe. Weil kein Strom fliessen muss, eignet sich das Mikroskop auch für die Abbildung von elektrisch isolierenden Materialien. Auch Kunststoffe und biologische Proben – wie etwa Ensembles von Lichtrezeptor-Molekülen aus der Netzhaut von Mäusen (siehe Bild) – können so sichtbar gemacht werden. Seither werden die Rastermikroskope stetig verfeinert, das zeigte auch die grosse Auswahl an Modellen an der Fachmesse in Basel. So kann man heute zum Beispiel einzelnen Molekülen bei ihrer Bewegung zuzuschauen, was Flemming Besenbacher von der Universität Aarhus an der Konferenz durch «Filme» von Wassermolekülen auf einer Titandioxid-Oberfläche demonstrierte. Und auch die Auflösung konnte für Rastertunnelmikroskope in vertikaler Richtung auf bis zu 0,01 Nanometer gesteigert werden. Leider aber, so sagte Quate in Basel, sei ein Mikroskop, das hohe Auflösung und Schnelligkeit vereine, noch nicht erfunden. Daran gelte es zu arbeiten. Hans-Joachim Güntherodt von der Universität Basel schwebt zudem ein Mikroskop vor, das die Probe mit mehreren Spitzen simultan von allen Seiten abtastet und so eine Rundum-Ansicht gewährt. Hanna Wick Schaltende Moleküle für die Elektronik der Zukunft Die Erfindung des Rastertunnelmikroskops war für die Nanowissenschaften nicht nur deshalb von Bedeutung, weil damit kleinste Strukturen sichtbar gemacht werden können, sondern auch, weil man diese damit gezielt manipulieren kann. Erstmals gelang dies dem Amerikaner Don Eigler im Jahr 1990: Er placierte einzelne Xenonatome auf einer Nickeloberfläche und formte daraus die Zeichen «IBM», eine Hommage an seinen Arbeitgeber, das IBM-Forschungslabor Almaden in San José, Kalifornien (siehe Bild). Damit rückte die Konstruktion von Nanostrukturen in den Bereich des Möglichen. Bald war die Rede von elektrischen Schaltkreisen aus einzelnen Atomen, tausendmal kleiner als die Siliziumbauteile in heutigen Computern. Doch diese hohen Erwartungen haben sich bisher nicht erfüllt. Eine kommerziell nutzbare Technologie dieser Art, so sagte Eigler in Basel, sei noch lange nicht in Sicht. Zu langsam sei die präzise Positionierung der Atome, zu sauber müssten die verwendeten Oberflächen sein. Fortschritte in der Grundlagenforschung «Machbarkeit ist nicht mehr die zentrale Frage» Im Gespräch mit dem Schweizer Nobelpreisträger Heinrich Rohrer Heinrich Rohrer wurde 1986 gemeinsam mit Gerd Binnig für die Erfindung des Rastertunnelmikroskops mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die NZZ hat den 73-jährigen «Vater der Nanotechnologie» am Rande einer internationalen Konferenz in Basel zum Gespräch getroffen. Die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops und die Sichtbarmachung von einzelnen Atomen wurden von vielen Ihrer Kollegen als unmöglich betrachtet. Waren Sie selbst schon zu Beginn überzeugt, dass es klappen würde? Heinrich Rohrer: Wenn wir nur eine 50-prozentige Erfolgschance gesehen hätten, hätten wir gar nicht mit der Entwicklung des Rastertunnelmikroskops angefangen. Wir sahen keine Probleme, die grundsätzlich nicht lösbar gewesen wären. Die grösste Hürde mentaler Art war, dass sich noch nie jemand daran gewagt hatte. Mit welchem Resultat gelang es Ihnen schliesslich, Ihre skeptischen Kollegen zu überzeugen? Auf einer breiteren Basis war das die Darstellung der 7×7-Struktur von Silizium (siehe Bild). Sie ist bis heute eines meiner Lieblingsbilder. Gedruckt auf Aluminiumpapier, ergab sie ein zauberhaftes Muster. Wir dachten damals sogar daran, ob man das nicht als Stoffmuster brauchen könnte. Die Mitarbeiterinnen in unserem Labor sind dann aber nicht darauf eingestiegen. Und so haben wir es leider bleiben lassen. Ahnten Sie damals, dass Ihnen dieses Bild einen Nobelpreis einbringen würde? Nein, so weit dachte ich gar nicht, obwohl das Wort Nobelpreis schon sehr früh fiel. Als ich Gerd 1981 auf eine Tieftemperatur-Konferenz in Kalifornien schickte, kam am Schluss von seinem Vortrag der Chairman zu ihm und sagte: «Herr Binnig, ich gratuliere Ihnen, das gibt sicher einen Nobelpreis.» Ich denke, ein Nobelpreis ergibt sich einfach. Ihn sich als Ziel zu setzen, ist verkehrt. Hätten Sie gedacht, dass die Nanowissenschaften mit Ihrer Erfindung so ins Rollen kommen? Nein, nicht in dem Mass. Dass man mit dem Rastertunnelmikroskop kleinste Strukturen nicht nur abbilden, sondern auch manipulieren kann, war uns aber schon früh bewusst. In Ihrem Vortrag zu Beginn der Konferenz hier in Basel haben Sie gesagt, dass in der Forschung einige Paradigmenwechsel nötig sind, damit die Nanotechnologie so revolutionär sein kann, wie man es sich erhofft. Was meinen Sie damit? Eine Revolution ist nicht einfach nur eine ausgefeiltere Fortführung von dem, was es schon gibt. Es braucht einen Bruch mit der Vergangen- Zur Person H. W. Heinrich Rohrer wurde 1933 in Buchs, St. Gallen, geboren. Nach der Ausbildung bei so berühmten Wissenschaftern wie Wolfgang Pauli und Paul Scherrer an der ETH Zürich begann er 1955 eine Doktorarbeit im Gebiet der Supraleitung. Ans neugegründete EPA IBM-Forschungslabor in Rüschlikon wurde Rohrer 1963 berufen. Im Jahr 1978 kam auch der damals 31-jährige Gerd Binnig nach Rüschlikon; gemeinsam entwickelten sie darauf das Rastertunnelmikroskop. heit. Das ist eigentlich das A und O der Wissenschaft. Was also wären die Paradigmenwechsel in der Nanowissenschaft und -technik? Einige ergeben sich aus den Möglichkeiten, die die Nanoskala offeriert, denn viele Materialeigenschaften, Prozesse und Gesetze ändern sich grundlegend, wenn man in sehr kleine Dimensionen vordringt. Andere betreffen neue Betrachtungsweisen. Das Atom beispielsweise wird dann zum Individuum, das man gezielt adressieren kann. Oder Nanosysteme, Schaltkreise eingeschlossen, können aus komplexen Molekülen ganz anders aufgebaut werden, als es mit den heutigen Miniaturisierungsverfahren geschieht. War Ihr Vortrag ein Aufruf an Ihre Kollegen? Ja, ich wollte einige grundlegende Aspekte aufbringen. Denn wenn man schon von Nanorevolution redet, dann muss man sich auch überlegen, was es dazu braucht. Man hört heute zum Beispiel viel von elektronischen Schaltkreisen aus Kohlenstoff-Nanoröhren. Deren Leitfähigkeit ist zwar sehr gut, doch das ist irrelevant, wenn man keinen guten Kontakt zu anderen elektronischen Komponenten herstellen kann und diese elektrischen Schaltkreise nicht praktisch und schnell fertigen kann. Ich will die Forscher stimulieren, das, was sie tun, im Kontext zu sehen. Besteht Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass die Nanotechnologie die in sie gesetzten hohen Erwartungen enttäuscht? Von allem, was man von der Nanotechnologie erwartet, kann ich guten Gewissens sagen, dass es das einmal geben könnte. Ich sehe da keine generellen Hürden. Heute ist die Machbarkeit nicht mehr die zentrale Frage. Die zentralen Fragen sind: Wollen wir diese Entwicklungen machen, müssen wir sie machen, und können wir es uns leisten – nicht nur aus finanziellen Gründen? Interview: H. W. Um rasch elektrische Schaltkreise von hoher Komplexität aufzubauen, versucht man deshalb auch, Moleküle zu nutzen, die sich selbst organisieren können. An der Konferenz in Basel, zu der sich vergangene Woche das Who's who der Nanowissenschaften versammelte, wurden in diesem Gebiet unzählige interessante Fortschritte vorgestellt, etwa zu schaltbaren Molekülen. So präsentierte James Heath vom California Institute of Technology in Pasadena einen Datenspeicher, der auf einem schaltbaren Molekül namens Rotaxan basiert. Dieses Molekül, das Heath schon seit einigen Jahren erforscht, nimmt je nach angelegter Spannung zwei unterschiedliche Zustände – «an» und «aus» – ein. Sie entsprechen den für die Datenspeicherung nötigen Zuständen «0» und «1» und repräsentieren ein Bit. Bei der Herstellung des Datenspeichers wird ein Film aus Rotaxan zwischen einer Lage aus hauchdünnen metallischen Drähten einerseits und Drähten aus dem Halbleitermaterial Silizium andererseits angeordnet. Die für den Schaltkreis nötigen Strukturen werden schliesslich in das Drahtgitter hineingeätzt. So sei es gelungen, einen Speicher von 160 000 Bits mit einer BitDichte von 1011 Bits pro Quadratzentimeter zu bauen, sagte Heath in Basel – seines Wissens sei dies der bisher dichteste Datenspeicher überhaupt. Unter Forschern besteht allerdings Uneinigkeit darüber, ob tatsächlich das Rotaxan für die Schaltung verantwortlich ist. Die Interaktion der Moleküle mit den Elektroden, das heisst den Drähten, ist nämlich grösstenteils noch unverstanden. Bekannt ist aber, dass die Schaltung, wenn man anstelle von Siliziumdrähten ebenfalls metallische Drähte einsetzt, dadurch zustande kommen kann, dass die Metallatome auf unkontrollierbare Weise dünne Filamente bilden und so die Lücke zwischen den Elektroden schliessen. Ein einzelnes Molekül auf dem Prüfstand Bei der Untersuchung eines anderen schaltbaren organischen Moleküls wollten Heike Riel und Emanuel Lörtscher vom IBM-Forschungslabor in Rüschlikon sichergehen, dass tatsächlich das Molekül für das Schalten verantwortlich ist. Dank einer ausgeklügelten Versuchsanordnung gelang es ihnen, jeweils nur ein einziges Molekül zwischen zwei etwa einen Nanometer voneinander entfernte Goldspitzen zu bringen. Dann legten sie an die Spitzen eine Spannung an und massen den Strom, der durch das Molekül floss. Bei einer Spannung von 1,6 Volt leitete das Molekül plötzlich viel mehr Strom: Es hatte vom «Aus»- in den «An»-Zustand gewechselt. Legten die Forscher eine Spannung von –1,6 Volt an, so sprang das Molekül wieder in den «Aus»-Zustand zurück. Dies konnte bis zu 500 Mal wiederholt werden. Befand sich ein strukturell sehr ähnliches, aber nicht schaltbares Referenzmolekül zwischen den Spitzen, war keine Zustandsänderung zu beobachten. Für das gemessene Schalten, so sagte Riel in Basel, sei also tatsächlich das schaltbare Molekül verantwortlich. Hanna Wick