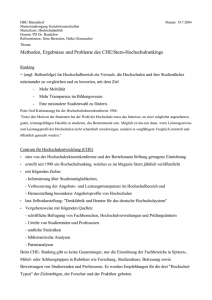Deutschland im internationalen Standortvergleich
Werbung

Allianz Dresdner Economic Research Working Paper Nr.: 90, 12. September 2007 Autoren: Claudia Broyer, Gregor Eder, Wolfgang Leim, Dr. Rolf Schneider _________________________________________________________________ Deutschland im internationalen Standortvergleich 1. Das Wichtigste in Kürze 2 2. Positionsbestimmung auf Basis harter Fakten 3 Box: Wie wird das Standort-Ranking berechnet? 3. Gesamtauswertung: Deutschland aktuell gleichauf mit den USA, klar vor den BRIC-Ländern; kleinere EU-Staaten erzielen beachtliche Resultate 4. Ergebnisse Subindikatoren 4.1 Wirtschaftliche Leistungskraft: Industrieländer unangefochten an der Spitze 4.2 Wirtschaftliche Dynamik: Emerging Markets haben die Nase vorn 4.3 Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen: Deutschland bleibt hinter anderen großen Wirtschaftsnationen zurück 4.4 Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung: Industrieländer mit sehr gemischten Ergebnissen 5 6 7 7 10 12 15 5. Ursachen für Standortschwächen und -stärken 18 6. Fazit und Ausblick: In Deutschland weder Grund zu Missmut noch zu Selbstzufriedenheit 23 Anhang: Jahrestabellen im Überblick 24 1 1. Das Wichtigste in Kürze Alles in allem muss sich der Standort Deutschland im internationalen Vergleich sicherlich nicht verstecken. Dies ist das Ergebnis eines neuen internationalen Standort-Rankings, das von den Volkswirten von Allianz und Dresdner Bank entwickelt worden ist. Die volkswirtschaftlichen Fakten zeigen: So schlecht wie Deutschland lange Zeit wahrgenommen wurde, ist es nicht. International steht die Bundesrepublik derzeit auf Platz 8. Die besten Wirtschaftsstandorte sind der Studie zufolge Schweden, gefolgt von den Niederlanden und Großbritannien. Die Analyse zeigt allerdings auch Schwachstellen in Deutschland: Insbesondere bei Einzelindikatoren wie der Investitionsquote und dem Beschäftigungswachstum schnitt das größte EU-Land bislang schwach ab. Hier besteht ganz offensichtlich noch Verbesserungsbedarf. Eine sich hieraus ableitende wirtschaftspolitische Strategie sollte aber nicht nur darauf abzielen, Schwächen auszumerzen, sondern vielmehr auch darauf, vorhandene Stärken auszubauen. Auch diese Stärken werden im Rahmen dieser Studie klar identifiziert. So schnitt Deutschland beispielsweise bei Einzelindikatoren in den Bereichen „Forschung und Entwicklung“, „Exporttätigkeit“ und „Innovation“ im internationalen Vergleich sehr gut ab. Die hier vorliegende Standortanalyse fußt ausschließlich auf quantitativen Kriterien. Dies unterscheidet sie von anderen internationalen Vergleichen der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortqualität, die oftmals stark auf Umfrageergebnissen basieren. Derartige Meinungsbilder überzeichnen häufig die tatsächliche Entwicklung. Die Studie umfasst neben den wichtigsten Industrienationen auch Polen als größtes neues EU-Land und die sogenannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China. Das Standort-Ranking von Allianz und Dresdner Bank basiert auf 17 Indikatoren, die sich folgenden Teilrankings zuordnen lassen: Wirtschaftliche Leistungskraft, wirtschaftliche Dynamik, Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen (Wirtschaftspotenzial) sowie Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung. Die in der Analyse betrachteten 17 Länder repräsentieren insgesamt rund 80 % der weltwirtschaftlichen Wertschöpfung. Ursache für die zuletzt verbesserte Position Deutschlands ist vor allem, dass sich die Teilindikatoren für die wirtschaftliche Dynamik im Jahr 2006 nach einer längeren Schwächephase wieder deutlich steigern konnten. Insgesamt fallen die guten Ergebnisse kleinerer EU-Staaten beim Gesamtranking sowie die Dominanz der Emerging Markets beim Teilranking „wirtschaftliche Dynamik“ auf. An dieser Dominanz dürfte sich wohl auch auf absehbare Zeit nichts ändern. 2 2. Positionsbestimmung auf Basis harter Fakten Die deutsche Wirtschaft hatte über Jahrzehnte international einen sehr guten Ruf, ab Mitte der neunziger Jahre begann sich ihr Image aber drastisch zu verschlechtern. Mehr und mehr sah man in ihr den kranken Mann Europas. Große strukturelle Rigiditäten wurden ihr zugeschrieben. Seit 2006 in Deutschland aber ein kräftiger Aufschwung eingesetzt hat, wandelt sich die internationale Beurteilung der deutschen Wirtschaft wieder zum Positiven. Ihre Reformen sind bereits als Vorbild für andere europäische Länder im Gespräch. Ist die deutsche Wirtschaft innerhalb von ein, zwei Jahren wieder ein so viel besserer Standort geworden? Oder war sie in den Jahren zuvor gar nicht so schlecht, wie sie bisweilen beurteilt wurde? Diesen Fragen wollen wir im folgenden anhand eines eigenen Standortvergleichs nachgehen. Wir haben uns dafür entschieden, ausschließlich quantitative Indikatoren zu verwenden. Internationale Vergleiche der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortqualität beziehen häufig in starkem Maße Umfrageergebnisse unter Fachleuten und Managern mit ein oder beruhen sogar ausschließlich darauf. Meinungsbilder überzeichnen jedoch gelegentlich die Entwicklung der Fakten. Der von uns entwickelte Standortindikator greift deshalb nicht auf Umfragen zurück. Als Ursachen für Standortschwächen und –stärken sind häufig Faktoren bedeutsam, die nur qualitativ erfassbar sind. Beispielsweise lässt sich die Arbeitsmarktflexibilität oder Regulierungsdichte kaum anhand quantitativer Indikatoren international vergleichen. Für ein Länder-Ranking, das nur die Ursachen von Standortschwächen abbildet, fehlt von daher eine quantitative Grundlage. Demgegenüber lässt sich der Erfolg eines Standorts anhand einer Vielzahl von quantitativen Indikatoren bewerten. Das von uns entwickelte Standort-Ranking beruht deshalb auf Indikatoren für den wirtschaftlichen Erfolg. Auf die Ursachenanalyse gehen wir in ergänzenden Abschnitten ein. Für die Attraktivität und den Erfolg eines Standorts spielen sowohl seine aktuelle wirtschaftliche Leistungskraft als auch seine aktuelle wirtschaftliche Dynamik eine Rolle. Mindestens ebenso wichtig aber dürften die wirtschaftlichen Größen sein, die auf das wirtschaftliche Potenzial eines Landes – also die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen – sowie auf die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung hinweisen. Für das Standort-Ranking haben wir insgesamt 17 Indikatoren ausgewählt, die mittels einer Gleichgewichtung in das Gesamtranking eingehen. Sie ordnen sich den genannten vier Kategorien wie folgt zu: - wirtschaftliche Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit: 2 Indikatoren - wirtschaftliche Dynamik: 3 Indikatoren - Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen: 7 Indikatoren • Sachkapitalbildung • Humankapitalbildung • Forschung und Innovation 3 • - Zuwanderung von Kapital und Arbeitskräften Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung: 5 Indikatoren • nachhaltiger Staatshaushalt • Leistungsbilanzsaldo • ressourcen- und umweltschonendes Wirtschaften. Als Ausdruck der wirtschaftlichen Leistungskraft findet als umfassender Wohlstandsindikator das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner Verwendung. Als Kennzeichen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit kann die Exportkraft einer Volkswirtschaft betrachtet werden. Indikator hierfür ist der Export je Einwohner. Das zentrale Maß für die wirtschaftliche Dynamik einer Volkswirtschaft stellt das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts dar. Es lässt sich definitorisch zerlegen in das Wachstum der Beschäftigung und der Arbeitsproduktivität. Beide Komponenten – Beschäftigung und Produktivität – haben wir in unser Standort-Ranking als Indikatoren aufgenommen, sodass die Entwicklung des Wirtschaftswachstums hierdurch implizit eine Doppelgewichtung erfährt. Als dritter Indikator, der die wirtschaftliche Dynamik anzeigt, geht das Exportwachstum ein. Als Indikatoren für die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen wurden ausgewählt: die Investitionsquote, die tertiären Bildungsabschlüsse in Prozent der Bevölkerung, die Erwerbsquote, die F&E-Ausgaben in Prozent des BIP, die Zahl der Patente je Einwohner, die ausländischen Direktinvestitionen in Prozent des BIP und der Wanderungssaldo von Arbeitskräften. Hinsichtlich der Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung verwenden wir als Indikatoren den staatlichen Schuldenstand und die staatliche Primärverschuldung in Prozent des BIP, den Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP, sowie den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß je BIP-Einheit. Die Verfügbarkeit von Ressourcen und die Ausgewogenheit der wirtschaftlichen Entwicklung sind zukunftsorientierte Faktoren, die mit 12 Indikatoren im Standort-Ranking mit einem klaren Übergewicht vertreten sind. Die aktuelle wirtschaftliche Leistungskraft und Dynamik gehen mit 5 Indikatoren ein. Im Standortwettbewerb stehen die Industrieländer heute nicht mehr allein untereinander; sie müssen sich mehr und mehr mit Emerging Markets als ernsthafte Konkurrenten auseinandersetzen. Von daher reicht es nicht mehr aus, Standortvergleiche auf die Industrieländer zu beschränken. Deshalb haben wir in unser Standort-Ranking die vier bedeutendsten Emerging Markets, die sogenannten BRIC-Länder Brasilien, Russland, Indien und China aufgenommen. Von Seiten der Industrieländer wurden die neun wirtschaftlich größten EU-Länder, Polen als größtes neues Beitrittsland sowie die G7-Länder USA, Japan und Kanada einbezogen. Die in dem Untersuchungskreis berücksichtigten Länder repräsentieren insgesamt gut 80 % der weltwirtschaftlichen Wertschöpfung. 4 Wie wird das Standort-Ranking berechnet? Im Rahmen dieser Studie haben wir 18 Länder (inklusive Euro-Raum) im Hinblick auf ihren wirtschaftlichen Erfolg untersucht und miteinander verglichen. Zu diesem Zweck wählten wir insgesamt 17 quantitative Indikatoren aus, die sich nach unserer Einschätzung dafür eignen, den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes zu beurteilen. Unser Augenmerk lag dabei nicht auf einer statischen Betrachtungsweise, sondern vielmehr darauf, eine Einschätzung darüber zu erhalten, wie sich ein Land bezüglich seiner Standortattraktivität im Zeitablauf relativ zu anderen Ländern entwickelt hat. Zu diesem Zweck wählten wir drei Jahre aus, für die wir die entsprechenden Indikatoren analysierten: 2000, 2003 und 2006. Bei den von uns verwendeten Daten handelt es sich ausnahmslos um Jahreswerte. In einzelnen Fällen lagen Angaben für die von uns ausgewählten Beobachtungszeitpunkte nicht vor. In diesen Fällen wählten wir den nächstgelegenen Beobachtungszeitpunkt aus, für den die Information zur Verfügung stand. Bei den Indikatoren „Zuwanderung von Arbeitskräften“ und „Bildungsabschlüsse“ konnten wir Brasilien, China, Indien und Russland nicht in den Ländervergleich einbeziehen, da uns keine entsprechenden nationalen Daten vorlagen. Wie gelangt man nun konkret zum Ranking? In einem ersten Schritt haben wir für jeden einzelnen Indikator eine Rangliste der betrachteten Länder erstellt. Dasjenige Land mit dem besten Wert bekam den ersten Platz zugewiesen, das zweitbeste Platz 2 und so weiter. Bei Wertgleichheit erhielten die betroffenen Länder dieselbe Platzierung. In einem zweiten Schritt ermittelten wir auf Basis der 17 Einzelrankings die durchschnittliche Platzierung jedes Landes, indem wir dessen Einzelplatzierungen aufaddiert und anschließend durch die Anzahl der Indikatoren geteilt haben. Zu guter Letzt wurden dann alle 18 Länder erneut gemäß ihres ermittelten Durchschnittswertes geordnet, um so das Gesamtranking zu erhalten. Dasjenige Land, das den niedrigsten Durchschnittswert ausweist, landet beim Standort-Ranking dann insgesamt auf dem ersten Platz, dasjenige mit dem höchsten auf dem letzten Platz. Zusätzlich zum Gesamtranking ermittelten wir für verschiedene Untergruppen von Indikatoren weitere Rankings. Zu diesem Zweck haben wir die 17 Einzelindikatoren thematisch in vier Blöcke eingeteilt: wirtschaftliche Leistungskraft, wirtschaftliche Dynamik, Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen sowie Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung. Auch für diese Untergruppen ermittelten wir analog zu dem eben beschriebenen Vorgehen jeweils ein Gruppenranking. Die Zuordnung der einzelnen Indikatoren zu den Untergruppen hat natürlich eine direkte Auswirkung auf das Abschneiden eines Landes bei einer speziellen Untergruppe. Sie hat jedoch keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis, da alle Indikatoren mit dem gleichen Gewicht in die Gesamtbewertung einfließen. 5 3. Gesamtauswertung: Deutschland aktuell gleichauf mit den USA klar vor den BRIC-Ländern, kleinere EU-Staaten erzielen beachtliche Resultate Unangefochtener Sieger unseres Standortvergleichs zu allen drei Beobachtungszeitpunkten ist Schweden. In keinem der vier Teilrankings weist es eine ausgeprägte Schwachstelle auf. Träger der Silbermedaille sind durchweg die Niederlande mit einem gewissen Manko bei der Indikatorengruppe „wirtschaftliche Dynamik“. Großbritannien konnte seine Position verbessern und liegt nun auch auf dem zweiten Rang. Performance-Vergleich der Standorte 2000 2003 2006 Schweden 1 Schweden 1 Schweden 1 Niederlande 2 Niederlande 2 Niederlande 2 Großbritannien 3 Österreich 3 Großbritannien 2 Kanada 4 Spanien 4 Belgien 4 Deutschland 5 Belgien 5 Österreich 5 Japan 6 Japan 6 Frankreich 6 Frankreich 7 Großbritannien 7 Kanada 7 USA 8 Frankreich 8 Deutschland 8 Belgien 9 Deutschland 9 USA 8 Österreich 10 Euro-Raum 10 Euro-Raum 10 Euro-Raum 11 USA 11 Spanien 11 Spanien 12 Brasilien 12 Japan 12 Italien 13 China 13 China 13 Brasilien 14 Russland 14 Brasilien 14 China 15 Kanada 15 Russland 15 Polen 16 Italien 16 Italien 16 Russland 17 Indien 17 Indien 17 Indien 18 Polen 18 Polen 18 Entgegen dem aktuellen Medientenor, wo Frankreich mitunter sogar schon als „neuer kranker Mann“ Europas bezeichnet wurde, schneidet es 2006 an sechster Stelle besser als Deutschland ab, das sich mit den USA Platz 8 teilt. Der deutsche Standort ist gegenüber dem Jahr 2000, als er noch Fünfter in unserer Rangliste war, zurückgefallen. Gegenüber dem neunten Platz 2003 ging es aber zuletzt wieder bergauf. Während sich Deutschland nach dem vorherigen Rückfall bei der wirtschaftlichen Dynamik 2006 deutlich steigern konnte, ist der Abwärtstrend bei der Verfügbarkeit von Arbeit, Kapital und technologischem Wissen noch nicht gestoppt. An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass sich an unserem Ranking ausschließlich ablesen lässt, wie sich ein Standort im Vergleich zu den anderen entwickelt hat. D.h. wir ermitteln keine absolute Performance, sondern orientieren uns am Wettbewerbsgedanken: Wenn alle gut sind, muss man besser sein; in (konjunkturell) schlechten Zeiten sollte man zumindest versuchen, „der Einäugige unter den Blinden“ zu sein. 6 Unter den G3-Ländern erzielt Japan auf Platz 12 gegenwärtig das schwächste Ergebnis, hingegen war es sowohl 2000 als auch 2003 noch Sechster (die Verschlechterung kommt von den Bereichen wirtschaftliche Dynamik sowie Leistungskraft). Auch Spaniens Platzierung weist beträchtliche Schwankungen auf: 2003 lag sie merklich weiter oben als zu den zwei anderen Untersuchungszeitpunkten. Umgekehrt hatte insbesondere Kanada zum mittleren Untersuchungszeitpunkt einen „Durchhänger“ (vorwiegend bedingt durch die Kategorien Leistungskraft sowie Verfügbarkeit von Ressourcen). An dreizehnter Stelle steht China als bestes Schwellenland, nacheinander folgen Brasilien und Russland. Einen enttäuschenden und zugleich alarmierenden sechzehnten Platz in der Gesamtauswertung belegt Italien. Ebenfalls schlechte Zeugnisse erhalten Indien sowie Polen. Insgesamt erscheint schließlich das Abschneiden der kleineren EU-Staaten bemerkenswert: Nicht nur dass Schweden und die Niederlande auf dem Siegerpodest landen, sondern auch Belgien und Österreich liegen an zuletzt vierter bzw. fünfter Stelle gut im Rennen. Dabei mag eine Rolle spielen, dass kleine Volkswirtschaften überschaubarer und die Umsetzungswege der Wirtschaftspolitik dort kürzer sind. Insofern kann ihnen die Gestaltung eines für sie passenden, Erfolg bringenden Wirtschaftsmodells möglicherweise leichter fallen als im Falle großer Länder. Eine genauere Analyse anhand der vier Teilbereiche, die unseres Erachtens Standortqualität ausmachen, erfolgt nun aber in den nächsten Abschnitten. Hier werden sowohl das Gesamtergebnis – wie es zustande kommt, was es aussagt – als auch Auffälligkeiten näher beleuchtet. Dabei ergänzen die Tabellen im Anhang das Stärken-Schwächen-Profil aller untersuchten Länder. 4. Ergebnisse Subindikatoren 4.1 Wirtschaftliche Leistungskraft: Industrieländer unangefochten an der Spitze Unter der wirtschaftlichen Leistungskraft eines Landes verstehen wir im Wesentlichen seinen gesamtwirtschaftlichen Wohlstand, der sich am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner messen lässt. Da bei einem Standortvergleich aber auch die Exportstärke eines Landes, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit, nicht fehlen darf, haben wir die Exporte je Einwohner in die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungskraft mit einbezogen. Bei beiden Indikatoren handelt es sich um Strukturindikatoren. Von daher ist es wenig überraschend, dass sich das Ranking bei dieser Indikatorengruppe im Zeitablauf als recht stabil erweist. 7 Leistungskraft 2000 2003 2006 Niederlande 2 1 1 Schweden 1 1 2 Österreich 5 3 3 Belgien 4 3 4 Kanada 2 10 5 Großbritannien 7 8 6 Deutschland 8 5 7 USA 9 5 7 Entwicklung im Ranking Frankreich 10 8 9 Euro-Raum 12 11 10 Italien 11 11 10 Japan 5 5 10 Spanien 13 13 13 Polen 14 14 14 Russland 15 15 15 Brasilien 15 15 16 China 17 17 16 Indien 18 18 18 Wenig überraschend ist auch, dass die Industrieländer hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft klar besser abschneiden als die Schwellenländer. So sind im Jahr 2006 die ersten dreizehn Plätze allesamt durch Industrieländer belegt. Am besten schneiden die Niederlande ab, die sich 2003 vom zweiten auf den ersten Platz verbesserten und diesen Platz im vergangenen Jahr auch verteidigen konnten. Deutschland rangiert seit dem Jahr 2000 im oberen Mittelfeld und landete im Jahr 2006 auf dem siebten Platz. Dabei sind die Veränderungen bei den einzelnen Indikatoren recht gering: Über den gesamten Beobachtungszeitraum ist eine leichte Verschlechterung beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner festzustellen. Beim zweiten Indikator, den Exporten je Einwohner, hat sich Deutschland im Ranking etwas verbessern können. Ein Aspekt erscheint uns besonders bemerkenswert: Deutschland hat im Hinblick auf sein Wohlstandsniveau im Vergleich mit dem europäischen Durchschnitt spürbar an Boden verloren. Das nominale Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ist in Deutschland nur noch geringfügig höher als im Euro-Raum. Im Vergleich zum Durchschnitt in der „alten“ EU (EU 15) ist es sogar niedriger. Und wie steht die größte Volkswirtschaft der Welt dar? Nachdem sich die USA im Jahr 2003 vom neunten auf den fünften Platz verbessern konnten, haben sie zuletzt wieder etwas an Boden verloren und liegen aktuell auf dem siebten Platz. Interessant ist die ausgeprägte Divergenz bei den einzelnen Indikatoren. Während die USA seit Jahren unangefochten auf dem ersten Platz bezüglich des höchsten Bruttoinlandsprodukts je Einwohner stehen, spiegelt sich die vergleichsweise geringe Exportfähigkeit im schlechten Abschneiden bei den Exporten wider. Hier kommt das Land seit Jahren nur auf den dreizehnten Platz. 8 2000 China Russland Polen EU15 Schweden Euro-Raum Niederlande Spanien Italien Frankreich 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Deutschland Nominales Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro, jeweilige Wechselkurse 2006 Nur bei wenigen Ländern kam es im Zeitablauf zu einer sehr deutlichen Veränderung im Ranking, nämlich bei Japan und Kanada. Interessant dabei ist insbesondere die Entwicklung Japans. Die größte asiatische Volkswirtschaft verlor zwischen 2000 und 2006 kräftig an Boden und fiel in diesem Zeitraum vom fünften auf den zehnten Rang zurück. Das schwächere Abschneiden erklärt sich im Wesentlichen bei einem Blick auf den Indikator Bruttoinlandsprodukt je Einwohner. Hier fiel Japan vom ersten Platz im Jahr 2000 auf den zehnten Platz im vergangenen Jahr zurück. Verantwortlich dafür war neben der Wechselkursentwicklung des Yen gegenüber dem Euro vor allem auch die jahrelange Deflation, die bei eher bescheidenen Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts dafür gesorgt hat, dass das nominale Bruttoinlandsprodukt über längere Zeit allenfalls geringfügig gewachsen ist. Russland schneidet unter den BRIC-Ländern am besten ab. Seit dem Jahr 2000 belegt die größte der ehemaligen Sowjetrepubliken den fünfzehnten Platz. Die Veränderungen bei den beiden Teilindikatoren sind minimal. Lediglich beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner konnte sich Russland zuletzt von dem sechszehnten auf den fünfzehnten Rang verbessern. In absoluten Zahlen ist die Verbesserung deutlich beeindruckender: Zwischen 2000 und 2006 stieg das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner von EUR 1.917 auf EUR 5.476. Das Schlusslicht bei diesem Teilranking ist eindeutig Indien. Bei beiden Indikatoren und zu sämtlichen Beobachtungszeitpunkten rangierte das asiatische Schwellenland an letzter Stelle. Besonders auffallend sind die sehr niedrigen Exporte je Einwohner. Auch wenn die Exportkraft Indiens im internationalen Vergleich nach wie vor sehr niedrig ist, so sollte man dabei aber nicht übersehen, dass sich die indische Exportwirtschaft in den vergangenen Jahren kräftig entwickelt hat. Immerhin haben sich die Exporte je Einwohner zwischen 2000 und 2006, wenn auch von niedrigem Niveau aus, mehr als verdoppelt. Bei den Industrieländern schneidet Spanien am 9 schlechtesten ab. Beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner landet Spanien vor Polen und Russland auf Platz 13. Bei den Exporten belegt das Land seit Jahren den zwölften Platz und liegt damit aktuell hinter Japan. 4.2 Wirtschaftliche Dynamik: Emerging Markets haben die Nase vorn Im Gegensatz zu den Indikatoren, die wir bei der wirtschaftlichen Leistungskraft betrachten, weisen Produktivitätswachstum, Beschäftigungsentwicklung und reales Exportwachstum, also diejenigen Indikatoren, die in unserem Standort-Ranking die wirtschaftliche Dynamik eines Landes widerspiegeln, in der Regel deutlich stärkere Schwankungen im Zeitverlauf auf. Dies bringt natürlich eine spürbar höhere Volatilität der Rankings mit sich. Ein Land, das in einem Jahr zu den besten gehört hat, kann sich möglicherweise angesichts einer negativen konjunkturellen Entwicklung nur wenige Jahre später am unteren Ende der Länderliste wiederfinden. Dynamik 2000 2003 2006 Indien 1 1 1 Polen 2 5 2 China 10 2 3 4 10 4 USA 15 8 5 Großbritannien 12 8 6 Brasilien 17 5 7 Deutschland 10 17 8 Russland 8 3 9 Euro-Raum 5 14 10 Spanien 8 4 10 Belgien Entwicklung im Ranking Schweden 12 12 12 Frankreich 2 14 12 Japan 6 5 12 15 16 12 6 11 16 Österreich 18 13 17 Italien 14 18 18 Niederlande Kanada Wie nicht anders zu erwarten führen die Emerging Markets das Ranking klar an. Im Jahr 2006 sind die ersten drei Plätze durch Schwellenländer belegt: Auf Platz 2 und 3 liegen Polen und China. Indien, das bei der wirtschaftlichen Leistungskraft durchweg auf Platz 18 landete, kommt in Sachen Dynamik zu jedem der drei Beobachtungszeitpunkte auf den ersten Platz. Das beste Industrieland war im Jahr 2006 Schweden auf Platz 4. Da nahezu alle Länder im Zeitverlauf kräftige 10 Rankingsprünge zu verzeichnen hatten, soll an dieser Stelle nur auf einige besonders auffällige Bewegungen eingegangen werden. Das Ranking Deutschlands gleicht beispielsweise einer Achterbahnfahrt: Auf den regelrechten Absturz vom zehnten auf den siebzehnten Platz im Jahr 2003 folgte ein Sprung auf den achten Platz im vergangenen Jahr. Besonders deutlich fiel zuletzt die Verbesserung bei der Arbeitsproduktivität aus, bei der Deutschland im Vergleich zu 2003 sechs Plätze gutmachen konnte. Nichts bewegte sich hingegen in Sachen Beschäftigungswachstum, zumindest was die Platzierung angeht: Nach wie vor nur der siebzehnte Platz. Angesichts eines Plus von 0,6 % im vergangenen Jahr ist das zunächst erstaunlich. Wenn man sich allerdings vor Augen führt, dass der Durchschnitt im Euro-Raum sogar bei 1,4 % gelegen hat, erscheint die Platzierung durchaus plausibel. Arbeitsproduktivität (reales BIP pro Beschäftigten) Veränderung gegenüber Vorjahr in % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 Deutschland Frankreich 2000 Italien 2003 Spanien Euro-Raum 2006 Am schlechtesten schneidet im Ländervergleich Italien ab. Seit 2003 liegt das Land auf dem achtzehnten Platz. Während der Beschäftigungsaufbau seit Jahren recht kräftig ist, entwickeln sich Produktivität und reale Exporte nur sehr schwach. Ein Produktivitätsproblem hat auch Spanien, das bei diesem Indikator im vergangenen Jahr auf dem achtzehnten Platz landete. Während die Produktivität im Euro-Raum um 1,3 % anstieg, ging sie in Spanien um 0,2 % zurück. 2003 belief sich das Minus sogar auf 0,9 %. Interessant ist auch die Entwicklung Japans: Trotz der konjunkturellen Erholung der vergangenen Jahre hat sich das Ranking der japanischen Volkswirtschaft spürbar verschlechtert. Lag das Land im Jahr 2003 noch auf dem fünften Platz, ist es in der Zwischenzeit auf den zwölften Rang zurückgefallen. Dies liegt jedoch weniger an den tatsächlichen Entwicklungen in der japanischen Wirtschaft, als vielmehr daran, dass sich relativ betrachtet andere Länder deutlich besser entwickelt haben. 2003 ging die Beschäftigung in Japan noch zurück. 2006 konnte mit einem Plus von immerhin 0,4 % eine leichte Verbesserung erzielt werden. Trotz11 dem verlor Japan in diesem Zeitraum vier Plätze, weil eben die Entwicklung in anderen Ländern deutlich positiver verlaufen ist. Aber genau das soll ja auch in einem Standort-Ranking zum Ausdruck kommen: Die Attraktivität eines Standorts im relativen Vergleich mit anderen Ländern. Was ist das Fazit der doch teils recht unterschiedlichen Ergebnisse im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungskraft und die wirtschaftliche Dynamik der betrachteten Länder? Die Schwellenländer befinden sich in einem sehr dynamischen Aufholprozess. Das Abschneiden der Emerging Markets bei der Bewertung der wirtschaftlichen Leistungskraft zeigt, dass dieser Prozess noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Bis diese Länder beispielsweise beim Bruttoinlandprodukt je Einwohner die Kluft zu den Industrieländern auch nur ansatzweise geschlossen haben werden, dürften sicherlich noch einige Jahrzehnte vergehen. Damit steht aber auch eine weitere Konsequenz fest: An den doch sehr unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich Leistungskraft und Dynamik wird sich auf lange Sicht nichts Grundsätzliches ändern: Die Schwellenländer werden bei der Dynamik dominieren und die Industrieländer bei der Leistungskraft. 4.3 Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen: Deutschland bleibt hinter anderen großen Wirtschaftsnationen zurück Heute wird morgen Schnee von gestern sein. Noch wichtiger als die Beurteilung, wie ein Standort aktuell dasteht, ist unseres Erachtens die Frage, ob er sich gut genug für die Zukunft gerüstet hat, um längerfristig im globalen Wettbewerb an vorderster Front mitmischen zu können. Deshalb haben in unserem Standortvergleich die folgenden beiden Indikatorengruppen zusammengenommen ein größeres Gewicht als die in den vorangegangenen Abschnitten behandelten Kenngrößen. Unter der Überschrift „Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen“ sind die Einzelindikatoren Investitionsquote (Bruttoinvestitionen in % des BIP), F&E-Ausgaben (in % des BIP), Patentanmeldungen (beim Europäischen Patentamt, je 1 Mio. Einwohner), Bevölkerungsanteil mit tertiärem Bildungsabschluss (25-64 Jahre), Erwerbsquote (Erwerbstätige in % aller Erwerbspersonen), Wanderungssaldo (Zuwanderer minus Abwanderer) und ausländische Direktinvestitionen (in % des BIP) subsummiert. Mit dieser Auswahl wollen wir verschiedenen Aspekten von „Zukunftsfähigkeit“ gerecht werden, wobei hier nicht auf die künftige wirtschaftliche Dynamik abgestellt wird, sondern auf das Niveau des wirtschaftlichen Potenzials. Die verfügbaren Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital bestimmen die Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft. Ob sie ihrer Bevölkerung auf Dauer Wohlstand gewährleisten kann, hängt nach unserer Ansicht außerdem ganz wesentlich von den Faktoren Wissen und Innovationen ab. Die ausgewählten Kennzahlen liefern Anhaltspunkte darüber, wie viel in einem Land dafür getan wird, dass neue Erkenntnisse entstehen, sich verbreiten und angewendet werden können. Hierbei spielen nicht nur eigenes Geld oder Humankapital eine Rolle, sondern auch Ressourcen aus dem Ausland. Sowohl der Wanderungssaldo als auch die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) sind daneben aber natürlich auch Ausdruck für die Attraktivität des Standorts. 12 Verfügbarkeit von Kapital, Arbeit und technologischem Wissen 2000 2003 2006 Kanada 4 7 1 Schweden 1 5 2 USA 2 2 3 Japan 5 4 4 Belgien 9 6 5 Frankreich 10 10 6 Euro-Raum 12 9 7 Entwicklung im Ranking Großbritannien 7 13 8 Deutschland 5 8 9 Niederlande 3 1 9 11 10 9 8 2 12 China 14 12 13 Italien 15 15 14 Russland 17 16 15 Brasilien 13 14 16 Polen 15 17 17 Indien 18 18 18 Spanien Österreich Unsere Ergebnisse lauten: Nach einem gehörigen Sprung ist Kanada die neue Nummer eins vor Schweden. Insgesamt fällt auf, dass die Platzierungen teils erheblich schwanken, was häufig auf die Einzelindikatoren der Direktinvestitionen und Investitionsquote zurückzuführen ist. So rutschten etwa die Niederlande sowie Österreich von Platz 1 bzw. 2 im Jahr 2003 auf nun Rang 9 bzw. 12 ab. Durch eine kontinuierlich hohe Ressourcenverfügbarkeit zeichnen sich vor allem die USA aus (gefolgt von Schweden und Kanada). Japan belegt im Durchschnitt der Beobachtungszeitpunkte einen recht guten vierten Rang. Deutschland hat an Potenzial verloren, findet sich aktuell an neunter Stelle dieses Teilrankings, bleibt aber top bei den Patentanmeldungen sowie Vierter bei den F&E-Ausgaben. Gemeinsam mit Deutschland und den Niederlanden auf Platz 9 liegt Spanien trotz guter Werte bei der Investitionsquote und dem Wanderungssaldo. Außerdem sollte nicht übersehen werden, dass gerade im Falle Spaniens in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung bei der Erwerbsquote stattgefunden hat, denn das Land verbesserte sich vom vierzehnten auf den zehnten Platz. Lag die Quote im Jahr 2000 noch gerade einmal bei 56,3 %, belief sie sich nur sechs Jahre später bereits auf 64,8 %. Ein derart deutlicher Anstieg ist in keinem anderen analysierten Land in diesem Zeitraum zu beobachten gewesen. Frankreich, das sich im Zeitablauf steigern konnte, schnitt 2006 im Teilranking mit Position 6 etwas besser als der Euro-Raum im Ganzen ab. Leicht hinter dem EWU-Aggregat liegt Großbritannien. Mit zuletzt Rang 14 erscheint Italien unter den betrachteten Industrieländern am 13 schlechtesten für die Zukunft gewappnet. Nachholbedarf besteht hier insbesondere in puncto Erwerbsquote, F&E-Ausgaben sowie tertiärem Bildungsanteil. Das beste Schwellenland ist China an dreizehnter Position, wobei uns für die BRIC-Länder keine Daten zum Bevölkerungsanteil mit tertiärem Bildungsabschluss und zum Wanderungssaldo vorliegen. Desgleichen sind für Russland keine vergleichbaren Daten zur Erwerbsquote verfügbar. Chinas Platzierung kommt hauptsächlich dank der hohen Investitionsquote zustande. Insofern bleibt mit Fragezeichen zu versehen, wie viel echte Innovationskraft – im Sinne von eigenem Erfindungsgeist oder der Fähigkeit, Knowhow selbst zu entwickeln – man diesem Land schon zuschreiben kann. Bemerkenswert ist allerdings dennoch, dass nur in China und Österreich die F&E-Ausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt im Zeitablauf nennenswert zugenommen haben. Die Stagnation sowie der leichte Rückgang des Anteils in einigen EU-Staaten sind nicht zuletzt deshalb unbefriedigend, weil sich die Europäische Union im Rahmen der Lissabon-Agenda eigentlich zum Ziel gesetzt hatte, die F&E-Ausgaben bis 2010 auf 3 % des BIP zu steigern. Schweden Japan* USA* Deutschland Österreich** Frankreich Kanada Euro-Raum Belgien Niederlande* Großbritannien* China Russland* Spanien Italien* Brasilien* Indien* 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Polen F&E-Ausgaben in % des BIP 2000/2005 * 2004 ** 2006 In unserem Teilranking liegen Russland und Brasilien vor Polen. In Sachen Verfügbarkeit von Arbeit, Kapital und technologischem Wissen an letzter Stelle steht Indien. Besonders fällt hier die sehr niedrige Erwerbsquote von zuletzt gerade einmal 44 % auf. Dabei dürfte die Tatsache, dass in Indien noch ein Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig ist, ohne dass diese Beschäftigung statistisch als Erwerbstätigkeit erfasst wird, sicherlich eine gewisse Rolle gespielt haben. Dass die Emerging Markets beim Wirtschaftspotenzial überwiegend die hinteren Plätze belegen, ist u.a. mit Blick auf die unterschiedliche Spezialisierung in der internationalen Arbeitsteilung kaum verwunderlich und dürfte sich auch vorerst nicht wesentlich ändern. Für die Industrieländer geht der grundsätzliche Weg, um sich im internationalen Konkurrenzkampf einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, weiter in Richtung Ausbau der Wissensgesellschaft, Spezialisierung auf neue Technologien, Hightech-Produkte, etc.. Natürlich erhöht sich diesbezüglich auch der Standard in den 14 aufstrebenden Volkswirtschaften, aber sie sind typischerweise eben nicht in der Vorreiterrolle sondern Nachzügler. 4.4 Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung: Industrieländer mit sehr gemischten Ergebnissen Unsere vierte und letzte Indikatorengruppe soll Aufschluss darüber geben, ob sich in einem Land Ungleichgewichte oder ungesunde Entwicklungen erkennen lassen, die eine Hypothek oder Risiken für die Zukunft darstellen. Hinsichtlich der Frage, ob die öffentlichen Finanzen auf Dauer tragfähig erscheinen, haben wir zum einen den staatlichen Schuldenstand (in % des BIP) herangezogen, mit dem zukünftige Zinslasten verbunden sind. Zum anderen geht der öffentliche Primärsaldo (Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben abzüglich der Zinszahlungen auf die ausstehenden Staatsschulden, in % des BIP) in die Beurteilung ein. Er gibt Auskunft über die laufende Haushaltsführung, ohne wie der Budgetsaldo durch aus der Vergangenheit resultierende Zinszahlungen „verfälscht“ zu sein: Lebt der Staat über seine Verhältnisse oder sorgt er für morgen vor? Den Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP) haben wir unter dem Aspekt der Tragfähigkeit einbezogen, da heutige Defizite die Gefahr einer späteren realwirtschaftlichen Anpassung bergen. Ein erhebliches Leistungsbilanzdefizit kann eine problematische Abhängigkeit vom Ausland bedeuten, ein Überschuss mag Beleg einer Position der Stärke gegenüber dem Rest der Welt sein. Der Leistungsbilanzsaldo lässt sich als Summe der Finanzierungssalden des inländischen privaten und öffentlichen Sektors ausdrücken, insofern gibt er indirekt Aufschluss über deren zusammengefasste Finanzlage. Spätestens seitdem der Klimawandel zum Topthema geworden ist sowie im Lichte des Ölpreisanstiegs und zunehmender Sorgen um Rohstoffknappheit dürfte Einigkeit bestehen, dass es mehr denn je auf ressourcen- und umweltschonendes Wirtschaften ankommt. Als Indikatoren für jene Nachhaltigkeit enthält unser Standortvergleich sowohl den Gesamtverbrauch an Primärenergie als auch den CO2-Ausstoß je Produktionseinheit (t Öläquivalent bzw. Mio. t pro 1.000 USD BIP, Basisjahr 2000, in Kaufkraftparitäten). 15 Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung 2000 2003 2006 Schweden 1 1 1 Entwicklung im Ranking Österreich 6 4 2 Brasilien 6 2 3 Spanien 9 3 3 Niederlande 2 6 5 Russland 12 8 6 Frankreich 5 9 7 3 5 7 Deutschland Großbritannien 11 12 9 Euro-Raum 8 10 9 Italien 4 6 9 Belgien 10 11 12 China 13 13 13 Japan 15 15 14 Kanada 14 16 15 Indien 17 13 16 USA 16 18 17 Polen 18 17 18 Das Teilranking der fiskalischen und ökologischen Nachhaltigkeit wird konstant von Schweden angeführt, obwohl hier eine kleine Schwäche in puncto Energieverbrauch pro BIP-Einheit besteht. Österreich konnte sich 2006 auf den zweiten Platz vorschieben, von dort verdrängte es Brasilien an die dritte Stelle. Beide Länder verdanken ihr gutes Abschneiden vor allem ihrer Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit. Im Falle Brasiliens mag dies überraschen, doch zum einen gilt es zu bedenken, dass dort der landwirtschaftliche Sektor ein relativ großes Gewicht hat, zum anderen ist Brasilien führend in der Nutzung von Biokraftstoffen. Auch Spanien liegt trotz seines hohen Leistungsbilanzdefizits auf Platz 3. Im oberen Drittel der Rangfolge findet sich aktuell neben den Niederlanden noch Russland, wo das Bild sehr zweigeteilt aussieht. Während Russland unter den analysierten Ländern in den Kategorien Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie Leistungsbilanzsaldo 2006 am besten dastand, war es bei den beiden Umweltindikatoren am schlechtesten. 16 Schweden Frankreich Brasilien Italien Österreich Großbritannien Euro-Raum Spanien Japan Indien Deutschland Niederlande Belgien USA Kanada Polen China 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Russland CO2-Ausstoß pro Produktionseinheit* 2004 * in Mio. t pro 1000 USD-BIP (Basisjahr 2000, in Kaufkraftparitäten) Das Mittelfeld der Rangliste nehmen weitere europäische Länder ein: Nach Frankreich und Großbritannien an siebter Stelle kommen das EWU-Aggregat, Italien zusammen mit Deutschland auf Platz 9, anschließend Belgien. Deutschland konnte gegenüber dem Jahr 2000 zwar seine Leistungsbilanzposition spürbar verbessern, fiel aber im Bereich Staatsfinanzen beim Schuldenstandskriterium zurück (die Platzierung bei Energiesparsamkeit und Kohlendioxidemissionen war zu allen drei Untersuchungszeitpunkten nahezu gleich). Das untere Drittel beginnt mit China. Japan ist Vierzehnter, wobei es die rote Laterne sowohl beim öffentlichen Schuldenstand als auch Primärsaldo trägt. Andere Schwachpunkte – nämlich mangelnde Ressourcen- und Umweltschonung – hat Kanada, das auf dem fünfzehnten Rang landet, gefolgt von Indien. Die USA sind Vorletzter, nur in Polen lässt die Nachhaltigkeit der fiskalischen und ökologischen Entwicklung noch mehr zu wünschen übrig. Die Länderverteilung im Ranking zeigt: Ob aus der heutigen Wirtschaftsweise sich kumulierende Ungleichgewichte oder Zukunftsrisiken resultieren, hängt nicht systematisch damit zusammen, ob es sich um ein Industrie- oder Schwellenland handelt. Natürlich kann eingewandt werden, dass sich im Falle der Emerging Markets zumeist schlechtere technische Voraussetzungen und geringere Umweltstandards in den Ergebnissen für Energieeffizienz und CO2Ausstoß negativ niederschlagen. Doch wie das Beispiel USA belegt, können genauso etwa politische Weichenstellungen von erheblichem Einfluss sein. Im Unterschied zu den USA hat sich Europa mehr in Sachen Klimaschutz engagiert und laut Europäischem Rat soll die EU diesbezüglich weiter als internationaler Vorreiter fungieren. Darüber hinaus ist selbstverständlich die öffentliche Haushaltskonsolidierung ein Gebiet, wo neben ökonomischer Machbarkeit politischer Wille eine entscheidende Rolle spielt. Auch im nächsten Abschnitt wird deutlich, dass der Politik für die 17 Standortattraktivität wesentliche Bedeutung über die Gestaltung von Institutionen und Rahmenbedingungen zukommt. 5. Ursachen für Standortschwächen und -stärken In dieser Studie haben wir den Standort Deutschland anhand einer Reihe von quantitativen Erfolgskriterien mit anderen größeren Volkswirtschaften verglichen. Eine Ursachenanalyse von Standortstärken- und schwächen schloss dies nicht mit ein. Erstens würde dies angesichts der Komplexität des Themas eine einzelne Studie überfordern, zweitens sind internationale Ursachenanalysen auf quantitativer Basis nur teilweise möglich. Wir möchten im folgenden dennoch auf einzelne Aspekte der „Ursachenforschung“ eingehen. Dabei ist das Ziel weder eine vollständige Auflistung aller denkbaren Ursachen, noch eine Gesamtbewertung der angesprochenen Aspekte. Vielmehr wollen wir deutlich machen, welche zusätzlichen Überlegungen ein Investor noch anstellt, um letztendlich zu dem Ergebnis zu gelangen, dass ein Standort als stärker oder schwächer einzuschätzen ist als ein anderer. Bei den zugrundeliegenden Informationen stützen wir uns auf Analysen Dritter, insbesondere auf internationale Institutionen. Hier nun zunächst einige Fragestellungen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, bevor wir dann anschließend auf einzelne ausgewählte Aspekte näher eingehen: • Wie stark sind Produkt- und Arbeitsmärkte reguliert? • Wie hoch ist die Abgabenquote für die Privaten? • Besteht eine gute Infrastruktur? • Wie stabil ist das politische System? • Wie gefestigt sind die Institutionen? • Welche Rolle spielt Korruption in Politik und Wirtschaft? Regulierung von Produkt- und Arbeitsmärkten Für das Funktionieren von Märkten ist ein stabiler ordnungspolitischer Rahmen erforderlich. Mittlerweile hat die Regulierung auf einigen Märkten allerdings ein Ausmaß angenommen, bei dem man eindeutig von Überregulierung sprechen kann. Bei den Produktmärkten ist weniger Regulierung häufig mehr, solange zumindest ein ausreichendes Maß an Verbraucherschutz gewährleistet ist. Weniger Regulierung bedeutet mehr Wettbewerb und auch mehr ökonomische Freiheit für die Marktteilnehmer. Ein Beispiel: Seit geraumer Zeit ist immer wieder die Rede von der notwendigen Deregulierung des europäischen Dienstleistungssektors. Davon verspricht man sich zum einen niedrigere Preise für die Endverbraucher auf Grund des höheren Wettbewerbs. Auf der anderen Seite geht man auch davon aus, dass die Deregulierung positive Impulse für das Wirtschaftswachstum in der EU mit sich bringen würde. 18 Eine im April 2005 erschienene Studie der OECD bescheinigt den OECD-Staaten einen durchweg positiven Trend: Zwischen 1998 und 2003 ist der Grad der Regulierung an den Produktmärkten in sämtlichen Mitgliedsstaaten zurückgegangen. Vergleichbare Ergebnisse zu den BRIC-Ländern liegen nicht vor, da bei der Studie ausschließlich OECD-Länder berücksichtigt worden sind. Wie reguliert sind die Produktmärkte? Land 1998 2003 Großbritannien 1,1 0,9 USA 1,3 1,0 Kanada 1,4 1,2 Schweden 1,8 1,2 Japan 1,9 1,3 Belgien 2,1 1,4 Niederlande 1,8 1,4 Österreich 1,8 1,4 Deutschland 1,9 1,4 Spanien 2,3 1,6 Frankreich 2,5 1,7 Italien 2,8 1,9 Polen 3,9 2,8 Anmerkung: Ein niedriger Wert ist Ausdruck geringer Regulierungsdichte. Quelle: OECD Das geringste Maß an Regulierung weisen unter allen Ländern, die sowohl in der OECD-Studie als auch in unserer eigenen untersucht worden sind, Großbritannien und die USA auf. Zwar hat die Deregulierung auch in Deutschland Fortschritte gemacht. Allerdings landet Deutschland nach wie vor nur im Mittelfeld, knapp hinter der EU 15. Mit Abstand am stärksten reguliert sind die Produktmärkte nach wie vor in Polen. Ist weniger Regulierung mehr? Diese Frage lässt sich im Hinblick auf den Arbeitsmarkt nicht grundsätzlich beantworten, da gerade bei diesem Markt in starkem Maße auch soziale Belange eine Rolle spielen. Positiv auf den Grad der Regulierung würde sich zum Beispiel auswirken, wenn ein Unternehmen einen Arbeitnehmer ohne jegliche Schutzrechte und ohne soziales Netz von heute auf morgen entlassen könnte. Wäre dies unter sozialen und gesellschaftlichen Aspekten aber wirklich wünschenswert? 19 Im Rahmen des „Doing business“-Projektes untersucht die Weltbank regelmäßig 175 Länder im Hinblick darauf, wie einfach oder wie schwer es für ein Unternehmen in einem Land ist, geschäftlich tätig zu sein. In diese Analyse geht auch die Frage nach dem Regulierungsgrad des Arbeitsmarktes ein. Nach Einschätzung der Weltbank haben die USA den am wenigsten regulierten Arbeitsmarkt. Wenig überraschend ist auch, dass Deutschland mit Platz 129 nur im unteren Drittel des Rankings landet. Insbesondere bei den Teilaspekten Arbeitszeitflexibilität und Entlassung kommt der vergleichsweise hohe Regulierungsgrad des deutschen Arbeitsmarktes zum Ausdruck. Wie reguliert ist der Arbeitsmarkt? Land Ranking nach Regulierungsgrad Teilaspekt Entlassung* USA 1 0,0 Kanada 13 28,0 Großbritannien 17 22,1 Belgien 23 16,0 Japan 36 8,6 Polen 49 13,0 China 78 91,0 Niederlande 86 17,3 Russland 87 17,3 Schweden 94 26,0 Brasilien 99 36,8 Italien 101 1,7 Österreich 103 56,3 Indien 112 55,9 Deutschland 129 69,3 Frankreich 134 31,8 Spanien 161 56,3 * Kosten einer Entlassung (gemessen in Anzahl bezahlter Arbeitswochen) Quelle: Weltbank Abgabenquote Die Abgabenquote gibt den Anteil von Steuern und Sozialabgaben an der Wirtschaftsleistung eines Landes an. Eine hohe Abgabenquote wird generell mit einem hohen Maß an staatlicher Umverteilung und hohen Produktionsnebenkosten gleichgesetzt, wobei insbesondere letzteres als Zeichen einer geringen Standortattraktivität angesehen wird. Umso überraschender ist es, dass in unserem internationalen Standortvergleich ausgerechnet diejenigen Länder zu den erfolgreichsten gehören, bei denen die Privaten eine vergleichsweise hohe Abgabenlast zu tragen haben. Schweden, der Gewinner unseres Standortvergleichs, weist beispielsweise mit einer Quote von 50 % einen der höchsten Werte weltweit aus. Auch Belgien, in unserem Ranking aktuell immerhin auf Platz 4, hatte im Jahr 2005 mit einer Abgabenquote von gut 45 % eine überdurchschnittlich hohe Rate. Und wie sieht es im umgekehrten Fall aus? Die Abgabenlast der japani20 schen Bürger liegt mit unter 30 % des BIP spürbar unter dem internationalen Durchschnitt. Beim Standort-Ranking landet Japan aber gerade einmal auf dem zwölften Platz. Einen Aspekt sollte man im Hinblick auf die Abgabenquote auf keinen Fall aus den Augen lassen: Eine entscheidende Rolle kommt natürlich der Frage der Mittelverwendung zu. Investiert ein Land beispielsweise stark in Infrastruktur und Bildung und hat gleichzeitig eine hohe Steuerquote, kann dies gesamtwirtschaftlich positiver sein als eine sehr niedrige Quote bei gleichzeitig vergleichsweise wenig Investitionen in die Zukunft. Ebenso wirken hohe Sozialleistungen nicht notgedrungen wachstumshemmend, solange damit nicht der Fehlanreiz für die Menschen verbunden ist, sich längerfristig alimentieren zu lassen, sondern Regeln gelten, bei denen „gefördert“ und „gefordert“ wird. Abgabenquoten in % des BIP 2005 60 50 40 30 20 10 Schweden Belgien Frankreich Österreich Italien Niederlande* Großbritannien Spanien Polen* Deutschland * 2004 Kanada USA Japan* 0 Infrastruktur An der Infrastruktur eines Landes kann man zwar seinen Erfolg als Investitionsstandort nicht direkt ablesen. Ein leistungsfähiger Standort ist aber ohne eine gute Infrastruktur praktisch nicht vorstellbar. Neben Transport und Verkehr zählen zur Infrastruktur auch Bereiche wie Energie und Kommunikation. Das World Economic Forum publiziert in regelmäßigen Abständen den so genannten Global Competitiveness Report. Darin bewertet es die über 120 analysierten Länder unter anderem im Hinblick auf die Qualität ihrer Infrastruktur. Deutschland schneidet bei diesem Ranking sehr gut ab. Es belegt aktuell den ersten Platz, noch vor der Schweiz und Hongkong. Etwas überraschend ist das doch recht schlechte Abschneiden Italiens mit Platz 50. Demnach haben Länder wie Mauritius, Namibia und Panama eine bessere Infrastruktur als Italien. Die BRIC-Länder rangieren allesamt in der unteren Hälfte des Rankings: China, Russland und Indien liegen auf den Plätzen 60 bis 62. Brasilien ist auf Platz 71 zu finden. Von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen zeigt sich also 21 ganz klar ein Zusammenhang zwischen der Qualität der Infrastruktur und dem Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft. Korruption Warum Korruption eine wesentliche Ursache der Stärken oder auch Schwächen eines Standorts darstellt, ist offensichtlich: Investoren wollen stabile, allgemeingültige Rahmenbedingungen für ihr Engagement. Sie wünschen sich Rechtssicherheit. Wenn aber beispielsweise vor Gericht derjenige Recht bekommt, der den Richter am höchsten bestochen hat und nicht derjenige, der objektiv Recht hat, ist Rechtssicherheit nicht gegeben. Das Engagement und die damit verbundenen Risiken werden schwer kalkulierbar. Es wird wohl kein Land in der Welt geben, das völlig frei von Korruption ist. Erhebliche Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich des Ausmaßes. Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International veröffentlicht einmal jährlich den so genannten Korruptionsindex. Dieser misst bei Geschäftsleuten und Länderanalysten deren Wahrnehmung von Korruption unter Amtsträgern und Politikern eines Landes. Die Organisation kommt zu einem recht klaren Ergebnis: Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Korruption und Armut: Ein Großteil der sehr armen Länder zählt gleichzeitig auch zu den korruptesten. Natürlich ist Korruption auch in Industrieländern anzutreffen. Allerdings kommt Transparency International zu dem Ergebnis, dass die Korruption in dieser Ländergruppe weniger negativen Einfluss auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung hat als in Entwicklungsländern. Die skandinavischen Staaten sind nach den aktuellen Ergebnissen der Anti-KorruptionsOrganisation am „saubersten“. Unter den besten acht Ländern befinden sich gleich fünf nordeuropäische Staaten, wobei Finnland das Ranking seit Jahren anführt. Deutschland rangiert stabil auf dem sechzehnten Platz und damit knapp vor Japan und Frankreich. Mit einem Wert von 8 Punkten, wobei 10 Punkte für „frei von Korruption“ und 0 Punkte für „extrem von Korruption befallen“ stehen, stellt Korruption in Deutschland ein eher moderates Problem dar. Die in unserer Studie berücksichtigten BRIC-Länder finden sich erst ab Platz 70 wieder. Am schlechtesten schneidet dabei mit Platz 121 Russland ab, das sich damit auf einem Niveau mit Ländern wie Benin, Honduras und Swasiland bewegt. Die Diskussion der hier angesprochenen Ursachen für Standortschwächen und –stärken hat deutlich gemacht, dass es abgesehen von einigen allgemeingültigen Basisqualitäten nicht immer einfach ist, wertfrei und objektiv einen bestimmten Aspekt zu beurteilen. Gerade bei der Abgabenquote sowie bei der Frage nach der Deregulierung des Arbeitsmarktes kam dies doch sehr deutlich zum Ausdruck. Dies hat uns, wie bereits schon zu Beginn der Studie erwähnt, veranlasst, uns bei unserem Standort-Ranking allein auf quantitative, objektiv messbare Erfolgskriterien zu beschränken. 22 6. Fazit und Ausblick: In Deutschland weder Grund zu Missmut noch zu Selbstzufriedenheit Alles in allem muss sich der Standort Deutschland im Vergleich mit den von uns untersuchten 17 Ländern nicht verstecken: Mit aktuell Platz 8 liegt er im oberen Mittelfeld, unter den G3-Ländern schneidet er zusammen mit den USA besser als Japan ab, außerdem steht er in der Rangliste vor dem EWU-Aggregat. Hinzu kommt, dass wir erhebliches Verbesserungspotenzial sehen. Denn hierzulande ist ein bemerkenswerter Aufschwung in Gang gekommen. Mit der guten Konjunktur hat sich insbesondere der Arbeitsmarkt günstiger entwickelt – im laufenden Jahr rechnen wir mit einem Beschäftigungszuwachs von 1,6 % (mehr als doppelt so hoch wie 2006) – und die Konsolidierung der Staatsfinanzen geht voran (allerdings natürlich auch bedingt durch die Mehrwertsteueranhebung). Angesichts solcher Fortschritte dürfte Deutschland im für nächstes Jahr geplanten Update unseres Standortvergleichs weiter vorrücken können. Bezüglich der Frage, was die deutsche Politik speziell von den EU-Ländern mit besserer Platzierung im Ranking lernen kann, erscheint es nicht Erfolg versprechend, ein komplettes Wirtschaftsund Gesellschaftsmodell nachahmen zu wollen. Man sollte sich zwar Anregungen holen, aber letztlich müssen Reformen auf die eigenen Gegebenheiten abgestimmt sein. Unsere RankingErgebnisse können helfen, besondere Defizite gegenüber der Konkurrenz, d.h. besonderen Handlungsbedarf auszumachen. Wie aus den nachfolgenden Tabellen hervorgeht, war Deutschland 2006 bei den Einzelindikatoren Beschäftigungswachstum und Investitionsquote Vorletzter. Daneben erscheinen Maßnahmen sinnvoll, die auf ein höheres Bildungsniveau, mehr ausländische Direktinvestitionen, eine Rückführung der öffentlichen Schuldenlast sowie auf geringere CO2Emmissionen abzielen. Doch eine vielversprechende Strategie sollte nicht ausschließlich versuchen, Schwächen auszumerzen, sondern genauso Stärken auszubauen. 23 Anhang: Jahrestabellen im Überblick 24 25 26