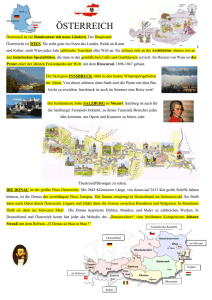PDF 1,5MB - Deutschland und Europa
Werbung

Reihe für Politik, Geschichte, Deutsch, Geographie, Kunst Heft 41 · Dezember 2000 Die Donau Lebensader Kulturräume Erkundungen Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zurück Inhalt Heft 41 · Dezember 2000 Die Donau Lebensader, Kulturräume, Erkundungen Vorwort des Herausgebers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Herausgeber: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Direktor Siegfried Schiele Geleitwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Redaktion: Dr. Walter-Siegfried Kircher (verantw.) Dietrich Rolbetzki Autorinnen und Autoren dieses Heftes . . . . . . . . . 2 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Anschrift der Redaktion: 70184 Stuttgart, Stafflenbergstraße 38, Telefon (07 11) 16 40 99-43/-45, Telefax (07 11) 16 40 99-77 I. Die Donau und die Landschaften ihres Einzugsgebietes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 II. »Ströme machen urbar das Land« . . . . . . . . . 6 III. Schauplatz europäischer Geschichte . . . 1. Die Donau: ein römischer Grenzfluss . . . 2. Christianisierung im Donauraum . . . . . . 3. »1100 Jahre in Europa«: die Ungarn . . . 4. Großreiche an der Donau . . . . . . . . . . . a) Die Donaumonarchie . . . . . . . . . . . . . b) Unter dem Banner des Propheten ins Innere Europas . . . . . . . . . . . . . . 5. Ulmer Schachteln und Donauschwaben 6. Linz und Mauthausen: Repräsentationsarchitektur und Menschenvernichtung . . a) Linz: die »Heimatstadt« Adolf Hitlers . b) Das Konzentrationslager Mauthausen Beirat: Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart, Günter Gerstberger Dr. Almut Satrapa-Schill Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Klaus Happold, Ministerialrat Prof. Dr. Lothar Burchardt, Universität Konstanz Dietrich Rolbetzki, Oberstudienrat, Filderstadt Lothar Schaechterle, Studiendirektor, Stetten i. R. Landeszentrale für politische Bildung, Dr. Walter-Siegfried Kircher Deutschland & Europa erscheint zweimal im Jahr Jahresbezugspreis DM 12,– Satz: Vaihinger Satz + Druck GmbH 71665 Vaihingen Druck: Reclam Graphischer Betrieb GmbH 71254 Ditzingen Auflage: 12 000 Titelbild: l. o.: Bregquelle r. o.: Zusammenfluss von Breg und Brigach m. l.: Wachau m. r.: Budapest, Kettenbrücke Fotos: Dietrich Rolbetzki l. u.: Eisernes Tor © Herold, Gerbrunn r. u.: Donaudelta © Focus, Hamburg (Foto: H. Silvester) Abb. S. 1: Staatsbibliothek Berlin, Fotostelle Nachdruck oder Vervielfältigung auf elektronischen Datenträgern sowie Einspeisung in Datennetze nur mit Genehmigung der Redaktion Mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport, der Stiftung für Bildung und Behindertenförderung und der Robert Bosch Stiftung. .... .... .... .... .... .... 9 9 11 13 17 17 . . . . 20 . . . . 23 . . . . 26 . . . . 26 . . . . 28 IV. An der Donau: Kunst- und Literaturlandschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1. Inszenierte Geschichte: Melk und Walhalla . . 30 2. Mit Dichtern die Donau hinunter . . . . . . . . . . 32 V. Den Strom entlang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ulm und Neu-Ulm: Einstimmung auf zwei Donaustädte . . . . . 2. Die Donau im Sattel »erfahren«: mit dem Rad von Passau nach Budapest 3. Wachau und Donauknie: zu Orten der Geschichte . . . . . . . . . . . . . 4. Die Donau kommt nach Wien . . . . . . . . . 5. Budapest: »Königin der Donau« . . . . . . . 6. Das Donaudelta: Reise in ein Paradies? . . . . . 35 . . . 35 . . . 37 ... ... ... ... 39 42 44 46 Die Donau – Gesamtdarstellungen und Bildbände . . . 47 Neues aus der Landeszentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Die Hefte werden nur in geringer Anzahl an die Schulen verteilt. Zusätzliche Exemplare können bei der Landeszentrale für politische Bildung, Redaktionssekretariat Deutschland und Europa, Fax (0711) 16 40 99-77, oder schriftlich nachgefordert werden. »Fluss im Herzen Europas«, »Der übernationale Fluss«, »Der mythische Strom«, »Der Strom der Superlative«, »Der Strom ohne Ende,« – dies sind nur einige der zahllosen Etiketten, die dem zweitlängsten Fluss Europas anhaften. Trotz strittiger Verhältnisse über Anfang und Ende sind sich die Geologen einig, dass der Strom von der offiziellen Bregquelle bei Furtwangen bis zum Mündungsdelta in Rumänien 2888 Kilometer fließt, sein Einzugsbereich ungefähr 817 000 km Quadratkilometer umfasst, er jährlich 203 Milliarden Kubikmeter Wasser ins Schwarze Meer sendet und das Donaudelta durch Ablagerungen im Jahr etwa fünfzig Meter ins Schwarze Meer hinauswächst. Vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer durchquert die Donau einen großen Teil Europas, und verbindet mehr Völker und Kulturen als irgendein anderer Fluss der Erde. Gründe genug, der Donau ein eigenes Heft zu widmen. Es handelt sich um das zweite »Flussheft« nach der »Oder« in der vorliegenden Reihe D&E (vgl. Heft 33/1996). Schon ihr Verlauf von Europas Mitte nach Osten macht die Donau zum wichtigen Verkehrsweg. Seit der Fertigstellung des Rhein-Main-Donaukanals ist sogar die Fahrt von der Nordsee bis ans Schwarze Meer möglich. Ein Kapitel des vorliegenden Heftes stellt denn auch die Bedeutung des Stromes in Vergangenheit und Gegenwart dar. Breiten Raum nimmt daneben die Geschichte ein, die sich an seinen Ufern abgespielt hat: von den Zeiten der Römer über die »Schwabenzüge« bis hin zu den Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland in Mauthausen bei Linz. Das Stichwort »Donau« lässt viele an Johann Strauß’ populärsten Walzer »An der schönen blauen Donau« denken, – unzählige Künstler und Dichter hat der Strom angeregt, nur wenige literarische Beispiele können hier präsentiert werden. Der schwäbische Dichter Friedrich Hölderlin liebte die Vorstellung, die Donau fließe umgekehrt, vom Schwarzen Meer zum Schwarzwald (»Ich mein, er müsse kommen von Osten«). Wir wollen bei den Erkundungen und Reiseberichten entlang der Donau, die abschließend zu einzelnen Städten und Landschaften bis hin zum Delta führen, den natürlichen west-östlichen Weg gehen. Ein Heft hat nur beschränkten Raum und so konnten viele Themen nicht aufgenommen werden: Anregung zu weiterer Beschäftigung mit dieser europäischen Lebensader. Siegfried Schiele Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Vorwort des Herausgebers 1 Geleitwort des Ministeriums 2 Am Beispiel der Donaulandschaft wird in besonderer Weise die geographische und kulturelle Vielfalt Europas sichtbar. Mit dieser Region verknüpfen sich historische Ereignisse und Prozesse, welche die Entwicklung der abendländischen Zivilisation und der politisch-staatlichen Ordnung Europas bis in unsere Gegenwart nachhaltig geprägt haben. An der Donau – bedeutender Verkehrs- und Handelsweg – siedelten im Wandel der Geschichte zahlreiche Stämme und Völker; Orient und Okzident prallten hier aufeinander. Die Nibelungen zogen an ihren Ufern in den Untergang; für die Donauschwaben war der Fluss der von Hoffnungen auf eine bessere Zukunft bestimmte Weg in eine neue Heimat. In diesem Teil Europas errichteten die Habsburger einen Staat, der, auch unter der Bezeichnung »Donaumonarchie« in die Geschichte eingegangen, eine bedeutende politische und geistige Rolle spielte. Das Thema dieses Heftes eröffnet zahlreiche didaktisch interessante Perspektiven für einen motivierenden, gerade auch fächerübergreifenden Unterricht. Die Verknüpfung projektbezogener Beiträge von Fächern wie Geschichte, Deutsch, Bildender Kunst und Erdkunde können Schülerinnen und Schülern ein plastisches Tableau geschichtlicher, kultureller Wirkungszusammenhänge vermitteln. Dazu bietet diese Publikation zahlreiche Materialien. Autorinnen und Autoren Klaus Happold Ministerialrat Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Dr. Heinrich Bock, StD i.R., Biberach a.d. Riß IV.2. Mit Dichtern die Donau hinunter: Der Nibelungen Not Dr. Dietmar Gohl, Leonberg I. Die Donau und die Landschaften ihres Einzugsgebietes / V.3. Die Donau kommt nach Wien / V.5. Budapest: »Königin der Donau« / Karte »Die Donau: Flusseinzugsgebiet, Staaten und Landschaften«, Umschlagseite 4 Wolf-Rüdiger Größl, StD, Staatliches Seminar für Schulpädagogik (Gymnasien) Esslingen III.6. b) Das Konzentrationslager Mauthausen Jakob Huff, StD, Blaustein III.5. Ulmer Schachteln und Donauschwaben / V.1. Ulm und Neu Ulm: Einstimmung auf zwei Donaustädte Erika Kern, StR a.D., und Helmuth Kern, Professor, Staatliches Seminar für Schulpädagogik (Gymnasien) Esslingen; beide Neckartenzlingen III.6. a) Linz: die »Heimatstadt« Adolf Hitlers / IV.1. Inszenierte Geschichte: Melk und Walhalla Dr. Martin Kramer, OStR, Nagold III.1. Die Donau: ein römischer Grenzfluss / III.2. Christianisierung im Donauraum / III.4. a) Die Donaumonarchie Sibylle Kußmaul, Historikerin, Berlin V.6. Das Donaudelta: Reise in ein Paradies? Dirk Lundberg, StR, Karlsruhe V.2. Die Donau im Sattel »erfahren«: mit dem Rad von Passau nach Budapest Dietrich Rolbetzki, OStR, Filderstadt Federführung / Einführung / II. »Ströme machen urbar das Land« / III.3. »1100 Jahre in Europa«: die Ungarn / III.4. b) Unter dem Banner des Propheten ins Innere Europas / IV.2. Mit Dichtern die Donau hinunter / V.4. Wachau und Donauknie: zu Orten der Geschichte Leiter des Projekts DEUTSCHLAN D & EUROPA: Dr. Walter-Siegfried Kircher Mitarbeiter der Werkstattseminare »Die Donau – ein europäischer Kulturraum« am 26. April 1997 in Urach vom 17.–18. Oktober 1997 in Fridingen vom 20.–21. März 1998 in Fridingen am 17. Oktober 1998 in Stuttgart alle oben genannten Autorinnen und Autoren 3 Die Donau Lebensader – Kulturräume – Erkundungen Einleitung Von Dietrich Rolbetzki Man nennet aber diesen den Ister. Schön wohnt er. Es brennet der Säulen Laub, Und reget sich. Wild stehn Sie aufgerichtet, untereinander; darob Ein zweites Maß, springt vor Von Felsen das Dach. So wundert Mich nicht, dass er Den Herkules zu Gaste geladen, Fernglänzend, am Olympos drunten, Da der, sich Schatten zu suchen Vom heißen Isthmos kam, Denn voll des Mutes waren Daselbst sie, es bedarf aber, der Geister wegen, Der Kühlung auch. Darum zog jener lieber An die Wasserquellen hieher und gelben Ufer, Hoch duftend oben, und schwarz Vom Fichtenwald, wo in den Tiefen Ein Jäger gern lustwandelt Mittags, und Wachstum hörbar ist An harzigen Bäumen des Isters, Der scheinet aber fast Rückwärts zu gehen und Ich mein, er müsse kommen Von Osten. Friedrich Hölderlin, »Der Ister« »Ister« – wie die Griechen des Altertums – nennt Friedrich Hölderlin die Donau, den zweitlängsten Strom Europas. Damit huldigt er seinem geliebten Arkadien, dessen Seefahrer kaum mehr als den Unterlauf des Flusses kannten. Auf der Ister-Donau ist er wohl oft in Gedanken nach Hellas enteilt, auf ihren Wassern stromauf – noch heute werden, einzigartig, ihre Flusskilometer von der Mündung an bei Sulina gezählt – sah er griechischen Geist nach Deutschland ziehen. Von jeher verband der Strom Menschen und Kulturen, wohnten und wohnen doch an den Ufern von Danubius (Römer), Donau (Deutsche), Dunaj (Tschechen), Duna (Ungarn), Dunav (Serben), Dunaw (Bulgaren), Dunǎrea (Rumänen), Dunai (Russen und Ukrainer) mehr Völker mit unterschiedlichen Sprachen, Brauchtum und Religionen als an irgendeinem anderen Fluss der Welt. Er war – wie es schon Hölderlin sieht – Weg nach Europa (für Magyaren und Osmanen etwa) und Weg aus Europa hinaus (für die Kreuzfahrer zum Beispiel). Menschen trennte er freilich auch und brachte sie doch wieder zusammen, denn niemand am Strom blieb von dem unberührt, was seine Nachbarn unternahmen. Das vorliegende Heft betrachtet die Donau vor allem unter europäischen Gesichtspunkten: – Kapitel I stellt den Fluss und die Landschaften seines Einzugsgebietes vor, – Kapitel II seine Bedeutung und Nutzung in Vergangenheit und Gegenwart. – Ein ausführliches Kapitel III ist der Donau als Schauplatz europäischer Geschichte gewidmet. Grenze war sie Römern, Habsburgern und Osmanen. Auch Glaube und Überzeugungen schufen Sperrlinien: die Christianisierung – von Rom aus oder Byzanz –, in jüngster Vergangenheit der Kommunismus. Grenze ist die Donau heute noch, doch haben die Barrieren das Trennende verloren. Immer wieder drangen fremde Völker in den Donauraum ein, wurden sesshaft wie die Ungarn, die aus der Geschichte europäischer Freiheitskämpfe nicht mehr wegzudenken sind, oder hinterließen, wie die Türken, kulturelle Spuren und z. T. bis heute ungelöste Fragen. Mit dem Osmanischen und dem Habsburgischen Reich sah der Donauraum zwei Staatsgründungen, wie es sie in Europa nie wieder geben sollte. Der Fluss bot dabei nicht nur den Raum für die Entstehung großflächiger Staaten, er gab auch ihrer Ausbreitung Richtung und verband die unterschiedlichen Reichsteile miteinander. Als aber in den unterworfenen Völkern das Gefühl der Eigenständigkeit erwachte, da war die Zeit übernationaler Großstaaten abgelaufen. Sie lösten sich in einem langen, schmerzhaften und den Frieden Europas und der Welt gefährdenden Prozess wieder auf. Verschwanden sie auch von der Landkarte, so blieben doch Probleme, die bis in die Gegenwart nachwirken. Nach den »Türkenkriegen« zwischen dem aufstrebenden Habsburg und dem noch immer mächtigen Osmanenreich zogen vor allem von Ulm aus Deutsche auf der Donau in eine neue Heimat, der sie ihre eigene und unverwechselbare Prägung gaben. Die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wurden zuerst an ihnen gerächt. Die Überlebenden mussten zurück in die Heimat der Vorfahren, die längst fremd geworden war. Nach Hitlers Willen sollte Linz, die Stadt seiner Jugend, noch spätere Generationen an ihn erinnern. Die Arbeiter, die das in die Wirklichkeit umzusetzen hatten, waren Sklaven: Insassen des Konzentrationslagers Mauthausen. – Kapitel IV stellt die Donau als Kunst- und Literaturlandschaft vor. Die Walhalla bei Regensburg und das Benediktinerstift Melk sind »inszenierte Geschichte«. Aber der Strom hat nicht nur Baumeister angeregt, sondern auch Dichter, mit denen es die »Donau abwärts« geht. – Kapitel V schließlich vermittelt persönliche Reiseerfahrungen. Vieles kann in diesem Heft nur angedeutet werden: zu weiterem Studium und eigenen Erkundungen. 4 Landschaften I. Die Donau und die Landschaften ihres Einzugsgebietes Von Dietmar Gohl Die Donau ist nach der Wolga der zweitlängste Strom Europas mit dem zweitgrößten Einzugsgebiet und der einzige, der den Kontinent von West nach Ost durchfließt. Der Name ist keltisch: »danu« bedeutet »die Schnelle«. Der Donauraum umfasst Regionen und Staaten unterschiedlichster Prägung. In Donaueschingen vereinigen sich die Schwarzwaldbäche Breg und Brigach zur Donau. Offizielle Donauquelle ist die Bregquelle bei Furtwangen, obwohl im Schlosspark von Donaueschingen der Quell eines winzigen Nebenbächleins der Brigach als »Donauquelle« mit gewaltiger steinerner Prunkfassung nebst Gedicht gefeiert wird. Unweit östlich beginnt das wildromantische Durchbruchstal der – in geologischer Vorzeit mächtigen – Donau durch die Donaudurchbruch bei Beuren Foto: Dietrich Rolbetzki weißen Felsen der Schwäbischen Alb, wobei das durchlässige Kalkgestein bei Immendingen und Fridingen zur zeitweisen Versickerung des Flüsschens führt, die größte Flussschwinde Mitteleuropas. Das verlorene Wasser tritt nach 60 Stunden unterirdischen Laufs im Aachtopf zutage. Diese stärkste Karstquelle Deutschlands speist die zum Bodensee fließende Radolfzeller Ache (Einzugsgebiet des Rheins). Die Donau wird erst bei Ulm zum ansehnlichen Fluss, nachdem sie die Iller, den ersten der wasserreichen Alpenflüsse, aufgenommen hat, wodurch sich die Wasserführung von 46 auf 116 m3/s erhöht und damit der des Neckars im Odenwald entspricht. Östlich von Ulm wird Donauwasser zur Trinkwasserversorgung der Stuttgarter Region entnommen und mit Grundwasser aus dem Donauried gemischt: Drei Pipelines führen nach Stuttgart. Diese »Landeswasserversorgung« ist der zweitgrößte Fernwasserverband Mitteleuropas. Auch an der Lechmündung wird der Donauaue Grundwasser entnommen: Fernleitung in den Nürnberger Ballungsraum. Oberhalb von Kelheim hat die Donau das Weltenburger Durchbruchstal sehr fremdenverkehrsattraktiv in die Fränkische Alb eingeschnitten. Die Donauzuflüsse vor allem aus den Alpen (Lech, Isar, Inn) führen dazu, dass der Strom beim Verlassen Deutschlands mit 1400 m3/s so wasserreich ist wie der Rhein bei Mainz. Passau ist die am stärksten überschwemmungsgefährdete Stadt an der Donau: Bis zu acht Meter über Normalhochwasser steigt dort die Flut, wenn die Hochwasserwellen von Inn und Donau gleichzeitig eintreffen. Besonders fruchtbare Agrarlandschaften an der deutschen Donau sind wegen der Lössauflage der Dungau um Straubing, die Kornkammer Bayerns, und die Hallertau unterhalb von Ingolstadt, größtes deutsches Hopfenanbaugebiet. Regionen mit hoher Industriedichte sind das Gebiet Schwenningen-Tuttlingen, das Brenztal um Heidenheim und die Ballungsräume München, Augsburg und Ingolstadt. Zwischen Regensburg und Wien hat die Donau malerische Engtäler in das böhmische Mittelgebirgsmassiv eingeschnitten; besonders anmutig ist die Wachau. Das Wiener Becken liegt zwischen den Ausläufern der Alpen (Wienerwald, Leithagebirge) und den Kleinen Karpaten bei Bratislava, die ineinander übergehen. Zur Wirtschaft Österreichs, die sich an den Flüssen konzentriert, sind zwei intensive Agrargebiete erwähnenswert: die Weinbauregion Wachau und die Kornkammer Marchfeld, die sich in das tschechische Mähren bis Olmütz hineinzieht. Im Marchfeld fördert Österreich Erdöl und Erdgas. Gebiete mit hoher Industriedichte sind die Ballungsräume von Wien und Linz-Wels-Steyr, auch das Inntal um Innsbruck und das Murtal oberhalb von Graz. Die Wasserkraftwerke in Österreich an allen seinen Flüssen liefern 68 % des in diesem Staat erzeugten Stroms. Der Donauraum unterhalb von Wien weist höhere Sommertemperaturen und geringere Niederschläge als Mitteleuropa auf. Auf seinem Weg nach Budapest hat der Strom 5 Passau: Rathausplatz unter Wasser (Mai 1999) Foto: dpa die Kleine Ungarische Tiefebene (Kis Alföld) gequert, die sich auf der slowakischen Seite an den Flüssen Waag und Gran fortsetzt und den romantischen Durchbruch durch das ungarische Mittelgebirge am Donauknie geschaffen. Die 2330 m3/s Mittelwasser in Budapest entsprechen dem des Rheins in Holland. Das trockene Klima der Großen Ungarischen Tiefebene (Nagy Alföld) mit nur 600 mm Niederschlag lässt die Donau bis Paks, wo das ungarische Atomkraftwerk steht, um drei Prozent schrumpfen. Doch bei dem weiteren Lauf durch Ostslawonien und die Wojwodina (Ausläufer des Alföds) kommt der größte Zuwachs zustande: durch die Alpenflüsse Drau und Save und durch die Theiß. Die Save als wasserreichster Nebenfluss überhaupt entwässert nicht nur die Alpenkette der Karawanken, sondern auch die ebenso stark beregneten Dinarischen Gebirgszüge, wobei die berühmte Drina ihr größter Zubringer ist. Die Theiß als längster Donauzufluss mit einem riesigen Einzugsgebiet weist trotzdem kaum mehr Wasser auf als der Inn, denn sie sammelt nicht nur die hohen Abflüsse der Karpaten, sondern auch die sehr niedrigen des Alfölds. So wälzt die Donau unterhalb von Belgrad 5500 m3/s und dazu den Abfluss der serbischen Morava durch den gewaltigsten ihrer Gebirgsdurchbrüche, das Eiserne Tor in den Südkarpaten (siehe Titelbild). Diese 120 km lange Schlucht mit ihrem fels- und kataraktreichen Stromlauf, der die Schifffahrt früher zu einem gefährlichen Abenteuer werden ließ, wurde durch den 32 Meter hohen und bis zu 2300 Meter breiten Aufstau für das Wasserkraftwerk Djerdap gebändigt. Die 1971 fertig gestellte rumänisch-jugoslawische Gemeinschaftsanlage bietet in zwei Staustufen eine gigantische Elektrizitätsleistung von 2100 Megawatt. Schließlich nimmt die Donau noch mehrere rumänische Karpatenflüsse von Norden – als wasserreichsten den Pruth – und von Süden wasserärmere bulgarische Balkanflüsse auf und wächst so bis zum Delta auf 6900 m3/s an. Diese Zuflüsse und die Donau selbst ermöglichen in den sehr trockenen Flachländern der Walachei und der bulgarischen Platte – in der Dobrudscha beträgt der Jahresniederschlag nur 400 mm – Feldbau mit künstlicher Bewässerung. Hier wie auch in den ungarischen und kroatisch-serbischen Tiefländern ziehen sich unendliche Mais- und Weizenfelder hin. Auch in der Puszta, der einstigen Steppe an der ungarischen Theiß, wird heute Bewässerung mit Kanälen und Grundwasserbrunnen betrieben, zum Teil für Reisanbau im nördlichsten Reisgebiet der Welt. Regionen mit hoher Industriedichte findet man in Südosteuropa vor allem im Nordwesten: im slowakischen Waagtal um Bystrica, im Budapester Ballungsraum, zwischen Plattensee und Donau, sonst nur um Belgrad und im Bukarester Großraum. Im letzteren liegt bei Ploies˛ti das größte Erdölfeld Rumäniens. Hier stand die älteste Raffinerie der Welt. In Siebenbürgen wird vor allem Erdgas gefördert. In Galat˛i und Brǎila befinden sich Schiffswerften und die größten Stahlwerke, am ukrainischen Ufer die größten Häfen des Stromes. In Sulina endet die Donau offiziell. Der Sulina-Arm des Deltas führt zwar nur zehn Prozent des Wassers, ist aber der Hauptschifffahrtsweg zum Schwarzen Meer. Der Chilja-Arm (ukrainisch Kilija) ist mit 60 % der wasserreichste Mündungszweig. Literaturhinweise Die Donau und ihr Einzugsgebiet. Eine hydrologische Monographie. Regionale Zusammenarbeit der Donauländer 1986 Rod Heikell: Die Donau. Donaueschingen – Schwarzes Meer. Edition Maritim, Hamburg 1993 6 Ströme machen urbar das Land II. »Ströme machen urbar das Land« 1 Von Dietrich Rolbetzki Da Wasser für das Entstehen und Bestehen menschlicher Siedlungen von größter Wichtigkeit ist, ließen sich schon in frühester Zeit Menschen an der Donau nieder (siehe Kap. V. 4.). Aber der Strom gab nicht nur das Wasser zum Leben 2 und zur Bewässerung der Felder, er diente auch der Müll- und Abwasserentsorgung und verband die Siedlungen miteinander. Von alters her waren Flüsse die natürlichsten Verkehrswege. Man brauchte sie nicht erst anzulegen, musste dafür aber ihren Verlauf hinnehmen; zudem lauerten auf den Reisenden vielfältige Gefahren wie Untiefen, Stromschnellen, Riffe und Strudel, zu manchen Jahreszeiten musste jeder Schiffsverkehr ruhen und bevor es Dampfund Motorschiffe gab, war die Fahrt stromauf mehr als mühsam und beschwerlich. Die Donau von heute ist freilich wesentlich ruhiger und zahmer als in früheren Zeiten: Tückische Hindernisse wurden beseitigt, Staudämme errichtet, das Flussbett vertieft, der Lauf reguliert. Mit Einbäumen begann in der Steinzeit die Schifffahrt auf der Donau. Zu Beginn unserer Zeitrechnung war das vorn und hinten gewölbte Bretterschiff mit leicht schrägen Seitenwänden in Gebrauch, die Römer setzten flache Ruderschiffe mit dem Steuer auf der rechten Seite ein. Auch Flöße waren wohl schon früh auf der Donau unterwegs. Da die Fahrt stromauf bis ins 19. Jahrhundert sehr schwierig war, fuhren viele Schiffe nur stromab und wurden – der Bedarf an Brenn- und Bauholz war groß – am Zielort zerlegt und verkauft. Die Mannschaft wanderte auf Schusters Rappen an den Ausgangsort zurück. Stromauf zogen anfangs Menschen die Schiffe, seit dem 15. Jahrhundert wurden Pferde eingesetzt. Einem Vorreiter, der einen trittsicheren Pfad suchte, folgten bis zu 60 Tiere, die einen Schiffskonvoi zogen, der meist aus drei bis vier großen Schiffen und weiteren Hilfsfahrzeugen bestand und eine Länge bis zu 600 m haben konnte. Mehr als 20 km/Tag schaffte man nicht und brauchte so für die Strecke Wien-Linz zwischen zwei und drei Wochen (heute ein bis zwei Tage). Noch heute kann man in Österreich diese »Treppelwege« sehen, die jetzt teilweise als Radwege dienen. 1830 begann auf der Donau das Zeitalter der Dampfer. Die »Erste Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft« entwickelte sich in wenigen Jahrzehnten zur größten Flussreederei der Welt. Zwischen 1869 und 1896 gab es in Österreich auch die Kettenschifffahrt: An einer in der Fahrrinne liegenden Kette zogen sich die Schiffe vorwärts. Im 20. Jahrhundert verdrängten allmählich (Diesel-)Motorschiffe die Dampfer. Mitte der 50er Jahre ging man von der Zugzur Schubschifffahrt über: Die Schiffe wurden nicht mehr gezogen, sondern geschoben, was Kraft und Personal – und damit Kosten – sparte. Daneben gab es »Selbstfahrer« mit eigenem Ruder. Seit kurzem befahren auch FlussSee-Schiffe, vom Schwarzen Meer kommend, den Unterlauf der Donau. Flussschifffahrt einst ... (Ausschnitt aus der Trajanssäule in Rom) Foto: Bildarchiv Museum für Antike Schifffahrt, Mainz ... und heute Foto: Dietrich Rolbetzki Befördert wurden und werden auf dem Strom Menschen und Waren: im Mittelalter vor allem Holz, Erz, Salz und Wein, heute Baustoffe und Steine, Kohle, Erze, Schrott und Getreide. Eisenbahn und Motorisierung haben der Flussschifffahrt sehr zugesetzt. Die Schiffe sind zwar umweltfreundlicher, aber auch langsamer und erreichen nur die Orte am Strom. So gibt es die Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft seit einigen Jahren nicht mehr. Und der Personentransport beschränkt sich heute neben einem Städteschnellverkehr zwischen Budapest, Bratislava und Wien auf kurze Ausflugsfahrten (z. B. von Regensburg und Passau aus), Tagesausflüge (etwa von Wien, Linz und Passau aus) und auf Kreuzfahrten mit luxuriösen Schiffen, die u. a. von Nürnberg nach Budapest führen. Der 1992 fertig gestellte Rhein-Main-Donau-Kanal verbindet die von Kelheim bis Sulina auf 2414 km schiffbare Donau nun mit dem Atlantik, womit ein Binnenschifffahrtsweg von 3500 km Länge entstanden ist. Der Bau des Kanals – eine Verbindung zwischen Donau und Rhein hatte im 8. Jahrhundert schon Karl der Große geplant – verschlang 4,7 Mrd. DM3 und war heftig umstritten. Wäh- 7 rend sich die bayerische Landesregierung von ihm eine Entlastung von Bahn und Straße, neue Industrieansiedlungen in einem strukturschwachen Gebiet, Erweiterung des Handels und Ausbau von Binnenhäfen erhoffte, lehnten ihn Naturschützer wegen der gewaltigen Eingriffe in die Landschaft, vor allem im Altmühltal, und der Folgen für die Umwelt wie etwa die Senkung des Grundwasserspiegels ab. Bis heute haben sich die großen wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllt. Für die Länder Osteuropas sind der Seeweg über das Schwarze Meer und der Lkw-Transport weiterhin attraktiver und auch in Deutschland sind Bahn und Lastwagen schneller und billiger. Zudem friert in strengen Wintern der Kanal zu und angesichts der über hundert Brücken mit einer Durchfahrtshöhe von sechs Metern4 sind auch dem Containertransport Grenzen gesetzt. Kreuzfahrtschiffen und Wassersportlern allerdings hat der Kanal neue Möglichkeiten eröffnet. Da die Donau viele Staaten durchquert oder berührt, war eine Verständigung über die freie Handelsschifffahrt wichtig. Eine erste internationale Regelung brachte 1856 der Friede von Paris, der den Krimkrieg beendete. Zwei Kommissionen, zuständig für die »Seedonau« bis Brǎila bzw. den übrigen Strom bis Ulm, sorgten für die Durchführung der Bestimmungen und überwachten sie. Im Versailler Vertrag wurde die Donau ab Ulm flussabwärts internationalisiert. Ein in Paris 1921 unterzeichneter Vertrag setzte eine Europäische Donaukommission für die »Seedonau« und eine Internationale Donaukommission für die Donau von Brǎila bis Ulm ein. Ihre Arbeit beendete der Zweite Weltkrieg. 1948 schlossen die Sowjetunion, die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien, Ungarn und die Tschechoslowakei5 einen Vertrag um »die freie Schifffahrt auf der Donau (...) zu sichern«6. Die Mitglieder dieser »Belgrader Konvention« verpflichteten sich den Strom in »schiffbarem Zustand zu erhalten« und die Schifffahrt »nicht zu behindern oder zu stören«7. Eine Donaukommission8 überwacht die Durchführung der Bestimmungen. Von der Schifffahrt auf der Donau profitierten viele Ansiedlungen am Strom, Wien etwa, wo sich schon in alten Zeiten zwei wichtige Verkehrswege kreuzten, die Donau und die Bernsteinstraße. Schon im 12. Jahrhundert war die Stadt ein bedeutendes Handelszentrum. Heute finden sich wichtige Industriezentren Österreichs an der Donau (siehe Kapitel I.). Und es ist kein Zufall, dass neben Wien auch andere Städte am großen Strom Hauptstädte wurden: Bratislava, Budapest, Belgrad. Schifffahrt, Häfen, Werften, Fischfang boten Arbeitsplätze. Im Fluss bzw. Flusssand fanden sich Perlen und Gold. Die Donau bot auch dem Weinbau an ihren Ufern günstige Bedingungen. Für die Ernährung der Bevölkerung spielten die Donaufische einst eine wichtige Rolle und der Fluss war schon in der Antike für seinen Fischreichtum berühmt. In den Flussauen und Auwäldern gab es Vögel und Wild. Die unberührten Landschaften am Strom sind fast alle den Regulierungen zur Verbesserung der Schifffahrt zum Opfer gefallen; die Wasserverschmutzung hat die Berufsfischerei aussterben lassen. Der Rhein-Main-Donau-Kanal © Globus 9773 8 Von der Schifffahrt auf der Donau versuchten viele geistliche und weltliche Herren zu profitieren, indem sie immer neue Zoll- und Mautstellen errichten ließen (siehe Kapitel V.4.). Im 12. Jahrhundert etwa gab es allein zwischen Linz und Wien 77 davon. Wer am Flussufer Land besaß, hatte oft auch das »Strandrecht«: Auf Grund gelaufene Schiffe gehörten ihm. Da die Donau zum Teil eine recht starke Strömung hat, lag die Nutzung ihrer Wasserkraft nahe. Anfangs übernahmen das Schiffsmühlen: Zwischen zwei verankerten Kähnen befand sich ein breites Wasserrad; das Mahlwerk war auf einem der Schiffe oder an Land. Bei Hochwasser oder Eisgang konnte man die Schiffsmühlen zerlegen und in Sicherheit bringen. Im 20. Jahrhundert traten moderne Mühlen an ihre Seite, zunächst mit Dampf betriebene. Mit der Ausbreitung der Elektrizität erhielt die Wasserkraft eine noch viel größere Bedeutung. Zwischen 1953 und 1959 entstand in Ybbs-Persenbeug das erste österreichische Donaukraftwerk9. Bis heute folgten weitere acht. 1971 wurde am Eisernen Tor (siehe Kapitel I) gemeinsam von Jugoslawien und Rumänien das größte Donau-Wasserkraftwerk in Betrieb genommen. Ein gigantisches Gemeinschaftsunternehmen bei Gabčikovo (östlich von Bratislava bis ins Donauknie) planten seit 1977 auch die Tschechoslowakei und Ungarn. Angesichts der durch Donauumleitungen und Staustufen zu erwartenden Umweltschäden erzwang in den 80er Jahren eine mächtige Protestbewegung den ungarischen Rückzug aus dem Projekt. So wurde 1992 nur das slowakische Kraftwerk fertig gestellt (siehe Kapitel I.). Die Kraftwerke sind alle etwa gleich gebaut: Sie bestehen aus einem Staudamm, dem Krafthaus mit Turbinen, Generatoren, Transformatoren und der Schleusenanlage. Sie erzeugen nicht nur Strom, sondern kommen auch der Schifffahrt zugute, dienen dem Schutz vor Hochwasser und haben den durch die Flussregulierungen gesunkenen Grundwasserspiegel wieder gehoben; auch die Trinkwasserversorgung profitiert von ihnen. Wenn sich Donaueschingen und Furtwangen darum streiten, wer die echte Donauquelle besitze, dann stehen dahinter nicht nur wissenschaftliche Gründe, sondern durchaus handfeste materielle Interessen, denn der Fremdenverkehr bringt Einnahmen. Nicht nur die Donauquellen, auch viele einmalige Landschaften ziehen Touristen an. Im Strom kann man auch immer noch baden. Das Leben an der Donau hat aber seinen Preis. Starker Regen, Schneeschmelze oder Eisstau nach großer Kälte und plötzlich einsetzendem Tauwetter haben immer wieder katastrophale Hochwasser gebracht. 1342 starben in der Wiener Gegend über 6000 Menschen, 1954 war Linz zu 20 % überschwemmt. Die Flussregulierungen und die für die Kraftwerke errichteten Staudämme haben diese Gefahr gemindert, andererseits aber auch den Grundwasserspiegel verändert, Nebenarme abgeschnitten und Auenlandschaften zerstört. Zusammen mit der Industrie haben sie die Donau in weiten Teilen »ökologisch schwer geschädigt« (Karl-Markus Gauß). Eines der »größten Umweltdesaster der letzten Jahrzehnte« (Der Spiegel) verursachten die zyanidhaltigen Abwässer einer rumänischen Goldtrennungsanlage, die nach einem Dammbruch im Februar 2000 in die Theiß und dann in die Donau gelangten und zu einem großen Fischsterben führten. Die NATO-Luftangriffe 1999 gegen die jugoslawische Infrastruktur haben nicht nur Brücken zerstört und damit die Donau teilweise unpassierbar gemacht. Schadstoffe aus zerbombten Erdölraffinerien, Treibstoffdepots und Chemiefabriken sind in den Fluss gelangt. Seit Jahren sind Umweltschützer aktiv. Große Proteste der Bevölkerung und wohl auch Geldmangel haben bisher verhindert die Donau in Niederbayern zwischen Straubing und Vilshofen durch Ausbau das ganze Jahr über schiffbar zu machen. Das hätte den längsten auf deutschem Boden noch frei fließenden Donaulauf mit seinen »unberührte(n) Auenwälder(n) und Feuchtwiesen, in denen nahezu drei Viertel aller deutschen Brutvogelarten und 29 stark gefährdete Pflanzenarten vorkommen«10, zerstört. Österreichische Naturschützer haben den Bau des Wasserkraftwerkes bei Hainburg verhindert und damit den umfangreichsten Auwald Mitteleuropas gerettet, der seit 1996 als »Naturpark Donau-Auen« geschützt ist. Mit dem Ende der kommunistischen Diktatur in Rumänien ist die Zerstörung des Donaudeltas durch intensive landwirtschaftliche Nutzung gestoppt. 1990 hat man große Teile zum Biosphärenreservat erklärt und damit begonnen, die vorherigen Veränderungen wieder rückgängig zu machen. Anmerkungen 1 Friedrich Hölderlin, »Der Ister« Zur heutigen Trinkwassernutzung siehe Kapitel I. 3 Nimmt man den Ausbau von Main und Donau seit 1921 hinzu, als die Rhein-Main-Donau AG gegründet wurde, kommt man auf 6 Mrd. DM. Betrieb und Unterhalt kosteten 1996 ca. 250 Mio. DM. 4 Rhein: im Durchschnitt neun Meter 5 Österreich trat 1959 bei, Deutschland 1999. 6/7 In: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich vom 16. Februar 1960. 8 Vertreter der Verkehrsverwaltung der Bundesrepublik Deutschland nehmen seit 1957 an ihren Sitzungen teil. 9 An kleineren Flüssen gab es in Österreich schon seit 1886 Wasserkraftwerke. 10 Stuttgarter Zeitung Nr. 139, 20. 6.1995, S. 3 2 Literaturhinweis Reimund Hinkel: Wien an der Donau. Der große Strom, seine Beziehungen zur Stadt und die Entwicklung der Schiffahrt im Wandel der Zeiten, Wien 1995 9 Schauplatz europäischer Geschichte III. Schauplatz europäischer Geschichte 1. Die Donau: ein römischer Grenzfluss Von Martin Kramer Obere Donau 17/16 15–12 13–9 7/6 6 9 v. Chr. Noricum wird Klientelfürstentum v. Chr. Zentralalpen und Alpenvorland bis zur Donau v. Chr. Pannonien; Vorstoß zur Elbe v. Chr. Siegesdenkmal bei Monaco n. Chr. Aufstand in Pannonien n. Chr. Niederlage im Teutoburger Wald Die obere Donau wurde unter Augustus Reichsgrenze. In den Jahren 15–12 v. Chr. unterwarfen die Stiefsöhne des Augustus Tiberius (von Gallien aus) und Drusus (von Süden durch das Tal der Etsch) in einer groß angelegten Zangenbewegung die Zentralalpen und das Alpenvorland bis zur oberen Donau: Die Provinz Raetien wurde geschaffen. Sie war als südliche Aufmarschbasis gegen die Germanen vorgesehen. Tiberius entdeckte auf seinem Feldzug die Donauquellen in den Bergen des Schwarzwaldes. Bereits 17/16 v. Chr. war das Königreich Noricum kampflos römisches Klientelfürstentum geworden. Parallel dazu (13– 9 v. Chr.) unterwarf Agrippa (nach dessen Tod 12 v. Chr. Tiberius) die Pannonier an der mittleren Donau (Provinz 10 bzw. 33 n. Chr.). Auch dieser Vorstoß verfolgte weiter gehende strategische Ziele. Im Jahrhundert zuvor war Rom in einen erbitterten Kleinkrieg mit illyrischen Korsaren verstrickt worden, die die adriatische Seefahrt permanent bedrohten. Aus der militärisch gesicherten pannonischen Ebene heraus wurde das schwer zugängliche gebirgige balkanische Binnenland bis zur Adriaküste befriedet und zugleich die Verbindung zwischen oberer und unterer Donau hergestellt. Nach einem Aufstand in Pannonien und der vernichtenden Niederlage im Teutoburger Wald wurde die Eroberung Germaniens aufgegeben. Die römischen Legionen zogen sich hinter Rhein und Donau zurück. Untere Donau 146 80/70 44 46 107 v. Chr. Provinz Makedonien v. Chr. Vorstöße zur unteren Donau n. Chr. Provinz Mösien n. Chr. Provinz Thrakien n. Chr. Provinz Dacien Die untere Donau war als Grenze bereits ins Auge gefasst worden, als Makedonien Provinz wurde (146 v. Chr.). Zwischen 80 und 70 v. Chr. erreichten mehrere makedonische Statthalter im Kampf mit den Thrakern den Unterlauf der Donau. Aber erst nach den Bürgerkriegswirren gelang es, zunächst ein thrakisches Klientelfürstentum (etwa dem heutigen Bulgarien entsprechend) zu errichten. Unter den Nachfolgern des Augustus wurden die Provinzen Mösien (44 n. Chr.) und Thrakien (46 n. Chr.) eingerichtet. Rom hatte damit die Herrschaft über den Balkan gesichert und die untere Donau zur Reichsgrenze gemacht. Zu Beginn des 2. Jahrhunderts errichtete Trajan die Provinz Dacien als weit über die Donau hinaus nach Norden vorgeschobenen Vorposten. Mit 60 000 Soldaten, die im Donauraum zusammengezogen worden waren, überschritt Trajan beim heutigen Turnu Serverin die Donau auf einer über einen Kilometer langen Holzbrücke, die auf 20 steinernen Pfeilern ruhte. Überreste sind heute noch am Donauufer zu sehen. »Nasser« Limes 1. Jahrhundert: Sicherung der Donaugrenze durch Holz-Erde-Lager/Kastelle 2. Jahrhundert: Aus- und Neubau von Grenzkastellen aus Stein 3. Jahrhundert: Nach Aufgabe des obergermanisch/rätischen Limes Reorganisation und Ausbau des Donau-Limes 4. Jahrhundert: Verstärkung der bestehenden Anlagen, Neuanlage von Wachtürmen und Kleinkastellen Abhängig vom Bedrohungspotenzial wurde die Donaugrenze seit der Mitte des 1. Jahrhunderts durch Legionslager, Kastelle und Straßen befestigt. So befindet sich beispielsweise auf der Strecke zwischen Oberstimm und Linz weder Lager noch Kastell, weil auf der gegenüberliegenden Seite Wälder und Sumpfgebiete lagen bzw. durch Verträge germanische »Pufferstaaten« gebildet wurden. Dagegen wurde im strategisch wichtigen Wiener Becken ein Legionslager in Carnuntum und wenig später auch ein Reiterlager in Vindobona (Wien) angelegt. Hier verlief die alte Bernsteinstraße von der Ostsee nach Süden, die eine ideale Einbruchslinie bildete. Erst Ende der 60er-Jahre wurden in Carnuntum (zwischen Deutsch-Altenburg und Petronell in Niederösterreich) systematische Ausgrabungen vorgenommen, die zeigten, dass das Legionslager zunächst als einfaches Holz-ErdeLager angelegt worden war: tiefer Graben, Erdwall, Innenbauten und Tore aus Holz. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Carnuntum zu einem militärischen und politischen Zentrum. Im Heerlager war die gesamte XIV. Legion stationiert (ca. 6000 Fußsoldaten und 120 Reiter), in der Garnisons- und Zivilstadt dürften bis zu 50 000 Bewohner gelebt haben: Rom an der Donau. Unter Trajan zu Beginn des 2. Jahrhunderts wurde entlang der Donau eine dichte Kette von steinernen Grenzkastellen angelegt. In Bulgarien wird seit einigen Jahren das Donau-Kastell Iatrus bei Swischtow freigelegt. Diese Grabung ist vor allem deshalb interessant, weil Iatrus nach der Aufgabe der DonauGrenze auch als Siedlung aufgegeben wurde. Deshalb ist es als Gesamtanlage – wenn auch in Ruinen – noch vorhanden und nicht wie zahlreiche andere Kastelle und Legionslager unter späteren Siedlungen verschwunden. 10 An der oberen Donau war Regensburg das einzige Legionslager der Provinz Rätien (Ausdehnung ca. 25 ha). Teile des Nordtores, der Porta Prätoria zur Donau hin, und große Teile der Umfassungsmauer sind noch erhalten. Augustus und seine Nachfolger arrondierten die Grenzen des Römischen Reiches, indem sie sie an die geographisch günstigen, natürlichen Grenzen von Rhein und Donau (im Osten an den Euphrat) heranschoben. Zum Schutz der offenen »Germanenflanke« zwischen Rhein und Donau planten und errichteten sie den Limes, der einen Teil des Neckars mit einbezog, aber sonst ohne Rücksicht auf landschaftliche Gegebenheiten Rhein und Donau verband. Romanisierung Nach Eroberung und Besetzung ermöglichte der stetige Ausbau der Donaugrenze eine ruhige innere Entwicklung. Ausgangspunkt dieser »Romanisierung« waren die Legionslager und Garnisonsstädte. Zunächst blieben die eroberten Gebiete Besatzungsland. Der Provinzstatus und damit eine zivile Verwaltung folgte oft erst Jahre später. Die Besatzungstruppen stammten vorwiegend aus weit entfernten, neu eingerichteten Provinzen. In Noricum waren z. B. Britannier, Bataver und Legionäre aus Kleinasien stationiert. Auf zahllosen Grabsteinen sind nicht nur Name und militärische Einheit überliefert, sondern auch persönliche Ruhmestaten. Ein batavischer Reiter rühmt sich: »Ich bin der Mann, berühmt an den Ufern Pannoniens, tapfer und der erste unter tausend Batavern, der unter den Augen Hadrians es fertig brachte, die breiten Gewässer der Donau in voller Rüstung zu durchschwimmen.« Die Legionäre brachten die römische Lebensweise mit, aber auch ihre eigenen Kulte, Moden und Traditionen. Dem Militär folgten römische Kolonisten, die sich ihre Gutshöfe und Landsitze bauten und das Land erschlossen. Im 2. und 3. Jahrhundert standen die illyrischen und pannonischen Legionen, inzwischen zum großen Teil aus Einheimischen rekrutiert, im Ruf besonders einsatzfreudig und schlagkräftig zu sein. Wann immer das Reich in Not geriet, wurden sie gerufen. Schließlich griffen sie direkt in die Reichspolitik ein und riefen mehrere Kaiser aus: die Soldatenkaiser, die oft aus diesen Provinzen stammten. Ihre Regierungszeit war meist kurz und kaum einer starb eines natürlichen Todes, aber dennoch gelang es ihnen immer wieder das krisengeschüttelte Reich zu stabilisieren und vor allem die Donaugrenze gegen die Welt der Barbaren zu sichern. Die Römer fanden an der Donau eine gut funktionierende Schifffahrt vor. Aus der schriftlichen Überlieferung und Reliefdarstellungen weiß man, dass die Donau durch eine Kriegsflottille gesichert und kontrolliert wurde. Es handelte sich um kleine, schnelle und wendige, meist mit zwei Ruderdecks ausgestattete Schiffe. Auch für Transporte wurde der Fluss benutzt: für Truppen, Baumaterial und Nachschubgüter. 1994 wurden beim Kastell Oberstimm in Österreich zwei Patrouillenboote freigelegt: 15 Meter lang, für 25 Mann Besatzung, aus der Zeit zwischen 90 und 112 n. Chr. Diese Schiffe werden in einem aufwendigen und langwierigen Verfahren im neu eröffneten Mainzer »Museum für Antike Schifffahrt« konserviert. Dort sind auch zahlreiche Funde der Rheinflotte ausgestellt, sowie Nachbauten in Originalgröße. Niedergang 176 n. Chr. Markomannen, Quaden und Sarmaten durchbrechen die Donaugrenze im Wiener Becken 260/70 n. Chr. Aufgabe des obergermanisch-rätischen Limes. Sarmaten u. Goten fallen in die Provinz Mösien ein. Ende 4. Jh. Ansiedlung von Ost- und Westgoten in Pannonien und Thrakien. Reichsteilung Ende 5. Jh. Untergang Westroms Fast ein halbes Jahrtausend hielt die Rhein-Donaugrenze, auch nachdem die römischen Truppen den obergermanischen und rätischen Limes aufgaben und sich hinter die beiden Grenzflüsse zurückzogen. Sie war die vielleicht längste und beständigste Grenze Europas – und eine, die noch lange nachwirkte. Die Gebiete diesseits nahmen teil an der zivilisatorischen Entwicklung und am Wohlstand des Römischen Reiches. Jenseits dieser Strukturgrenze stagnierte die Entwicklung jahrhundertelang bzw. blieb abhängig von der römischen Hochkultur, erkennbar an den reichen Importen römischer Erzeugnisse, denen keine gleichwertigen einheimischen Produkte entgegenstanden. Die allmähliche Auflösung der Donaugrenze erfolgte im 3. Jahrhundert unter dem Druck der Barbaren und aufgrund einer krisenhaften ökologischen und ökonomischen Entwicklung im Inneren des Römischen Reiches. Die Erschöpfung der Böden durch intensive Landwirtschaft und der Raubbau am Wald für Bauten aller Art, Heizmaterial und Produktion von Eisen, Ton und Glas führte zu einer schweren Agrarkrise. Die Einfälle der Germanen trugen dazu bei, das militärische Sicherungssystem zu durchlöchern. Kastelle wurden eingenommen und zerstört, Garnisonsstädte verfielen, aber auch die Truppenstärke wurde kontinuierlich reduziert. Die romanische Bevölkerung verlor zunehmend den Rückhalt. Aufgegeben von der zentralen Reichsverwaltung und ohne Schutz des Militärs blieben Städte und Dörfer sich selbst überlassen. Und nun zeigte sich, dass es einen Unterschied zwischen Romanen und einheimischer Bevölkerung nach wie vor gab. Ein Teil der Romanen, vor allem Angehörige der Oberschicht, zog sich über die Alpen in die Sicherheit des Kernreiches zurück oder wurde vertrieben. Zurück blieb eine ausgedünnte einheimisch-romanische Mischbevölkerung, die sich mit den eindringenden Barbaren arrangieren musste. Literaturhinweise Wolfgang Czysz: Die Römer in Bayern. Stuttgart 1995 Kurt Genser: Der Donaulimes in Österreich. Winnenden 1990 Hans-Peter Kuhnen (Hrsg.): Gestürmt – Geräumt – Vergessen? Der Limesfall und das Ende der Römerherrschaft in Südwestdeutschland. Stuttgart 1992 Dieter Maier/Erich Lessing: Die Donau. München 1982 Ulmer Museum (Hrsg.): Römer an Donau und Iller. Sigmaringen 1996 Leo Weber: Als die Römer kamen. Landsberg 1975 Michael W. Weithmann: Balkan-Chronik. 2000 Jahre zwischen Orient und Occident. Regensburg 1995 11 2. Christianisierung im Donauraum Von Martin Kramer 64 n. Chr. ca. 64/65 303–305 312 380 476 716 Christenverfolgung unter Nero (54–68) Tod des Petrus und Paulus in Rom Christenverfolgung unter Diokletian (284–305) »Bekehrung« Konstantins (306/312–337) Toleranzedikt des Theodosius (375–395) Ende Westroms Beginn der Mission des Winfried-Bonifatius Trotz mehrerer Verfolgungswellen – die schlimmste, zugleich aber auch die letzte, fand unter Diokletian statt – hatte sich das Christentum zu Beginn des 4. Jahrhunderts vor allem in der Osthälfte des Römischen Reiches ausgebreitet. In Kleinasien bekannte sich fast die Hälfte der Bevölkerung dazu. In der Westhälfte des Reiches hingegen konnte das Christentum nur in wenigen Gebieten, vor allem in den Städten, Fuß fassen. Von der Prinzipatszeit bis in die Spätantike waren die römischen Städte Umschlagplatz für Handel und Gewerbe und zugleich kulturelles Zentrum. Sie waren die Träger der heIlenistischen Mischkultur, während das Land noch stark an regionalen, vorrömischen Kulturen orientiert war. Deshalb entstanden christliche Stadtgemeinden umgeben von ländlichen Gebieten mit den verschiedensten Kulten. Vor allem unter Legionären und Hilfstruppen an Donau und Rhein verbreitete sich der aus Persien stammende Kult des Sonnengottes Mithras. Zahlreiche Mithrasheiligtümer lassen sich in den Kastellen und Legionslagern entlang der Donau und des Limes nachweisen, ebenso Abbildungen des Sol invictus, Jupitersäulen und Darstellungen verschiedener anderer Götter. Frühe christliche Zentren an der Donau sollen während der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts in Singidunum (Belgrad), Carnuntum, (zwischen Deutsch-Altenburg und Petronell in Niederösterreich), Lauriacum (Lorch) und Castra Regina (Regensburg) entstanden sein. Versuche, die Größe dieser Gemeinden und das Zahlenverhältnis zu den Nichtchristen bestimmen zu wollen, bleiben allerdings hypothetisch, weil es kaum schriftliche Quellen gibt und die archäologischen Befunde äußerst dürftig sind. In Carnuntum, dem größten Legionslager an der Donau, konnte bisher keine Kirche nachgewiesen werden. Auch Grabsteine mit christlichen Inschriften fehlen. In Aalen, dem größten Reiterkastell nördlich der Alpen, wurde die erste Kirche erst nach der Aufgabe des Limes gebaut. Wahrscheinlich waren Berufssoldaten, ob nun Legionäre mit römischem Bürgerrecht oder Hilfstruppen, die es erst durch ihren 25-jährigen Dienst erwerben wollten, für die christliche Botschaft nicht sehr empfänglich. Überliefert sind zwei Heiligenlegenden aus jener Zeit, die zeigen, dass das Christentum nur von Einzelnen oder kleinen Gruppen übernommen wurde. 304, während der diokletianischen Verfolgung, soll der Kanzleibeamte Florian in Lauriacum (Lorch) den Märtyrertod gestorben sein. Man stürzte ihn mit einem um den Nacken gebundenen Mühlstein von einer Brücke in die Enns. Albrecht Altdorfer, Die Bergung der Leiche des Hl. Florian, um 1520 Germanisches Nationalmuseum Nürnberg Gm 315 Als die Grenze an der Donau Mitte des 4. Jahrhunderts bereits brüchig geworden war und die römischen Truppen sich ins Hinterland zurückzogen, tauchte in den Provinzen Pannonien und Ufernoricum ein Römer unbekannter Herkunft namens Severinus auf. Er wanderte an der Donau von einer Stadt zur anderen und avancierte nicht nur zu einer moralischen Autorität, die zur Unterstützung der Armen aufrief und das Horten von Getreide anprangerte, sondern auch zu einer lokalen politischen Größe, die nach dem Zusammenbruch des Hunnenreiches mit den untereinander rivalisierenden Barbaren-Königen und Stammeshäuptlingen verhandelte. In Passau soll er der Legende nach eine kleine Mönchszelle gegründet haben. Dieses spärliche provinzialrömische Christentum, das sich in den ersten vier Jahrhunderten südlich der Donau im Gefolge der Romanisierung entwickelt hatte, ging durch die germanische Völkerwanderung (4./5. Jahrhundert) und die awarisch-slawische Landnahme (um 600) völlig unter. Erst nach über zwei Jahrhunderten setzten christliche Missionare wieder ihren Fuß in die ehemaligen römischen Provinzen. Der gesamte Balkan wurde im 9. und 10. Jahrhundert in Konkurrenz zu römischen Missionaren, die von der Adriaküste und vom germanischen Westen aus operierten, von Byzanz aus für das Christentum gewonnen. Die Brüder Konstantin und Methodius drangen seit 863 über Bulgarien und Serbien bis nach Mähren vor. Sie entwickelten eine an der Volkssprache 12 orientierte Schriftsprache, das Kirchenslawisch, in das Bibel und Schriften der Kirchenväter übersetzt wurden, im Gegensatz zur römischen Kirche, die in Gottesdienst und Schrift am Lateinischen festhielt. In Pannonien stieß Methodius nach dem Tod seines Bruders 870 auf die kirchenpolitischen Ansprüche des Erzbistums Salzburg, das für die Missionierung und kirchliche Erschließung des Alpenraums zuständig war und sich gegen die griechische Konkurrenz durchsetzte. In den folgenden Jahrhunderten entstand an der Drina, die einst die Grenze zwischen westlicher und östlicher Reichshälfte markiert hatte, eine neue Strukturgrenze, die bis in die Gegenwart hinein besteht. Sie trennt lateinischkatholische und griechisch-orthodoxe Christen und seit der Osmanenzeit auch Christentum und Islam. An der oberen Donau wurde das Herzogtum Baiern zum missionarischen Ausgangspunkt des frühmittelalterlichen Christentums. Regensburg wurde zum ersten christlichen Zentrum. Träger der Mission war das Mönchtum, das unter dem Schutz und im Auftrag der adligen Grundherren Klöster als geistliche Brückenköpfe und landwirtschaftliche Musterbetriebe gründete. Erst danach folgte der Auf- und Ausbau der Kirchenorganisation: Kirchen und Kapellen wurden gebaut, Bistümer eingerichtet und abgegrenzt. Von Regensburg aus wurde flussaufwärts, am Donaudurchbruch, bereits zu Beginn des 7. Jahrhunderts das bairische »Urkloster« Weltenburg gegründet. Flussabwärts stifteten ein Jahrhundert später die Agilolfinger das Kloster Niederalteich. Zur gleichen Zeit entstand das Donaubistum Passau, abhängig von Salzburg. Von Passau aus wurden bis zum Ausgang des 10. Jahrhunderts die Gebiete donauabwärts bis nach Pannonien missioniert und kirchlich erschlossen (siehe oben). Die Übernahme des Christentums durch die bäuerliche Bevölkerung – Städte gab es in den ehemaligen Donauprovinzen des untergegangenen Römischen Reiches im Unterschied zum italischen Kernland nicht mehr – war eine Frage der Gefolgschaftstreue, keine Glaubensentscheidung. Massenübertritte und Massentaufen in Flüssen waren nicht selten. Oft blieb die Übernahme des Christentums deshalb ein dünner Firnis, unter dem heidnische Riten und Götter als Volksbräuche weiterlebten. Der Übertritt heidnischer Herrscher oder ganzer Völker zum Christentum war nicht nur ein religiöser, sondern auch ein politischer und kultureller Akt. Vielleicht noch schwerer aber wog die kulturelle Attraktivität des Christentums, denn die christliche Kirche »repräsentierte mit ihrer systematischen Theologie und Hierarchie ein letztes Stück antiker Strukturen« (Imanuel Geiss, S. 21). Sie bewahrte und überlieferte die letzten Reste der zertrümmerten und weitgehend untergegangenen griechisch-römischen Kultur. Christentum bedeutete Schriftlichkeit, die Kirche zivilisierte das halbbarbarische Europa bis weit ins Mittelalter hinein: »Europas Weg in die Moderne führte nur durch das Nadelöhr der Kirche und ihres Lateins.« (Geiss, S. 21) Literaturhinweise Carl Andresen: Geschichte des Christentums I. Von den Anfängen bis zur Hochscholastik. Stuttgart usw. 1975 Peter Brown: Die Entstehung des christlichen Europa. München 1999 Imanuel Geiss: Europa – Vielfalt und Einheit. Eine historische Erklärung. Mannheim 1993 Adolf v. Harnack: Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. 4. Auflage, Leipzig 1924 Christina Lutter/Helmut Reinitz (Hrsg.): Römer und Barbaren. Ein Lesebuch zur deutschen Geschichte von der Spätantike bis 800, München 1997 Bernd Moeller: Geschichte des Christentums in Grundzügen. 6. Auflage, Göttingen 1996 Friedhelm Winkelmann: Geschichte des frühen Christentums. München 1996 Kloster Weltenburg Foto: Helga Glasner 13 3. »1100 Jahre in Europa«: die Ungarn Von Dietrich Rolbetzki Budapest 1896, Hösök tér/Heldenplatz. Ein Volk erinnert sich seiner Herkunft. Tausend Jahre zuvor hatten seine Vorfahren, vom östlichsten Rand Europas kommend, das Tiefland an Donau und Theiß in Besitz genommen. Eine Ausstellung, später an ihrer Stelle ein Denkmal, um seinen Sockel herum zu Pferd die sieben Stammesfürsten aus der Zeit der Landnahme, allen voran ihr Anführer Árpád, entschlossen und Furcht erregend. Budapest 1989, Hösök tér/Heldenplatz. Ein Volk trauert. Vor dem Denkmal, mit der rot-weiß-grünen Nationalfahne bedeckt, die Särge mit den sterblichen Überresten Imre Nagys, Ministerpräsident während des Aufstands 1956, und seiner vier Schicksalsgefährten. Drei Jahrzehnte zuvor hingerichtet und verscharrt werden sie nun in einem würdevollen Staatsakt rehabilitiert. Der Redner: ein (Reform-)Kommunist, Mitglied der Partei, die die Toten auf dem Gewissen hat und sich nun vor ihnen verbeugt. Knapper und anschaulicher als in diesen Momentaufnahmen lässt sich Ungarns Geschichte kaum darstellen: fremde Eroberer, die zu Europäern wurden, und Unterdrückte, die sich immer wieder leidenschaftlich für ihre und auch die Freiheit Europas erhoben haben. »Geißel Gottes«? Wie jener Árpád aus Bronze haben wohl die Vorfahren der heutigen Ungarn um 896 von den Karpatenhöhen in das Tiefland an der Donau hinunter geschaut: ein Steppenreitervolk, dessen Heimat zwischen Wolga und Ural gelegen hatte. Sie suchten nicht nur neue Weiden, sondern waren vor allem auf der Flucht vor Völkern, gegen die sie in byzantinischem Auftrag gekämpft und verloren hatten. Anführer der sieben verbündeten Stämme war Árpád, ein Magyar, später wurde das ganze Volk so genannt; die Bezeichnung »Ungar« kommt von den türkischen Onoguren, denen die Magyaren auf ihrer Westwanderung vorübergehend angehört hatten. Die Eroberung des Tieflands an der Donau und Siebenbürgens lief wohl recht friedlich ab und Neuankömmlinge und Eingesessene – eine Mischung aus Skythen, Kelten, Römern, Germanen, Hunnen, Awaren und Slawen – verschmolzen allmählich miteinander. Bei ihrer Ankunft waren die Ungarn Halbnomaden: Ein Teil lebte vom Ackerbau, der andere von Viehzucht und Beutezügen. Von Byzanz bis Spanien war kaum ein Europäer vor den magyarischen Reitern sicher. Aber die Drangsalierten organisierten Gegenwehr und 955 schlug der deutsche König Otto I. die Ungarn bei Augsburg vernichtend. herbei und gab mit seiner Taufe ein Beispiel. Sein Sohn Stephan I. (997–1038), getauft auf den Namen des Patrons von Passau, heiratete die bayerische Herzogstochter Gisela, Schwester des späteren Kaisers Heinrich II. Stephan brach mit der Vergangenheit und wurde Staatsgründer: – Im Jahre 1000 fand seine Königskrönung statt; die Krone erhielt er mit Billigung des deutschen Kaisers Otto III. vom Papst. Ungarn hatte sich damit für Europa entschieden, geriet aber nicht in ein Lehensverhältnis zum Kaiser. – 1001 erbat er von Otto III. die Errichtung eines Erzbistums an seinem Regierungssitz Esztergom (Gran). Die ungarische Kirche unterstand damit nur Rom. – Die Stammes- und Sippenverbände wurden zerschlagen und Ungarn ein Staat nach westeuropäischem Vorbild. Dabei kam Stephan zugute, dass mit seiner Frau zahlreiche Deutsche – Priester, Ritter, Beamte – ins Land gekommen waren. Unter Stephans Nachfolgern wurde der ungarische Staat größer (seit etwa 1100 gehörte Kroatien dazu) und wuchs immer enger mit Europa zusammen. Dennoch blieb wegen der Herkunft aus der Fremde und der nichtindoeuropäischen Sprache ein Gefühl der Isolierung, ein »Einsamkeitskomplex« (Paul Lendvai). Der Ansturm der Mongolen 1241/42 verwüstete weite Teile des Landes und forderte viele Menschenleben. Béla IV. (1235–1270) leitete den Wiederaufbau ein, ließ Burgen gründen, Städte befestigen und Siedler aus Mitteleuropa holen. Er gilt als »zweiter Staatsgründer«. Ein Jahrhundert später näherte sich aus dem Südosten Europas ein neuer Feind: die Türken. Dass Ungarn ihnen zunächst nicht erlag, hat es v. a. dem äußerst begabten Heerführer János Hunyádi zu verdanken. 1456 konnte er sie bei Belgrad zum Stehen bringen: Die Ungarn wurden damit zum »Beschützer des Christentums« (Paul Lendvai). Das mittäg- Schutzschild des Abendlandes Die Niederlage führte zu einem »Umdenk- und Lernprozess« (Laura Conti): Die Magyaren wurden sesshaft, Teil Europas und behielten doch ihre Identität. Großfürst Géza (992–997) rief Priester des Erzbistums Passau zur Mission Budapest, Heldenplatz: Standbilder der ungarischen Stammesfürsten von 896 Foto: Dietrich Rolbetzki 14 liche Glockenläuten im katholischen Europa bis heute geht auf eine päpstliche Anordnung zurück: vor der Schlacht als Bitte an Gott, danach als Ausdruck der Freude. Unter seinem Sohn Mátyás I. (Matthias I.) erlebte das Land eine neue Blütezeit. Er eroberte Mähren, Schlesien, die Lausitz, die Steiermark, Kärnten und Niederösterreich mit Wien. Ungarn war nun mächtigstes Reich in Mitteleuropa. Was Matthias I. geschaffen hatte, ging nach seinem Tod schnell wieder verloren. Auseinandersetzungen um den Thron, Kämpfe zwischen den Adelsfamilien und Bauernaufstände »trieben das Land binnen kurzem an den Rand des Abgrunds« (Paul Lendvai). Mohács: Auf dem Schlachtfeld von 1526 (6 km südlich der Stadt) erinnern Holzplastiken an die Katastrophe Foto: Dietrich Rolbetzki Unter fremden Herren Alle zwei Jahre werden im Park des Schlosses von Nagyvázsony, nahe Veszprém, Reiterspiele aufgeführt, bei denen unter dem Jubel der Zuschauer die Ungarn Türken besiegen. Die Ruinen der Burg des legendären Türkenbezwingers Pál Kinizsi liegen nur ein paar hundert Meter entfernt. Doch die Festspiele feiern nur Anfangs- und Augenblickserfolge. 1526 schlug die Armee Sultan Suleimans II. bei Mohács an der Donau das »schlecht ausgebildete und dilettantisch geführte« (Paul Lendvai) ungarische Heer vernichtend. Mohács war eine »nationale Katastrophe« (Paul Lendvai). Für Jahrhunderte verloren die Ungarn ihre Selbstständigkeit. Ihr Land war die nächsten 150 Jahre dreigeteilt: – Habsburg, dem durch einen Erbvertrag (siehe Kapitel VI.4.a)) nach dem Tod Ludwigs II. in der Schlacht von Mohács das ganze Land zugefallen war, regierte den Westen (»Königliches Ungarn«) mit harter Hand und rekatholisierte ihn, nachdem sich zunächst der Protestantismus rasch ausgebreitet hatte; die Deutschen tendierten zu Luther, die Ungarn zu Calvin. – Zentralungarn wurde Teil des Osmanischen Reiches und hatte besonders zu leiden unter der Fremdherrschaft. Es herrschte allerdings weitgehend religiöse Freiheit. Islamische Kultur kam ins Land (siehe Kapitel III.4.b)). GRAN (Esztergom) – Das Fürstentum Siebenbürgen erlangte unter dem Schutz der türkischen Sultane eine gewisse Eigenständigkeit. Es war wohlhabender als die anderen beiden Reichsteile, entwickelte sich zum »Zufluchtsort der ungarischen Kultur und Staatsidee« (Paul Lendvai) und trug damit zum Überleben der Nation entscheidend bei. 1683 siegte eine europäische Streitmacht bei Wien über die Türken. Erst jetzt konnten die Habsburger ihr gesamtes Erbe antreten. Der Friede von Karlowitz beendete 1699 die Herrschaft des Osmanischen Reiches über Ungarn. Die Magyaren hatten freilich nur den Herrn gewechselt. Die Militärverwaltung war streng, die Steuern hoch und die Protestanten wurden gewaltsam rekatholisiert. Nur Wien treu ergebene ungarische Magnaten behielten Besitz und Privilegien, kaiserliche Offiziere wurden mit Grundbesitz belohnt. In den verwüsteten und entvölkerten Gebieten wurden deutsche (siehe Kapitel III.5.) und slawische Kolonisten angesiedelt, wodurch die Ungarn zur Minderheit wurden (1787 unter 40 Prozent). • KRONSTADT (Brasso) Ungarn zur Zeit der Türkenherrschaft Zeichnung: Peter Steinheisser 15 Reformen, nicht Umsturz wollte Széchenyi, doch erfasste die Pariser Februarrevolution 1848 auch Ungarn. Mitte März kam es in Pest zu einer Demonstration, auf der Pressefreiheit, ein eigenes Parlament, eine eigene Regierung und der Abzug der österreichischen Truppen gefordert wurden. Wien stimmte zu. Lajos Kossuth (1802–94) auf einer ungarischen Briefmarke (1953) Der Kuruzzenaufstand auf ungarischen Briefmarken (1953) So brach denn 1703 unter der Führung von Fürst Ferenc II. Rákóczi der Aufstand der Kuruzzen (»Rebellen«) gegen die habsburgische Herrschaft aus. Der Freiheitskampf endete 1711 mit einer Niederlage, denn Österreich war übermächtig, die Führung wenig fähig und Hilfe von außen, von Frankreich oder Russland, blieb weitgehend aus. Dass Wien die Vorrechte des ungarischen Adels (u. a. Steuerfreiheit, uneingeschränkte Verfügung über die Leibeigenen) nicht antastete und die praktisch in der Hand der Stände liegende Exekutivgewalt auf Komitatsebene (Verwaltungsbezirke) bestehen ließ, sollte sich während der Kriege um Schlesien Mitte des 18. Jahrhunderts auszahlen. Als Maria Theresia die Ungarn 1741 persönlich um Beistand bat, retteten sie Österreich. Die Angst um die Vorrechte und vor einer Revolution ließen auch im Zeitalter Napoleons keine nennenswerte Opposition gegen Habsburg aufkommen. Zu dieser Zeit war Latein die Amtssprache Ungarns, doch nun forderte eine nationale Erneuerungsbewegung es durch Ungarisch zu ersetzen, was 1844 geschah. An ihrer Spitze standen Adelige wie Graf István Széchenyi (1791–1860). Graf István Széchenyi (1791–1860) Ölgemälde von Barabás Miklós (1848) Aus: Magyar Nemzeti Múzeum. (Hg): Fodor István, Budapest 1992 Ein ungarisches Parlament wurde gewählt, eine Regierung gebildet und Reformen durchgeführt. Doch nach dem Sieg der Gegenrevolution in Österreich wurde Ungarn eine reaktionäre Verfassung aufgezwungen. Daraufhin erklärten die Ungarn im Frühjahr 1849 ihr Land für unabhängig. Lajos Kossuth (1802–94), von Anfang an der führende Kopf der ungarischen Revolution, wurde Reichsverweser. Österreichische und russische Truppen zwangen die Ungarn ins Habsburger Reich zurück. Von den Reformen bleib nur die Bauernbefreiung. »Kakanien«: Ungarn im Zeitalter des Dualismus Fast zwei Jahrzehnte später musste Wien die Ungarn zu gleichberechtigten Partnern machen. Die Niederlage von 1866 und der damit verbundene »Hinauswurf« aus Deutschland machte Kaiser Franz Joseph I. zum »Ausgleich« von 1867 bereit und der ungarische Politiker Ferenc Deák (1803–76) nutzte die Gunst der Stunde. Das Ergebnis (siehe auch Kapitel III.4.a)): ein Herrscher, drei gemeinsame Ministerien (für Außenpolitik, Armee und gemeinsame Finanzen), aber zwei Regierungen und zwei Parlamente. Die Ungarn, die nicht einmal die Mehrheit in ihrer Reichshälfte stellten, waren die Gewinner, die anderen Nationalitäten gingen leer aus und sahen sich bald starker Magyarisierung ausgesetzt. Dahinter verbargen sich ungarische Ängste, in der Mehrheit unterzugehen, Sendungsbewusstsein und Überheblichkeit. Vom »Ausgleich« profitierte auch Ungarns Wirtschaft. Motor der Industrialisierung wurde der Eisenbahnbau. Das Land wandelte sich vom reinen Agrarstaat »zu einem agroindustriellen Staat« (Paul Lendvai). Die Verstädterung schritt voran und Budapest wurde zur siebtgrößten europäischen Metropole (siehe Kapitel V.5.). Die Gesellschaft blieb dennoch feudal geprägt. Kirche und Großgrundbesitzer verfügten über mehr als ein Drittel des Landes und hatten die politische Macht. Neben dem Adel entstand ein Großbürgertum, das Banken und Industrie kontrollierte und dessen Mitglieder oft geadelt wurden. Während die reichsten Magnaten in unvorstellbarem Luxus schwelgten, gab es auf dem Lande unzählige arme Bauern und Tagelöhner. 16 Endlich frei: Ungarn zwischen den Weltkriegen Die Niederlage 1918 bedeutete das Ende der Donaumonarchie. Am 31. Oktober übernahm in Budapest ein Nationalrat die Regierungsgeschäfte und rief wenig später die Republik aus. Der ungarische Reichsteil zerfiel, das soziale Elend wuchs; vorübergehend versuchten linke Sozialisten und Kommunisten 1919 eine Räterepublik zu errichten. Soldaten der von einer Gegenregierung aufgestellten neuen ungarischen Nationalarmee unter Miklós Horthy de Nagybánya (1868–1957) machten dem Experiment ein Ende. 1920 wählte das ungarische Parlament Horthy zum Reichsverweser; man wollte die Monarchie, nicht aber die Habsburger. Ungarn war damit ein Königreich ohne König. Zwei Versuche des letzten österreichisch-ungarischen Kaisers Karl I. seinen Thron in Budapest einzunehmen scheiterten 1921 kläglich und führten zur Absetzung des Hauses Habsburg. Im Frieden von Trianon 1920 verlor Ungarn zwei Drittel seines Gebietes. Millionen Magyaren mussten nun unter fremder Herrschaft leben. Hohe Reparationen waren zu zahlen, nur ein kleines Berufsheer ohne schwere Waffen erlaubt. Die Revision dieses Vertrages bildete fortan das Ziel der ungarischen Außenpolitik. Trianon verhinderte auch eine Demokratisierung, denn es entfachte den Nationalismus und beflügelte die Reaktionäre um Horthy. Horthy regierte autoritär, das Parlament hatte wenig zu sagen. Der Großgrundbesitz war immer noch einseitig verteilt, was zu sozialen Spannungen führte. Abgeschnitten von vielen Rohstoffquellen und traditionellen Märkten und belastet durch die Zahlungen an die Sieger kam die Wirtschaft nur mühsam wieder auf die Beine. Und dann kam schon die große Krise von 1929. Nur französische Unterstützung konnte den Zusammenbruch der Staatsfinanzen verhindern. In den dreißiger Jahren geriet Ungarn immer mehr ins »Schlepptau des Deutschen Reiches« (Jörg K. Hoensch), denn nur im Bündnis mit Berlin schien eine Revision des Vertrages von Trianon möglich. Die neuen Freunde zeigten sich großzügig und überließen aus ihrer Beute zwischen 1938 und 1941 den Ungarn Teile ihres ehemaligen Territoriums. Der Preis: Teilnahme am Überfall auf die Sowjetunion und Beteiligung an der Entrechtung und Ermordung der Juden. Als sich die Ungarn kurz vor Kriegsende von den Deutschen absetzen wollten, besetzte die Wehrmacht 1944 das Land. Eine im Dezember gegründete Gegenregierung erklärte dem Deutschen Reich den Krieg. Nun kämpften Ungarn auf beiden Seiten der Front, bis am 4. April 1945 endgültig die Waffen schwiegen. Die »fröhlichste Baracke im Lager«: Ungarn unter dem Sozialismus Von den Deutschen befreit, geriet Ungarn – wieder auf die Grenzen von 1939 zurückgeführt – in neue Knechtschaft. Die mit sowjetischer Hilfe an die Macht gelangten Kommunisten formten das Land nach dem Vorbild der UdSSR um. Von der Kirchenverfolgung bis zu blutigen »Säuberungen« erlebte Ungarn auch alle Schrecken der Stalinzeit. 1956 war das Maß voll. Chruschtschows Abrechnung mit Stalin führte zum Aufstand, der Demokratie und Unabhängigkeit bringen sollte. Die Rote Armee schlug ihn nieder. Eine neue, moskauhörige Regierung unter János Kádár (1912–89) lenkte das Land an die Seite der Sowjetunion zurück, bescherte ihm dann aber nach wenigen Jahren etwas größere Freiheiten und einen höheren Lebensstandard, was Ungarn den Ruf der »fröhlichsten Baracke« im Ostblock eintrug. Das Ende dieses »Gulaschkommunismus« kam in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Gorbatschows Reformkurs, dazu eine sich anbahnende Wirtschaftskrise, ließen auch in der ungarischen KP Reformkräfte heranwachsen, die mit dem am 2. Mai 1989 beginnenden Abbau des »Eisernen Vorhangs« entlang der Grenze zu Österreich das Ende des Ostblocks einleiteten. Und wieder frei Weil kommunistische Reformer mit der Vergangenheit gebrochen hatten, erfolgte der schwierige Übergang zur Demokratie und Marktwirtschaft in Absprache mit der Opposition. Ungarn trat aus dem Warschauer Pakt aus und vereinbarte mit der UdSSR den Abzug ihrer Soldaten. Dafür wurde es Mitglied des Europarats und der NATO und strebt heute die Mitgliedschaft in der EU an. So ist Ungarn wieder, in jener Gemeinschaft angekommen, der es sich zugehörig fühlt. Literaturhinweise Die Außenminister von Österreich und Ungarn, Alois Mock und Gyula Horn, durchschneiden am 2. Mai 1989 ein Stück des »Eisernen Vorhangs«. Foto: dpa Zoltán Halasz: Ungarn, 3. Auflage, Budapest 1983 Jörg K. Hoensch: Geschichte Ungarns. 1867–1983, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1984 István Lázár: Kleine Geschichte Ungarns. Wien 1990 Paul Lendvai: Die Ungarn. Ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen. München 1999 Gyula Németh: Ungarn. 2. Auflage, Budapest 1983 Michael W. Weithmann: Balkan-Chronik. 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident. 2. Auflage, Regensburg/Graz/Wien/Köln 1997 17 4. Großreiche an der Donau Maria von Ungarn © Archiv für Kunst und Geschichte Von Martin Kramer a) Die Donaumonarchie Der Staat, den die Habsburger in langen Jahrhunderten im Südosten Europas schufen, war ein sehr heterogenes, multikulturelles Gebilde, das außer der Dynastie nur noch die Donau als einigende Klammer besaß. Der Anfang 1253–78 König Ottokar II. v. Böhmen 1254–73 Interregnum 1273–91 König Rudolf von Habsburg 1278 Schlacht auf dem Marchfeld. Niederlage u. Tod Ottokars 1273 wurde Graf Rudolf von Habsburg von den Großen des Reiches in Frankfurt zum König gewählt. Der herrschende Adel hatte mehr an seine eigenen Machtinteressen gedacht und einen Habenichts ohne nennenswerte Hausmacht auf den Thron gehoben. Rudolf entpuppte sich jedoch als tatkräftiger Monarch und zielstrebiger Hausmachtpolitiker. Er begann im Reich aufzuräumen, setzte den darniederliegenden Landfrieden mit Waffengewalt durch und verschaffte sich die fehlende Hausmacht, ohne die die Krone des Heiligen Römischen Reiches ein bloßer Zierrat war. Fündig wurde er dort, wo die Machtverhältnisse noch nicht zementiert waren: im Südosten, außerhalb der Reichsgrenzen. Er verlangte von seinem Gegenspieler Ottokar II. die Herausgabe der usurpierten BabenbergerHerzogtümer an der mittleren Donau zwischen Linz und Wien und er bekam sie nach Niederlage und Schlachtentod Ottokars, 1278 auf dem Marchfeld. Damit legte er den Grundstein für die spätere Donaumonarchie. 1526 verlor Ludwig II. in der Schlacht bei Mohács im Kampf gegen die Osmanen Leben und Land. Schwager Ferdinand, inzwischen Herr über das österreichische Kernland, erbte wenigstens den Anspruch auf die ungarische Krone. Drei Jahre später belagerten türkischen Truppen Wien. Die Hartnäckigkeit der Verteidiger Wiens und das schlechte Herbstwetter bewogen die Türken allerdings dazu, die Belagerung aufzugeben und sich hinter die nahe gelegene Grenze zurückzuziehen. Das Zentrum Ungarns, die Donau-Theiss-Tiefebene, blieb fast anderthalb Jahrhunderte fest in türkischer Hand. Nur einen schmalen Streifen, von der Slowakei bis zur Adria reichend, beherrschten die Habsburger (siehe Kapitel III.3.). Die Entscheidung 1683 1687 1717 1718 Großwesir Kara Mustafa belagert Wien Prinz Eugen v. Savoyen wird Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee Eroberung Belgrads Friede von Passarowitz. Ungarn wird habsburgisch Die Grundlagen 1493–1519 Kaiser Maximilian I. 1515 Heirats- und Erbverträge Habsburgs mit Böhmen und Mähren 1526 Schlacht bei Mohács. Ungarn wird osmanisch 1529 Erste Belagerung Wiens durch die Osmanen. Die Wiener Doppelhochzeit von 1515 begründete die Donaumonarchie wenigstens dem Anspruch nach. Maximilian I. verheiratete seine Enkelin Maria mit Ludwig, dem Sohn des ungarischen Königs, dessen Schwester Anna gleichzeitig Maximilians Enkel Ferdinand das Jawort gab. Die 10-jährige Maria wurde in Innsbruck auf ihre Rolle als Königin von Ungarn vorbereitet. Im Frühjahr 1521 fuhr sie in einem reich geschmückten Donauschiff von Linz nach Wien und weiter nach Buda, wo sich Ludwig wegen der akuten Türkengefahr aufhielt. Im Sommer 1683 standen die Türken mit 250000 Mann erneut vor Wien. Kaiser Leopold I. hatte fluchtartig die Stadt verlassen und sich donauaufwärts in Passau in Sicherheit gebracht. Rund 20000 Wiener waren ihm in Panik gefolgt. Die zurückgebliebenen Verteidiger Wiens wurden durch Hunger und Seuchen dezimiert. Überraschend brachen die Türken die Belagerung ab, als in ihrem Rücken das rund 80000 Mann starke Entsatzheer unter dem Befehl des polnischen Königs Johann Sobieski aufmarschierte. Es brachte den desorientierten Türken eine vernichtende Niederlage bei und bannte damit die Türkengefahr ein für alle Mal. Mehr noch: Die Gegenoffensive begann und jetzt erst nahm die »Donaumonarchie« Konturen an. Innerhalb von wenigen Jahren wurde Belgrad den Türken entrissen. In vorderster Linie der »edle Ritter« Prinz Eugen, der als kaiserlicher Feldherr die Osmanen ein halbes Jahrhundert lang imm er weiter nach Südosten zurückdrängte. Der kleingewachsene savoyische Prinz gewann die entscheidenden 18 Schlachten und handelte die Friedensbedingungen aus. Er sicherte Österreich nach dem Sieg über das Osmanische Reich außer Ungarn den größeren Teil von Serbien, einen Teil Bosniens und die kleine Walachei und für ein Jahrzehnt bis zum Frieden von Rastatt 1714 dehnte er Österreich entlang der Donau nach Westen aus und besetzte Bayern. Prinz Eugen machte Österreich zur »Donaumonarchie« und für zwei Jahrhunderte zu einer der unbestrittenen Großmächte Europas. Öffnung nach Europa 1740–80 Kaiserin Maria Theresia 1780–90 Joseph II. (seit 1765 Mitregent seiner Mutter in Österreich) 1806 Franz II. verzichtet auf die deutsche Krone. Ende des HI. Römischen Reiches Deutscher Nation Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die »Donaumonarchie« ein bunt zusammengewürfeltes Gebilde, das nur durch die gemeinsame Dynastie zusammengehalten wurde. Sie umfasste über ein Dutzend ethnischer Gruppen in verschiedenen Stadien ihrer nationalen Entwicklung, zwar eine Großmacht, aber eine gegenüber Westeuropa zurückgebliebene. Maria Theresia leitete eine Politik der vorsichtigen Modernisierung ein. Frühzeitig von ihrem Sohn Joseph unterstützt und, seitdem er 1765 als Mitregent eingesetzt worden war, regelrecht getrieben. Als Joseph nach dem Tod seiner Mutter 1780 Alleinherrscher wurde, versuchte er in atemberaubendem Tempo innerhalb eines Jahrzehnts aus dem amorphen Vielvölkerstaat einen zentralisierten, bürokratischen Einheitsstaat zu schmieden. Innerhalb kürzester Zeit machte er sich dadurch alle gesellschaftlichen und politisch relevanten Gruppen zu erbitterten Feinden: den Adel, vor allem den ungarischen, die Kirche und selbst die durch seine Reformen begünstigten Bauern. Einen Teil seiner Reformen musste bereits Joseph selbst zurücknehmen. Auch unter dem Eindruck der revolutionären Entwicklung in Frankreich wurden sie unter seinem Nachfolger vollständig rückgängig gemacht. Dennoch war Josephs radikaler Reformismus nicht umsonst gewesen. Wien, immerhin die zweitgrößte Stadt des Kontinents, entwickelte sich sehr schnell zu einem Zentrum der europäischen Aufklärungskultur. Stagnation und Fortschritt 1814/15 1815 1809–48 1815–66 Wiener Kongress. Neuordnung Europas Heilige Allianz Ära Metternich Deutscher Bund Wohl kaum ein Politiker wurde so sehr mit den Schattenseiten des Ancien régime identifiziert wie Österreichs Staatskanzler Metternich. Er stand für die europaweite Unterdrückung jeder liberalen und nationalen Bewegung, für die rücksichtslose Knebelung der Meinungsfreiheit. Dabei verfolgte er im Dienste seines Monarchen nur ein Ziel: in der »Donaumonarchie« Sicherheit und inneren Frieden zu garantieren. Er setzte die vom russischen Zaren aus dem Geist christlicher Romantik ins Leben gerufene »Heilige Allianz« der Fürsten in nüchterne, praktikable Politik um. Sie stemmte sich gegen alle modernen Tendenzen der Gegenwart, gegen Parlamentarismus und Selbstbestimmungsrecht der Völker. Andererseits konstituierte sie ein europäisches Friedens- und Sicherheitssystem, wie es seit dem Westfälischen Frieden nicht mehr bestanden hatte. Es bewahrte Europa das ganze 19. Jahrhundert hindurch vor dem großen Waffengang und zerbrach erst im Ersten Weltkrieg. Der Preis für diesen Frieden hieß Unfreiheit, von Metternichs Gegnern als Friedhofsruhe empfunden. Vor allem aber wurde die von Joseph II. eingeleitete Öffnung nach Europa nicht fortgeführt. Österreich zog sich auf sein altes Kerngebiet an der mittleren Donau zurück, orientierte sich zum Balkan hin. Untergang 1848/49 1848–1916 1863 1866 1867 1871 1914 Revolutionen in Europa Kaiser Franz Joseph I. Fürstentag in Frankfurt Preußisch-Österreichischer Krieg Ausgleich Österreich Ungarn Franz Joseph König von Ungarn Zweites Deutsches Kaiserreich Beginn des Ersten Weltkrieges Mitten in den Revolutionswirren von 1848 trat der 18-jährige Erzherzog Franz Joseph auf Betreiben seiner Mutter Sophie die Nachfolge seines regierungsunfähigen Vaters an. Mit Hilfe seiner eigenen und der russischen Armee unterdrückte er die Revolution und suchte den Status quo zu bewahren und doch einen modernen Zentralstaat zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner frühen Aktivitäten lag in der Bewahrung der österreichischen Führungsrolle im Deutschen Bund und der Integration seines gemischt nationalen Staates in ein Großdeutschland. Diese Deutschlandpolitik scheiterte auf dem Fürstentag zu Frankfurt 1863 an der ablehnenden Haltung Preußens. Es war der letzte Versuch, die Donaumonarchie nach Westen hin zu orientieren. Der preußische Sieg bei Königgrätz 1866 schloss Österreich aus dem Deutschen Bund aus und verlagerte das Machtzentrum der Doppelmonarchie endgültig in den Donauraum. Mit dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn im Jahr 1867 (siehe Kapitel III.3.) begann eine lange Friedenszeit, gekennzeichnet durch wirtschaftlichen Aufschwung und bürgerliche Sicherheit, allerdings auf Kosten der kleineren Nationalitäten im Vielvölkerstaat. Die Reichsteilung in einen westlichen, von Österreich dominierten und einen östlichen, von Ungarn dominierten Teil, nach dem Grenzflüsschen Leitha Cis- und Transleithanien genannt, war ein mühsam austarierter Kompromiss. Dieser Dualismus hielt bis zum Ende der Monarchie 1918, obwohl niemand mit ihm zufrieden war und die unterdrückten Minderheiten, die seit der Annexion Bos- 19 plant, direkt an der serbischen Grenze. Sie wurden kommandiert von Franz Ferdinand persönlich. Dort trafen ihn und seine Gemahlin die Kugeln eines Attentäters tödlich. Generalstabschef Conrad von Hötzendorf sah endlich seine Stunde gekommen. Seitdem er im Amt war, hatte er sich dafür eingesetzt, die internen Nationalitätenprobleme der »Donaumonarchie« durch einen Präventivkrieg gegen Serbien und Italien gewaltsam zu lösen. Die österreichische Kriegserklärung an Serbien läutete das Ende der Donaumonarchie ein, zugleich aber auch das Ende des alten Europa. Franz Joseph I. im Alter von 18 Jahren Zeitgenöss. Lithographie © ZEIT-Archiv niens 1908 zusammengenommen eine Mehrheit ausmachten, verbissen um mehr Autonomie stritten. 1854 heiratete Franz Joseph I. seine bayerische Cousine Elisabeth. Populär beim Volk als »Sisi«, am Hof jedoch bald als »hübsches Dummerl« verrufen, gebar sie pflichtgemäß den erwünschten Thronfolger – und ging ihre eigenen Wege, auch politisch. Sie hatte entscheidenden Anteil am Ausgleich von 1867. Persönlicher und politischer Höhepunkt ihres Lebens war die feierliche Krönung zur Königin von Ungarn in Budapest. Bis heute ist Erzsébet dort eine schwärmerisch verehrte Kultfigur geblieben. Ihr gewaltsamer Tod 1898 auf der Genfer Uferpromenade entrückte sie vollends ins Reich des Mythos. Kronprinz Rudolf verkörperte einen verbreiteten deutschösterreichischen Typus: Obwohl überzeugter Repräsentant der Monarchie, wollte er ihre völlig verkrusteten und erstarrten Strukturen aufbrechen, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu retten. Politisch kaltgestellt, ohne reale Macht, blieb ihm jedoch die politische Reformarbeit verwehrt. Er sympathisierte mit den Liberalen und veröffentlichte seine oppositionellen Ideen in der nationalen und internationalen Presse unter einem Pseudonym. Ende Januar 1889 erschoss der 30-Jährige sich und seine Geliebte, die 17-jährige Baroness Vetsera, im Jagdschlösschen Mayerling. Der Skandal erschütterte die ohnehin krisengeschüttelte k.u.k. Monarchie bis in ihre Grundfesten. Zeitgenossen deuteten den Tod des Kronprinzen als ein Mentekel des Untergangs. Nach Rudolfs Tod regierte Franz Joseph in der Hofburg weiter, bis schließlich nur noch er selbst die auseinanderdriftende Monarchie zusammenhielt. Die Nationalitätenprobleme verlangten nach einer Lösung. Thronfolger Franz Ferdinand, Neffe des Kaisers, forderte deshalb schon seit Jahren eine Föderalisierung der »Donaumonarchie«, die insbesondere dem slawischen Bevölkerungsteil mehr Autonomie bringen sollte. Vor allem bei den Ungarn und den großserbischen Nationalisten war er deshalb verhasst. Im Sommer 1914 waren – wohl auch zur Einschüchterung der Serben – österreichische Manöver an der Drina ge- Kaiserin Elisabeth 1865 Fotografie von Emil Rabending © Historisches Museum der Stadt Wien Literaturhinweise Rolf Bauer: Österreich. Ein Jahrtausend Geschichte im Herzen Europas. München 1994 Brigitte Hamann: Elisabeth. Kaiserin wider Willen. München 1989 Robert A. Kann: Geschichte des Habsburgerreiches 1526–1918. Graz 1977 Walter Pohl/Brigitte Vacha: Die Welt der Babenberger. Graz 1995 Roman Sandgruber: Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wien 1995 Brigitte Vacha (Hrsg.): Die Habsburger. Eine europäische Familiengeschichte. Graz 1992 Adam Wandruzka/Peter Urbanitsch: Die Habsburgermonarchie 1848–1918 (6 Bde.).Wien 1973ff. Erich Zöllner: Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 8. Auflage 1990 20 b) Unter dem Banner des Propheten ins Innere Europas Von Dietrich Rolbetzki Wie die Ungarn kamen die Türken als Eroberer und versetzten zunächst die Völker Europas in Angst und Schrecken. Aber anders als die Ungarn hielten sie an ihrer Religion fest und wuchsen nicht in die europäische Kultur hinein. Über Jahrhunderte waren sie die Herren Südosteuropas und hinterließen mannigfache Spuren. Am Ende aber wurden sie wieder fast ganz aus Europa hinausgedrängt. Die moderne Türkei schwankt heute zwischen der engeren Verbindung mit Europa und der Hinwendung nach Asien. Von Mittelasien nach Anatolien Nomadische Turkvölker aus Mittelasien kamen bei ihrem Vordringen nach Westen mit persischer und arabischer Kultur in Berührung und nahmen den Islam an. Der Stamm der Seldschuken – ihrem Anführer wurde nach der Eroberung Bagdads im 11. Jahrhundert der Titel »Sultan« (»Herrscher über die Gläubigen«) vom Kalifen (Nachfolger Mohammeds) verliehen – errichtete in Anatolien einen Staat, den die Mongolen im 13. Jahrhundert wieder zerstörten. Seine Nachfolge traten zahlreiche Kleinfürstentümer an. Vom asiatischen Kleinstaat zur europäischen Großmacht Eines dieser kleinen Fürstentümer, das osmanische um Bursa, benannt nach dem Stammesführer Osman (1281?–1326), stieg im Laufe der nächsten Jahrhunderte zu einer Großmacht auf. Osman eroberte neue Gebiete, weil er den Islam ausbreiten und seine Krieger mit Beute versorgen wollte. Er förderte auch die Landwirtschaft und damit das Sesshaftwerden und nahm den Titel »Sultan« an. Bürgerkriege und Thronkämpfe im Byzantinischen Reich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts brachten die Osmanen nach Europa. Zunächst wurden sie als Hilfstruppen herbeigerufen, 1354 aber kamen sie unaufgefordert, eroberten Adrianopel und machten es zum neuen Mittelpunkt ihres Staates. Byzanz war jetzt vom westlichen Europa abgeschnitten, musste den Osmanen Tribut zahlen und erhielt dafür Getreide. 1389 wurden die Serben auf dem Amselfeld (Kosovo polje) geschlagen, wenig später wurde Bulgarien türkische Provinz und die Walachei tributpflichtig. Die osmanischen Erfolge erklären sich aus einer straffen Führung, der Notwendigkeit Beute zu machen, um Militär und Verwaltung zu versorgen und dem Drang den Islam auszubreiten. Dabei profitierten die Türken davon, dass der Balkan politisch zersplittert war, wirtschaftlich am Boden lag (Pest) und die Bauern von großen Grundbesitzern ausgebeutet wurden. Gegen die Türken aufgebotene europäische Heere, Ausdruck eines Gefühls kollektiver Bedrohung, erlitten Niederlagen. 1453 ließ Mehmet II., »der Eroberer«, seine Soldaten zum Sturm auf Konstantinopel antreten. Europa aber ließ die Stadt am Goldenen Horn in ihren letzten schweren Stunden allein. Als Istanbul (istan polis = in der Stadt) war sie fortan bis 1923 die neue Hauptstadt des Osmanischen Reiches, das sich endgültig als Großmacht etabliert hatte. Nichts schien in den folgenden Jahrzehnten die Osmanen daran zu hindern ihre Herrschaft weiter auszudehnen: auf dem Balkan, in Vorderasien und Nordafrika. In Kairo geriet der letzte Kalif in türkische Gefangenschaft und soll seine Würde als geistliches Oberhaupt der Sunniten auf Sultan Selim I. übertragen haben. Der Griff nach dem »Goldenen Apfel«: die Türken vor Wien Die neuen Eroberungen gaben Sultan Suleiman II. (1520– 1566), »dem Prächtigen«, die Mittel zum Vorstoß auf Wien an die Hand, den »Goldenen Apfel«, wie die Stadt seit langem in osmanischen Militärkreisen genannt wurde: 1521 fiel Belgrad, 1526 wurden die Ungarn bei Mohács an der Donau geschlagen, 1529 war erstmals die österreichische Kaiserstadt bedroht. Zwar scheiterte die Eroberung Wiens, doch war das Osmanische Reich unter Suleiman II. »stärkste militärische und politische Macht der Erde« (Josef Matuz) geworden. Innerhalb seiner Grenzen wohnten mehr Völker als in irgendeinem anderen damaligen Staat. Ihnen gegenüber waren die Osmanen, sieht man von der Eroberungszeit und bei Widerstand ab, recht tolerant: Juden und Christen mussten nur die Herrschaft des Islam anerkennen und die Kopfsteuer zahlen (deshalb blieb der Balkan im Wesentlichen christlich); auch die Roma wurden nicht verfolgt. Regiert wurde dieses Reich von einem Sultan mit unumschränkter Macht, der seit dem 15. Jahrhundert durch Erbfolge ins Amt gelangte. Dem Großwesir unterstand die Verwaltung, der Diwan war Beraterrunde und oberstes Gericht. Ein Gegengewicht gegen die Macht des Sultans bildete die Geistlichkeit. Bei der Besetzung von Ämtern Sultan Suleiman II. (1520–1566). Aus: Varga Domokos: Magyarország Virágzása ... (o. J.) 21 kurze Zeit die Nordgrenze ihres Reiches, die durch eine Reihe von Sperrfestungen am südlichen Flussufer gesichert wurde. In den folgenden drei Jahrhunderten wurde der Fluss überschritten und lag nun innerhalb des Osmanischen Reiches. Er bildete auch das Rückgrat des Vorstoßes auf Wien und diente dem Transport von Nachschub. Solange sie innerhalb ihres Reiches dahinströmte, benutzten die Türken die Donau immer auch als »Straße« für Handel und Verkehr. Als im 19. und 20. Jahrhundert ihr Kolonialbesitz in Südosteuropa Stück um Stück verloren ging, wurde der Fluss für den Kontinent wieder zum übernationalen Handels- und Verkehrsweg. Jahrhunderte des Niedergangs Der europäische Teil des Osmanisches Reiches im 17. Jahrhundert Zeichnung: Peter Steinheisser spielten Herkunft und Nationalität jahrhundertelang keine Rolle. Das eroberte Land wurde in Militärbezirke aufgeteilt und von Paschas regiert bzw. ausgebeutet. Solange die Bewohner gehorchten und Steuern zahlten, hatten sie ihre Ruhe. So arrangierten sie sich mit den Eroberern. Die Donau im Osmanischen Reich Ende des 14. Jahrhunderts hatten die Türken den Unterlauf der Donau erreicht. Doch der Strom bildete nur für Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts leiteten eine Reihe unfähiger Herrscher, Korruption und Ämterkauf, wirtschaftliche Probleme, militärische Misserfolge und zunehmende Stärke der Armeen des christlichen Europa den Niedergang des Osmanischen Reiches ein. 1683 raffte man sich in Istanbul noch einmal zu einem Kraftakt auf: Kara Mustafa befehligte den zweiten Angriff auf Wien. Der Feldzug endete mit einer schweren Niederlage (siehe Kapitel III.4.a)). Das Gesetz des Handelns ging nun an Habsburg über, das in den Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich zur Großmacht aufstieg. Zwischen 1684 und 1699 (Friede von Karlowitz) verloren die Türken mit Ungarn, Siebenbürgen, dem größten Teil Kroatiens und Slawoniens fast die Hälfte ihrer europäischen Besitzungen und außerdem die wirtschaftlich wertvollsten. Russland erkämpfte sich im 18. Jahrhundert den Zugang zum Schwarzen Meer und fasste auch auf dem Balkan Fuß. Schlacht am Kahlenberg. Gemälde von Franz Gaffels © Historisches Museum der Stadt Wien. 22 Pécs (Ungarn): Innerstädtische Pfarrkirche auf dem Széchenyi tér, erbaut 1585 als Moschee. Auf dem Denkmal Türkenbezwinger János Hunyadi. Foto: Dietrich Rolbetzki Abschied von der Donau Ungeniert rissen dann im 19. Jahrhundert europäische Großmächte türkische Gebiete an sich. Der »kranke Mann am Bosporus« blieb nur am Leben, weil kein Staat im Falle seines Dahinscheidens dem anderen große Vorteile gönnen mochte. Neue Ideen aus dem Westen und der Mitte Europas leiteten das »nationale Erwachen« der Balkanvölker ein. Russland propagierte die Vereinigung aller Slawen unter seiner Führung und stand, wie auch andere Großmächte, zum Eingreifen auf dem Balkan bereit. Als Erste erkämpften die Serben 1817 ihre Autonomie. 1830 wurde Griechenland unabhängig; 1878 folgten Serbien, Montenegro und Rumänien. Zur Ruhe kam der Balkan dadurch freilich nicht: Die neuen Staaten waren instabil und voller ungelöster Probleme und das dahinsiechende Osmanische Reich, 1908 auch noch von innen erschüttert durch die sich an die Macht putschende Reformbewegung der »Jungtürken«, weckte allerorten neue Begehrlichkeiten. Österreich-Ungarn nutzte die Gunst der Stunde, drängte Bulgarien zur Unabhängigkeit und annektierte selbst Bosnien und die Herzegowina. In den Balkankriegen 1912/13 konnte das Osmanische Reich gerade noch einen Zipfel Europas für sich retten, der der Türkei bis heute geblieben ist. die große Trommel, das Becken, Triangel und die Piccoloflöte, Preußen auch den Schellenbaum, der zum Wahrzeichen seines Militärs wurde. Und während ihr Reich in die Defensive ging, eroberten die Türken die Opernbühnen ihrer Gegner, z. B. mit Mozarts »Die Entführung aus dem Serail« (1782). Den Türken verdankt Europa auch mehr als nur den Kaffee. »Wo immer man gewürzte Hackfleischwürstchen über glimmender Holzkohle grillt und Fleisch in bunten Gemüsetöpfen gart, ist Balkan.«: eine Küche, die den »unverwechselbaren Hauch des Orients« (Marion Schwedt) aufweist, und den haben die Türken eingebracht. Im Bewusstsein der unterworfenen Völker hat die Türkenherrschaft tiefe Narben hinterlassen. Die Serben sehen sich seit der Schlacht auf dem Amselfeld in der Rolle von Opfern und Märtyrern für Europa; in Ungarn wirkt das Trauma des ewigen Verlierers nach. In den Ländern des ehemaligen Osmanisches Reiches blieben türkische Minderheiten zurück, die immer wieder für ihr Mutterland büßen mussten. 1922 wurden sie aus Griechenland vertrieben. Ende der 80er-Jahre führten Zwangsbulgarisierungen zu einer weiteren Fluchtwelle. Als einstige Kolonialmacht hat es die Türkei bis heute schwer mit ihren ehemaligen Kolonien. Misstrauen und Feindschaft sind vielfach geblieben. Was blieb vom Halbmond in Europa? Die sichtbarsten Spuren sind heute noch Moscheen und Minarette, Bäder und Grabmäler. Einflüsse türkischer Architektur lassen sich auch in der heimischen Baukunst nachweisen, etwa in Bulgarien. Millionen Menschen in Albanien und Bosnien folgen täglich dem Ruf des Muezzins und verneigen sich gen Mekka: Moslems, deren Vorfahren unter der Türkenherrschaft zum Islam übergetreten sind. Die Musik Südosteuropas weist orientalische Anklänge auf, doch ist nicht sicher, ob das eine Folge der langen Besetzung ist. Von den Musikkapellen der Janitscharen übernahmen europäische Orchester im 18. Jahrhundert Literaturhinweise Wolfgang Gust: Das Imperium der Sultane. Eine Geschichte des Osmanischen Reichs. München/Wien 1995 Josef Matuz: Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte. 3. Auflage, Darmstadt 1996 Alan Palmer: Verfall und Untergang des Osmanischen Reiches. München 1997 Michael W. Weithmann: Balkan-Chronik. 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident. 2. Auflage, Regensburg/Graz/Wien/Köln 1997 23 5. Ulmer Schachteln und Donauschwaben Von Jakob Huff »Ulmer Schachteln« und »Kelheimer Pletten« beförderten vor allem im 18. Jahrhundert rund 200 000 meist deutsche Kolonisten in den Südosten des von den Habsburgern beherrschten und nach den Türkenkriegen in weiten Teilen entvölkerten Königreichs Ungarn. Dort fanden sie in sechs Hauptsiedlungsgebieten – dem Bergland im Donauknie, der Schwäbischen Türkei, in Syrmien/Slawonien, der Batschka, dem Banat und dem Sathmar-Theißgebiet – in über 1000 Städten und Gemeinden und oft unter beträchtlichen Mühen (»Den Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot«) letztendlich doch eine neue Heimat. Diese Orte und Gebiete wurden für rund eine Million Donauschwaben (gegenwärtig etwas mehr als 1,5 Millionen) die »alte« Heimat, weil der von Hitler und den Nationalsozialisten entfesselte Zweite Weltkrieg und das Verhalten der Sieger sie zur Flucht und Vertreibung zwangen. Nur gut 500 000 Menschen versuchten, oft unter beispiellosen Entsagungen, der räumlichen Verpflanzung und geistig-kulturellen Entwurzelung vor allem in Ungarn und Rumänien zu widerstehen. Doch der Exodus hält an und auch die Suche nach einer neuen Heimat, hauptsächlich in Deutschland. Das verlorene »a« Im Wintersemester 1965/66 saß ich mit etwa 20 Studentinnen und Studenten in einem landesgeschichtlichen Proseminar von Professor Decker-Hauff in Tübingen. Am Ende der ersten Sitzung ging der Professor die Namensliste der Seminarteilnehmer durch. Als ich an der Reihe war, verblüffte er mich mit einem: »Donauschwabe, gell?« und lokalisierte mich als schwäbischen Namensvetter, dessen Vorfahren auf dem Weg nach Südosteuropa wohl das »a« aus dem Namen abhanden gekommen war. Es stimmte tatsächlich. Mein Geburtsort ist Bukin, ein 1941 knapp 4000 Menschen zählender und zu 90 % von Deutschen bewohnter Ort an der Donau etwa 60 km oberhalb von Neusatz/Novisad gelegen. Tiefere Wurzeln konnte ich in meinem Geburtsort nicht schlagen, weil ich mit vielen anderen Donauschwaben das Schicksal und die Folgen der Vertreibung teile; eine gewisse Prägung besteht jedoch darin, dass ich den Dialekt meines Geburtsortes noch vor anderen Dialekten und Sprachen gelernt habe. Meine schwäbischen Wurzeln sprossen dagegen erst seit 1947 mit der Einschulung in der einklassigen Zwergschule in Bühlenhausen auf der Schwäbischen Alb. Eine gut zweieinhalbjährige Odyssee hatte mich und einen Teil meiner Familie mütterlicherseits aus der Batschka – über Ungarn, die Tschechoslowakei, Schlesien – in die SBZ nach Salzwedel und von dort auf abenteuerliche Weise über zwei Zonengrenzen hinweg im Mai 1947 nach Süddeutschland zu den Amerikanern gebracht. Zunächst bei Bauern in Treffensbuch auf der Schwäbischen Alb einquartiert zog ich 1951 mit meiner Mutter nach Ulm, das für sie Wohn- und Arbeitsort, für mich aber zur eigentlichen »Heimat« wurde. Mit meinen donauschwäbischen Wurzeln und deren historischen Bedingungen wurde ich umständehalber mehrfach in meinem Leben konfrontiert. Besondere Situationen waren beispielsweise: die Rolle als »Reigschmeckter« auf der Alb oder die Suche nach meiner Familie väterlicherseits infolge der Anträge auf Lastenausgleich, die viele Todesurkunden erbrachte – z. B. die meines Vaters, gefallen an der Ostfront, meines Großvaters, erschossen auf einem Marsch in ein serbisches »Lager«, von Onkel und Tante mit Kindern, vermisst oder im »Lager« verhungert etc. Nur meine Großmutter konnte sich lebend nach Wien zu ihrer Schwester und deren Familie durchschlagen. Sie ist wieder eingebürgerte Österreicherin geworden, was unsere historischen Vorfahren ja eigentlich schon einmal gewesen sind. Spurensuche Der Raum um Donau, Theiß und Karpaten verzeichnet eine sehr wechselvolle Siedlungsgeschichte. Völker und Volksgruppen kamen, gingen, wurden vertrieben, erobert, assimiliert, beherrscht und wieder befreit. Germanen, Römer, Hunnen, Awaren, Slawen, Ungarn, Türken, Deutsche u. a. m. haben ihre Spuren hinterlassen. Die Ansiedlung von Menschen in diesem Raum ist eng verbunden mit der historischen Rolle der Habsburger, die in einer feudalistischen Welt seit dem 15. bzw. 16. Jahrhundert gleichzeitig als Kaiser an der Spitze des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation standen und u. a. als Könige die Herrschaft über Ungarn und ein Gemisch aus vielen Völkern innehatten. Mit der erfolgreichen Zurückdrängung der Türken (Prinz Eugen) begann der eigentliche Prozess der »Landnahme« durch die Vorfahren der später so genannten Donauschwaben, im Verein mit ungarischen, slawischen und anderen Siedlern. Kaiser und feudale Grundherren begannen schon nach 1686 die ersten befreiten, oft fast menschenleeren Gebiete zu besiedeln, denn die Abgaben an den Lehensherrn bildeten eine wesentliche Grundlage des ganzen Systems. So intensivierte sich ein vielschichtiger, etwa 150 Jahre (1686–1829) währender Prozess der Besiedlung und Kolonisation von Gebieten, die der teilweise verwilderten Natur und vor allem dem Wasser zur wirtschaftlichen Nutzung abgerungen werden mussten. Die Besiedlung von Städten, hauptsächlich in Ungarn, ist nur ein Teilaspekt, die Kolonisation des Landes durch Bauern und Handwerker ein parallel dazu verlaufender, ergänzender Vorgang. Das persönliche und wirtschaftliche Wohl der Siedler hing zudem sehr davon ab, ob private Grundherren (ungarische und deutsche Adelige) oder der Kaiser (Kameralherrschaft) die Siedlungstätigkeit betrieben. So reichten die Formen der Abhängigkeit von einer annähernden Leibeigenschaft bis hin zur »persönlichen Freiheit« im Rahmen der kaiserlichen Grundherrschaft. Aus dem Zuzug von Menschen sind drei Phasen besonders hervorzuheben (drei große »Schwabenzüge«: 1722–1727, 1763–1773, 1782–1787), in denen Menschen meist aus Süddeutschland (ein Drittel war fränkischer, pfälzischer, ein Drittel bayerischer, österreichischer, sudetendeutscher und ein Viertel schwäbischer, elsässischer, 24 Aufteilung der östlichen Donaumonarchie und Dreiteilung der Donauschwaben Städte und Gemeinden mit 2000 und mehr Donauschwaben »lnsellandschaft« Skizze: Jakob Huff Donauschwäbische Siedlungsgebiete I. Bergland im Donauknie II. Schwäbische Türkei III. Syrmien-Slawonien-Kroatien IV. Batschka V. Banat VI. Sathmar-Theißgebiet badensischer Herkunft) oft angeworben und in großer Zahl planmäßig, mit einer Erstausstattung für Hof und Feld versehen, angesiedelt wurden. Der relativ starke Bevölkerungsdruck in südwestdeutschen Gebieten ließ viele Menschen daran denken, als Kolonisten die Chance wahrzunehmen, ihre wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu verbessern, mit der Aussicht, als freie Bauern in Erbpacht die zurückgebliebenen Ge-biete erschließen zu können. Obwohl sich die Siedler i.d.R. verpflichten mussten, fünf bzw. sieben Freijahre und weitere fünf Jahre unter Entrichtung von Zehnt und Neunt sesshaft zu bleiben, verlieren sich die Spuren der meisten ersten Siedler der ländlichen Gebiete. Harte Arbeit, ein früher Tod, Seuchen und die Hoffnung auf ein leichteres Leben an einem anderen Ort waren die Hauptgründe dafür. Doch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Ansiedlung der Menschen in diesen Gebieten allmählich zu einer Erfolgsgeschichte für sie persönlich und vornehmlich für Ungarn, das von der entstehenden Kornkammer vor allem wirtschaftlich profitierte. Die Siedlungen mit überwiegend deutscher Bevölkerung bildeten ein Archipel in einer zunehmend von Nationalismus geprägten Umwelt. Dieser Herausforderung konnte 1848 und danach noch mit Mühe begegnet werden. Die Donauschwaben entwickelten in dieser Zeit ihre unverkennbare kulturelle Eigenart mit vielfältigen lokalen und regionalen Ausprägungen hinsichtlich Dialekt, Brauchtum, reli- giöser Verankerung im Rahmen dessen, was politisch möglich war. Revolution und Nationalismus In ihrem Selbstverständnis empfanden sich die Donauschwaben zunehmend als Verteidiger ihrer kulturellen Eigenart und ihrer wirtschaftlichen Erfolge. Es ging ihnen um Freiheit, um Recht und Ordnung in Stadt und Land; nationale Forderungen kamen ihnen in ihrer Streulage erst gar nicht in den Sinn, obwohl sie sich diesen andauernd ausgesetzt sahen. Die Niederschlagung der Revolution von 1848 und die reaktionäre Zeit danach brachte für die politisch macht- und sorglosen Donauschwaben eher günstige Entwicklungsmöglichkeiten. Mit der Schwächung der Donaumonarchie und dem Ausgleich mit Ungarn 1867 kamen sie unter den Druck der Magyarisierung, dem im Laufe der Zeit vor allem viele deutsche Stadtbewohner nachgaben. Die Donauschwaben waren mehrheitlich ein konservatives und eher unpolitisches Bauernvolk, das sich, anders als die Siebenbürger Sachsen, erst viel später organisierte, um in den entstehenden Nationalstaaten als Minderheiten überdauern zu können. So wurden beispielsweise 1906 die Ungarländische Deutsche Volkspartei und 1920 der Schwäbisch-Deutsche Kulturbund in Jugoslawien gegründet sowie nach der Jahrhundertwende ein Presseund Genossenschaftswesen entwickelt. 25 Auswanderung und Erster Weltkrieg Die Magyarisierung und die gestiegene Bevölkerungszahl brachten vor dem Ersten Weltkrieg rund 150 000 Donauschwaben dazu vor allem nach Nordamerika auszuwandern. Mit ihren Nachkömmlingen und den Auswanderern nach 1945 bilden sie heute etwa ein Drittel aller Menschen mit einem donauschwäbischen Hintergrund. Im Ersten Weltkrieg dienten die schwäbischen Soldaten im k.u.k. Heer und bei der ungarischen Landwehr. Er brachte das Ende des habsburgischen Vielvölkerstaates und die Aufteilung des donauschwäbischen Siedlungsgebietes unter den neuen Vaterländern Ungarn, Jugoslawien und Rumänien. Andererseits wurde aber der Existenz dieser deutschen Volksgruppe und ihren Problemen (Minderheitenschutz) national (in Deutschland) und international (im Völkerbund) eine gewisse Beachtung geschenkt. Die Entwicklung des Schulwesens und die kulturelle Arbeit im Allgemeinen verstärkten das donauschwäbische Element und das Selbstbewusstsein der Menschen. Das »Reich« und die Donauschwaben Das Mutterland Deutschland erstarkte als mögliche neue Hilfs- und Schutzmacht zusehends. Und sehr bald wurden auch die volksdeutschen Menschen und ihre Einrichtungen zu nationalsozialistischen Zwecken gebraucht und dann auch missbraucht. Nicht alle waren mit dieser Einmischung einverstanden, auch nicht mit Hitlers Umsiedlungsplänen. Doch ein Bauernvolk, das Recht und Ordnung liebt, gehorcht. Und so gerieten die Donauschwaben endgültig zwischen die Mahlsteine von Rassismus, Ideologie und Machtpolitik. Nur wenige wollten oder konnten widerstehen und die oft mühsam behauptete Heimat und Eigenständigkeit halten. Das Ende war für viele Donauschwaben tragisch. Es folgten: Evakuierung, Zwangsverschleppung – auch in die UdSSR –, Entrechtung, Enteignung, Vertreibung, Internierung und Ermordung in Arbeitslagern. Bei der Frage nach Schuld und Verantwortung darf nicht vergessen werden, dass Hitler und die Nazis die Schleusen für die Flut geöffnet haben, in der die »Inselwelt« der Donauschwaben letztlich unterging. Der einzelne geschädigte Mensch empfand jedes Leid, gleich ob es ihm nun im Namen des Rassismus, einer Ideologie, einer »ethnischen« Säuberung oder infolge persönlicher Rache zugefügt wurde, wenn er es denn physisch überlebte, als Unrecht. zusammen nicht ganz die Hälfte von rund 1,5 Millionen Menschen. Die meisten haben sich durch persönliches Bemühen und auch mit Hilfe des Lastenausgleiches zumindest äußerlich schnell integriert. Sie leisteten ihren Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands. Viele der älteren Heimatvertriebenen müssen mit dem Trauma der Entwurzelung leben. Eine große Zahl Donauschwaben hat in der»alten« Heimat nicht nur die neue Heimat gefunden, sondern versucht auch, durch nationale Institutionen und Organisationen und durch internationale Kontakte ihr kulturelles Erbe zu bewahren. Dies ist einerseits eine historische Notwendigkeit, wird aber künftig immer schwieriger aufrechtzuerhalten und umzusetzen sein. Literaturhinweise Innenministerium Baden-Württemberg (Hg.): Die Donauschwaben, Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Sigmaringen 1987 Annemarie Roeder: Deutsche, Schwaben, Donauschwaben. Marburg 1998 Ingomar Senz: Die Geschichte der Donauschwaben. 2. Auflage, München 1994 Die neue Heimat Nach 1945 waren neben den Donauschwaben in aller Welt besonders die katholische und evangelische Kirche, das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen bemüht, die materielle und seelische Not zu lindern. Heute leben die Donauschwaben in der Zerstreuung, auch wenn sich in manchen Ländern Siedlungsschwerpunkte feststellen lassen: In Nord- und Südamerika, Australien, in Ungarn (noch rund 270 000 – hier waren die Vertreibungsmaßnahmen nicht so umfangreich und brutal wie in anderen osteuropäischen Ländern), in Österreich und Deutschland Donauschwaben-Denkmal in Ulm Foto: Jakob Huff 26 6. Linz und Mauthausen: Repräsentationsarchitektur und Menschenvernichtung a) Linz: die »Heimatstadt« Adolf Hitlers Von Erika und Helmuth Kern Berlin lag längst in Trümmern, aber noch im Bunker unter der Reichskanzlei saß er immer wieder vor den Linzer Modellbauten, seinem Lieblingsprojekt. Peter Reichel: Der Schöne Schein des Dritten Reiches Seit 1939 gehörte Linz zu den fünf »Führerstädten«, die zum Vorbild künftiger nationalsozialistischer Architektur umgestaltet werden sollten. Die »Jugendstadt des Führers« sollte zum »europäischen Kunstzentrum« werden, Wien, die »Phäakenstadt«1, damit übertrumpfend. Gewaltige Kriegsgewinne waren zur Finanzierung des »deutschen Budapest« vorgesehen. Schon während des Krieges sollte massenhafter Kunstraub in den besetzten Gebieten die Südlicher Abschnitt mit Ausschnitt Donauuferbebauung, verbreiterter Landstraße und linker Achse. Plan der Neugestaltung (April 1944). Ausstattung des »Führermuseums« sicherstellen. Aus den Granitsteinbrüchen des nahe gelegenen Mauthausen (siehe 6.b)), aus denen vor 1938 die meisten in Wien verarbeiteten Pflastersteine stammten, wurde das Baumaterial für »Hitropolis«2 unter unvorstellbaren Leiden gebrochen. 1945 waren die Vorstellungen der Neugestaltung von Linz jäh zu Ende, was blieb, waren Modelle und Pläne. Zwei repräsentative Stadtzentren sollten das neugestaltete Linz bestimmen: am Donauufer ein monumentales über zwei Kilometer sich erstreckendes Verwaltungsforum, um die Macht des Staates zu repräsentieren: Partei, Wehrmacht, Wissenschaft, Freizeit. Südlich an die Innenstadt anschließend, zwischen der Blumau und dem Niernharter Rücken, die neue »Kunstmetropole« Linz, in der typischen Achsenplanung nationalsozialistischer Großprojekte. Die ehemalige »Landstraße« sollte auf 36 m verbreitert werden und die beiden Zentren miteinander verbinden. Sie sollte damit zur Hauptverkehrsachse werden, östlich dazu verliefen parallel zwei zusätzliche Ringstraßen. Alle drei Hauptverkehrsachsen sollten über drei neu zu gestaltende Stadtbrücken nach Urfahr verlaufen. Am diesseitigen Donauufer waren die über 450 m langen Gauanlagen geplant, mit einer Gaufesthalle für 35 000 Besucher. Die Anlage sollte einen Aufmarschplatz für 100 000 Menschen umschließen, das Ganze sollte ein 167 m hoher Glockenturm (mit dem Grabmal der Eltern Hitlers) überragen, der Donauturm, höher als der Stephansdom (137 m). Modell der Uferbebauung, Blick nach Urfahr: Im Hintergrund (v.l.n.r.) Stadthaus mit Hochhaus für Kreisleitung, Gauanlage mit Donauturm und Gauhalle, Ausstellungsgelände. Vorne: Basar, KdF-Hotel, Stahlhängebrücke, Verwaltungsgebäude der Herman-Göring-Werke, Technische Hochschule. Das Modell der Uferbebauung; rechtes Ufer: Hitlers Alterssitz, Brückenkopfgebäude, Nibelungenbrücke, Hotel Donauhof, Basar, KdF-Hotel, Stahlhängebrücke. Linkes Ufer: Rathausanlage mit Stadthaus, Hochhaus für Kreisleitung und Kepplerdenkmal. Nibelungenbrücke, Gauanlage mit Donauturm (jeweils v.l.n.r.) 27 Auf dem Spatzenberg über Urfahr sollte die Adolf-HitlerSchule, eine nationalsozialistische Erziehungsanstalt (NAPOLA), stehen3. Hermann Giesler (1898–1987), zuletzt freischaffender Architekt in Düsseldorf, wurde 1940 von Hitler mit der Neugestaltung von Linz beauftragt. Seit 1924 bereits aktives Mitglied der nationalsozialistischenBewegung, hatte er die Ordensburg in Sonthofen geplant, war 1937 zum Professor und stellvertretenden Leiter der Bauabteilung der DAF und 1939 zum Generalbaurat der »Hauptstadt der Bewegung« ernannt worden. 1944/45 wurde er Leiter der »OT-Einsatzgruppe Deutschland VI« (Organisation Todt), zuständig für Bayern und die Donau-Gaue, und Generalbevollmächtigter für das dortige Bauwesen.4 Neugestaltung von Linz – Linzer Achse mit Opernplatz, Prachtstraße »In den Lauben« und Verkehrsplatz. Im Vordergrund links das Kunstmuseum Linz sollte die schönste Donaumetropole werden. Hitler entwarf Teile der Donauuferbebauung, auch die Linzer Achse mit ihrer 60 m breiten Prachtstraße »In den Lauben« war nach seinen Wünschen und Skizzen geplant. An deren nördlichem Ende sollte im Osten das »Führermuseum« stehen, gedacht als Gegenstück zu den Uffizien in Florenz. Der »Sonderauftrag Linz« diente zur Beschaffung von Kunstwerken, die den Grundstock für eine der größten Kunstgalerien der Welt bilden sollte, Schwerpunkt der Sammlung: die so genannte »germanische Klassik«. Dafür wurde im besetzten Europa hemmungslos beschlagnahmt und geplündert, meist waren es Werke aus jüdischem Besitz. Die am stärksten vom Kunstraub betroffenen Staaten waren Polen und Frankreich und ab September 1943 ltalien. ln den besetzten Zonen im Westen, in Frankreich, Belgien und Holland, wurde nichtjüdischen Besitzern gegenüber der Schein des legalen Kaufs gewahrt, im Osten wurde einfach requiriert. Am 26. Juni 1939 erließ Hitler den »Sonderauftrag Linz«, der Linz zur Hauptstadt der Künste machen sollte. Kunst-Einkäufer war Hans Posse, ein ehemaliger Dresdner Museumsdirektor, nach seinem Tod 1942 H. Voss. Zunehmend gewann dann allerdings der »Fotograf des Füh- Ostansicht des Kunstmuseums am Opernplatz rers«, Heinrich Hoffmann, als Kunstberater Hitlers an EinfIuss, bis zuletzt Martin Bormann 1944 alleiniger Berater in Sachen Kunst für Linz wurde. In den Luftschutzräumen unter dem Münchner »Führerbau« wurden zunächst die Kunstwerke deponiert, als dann der Platz nicht mehr ausreichte, wurde SchIoss Neuschwanstein zusätzlich belegt. 1944, nach der alliierten Invasion in Frankreich, wurden die gehorteten Kunstschätze nach Alt-Aussee (Bayern) gebracht. Nach Kriegsende entdeckten die Alliierten im dortigen Salzbergwerk 10 000 Gemälde, die Hälfte davon alte Meister. Infamer Zug der Aktion: SolIte der Feind siegen, mussten die Werke allesamt vernichtet werden. Der Plan wurde nicht ausgeführt. Viele Kunstwerke sind jedoch bis heute verschwunden.6 Neben der Linzer Gemäldegalerie, dem »Führermuseum«, sollten noch ein »Pantheon der Bildhauerkunst« sowie eine Sammlung für Kunsthandwerk und Münzen entstehen. In der der Gemäldegalerie gegenüber liegenden Bibliothek sollten eine Million Bände Platz finden, als Gegenstück zur Wiener Urania gedacht. Und was in Bayreuth Wagner war, das sollte für Linz der von Hitler ebenfalls geschätzte Linzer Komponist Anton Bruckner werden: In der Brucknerhalle mit Brucknerorchester und Brucknerchor sollten die jährlichen Festspiele zelebriert werden. Dazu Schauspielhaus, Operettenhaus, Künstlerhaus und Freiluftausstellungsgelände bis hin zu einem Uraufführungskino der Ufa – sie sollten nationalsozialistisch geprägte Kunst und Kultur auf dem »idealsten Bummel der Welt« erleben lassen. Mitte Februar 1945 war das Modell fertig gestellt und Giesler übergab es Hitler in der Berliner Reichskanzlei, dort wurde es allen Besuchern gezeigt. Das Linzer Modell scheint für Hitler in den letzten Wochen vor seinem Selbstmord zum Linz-Traum geworden zu sein, zum Ort der Flucht.7 Anmerkungen/Literaturhinweise 1 2 3 4 5 6 7 Bezeichnung Hitlers für Wien, das er verachtete. Die Phäaken waren in der »Odyssee« ein Seefahrervolk, das Odysseus half nach Ithaka zu kommen. lngo Sarlay: Hitropolis, in: Bazon Brock, Achim Preiß: Kunst auf Befehl?, Klinkhardt & Biermann, München, 1990, S. 187 (Alle Bilder sind diesem Buch entnommen.) Ingo Sarlay: Hitropolis, S. 187–199 CaroIine Schönemann: 50 Biographien, in: 1945 Krieg-Zerstörung-Aufbau: Architektur und Stadtplanung 1940–1960: Schriftenreihe der Akademie der Künste, Henschel Verlag, Berlin, 1995, S. 367 Ingo Sarlay: Hitropolis, S. 188 lngo Sarlay: Hitropolis, S. 195 Reinhard Merker: Die bildenden Künste im Nationalsozialismus, DuMont Köln, 1983, S. 177 Alle Abbildungen: Stadtbauamt Linz 28 Das Konzentrationslager Mauthausen war ein ganzer Komplex bestehend aus einem Haupt- und 62 Nebenlagern und Außenkommandos, der offiziell am 8. August 1938 eröffnet wurde. Nach der Annexion Österreichs verkündete am 28. März 1938 Gauleiter August Eigruber, »wegen seiner Verdienste [!] um den Nationalsozialismus werde Oberösterreich ein Konzentrationslager bekommen«1, und er kündigte an, dass darin alle Gegner und »Verräter« eingesperrt würden. Bereits am 7. April 1938 wurde der Linzer Stadtverwaltung mitgeteilt, »dass in Mauthausen ein staatliches Konzentrationslager für 3000 bis 5000 Leute errichtet werden soll.«2 Am 16. Mai 1938 nahm dann die SS mit 30 Zivilarbeitern die Produktion in den Steinbrüchen auf und am 26. August trafen die ersten 600 Häftlinge, zumeist Kriminelle, aus Dachau in Mauthausen ein. Mit weiteren 480 Häftlingen, die bis November aus Sachsenhausen kamen, errichteten sie bis 1939 im späteren Hauptlager 19 Baracken, in denen auf je 52,6 m x 8,2 m 300 Häftlinge »leben« sollten, dazu die Versorgungsgebäude und die SS-Unterkünfte. Die Steine mussten sie unter lebensgefährlichen Bedingungen aus dem nahe gelegenen Steinbruch über »eine unebene Stiege mit 186 Stufen heraufschleppen«.3 Ab Mai 1939 wurden die ersten politischen Häftlinge nach Mauthausen gebracht; »das Lager für weibliche Häftlinge wurde am 5. Oktober 1943 eingerichtet.«4 Erster Kommandant des Lagers wurde SS-Sturmbannführer Franz Ziereis. Die SS hatte sich für das Lager Mauthausen wegen des abbauwürdigen Granits entschieden. Bereits im Juni 1938 verhandelte der »Generalbauinspekteur für die Reichshauptstadt« Albert Speer über die Lieferung von Baumaterial für einen Zeitraum von zehn Jahren. »Millionen von Quadern, Gehsteigkanten, Grundbausteinen, Treppenstufen, Granitsockel [...], viele Tausende Waggonladungen von Pflastersteinen und Granitwürfeln wurden in den Jahren 1938 bis Herbst 1943 in Mauthausen und den Gusener Steinbrüchen [unter ständiger Lebensgefahr] erzeugt.«5 Todesstiege Sommer 1941 Todesstiege heute b) Das Konzentrationslager Mauthausen Von Wolf-Rüdiger Größl Aus: Katalog Mauthausen Foto: Wolf-Rüdiger Größl Ihre heute gleichmäßig und normal hohen Stufen waren zur Zeit des Konzentrationslagers willkürlich aneinandergereihte, ungleich große Felsbrocken der verschiedensten Formen. Die oft einen halben Meter hohen Felsbrocken erforderten beim Steigen größte Kraftanstrengung. Die SS vergnügte sich unter anderem damit, die letzten Reihen der abwärts gehenden Kolonne durch Fußtritte und Kolbenhiebe zum Ausgleiten zu bringen, so dass sie im Sturze, ihre Vordermänner mitreißend, in einem wüsten Haufen die Stufen hinunterkollerten. Am Ende eines Arbeitstages, wenn der Aufmarsch ins Lager mit einem Stein auf der Schulter begann, trieben die den Abschluss bildenden SS-Leute Nachzügler mit Schlägen und Tritten an. Wer nicht mitkonnte, endete auf dieser Todesstiege. (Text der Gedenktafel) 29 Ab 1941/42 entschloss sich dann Himmler, auch das Lager Mauthausen für den verstärkten Rüstungsbedarf nutzbar zu machen, weil Österreich wegen seiner damals noch luftgeschützten Lage zum Schwerpunkt der deutschen Rüstung gemacht wurde (Steyr, Linz, Wels, St. Valentin). Dennoch waren 1942 erst etwa acht Prozent der Häftlinge im Rüstungsbereich tätig. Pläne, die im Zusammenhang mit der »Neugestaltung der Gauhauptstadt Linz« zu einer Großziegelei in einem Außenlager bei Bachmanning in Oberösterreich führen sollten, wurden 1942 auf Anordnung Speers eingestellt. 1943 schufteten von den rund 12 000 Häftlingen 8000 in den Steinbrüchen, 4000 in den verschiedensten Werkstätten des Lagerkomplexes. Mauthausen unterschied sich von allen anderen Konzentrationslagern: Es war das einzige Lager der Stufe III. 1941 war in einem Erlass Reinhard Heydrichs, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, eine Klassifizierung der bestehenden Lager vorgenommen worden. Heydrich hatte darin Folgendes bestimmt6: Für »alle wenig belasteten und bedingt besserungsfähigen Schutzhäftlinge, außerdem für Sonderfälle und Einzelhaft« die Lagerstufe I (Dachau, Sachsenhausen, Auschwitz-Stammlager); »für besonders schonungsbedürftige, ältere, kaum arbeitsfähige Häftlinge« sowie für prominente Häftlinge die Lagerstufe Ia im Lager Dachau; »schwer belastete, jedoch noch erziehungs- und besserungsfähige Schutzhäftlinge« Lagerstufe II (Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme, Auschwitz II Birkenau, das dann aber Vernichtungslager wurde); »für schwerbelastete, unverbesserliche auch gleichzeitig kriminell vorbestrafte und asoziale, d.h. kaum noch erziehbare Schutzhäftlinge« die Lagerstufe III (Mauthausen und Unterkunft Gusen). »Als einziges Konzentrationslager im gesamten Reichsgebiet blieb dieses Lager das, was es vorher war: eine Liquidationsstätte ohne Gerichtsurteil für politische Gegner! So z. B. sind bei einem durchschnittlichen Gesamtstand von etwa 10 000 Häftlingen im Jahre 1942 im KL [Mauthausen] etwa 13 000 Neuzugänge registriert worden und im gleichen Zeitraum wurden 14 293 Gefangene als ›verstorben‹ gemeldet. Allein in den ersten vier Monaten des Jahres 1943 sind im KLM mindestens 5147 Tote registriert worden!«7 Ab Frühjahr 1943 begann auf Forderung Speers der verstärkte Einsatz für die Kriegswirtschaft – hauptsächlich in den Nebenlagern – und aus Mauthausen wurde ein »Lagernetz« mit Zehntausenden von Arbeitssklaven aus ganz Europa. Auch in Mauthausen missbrauchten die SS-Ärzte viele hundert Häftlinge für Menschen verachtende, pseudowissenschaftliche Versuche; alle Opfer wurden dabei getötet.8 Zahlreiche Häftlinge wurden von der Gestapo mit dem Vermerk »Rückkehr unerwünscht« (RU) eingeliefert; ihnen und vielen Kranken wurde eine »Sonderbehandlung« zuteil. Entweder wurden sie »auf der Flucht« erschossen oder mittels Herzinjektionen ermordet. Hunderte von Häftlingen wurden v. a. im Winter bis zu 30 Minuten lang mit eiskaltem Wasser abgespritzt, so dass sie einem Herzschlag erlagen, andere wurden erschlagen, Hunderte wurden vergast und in einem der drei Krematorien verbrannt; so wurden mehr als 27 500 Menschen ermordet. Ein besonders dunkles Kapitel ist die so genannte »Mühlviertler Hasenjagd« im Februar 1945. Am 2. 2. 1945 bra- chen etwa 570 sowjetische Kriegsgefangene aus dem Lager aus. Sie gehörten zu den so genannten »K-Gefangenen«, die auf Grund eines Erlasses des OKW vom 2. 3. 1944 (»Keitel-Verordnung«) erschossen werden sollten. An der Fahndung nach den Flüchtlingen beteiligten sich alle Behörden und Dienststellen von Partei und Wehrmacht, aber auch die Bevölkerung und v. a. die Hitlerjugend, so dass eine regelrechte Treibjagd, »Hasenjagd« genannt, einsetzte, in deren Verlauf bis auf vielleicht 17 Häftlinge, die entkommen konnten, alle Flüchtlinge getötet wurden.9 Als die Amerikaner am 5. Mai 1945 das KL Mauthausen befreiten, fanden sie ungefähr 30 000 Frauen und Männer in einem erbärmlichen Zustand vor. Bis dahin hatten wohl 113 575 Menschen in Mauthausen und seinen Nebenlagern den Tod gefunden.10 Mauthausen mit seinen Außenstellen war ein Sklavenbetrieb und zugleich ein Vernichtungslager und »wer heute durch das sanfte Donautal des oberösterreichischen Mühlviertels fährt, kann sich nicht vorstellen, dass hier in den Jahren 1938 bis 1945 massenweise Menschen in die Postenkette getrieben ›auf der Flucht‹ erschossen, Verfolgte über die steilen Hänge der Granitsteinbrüche hinuntergestürzt oder in den Gaskammern vergiftet wurden, dass die Krematorien-Anlagen in Mauthausen, Gusen, Ebensee, Melk und Schloss Hartheim Tag und Nacht brannten«, schreibt ein ehemaliger Gefangener des Lagers.11 Schloss Hartheim war zudem unter Franz Stangl, dem späteren Kommandanten des Vernichtungslagers Treblinka, ein Zentrum des »Euthanasie-Programms«, sein Personal wurde später dem KL Mauthausen unterstellt. Heute mahnen die Wachtürme oberhalb der Ortschaft Mauthausen als steinerne Reste, sich der Vergangenheit stets zu erinnern, damit solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit nie wieder begangen werden. Anmerkungen / Literaturhinweise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klaus Drobisch / Günther Wieland: System der NS Konzentrationslager 1933–1939, Akademie Verlag, Berlin 1993, S. 272 Zit. in: ebenda, S. 274 Ebenda S. 274 Gudrun Schwarz: Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt 1996, S. 207 Hans Maršálek: Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen. Dokumentation, Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen, Wien 1974, S. 6 Das Folgende nach H. Maršálek, Mauthausen, S. 22 Ebenda, S. 9 Vgl. dazu: H. Maršálek, Mauthausen, S. 142–144 Eine genaue Angabe ist nicht möglich, da die »K-Häftlinge« ohne Häftlingsnummer waren Vgl. G. Schwarz, System, S. 208 und H. Maršálek, Mauthausen, S. 115–119 H. Maršálek, Mauthausen, S. IX 30 Kunst- und Literaturlandschaften IV. An der Donau: Kunst- und Literaturlandschaften Stift MeIk: Stiftsbibliothek Foto: Katalog der Jübiläumsausstellung 1989, S. 279 Stift MeIk (1701–1739) Foto: Österreich Information, Taufkirchen 1. Inszenierte Geschichte Der Bauherr Berthold Dietmayr (1670–1739), seit 1700 Abt in Melk. Zahlreiche Ämter: Dekan der theologischen Fakultät, Rektor der Universität Wien, Mitglied im ständigen Ausschuss des Landtags. 1728 kaiserliche Ernennung zum Wirklichen Geheimrat. Unter ihm wirtschaftliche, künstlerische, wissenschaftliche Blütezeit des Stifts. Europäisches barockes Lebensgefühl. Bezugspunkte glanzvoller repräsentativer Selbstdarstellung: Kaiserhaus, Papsttum und Wissenschaften – Kaisersaal, Kirche und Bibliothek. Monumentale Deckenmalerei als zentrale Aufgabe der Kunst. Schein und Wirklichkeit fließen ineinander. Lehrstücke von monumentalen Ausmaßen überhöhen die jeweilige Funktion der Räume: z. B. der große Bibliothekssaal: In Wolken triumphiert die göttliche Weisheit, umgeben von den vier Kardinaltugenden, über den Personifikationen der Wissenschaften und Künste. Von Erika und Helmuth Kern »Wie ein Torwächter steht am Eingang zur Wachau das Benediktiner-Stift Melk. Auf einer 50 m hohen Felsnase über der Donau erhebt sich die palastartige Anlage, deren Schauseite, die Westfront, dem Strom zugewandt ist. Die über 300 m lange Südfront wird überragt von der mächtigen Kuppel und dem Turmpaar der Stiftskirche. Das Meisterwerk Josef Prandtauers ist eine der glanzvollsten Schöpfungen europäischen Barocks.« (Günter Treffet: Das Zeitalter des Barock. Edition Christina Brandstätter. Wien. 1990. S. 18) Das Klostermuseum. Schatzhaus sakraler Kunst: Reliquien, Kunsthandwerk Mythos Melk, als »der zentrale Ort des frühen Österreich«: Grenzburg der Ungarn. 975 vom ersten Markgrafen Leopold I. erobert. Hauptburg. Kanonikerstift und Begräbnisstätte der Babenberger bis Anfang des 12. Jahrhunderts. Besucher von Melk: Jährlich 400 000–450 000! Unterschiedliche Beweggründe: Aussichtspunkt. Glaube. Kunst. Wissenschaft. Benediktinerkloster seit 1089 ohne Unterbrechung. Seit 1122 direkt dem Papst unterstellt, bistumsunabhängig. Heute 36 Mönche. 1998: sensationeller Fund: im Falz einer mittelalterlichen Handschrift Entdeckung von weiteren Fragmenten des Nibelungenlieds Die Bibliothek umfasst in zwölf Räumen etwa 100 000 Bände: davon sind 1 800 Handschriften – vom frühen 9. Jahrhundert an (Beda Venerabilis) und 750 Inkunabeln (Frühdrucke bis 1500), in gesondertem Raum verwahrt: 1700 Werke des 16. Jahrhunderts, 4500 des 17. Jahrhunderts, 18 000 des 18. Jahrhunderts, thematisch geordnet. Im großen Bibliotheksraum allein über 16 000 Bände: Bibelausgaben, Theologie, Jurisprudenz, Erd- und Himmelskunde, Geschichte, barocke Lexika. In den anderen Räumen Literatur. Altphilologie, Naturwissenschaften. Grab des Hl. Koloman seit 1014. Jerusalempilger, der Spionage für die Ungarn verdächtigt. 1012 in Stockerau bei Wien gehängt: Wunder nach seinem Tode machten ihn berühmt, nach Melk gebracht und begraben wurde er Landesheiliger. Der Legende nach durch ihn Beendigung der Türkenkriege. Das Stiftsgymnasium: Im 14. Jahrhundert Unterricht für »weltliche« Schüler, als Gegenleistung für Singen beim Gottesdienst. 1778 öffentliches Gymnasium. 1938 Schließung durch NS-Regime. 1945 Wiedereröffnung als humanistisches Gymnasium (161 Schüler), 1967 Einführung der Koedukation und des neusprachlichen Zweigs. 1976 Einführung des Oberstufenrealgymnasiums mit Instrumentalmusik. Differenziertes Angebot in vier Zweigen: gymnasiale Oberstufe: humanistisch, neusprachlich und Oberstufenrealgymnasium: musisch und realistisch (Biologie, Umweltkunde, Physik, Chemie). Sprachenbetont: Englisch (Kl. 1). Latein (Kl. 3); Wahl des Oberstufenzweigs zu Beginn der Klasse 5, ab Klasse 6 Wahlpflichtfächer wie Italienisch, Spanisch, Russisch. Abschluss in Klasse 8 mit Reifeprüfung. Schulträger ist der jeweilige Abt. Staatlich anerkannte private Schule mit einem Schulgeld von ÖS 700,- pro Monat, Ermäßigung für sozial benachteiligte Schüler (Stand 1998). 31 Walhalla: Griechenland an der Donau (1830–1842) Für »rühmlichst ausgezeichnete Teutsche«. Plan Ludwigs I. von Bayern (1786–1868) als Ehrentempel ab 1807. Im Innern: der Bauherr in römischer Toga, Sitzfigur, überlebensgroß, idealisiert, nachdenkliche Pose: aufgestellt am 104. Geburtstag des Königs (1890) aus dem besten Marmor Italiens, aus Carrara. Innen im umlaufenden Relieffries Illustration folgender Geschichtstheorie: Einwanderung vom Kaukasus her, Querung des Ister, Kämpfe mit den einheimischen wilden Tieren. Schilderung von Kultur, Kunst und Politik der »Germanen«, Einfall in Italien, Völkerschlacht von Adrianopel (Edirne, 378) – Sieg der germanischen Volksstämme, Eroberung Roms und Bekehrung zum Christentum durch Bonifatius (auf Gedenktafel). Einweihung am 18. Oktober 1842, dem 29. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig. Architekt: Hofbaumeister Leo von Klenze, der München klassizistisch gestaltete. Heute sind 126 Bildnisbüsten aufgestellt; zuletzt kamen die Gründerin des Ordens der Armen Schulschwestern, Maria Theresia Gerhartinger (1797–1879), zum 50-jährigen Bestehen der Bundesrepublik Deutschland Konrad Adenauer und dann Johannes Brahms hinzu: Beschluss der Bayerischen Staatsregierung, heute für Walhalla zuständig. Der Name: Vorschlag von Johannes von Müller, Schweizer Historiker im Dienste Preußens. Der Name erinnert an das Elysium des Nordens: Gefilde der Seligen und Ort der Unsterblichkeit. Bereits während der Bauzeit (18. Oktober 1830 bis 18. Oktober 1842) touristischer Magnet, über den man in England, Frankreich und Spanien schreibt. Heute zählt man jährlich mehr als 200 000 Besucher internationaler Herkunft. Die Lage: freie Natur in Anlehnung an den englischen Garten, Sinnbild freiheitlicher Gesinnung. Hoch über der Donau, die nach romantischer Vorstellung zum gemeinsamen Ursprung aller germanischen Völker in Zentralasien fließt: von dort seien diese donauaufwärts gezogen. Vertreter dieser Theorie: Friedrich Schlegel, Johannes von Müller und Joseph Görres. Von Müller, der den König in Auswahl der Walhallarepräsentanten beriet, Fotos: E. + H. Kern wurde 1808 vom Bildhauer Schadow für die Walhalla in Marmor porträtiert. Görres dagegen bekam erst 1931 Walhallaehren, Schlegel gar nicht. Vorbild für die äußere Form ist der Parthenon. Das Innere ist christlichem Kirchenbau entlehnt. Ludwig I. am 18. Oktober 1842: »Möchte Walhalla förderlich sein der Erstarkung und Vermehrung Deutschen Sinnes! Möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch seien, immer fühlen, dass sie ein gemeinsames Vaterland haben, ein Vaterland, auf das sie stolz sein können: und jeder trage bei, soviel er vermag, zu dessen Verherrlichung.« Seit 1945 kamen ins deutsche Pantheon: Max Reger (1948), Adalbert Stifter (1954) und Joseph Freiherr von Eichendorff (1957). Wilhelm Conrad Röntgen (1959), Max von Pettenkofer (1962), die »erste deutsche Unternehmerpersönlichkeit« Jakob Fugger (1967), Jean Paul (1973) und Richard Strauß, Carl Maria von Weber (1978), Gregor Johann Mendel (1983) und Albert Einstein (1990). Bei der Eröffnung sind 96 Büsten aufgestellt und 64 Namenstafeln angebracht. Maßstab für die Auswahl: »teutsche Zunge« und bedeutende Leistung in Politik, Künsten und Wissenschaften in Friedens- und Kriegszeiten. Einendes Band ist die germanische Sprachfamilie, einbezogen auch Schweizer, Niederländer, Briten, Schweden, Balten. Sie sollen als Vorbilder wirksam sein. Kunst als Erzieherin des Volkes – Walhalla als Gedenkmuseum. Aufklärung – Grundsatz der Gleichheit: »Kein Stand ist ausgeschlossen, auch das weibliche Geschlecht nicht«, so Ludwig I. in »Walhallas Genossen« zur Einweihung. Deswegen auch Gleichheit in Größe, Stil und Material der Bildnisbüsten. »Bei Regensburg läßt er erbaun/ Eine marmorne Schädelstätte,/Und er hat höchstselbst für jeden Kopf/ Verfertigt die Etikette// Walhallagenosse, ein Meisterwerk./ Worin er jedweden Mannes/ Verdienste, Charakter und Taten gerühmt,/von Teut bis Schinderhannes, spottete Heinrich Heine. Im Pantheon sucht man ihn vergeblich. 32 2. Mit Dichtern die Donau hinunter Von Heinrich Bock · Textauswahl: D. Rolbetzki Donaueschingen: »von wo an die Sache Donau genannt wird« (Péter Esterházy) »Dort saß ich dann und blickte auf das Wasser, wie es sich mischte, ... dies ist das der Breg, dies ist sicherlich das der Brigach, und dort!, das dort ist schon die Donau. ... Ab und zu warf ich Blätter ins Wasser und brachte meine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie nun bis ins Schwarze Meer schwimmen würden.« Péter Esterházy: Donau abwärts, 2. Auflage Salzburg/ Wien 1993, S. 30 Péter Esterházy, geboren 1950 in Budapest, gilt als »Enfant terrible der ungarischen Literaturszene« (Rolf Scheller). Sein Roman »Donau abwärts« (1991) schildert eine turbulente Donaureise. Am Zusammenfluss von Brigach und Breg Foto: Dietrich Rolbetzki Von Passau nach Esztergom: Der Nibelungen Not »Dergleichen elendes Zeug« würde er in seiner Bibliothek nicht dulden, empörte sich Friedrich der Große. Goethe dagegen bescheinigte dem ersten Teil des Nibelungenliedes (Siegfrieds Ermordung) »mehr Prunk«, dem zweiten (Untergang der Burgunden) »mehr Kraft« und meinte, die Kenntnis dieses Gedichts gehöre »zu einer Bildungsstufe der Nation«. Wer heute dem Zug der Nibelungen vom Rhein zur Donau folgen möchte, rüstet sich am besten mit einer zweisprachigen Textausgabe und einem der zahlreichen literarischen Reiseführer aus. Zwar ist der Verlauf des Reisewegs der historischen Burgunden von Xanten und Worms bis an die Donau (»unz an die Tuonouwe«) wenig gesichert, weil man annimmt, dass die Ortskenntnis des Autors, der die 39 Aventiuren um 1200 wahrscheinlich in Passau aufschrieb, zu wünschen übrig ließ. Zuverlässiger informiert wird man bei den im zweiten Teil des Epos genannten und weitgehend an der Realität orientierten Schauplätzen im donauländischen Raum zwischen Passau, Wien und dem ungarischen Esztergom. Im bayerischen Pförring (»ze Vergen«) soll Kriemhild auf ihrem Weg zu König Etzel im Hunnenland über die Donau gesetzt sein. Bei Großmehring (»ze Moeringen«) zog dreizehn Jahre später das Nibelungenheer durch die Donaufurt. Im Passauer Rathaussaal wird auf einem Kolossalgemälde aus dem späten 19. Jahrhundert der Einzug Kriemhilds in die Dreiflüssestadt und der Empfang durch Bischof Pilgrim, ihren Onkel, dargestellt: ein Gemälde, das »nichts von dem düsteren Wesen des Nibelungenliedes« enthält, sondern eher an die Kulissen des 1924 entstandenen »grandiosen Ausstattungsfilm[s] von Fritz Lang« erinnert (Claudio Magris). In Pöchlarn, das sich heute werbewirksam und marktkonform »das Herz des Nibelungengaus« nennt, macht ein Denkmal aus dem Jahre 1987 darauf aufmerksam, dass hier Markgraf Rüdiger von Bechelaren das Nibelungenheer empfangen haben soll. Es will den »europaweiten Friedensgedanken« versinnbildlichen und die Verbundenheit aller im Nibelungenlied erwähnten Städte dokumentieren. Unterhalb des Benediktinerklosters Melk, am Fuß des Felsens, weist eine Tafel auf eine weitere Station der Reise Kriemhilds nach Ungarn hin. Bis Tulln reitet ihr König Etzel in Begleitung Dietrichs von Bern entgegen. In Wien wird siebzehn Tage lang die Hochzeit gefeiert, und reich beschenkt reitet man »froh am Donauufer entlang, stromab bis zum hunnischen Land«. In Gran (Esztergom), hoch oben über der Donau in der Etzelburg, vermutet man heute den Schauplatz des Nibelungen-Untergangs: »hie hat daz maere ein ende: daz ist der Nibelunge not«. Kein anderer mittelalterlich »ritterlich-höfischer Roman« (Helmut de Boor) hat die Deutschen bei ihrer Suche nach Identität immer wieder so beschäftigt wie das in der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder entdeckte Nibelungenlied. Seine Bibliographie umfasst etwa 500 Titel: 64 vollständige Übersetzungen, Romane, Erzählungen, Balladen, allein 123 Schauspiele, mehrere Opern, Operetten, Hörspiele, Filme, Comics. Vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute spiegelt sich seine Rezeptions- und Wirkungsgeschichte aber auch in ideologischen Fehldeutungen und nationalpolitischer Geschichtsklitterung. Das angeblich »durch und durch deutsche, heimische Gedicht« wurde zu einem »Hauptbuch bei der Erziehung der deutschen Jugend« (August Wilhelm Schlegel): »Kein anderes Lied mag ein vaterländisches Herz so zu rühren und ergreifen, so ergötzen und stärken als dieses« (Friedrich Heinrich von der Hagen, 1907). Der »Brockhaus« nannte es 1835 »das deutsche Nationalepos, das bedeutendste Denkmal der mittelhochdeutschen Poesie«. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 interpretierte man es als »Urbild reiner echter Deutschheit, Evangelium der Treue, Spiegel noch immer gültiger Hoheit der Gesittung«. Siegfried wurde zum »Inbild deutschen Heldentums«, der im Rhein versenkte Nibelungenhort das »versunkene, noch zu hebende Deutschtum« (Helmut Brackert, 1971). Aber Heinrich Heine dichtete 1849: »Es ist dasselbe Heldenlos, / Es sind dieselben alten Mären, / Die Namen sind verändert bloß, / Doch sinds dieselben ›Helden lobebären‹.« 33 Unter den zahlreichen Nachdichtungen hat Richard Wagners Bühnenfestspiel »Der Ring des Nibelungen« (entstanden 1849–1874), mit dem auch 1876 das Bayreuther Festspielhaus eröffnet wurde, zum Fortleben des aus verschiedenen Sagenstoffen der Völkerwanderungszeit bestehenden Epos entscheidend beigetragen. Das »Götterdämmerungspathos« (Thomas Nipperdey) des dritten Teils wurde zu einem Menetekel germanischer Untergangssehnsucht: »... Wir stiegen auf in Kampfgewittern, / Der Heldentod ist unser Recht: / Die Erde soll im Kern erzittern, / Wann fällt ihr tapferstes Geschlecht: / Brach Etzels Haus in Glut zusammen, / als er die Nibelungen zwang, / So soll Europa stehn in Flammen / bei der Germanen Untergang!« (Felix Dahn, 1859) Der Historienmaler Julius Schnorr von Carolsfeld gestaltete 1847 seinen Nibelungenzyklus in der Münchner Residenz. Friedrich Hebbel wollte in seinem »deutschen Trauerspiel in drei Abteilungen« (»Die Nibelungen«, 1862) den »dramatischen Schatz des Nibelungen-Liedes für die reale Bühne flüssig machen«. Im Deutsch-Französischen Krieg (1870) wurde die »teutsche Ilias« (Johannes von Müller) zur »Feld- und Zeltpoesie« manipuliert: »Damit kann man Armeen aus der Erde stampfen ..., wenn es den gallischen Mordbrennern, der römischen Anmaßung zu wehren gilt« (Karl Simrock). Nach der Reichsgründung fanden sich Auszüge in jedem Schullesebuch. Man wollte den nationalen Gedanken des neu etablierten Staates pädagogisch stärken helfen. Nibelungen-Balladen von Ludwig Uhland, Friedrich Rückert, Börries von Münchhausen und Agnes Miegel wurden in den Schulen auswendig gelernt. Das Interesse verlagerte sich zunehmend auf die Siegfried-Figur, die als Verkörperung jener »Nibelungentreue« galt, die Kaiser Wilhelm II. am Beginn des Ersten Weltkriegs beschwor. Eine ganze Generation des deutschen Bürgertums nannte ihre Söhne »Siegfried«. Das Vaterland sollte an der »Siegfried-Linie« verteidigt werden. Die Ermordung Siegfrieds musste als Erklärungsmodell für die deutsche Niederlage 1918 und zur Konkretisierung der »Dolchstoßlegende« herhalten: »Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf des grimmigen Hagen so stürzte unsere ermattete Front«. Im NS-Staat wurde das Nibelungenlied als »Urkunde« im Dienst der »nationalen Erneuerung« und zur Legitimation des »bedingungslosen Einsatzes für den Führer« missbraucht: »Die Gestalten Siegfrieds und Dietrichs von Bern, Hagens und Gunthers leben heute wieder unter uns«. Den Höhepunkt propagandistischer Vereinnahmung bildete der berüchtigte »Appell an die Wehrmacht« am 30. Januar 1943, in dem »Reichsmarschall« Hermann Göring den Untergang der 6. deutschen Armee in Stalingrad zum »größten Heroenkampf unserer Geschichte« umfälschte und »trotz allem Deutschlands Sieg« versprach: »Auch sie standen in einer Halle voll Feuer und Brand, löschten den Durst mit dem eigenen Blut, aber sie kämpften bis zum Letzten.« Heute sehen Literaturwissenschaftler die Bedeutung des Nibelungenliedes vor allem in der Darstellung gesellschaftlicher Spannungen und Widersprüche: »ein bedrückend negatives Gesellschaftsbild«, in dem Mord, Betrug, Hass, Rache, Machtgier und Hinterlist, aber auch Leid und Trauer »die Handlung von Anfang bis Schluss« bestimmen (Joachim Bumke, 1990). In einer Szenenfolge von Heiner Müller, »Germania Tod in Berlin« (1971), stür- zen sich die Nibelungen mit dem Schlachtruf »Die Hunnen kommen!« auf ihren Feind und zerstückeln sich am Ende gegenseitig. Die Geschehnisse im Nibelungenlied erwecken aber auch als »Bestandsaufnahme der deutschen Seele« weiterhin das Interesse vieler Leser. In dem in zahlreichen Auflagen verbreiteten Roman »Disteln für Hagen« (1966) von Joachim Fernau wird Deutschlands Vergangenheit und Gegenwart aus den Charakteren der Nibelungenhelden zu erklären versucht. Daneben setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass diese »Bibel deutschen Wesens« (Renate Schostack) ganze Generationen mit ihrem »blutrünstigen Stoff vergiftet« habe (Erich Kuby). Die Demontage der Nibelungen als »Götzen und Götter der Moderne« (Wilhelm Emrich) hat spätestens in den 60er Jahren mit einer Neuverfilmung begonnen, als der Hammerwerfer Uwe Beyer die Rolle Siegfrieds spielte – »ein Unternehmen zwischen Märchen und Comic Strip« (Karl Heinz Bohrer). Donaufahrt mit einer Nixe: »Undine« [Undine, ihr Ehemann und die Freundin Bertalda] waren die ersten Tage ihrer Donaufahrt hindurch außerordentlich vergnügt gewesen. Es ward auch alles immer besser und schöner, sowie sie den stolzen flutenden Strom weiter hinunterschifften. [...] [Als Bertalda ihr Halsband gedankenverloren über die Bordwand hielt,] griff plötzlich eine große Hand aus der Donau herauf, erfaßte das Halsband und fuhr damit unter die Fluten. Bertalda schrie laut auf und ein höhnisches Gelächter schallte aus den Tiefen des Stroms drein. Nun hielt sich des Ritters Zorn nicht länger. Aufspringend schalt er in die Gewässer hinein, verwünschte alle, die sich in seine Verwandtschaft und sein Leben drängen wollten, und forderte sie auf, Nix oder Sirene, sich vor sein blankes Schwert zu stellen. Bertalda weinte indes um den verlorenen, ihr so innig lieben Schmuck und goß mit ihren Tränen Öl in des Ritters Zorn, während Undine ihre Hand über den Schiffsbord in die Wellen getaucht hielt, in einem fort sacht vor sich hinmurmelnd und nur manchmal ihr seltsam heimliches Geflüster unterbrechend, indem sie bittend zu ihrem Eheherrn sprach: »Mein Herzlichlieber, hier schilt mich nicht, schilt alles, was du willst, aber hier mich nicht! Du weißt ja.« – [...] Da brachte sie mit der feuchten Hand, die sie unter den Wogen gehalten hatte, ein wunderschönes Korallenhalsband hervor, so herrlich blitzend, daß allen davon die Augen fast geblendet wurden. »Nimm hin«, sagte sie, es Bertalden freundlich hinhaltend, »das hab ich dir zum Ersatz bringen lassen und sei nicht weiter betrübt, du armes Kind.« – Aber der Ritter sprang dazwischen. Er riß den schönen Schmuck Undinen aus der Hand, schleuderte ihn wieder in den Fluss und schrie wutentbrannt: »So hast du denn immer Verbindung mit ihnen? Bleib bei ihnen in aller Hexen Namen mit all deinen Geschenken und laß uns Menschen zufrieden. Gauklerin du!« – Starren, aber tränenüberströmenden Blickes sah ihn die arme Undine an [...] Endlich sagte sie ganz matt: »Ach, holder Freund, ach, lebe wohl! Sie sollen dir nichts tun; nur bleibe treu, daß ich sie dir abwehren kann. Ach, aber fort muß ich, muß fort auf diese ganze junge Lebenszeit. O weh, o weh, was hast du angerichtet! O weh, o weh!« 34 Und über den Rand der Barke schwand sie hinaus. – Stieg sie hinüber in die Flut, verströmte sie darin, man wußt’ es nicht, es war wie beides und wie keins. Bald aber war sie in die Donau ganz verronnen; nur flüsterten noch kleine Wellchen schluchzend um den Kahn und fast vernehmlich war’s, als sprächen sie: O weh, o weh! Ach bleibe treu! O weh! Friedrich de la Motte Fouqué: Undine, Stuttgart 1983, S. 78 ff. »Undine« (1811) ist die Geschichte einer Wasserfrau, die sich in einen Menschen verliebt und dadurch eine Seele bekommt. Als er aber nach ihrem Verschwinden ihre Freundin heiratet, tötet sie ihn für seine Untreue. Im ungarischen Tiefland [...] Das meerglatte Tiefland ist’s, das ich erwähle: Hier bin ich zu Hause, hier bin ich so froh; Im Anblick der Ebne erstarkt mir die Seele – Ein Adler, der plötzlich dem Kerker entfloh. Hier trägt mein Gedanke mich bis an die Sterne, Hier flieg’ ich mit Wolken in endlosem Kreis, Hier lächelt mein Tiefland mir zu aus der Ferne Vom Strande der Donau bis weit an die Theiß. Hier weiden, vom Zauber Morganas umsponnen, Unzählige Herden mit Schellengeläut’; Die doppelten Tröge langschwengliger Bronnen, Sie laden zur Tränke, im Rasen zerstreut. Hinjagender Rosse aufpochende Hufe Durchbrausen die Lüfte mit dröhnendem Schall, Dazwischen der Treiber verworrene Rufe – Gewieher, Gestampfe und Peitschengeknall. Entlegene Weiler in üppigem Kranze Umwoget der Weizen vom Windhauch gewiegt, Der mit des Smaragdes lebendigem Glanze Die friedliche Gegend so traulich umschmiegt. Wildgänse, die kommen in Scharen gezogen Und schwärmen im Riede mit Anbruch der Nacht; Doch kaum sie gekommen, sind rasch sie entflogen, Wenn flüsternd im Schilfe ein Lüftchen erwacht. Die Schenke mit ihrer geborstenen Esse Steht mitten der Heide in einsamer Haft; Rossdiebe, sie ziehen vorbei hier zur Messe Und zechen heimkehrend den funkelnden Saft. Und neben der Schenke in sandigem Grunde Ergrünen Zwergpappeln, ein Wäldchen gar dicht; Hier nisten die Falken in schattiger Runde, Hier stören mutwillige Buben sie nicht. Hier blühen und wuchern in buntester Mischung Reihgräser und Disteln zusammengedrängt, Drin suchen Eidechsen sich Schutz und Erfrischung, Wenn mittags die Sonne die Fluren versengt. Und fern, wo der Himmel die Erde umschlossen, Erglänzen Obstbäume in bläulichem Schein, Dahinter Stadttürme in Neben zerflossen; Wie schimmernder Säulen verschwommene Reihn. [...] Sándor Peto씵 fi; Das Tiefland. In: Sándor Peto씵 fi. Gedichte, Leipzig o.J. Sándor Peto씵 fi (1823–1849) war nicht nur einer der bedeutendsten ungarischen Lyriker, sondern auch geistiger Wegbereiter der Revolution von 1848, für die er sich als Abgeordneter und Soldat einsetzte. Er fiel für Ungarns Freiheit im Kampf gegen die Russen. Am Delta In der Stille dieses Frühlingsabends tönte die Sirene eines Dampfers mit ihrem schneidenden Pfiff durch die Luft und weckte den jungen Mann aus seinen Gedanken. Gleichzeitig traf ihn eine Wolke von Rosen- und Nelkenduft. Adrian bog in den großen Promenadenweg ein, der am Rand des Plateaus entlang läuft und den Hafen und die Donau beherrscht. Einen Augenblick blieb er stehen, um die Tausende von elektrischen Lampen zu betrachten, die auf den im Hafen verankerten Booten brannten, und seine Brust dehnte sich in einer unwiderstehlichen Reiselust: »Herrgott! Wie schön muss das sein, sich auf einem dieser Schiffe zu befinden, die auf den Meeren gleiten und andere Ufer entdecken, andere Welten!...« Betrübt, seinen Wunsch nicht erfüllen zu können, setzte er mit gesenktem Kopf seinen Weg fort [...] Sie lief über den Steg und sprang in die Barke wie eine Hindin. Als ich ihr folgte, hörte ich hinter mir einen Schiffer jene Worte sagen, an die ich mich in all meinem Unglück stets erinnert habe: »Welch schönes Wild!« Ich berichtete Kyra diese Worte und fragte nach ihrer Bedeutung. »Ach, das sind Dummköpfe!«, sagte sie. Es wehte ein schwacher Westwind, und wir genossen zum ersten Mal das Entzücken dieses sanften Dahingleitens; das Segel war kaum geschwellt. Als wir uns vom Ufer entfernten, begann unser Boot unvermittelt auf den kleinen Wellen der Strömung zu tanzen. Kyra hatte Angst und rief: »Nicht in die Mitte des Flusses! ... Den Hafen entlang!« Der Araber drehte das Steuer, wir näherten uns wieder dem Ufer. Unser Haus erschien oben auf der Böschung in seiner verlassenen Trübseligkeit, daneben das Gasthaus mit den offenen Fenstern unsrer Zimmer. Langsam fuhr das Boot daran vorüber, auch an dem Ameisenschwarm des Hafens, an den zahllosen Seglern, Transportschiffen und Brückenkähnen, und wir befanden uns am andern Ende, als die Schaluppe auf einen einsamen Steg zuhielt und anlegte. Panait Istrati: Kyra Kyralina, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 1984, S. 14 und S. 81. Der Rumäne Panait Istrati (1884–1935) schildert in seinem 1924 erschienenen Erstlingswerk die Lebensgeschichte des Jahrmarkthändlers Stavro, der in einem Haus an der Donau aufgewachsen ist. Literaturhinweise Susanne Schaber: Literaturreisen. Die Donau von Passau bis Wien, Stuttgart/Dresden 1993. 35 Den Strom entlang V. Den Strom entlang 1. Ulm und Neu-Ulm: Einstimmung auf zwei Donaustädte Von Jakob Huff »Historisch trennt sie unsere beiden Bundesländer. Wir Menschen erleben sie dagegen als verbindendes Element. Wir sollten sehr viel bewusster mit der Donau leben. Das internationale Donaufestival (1998) wird dazu einen Anstoß geben.« Beate Merk, Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm »Sie prägt unsere Städte Ulm und Neu-Ulm. Und sie verbindet uns mit Süd-Ost-Europa – viel mehr als wir heute annehmen und erahnen können.« Ivo Gönner, Oberbürgermeister von Ulm Eine Annäherung »I ben Ulmer«, würde ich ohne zu überlegen jedem (Schwaben) antworten, der mich nach meiner Herkunft fragte, und das nicht nur, weil ich seit Jahrzehnten in Ulm lebe und arbeite, sondern weil ich in Ulm heimisch geworden bin, obwohl ich da nicht geboren bin. Das habe ich genauso empfunden und gesagt, als ich eineinhalb Jahrzehnte in Neu-Ulm wohnte. Denn die damalige Entscheidung für den bayerischen Wohnort war weitgehend von wirtschaftlichen und praktischen Überlegungen bestimmt gewesen. Und die Rückkehr ins baden-württembergische Ulm war ebenso ein ganz rational begründeter Entschluss aufgrund wirtschaftlicher und familiärer Gegebenheiten, Blick über Ulm nach Neu-Ulm der mir aber, ehrlich gesagt, viel leichter fiel, auch weil er mich von der eigentlich unsinnigen, aber immer wieder von Freunden ironisch provozierten Rechtfertigung meines Daseins in Neu-Ulm befreite. Genauso haben sich Neu-Ulmer Bekannte und Schulfreunde manchmal auch ungefragt zu ihrer Heimatstadt bekannt, im besten Falle wohl um ihre eindeutige Verwurzelung zu bekennen und schlechtestenfalls, um sich so aus einem bestimmten Grund unmissverständlich abzugrenzen. Und für Ulmer ist in einem solchen Falle sowieso klar, dass jenseits der Donau der Balkan beginnt. Die zuweilen liebevolle und zuweilen ruppige Pflege des Mit- und Gegeneinander gehört für mich zu beiden Städten und zu vielen ihrer Menschen. Meine Verbundenheit mit der Stadt, ihrer Umgebung und vielen Bewohnern empfinde ich sehr stark. Vor allem, wenn ich länger verreist war, ist es immer wieder ein »spannender« Moment die Stadt und das gewaltige Münster zu erblicken. Und je nachdem aus welcher Himmelsrichtung man sich der Stadt nähert, sieht man entweder erst nur die Spitze des Münsterturms oder das ganze Bauwerk, das sich weit über die Stadt erhebt. Am effektvollsten, für mich aber am unfreundlichsten, ist die Annäherung von Norden her, wenn ich mit dem Auto durch den Tunnel des Zigeunerfelsens auf die Stadt zufahre. Dann hat mich gefühlsmäßig sofort der Alltag wieder. Im Alltag sind die beiden Städte für mich und wohl die meisten Bewohner diesseits und jenseits der Donau eine Einheit, und der Grenzfluss ist außerhalb der Hauptverkehrszeiten über eine der sechs Straßen, Eisenbahn- und Fußgängerbrücken, die beide Städte miteinander verbinden, schnell überquert. Die hübschen bayerischen Grenzschilder wurden aus Jux oder aus Prinzip so oft beseitigt, dass der Freistaat Bayern wohl aus Kostengründen seit Foto: Gerhard Kolb 36 längerem im Stadtbereich keine mehr anbringen lässt. Für manch einen unbedarften Fremden liegt Ulm sowieso in Bayern. Und so falsch ist die Vermutung auch gar nicht, zumindest nicht was Teile ulmischen Besitzes – beispielsweise die Kläranlage – auf Neu-Ulmer Flur anbelangt. Andere Objekte, wie das Freibad und die Eislaufanlage, betreiben beide Städte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen gemeinsam. Früher war in dieser Hinsicht sowieso alles einfacher, weil es Neu-Ulm noch gar nicht gab, und die Donau im Territorium der Reichsstadt Ulm keine Grenze darstellte, wiewohl die Stadtbefestigung die Stadt auch zur Donau hin schützen sollte. Eine Gründungsidee Die Anfänge der Stadtgründung haben viel mit Ideen wie Sicherheit und Kontrolle zu tun. Ursprünglich bestimmt auf der Suche nach einem sicheren Platz in einem vom Wasser beherrschten, sumpfigen Gelände, in dem vor allem Ulmen wuchsen. Der mittelalterliche Chronist Felix Fabri erklärt so (1488) den Namen der Stadt. Den Platz fand man auf dem heute so genannten Weinhof. Von dort aus ließ sich auch der etwas flussabwärts gelegene Donauübergang gut kontrollieren. Die erste bekannte urkundliche Erwähnung vom 22. 07. 854 weist Ulm als Kaiserpfalz aus; die Stadtwerdung dürfte wohl in der Stauferzeit (1274) rechtlich abgeschlossen gewesen sein. Ulm, die aufblühende Reichsstadt, hat sich natürlich mit Mauern umgeben und die Stadtbefestigungen im Laufe der Jahrhunderte erneuert, erweitert, angepasst. Es ist gewiss kein Zufall, dass das Militär in der Stadt eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber nur historisch besonders Interessierte wissen, dass Ulm mit der Bundesfestung im 19. Jahrhundert die größte Festungsanlage Europas bekam, um die deutsche Westgrenze mit abzusichern. Einen Teil der Festung, das Fort Oberer Kuhberg, benutzten die Nazis 1933–35 als KZ, um Gegner aus Württemberg in »Schutzhaft« zu nehmen. Eine Dokumentations- und Gedenkstätte erinnert heute daran. Wer denkt schon an solche Dinge, wenn er auf der Stadtmauer einen Spaziergang macht und auf die Stadt, die Donau und Neu-Ulm blickt? Ulm auf dem rechten Ufer wurde zwischen 1802 und 1810 ausgegrenzt, nachdem Ulm die letzten vier Jahre dieser napoleonischen Zeit zu Bayern gehört hatte und am 18. 5. 1810 wieder zu Württemberg kam. Die damalige Gemütslage beschreibt das folgende Gedicht aus dem Jahre 1812: »Doch standat iezt d’Gwerber fast älle still, ma hot koin Verdeast und koi Geld; iezt schoidet ja d’Donau de beschte Froind, dös isch a verzipfelte Weltl« Die ersten nennenswerten städtischen Bauten waren dann Militär-, Zoll-, Polizei- und Verwaltungsgebäude. Die neu angelegte Gemeinde entwickelte sich rasch, wurde in den Donau übergreifenden Ring der Bundesfestung mit einbezogen und erhielt 1869 das Stadtrecht. Ulm ist so ein neues, junges Gegenüber zugewachsen, und die beiden zusammen bieten gegenwärtig etwa 170 000 Einwohnern Lebensraum. Mehr Platz für wirtschaftliche Erweiterung hat inzwischen jedoch der Konkurrent NeuUlm. Ein wirtschaftliches Zentrum Die geographische Lage an der Donau, kurz nach Einmündung der IIIer, am Südrand der Alb machte Ulm zu einer wichtigen Etappe von Überlandwegen, Donauschifffahrt (von West nach Ost) und von Fernhandelsstraßen (von Süd nach Nord). Handel und Gewerbe (Wolle, Barchent, Holz, Schiffbau, Transport auf der Donau) brachten Ulm Reichtum (»Ulmer Geld regiert die Welt«) und machten es zu einem überregionalen Machtfaktor im 15. Jahrhundert. Die Umbrüche der Neuzeit brachten für Ulm den allmählichen Abstieg von einer mittelalterlichen deutschen Großstadt mit etwa 20 000 Einwohnern zu einer ziemlich unbedeutenden Kleinstadt mit etwas mehr als der Hälfte der Einwohner. Festungsbau, Eisenbahnbau, die Industrialisierung (Magirus, Telefunken) nach 1900 und der Wiederaufbau nach 1945 ließen Ulm wieder zu einer Großstadt werden, der Strukturprobleme und Globalisierung der Wirtschaft wie vielen anderen deutschen Städten heute Probleme bereiten. Beiden Städten gemeinsam ist, dass man eine erstaunliche Weltoffenheit neben ausgeprägtem Krämergeist findet. Ein kulturelles Zentrum Dass Ulm ein lokaler, regionaler und teilweise überregionaler kultureller Mittelpunkt ist, bezeugen historische Denkmäler (allen voran das Ulmer Münster), Museen, die Universität, Verlage, Theater, Schulen, Wirtshäuser, Feste. Neu-Ulm hat sein Edwin-Scharff-Haus, dem Ulm unbedingt ein Congress Centrum entgegensetzen musste. Einstein ist zumindest in Ulm geboren. Geniale Leistungen sind nirgendwo an der Tagesordnung, und Provinzialität ist auch nicht nur eine Frage des Geldes. Ein politisches Zentrum Ulm blickt auf eine lange Geschichte als Reichsstadt mit feudalen Strukturen zurück. Patriziat und Zünfte brachten 1397 im Ringen um die Herrschaft den Großen Schwörbrief zustande. Mit diesem wurde die Ulmer Bürgerschaft auf einen langen Weg zur Demokratie gebracht. Mit seiner Schwörrede, einem jährlichen Rechenschaftsbericht, und dem abschließenden Eid bekräftigt der Oberbürgermeister demokratische Grundsätze und dass er auch für Arme und Reiche gleichermaßen da sei. Solch einer Tradition hat das bayerische Neu-Ulm nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Doch gelegentlich tagen die beiden Stadträte gemeinsam, um ihre verschiedenen Standpunkte darzulegen, und auch der Neujahrsempfang wird im Wechsel von beiden Städten gemeinsam abgehalten. Ökonomische Zwänge ebnen in letzter Zeit erstaunlich vielen gemeinsamen Vorhaben den Weg. Literaturhinweise H. E. Specker, Geschichte, in: Der Stadtkreis Ulm, Amtliche Kreisbeschreibung, Ulm 1977 Barbara Treu (Hg.): Stadt Neu-Ulm 1869–1994, Neu-Ulm 1994 37 2. Die Donau im Sattel »erfahren«: mit dem Rad von Passau nach Budapest Von Dirk Lundberg Auszüge aus dem Reisetagebuch 6.8.1997 »Tschuldigung, haben sie vielleicht einen Dosenöffner für uns?« Der dreizehnjährige Georg steht mit einer Raviolidose vor unserem Zelt. Seit letzter Woche ist er mit seinem Vater auf dem Donauradwanderweg unterwegs und zeigt uns stolz auf seinem Tacho, wie viele Kilometer er bereits in den Beinen hat. Wir tauschen Erfahrungen aus, fachsimpeln über Straßenzustände, Fahrradtechnik und Kartenmaterial. Heute seien sie 80 Kilometer gefahren, aber gemütlich, ohne zu hetzen. Dabei hatten sie noch genügend Zeit, um morgens die Raubritterburg Aggstein zu besuchen. An die ausgedehnte Mittagspause in einem der zahlreichen Radlertreffs erinnert sich Georg besonders gern, vor allem wegen der österreichischen Mehlspeisen. Den Dosenöffner hat in der Zwischenzeit die rüstige, grauhaarige Dame gebracht, die mit ihrer Freundin bereits zum vierten Mal an der Donau unterwegs ist, weil sie immer wieder neue reizvolle Entdeckungen machen. Dazu bedarf es offenbar nicht der neuesten technischen Ausrüstung: Die beiden Damen sind mit den guten alten Drei-Gang-Rädern unterwegs – und mit Packtaschen, Zelt, Schlafsack und Isomatten auf dem Gepäckträger. Abends sehen wir das fidele Team in einem »Buschenschank« (Heurigenlokal) wieder, in dem wir uns an einer »Brettl-Jausn« und Grünem Veltliner inmitten fruchtig duftender Marillenplantagen laben... 9.8.1997 Entgegen der empfohlenen Route unseres Fahrradführers haben wir uns auf die Ratschläge des neuseeländischen Kunststudenten aus Bratislava verlassen und sind eine nagelneue, schnurgerade Nebenstraße von Pama nach Deutsch Jahrndorf regelrecht entlanggeschwebt – wieso kommt der Wind bei unserer Tour entgegen jeder Radlerweisheit fast immer von hinten? Egal, hohen Gang rein und genießen. In Nickelsdorf, kurz vor dem Grenzübergang nach Ungarn, letzter Halt an einem »Tante-Emma-Laden«, der leider geschlossen ist. SamstagNachmittag, 28 Grad im Schatten, wir drücken uns die Nasen am Schaufenster platt. Jetzt ein kühles Getränk... Wir lassen unfeine Bemerkungen über Ladenschlussgesetze fallen und greifen nach den Fahrradflaschen mit dem lauwarmen Mineralwasser. Plötzlich hören wir eine freundliche Stimme – der ältere Herr in Freizeitshorts und Unterhemd erscheint an der Ladentür: Er habe uns vom Garten aus gesehen, fahre selber Fahrrad und wisse, was ein »g’scheiter Durst« sei. Er führt uns in seinen unbeleuchteten Laden und fordert uns auf, ordentlich zuzugreifen. Dazu gibt’s noch reichlich Tipps für herrliche Schleichwege vor und nach der Grenze... 10.8.1997 Wir sind mit Muskelkraft nach Ungarn gekommen! Der junge Mann mit der Schirmmütze salutiert, geht dann zum Schlagbaum, öffnet ihn langsam und mit wichtiger Miene für uns zwei Radler. Er freut sich sichtlich über unsere ersten Versuche in ungarischer Minimalkommunikation. Die nun folgenden Kilometer saugen wir alle neuen Eindrücke auf wie ein Schwamm, tauschen Beobachtungen aus, entziffern die ersten ungarischen Verkehrsschilder und Werbeplakate. Mosonmagyaróvár rangiert in der inoffiziellen Rangliste der schönsten Zungenbrecher ganz weit oben. Gespannt warten wir auf die ersten Sprachkontakte mit Einheimischen. In dem kleinen, malerischen Ort Halászi überqueren wir die Mosoni Duna, einen Nebenarm der Donau. Die »Kleine Donau« fließt in sanften Bögen bis Gyo씵 r, um in Venek wieder in das Bett ihrer berühmten Schwester aufgenommen zu werden. Das von beiden Donauarmen eingeschlossene Gebiet ist die Kleine Schüttinsel, die wegen ihrer riesigen Sonnenblumenfelder einen herrlichen Anblick bietet. Es beginnt nun bereits zu dämmern und wir sollten uns nach einem Nachtlager umsehen, Sprachbarriere hin oder her. »Excuse me!«, hören wir eine Stimme hinter uns. Damit haben wir nun überhaupt nicht gerechnet. »Can I help you?« Der junge Mann hat von der anderen Straßenseite aus beobachtet, wie wir über die weitere Planung beratschlagen. Es wird uns mal wieder leichter gemacht, als wir geahnt haben. Wir sind begeistert von der Offenheit und dem unaufdringlichen Interesse der Menschen, mit denen wir seit der Grenze zu tun haben. Wo wollt ihr übernachten? Lieber Camping, Hotel oder privat? Habt ihr schon zu Abend gegessen? ... Die Straße führt uns durch die fruchtbare Ebene der Schüttinsel an Feldern vorbei, die hin und wieder von kleinen Wäldern begrenzt werden. Hier lässt es sich herrlich radeln auf kleinen, unbefahrenen Straßen ohne jede Steigung. Wir zählen neun Störche und fragen uns, ob sich Rückschlüsse auf demographische Entwicklungen mit der hiesigen Sagenwelt vertragen. 11.8.1997 Montags Ruhetag. Ratlos stehen wir vor dem hohen Bretterzaun, der das frisch renovierte und gerade erst fertig gestellte Museum von Tata umgibt. Sollen wir unsere Reise extra einen Tag unterbrechen, um morgen wiederzukommen? Wieder hilft uns die freundliche Offenheit eines Einheimischen: Ob wir das Museum besichtigen wollten? Dann werde er mal den Direktor rausklingeln. Ein kurzes Gespräch, ein Zeichen, wir mögen unsere Räder mit in den Hof nehmen und schon bekommen wir eine Sonderführung durch das Ungarndeutsche Museum. Es entpuppt sich als Fundgrube interessanter Zeitdokumente, von Geräten aus Haushalt und Landwirtschaft über Kleidung, Schriftgut und Fotodokumentationen, begleitet von ausführlichen Texten und Karten zur Geschichte der ungarndeutschen Minderheit ... 12.8.1997 Es ist Mittagszeit, seit Stunden brennt die Sonne auf die Ausläufer des Gerecse-Gebirges. Wir haben die einzige ernsthafte Steigung unserer Tour in den frühen, noch angenehm kühlen Vormittagsstunden bewältigt und den phantastischen Blick über das Donautal bis weit in die Slowakei hinein genossen. Jetzt suchen wir in der winzigen Ortschaft Bajot nach der kleinen Schotterstraße, die laut Reiseführer an einer idyllisch gelegenen Klosterschule vorbei Richtung Esztergom führen soll. Der Ort ist so klein und abgelegen, dass es keine Hinweisschilder für den Ortsfremden gibt. Also wenden wir uns an eine junge Frau, die gerade die Wäsche ihres kleinen Sohnes zum Trocknen hinterm Haus aufhängt. Sie quittiert unsere radebrechenden Versuche in ungarischer Sprache 38 mit einem Lächeln und einem Achselzucken, vermittelt uns dann an einen alten, hageren Mann mit zerfurchtem Gesicht, der gerade sein Fahrrad die Straße entlangschiebt. lstván spricht noch ein paar Brocken Deutsch und zeigt sich sofort interessiert und hilfsbereit. Er strahlt solche Herzlichkeit und Wärme aus, dass unser Gespräch sich nicht in der ausführlichen Wegbeschreibung erschöpft – wir erfahren von seiner Familie, seiner Vergangenheit im Krieg, seinen Erfahrungen mit Deutschen und Russen. Es sind nur wenige Wörter, die uns gemeinsam zur Verfügung stehen, der Rest wird mit Händen und Füßen, mit Mimik und Gestik kompensiert. Schließlich verabschieden wir uns voneinander mit großer Herzlichkeit und radeln weiter. Schon nach wenigen hundert Metern taucht an der Dorfstraße das einzige Café des Ortes. Kaum haben wir unsere Gläser ausgetrunken, stellt die Bedienung zu unserer großen Überraschung zwei weitere Gläser Limonade auf den Tisch; wir sehen uns verdutzt an, versuchen den Irrtum zu erklären. Die junge Frau winkt ab, ihrer Gestik mehr als ihren Worten entnehmen wir, dass ein alter Mann die Getränke bereits an der Theke für uns bezahlt habe ... 14.8.1997 »Húskészítmények Szalonnafélék« steht auf der linken Seite der Hauswand. Rechts daneben lesen wir in verzierten Lettern: »Rauchfleisch, Speck geräuchert ...«. Wir sind in Pilisvörösvár, am Ausläufer des Pilis-Gebirges, ungefähr 20 Kilometer vor den Toren Budapests. Unsere Zimmerwirtin, Frau Wippelhauser, erklärt uns, dass noch viele im Ort »schwobisch« sprächen, besonders die Älteren. Bei den Jüngeren stehe Englisch hoch im Kurs, aber selbstverständlich lernten die Kinder der deutschstämmigen Familien am örtlichen Gymnasium ab der ersten Klasse Deutsch. Ein Rundgang durch das Schulgebäude, in dem Frau Wippelhauser als Hausmeisterin und »gute Seele« tätig ist, versetzt uns in Staunen: Jeder Raum verfügt über einen Tageslichtprojektor, der Computersaal ist mit 30 nagelneuen PCs ausgestattet, die neu ausgebaute Pausenhalle dient gleichzeitig als Theaterraum mit Bühne und moderner Lautsprecher- und Scheinwerferanlage. Finanziert werde das meiste von der deutschen Bundesregierung, erklärt Frau Wippelhauser. An der Schule büffeln deutschstämmige und ungarische Schüler gemeinsam, schreiben ihre Abiturarbeiten über deutsche Literaturklassiker. Edith, die Tochter des Hauses, erzählt uns, dass viele Ungarndeutsche bereits in die Bundesrepublik ausgesiedelt seien. Für ihre Freunde und sie komme das nicht in Frage, schließlich lebten hier alle Freunde und Verwandten, hier fühle sie sich zu Hause. Tagsüber arbeitet Edith in einem deutschen Industriebetrieb in Budapest, wo ihr ihre soliden Deutschkenntnisse sehr zugute kommen. Abends tanzt sie zweimal in der Woche in einer ungarndeutschen Folkloregruppe, verbringt die Abende im Kulturzentrum des Ortes. Nein, die Heimat zu verlassen komme für sie überhaupt nicht in Frage ... Tipps und Hinweise zur Tour Der Donauradweg ist unter Radwanderern seit langem als Klassiker bekannt. Besonders der ausgesprochen familienfreundliche Abschnitt Passau – Wien wurde Anfang der neunziger Jahre in den Sommermonaten sehr stark frequentiert – zu stark, wie manche meinten. Seit drei Jahren sind die Besucherzahlen allerdings wieder stark rückläufig – sehr zum Leidwesen der Gastronomiebetriebe. Aus unserer Sicht ist davon abzuraten, Unterkünfte im Voraus zu bestellen und eine unumstößliche Route festzulegen. Man ist ohne Vorbuchung viel flexibler und offener für interessante Hinweise und Ideen und muss sich nicht von einem vorgegebenen Terminkalender gängeln lassen. Auch die Unvorhersehbarkeit des Wetters spricht gegen eine Pauschalbuchung. Der Donauradweg ist in Österreich so gut ausgeschildert, dass man ihn theoretisch auch ohne Reiseführer fahren kann. Allerdings empfiehlt sich ein Radwanderführer mit guten Begleitkarten, um die zahlreichen lohnenden Abstecher bzw. Tourenvarianten in die Reiseplanung miteinbeziehen zu können. Die Hauptroute führt in Österreich zum größten Teil auf Fahrradwegen entlang der Donau und ist daher auch besonders für Familien mit Kindern geeignet. In Ungarn verläuft die Route auf meist verkehrsarmen Landstraßen, die ungefähr dem Flusslauf folgen. In größeren Städten ist man dabei, das Radwegnetz auszubauen, es entspricht aber noch nicht westlichen Standards. Der Donauradweg ist durchaus mit einem ganz einfachen Fahrrad zu fahren, neueste Technik ist also nicht nötig. Auch braucht man sich für die Tour keinesfalls wochenlang körperlich vorzubereiten – auch schwach trainierte Radler können die Strecke in vernünftigen Etappen bewältigen. Empfehlenswert ist eine gepolsterte Fahrradhose, die einem das Sitzen im Sattel erheblich erleichtert. Wer bis Budapest fährt, sollte sich mit den Ausspracheregeln des Ungarischen und einem Minimum an Vokabeln vertraut machen, nicht nur weil es der Verständigung dient und Spaß macht, sondern auch weil jeder noch so ungelenke Gehversuch in der Landessprache sehr positiv und erfreut zur Kenntnis genommen wird. Als sehr praktisch und gut handhabbar haben sich die Donauradweg-Reiseführer von bikline erwiesen: Sie verfügen über sehr exakte Wegbeschreibungen, genaue Landkarten und zahlreiche Routenvarianten. Die Ausführungen zu den historisch-kulturell interessanten Besichtigungszielen links und rechts des Weges fallen dagegen etwas dürftig aus; hier empfiehlt sich in jedem Falle eine Ergänzung. Wer sich dazu entschließt, das Donautal bis Budapest radelnd zu »erfahren«, dem sei abschließend geraten, einen Teil des Rückwegs per Schiff zu bestreiten: Das Schnellboot, das zwischen Wien und Budapest zweimal täglich verkehrt, transportiert auch Fahrräder. Die meisten Radler beenden ihre Tour mit einem Aufenthalt in Wien, um dann in einem Zug(e) nach Hause zu fahren. 39 Die Burgherren wachten nicht nur über den Verkehr auf dem Fluss (eine der Deutungen des Namens »Wachau« führt ihn auf »wacta« = Wachtposten zurück), sie verdienten auch an ihm. 1438 erhielt ein Georg Scheck das Mautrecht für donauaufwärts fahrende Von Dietrich Rolbetzki Schiffe, musste dafür aber den Schiffsweg erhalten, am Ufer liegt noch das 6 8 9 1 WILLENDORF ehemalige Mauthaus (heute Forsthof). 2 SPITZ 2 Wie Melk am Anfang, so 4 3 MELK steht die Doppelstadt4 MAUTERN L Krems-Stein 쩽 am Aus7 E T 5 RUINE AGGSTEIN 10 gang der Wachau: VerER I V 6 KREMS-STEIN kehrsknotenpunkt, EinLD A kaufsund Schulzentrum 7 STIFT GÖTTWEIG W 5 1 und Kulturstadt. 8 WEIßENKIRCHEN LD A Heute erstrecken sich 9 DÜRNSTEIN W Krems und Stein bis an die R E 10 "TEUFELSMAUER" IN Donau, aber ihre Anfänge E ST im 10./11. Jahrhundert laL E U K gen nicht am Strom DONA N 3 (Hochwasser!). Einst erDU hob sich hoch über dem heutigen Krems die älteste Pfarrkirche der Stadt. Jetzt steht dort die spätgotische Die Wachau Zeichnung: Peter Steinheisser Piaristenkirche »Zu unserer lieben Frau«. Auch Steins Anfänge befinden sich auf einem Hügel, verZwischen Melk und Krems-Stein in Niederösterreich mutlich dort, wo heute die Frauenbergkirche steht, die zwängt sich die Donau auf etwa 35 km Länge zwischen jetzt der Erinnerung an die Toten zweier Weltkriege dient. den Höhen des Waldviertels im Norden und denen des Der Handel mit Wein, Getreide, Salz und Eisen machte Dunkelsteiner Waldes im Süden hindurch und hat eine Krems und Stein, wo die Güter verladen wurden, reich. Da Landschaft von seltenem Reiz geschaffen: die Wachau. sich die beiden Orte – hier der Handel, dort der Versand – Von einem festen Standort aus – etwa Weißenkirchen – wirtschaftlich ergänzten, bildeten sie schon 1250 eine lässt sie sich in zwei bis drei Tagen »erfahren«. Bürgergemeinde mit einem Stadtrichter, seit 1416 mit eiFrüh schon lebten Menschen an der Donau (siehe Kapinem Bürgermeister und seit 1463 mit einem gemeinsatel II.). 1908 wurde in Willendorf 쩸 eine nur wenige Zentimen Wappen: einem doppelköpfigen Adler in Gold auf meter große Kalkstein-Plastik aus der Altsteinzeit (vor etwa schwarzem Grund. 25 000 Jahren) gefunden. Diese »Venus von Willendorf« ist Die Steiner Landstraße in Stein ist mit ihren 113 Häusern wohl ein Fruchtbarkeitssymbol. An der Fundstelle befindet »einer der schönsten Straßenzüge Österreichs« (Erika sich heute eine große Nachbildung. Das Original kann man Schüler). Die ehemaligen Salzstadel (Häuser Nr. 27 und im Wiener Naturhistorischen Museum besichtigen. Früh war die Donau auch schon Verkehrsweg und immer wieder – so für die Römer – Grenze. Ein Museum in Spitz 쩹 (an der Straße nach Mühldorf) informiert über die Schifffahrt auf dem Fluss. Die Stadt Melk 쩺 am westlichen Zugang zur Wachau bot sich durch ihre Lage zum Siedeln an. Nur wenige Meter liegen zwischen der Donau und der Anhöhe, auf der sich das Stift Melk (siehe Kapitel IV.1.) erhebt. Die Römer (siehe Kapitel III.1.) bauten hier ein Kastell; später waren die Magyaren da und die Babenberger – Markgrafen der Ostmark – machten den Ort zu ihrem Hauptsitz und zur Begräbnisstätte ihres Geschlechts. Mautern 쩻 war eine der wichtigsten römischen Siedlungen in Niederösterreich. Erhalten aus dieser Zeit sind noch Reste der ehemaligen Befestigung, ein Stück Straße am Ortsende von Mauternbach und zahlreiche Funde, die das Römermuseum in der Margarethenkapelle aufbewahrt. Gegenüber von Willendorf am südlichen Donauufer erheKrems-Stein, vom südlichen Donauufer aus gesehen ben sich auf einem Felsen, 300 Meter über dem Strom, Foto: Peter Steinheisser die Ruinen der einst gewaltigen Burg Aggstein 쩼. 3. Wachau und Donauknie: zu Orten der Geschichte 40 29) erinnern noch an den einstigen Handel mit Salz. Ein »Kleinod« (Dr. Gabriele Rüttnauer) ist auch der große Passauerhof (Haus Nr. 76), im Mittelalter Verwaltungssitz des Bistums Passau. 42 Klöster besaßen in der Wachau Weingüter mit Wirtschafts- und Lagergebäuden, so begehrt war der Wein dieser Landschaft. Das kaiserliche Mauthaus (Haus Nr. 84) »mit seiner prachtvoll bemalten Renaissancefassade« (Erika Schüler) legt Zeugnis davon ab, wie wichtig Handel und Donauschifffahrt als Einnahmequelle waren. Immer wieder haben Kriege die Gegend heimgesucht. Dann drängte das aufstrebende Wien beide Orte in den Hintergrund. Weil die Eisenbahnlinie von Salzburg nach Wien das Donautal wegen seiner Enge umging, gerieten Krems und Stein auch verkehrstechnisch ins Abseits. Gegenüber der Doppelstadt erhebt sich auf einem aus den Donauauen aufragenden Berg Stift Göttweig 쩾. 1083 gründete der Passauer Bischof Altmann hier ein Augustiner-Kloster (Besitz in der Wachau war schon wegen des Weins wichtig), das nach seinem Tod aus dem Südschwarzwald herbeigerufene Benediktinermönche übernahmen. Was anfangs noch burgartigen Charakter hatte – die Zeiten waren unfriedlich –, entwickelte sich mehr und mehr zu einer eher an ein Schloss erinnernden weitläufigen Anlage, die Göttweig den Beinamen »Österreichisches Escorial« eintrug. Das Stiftsgebäude mit Kaiserstiege und Kaiserzimmer verstärkt diesen Eindruck noch. Hier werden Reichtum und weltliche Macht sichtbar, auch Prunk, kaum mönchische Ideale. Von friedlosen Zeiten kündet auch Weißenkirchen 햹, an den Hängen des Waldviertels gelegen. Beherrschendes Bauwerk ist die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt; man gelangt zu ihr vom Teisenhoferhof (Wachaumuseum) über eine schindelgedeckte Stiege. Die hohen Wehrmauern und Türme, mit denen sie befestigt ist, wurden 1531 errichtet, nachdem die Türken erstmals Wien bedroht hatten (siehe Kapitel III.4.). Dürnstein 햺 ist der meistbesuchte Ort der Wachau und das verdankt er gewiss auch Richard Löwenherz. Dass dieser hier im 12. Jahrhundert »Urlaub« gemacht habe, damit wirbt der niederösterreichische Fremdenverkehrsverband heutige Besucher, stellt dann aber richtig, der englische König habe »bei Wasser und Brot« in der Dürnstein: Blick von der Festung auf Stadt und Donau Foto: Peter Steinheisser Burg hoch über der Stadt gedarbt, während heutige Gäste in den noblen Hotels »erlesene Schmankerln« erwarten dürfen. Ende 1192 fiel Richard Löwenherz auf der Rückreise von einem Kreuzzug in die Hände des Babenberger Herzogs Leopold V. und kam für kurze Zeit in die Feste Dürnstein, bevor er Kaiser Heinrich VI. übergeben wurde, der ihn auf Burg Trifels in der Pfalz einkerkerte. 1194 kam er gegen Zahlung eines riesigen Lösegeldes (etwa 28 t Silber) wieder frei. Ein österreichischer Herzog, ein deutscher Kaiser und ein französischer König hatten dieses »Kidnapping« vereinbart und teilten dann das Lösegeld. Der Kaiser brachte seinen Anteil in Kriegen durch, Leopold V. dagegen legte seine Beute gut an: in neuen Münzen, einer verbesserten Wiener Stadtmauer und in der neu gegründeten Wiener Neustadt. Burg Dürnstein ist längst verfallen. Geschichte dient heute vor allem dem Fremdenverkehr wie die anrührende Sage von dem wohl nie existierenden Sänger Blondel, der von Burg zu Burg gezogen sein soll, um durch Absingen eines bestimmten Liedes seinen Herrn Richard Löwenherz zu finden. In Dürnstein habe er endlich Erfolg gehabt, weshalb hier ein Hotel seinen Namen trägt. Immer wieder hat die Donau die Phantasie der Menschen angeregt. Zwischen Spitz und Schwallenbach ist eine Felsformation, die wie der Überrest einer riesigen Sperrmauer wirkt: die »Teufelsmauer« 햻. Eine Sage versucht sie zu erklären. Der Teufel, so erzählte man sich, habe hier eine Staumauer errichten wollen, sei aber durch einen krähenden Hahn an der Vollendung gehindert worden. An das daraufhin von ihm getötete Tier erinnert der von einem Pfeil durchbohrte Wetterhahn auf dem Kirchturm von St. Johann im Mauertal am gegenüberliegenden Ufer. Bei Esztergom in Ungarn durchbricht die Donau das Nordungarische Mittelgebirge und bahnt sich ihren Weg zwischen dem Börzsönygebirge im Norden und dem Visegrader- und Pilisgebirge im Süden hindurch. Sie fließt dabei erst nach Süden, dann nach Osten, dann nach Norden, um schließlich bei Visegrad endgültig die Südrichtung zu wählen, wobei sie sich in zwei Arme aufteilt, die die Insel Szentendre umschließen; kurz vor Budapest vereinigen sie sich wieder. Der Strom, der dieses Donauknie geschaffen hat, ist breiter als noch in der Wachau, die Uferlandschaft lässt mehr Raum für Siedlungen, historische Bauten sind wegen vieler Kriege selten. Visegrad (»hohe Burg«) 햽 ist ein slawischer Name und Hinweis auf die wechselvolle Geschichte der Gegend. Eine römische Befestigung diente später auch den Slawen als Schutz, die sich hier angesiedelt hatten. Die Ungarn begannen nach dem Mongoleneinfall im 13. Jahrhundert mit dem Bau einer Burg zwischen Donau und steil aufragendem Berg. Später entstand die 350 m höher gelegene Hochburg. Eine Mauer verband beide mit der am Ufer (an der heutigen Schiffsanlegestelle) errichteten Wasserbastei. 1316 verlegte der ungarische König Karl von Anjou seine Residenz nach Visegrad und ließ die untere Burg zu einen Palast umbauen, der Ende des 15. Jahrhunderts im Renaissancestil umgestaltet wurde und eines der schönsten Bauwerke seiner Zeit gewesen sein soll. Während der Kämpfe mit den Türken wurde er zerstört. Die bisherigen Ausgrabungen an der Straße Fo씵 utca zeigen nur einen Bruchteil der Anlage. 41 DONAU 12 ESZTERGOM (Gran) GE R I B GE S I PIL 11 VISEGRÁD SZENTENDRE 13 Das Donauknie Zeichnung: Peter Steinheisser Weitere 600 m in Richtung Osten und etwas erhöht liegt der »Salomonturm«, ein Wohnturm der unteren Burg, heute Museum. Zur Hochburg gelangt man mit dem Auto oder zu Fuß (in etwa einer halben Stunde; der Weg beginnt hinter der katholischen Kirche). Die Burg – 1702 von den Habsburgern gesprengt – ist heute gut restauriert. Eine Ausstellung zeigt die Geschichte der Anlage und wie Adelige und einfache Leute in früheren Zeiten jagten und fischten. Esztergom (Gran): Kathedrale Visegrad: Burgruine mit Blick auf die Donau Foto: Peter Steinheisser Etwa 23 Kilometer sind es von Visegrad nach Esztergom 햾, einer der ältesten Städte Ungarns. Fürst Géza (siehe Kapitel III.3.) bestimmte den Ort um 973 zu seiner Residenz. Sein Sohn Stephan wurde hier um 1000 zum ersten ungarischen König gekrönt. Hier stand der erste Königspalast Ungarns und, weil Esztergom Sitz des Erzbischofs wurde, die erste Hauptkathedrale. Im 13. Jahrhundert wurde die Residenz nach Buda verlegt, das geistliche Oberhaupt der ungarischen Kirche aber blieb in der Stadt. Esztergoms Wahrzeichen ist die wuchtige klassizistische Kathedrale auf dem Burgberg hoch über der Donau. »Von der kalten und toten Monumentalität eines Zenotaphs (Grabmals)« strahlt sie »eine eisige zeitliche [...] Übermacht« (Claudio Magris) aus. Foto: Peter Steinheisser Auch innen ist der Eindruck Größe und Wucht. Die Schatzkammer zeigt wertvolle sakrale Gegenstände. In der Krypta finden sich Reste der St.-Adalbert-Kathedrale, die einst hier stand. Hier unten hat auch Kardinal Mindszenty – Kirchenoberhaupt nach 1945 und von den Kommunisten verfolgt – seine letzte Ruhestätte gefunden. Von der Kuppel aus hat man einen herrlichen Blick auf die Donau (die Brücke mit der Inschrift »Die Brücke verbindet«, die in die Slowakei hinüberführte, wurde 1945 gesprengt), den Burgberg (Überreste des alten Königspalastes) und die Stadt. Etwa 25 Kilometer von Visegrad entfernt in Richtung Budapest liegt Szentendre 햿, ein »Montmartre« (Claudio Magris) mit vielen Galerien und Ateliers, mit malerischen Gässchen und Häusern, wie man das in Ungarn sonst kaum findet. Literaturhinweise Felix Czeike / Walther Brauneis: Wien und Umgebung. DuMont Kunst-Reiseführer, 12. Auflage, Köln 1993 Ingrid Fleischmann-Niederbacher / Erika Schüler: Die Wachau, 3. Auflage, Innsbruck / Rum 1991 Michael Herl: Ungarn. Polyglott-Reiseführer, München 1996 Gabriele Rüttnauer: Wachau. Polyglott-Reiseführer, München 1995/96 Roman Sandgruber: Wirtschaftswunder durch Lösegeld. In: Damals, 9/1996, S. 24 ff. Edgar Schütz: Bildatlas Niederösterreich. Wachau, Hamburg 1999 42 4. Die Donau kommt nach Wien1 Von Dietmar Gohl Das alljährlich stattfindende Donauinselfest (zwischen den beiden parallelen Flussläufen), dahinter das »Vienna International Center« Foto: Prof. Dr. Elisabeth Lichtenberger Wien besitzt eine Besonderheit, die sonst in keiner Großoder Weltstadt zu finden ist: eine 21 Kilometer lange Erholungsinsel zwischen den beiden Donausträngen, zentral gelegen und mit U- und S-Bahn bequem erreichbar. Bis zu 200 000 Menschen tummeln sich hier an schönen Sommersonntagen. Wien liegt nun wirklich und endgültig an der Donau und die Donau mitten in Wien. Das war jahrhundertelang nicht so. Wien ist ein alter Siedlungsplatz im Westteil des Wiener Beckens, wo die Alpen im Wienerwald auslaufen und die Donau sich einst in ein breites Netz von verschlungenen Armen verzweigte. Der Name des Ortes und des Wienflusses stammt vom keltischen Stamm der Wienden, deren Siedlung Vindomina am Leopoldsberg schon für 350 v. Chr. belegt ist. Die Römer errichteten ab 15 v. Chr. ihr Militärlager Vindobona etwas südlich davon am westlichsten Donauarm auf der 10 m höheren Talterrasse, die vor Hochwasser schützt. Nach ihrem Rückzug im 5. Jahrhundert wurde die Siedlung Handelsstadt und im 12. Jahrhundert Herzogssitz Österreichs. Als die Bedeutung der Stadt als Zentrum des habsburgischen Reiches ständig wuchs, war eine Stadtausdehnung wegen der wilden Donau nur nach Westen möglich. Es gab außer der Brücke über den Wienfluss erst seit dem 15. Jahrhundert eine einzige Holzbrücke über den westlichen Donauarm, die »Schwedenbrücke«, die nach starken Hochwassern und Eisdriften stets erneuert werden musste. Diese Brücke führte zum Barfüßerkloster, in dessen Nähe im Jahre 1625 die Juden ihr Ghetto errichten durften. Es lag inmitten des kaiserlichen Jagdgebietes der Praterinsel. Die im Westen entstandenen »Vorstädte« und »Vororte« wurden im 19. Jahrhundert nach Wien eingemeindet, so dass die Stadt amphitheatralisch die Berghänge des Wienerwaldes hinaufwuchs. Zum Strom hin aber kehrte das kaiserliche Wien seine Schmuddelseite: Hier waren Lagerhallen, Fabriken und Eisenbahnanlagen entstanden. Doch auch die Dörfer östlich des Stromes wuchsen beträchtlich, Floridsdorf sogar zu einer Kleinstadt: Erreichbar aber waren sie nur mit der Floridsdorfer Donaufähre. So entschloss sich die kaiserliche Reichsverwaltung, den Wildstrom mittels einer großen Donauregulierung zu bändigen. In einer ersten Phase (1869/70) wurde der Südwestarm mit Steinmauern begradigt – der »Donaukanal« war entstanden. In der Hauptphase bis 1874 schüttete man die meisten Flussarme zu und schuf mit einem großen geraden Durchstich – auch als Schifffahrtsstraße – die neue Donau. Einen Teil des früheren Hauptarmes ließ man isoliert als »Alte Donau« bestehen. Gleichzeitig entstanden erstmalig zwei Straßenbrücken, die Floridsdorfer Brücke und die Reichsbrücke, dazu zwei Eisenbahnbrücken. 1904 wurde Floridsdorf eingemeindet. Doch große Teile des heutigen Stadtgebiets lagen noch außerhalb. Auf dem Nordteil der neuen Insel dehnte sich die Wiener Mülldeponie immer weiter aus. Auch war die Hochwassergefahr wegen des verkürzten Donaulaufs noch verschärft worden. Nach 1945 schuf die Stadtverwaltung mit Erfolg neue Verhältnisse: Die Donaustadt wurde 1954 als XXII. Wiener Bezirk eingemeindet. Anstelle der Mülldeponie entstand 1964 für die Internationale Gartenbauausstellung der Donaupark samt Donauturm und später daneben das »Vienna International Center«, bestehend aus der UNO-City mit ihren gläsernen Bürotürmen (1979), worin mehrere internationale Organisationen ihren Sitz haben, und aus einem großen Tagungs-, Ausstellungs- und Konzertsaal-Komplex (1987). Diese neue städtebauliche Dominante im Osten liegt in der Sichtachse über die Reichsbrücke zur historischen Dominante des Stephansdomes. Sozusagen als dritte Phase der Donauregulierung wurde 1984 der Hochwasserentlastungskanal, »Neue Donau« genannt, fertig gestellt und erfüllt seinen Zweck. So entstand zwischen beiden Flusssträngen die Donauinsel für Freizeitzwecke, die zusammen mit dem UNO- und Tagungskomplex dem Donauareal zur Integration in den Stadtkörper verhalf. Anmerkung 1 In der Reihe »Deutschland und Europa« ist im November 1999 das Heft 39 »Wien – Europäische Metropole im Wandel« erschienen. Literaturhinweise Raimund Hinkel: Wien an der Donau. 1. Auflage, Wien 1995 Elisabeth Lichtenberger: Wien – zwischen extremer Grenz- und Mittelpunktslage. In: Der Bürger im Staat, 47. Jg. H. 2, S. 80 ff., Stuttgart 1997 43 44 5. Budapest – »Königin der Donau« Von Dietmar Gohl Budapest Foto: Dietrich Rolbetzki Stadt und Name Budapest sind jung: Vor 1872 gab es sie noch nicht. Grund dafür ist die lange Fremdherrschaft (siehe Kap. III.3. und 4.). In den Jahren nach 1840 ging ein nationales Aufbegehren durch das wirtschaftlich erstarkende Land (siehe Kapitel III.3.). Graf Széchenyi erwirkte und leitete den Bau der ersten Donaubrücke zwischen Buda und Pest und regte auch den Bau des Nationalmuseums an. Nach dem »Ausgleich« mit Österreich von 1867 (siehe Kapitel III.3. und 4.a)) wurden 1872 Buda und Pest vereinigt. Die ungarische Königskrone aus römischen und byzantinischen Teilen stammt aus dem 11. und 12. Jahrhundert und befindet sich im Parlamentsgebäude. Foto: MTI Hámar Szabolcs In der noch kleinen Stadt waren Bauten im habsburgischen Barockstil vorherrschend. Nun führte ein nahezu rauschhafter Bauboom zur völligen Überprägung des Stadtbildes im Historismusstil, meist in Neugotik, als Kulisse für das große nationale Ereignis der 1000-JahrFeier der Landnahme durch die ungarischen Stämme, des Milleniums 1896. Damals entstanden weitere Donaubrücken; der »Große Ring«, heute die mittlere der drei Ringstraßen, und Radialstraßen durchzogen nun Pest, den am stärksten wachsenden Stadtteil. Die prächtigste Radiale, die Andrássy-Allee, benannt nach dem Freiheitskämpfer von 1849 und ersten ungarischen Ministerpräsidenten von 1867, wurde bestückt u. a. mit der Stephans-Basilika und der Staatsoper. Diese Allee führt zum eindrucksvollsten Komplex von 1896, der im und am alten Stadtwäldchen errichtet wurde: Hier gruppieren sich der Heldenplatz mit dem grandiosen Milleniumsdenkmal als Symbol des ungarischen Nationalbewusstseins, mehrere Museen, das »Schloss aller Schlösser« (Nachbildung der Burg des Türkenbezwingers Hunyád), der Zoo und das »Gundel«, das bekannteste aller ungarischen Nobelrestaurants. Unter der Andrássy útca verkehrt seit 1896 die zweitälteste U-Bahnlinie Europas. An der Donau prunkt unübersehbar das erst 1900 fertig gestellte Parlamentsgebäude, mit 268 m Länge und 96 m Kuppelhöhe das größte der Welt. Um 1900 brachte auch der Jugendstil einige Bauten in diese neue Stadt, entworfen von Ödön Lechner, geschmückt mit bunten Elementen aus der ungarischen und orientalischen Volkskunst: Postsparkassenamt, Kunstgewerbemuseum, Geologisches Institut der Universität. Auch die Musikhochschule, gegründet vom ungarischen Komponisten Franz Liszt, ist ein Jugendstilbau. Buda, der ältere Stadtteil an der bergigen Donauseite, bietet Überraschungen aus der alten Geschichte. Außer den gemütlichen Gässchen mit Barockschmuck finden sich mit dem Rittersaal auf der Burg und mit der Matthiaskirche auch zwei Reste aus dem Mittelalter – alles andere war den Zerstörungen im Kampf gegen die Türken und die deutsche Wehrmacht anheim gefallen. Die Matthiaskirche war die Krönungsstätte der ungarischen Könige, auch »Sissi« wurde hier 1867 von ihren geliebten Ungarn umjubelt, wobei Franz Liszt seine Krönungsmesse uraufführte. Das mauerumgebene Burgviertel überragt als malerische Kulisse die repräsentativen Donaupromenaden und Brücken um 60 m, woraus ein unter den europäischen Metropolen einzigartiges Stadtbild resultiert. Am Gellértberg und am Burgberg trifft man auf Reste der hoch entwickelten Badekultur aus der Zeit, als die osmanischen Paschas auf der Burg regierten: Rác-Bad, RudasBad und Király-Bad sind türkische Kuppelbauten. Das im Jugendstil erbaute Gellértbad ist heute das größte der zwölf Thermalbäder und Budapest mit seinen 123 Heilquellen die bedeutendste Bäderstadt der Welt. Schon die keltischen Evarisker hatten hier eine Siedlung namens Ak Ink (»reichlich Wasser«). Später nutzten die Römer an gleicher Stelle – im heutigen Ortsteil Óbuda (Altbuda) – die Quellen. Dort bestand von 9 v. Chr. bis 400 n. Chr. die große römische Militär- und Zivilstadt Aquincum als Zentrum der Provinz Pannonia. Heute kann man dort u. a. zwei Amphitheater, ein Römerbad und eine Villa mit Fresko- und Mosaikbildern besichtigen. 45 Zwischen Buda/ Óbuda und Pest liegt der größte und schönste Park, die Margareteninsel, mit jahrhundertealten Bäumen und Klosterruinen, Schwimmbädern und Hotels. Schon in sozialistischer Zeit entstanden Nachtlokale und große amerikanische Luxushotels und unweit der Stadt wird seit 1986 auf dem neuen Hungaro-Ring bei Mogyoród im August das Formel-I-Rennen um den »Großen Preis von Ungarn« ausgetragen. 1996 stand Budapest im Zeichen der 1100-Jahrfeier der Ankunft der Ungarn in Europa (siehe Kapitel III.3.). Seit Jahrhunderten eine europäische Stadt bereitet Budapest sich nun darauf vor, Weltstadt zu werden. Museum und Ausgrabungen (mit Jupiter-Säule) der Römerstadt Aquincum Foto: Ungarischer Diafilmbetrieb 46 Fotos: Sibylle Kußmaul 6. Das Donaudelta: Reise in ein Paradies? Von Sibylle Kußmaul Da waren wir nun also, am Ziel einer längeren Reise, damals 1989, entsprechend ungeduldig, neugierig und zugleich vielleicht sogar etwas betrübt über das nahende Ende einer Fahrt die Donau hinunter in einer Zille, einem jener Holzboote, mit denen sich seit alters her die Menschen auf der Donau fortbewegten. Unsere Zille war sieben Meter lang, eigens in Auftrag gegeben für diese Reise, die einen nachhaltigen, unvergleichlichen Eindruck hinterließ und eine noch heute tatsächlich empfundene Verbundenheit zur Donau. Vier Wochen lang, manche von uns sogar acht, näherten wir uns beharrlich dem Delta, paddelten etwa 50 Flusskilometer pro Tag. »Wir«, das waren sieben 20-Jährige, die schon viele Flusskilometer auf der Donau verbracht hatten und die zur Krönung aller vorangegangenen Fahrten auf dem oberen Flusslauf diese Reise bis ans Schwarze Meer angetreten hatten. Das Delta versetzte uns in Staunen, obwohl wir großartige Natur in den Wochen zuvor bereits häufig erlebt hatten. Auf die große Ruhe und Gelassenheit der stillen Seitenarme, der plötzlich sich auftuenden Seen und der trockengelegten Ebenen seitlich des Hauptkanals waren wir bestens vorbereitet. Vielmehr, das hatten wir so erwartet. Es entsprach unserem Rhythmus, der sich dem ruhig dahinziehenden Fluss angepasst hatte. Dagegen hatte die kommerzielle Nutzung des Flusses, wo immer sie auftrat entlang der Donau, uns immer wieder einen Schock versetzt, besonders in Rumänien, und so konnten wir auch dem Hauptkanal »Braţul Sulina« sehr wenig abgewinnen in seiner ganzen geradlinigen Hässlichkeit, permanent begleitet von mächtigen Strommasten, die die alten, hölzernen Masten mit ihren vielen Porzellanköpfen in den Schatten stellten. Wir waren also in einer sehr privilegierten Situation, da ein großer Teil der Deltabesucher vor allem diesen Hauptkanal von Sulina nach Tulcea zu Gesicht bekommt, vielleicht garniert mit einem der größeren Seen, der mit einem großen motorisierten Boot zu erreichen ist. Obwohl es mit der Ruhe der Tiere, dem Status der Naturschutzgebiete im Delta nicht mehr weit her wäre, würden alle Besucher sich ins Delta verstreuen ... doch dieser Gedanke ist nicht realistisch, kann nicht zu Ende gedacht werden, denn das Delta macht es niemandem leicht, eine totale Einverleibung durch Touristen erscheint nicht wirklich möglich. Was hat uns also so beeindruckt? Vielleicht waren es die Erzählungen, die Berichte aus einer fernen Region, die noch vor zehn Jahren weiter entfernt schien als etwa Reiseziele wie Australien und Neuseeland. Es war wohl der Mythos Delta, den wir erleben durften und den wir nähren konnten in den Wochen zuvor. Über die Donau in Bulgarien gab es nur wenige Berichte, über die Donau in Rumänien praktisch keine – bis auf Artikel zum Delta. Damit war dieses Gebiet das für uns am klarsten zu fassende. Irgendwie hatten wir ein Gefühl zu wissen, was uns erwartet, nämlich eine großartige Pflanzen- und Tierwelt, wenige Dörfer entlang der Kanäle und versprengte Bewohner. Doch sämtliche Berichte über das Delta schmälern ihren Informationsgehalt durch das Eingeständnis, diese äußerst komplexe Flusslandschaft nicht wirklich erfassen zu können. Das wird sich wohl auch hier wiederholen. Die Größenangaben für das DeIta schwanken zum Teil erheblich. 1000 Quadratkilometer hin oder her – tagtäglich ändert das Delta sein Gesicht. Was in der Tat so nachhaltig beeindruckt ist das Wissen, nur erste Eindrücke vom Delta mitbekommen zu haben. Dieses Wissen war vom ersten Paddelschlag an in unseren Köpfen, als wir endlich, nach unmäßig langen Verhandlungen mit den Behörden, Tulcea, unser Eingangstor zum Delta, passieren durften. Nach allem, was über die ehemaligen Ostblockländer bekannt ist, dürfte die Willkür der Beamten, zumindest den Touristen aus dem Westen gegenüber, heutzutage nicht mehr bestehen. Ein Visum für das Delta kann jetzt bereits in Deutschland bei den Konsulaten erworben werden. Wir schafften es damals erst nach eineinhalb Tagen, die Genehmigung für das Delta zu bekommen. Auch so wurden Mythen gemacht. In Tulcea trafen wir auf eine Gruppe junger Studenten aus der DDR, die uns eine detaillierte Karte schenkten. Ohne sie hätten wir es wohl kaum gewagt, von einem der drei großen Kanäle abzubiegen. Im Westen gab es keine Karten vom Delta und noch heute ist im Buchhandel eine solche Karte schwer erhältlich. Begierig, endlich eintauchen zu können in die versprochene Traumlandschaft, wegzukommen von Tulcea, langten wir in die Paddel. Weg von Tulcea, Symbol für vergeudete 47 Zeit, wo sogar Cafés und Restaurants waren, Schokolade und andere Luxuswaren, wo es eine gepflegte Uferpromenade gab. Wir konnten bereits Seeluft riechen, das Klima war äußerst angenehm, mediterran. In Erinnerung blieb nur klares und gleichzeitig sehr warmes Licht, obwohl die Fotos beweisen, dass es auch dunkle, schwere Wolken gab, gedämpfte Sonne. Mit der Karte bewaffnet wagten wir uns in einen Seitenarm, der sich bald verengte. Links und rechts dicht bewachsene Ufer mit Schilf, blühenden Gräsern, alten, knorrigen Bäumen. Das Wasser war bedeckt mit einem hellgrünen Linsenteppich, der sich nach uns sofort wieder zusammenschob. An den Ufern saßen riesige Unken in allen Braun- und Grüntönen und einmal sahen wir eine Schlange, die nach einem noch nicht lange zurückliegenden Krötenmahl träge und schwer in der Sonne lag mit diesem signifikanten Knubbel irgendwo auf ihrer Länge und sich so zögerlich trollte, dass wir sie immerhin ein paar Sekunden begutachten konnten. Ein wenig seltsam war diese natürliche Übermacht schon, die sich immer dichter an den Bootsrand drängte, der ein gewisses Gefühl von Sicherheit vermittelte und eine Grenze bildete zum Schilf, das das Boot immer dichter umschloss. Einmal verließ doch einer das Boot, musste uns anschieben, weil wir auf eine Wurzel gefahren waren. Vermutlich angelockt durch die interessante Wellenbewegung, schlängelte sich prompt eine Schlange auf uns zu, worauf der Rest der Gruppe den siebten Mann mit vereinten Kräften ins Boot rettete. Es roch nach fauliger Luft und Blutegel gab es offensichtlich auch. Als uns beinahe der Mut verließ angesichts dieser aufregenden, aber auch ungewohnten Enge, öffnete sich mit einem Mal der Blick auf einen wunderschönen, lichtüberfluteten See, auf dem wir sogar andere Menschen in Booten entdeckten, Fischer vermutlich. Auf unserer Fahrt zurück zum Sulinaarm paddelten wir auch an schilfgedeckten Hütten und Unterständen vorbei, vor denen Gejagtes hing. Hier wohnten wohl Menschen, die uns auch nicht begegnen wollten. Es wird erzählt, es gebe eine ganze Reihe von Bewohnern im Delta, geflohen vor dem rumänischen Staat oder wem auch immer. Letztlich sind alle Bewohner des Deltas Geflohene, meist Religionsflüchtlinge früherer Jahrhunderte, wie die Lipovenen, die aus Russland als Erste kamen. Wir übernachteten am Rande einer großen trockengelegten Ebene am Sulinakanal. Von einem Strommast aus konnte man das Schwarze Meer bereits erahnen. Über dem See hatten wir am Mittag einen Schwarm rosaroter Pelikane gesehen. Wir waren zufrieden. Wir hatten unser Abenteuer mit der Natur mit einem großen Finale beschlossen, die Donau in all ihren Facetten noch einmal erlebt drei Tage lang. Es war Zeit, nach Sulina zu fahren, dort das Kilometerschild »0« zu passieren und die Zille im Hafen am Schwarzen Meer abzuliefern, von wo ein Transfer sie zurückbringen sollte nach Biberach. An einer schönen alten Kirche legten wir an und entluden das Boot. Zurück nach Tulcea ging es mit dem Schnellboot. Die Landschaft flog an uns vorüber in einer unangenehmen Geschwindigkeit. Es blieb der Wunsch, wiederzukommen und viel Zeit mitzubringen, um dieses Delta genauer kennen zu lernen. Reisehinweise Konsulate – Visa-Konsulat-Abteilung, Matterhornstraße 79, 14129 Berlin, Telefon 0 30/803 3018 (-19). – Visa-Konsulat-Abteilung, Legionsweg 14, 53117 Bonn, Telefon 02 28/6 83 81 60. – Rumänisches Generalkonsulat, Dachauer Straße 17, 80335 München, Telefon 0 89/55 33 07/08. Ein Visum für Rumänien ist auch direkt an der Grenze erhältlich. Dieses Touristenvisum hat drei Monate Gültigkeit und kostet DM 90,-. Ermäßigung für organisierte Gruppenreisen. Hotels gibt es in allen größeren Orten im Delta. Privatunterkünfte werden auch in den kleineren Dörfern angeboten. Literaturhinweise Stephan Hoffstadt/Edgar Zippel: Rumänien, (Aragon) Moers 1996. Hier finden sich wertvolle praktikable Tipps für Unterkünfte, Restaurants, Bootsverleihe u.a. Die Donau – Gesamtdarstellungen und Bildbände Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz (Hrsg.): Flüsse im Herzen Europas. Rhein – Elbe – Donau, Berlin 1993. Claudio Magris: Donau. Biographie eines Flusses, dtv 1991. Thomas A. Merk / Andreas Riedmüller: Die Donau. Von der Quelle bis zur Mündung. Eine Bildreise, Hamburg 1994. Inge Morath: Donau, Salzburg / Wien 1995. Gerda Rob: Die Donau. Von der Quelle bis zur Mündung, Künzelsau o. J. Michael W. Weithmann: Die Donau. Ein europäischer Fluss und seine 3000-jährige Geschichte, Regensburg 2000 Die Donau: Flusseinzugsgebiet, Staaten und Landschaften 48 Neues aus der Landeszentrale Medienpaket gegen rechts Schulen, Jugendhäuser, Sozialarbeiter und alle, die sich aktiv am Kampf gegen den Rechtsextremismus beteiligen wollen und dafür Unterstützung suchen, können bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) ein »Medienpaket gegen rechts« mit praxisnahen Informations- und Aufklärungsmaterialien bekommen. Es umfasst Informationen zu den Themen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Asyl. Bestellungen werden unter Fax (0711) 164099-77 und E-mail [email protected] entgegengenommen. Das Angebot umfasst Listen und Verzeichnisse über • Literatur und Unterrichtsmaterial • Internet@dressen • Jugendbücher • Referentinnen und Referenten (»Wer worüber«) • Medien Besonders Interessierte können außerdem bestellen • »Argumentationstraining gegen Stammtischparolen – Materialien und Anleitungen für Bildungsarbeit und Selbstlernen« (Praxisband von Klaus-Peter Hufer) • »Werte in der politischen Bildung« (Fachbuch, herausgegeben von Gotthard Breit und Siegfried Schiele) • »Die Türkei vor den Toren Europas« (Heft 1/2000 der LpB-Zeitschrift »Der Bürger im Staat«) • »Türken bei uns« (Heft 3/2000 der LpB-Zeitschrift »Politik & Unterricht«) gegen rechts Am besten per Fax (0711) 16 40 99 77 Landeszentrale für politische Bildung Stabsstelle Marketing / Frau Weber Stafflenbergstr. 38 70184 Stuttgart Bestellung Bitte schicken Sie mir kostenfrei aus dem »Medienpaket gegen rechts« Listen und Verzeichnisse Zeitschriften-Hefte ______ Stk. »Literatur und Unterrichtsmaterial« ______ Stk. ______ Stk. »Referentinnen und Referenten« (Wer worüber) »Die Türkei vor den Toren Europas« (Bürger im Staat, Heft 1/2000) ______ Stk. »Türken bei uns« (Politik & Unterricht, Heft 3/2000) ______ Stk. »Internet@dressen« ______ Stk. »Medien« ______ Stk. »Jugendbücher« Bücher (nur Einzelexemplare möglich) ❏ Breit/Schiele (Hrsg.): Werte in der politischen Bildung« ❏ Hufer: Argumentationstraining gegen Stammtischparolen Lieferadresse: Name Straße PLZ / Ort Unterschrift Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart Telefax 07 11/164099-77 [email protected] www.lpb.bwue.de Telefon (07 11) 16 40 99-0 Durchwahlnummern Direktor: Siegfried Schiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -60 Referentin des Direktors: Sabine Keitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -62 Stabsstelle Marketing: Leiter: Werner Fichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -63 Öffentlichkeitsarbeit: Joachim Lauk . . . . . . . . . . . . . . . . . -64 Abteilung I Verwaltung (Günter Georgi) Fachreferate I/1 Grundsatzfragen: Günter Georgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 Controlling: Christine Windeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -11 I/2 Haushalt und Organisation: Jörg Harms . . . . . . . . . . . . . . -12 I/3 Personal: Gudrun Gebauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -13 I/4 Information und Kommunikation: Wolfgang Herterich . . . -14 I/5** Haus auf der Alb: Erika Höhne . . . . . . . . . . (0 71 25) 152 -109 Abteilung II Adressaten (Karl-Ulrich Templ, stellv. Direktor) Fachreferate II/1 Medien: Karl-Ulrich Templ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 II/2** Frieden und Sicherheit: Wolfgang Hesse . . (0 71 25) 152 -140 II/3 Lehrerfortbildung: Karl-Ulrich Templ . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 II/4* Schülerwettbewerb: Reinhard Gaßmann . . . . .-25, Monika Greiner . . . . . . . . . -26 II/5 Außerschulische Jugendbildung: Wolfgang Berger . . . . . -22 II/6** Öffentlicher Dienst: Eugen Baacke . . . . . . . (0 71 25) 152 -136 Abteilung III Schwerpunkte (Konrad Pflug) Fachreferate III/1** Landeskunde/Landespolitik: Dr. Angelika Hauser-Hauswirth . . . . . . . . . . (0 71 25) 152 III/2 Frauenbildung: Christine Herfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III/3** Zukunft und Entwicklung: Gottfried Böttger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 71 25) 152 III/4** Ökologie: Dr. Markus Hug . . . . . . . . . . . . . . (0 71 25) 152 III/5* Freiwilliges Ökologisches Jahr: Steffen Vogel . . . . . . . . . . III/6** Europa: Dr. Karlheinz Dürr . . . . . . . . . . . . . . (0 71 25) 152 III/7* Gedenkstättenarbeit: Konrad Pflug . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abteilung IV Publikationen (Prof. Dr. Hans-Georg Wehling) Fachreferate IV/1 Wissenschaftliche Publikationen Redaktion »Der Bürger im Staat«: Prof. Dr. Hans-Georg Wehling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV/2 Redaktion »Politik und Unterricht«: Otto Bauschert . . . . . IV/3 Redaktion »Deutschland und Europa«: Dr. Walter-Siegfried Kircher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV/4 Didaktik politischer Bildung: Siegfried Frech . . . . . . . . . . Anschriften Hauptsitz in Stuttgart (s. links) * 70178 Stuttgart, Sophienstraße 28-30, Telefax (07 11) 16 40 99-55 ** Haus auf der Alb 72574 Bad Urach, Hanner Steige 1, Tel. (0 71 25) 152-0, Telefax (0 71 25) 152-100 Außenstelle Freiburg Friedrichring 29, 79098 Freiburg, Telefon (07 61) 20 77 30, Telefax (07 61) 2 07 73 99 Außenstelle Heidelberg Friedrich-Ebert-Anlage 22-24, 69117 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 60 78-0, Telefax (0 62 21) 60 78-22 Außenstelle Stuttgart Sophienstraße 28-30, 70178 Stuttgart, Telefon (07 11) 16 40 99-51, Telefax (07 11) 16 40 99-55 Außenstelle Tübingen Herrenberger Straße 36, 72070 Tübingen Tel. (0 70 71) 2 00 29 96, Telefax (0 70 71) 2 00 29 93 Bibliothek Bad Urach Bibliothek/Mediothek Haus auf der Alb, Bad Urach Gordana Schumann, Telefon (07125) 152-121 Dienstag 13.00 –17.30 Uhr Mittwoch 13.00 –16.00 Uhr LpB-Shop Stuttgart Stafflenbergstraße 38 Ulrike Weber, Telefon (07 11) 16 40 99-66 Montag 9 – 12 Uhr und 14 –17 Uhr Dienstag 9 – 12 Uhr Donnerstag 9 – 12 Uhr und 14 –17 Uhr Nachfragen -134 -32 -139 -146 -35 -147 -31 -40 -42 -43 -44 Abteilung V Regionale Arbeit (Dr. Ernst Lüdemann) Fachreferate / Außenstellen V/1 Freiburg: Dr. Michael Wehner . . . . . . . . . . . (07 61) 2 07 73 77 V/2 Heidelberg: Dr. Ernst Lüdemann . . . . . . . . . (0 62 21) 60 78-14 V/3* Stuttgart: Dr. Iris Häuser . . . . . . . . . . . . . . . (07 11) 16 40 99-52 V/3* Stuttgart: Peter Trummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50 V/4 Tübingen: Rolf Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 71) 2 00 29 96 »Der Bürger im Staat« Ulrike Hirsch, Telefon (07 11) 16 40 99-41 E-Mail: [email protected] »Deutschland und Europa« Sylvia Rösch, Telefon (07 11) 16 40 99-45 E-Mail: [email protected] »Politik und Unterricht« Sylvia Rösch, Telefon (07 11) 16 40 99-45 E-Mail: [email protected] Publikationen (außer Zeitschriften): Ulrike Weber, Telefon (07 11) 16 40 99-66 E-Mail: [email protected] Bestellungen bitte schriftlich an die o.g. Sachbearbeiterinnen: Stafflenbergstr. 38, 70184 Stuttgart, Fax (07 11) 16 40 99-77 oder online: http://www.lpb.bwue.de Thema des nächsten Hefts: Katalonien Reclam Graphischer Betrieb GmbH · 71254 Ditzingen