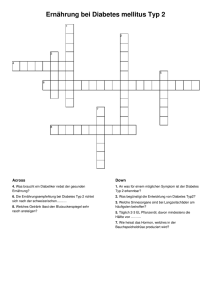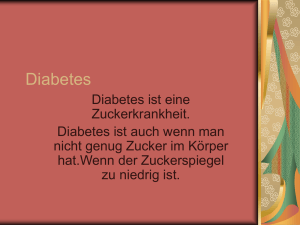Diabetiker werden häufiger depressiv
Werbung

52 LEIB & SEELE F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N TAG S Z E I T U N G , 1 2 . A P R I L 2 0 1 5 , N R . 1 5 SAGEN SIE MAL, FRAU DOKTOR F R AG E N V O N L E S E R N , BEANTWORTET VON ÄRZTIN C H R I S T I N A S T E FA N E S C U Sagen Sie mal, Frau Doktor, warum riecht der Urin nach dem Spargelessen so intensiv? Diese Frage, die mich von einem Leser erreicht hat, kommt jedes Jahr pünktlich zum Beginn der Spargelsaison wieder auf. Dabei kann man fast den Eindruck gewinnen, dass diese Frage schon so salonfähig ist, dass sie sogar am Tisch schon gestellt werden darf, während das weiße lange Gemüse noch verspeist wird. Und obwohl schon viel drüber gesprochen wurde, meint der Leser, vergesse man bis zum nächsten Jahr doch wieder die Begründung für dieses körperliche Phänomen. Damit Sie dieses Jahr sicher mitreden können am Tisch, habe ich mich der Frage des Lesers noch mal gewidmet, noch bevor die Spargelsaison in diesem Jahr so richtig losgeht. Mit dem Uringeruch nach dem Spargelverzehr verhält es sich wie mit dem Zungerollen oder dem Ohrenwackeln: Der eine kann es, der andere nicht. Genauer formuliert, müsste man eigentlich sagen, der eine hat es, der andere nicht schuld sind nämlich die Gene. Mehrere Aromastoffe im Spargel sind schwefelhaltig, dominierend ist darunter die Asparagusinsäure, die auch Asparagussäure genannt wird. Menschen, die beim Toilettengang verraten, was sie heute zu Mittag verspeist haben, besitzen ein Enzym, dass die Asparagussäure in schwefelhaltige Stoffe mit solch schwierigen Namen wie S-Methyl-thioacrylat sowie S-Methyl-3-(methylthio)thioproponiat zersetzt. Und dass Schwefel unangenehm riecht, ist allseits bekannt. Wer dieses Enzym nicht besitzt, hat in diesem Fall Glück, bei ihm wird die Aspargussäure nicht zersetzt, und deshalb riecht sein Urin nicht nach Schwefel. Aber es gibt auch Menschen, die riechen den Geruch des Urins nach dem Spargelverzehr nicht etwa, weil er nicht da ist, sondern weil sie wegen einer Mutation im Gen eines Geruchsrezeptors den spezifischen schwefeligen Duft nicht riechen können. Sie leiden an einer sogenannten spezifischen Anosmie, also einem selektiven Nicht-Riechen. Das lassen unter anderem die Studiendaten von Wissenschaftlern aus Philadelphia aus dem Jahr 2010 vermuten. Eins ist aber in jedem Fall sicher: Der beißende Geruch des Urins nach dem Spargelkonsum ist harmlos und kein Anzeichen für Krankheiten oder gar Vergiftungen. Ganz im Gegenteil sogar, Spargel ist eigentlich bekannt für seine wertvollen Inhaltsstoffe wie viele Ballaststoffe, Eisen, Vitamine oder Kalzium. Also lassen Sie sich das Gemüse schmecken. Die Asparagussäure ist übrigens nicht nur für den beißenden Geruch verantwortlich, sondern auch dafür, dass wir nach dem Spargelessen relativ schnell auf die Toilette müssen; sie gilt nämlich als harntreibend. Ob man am Uringeruch auch die Qualität des Spargels messen kann, wie der Leser in seiner Frage noch mutmaßt? Dazu kann ich nichts sagen. Ich als Ärztin kann mit einer kurzen Geruchsprobe sagen, ob Sie einen Infekt im Urin haben. Die Qualität des Spargels teste ich aber doch lieber auf dem Teller. Haben Sie auch eine Frage? Haben Sie auch eine Frage, die Sie schon immer mal einem Arzt stellen wollten, ohne dass Sie sich extra einen Termin in seiner Sprechstunde geben lassen wollen? Kennen Sie Hausmittel, von denen Sie schon immer mal erfahren wollten, ob sie auch halten, was die Großmutter versprochen hat? Bekommen Sie regelmäßig Tipps für Ihre Gesundheit, deren Wahrheitsgehalt Sie anzweifeln? Dann fragen Sie doch einfach unsere Kolumnistin, Christina Stefanescu, Ärztin aus Hessen, und schicken Sie uns die Frage an: [email protected]. Foto Helmut Fricke „Diabetiker werden häufiger depressiv“ Der Psychologe Bernhard Kulzer erklärt, wie Zucker und seelische Probleme aufeinander wirken – und was zu tun ist Herr Kulzer, dass Diabetespatienten unter einer schlechten Durchblutung, Sehproblemen und Unterzuckerung leiden können, ist bekannt. Dass Diabetes in der Folge aber auch psychische Erkrankungen hervorrufen kann, wissen viele nicht. Sind das neue Erkenntnisse? Ganz neu sind diese Erkenntnisse nicht. Aber man hat erst in den letzten Jahren begriffen, in welch gravierender Art und Weise Diabetes und psychische Erkrankungen sich gegenseitig beeinflussen können. Neue medizinische Erkenntnisse brauchen ihre Zeit, bis sie in der Fachwelt und darüber hinaus bekannt und akzeptiert werden. Man kann von dem heutigen Stand der Forschung aber sagen, dass alle psychischen Erkrankungen die Behandlung des Diabetes erschweren und die Prognose des Diabetes verschlechtern. Wie erklären Sie sich diesen Zusammenhang? Diabetes ist eine chronische Erkrankung. Bei der Diabetestherapie kommt dem Patienten die entscheidende Rolle zu. Er muss die Therapiemaßnahmen in unterschiedlichen Situationen in seinem Alltag eigenverantwortlich umsetzen. Das kann Stress bedeuten. Dies gelingt im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung fast immer schlechter. Der Diabetes wird dadurch zu einer immer stärkeren Belastung. Kommen dann noch andere mögliche Stressfaktoren wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Einsamkeit oder berufliche Probleme hinzu, dann ist die Stressachse der Betroffenen andauernd aktiviert. Als Folge wirkt das Insulin schlechter, und entzündliche Prozesse in den Gefäßen werden aktiviert. Dies schädigt die Blutgefäße, die durch den Zucker sowieso schon gefährdet sind, zusätzlich. Das Problem also ist, depressive Diabetespatienten kümmern sich schlechter um sich. Aus zahlreichen Studienergebnissen wissen wir, dass Patienten mit einer depressiven Symptomatik weniger auf ihre Gesundheit achten und die Therapie deutlich schlechter umsetzen. Medikamente werden nicht regelmäßig eingenommen, der Blutzucker weniger häufiger kontrolliert. Daher weisen Diabetespatienten mit einer Depression im Vergleich zu nichtdepressi- ven Patienten eine schlechtere Blutzuckereinstellung auf und mehr Folgeerkrankungen wie Augen-, Nieren- oder Herzprobleme. Zudem ist die Lebenserwartung deutlich verkürzt. Sie haben gesagt, dass Diabetes und Depression sich gegenseitig beeinflussen. Heißt das, depressive Menschen entwickeln auch häufiger Diabetes? Es ist tatsächlich so, dass nicht nur Menschen mit Diabetes öfter depressiv werden, sondern auch umgekehrt depressive Menschen ein erhöhtes Risiko aufweisen, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Wahrscheinlich liegt das daran, dass aufgrund des psychischen Stresses das Insulin nicht mehr so gut wirkt. Aber auch die Einnahme von Antidepressiva könnte aufgrund einer möglichen Gewichtszunahme und Verschlechterung der Insulinwirkung einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Diabetes haben. Sie arbeiten als Fachpsychologe jeden Tag mit Diabetespatienten zu- sammen. Wie viele von diesen leiden unter einer Depression? Ehrlich gesagt, bin ich immer wieder überrascht, wie viele Patienten zumindest mit leichten depressiven Symptomen ich sehe. In Deutschland leidet jeder achte Mensch mit Diabetes mellitus an einer klinischen Depression, jeder dritte Patient weist eine erhöhte Depressivität auf. Damit kommen bei Menschen mit Diabetes depressive Stimmungen und Störungen etwa doppelt so häufig vor wie bei Menschen ohne Diabetes. Gilt das für Typ-1-Diabetespatienten genauso wie für den Typ-2-Diabetes? Das gilt sowohl für den selteneren Typ-1-Diabetes, der oft bereits schon in jungen Jahren auftritt, als auch für den Typ-2-Diabetes, von dem über neunzig Prozent der Menschen mit Diabetes betroffen sind. Gibt es Patienten, die besonders gefährdet sind? Ganz allgemein sind Frauen eher gefährdet, an einer Depression zu erkranken, ebenso wie Personen mit einem niedrigeren sozialen Status und Menschen, die sozial nicht gut integriert sind. Dies gilt gleichermaßen auch für Menschen mit Diabetes. Dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte, das Auftreten von Folgeerkrankungen oder schwere Unterzuckerungen sind zusätzliche Risikomerkmale. Allerdings bedeutet dies noch keine Aussage über mögliche Kausalitäten. Es ist wie bei dem berühmten Henne-Ei-Problem: Oft wissen wir bei einem Patienten nicht, ob dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte bei ihm zu einer depressiven Verstimmung geführt haben oder umgekehrt. Wohin können sich Diabetespatienten, die gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit und Interessenverlust bei sich feststellen, wenden? Die ersten Ansprechpartner sind der Hausarzt oder der Diabetologe. Allerdings gibt es da noch viel Fortbildungsbedarf, da weniger als die Hälfte aller betroffenen Patien- Für die regionalen Unterschiede verantwortlich sind nach Schätzung von Experten der Sozialstatus, wirtschaftliche Faktoren, aber auch eine uneinheitliche medizinische Versorgung. In sozioökonomisch benachteiligten Regionen leiden Bewohner demnach durchschnittlich häufig an Diabetes. Im internationalen Vergleich, so wird vermutet, können zusätzlich noch unterschiedliche Ernährungs- und Verhaltensweisen der Grund sein. ten auch tatsächlich diagnostiziert werden. Da häufig diabetesspezifische Ursachen für die depressive Verstimmung verantwortlich sind, wäre es wünschenswert, dass solche Fachleute im Behandlungsteam integriert sind. Dies ist jedoch nur in Ausnahmen in Deutschland der Fall. Zudem sollten wir viel mehr tun, um durch präventive Maßnahmen die Entwicklung von Depressionen bei Menschen mit Diabetes zu verhindern. Wir brauchen dringend Anlaufstellen und bessere Konzepte für gefährdete Patienten. Immerhin reden wir hier über etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland, die nicht gut versorgt sind. An welche Anlaufstellen denken Sie da? In Deutschland gibt es für eine Vielzahl von Krankheiten Beratungsstellen, so zum Beispiel für Krebs-, Parkinson-, Sucht- oder HIV-Erkrankte. Diese haben das Ziel, Patienten zu beraten, wie sie mit Problemen im Zusammenhang mit ihrer Krankheit gut zurechtkommen können. So etwas fehlt für Diabetespatienten, dabei sollte es doch ein wichtiges Ziel sein, durch eine gezielte Beratung die Kompetenz im Umgang mit der Erkrankung und die Lebensqualität von Betroffenen zu stärken und zu verhindern, dass Diabetespatienten überhaupt psychisch krank werden. Gerade hier sollten niedrigschwellige Beratungsangebote ansetzen, die Patienten nicht gleich den Stempel „psychisch krank“ aufdrücken, sondern versuchen, persönliche Ressourcen zu aktivieren, um wieder besser mit dem lebenslangen Begleiter Diabetes klarzukommen. Aber solange es die nicht gibt, muss ich mich doch irgendwo hinwenden, wenn ich „Zucker“ und „Niedergeschlagenheit“ bei mir feststelle. Es ist sicher sinnvoll, den Hausarzt oder Diabetologen auf den eigenen Verdacht, depressiv zu sein, aufmerksam zu machen. Gemeinsam sollte man dann herausfinden, ob es wirklich eine Depression ist und ob sie mit dem Diabetes zusammenhängt. Hat man das eruiert, sollte der Arzt feststellen, wie schwer die depressive Episode ist und welche Therapiemaßnahme geeignet ist. Und welche gibt es? Bei leichten Depressionen reichen oft einige wenige Gespräche, manchmal auch der Besuch einer Diabetesschulung. Bei mittelschweren und schweren Depressionen lautet die Empfehlung, einen Psychotherapeuten aufzusuchen, hierbei haben sich vor allem relativ kurze Verhaltenstherapien als erfolgreich erwiesen. Zusätzlich ist die Einnahme von Medikamenten sinnvoll. Sie sollten aber weder Körpergewicht noch Blutzucker beeinflussen. Wie effektiv sind diese Therapien? Die Patienten haben gute Chancen, die depressiven Symptome wieder in den Griff zu bekommen. Etwa 80 Prozent der Patienten geht es nach einem halben Jahr deutlich besser. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen: Zwei von drei dieser Patienten erleben irgendwann im Leben einen Rückfall. Könnte man das auch durch bessere Versorgungsstrukturen verhindern? Sicherlich. Diabetes ist eine Erkrankung mit vielen Facetten. Betroffene sollten interdisziplinär behandelt werden, doch insbesondere die psychische Seite des Diabetes wird vernachlässigt wie auch das Thema Sexualität. Ein Tabuthema also? Absolut. Viele Diabetiker leiden unter sexuellen Störungen, was für die Betroffenen sehr belastend ist. Fast jeder zweite Mann mit Diabetes hat eine sogenannte erektile Dysfunktion. Das ist deutlich häufiger als bei dem Rest der Bevölkerung. Potenzprobleme nagen sowohl am Selbstwertgefühl der Betroffenen, sind aber auch eine Belastung für die Partnerschaft. Allerdings machen wir in der Diabetologie vor diesen Problemen häufig die Augen zu und verdrängen es aufgrund fehlender Interventionsmöglichkeiten. Die Onkologen sind da schon deutlich weiter. In welcher Beziehung? Bei Krebserkrankungen werden immer häufiger schon frühzeitig routinemäßig Psychoonkologen in die Behandlung mit einbezogen. Das würde ich mir auch für die Diabetespatienten wünschen. Die Fragen stellte Lucia Schmidt. Bernhard Kulzer ist Psychologe am Diabetes-Zentrum Mergentheim und Vorsitzender in der Arbeitsgemeinschaft „Diabetes und Psychologie“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Infos unter www.diabetes-psychologie.de