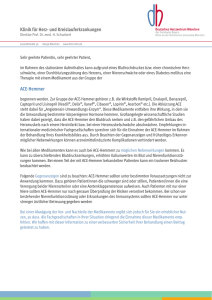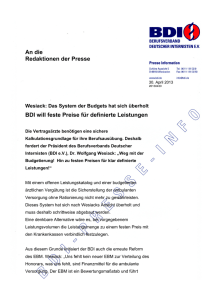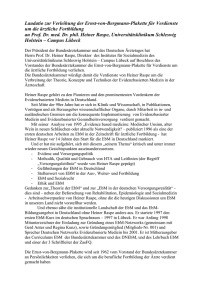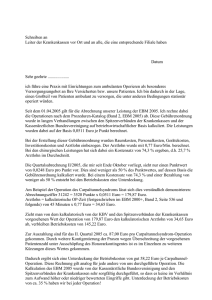Das Individuum bleibt auf der Strecke
Werbung

T H E M E N D E R Z E I T Evidenzbasierte Medizin Feraydoon Niroomand Das Individuum bleibt auf der Strecke Bei aller Euphorie über die evidenzbasierte Medizin sollten deren inhärente Beschränkungen und Fallstricke möglichst allen Ärzten geläufig sein. G Foto: Peter Wirtz roße, prospektive, randomisierte dizin. Bei aller Euphorie über die nen. Mit einem ähnlichen Problem der und kontrollierte Studien bilden Errungenschaft einer weitgehend ob- Unvereinbarkeit in der Kenntnisgewindas Rückgrat der modernen Evi- jektiven Methode sollten deren in- nung sind klinische Studien behaftet. Es denzbasierten Medizin (EbM). Sie er- härente Beschränkungen und Fall- ist prinzipiell nicht möglich, gleichzeitig lauben eine objektive Beurteilung und stricke nach Möglichkeit allen geläufig Ergebnisse zur Wirkung eines Meeine Quantifizierung des Nutzens von sein, die an der Umsetzung ihrer Ergeb- dikaments bei der Behandlung eines diagnostischen und therapeutischen nisse mitwirken. Die Beschränkungen Krankheitsbildes und zur Behandlung Maßnahmen bei bestimmten Krank- der EbM sind vielschichtig. Sie beste- individueller Patienten zu erzielen. heitsbildern. Der große Fortschritt, den hen in erkenntnistheoretischen, formal Das Problem liegt in der Definition die Medizin mit dieser Meder Einschlusskriterien. Sind thode gemacht hat, steht diese offen und weit gefasst, außer Frage, und es ist gewie beispielsweise in der genwärtig eher ein Problem, ALLHAT-Studie (nomen est dass Erkenntnisse aus den omen: ein Hut für alle) zur Studiendaten nur ungenüarteriellen Hypertonie (3), genden Eingang in die mediso kann man zwar ermitteln, zinische Versorgung finden. welches Präparat statistisch Dieser Artikel richtet sich am besten abschneidet, hat deswegen keinesfalls gegen aber für den einzelnen PatiEbM.Wie jede wissenschaftenten kaum mehr als eine liche Methode hat aber auch seichte Hilfestellung. Andie EbM ihre inhärenten schaulicher gesagt: Ein RadBeschränkungen. Man kann fahrer kann die Tour de mit einem noch so guten TeFrance gewinnen, ohne bei leskop nichts hören, und Es besteht die Gefahr, dass man vor lauter „Evidenz“ die Wünsche des einer einzigen Etappe (eiman kann mit einem Maß- Patienten nicht nur übersieht, sondern gar nicht erst aufkommen lässt. nem einzigen Patienten) Erband nichts wiegen. Die ster (das beste Präparat) geKenntnis der methodischen Beschrän- logischen, ethischen, statistischen und wesen zu sein. In den großen Studien kungen ist jedoch gerade für die Umset- technischen Unzulänglichkeiten. Diese versucht man, diesem Problem mit Subzung von entscheidender Bedeutung. sollen an Beispielen aus der kardiovas- gruppen-Analysen zu begegnen, was in Außerdem fördert sie die Suche nach kulären Medizin erläutert werden. wenigen, besonders ausführlich unterweiteren wissenschaftlichen Ansätzen suchten Fällen eine Annäherung an das zur Verbesserung. Grundproblem bringen kann. In der Das Bedürfnis der Ärzte und ihrer Erkenntnistheorie Regel reicht aber die statistische AussaPatienten nach gesicherter optimaler gefähigkeit („power“) nicht aus, um Diagnostik und Therapie fordert ein Im Jahr 1927 zeigte der Physiker Wer- selbst große Unterschiede bei den Subnormiertes Handeln. Infolge der Kom- ner Heisenberg in der nach ihm be- gruppen zu diskriminieren. Da sich plexität der Materie besteht die Gefahr nannten Unschärferelation, dass zwei dann die Ergebnisse für die Subgrupeiner übertriebenen Vereinfachung und kanonische Messgrößen, deren Produkt pen nicht signifikant vom GesamterDogmatisierung. Was bis vor kurzem die Wirkung ist, zum Beispiel der Ort gebnis unterscheiden (können), wird die bereitwillige Annahme von Lehr- und der Impuls eines Elementarteil- impliziert, dass dieses auch für sie zumeinungen war, ist heute der Glaube an chens, nicht gleichzeitig mit beliebiger trifft. Durchaus legitim ist die Annahdie Allmacht der Evidenzbasierten Me- Messgenauigkeit erfasst werden kön- me, dass der Nutzen innerhalb einer Po- A 1870 Jg. 101 Heft 26 25. Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt T H E M E N pulation nach vernünftigem Ermessen auch auf einzelne Patienten übertragen werden kann. Das vernünftige Ermessen leitet sich aus persönlicher und kommunizierter Erfahrung sowie dem physiologisch/pathophysiologischen Verständnis ab, von dem man manchmal den Eindruck gewinnt, es sei der Todfeind der EbM-Apologeten. Das andere Extrem bilden Studien mit engen Einschlusskriterien. Ein Beispiel hierfür ist die erste MADIT-Studie zur Verhütung des plötzlichen Herztodes mit implantierbarem Defibrillator (9). Eingeschlossen wurden ausschließlich Patienten nach Herzinfarkt, mit einer deutlich verminderten Pumpfunktion des Herzens (linksventrikuläre Auswurffraktion unter 35 Prozent), einer komplexen ventrikulären Extrasystolie im Langzeit-EKG, Auslösbarkeit einer anhaltenden Kammertachykardie unter programmierter elektrischer Stimulation des Herzens und fehlendem Ansprechen der auszulösenden Tachykardie auf Medikamente. Hier sind die Patienten, die von der Behandlung profitieren, zwar relativ gut definiert, sie machen jedoch nur einen sehr kleinen Prozentsatz, etwa ein Prozent, der Postinfarktpatienten aus. Um die Analogie aus der Tour de France nochmals zu bemühen: Ein Fahrer kann zwar eine Etappe gewinnen, im Gesamtklassement (der weiter gefassten Patientenpopulation) aber auf den letzten Platz landen. Diese Beschränkung ist kein Problem des guten oder schlechten Studiendesigns, sondern eine unausweichliche Folge der Methode. Im Allgemeinen ist der Patient in Herz-Kreislauf-Studien männlich, Kaukasier und zwischen 55 und 75 Jahren alt. Dagegen existieren überhaupt keine, wenige oder lediglich ignorierte Daten zu Frauen (circa 50 Prozent der Erdbevölkerung), Nicht-Kaukasiern (circa 90 Prozent der Weltbevölkerung), Alten (circa ein Drittel der Patienten in einer internistischen Klinik in Deutschland) und jungen Patienten (< 55 Jahre), die in der kardiovaskulären Medizin zwar relativ selten anzutreffen sind, die aber am längsten von der Behandlung profitieren könnten. Die Einhaltung der EbM erfordert bei der Behandlung eines Patienten mit D E R Z E I T koronarer Herzkrankheit und Herzinsuffizienz eine Therapie mit Acetylsalizylsäure, einem Betablocker, einem ACE-Hemmer, einem Aldosteronantagonisten und einem Statin. Bereits dieses „Minimalprogramm“ lässt sich nicht in allen möglichen Kombinationen durchuntersuchen. Die vermeintliche Evidenz, dass diese Medikamente auch in Kombination ihren günstigen Effekt haben, basiert auf ihrer (teilweise) unterschiedlichen biologischen Wirkung und der zufälligen Abfolge der Studien. So wurden Betablocker in Herzinsuffizienzstudien an Patienten untersucht, die bereits mit einem ACE-Hemmer behandelt waren; die Betablocker konnten dabei eine weitere Abnahme der Sterblichkeit dieser Patienten bewirken. Es ist damit aber nicht gesagt, dass Patienten, die einen Betablocker erhalten, auch von einem ACE-Hemmer profitieren. Für die genannte Medikamentenkombination, geschweige denn irgendeine Dosierung, gibt es keine Evidenz. Es ist eine stark vereinfachende und in Anbetracht der wenigen Untersuchungen zu diesem Thema zweifelhafte Annahme, dass die günstigen Wirkungen der einzelnen Therapien beliebig additiv sind. Ethik Andererseits ist es ethisch kaum zu vertreten, dass einem Patienten eine „erwiesenermaßen“ lebensverlängernde Therapie vorenthalten wird. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist noch nicht in Sicht. Inzwischen sind selbst Dreifachkombinationen mit gleichem Angriffspunkt, zum Beispiel Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems mit ACE-Hemmer, AT1-Rezeptorantagonisten und Aldosteron-Antagonisten, zur Behandlung der Herzinsuffizienz in Erprobung. Es ist nach den neuesten Untersuchungen nicht unwahrscheinlich, dass auf Grundlage der Evidenzbasierten Medizin das „Minimalprogramm“ für Patienten mit koronarer Herzkrankheit und Herzinsuffizienz demnächst aus Betablocker, Statin, ACE-Hemmer, AT1-Rezeptorblocker, Aldosteronantagonisten, Aspirin, Clopidogrel und/oder oralem Thrombin-Inhibitor bestehen wird. Jg. 101 Heft 26 25. Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt Eine Studie hat eine umso größere Chance, mit relativ wenigen Patienten in relativ kurzer Zeit zu einem positiven Ergebnis zu führen, je häufiger der Endpunkt, im „Idealfall“ das Sterben des Patienten, eintritt. Eine Analyse aller Studien zur Sekundärprävention des plötzlichen Herztodes mittels implantierbarem Defibrillator hat gezeigt, dass ausschließlich Patienten mit einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion des Herzens, insbesondere im hohen Lebensalter und bei hochgradiger Einschränkung ihrer körperlichen Belastbarkeit, von der Implantation des Defibrillators profitieren (8). Die keinesfalls übertriebene Schlussfolgerung der EbM hieraus müsste lauten, dass man alte Menschen, die bereits bei der Verrichtung ihrer einfachen täglichen Bedürfnisse Atemnot verspüren, mit dieser sehr kosten- und ressourcenintensiven Therapie versorgen soll, diese andererseits einem jungen, weitgehend gesunden Menschen, der ein substanzielles Risiko hat, am nächsten Morgen plötzlich tot umzufallen, aber vorenthalten darf (und vielleicht bald muss). Eine Behandlung schwerstkranker Patienten, die sich aus vielen Studien nach EbM ableiten lässt, hat neben der manchmal unmenschlichen auch eine unterschätzte finanzielle Seite. Bei der Berechnung der Kosten je gewonnenem Überlebenszeitraum werden lediglich die unmittelbar aus der untersuchten Behandlung resultierenden Kosten gewertet. Dies müsste hinterfragt werden, denn bei der Berechnung sollten sämtliche Behandlungskosten dieser Patienten für den gewonnenen Lebenszeitraum zugrunde gelegt werden. Die Implantation eines Defibrillators nach den Kriterien der EbM verhindert vielleicht den plötzlichen Herztod durch eine Herzrhythmusstörung zugunsten eines Siechtums auf einer kardiologischen Intensivstation. Angesichts der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Ausgaben für die medizinische Versorgung auf die beiden letzten Lebensjahre entfallen, sollte es ein Anliegen sein, bei den Kostenberechnungen die real anfallenden Gesamtkosten zu ermitteln und eine Betrachtung der Lebensqualität in den gewonnenen Lebenszeitraum mit einzubeziehen. Dies darf nicht dahingehend fehlinterpretiert werden, A 1871 T H E M E N Z E I T wurde bislang das ethische Problem, wie vielen Menschen man eine Medikation zumuten darf, die ihnen gar nichts nützt, um einem aus dieser Gruppe zu helfen. Aufgrund des geringen Risikos im Gesamtkollektiv zeigen diese Studien in der Regel keine Reduktion für schwerwiegende Endpunkte durch das untersuchte Medikament. Deshalb werden kombinierte Endpunkte gewählt, die so unterschiedliche Ereignisse wie Mortalität und Zahl der Krankenhausaufnahmen vermischen, womit dann suggeriert wird, dass ein Präparat auch die Mortalität im untersuchten Kollektiv günstig beeinflusst. Um bei einer ökonomischen Betrachtung etwaigen Illusionen vorzubeugen: Es gibt kaum etwas Teureres im Gesundheitswesen als die mit einer medizinischen Maßnahme verbundene Primärprävention bei nur leicht Erkrankten oder gar Gesunden, und auch für diesen Bereich wird die EbM nach Kräften missbraucht. Statistik In den von John Canton postum veröffentlichten Schriften des englischen Pastors und Mathematikers Thomas Bayes wird erstmals dargelegt, dass die Wahrscheinlichkeit für die richtige Vorhersage eines statistischen Tests von der Foto: BilderBox dass man Alten und Schwerkranken keine optimale Behandlung zukommen lassen soll. Es zeigt stattdessen, dass viele therapierelevante Faktoren vorliegen können, die in die Ergebnisse der EbM nicht einfließen und die deshalb leider immer häufiger ignoriert werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass man vor lauter „Evidenz“ die Wünsche des Patienten nicht nur übersieht, sondern gar nicht erst aufkommen lässt. Das zweite Problem mit der Ethik zielt in die entgegengesetzte Richtung. Es besteht darin, dass die Kunst differenzierten ärztlichen Handelns zunehmend durch gleichgeschaltete Behandlungsmethoden an immer größeren und heterogeneren Patientenpopulationen ersetzt wird. Ist die Zahl der Untersuchten groß genug und die Behandlung mit einem relativ geringen Risiko verbunden, so kann das Ergebnis für das gesamte Kollektiv „signifikant“ positiv ausfallen, obwohl nur ein geringer Anteil der Behandelten tatsächlich profitiert. Das Ausmaß des präventiven Nutzens wird dabei beschönigend dargestellt, indem die eigentlich irrelevante, aber zahlenmäßig beeindruckendere relative Risikoreduktion in den Vordergrund gerückt wird. Für die eigentlich relevante Zahl der erforderlichen Behandlungen, um ein Ereignis zu verhindern („number needed to treat“), gelten derzeit Größenordnungen von 100 bis 200 noch als seriös. Kaum diskutiert D E R Kaum diskutiert wurde bislang das ethische Problem, wie vielen Menschen man eine Medikation zumuten darf, die ihnen gar nichts nützt, um einem aus dieser Gruppe zu helfen. A 1872 A-priori-Wahrscheinlichkeit der Testvorhersage abhängig ist (4). Beispiel: Ein 65-jähriger Patient mit langjährigem schwerem Nikotinabusus, Diabetes mellitus, arterieller Hypertonie und einer Hypercholesterinämie zeigt im Belastungs-EKG horizontale STStreckensenkungen in zwei konsekutiven Brustwandableitungen. Am gleichen Tag zeigt das Belastungs-EKG einer 35-jährigen Frau mit atypischen pektanginösen Beschwerden und einer positiven Familienanamnese, sonst aber fehlenden Risikofaktoren, die gleichen Veränderungen wie ihr männlicher Kollege zuvor. Obwohl der gleiche Test in diesem Fall ein identisches Ergebnis liefert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Fall tatsächlich eine koronare Herzerkrankung vorliegt, ungleich größer. Dieser grundlegende Tatbestand wird bei der Beurteilung von Studienergebnissen gänzlich ignoriert. Ein Grund hierfür besteht vor allem darin, dass die A-priori-Wahrscheinlichkeit (pretest probability) für die Studienhypothese kaum zu ermitteln ist. Sie kann allenfalls grob abgeschätzt werden. Aber nur dann lässt sich überhaupt aussagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine neue Behandlung im Falle eines positiven Studienergebnisses besser ist. Wenn man beispielsweise eine A-prioriWahrscheinlichkeit von zehn Prozent veranschlagt, liegt die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Überlegenheit eines positiv getesteten Präparats aus einer Studie mit einer „power“ von 80 Prozent und einem Signifikanzniveau von fünf Prozent (den heute üblichen Standards für ein signifikantes Studienergebnis), lediglich bei 78 Prozent und nicht, wie man meinen könnte, bei 95 Prozent. Bei 50 Prozent hätte man auch würfeln können (5). Der Goldstandard der EbM ist die prospektive, randomisierte und kontrollierte Studie mit großer statistischer Sicherheit (hohe „power“, niedriges Signifikanzniveau) bei ausreichend langer Nachverfolgung der Patienten. Um dem gerecht zu werden, braucht man vor allem Zeit. Zeit um eine ausreichend große Zahl an Patienten lange genug untersuchen zu können. „Multicenter-Studien“ lösen dieses Zeitproblem nur partiell und sind mit eigenen Schwächen behaftet. Studien, die einen Jg. 101 Heft 26 25. Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt T H E M E N Überlebensvorteil für die koronare Bypass-Operation bei bestimmten Patienten (natürlich die schwerstkranken) mit koronarer Herzkrankheit belegen, sind – gemessen an den rasanten Fortschritten in der Medizin – sehr alt. Sie stammen vom Anfang der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Seither haben sich die bereits erwähnten medikamentösen Behandlungen (Aspirin, Betablocker, ACE-Hemmer,Aldosteron-Antagonisten und Statine) etabliert, die im Schnitt die Mortalität jeweils um etwa 20 Prozent reduzieren. In Kombination ergibt sich daraus eine theoretische Senkung der Sterblichkeit um etwa 67 Prozent .Würde man diese prognostisch relevanten medikamentösen Wirkungen mit der historischen Kontrolle von BypassOperationen vergleichen (eine allerdings unseriöse Vorgehensweise), ergäbe sich eine gewaltige prognostische Überlegenheit der medikamentösen Therapie. Neuere Studien vergleichen die koronare Bypass-Operation mit der alternativen Ballonangioplastie (PTCA) der Koronararterien. Wann immer eine dieser Studien abgeschlossen wurde, war die Behandlung mit PTCA (und in gewissem Umfang auch die der BypassOperationen) in einem wesentlichen Punkt weiterentwickelt worden. Zunächst waren es die implantierten Gefäßstützen (Stents), dann die verbesserten medikamentösen Maßnahmen zur Hemmung der Blutplättchen (ADPAntagonisten, GPIIb/IIIa-Antagonisten) und zuletzt die mit Medikamenten beschichteten Stents, nicht zu vergessen die verbesserte adjuvante medikamentöse Therapie. So kann heute der einzige verbliebene „EbM-Vorteil“ der Bypass-Operationen, die geringere Häufigkeit von später notwendig werdenden Revaskularisationsmaßnahmen, bei optimaler konservativer Therapie und der Verwendung beschichteter Stents, in Zweifel gezogen werden. Anders ausgedrückt: Wann immer der Hase meint, das Ziel als Erster durchlaufen zu haben, steht ein neuer Igel bereits da. Sehr genau genommen mit der EbM haben es die Londoner Mediziner Nicolas Wald und Malcom Law. Sie griffen zum „höchsten Gut“ der EbM, der Metaanalyse von Studien mit ho- D E R Z E I T her Bonität, und zeigen, was man alles damit machen kann (10). Aus den Daten dieser Studien berechneten sie den prognostischen Nutzen einer Polypille, bestehend aus der Kombination eines Statins, Azetylsalicylsäure, einem Thiazid-Diuretikum, einem ACE-Hemmer, einem Betablocker sowie Folsäure. Nach der Auswertung ihrer Studie sollte diese Polypille von jedem ab dem 56. Lebensjahr eingenommen werden. Die Lebenserwartung der so Behandelten würde im Durchschnitt um elf Jahre steigen, in Deutschland also von derzeit durchschnittlich 81 Jahren auf 92 Jahre. Das bedeutete die Einnahme von (mindestens) sechs verschiedenen Pharmaka über einen Zeitraum von 36 Jahren. Rund 45 Millionen Menschen würden täglich dieser Behandlung bedürfen. Veranschlagt man einen Tagespreis von fünf Euro, so entstünden für diese rein präventive Maßnahme jährliche Behandlungskosten von mehr als 82 Milliarden Euro. Mit diesem „Einjahresbetrag“ ließe sich die gesamte Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Medizin über einen Zeitraum von 330 Jahren bezahlen. Haben wir wirklich ein so schlechtes Zutrauen in unsere Forschung und unsere Medizin, dass wir auch nur erwägen, unsere Ressourcen in dieser Weise zu verteilen? Polypille für alle Da die Empfehlung für die Polypille auf Evidenzbasierter Medizin beruht, wurde sie nicht nur in einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften publiziert, sondern ihre Schlussfolgerungen werden durchaus ernst genommen. Dabei werden geradezu exemplarisch alle hier erhobenen Einwände ignoriert. Nachfolgend seien einige der zugrunde gelegten Primärpräventions-Studien, besonders die an Probanden mit einem niedrigen kardiovaskulären Risiko, näher beleuchtet. Aspirin wurde bereits von 27 359 gesunden Probanden (BMD-, PHS-, TPT-, HOT- und PPP-Studie) zur Primärprävention im Durchschnitt fünf Jahre lang eingenommen. Ein Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit ließ sich nicht nachweisen. Es konnten 1,47 vaskuläre Ereig- Jg. 101 Heft 26 25. Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt nisse pro tausend behandelter Patienten pro Jahr verhindert werden (7). Auch für Betablocker gibt es keine Daten, die bei der Primärprävention eine Mortalitätsreduktion zeigen. Für ACE-Hemmer zeigt eine Studie (1) an Hochrisikopatienten (manifeste Atherosklerose oder Diabetes mellitus plus einem weiteren Risikofaktor) eine geringe Reduktion der Mortalität. Dabei mussten allerdings 54 Patienten fünf Jahre lang mit einer hohen Dosis (zehn Milligramm) Ramipril behandelt werden, um einen Todesfall zu verhindern. Bei 3 304 gesunden Probanden, die über im Mittel fünf Jahre mit dem Cholesterinsenker Lovastatin behandelt wurden, traten innerhalb des Studienzeitraums 17 kardiovaskuläre Todesfälle auf, verglichen mit 25 bei den 3 301 Kontrollpatienten (6). Die angeführten Beispiele zeigen, dass Ärzte auch in Zukunft nicht durch mit Studiendaten gefütterte Computerprogramme ersetzt werden können. Bei aller Euphorie über EbM sollte das kritische Nachdenken über ärztliches Handeln nicht auf der Strecke bleiben. Den Ärzten muss bewusst sein, dass mit dieser Methode auch Manipulationen von gewaltiger sozioökonomischer Bedeutung stattfinden; gerade deshalb sollte eine unabhängige Unterstützung klinischer Studien, zum Beispiel durch Krankenkassen, private Förderinitiativen oder gar öffentliche Haushaltsmittel angeregt werden. Dringend erforderlich ist die Erfassung aller Patienten in Registern sowie die fortlaufende wissenschaftliche Auswertung dieser Register. Surrogatparameter sind, häufig zu Recht, für die Bewertung von Therapien in Verruf geraten. Es ist aber vorstellbar, dass eine darauf konzentrierte Forschung in der Lage sein könnte, einfache Surrogatmarker zu identifizieren, die gut mit dem gewünschten therapeutischen Effekt korrelieren. Dadurch könnte die individuelle Anpassung von Therapien drastisch vereinfacht werden. Die hier aufgeführten kritischen Anmerkungen zeigen auch die relative Beschränktheit der momentanen therapeutischen Möglichkeiten und implizieren damit das Primat, unsere Forschungsanstrengungen und insbesondere die Bereitstellung von Ressourcen für die Forschung drastisch zu intensivieren, um kurative Therapieansätze zu A 1873 T H E M E N entwickeln. Damit wäre ein Großteil der genannten Probleme beseitigt. Epidemiologische Daten zeigen, dass bereits die Schulbildung enormen Einfluss auf die Prävalenz kardialer Risikofaktoren wie Übergewicht, Hypertonie, Diabetes und Nikotinmissbrauch hat (2). Vielleicht sollten gerade ambitionierte Ärzte deshalb einen Teil ihrer Zeit – statt mit der Durchführung einer neuen Medikamentenstudie – mit der Abhaltung einer Stunde Schulunterricht zum Thema Gesundheit verbringen. Neben dem primär präventiven Nutzen würde es vielleicht dazu führen, besser informierte Patienten zukünftig auch besser in Therapieentscheidungsprozesse einzubinden. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2004; 101: A 1870–1874 [Heft 26] Literatur 1. Anonymous: Effects of an angiotensin-convertingenzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. New Engl J Med 2000; 342: 145–153. 2. Anonymous: Heart disease and stroke statistics–2003 update. http://www. americanheart.org. 3. Anonymous: Major outcomes in high risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs. diuretic: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002; 288: 2981–2997. 4. Bayes T: An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 1763, 1764; 53: 376–399; 54: 298–310. 5. Beck-Bornhold HP, Dubben HH: Der Schein der Weisen. Hamburg: rororo-science 2003. 6. Downs JR, Clearfield M, Weis S et al.: Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels. JAMA 1998; 279: 1615–1622. 7. Hayden M, Pigone M, Phillips C, Murlow C:Aspirin for the primary prevention of cardiovascular events: A summary of the evidence for the U.S. preventive services task force.Ann Intern Med 2002; 136: 161–172. 8. Moss AJ: Implantable cardioverter defibrillator therapy. The sickest patients benefit the most. Circulation 2000; 101: 1638–1640. 9. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS et al.: Improved survival with an implanted defibrillator in patients with coronary disease at high risk for ventricular arrhythmia. New Engl J Med 1996; 336: 1933–1940. 10. Wald NJ, Law MR: A strategy to reduce cardiovascular disease by more than 80 %. BMJ 2003; 326: 1419–1424. Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. Feraydoon Niroomand Universität Heidelberg Innere Medizin III Bergheimer Straße 58 69115 Heidelberg E-Mail: [email protected] A 1874 D E R Z E I T Advanced Trauma Life Support Mit Blaulicht in die Sackgasse? Die Absicht, weltweit eine standardisierte Traumaversorgung zu etablieren, muss mit Vorsicht betrachtet werden. S tellen Sie sich vor, Sie fahren in einer kalten Dezembernacht auf einer dunklen Straße mit ihrem PKW gegen einen unbeleuchteten Container. Sie haben den Unfall bis auf ein paar Schrammen gut überstanden, Ihr Auto allerdings nicht. Sie rufen über Mobiltelefon die Polizei, die wenige Minuten später an der Unglücksstelle erscheint. Die hilfsbereiten Beamten bieten Ihnen an, sich in ihrem Einsatzfahrzeug aufzuwärmen und dort das Protokoll aufzunehmen. Kurze Zeit darauf trifft der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst ein. Da Sie ein leichtes Ziehen im Nacken verspüren, äußert eine Rettungsdienstfachkraft den Verdacht auf eine gefährliche Verletzung der Halswirbelsäule. Um Sie „wirbelsäulengerecht“ aus dem Polizeiauto zu befreien, stellt der Rettungsdienstmitarbeiter die Indikation zur „technischen Rettung“, woraufhin der Rüstzug der Feuerwehr mit Sondersignal anrückt. Ein Feuerwehrmann nimmt hinter Ihnen Platz und hält Ihren Kopf in Neutralposition, während der Rettungsdienstmitarbeiter Ihnen eine Halsmanschette anlegt. Realität statt Glosse Nun beginnt die Feuerwehr, mit schwerem Gerät das Polizeifahrzeug um Sie herum in seine Einzelteile zu zerlegen. Nachdem das Dach entfernt ist, legt man Ihre Rückenlehne nach hinten um, schiebt Ihnen ein zwei Meter langes Brett ins Kreuz und zieht Sie aus dem Wrack des Polizeifahrzeugs. Mit Gurten fixiert man Sie dann so auf dem ungepolsterten Brett, dass Sie komplett bewegungsunfähig sind. Zu guter Letzt versorgt man Sie mit einer Sauerstoffmaske und verfrachtet Sie in einen großen ame- rikanischen Rettungswagen, der Sie mit heulender Sirene ins nächste Krankenhaus bringt. 30 Minuten nach Aufnahme stehen Sie vor dem Haupteingang des Krankenhauses mit einer Packung Paracetamol in der Hand, warten auf Ihr Taxi, das Sie nach Hause bringen soll, und fragen sich,was eigentlich passiert ist. Wer annimmt, es handle sich hierbei um eine Glosse, täuscht sich. Der geschilderte Fall (1) ist rettungsdienstliche Realität in Europa und stellt die konsequente Umsetzung des Versorgungsprotokolls „Advanced Trauma Life Support“ (ATLS®) dar. Anstoß hierzu gab ein Arzt, der in den USA 1976 einen Flugzeugabsturz erlitt. Die medizinische Primärversorgung empfand er als so schlecht, dass er die Universität von Nebraska veranlasste, ein systematisches Konzept zur Versorgung von Schwerverletzten zu erarbeiten. Dieses Konzept wurde vom American College of Surgeons (ACS) aufgegriffen und zu ATLS weiterentwickelt – mit dem Ziel, die Mortalität von Traumaopfern zu senken und das Outcome zu verbessern. Inzwischen ist ATLS zusammen mit dem „Pre-Hospital-Trauma-Life-Support“-(PHTLS®-)Protokoll international zum Standard für die präklinische und klinische Versorgung von Unfallverletzten avanciert. Innerhalb Europas haben die Niederlande und Großbritannien diese Protokolle eingeführt. Die Ausbildung wird von Tochterorganisationen des ACS und von nationalen Fachgesellschaften ausgerichtet, die im Franchising den kompletten Kursus einschließlich Zertifizierung vom ACS übernehmen. Zielgruppe des zweieinhalbtägigen Intensivkurses mit abschließender Prüfung sind alle Berufe, die aktiv an der Versorgung Schwerverletzter teil- Jg. 101 Heft 26 25. Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt