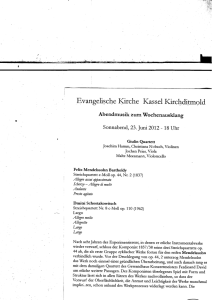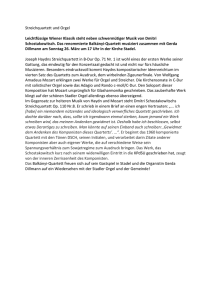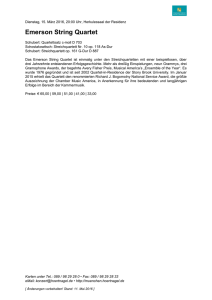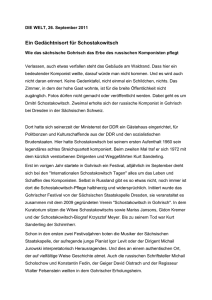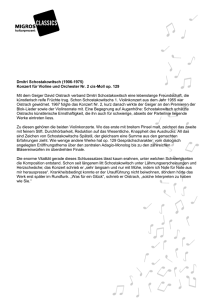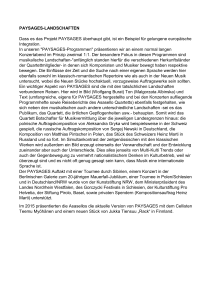SWR2 MUSIKSTUNDE
Werbung

___________________________________________________________________ SWR2 MUSIKSTUNDE Individualisten und Kollektive Kleine Ensembles “auf eine gantz neue Besondere art”, Folge 4 Freitag, Freitag, 18.05.2012, 9.05 – 10.00 Uhr Karl Dietrich Gräwe Wäre es nach dem Willen des Münchner Hornvirtuosen Franz Strauss gegangen, dann hätte sein Sohn Richard sich auf das Studium Mozarts und Mendelssohns beschränken dürfen. Heimlich verfiel Sohn Richard zwar dem Bann Richard Wagners, aber Mozart blieb zeitlebens auch für ihn die höchste Instanz. Als 17jähriger Gymnasiast schrieb Richard Strauss eine Serenade für 13 Bläser, die dem Dirigenten Hans von Bülow, dem damaligen Leiter der Meininger Hofkapelle, so gut gefiel, dass er sie in das Reiseprogramm seines Orchesters aufnahm. Unverkennbare Vorbilder: Die Serenaden Mozarts, allen voran die Gran Partita in Bdur, ebenfalls für 13 Instrumente. Die Serenade hatte Erfolg, und Bülow ermutigte den jungen Strauss zu einem weiteren Werk dieser Art. Strauss war 20, als er die Suite in B-dur, wieder für 13 Blasinstrumente, folgen ließ. Bei der Uraufführung, 1884 in München, verdiente er sich gleich die ersten Sporen als Dirigent, auch darin erfolgreich, denn ein Jahr später war er 2. Kapellmeister der Meininger Hofkapelle. Richard Strauss, der künftige Inszenator instrumenten- und farbenreicher Orchesterpanoramen – und am Anfang wie zuletzt am Ende seiner Laufbahn, erweist er, sicher im Sinne seines Vaters, dem Serenadenstil Mozarts seine Observanz. Richard Strauss Suite B-dur für 13 Bläser op. 4 1. Satz: Praeludium (Allegretto) Niederländisches Bläserensemble Ltg.: Edo de Waart Philips 438 733-2, LC 00305 CD I, Track 2 5’54“ Mit 20 Jahren komponierte Richard Strauss eine Suite in B-dur für 13 Bläser. Das Niederländische Bläserensemble spielte daraus den 1. Satz: Praeludium. In den ersten Opern Puccinis machte sich bereits ein Grundzug bemerkbar, den man als „sinfonisch“ bezeichnen könnte. Sein erster anhaltender Opernerfolg, „Manon Lescaut“, und die letzte Oper Verdis, der „Falstaff“, kamen im Abstand einer Woche in Mailand heraus. Wachablösung in der Domäne des italienischen Melodramma. Dem alten Verdi war das Sinfonisch-Verschmelzende der Schreibweise Puccinis nicht entgangen. Misstrauisch knurrte er: „Oper ist Oper, Sinfonie ist Sinfonie“. Puccinis allererste Oper, „Le Villi“, war ein allzu kurzlebiger Sensationserfolg gewesen, der zweite Versuch, „Edgar“, geriet gleich zum Fiasko. Der Verleger Giulio Ricordi, der eine untrügliche Witterung für Talente und Genies hatte, stärkte ihm mit Zuspruch und Geld das schwankende Selbstvertrauen und schickte ihn zur Aufmunterung sogar zu den Bayreuther Festspielen. Der Besuch brachte Puccini Erfahrungen ein, die ihn in seinen sinfonischen Neigungen bestärkten und sich in seinen nächsten Werken prompt auswirken sollten. Da war dieser lang gezogene elegische Zug, der Sog der Vorhaltsspannungen, da waren die Harmoniefolgen, die trügerisch-verheißungsvollen Sequenzen, die Halbschlüsse, die sich immer ferneren Bezirken öffnen. Das muss Puccini nicht unbedingt erst bei Wagner gelernt haben, aber der „Tristan“ in Bayreuth hat sicher eine Ader berührt, die in ihm selber pochte, 2 und Verdi hat den Braten gerochen. Bevor sich Puccini 1893 in Mailand mit „Manon Lescaut“ als der neue Opern-Souverän Italiens akkreditierte, hatte er seiner Ader schon öfter freien Lauf gelassen und Orchesterstücke geschrieben. 1890 auch einen Streichquartettsatz, er gab ihm den Titel „Crisantemi“ – „Chrysantemen“ und dachte dabei an die Blumen mit den herbstlich und vergänglich lodernden Köpfen. Die „Crisantemi“ sind ein vierstimmiger instrumentaler Trauergesang, komponiert zu nächtlicher Zeit unter dem Eindruck des Todes. Amedeo von Savoyen, Herzog von Aosta, ein Mitglied der königlichen Familie, war gestorben. Aber für einen Puccini bedeutet ein Streichquartett nicht, dass er die Hohe Schule der „absoluten Musik“ reitet. Wenig später bringt er die „Crisantemi“ als Zitat in einer Oper unter, passender Weise im todtraurigen 4. Akt der „Manon Lescaut“. Giacomo Puccini “Crisantemi” (Andante mesto) Hagen Quartett DG 447 069-2, LC 00173 Track 5 8’00” „Crisantemi“, der Streichquartettsatz des 32-jährigen Giacomo Puccini, gespielt vom Hagen-Quartett. Der junge Samuel Barber galt im Jahr 1936 als einer der fortschrittlichen Konservativen Amerikas, die über die Gabe verfügten, beim Publikum sofort Anklang zu finden. Bei einem Aufenthalt in Rom schrieb er seine 1. Sinfonie, dazu ein Streichquartett, eingedenk der Modelle, die die Wiener Klassiker als Erbe hinterlassen hatten. Das belgische Pro-Arte-Quartett brachte das Opus 11 in Rom zur Uraufführung. Mit dem Quartett in seiner Gesamtanlage von drei Sätzen war Barber zuerst nicht ganz glücklich und hat nachgebessert. Ohnehin war es der Mittelsatz, ein Molto adagio, das nicht nur den beiden andere Sätzen, sondern dem ganzen Oeuvre Samuel Barbers noch den Rang ablaufen sollte. Und das lag nicht nur an dem Quartettsatz selbst, sondern an einer Fassung für Streichorchester, die Barber wenig später folgen ließ. Arturo Toscanini hob dieses „Adagio for Strings“ mit den Streichern des NBC-Orchesters in einer Radioübertragung aus der Taufe, machte danach noch eine Schallplattenaufnahme, und wieder war ein Werk auf der Welt, dessen alles überstrahlende Berühmtheit das übrige Schaffen eines Komponisten in den Schatten stellt. Als der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt starb, war Barbers Adagio die Musik, die bei der Rundfunkübertragung der Trauerfeierlichkeiten in den Hörern Stürme der Empfindungen auslöste: diese Elegie in b-moll, die sich über 8 Minuten in langen, geduldigen Fortschreitungen auf einen Höhepunkt zu bewegt und dann wieder resigniert in sich zurücksinkt. Bei dem Erfolg der chorischen Streicherfassung hätte man beinahe vergessen, dass diese Musik aus dem Satz eines Quartetts hervorgegangen war. Samuel Barber Streichquartett op. 11 2. Satz: Molto adagio Tokyo String Quartet BMG/RCA 09026 613867-2, LC 00316 Track 3 8’01“ 3 Das Tokyo String Quartet spielte Barbers berühmtes Adagio in der originalen Fassung, und so war es zuerst, als Mittelsatz des Streichquartetts op. 11, auch gedacht. Humor ist, wenn er zielsicher die Pointe treffen will, eine Sache der Organisation. Der amerikanische Komponist Charles Ives, ganz sicher mit Humor begabt, rechnete zu seinen besten Werken ein Stück für Klavier und Streichquartett, das ganze 18 Takte lang ist und kaum mehr als 2 Minuten dauert. Er nannte es „Hallowe’en“. Hallowe’en: der Abend vor Allerheiligen, da läuft man in Masken und Kostümen herum, entzündet Freudenfeuer, das ausgelassene Treiben mutet chaotisch an und sucht doch seine eigene Ordnung, es ist nicht alles ganz geheuer. Charles Ives organisiert auf engem Raum seine verschiedenen Klangebenen und Tonarten zu einem wimmelnden, schwirrenden Kunterbunt, das sich seines Zieles aber sehr wohl bewusst ist: Plötzlich sind sich die Rhythmen einig, und ehe das Stück vorbei ist, raffen sich die Akkorde in der unverblümtesten aller Tonarten zusammen, in C-dur. Dann folgen noch ein paar polternde Schläge – wer weiß, wann der letzte kommt. Charles Ives “Halowe’en” Leipziger Streichquartett Steffen Schleiermacher, Klavier MDG 307 1143-2, LC 06768 Track 13 2’14” Am Schluss wird’s unheimlich, zwar ist ein zuverlässiges C-dur gewonnen, doch man weiß nicht, was die Schläge bedeuten und wie lange das so weitergeht. Es ist ein Scherz von der Art, wie Haydn ihn am Schluss seines Streichquartetts Es-dur op. 33 Nr. 2 anstellt. Charles Ives nannte sein Zweiminutenstück „Hallowe’en“ und stellte den Ausführenden frei, es nach Belieben zu wiederholen, dann aber in immer schnellerem Tempo. Das Leipziger Streichquartett und Steffen Schleiermacher am Klavier haben sich in unserer Aufnahme mit einem Durchlauf begnügt. Das Werk des Künstlers liegt widersprüchlich im Schnittpunkt von öffentlicher Darstellung und intimem Selbstgespräch, ist sowohl Verlautbarung für Gott und die Welt als auch innerer Monolog, der keinen draußen was angeht. Dimitri Schostakowitsch kam 1960 nach Dresden, um zu einem Film über die im Krieg zerstörte Stadt die Musik zu schreiben. Der Anblick der Verwüstung mag sich mit der traumatischen Erfahrung „Leningrad“ überlagert haben, dem Leid und Leiden der von den Deutschen belagerten, ausgezehrten und doch nicht bezwungenen Heimatstadt. Bevor Schostakowitsch sich auftragsgemäß der Film-Partitur zuwandte, brachte er seine Erschütterung vorab in einem Streichquartett zum Ausdruck, in seinem Quartett Nr. 8 in c-moll. Schon diese Vierer-Konstellation konnte ihren Drang zu expandierender Klangfülle nicht verhehlen. Der Bratschist und Dirigent Rudolf Barshai hatte dem Komponisten bereits mit seiner Orchestrierung und Komplettierung von Bachs „Kunst der Fuge“ imponiert. Jetzt durfte er einige der Streichquartette von Schostakowitsch zu „Kammersinfonien“ umarbeiten, darunter auch jenes in Dresden entstandene in c-moll. Die Tonfolge D-Es-C-H, die Initialen des Namens Dimitri Schostakowitsch, zieht ihren roten Faden bindend durch alle 5 Sätze, jenem magischen Siegel B-A-C-H absichtsvoll ähnlich, dessen Abwandlung es ja auch ist. Barshai in seiner Bearbeitung fächert das Spektrum des reinen Streicherklangs so komplex und extrem wie möglich auf. Er vertieft das Bassfundament durch Kontrabässe, lässt einzelne Gruppen in zwei- und dreifacher 4 Teilung spielen, weist der Violine oder dem Cello solistische Rollen zu, verschärft die Gegenüberstellung von Soli und Tutti. Im 4. Satz, einem Largo, bringt das Solo-Cello in hoher Lage und in der unerwarteten Tonart Fis-dur ein Zitat aus der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, eine Kantilene der Hauptfigur Katerina - ein eindringlicher Lichteffekt im Dämmer des vorherrschenden c-moll. Dimitri Schostakowitsch Kammersymphonie op. 110a 4. Satz: Largo The Chamber Orchestra of Europe Ltg.: Rdolf Barshai DG 429 229-2, LC 00173 Track 4 5’31“ Das Streichquartett Nr. 8 c-moll von Dimitri Schostakowitsch, umgewandelt zur Kammersinfonie für Streicherchor durch Rudolf Barshai. Barshai war in dieser Aufnahme auch der Dirigent des Chamber Orchestra of Europe, zu hören war der 4. Satz, Largo. Eine Zeppelinreise kann musikalische Spuren hinterlassen. Am 14. November 1919 flog das Leipziger Gewandhauquartett im Zeppelin von Berlin nach Friedrichshafen am Bodensee. Oben in der Luft und der Erdenschwere ein wenig enthoben, kam der zu seiner Zeit legendäre Gewandhauscellist Julius Klengel auf den Gedanken, einen „Hymnus“ für einen Chor von 12 Celli zu schreiben. Dieser „Hymnus“ op. 57, gedacht als Hommage an den Gewandhauskapellmeister Arthur Nikisch, wurde für kurze Zeit sehr berühmt. Klengel stand mit seiner Idee nicht allein da. Der Katalane Pablo Casals, auch einer der überlebensgroßen Erzväter der Cellokunst, sollte noch von einem richtigen Sinfonieorchester träumen, das nur aus Celli bestand. Keine Absurdität: Der Ton des Cellos ist wie kein anderer der Schwingung der menschlichen Stimme verwandt, vielleicht auch dem Pulsieren des Herzens. 1956 versammelte sich im Grand Amphithéatre der Sorbonne in Paris ein Ensemble von 110 Cellisten, um den 80. Geburtstag des Großmeisters zu feiern, 1990 im Théatre des Champs-Elysées waren es dann sogar 133, die Casals ein Gedenkkonzert widmeten. Kommen wir auf das von Julius Klengel beabsichtigte Originalmaß zurück. 12 Cellisten des Leipziger Gewandhausorchesters spielen jetzt seinen Hymnus op. 57. Julius Klengel “Hymnus” für 12 Violoncelli op. 57 12 Cellisten des Gewandhausorchesters Leipzig mdr KULTUR 88033/2, LC – CD II, Track 11 6’09“ 12 Cellisten des Gewandhausorchesters Leipzig spielten den „Hymnus“ op. 57 aus der Feder eines ihrer Vorgänger, des einstigen Gewandhauscellisten Julius Klengel. Ohne Klengel hätte es vielleicht nie die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker gegeben - Mitglieder des Orchesters natürlich, aber auch eine renommierte Extratruppe für sich, die nur die logistische Meisterleistung zu vollbringen hat, ihre individuellen Reisepläne mit den übergeordneten philharmonischen Pflichten in Einklang zu bringen. Im März 1972 fragte ORF Salzburg bei den Berlinern an, ob ihre Cellogruppe vielleicht für eine Radio-Produktion des Klengelschen „Hymnus“ zur 5 Verfügung stünde. Im Salzburger Mozarteum schlug die Geburtsstunde „der Zwölf“, und schon auf dem Rückflug stellte man Überlegungen an, wie dem gelungenen Experiment Dauerhaftigkeit zu verleihen und ein breiteres Repertoire anzulegen wäre. In mittlerweile 36 Jahren ist dem philharmonischen Dutzend keine Musiksprache der Welt mehr fremd, und das Repertoire erstreckt sich in feinster Crossover-Manier von Horizont zu Horizont. Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker spielen das Evergreen „Tea for Two“ aus dem Musical „No, no, Nanette“ von Vincent Youmans. Vincent Youmans/arr. Michail Tsygutkin „Tea for Two“ 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker EMI 5 57789-2, LC 06646 Track 5 3’11” 6