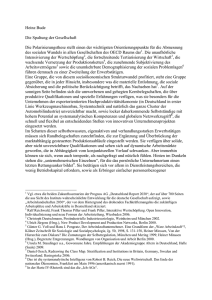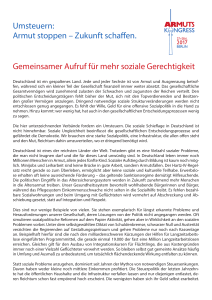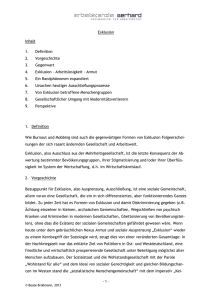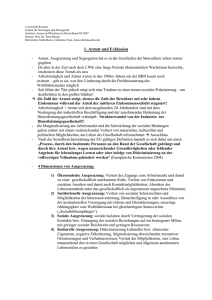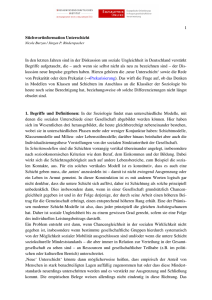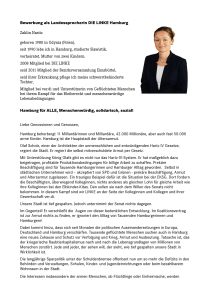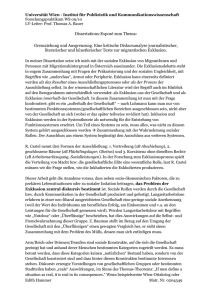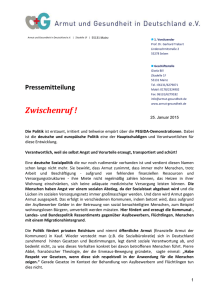Irene Kühnlein, Gerd Mutz Neue Prozesse der Prekarisierung und
Werbung

Irene Kühnlein, Gerd Mutz Neue Prozesse der Prekarisierung und Exklusion – Eine Herausforderung für die Psychotherapie In den vergangenen 20 Jahren haben sich die sozialen Strukturen unserer Gesellschaft einschneidend verändert: Es werden neue Formen der Prekarisierung von Lebenslagen und Exklusionen beobachtet, Arbeitslosigkeits- und Armutsprozesse haben sich dynamisiert. Sozialwissenschaftler befürchten, dass sich neben den gut integrierten Menschen in der gesellschaftlichen Mitte und den Randzonen, also zwischen dem Drinnen und Draußen, ein neues Prekariat herausbildet und sprechen deshalb schon von einer Neuen Sozialen Frage und von einer Drei-Drittel-Gesellschaft. Dabei wird darauf hingewiesen, dass sich die Wirkmechanismen in der Gesellschaft verändert haben, also auch von einem deutlich spürbaren Wandel im Inneren der Gesellschaft auszugehen ist. Genannt werden Flexibilisierung der Arbeitswelt und damit „blockierte“ Inklusionsmodi im Erwerbsbereich, Individualisierung der Lebensgestaltung und somit Auflösung von sozialen Nahbeziehungen sowie Umbrüche in den sozialen Beziehungen und Teilhabemöglichkeiten. Gleichzeitig hat durch die Reformen der frühen 2000er Jahre ein Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik stattgefunden: Das frühere vor- und fürsorgende Verständnis wird abgelöst durch eine gewährleistende Politik der Exklusionsvermeidung. Sie führt zu einer Verschärfung, nicht aber zu einer Abdämpfung von Prekarisierungstendenzen. Die neue Politik des Forderns und Förderns reduziert die Menschen auf ihre bloße Arbeitskraft, welche sie nun unter allen Umständen, egal unter welchen Arbeits- und Lebensbedingungen, einsetzen sollen, um eigenverantwortlich für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Risiken der Arbeitswelt und der Lebensführung werden privatisiert. Auf der individuellen Ebene korrespondieren dazu Erfahrungen der sozialen Unsicherheit: eingeschränkte Lebensplanungen, Abstiegs- und Zukunftsängste oder das Gefühl der Nutz- und Chancenlosigkeit. Man kann von einer neuartigen „Ökonomie der Unsicherheit“ sprechen, die die alltägliche Lebensführung dominiert; negative Individualisierungen erschweren eine gelingende Identität. Die Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden sind dramatisch: Ängste und Depressionen, selbst bei Jugendlichen, steigen an und in der ambulanten psychotherapeutischen Praxis sind längst nicht mehr nur gut situierte Klienten der Mittelschicht zu finden, sondern auch Personen, die von Prekarisierung bedroht oder bereits exkludiert sind: überforderte alleinerziehende Mütter, Heranwachsende mit Zukunftsängsten, Menschen mit Migrationshintergrund oder Zuwanderer. Dies verändert die psychotherapeutische Praxis in vielfältiger Weise, weil beratende Elemente und konkrete Hilfestellungen zur Bewältigung der gesellschaftlichen Veränderungen eine größere zusätzliche Rolle spielen. Die Psychotherapie steht dabei vor der Herausforderung, nicht nur auf innerpsychische Vorgänge einzuwirken, sondern das soziale Umfeld und kulturelle Besonderheiten mit einzubeziehen und darauf aufbauend ressourcen- und kompetenzorientiert das Selbstvertrauen in die eigenen sozialen und psychischen Kräfte sowie Autonomieprozesse zu stärken – ohne jedoch unmittelbar auf die krankmachenden Arbeits- und Lebensbedingungen einwirken zu können. Deshalb sind alle Angehörigen sozialer Berufe gefordert, sich stärker mit den Folgen des Umbaus der Arbeitsgesellschaft zu beschäftigen und sich für „gute Arbeit“ und eine das Soziale gestaltende Sozialpolitik zugunsten individueller Verwirklichungschancen einzusetzen. 1. Neue Prekarisierungs- und Exklusionstendenzen In den Sozialwissenschaften sind unzählige Armutsstudien und theoretische Erklärungen sowie sehr unterschiedliche Definitionen und Abgrenzungskriterien zu Armuts- und Prekarisierungstendenzen zu finden (für einen Überblick vgl. Dietz 1997 und LudwigMayerhofer 2001). Sie reichen von sehr einfachen Definitionen der üblichen Sozialhilfestatistiken (arm ist, wer öffentliche Leistungen erhält) bis hin zu komplexen, theoretisch gut fundierten Lebenslagen- und Lebensphasenkonzepten, die kaum noch empirisch zu operationalisieren sind. Einig ist man sich in der heutigen Diskussion, dass nicht nur geringes Einkommen ein Merkmal von Armut ist, sondern dass vielmehr ein komplexes Bündel individueller und gesellschaftlicher Faktoren bzw. unterschiedliche Ursachentypen ineinander greifen und es in zentraler Weise auf den Grad der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen ankommt. Zu den sich wechselseitig verstärkenden multidimensionalen Deprivationsaspekten zählen Arbeit, Bildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit, Erholung sowie ebenso soziale, politische und kulturelle Teilhabe. Unstrittig ist inzwischen in Theorie und Forschung, dass Armut kein Randgruppenphänomen ist, sondern dass Prekarisierungs- und Exklusionsrisiken in der Bevölkerung relativ breit gestreut sind. Es hat sich im Anschluss an die Verzeitlichungsthese auch durchgesetzt, nicht nur mehr von Armut oder die Armen, sondern von Armuts-, Desintegrations-, Prekarisierungs- oder Ausschlussprozessen zu sprechen. 1.1 Dynamische Arbeitslosigkeit und Armut – stabile Diskontinuitäten Um die Entwicklung neuer Prekarisierungs- und Exklusionstendenzen zu verstehen, ist es aufschlussreich, einen Blick in die frühen Arbeitslosigkeits- und Armutsstudien der 1980/90iger Jahre zu werfen. In diesen Untersuchungen gab es erste Hinweise auf sich verändernde Prozesse sowohl im Kern als auch am Rand der Gesellschaft. Bereits Ende der 1970er Jahre zeichnete sich der einschneidende Wandel in der Arbeitswelt ab. Soziologen diskutiert 1983 auf dem Soziologiekongress die „Krise der Arbeitsgesellschaft“ (Matthes 1983). Namhafte Sozialwissenschaftler, wie etwa Dahrendorf und Offe, debattierten Ursachen und Folgen dieses Umbruchs und gingen in 2 Anlehnung an Hannah Arendt der Frage nach, wie sich eine Arbeitsgesellschaft entwickeln würde, wenn ihr die Arbeit ausginge: „Was uns bevorsteht ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht" (Arendt 2002; Erstausgabe 1958, 12). Die Ursachen wurden – noch unter dem Eindruck des Ölpreisschocks 1973 – darin vermutet, dass sich einerseits die Rohstoffe stetig verteuerten und damit Wachstumsgrenzen erreicht sein könnten (Club of Rome 1972: „Limits of Growth“). Andererseits entstanden Zweifel, ob die bis dahin als selbstverständlich angenommenen „Marktgesetze“ noch gültig seien. Skepsis bestand insbesondere darin, ob die Formel „Wirtschaftswachstum schafft Beschäftigung“ überhaupt noch zutreffend sei. Ein wichtiger empirischer Beleg für diese Vermutungen waren die „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“ (Mückenberger 1985) und eine stetig steigende Arbeitslosigkeit (Bonß & Heinze 1984: "Arbeit, Lohnarbeit, ohne Arbeit“). Zwar stellte die unbefristete Vollzeitbeschäftigung noch die weitaus häufigste Erwerbsform dar, aber so genannte atypische Beschäftigungen, insbesondere in Form von Befristungen und Teilzeitarbeit nahmen bereits deutlich zu. Vor diesem Hintergrund entstanden die ersten umfassenden Arbeitslosigkeitsstudien und Untersuchungen von Erwerbsverläufen. 1 Einige dieser Studien, etwa der Müncher Forschungsgruppe um Wolfgang Bonß, Klaus Eder, Elamar Koenen, Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und Gerd Mutz (Mutz et al. 1995), führten im Hinblick auf neue Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse zu interessanten Ergebnissen: Während in den 1980er Jahren Arbeitslosigkeit für die Mehrzahl der Erwerbspersonen entweder ein kurzfristiges, einmaliges Ereignis darstellte (transitorische Arbeitslosigkeit) oder in wenigen Fällen zu einem Ausschluss aus dem Beschäftigungssystem führte (Langzeitarbeitslosigkeit und drohende Exklusion), trat damals bereits eine kleine Gruppe in Erscheinung, für die sich Arbeitslosigkeit häufig wiederholte (dynamische Arbeitslosigkeit). Es zeigte sich das Phänomen diskontinuierlicher Erwerbsverläufe und es erschien eigentümlich, dass man diese Lage des ständigen Wechsels als stabil bezeichnen konnte. Damals wurde von „stabilen Diskontinuitäten“ gesprochen. Es zeichnete sich eine noch recht unspezifische und kaum exakt beschreibbare „Gemengelage des Dazwischen“ ab, von der nicht nur bestimmte Berufs- oder Risikogruppen betroffen waren; „Unsicherheit“, so die damalige Schlussfolgerung, „verbreitet sich auch im Kern der Beschäftigung und es können alle Erwerbspersonen betroffen sein“ (Mutz 1997, 7). Einen ähnlichen Untersuchungsansatz verfolgte später die Bremer Forschungsgruppe um Stefan Leibfried mit der dynamischen Armutsforschung (Buhr & Leibfried 1993; Leibfried & Voges 1992; Leibfried & Leisering 1995; Leibfried et al. 1995). Sie kamen zu vergleichbaren Ergebnissen und sprachen analog von einer Dynamik von Armutsverläufen. Erstens wurde festgestellt, dass die Wege in die Armut vielfältig geworden waren, zweitens variierten Anzahl und Dauer der Armutsphasen bei den betreffenden Personen sehr stark. Drittens wurde nachgewiesen, dass die Mehrzahl der 1 Bei den zuvor durchgeführten Studien handelte es sich entweder um deskriptiv-statistische Analysen oder um Forschungen zu dem Personenkreis der Arbeitslosen, nicht jedoch zu der Struktur der Arbeitslosigkeit; stark rezipiert wurden auch eher sozialpsychologische Forschungen, siehe prominent: Kieselbach/ Wacker 1987; Wacker 1983. 3 Betroffenen nicht in der Armut verblieb, sondern dass es auch Wege aus der Armut gab: Beobachtet wurden unterschiedliche „Karrieretypen“ (Ludwig 1992). Die These war, dass die Grenzen zwischen Armut und Nichtarmut zunehmend verschwimmen (vgl. Buhr 1998). Später kam die Überlegung hinzu (vgl. Böhnke & Delhey 1999), dass es sich auch bei Armutsprozessen um „Statuspassagen“ handele: Es gehöre zum Erscheinungsbild moderner Armutsprozesse, dass Menschen aufgrund bestimmter Ereignisse für einen begrenzten zeitlichen Abschnitt arm sein könnten, sich dann aber wieder aus dieser Situation befreiten (vgl. ebd. 1999, 6). Diese Untersuchungen haben deutlich gemacht, dass nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern auch Armut in der Zeitdimension und damit in ihrer Prozesshaftigkeit zu sehen sind, weshalb seit dem von einer „Verzeitlichung“ sozialer Ungleichheit ausgegangen wird (vgl. Berger 1990, Leisering 1993). Aus diesem Grund sei es treffender, von Arbeitslosigkeitsund Armutsprozessen zu sprechen (vgl. die Beiträge in Berger & Sopp 1995). In diesen Prozessen verbleiben immer mehr Menschen in einem relativ stabilen „Zwischenraum“ (Mutz 1995). 1.2 Prekäre Zwischenzone(n) Die heutigen Diskussionen über das neue Phänomen einer Prekarisierung wurden seit dem Jahr 2000 maßgeblich von den Arbeiten des französischen Sozialwissenschaftlers Robert Castel beeinflusst. Er hat ein analytisches Gerüst zu gesellschaftlichen Kern-, Rand- und Prekaritätszonen entworfen und den Begriff der „Zone der Verwundbarkeit“ geprägt. Castel beschreibt die gesellschaftliche Struktur nicht als ein Oben-Unten, sondern folgt – von Bourdieu beeinflusst – der Vorstellung eines sozialen Raums, dessen Kern eine „Zone der Integration“ bildet; am Rand befindet sich die „Zone der Entkopplung“, dazwischen schließlich liegt die „Zone der Prekarität/Verwundbarkeit“ (Castel 2000). Im Kern sichern überwiegend stabile Normalarbeitsverhältnisse die gesellschaftliche Integration, die allerdings ebenfalls zunehmend gefährdet sei; Castel spricht von einer „Destabilisierung der Stabilen“ (2000, 357). In der entkoppelten Zone haben sich – etwa durch Langzeitarbeitslosigkeit verursachte – Desintegrations- und Exklusionsprozesse bereits verfestigt. Dazwischen liegen prekäre Beschäftigungsstrukturen: Unterbeschäftigung und instabile Beschäftigungsverhältnisse, wie z.B. Zeit- und Leiharbeit, abhängige Selbständigkeit, gewisse Formen der Teilzeitarbeit oder auch Beschäftigungen im Niedriglohnbereich. In dieser prekären Zwischenzone sind zudem auch jene Personengruppen, die durchaus wertschöpfend und produktiv arbeiten – aber eben nicht über das Erwerbsarbeitssystem integriert sind: insbesondere Formen des Caring, aber auch private Eigenarbeit oder Bürgerengagement. Derartige Tätigkeiten, so Castel, sicherten nicht den Lebensunterhalt und bewirkten keine Integrationsprozesse in Richtung Kernzone. 4 Zone der Integration Zone der Prekarität Zone der Entkopplung Abbildung 1: Eigene Darstellung, Castels Zonen des sozialen Raums Castel beschreibt diese Entwicklung als „Metamorphosen der sozialen Frage“ (so auch der Buchtitel) und behauptet die Entstehung einer Neuen Sozialen Frage, die zu besonderen Formen sozialer Unsicherheit führe. Er sieht in den hoch entwickelten Arbeitsgesellschaften einen Trend zur zweifachen Spaltung, die die Vorstellung von einer einfach gespalteten Gesellschaft – die Zweidrittelgesellschaft – ablösen würde. Dabei gebe es zwei Sachverhalte, die derartige Prozesse ausgelöst hätten: Die zunehmende Marginalisierung Vieler am Arbeitsmarkt und die damit verknüpfte allgemeine Schwächung sozialer Beziehungen und Netzwerke. Im Anschluss an Castel haben in Deutschland Klaus Dörre und Mitarbeiter der Universität Jena Untersuchungen zum Prekariat aus beschäftigungsorientierter Perspektive vorgelegt und das Instrumentarium zur Analyse prekärer Lebenslagen verfeinert. Sie weisen in ihrer empirischen Studie erstmalig nach, dass sich auch in der Bundesrepublik Deutschland prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse durchgesetzt haben (Brinkmann et al. 2006; Dörre et al. 2003; Dörre 2003; 2006). Sie grenzen den Bereich der Exklusion präziser von der Zone der Prekarität ab und unterscheiden in der „Zone der Entkopplung“ die „überwindbare“ und die „kontrollierte“ Ausgrenzung. Im ersten Bereich sei Veränderung möglich, im zweiten seien die Personengruppen bereits „abgehängt“ (Brinkmann et al. 2006, 55). Auf der subjektiven Ebene seien „Sinnverluste, soziale Isolation, Statusunsicherheit sowie Anerkennungsund Planungsdefizite“ (Dörre 2005, 3) zu beobachten. Wie Castel sind auch sie der Ansicht, dass soziale Unsicherheit in die reichen westlichen Gesellschaften zurückkehre – so auch in die Bundesrepublik Deutschland. Zone der Prekarität Zone der Zone der 5 Integration Entkopplung Abbildung 2: Eigene Darstellung, Schnittmengen im sozialen Raum 1.3 Inklusions- und Exklusionsprozesse Mit Inklusions- und Exklusionsprozessen haben sich in jüngster Zeit die Soziologen Martin Kronauer und Heinz Bude/ Andreas Willisch sowie Berthold Vogel beschäftigt. Kronauer beschreibt Inklusions- und Exklusionsprozesse im Hinblick auf Erwerbsarbeit, soziale Beziehungen und gesellschaftliche Teilhabe und unterscheidet dabei drei Ebenen (vgl. Kronauer 2002; 2006): - Im Hinblick auf die Erwerbsarbeit droht Marginalisierung oder gar vollständige Exklusion, wenn Desintegrationsprozesse am Arbeitsmarkt greifen und keine Statusalternativen vorhanden sind (Ausbildung, Haushaltstätigkeiten, Ruhestand). Prekäre Arbeitsverhältnisse können, müssen aber keine Ausgrenzungsprozesse auslösen. 2 - Die zweite Exklusionsebene bezieht sich auf die Schwächung von sozialen Beziehungen und Bindungen, also eine Verringerung des sozialen Kapitals. - Auf der dritten Ebene geht es schließlich um mangelnde Beteiligungsmöglichkeiten in Bereichen Politik oder Kultur und Zugang zu (sozialen) Bürgerrechten. Diese Differenzierung von Exklusionsebenen geht über die bislang immer noch starke Fokussierung auf den Erwerbsbereich hinaus und betont die Bedeutung von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Teilhabe. Damit wird die Vielschichtigkeit von Exklusionsprozessen und damit das Ineinandergreifen von Prekarität und Ausgrenzung deutlich. Es ist darüber hinaus das Verdienst Kronauers, dass neben der Ebenendifferenzierung auf einen besonderen Sachverhalt hingewiesen wird: Er versteht Exklusion als einen Prozess, der auf die Wirkmechanismen in der Gesellschaft verweist. „Denn die Umbrüche der Erwerbsarbeit, die Veränderungen wohlfahrtsstaatlicher Regulierung und der Wandel sozialer Beziehungen, die sich in zugespitzter Form in der Exklusion bemerkbar machen, durchdringen in unterschiedlichen Manifestationen das gesellschaftliche Leben insgesamt“ (ders. 2007, 8). Exklusionsprozesse haben in der Gesellschaft ihren Ausgangspunkt und somit geht es folglich nicht nur um ein Verständnis der Ausgrenzungs- sondern insbesondere auch der Inklusionsprozesse; das Konzept der Exklusion „zwingt, vom Rand her ins gesellschaftliche Zentrum vorzudringen (ders. 2006, 30, Herv.i.O.). 3 Somit müsse man sich von der Vorstellung verabschieden, „die Welt der Ausgegrenzten sei eine 2 Auch Bartelheimer stellt dazu fest: „Nicht jedes atypische Beschäftigungsverhältnis ist zugleich prekär, und auch das subjektive Empfinden von Prekarität unterscheidet sich z.B. bei Männern und Frauen erheblich“ (1998, 165). 3 „Heute, unter den Bedingungen universalisierter Normen, intern verallgemeinerter Bürgerrechte und transnationaler Marktbeziehungen, muss Ausgrenzung mehr denn je als Ausgrenzung in der Gesellschaft begriffen werden. Sie setzt den Anspruch oder die formale Berechtigung zur Zugehörigkeit geradezu voraus – ohne dass dieser Anspruch eingelöst würde. Weniger der Ausschluss aus Institutionen als die Ausgestaltung der Institutionen selbst …, die Ausgestaltung der institutionellen Inklusion – ist heute für den Verlust von realer Teilhabe entscheidend“ (ebd., 10; Herv.i.O.). 6 Gegenwelt zur eigenen“. Vielmehr ginge es darum, „die Gleichzeitigkeiten des ‚Drinnen’ und ‚Draußen’ zu erkennen. Die Ausgegrenzten sind Teil der Gesellschaft, auch wenn sie nicht an ihren Möglichkeiten teilhaben (ders. 2006, 10; Herv.i.O.). Mit dieser Ansicht überwindet Kronauer das typische Randgruppenkonzept von Armut; für ihn ist Exklusion keine individuelle Lage, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis (ders. 2002) – das Risiko ist dabei höchst ungleich verteilt (vgl. bereits: Kronauer & Vogel 1998). Auch Bude betont die Dimension der Teilhabe und verknüpft diese mit der individuellen Ebene von Statuserfahrungen: „Weil diese Entwicklungen die gesamte Gesellschaft durchziehen, gibt es für immer mehr Leute nicht nur eine Frage sozialer Selbsteinstufung, nämlich die von oben und unten, sondern auch noch die Frage von drinnen und draußen. Das heißt, über die Frage von oben unten, die es natürlich nach wie vor gibt, die man auch relativ gut messen kann, legt sich die Frage von drinnen und draußen, also wer gehört dazu und wer nicht“ (Bude 2004, 2-3; siehe auch: Bude, Lantermann 2006; Bude & Willisch 2006). Mit der Fokussierung auf „Drinnen-DraußenErfahrungen“ wird eine weitere Ebene von Exklusionsprozessen thematisiert, die das Oben-Unten gewissermaßen überlagert. Bude kritisiert an der gängigen Verwendung des Exklusionsbegriffs, dass diesem zumeist die Vorstellung von „Ghettos“, „sozialen Brennpunkten“ oder „Teufelskreisen der Benachteiligung“ zu Grunde liege. Der gängige Exklusionsbegriff „unterstellt eine Welt der Chancen und der Berücksichtigung auf der einen und eine Welt des Ausschlusses und der Ignorierung auf der anderen Seite“ (Bude, 2004, 4). Exklusion stellt im Sinne Budes vielmehr einen abstrakten Sammelbegriff für verschiedene Formen gezielter Ausgrenzung, funktionaler Ausschließung und existenzieller Überflüssigkeit dar, „die eine Spaltung der eingelebten Sozialstruktur mit sich bringt“ (Bude & Willisch 2006, 10). Wenn wir diese Studien zu Exklusionsprozessen zusammenfassen, so werden die Anschlüsse insbesondere zu Castels Analysen von neuen Prekarisierungstendenzen deutlich. Die genannten Autoren greifen Prozesse im „Zentrum“ auf und beschreiben von dort aus Exklusionsgefährdungen im Bereich der Erwerbsarbeit, des sozialen Gefüges und der Teilhabe. Die Vorstellung von Zentrum und Peripherie wird durch ein bipolares Drinnen und Draußen ergänzt, das als ein ausdifferenziertes und heterogenes „Ungleichheitsspektrum“ (Bude) beschrieben wird. Im Unterschied zu Castel oder Dörre und Mitarbeitern sehen Bude, Kronauer und Willisch jedoch dazwischen keinen ausgezeichneten sozialen Raum mit charakteristischen Merkmalen. 1.4 Ein Konzept zur Analyse neuer Prekarisierungs- und Exklusionsprozessen Um Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse theoretisch soziologischer Sicht folgendermaßen argumentiert werden: zu erfassen, muß aus (1) Festzuhalten ist zunächst eine Flexibilisierung in der Arbeitswelt und der Arbeitsverhältnisse selbst. Dies führt zu einer Verdichtung der Arbeitsprozesse einerseits und zu einer Pluralisierung der Arbeitsverhältnisse andererseits. Dabei ist umstritten, ob man bereits von einer Erosion der industriell geprägten Normalarbeitsverhältnisse 7 sprechen kann oder deren erstaunliche Stabilität konstatiert – dies ist eine Frage der jeweiligen Perspektive („das Glas ist halb leer oder halb voll“). Eindeutig ist jedoch, dass gerade auch in den noch relativ stabilen Kernbeschäftigungslagen Arbeitsverdichtungen zu beobachten sind, und dass sich neben den Normalarbeitsverhältnissen eine „bunte Vielfalt“ (Beck) von diskontinuierlichen Beschäftigungsformen entwickelt hat. 4 (2) Des Weiteren, und dies bleibt in fast allen herkömmlichen Armutsstudien unberücksichtigt, hat sich der bereits seit Jahrzehnten beobachtbare Prozess der Individualisierung von Lebensgestaltungen fortgesetzt, der zu einer Ausdifferenzierung und damit Pluralisierung von Lebensgemeinschaften geführt hat; gemeint sind hier in erster Linie die traditionelle Familie und andere Formen von Lebensgemeinschaften. Sie sind ebenso diskontinuierlich geworden wie Erwerbsverhältnisse. Parallel zur Arbeitswelt – und dies ist für Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse neu – kann ebenfalls von einer Destabilisierung von Familien und Lebensgemeinschaften gesprochen werden. Zusätzlich kann von einer erweiterten Stufe der „Arbeitsmarktindividualisierung“ (Beck 1986) gesprochen werden, denn auch die Erwerbswünsche der Erwerbspersonen haben sich ausdifferenziert und damit pluralisiert; ein Wandel von Erwerbsorientierung und zentrierung ist die Folge (Mutz et al. 1997). Die Ansätze von Castel und Dörre erweisen sich in dieser Hinsicht als zu einseitig auf die Arbeitswelt bezogen. (3) Erst diese veränderten und teilweise „blockierten“ Integrationsmodi in der Arbeitswelt und in Lebenspartnerschaften des sozialen Nahbereichs führen – so unsere These – zu dem von Kronauer beschriebenen allmählichen Abbau sozialer Beziehungen. 5 An dieser Stelle ist Putnams Unterscheidung von „bonding“, „linking“ und „bridging social capital“ hilfreich: 6 Wenn sich im Kern der Gesellschaft, wie oben beschrieben, die Integrationsmodi einschneidend verändern, dann reduzieren sich zunächst die sozialen Beziehungen im engen sozialen Umfeld (zu Nachbarn, Freunden, Bekannten), aber dann insbesondere auch zu anderen Hierarchieebenen (insbesondere zu Bürokratie und Verwaltung – „Ämter“) sowie zu anderen Stadtvierteln, Milieus oder Gruppen der Gesellschaft. (4) Eine allmähliche Abnahme des sozialen Kapitals wiederum reduziert gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten, nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch politischer, sozialer oder kultureller Art. Eine bedeutsame Rolle spielen hier wirksame Zugangschancen, nicht nur zur Arbeitswelt, sondern ebenfalls zu solchen sozialen Netzwerken, die Teilhabe erst ermöglichen. Es ist unmittelbar einsichtig, dass diese vier Dimensionen zusammen- und rückwirken, sich also gegenseitig verstärken und „aufschaukeln“ und zu einer „kumulativen Entbindung“ (Bude) führen; der soziale Zusammenhalt schwindet und verliert an sozialer 4 Einerseits kann gezeigt werden, dass die absolute Zahl von Normalarbeitsverhältnissen in den vergangenen 30 Jahren stabil geblieben ist; andererseits ist gleichzeitig die absolute Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse deutlich gestiegen, weshalb insgesamt der Anteil von Normalarbeitsverhältnissen kontinuierlich zurückgegangen ist (Hacket et al. 2001; Schmidt 2000). 5 Zum Einfluß sozialer Unsicherheit auf die „Tragfähigkeit“ sozialer Nahbeziehungen vgl. Diewald 2003 und zur Rolle von sozialen Beziehungen als „mögliche infrastruktur“ siehe ders. (1991,78). 6 „Bonding“ beschreibt soziale Beziehungen zu „Gleichgesinnten“ auf horizontaler Ebene, „Linking“ vertikale Kontakte zu höheren Hierarchieebenen und bei „Bridging“ geht es um überbrückende soziale Beziehungen etwa über Milieugrenzen hinaus (vgl. Putnam 2000; Woolcock 2001). 8 Dichte. Ähnliche Zusammenhänge sind bereits in vielen Armutsstudien empirisch belegt worden. Die theoretische Klammer bilden Individualisierungsprozesse, die zu spezifischen Prekaritäts- und Entkopplungslagen führen (zur sozialen Lage vgl. Hradil 1987). Hierbei handelt es sich um Momente „objektiver“ sozialer Gefährdungen, die auf der „subjektiven“ Ebene zu sozialer Unsicherheit, also wie Bude beschreibt, zu einem Prekaritäts- und Entkopplungsempfinden führen können. Bezug nehmend auf Kronauer ist hinzuzufügen, dass Individuen gesellschaftliche Normen akzeptiert und verinnerlicht haben müssen, um sich ausgegrenzt fühlen zu können. Scheiternserfahrungen, Ohnmachtsgefühle oder das Empfinden von Chancen- und Machtlosigkeit sowie Zukunftsängste haben ihren Bezugspunkt in der Gesellschaft. Es ist schließlich eine Frage der individuellen (materiellen, sozialen und psychischen) Ressourcen und Kompetenzen, die, biographisch erworben, sehr ungleich verteilt sind (vgl. Vogel 2006). Deshalb kommt es zu sehr verschiedenen Formen des Gefährdungsmanagements und die „alltägliche Lebensführung“ (vgl. etwa: Voß 1995) weist eine zwar eingeschränkte, aber gestaltbare Variabilität auf. Besonderes Merkmal dieser modernen objektiven Gefährdungslagen ist nicht nur ihre Mehrdimensionalität, sondern insbesondere eine bislang nicht gekannte Komplexität, die kaum die notwendige Reflexion der eigenen Lage erlaubt. Die gesellschaftlichen Anforderungen einer „Reflexiven Moderne“ (Beck et al. 2004, Beck & Holzer 2004) und ihrer neuartigen „Politischen Ökonomie der Unsicherheit“ können immer weniger mit den vorhandenen traditionellen individuellen Ressourcen und Kompetenzen bewältigt und „normalisiert“ werden (Mutz et al. 1995). Das Leben wird zu einem offenen Projekt. Eine „gelingende Identität“ wird Aufgabe alltäglicher Lebensbewältigung – hierauf hat der Sozialpsychologe Heiner Keupp in vielen seiner Schriften hingewiesen (vgl. z.B. Keupp 2004). Die in empirischen Studien beobachteten Bastel- und Patchworkbiographien (Hitzler; Keupp) beruhen allerdings weniger auf autonomen Lebensentwürfen; sie sind vielmehr Ausdruck dieser „gefühlten gesellschaftlichen Ungleichheit und Unsicherheit“ (Vogel 2006, 345) und stellen allenfalls einen kreativen Umgang mit „negativen Individualisierungen“ dar. Dabei ergeben sich beachtliche Unterschiede, ob sich Menschen in einer prekären oder entkoppelten Lebenslage befinden und wie sie diese bewältigen können (siehe weiter unten). Prekarität bedeutet, dass es immer wieder möglich ist, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder Lebensgemeinschaften einzugehen und dass damit der Verbleib in dieser sozialen Lage möglich ist. Prekäre Beschäftigungssituationen sind durch diskontinuierliche Erwerbstätigkeiten gekennzeichnet („dynamische Arbeitslosigkeit“), eine solche soziale Lage (mal beschäftigt, mal arbeitslos) kann durchaus relativ stabil sein („stabile Diskontinuität“). Die persönliche Lebenssituation etwa von Alleinerziehenden oder gering Verdienenden kann in hohem Maße prekär sein, obwohl sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen, die aber keine ausreichende materielle Absicherung 9 gewährleistet 7 - und es gilt festzuhalten, dass es selbst den „Mittelklassen … an ihren weißen Kragen geht“ (Kronauer 2006, 27). Entkoppelung ist eher gleichzusetzen mit Langzeitarbeitslosigkeit und relativ andauernde Exklusion aus dem Beschäftigungssystem. Kennzeichen prekärer Strukturen in Familie und Lebensgemeinschaften sind temporäre Diskontinuität und zugleich gelegentliche Stabilität. Entkoppelte haben charakteristischerweise kaum noch Aussichten, der Exklusion zu „entkommen“, weil die notwendigen Zugänge (assets) verschlossen sind. Entkoppelung in den persönlichen Nahbeziehungen bedeutet eine soziale Isolation, die stabile Partnerschaften erschwert. In einer prekären sozialen Lage gibt es meist noch ein relativ dichtes soziales Beziehungsgeflecht, also „bonding social capital“, das sich aber als so geschlossen erweist, dass es die Personen an diese soziale Lage bindet und somit zu einem allmählichen Abbau von „linking“ und „bridging social capital“ führt. Dem entsprechend ist die soziale, kulturelle oder politische Teilhabe in einer prekären Lebenssituation zwar eingeschränkt, aber immerhin so umfassend, dass es das geringe soziale Kapital stabilisiert. Eine entkoppelte soziale Lage ist dem gegenüber gekennzeichnet durch ein insgesamt wenig dichtes und instabiles Beziehungsgeflecht, das den sozialen Zusammenhalt brüchig werden lässt. 8 Auf der individuellen Ebene geht es um die Erfahrung dieser „um sich greifenden Mikroturbulenzen“ (Bude & Willisch 2006, 11): Im Anschluss an Dörre und Mitarbeiter kann für die Zone der Integration das Gefühl der Statusunsicherheit festgestellt werden. In der Prekarität sind individuelle Ressourcen und Kompetenzen vorhanden, die zwar keine Überwindung dieser sozialen Lage erlauben, aber dennoch relative Stabilität in der Zone der Prekarität ermöglichen. In den Begriffen von Dörre und Mitarbeitern wären dies die Typen der „Realistischen“ und „Zufriedenen“, also jene Personen, denen es aufgrund ihrer Ressourcenausstattung gelingt, es sich in der Prekarität „einzurichten“. Diese Situation ist durchaus nicht nur aus einer Mangelperspektive zu betrachten, sondern es gilt vielmehr auch die vorhandenen Kompetenzen in den Blick zu nehmen, die ein gelingendes Gefährdungsmanagement ermöglichen. Zur Prekarität gehört auch eine spezifische Statuserfahrung und somit Reflexion und Bewußtheit der eigenen sozialen Lage: Charakteristisch ist die Erfahrung einer permanenten Überlastung, gepaart mit einer Apathie, die daraus resultiert, diese Lebenssituation nicht verändern zu können. Folge ist eine spezifische Form sozialer Unsicherheit, weshalb bei den Prekären ein ständig angestrengtes „Normalisieren“ zu beobachten ist, um Identität in der Prekarität zu stabilisieren. Entkopplung bedeutet hingegen, dass die individuellen Ressourcen und Kompetenzen bereits sehr eingeschränkt und geschwächt sind; hier herrscht das Gefühl der „Überflüssigkeit“ (Bude) oder „Nutzlosigkeit“ (Sennett) vor. Es ist natürlich in erster Linie eine empirische Frage, ob sich gleichsam zwischen Drinnen und Draußen eine von „Kern“ und „Rand“ abgrenzbare soziale Lage der Prekarität identifizieren lässt. Konzeptionell von einer sozialen Lage der Prekarität zu sprechen 7 „Bedürftigkeit trotz Arbeit ist längst Realität“ (Bury, zit. nach Deutsches Ärzteblatt 2007, 19) 8 Eine „geringe Außenorientierung erschwert … innovative Prozesse“ und: „Eine weitere Schwachstelle stellt die Verletzlichkeit starker Kernnentze … dar (Bien & Weidacher 2004, 117). 10 macht nur dann Sinn, wenn es einerseits gelingt, im Hinblick auf die genannten objektiven Dimensionen Erwerbstätigkeit, Nahbeziehungen, soziales Kapital und Teilhabe sowie subjektivem Empfinden und Ressourcenmanagement derartige „Grenzen“ und entsprechende Charakteristika nachzuweisen; es geht um „eine präzisere Ortsbestimmung sozialer Brüche und Gefährdungen“ (Vogel 2006, 351). Eine Empirie von Prekarisierungs- und Exklusionsprozessen ist jedoch andererseits unterdeterminiert, würde man diese als sozial abgeschlossene Lebenslagen konzipieren. Vielmehr ist in Anlehnung an die empirischen Ergebnisse von Dörre und Mitarbeitern von Überschneidungen mit den Zonen Integration und Entkopplung, nämlich (in der Sprache von Baumann) von fluiden Rändern auszugehen. Dies sind zur einen Seite hin „die Hoffenden“ und „die Veränderungswilligen“, zur anderen Seite hin die von Exklusion Bedrohten. Das Konzept der sozialen Lage hat genau den Vorzug, Beides - relative Geschlossenheit und zugleich Offenheit der Zonen an ihren Rändern - angemessen zu berücksichtigen. Für eine analytisch „getrennte“ Empirie von Prekarisierungs- und Exklusionsprozessen spricht die begründete theoretische Vermutung, dass wir es in vielfacher Hinsicht mit Entgrenzungen zu tun haben (zwischen unterschiedlichen Beschäftigungsformen, Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Arbeits- und Lebenswelt usw.). Entgrenzung bezeichnet die Auflösung der bisherigen Grenzen, hier zwischen Inklusion und Entkopplung. Es entstehen in dieser gesellschaftlichen Umbruchsituation Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten oder, um mit Habermas (1996) zu sprechen, „Neue Unübersichtlichkeiten“: Bisher vertraute Selbstverständlichkeiten sind brüchig geworden oder haben ihre allgemeine Gültigkeit verloren, neue gesellschaftliche Ordnungen oder gar feste Strukturen – von Prekaritätsprozessen – sind noch nicht erkennbar. In dieser unübersichtlichen Gemengelage entsteht einerseits eine neue Zone, andererseits gibt es dazwischen wiederum im Baumannschen Sinne fluide Ränder. Wir finden also sowohl fluide Strukturen, als auch Stabilität in den jeweiligen Zonen. In den einzelnen Zonen gibt es jeweils temporär und gleichzeitig dauerhaft Zugehörige. 2. Prekarisierung, Exklusion und psychische Störungen 2.1 Allgemeine Befunde Psychische Störungen sind kein Randphänomen, sondern inzwischen weit verbreitet: Jedes Jahr leiden in der Europäischen Union 27% (83 Millionen) Männer und Frauen unter psychischen Störungen, einige chronisch, einige episodisch, einige nur einmalig für einige Wochen. Die Lebenszeitprävalenz für die Entwicklung einer psychischen Störung beträgt ungefähr 50%, d.h. jeder Zweite entwickelt einmal in seinem Leben eine psychische Störung. Epidemiologischen Studien zufolge sind die am meisten verbreiteten psychischen Störungen in der Europäischen Union Angst und Depression, gefolgt von somatoformen und Abhängigkeitsstörungen (Weltgesundheitsreport der WHO 2001a; siehe auch: Wittchen & Jacobi 2005). Die Rate der stationär mit der primären Diagnose 11 Depression Behandelten stieg in Deutschland in den letzten vier Jahren um 40% (Stoppe et al. 2006). Man rechnet damit, dass bis zum Jahr 2020 affektive Störungen (Depressionen) in den entwickelten Industriestaaten die zweithäufigste Ursache von Erkrankungen sein werden (WHO 2001a, 11). In Deutschland sind Angsterkrankungen sogar weiter verbreitet als depressive Störungen (Wittchen et al. 1999, Weber et al. 2006). 9 Wittchen (2005) weist allerdings darauf hin, dass zwar Ängste, Depressionen und Substanzmissbrauch 10 , aber nicht psychische Störungen im Allgemeinen angestiegen sind. Surveys zeigen, dass in Deutschland insbesondere Verarmungs- und Zukunftsängste gestiegen sind: Die Bielefelder Langzeitstudie (Heitmeyer 2006) zeigt eine Erhöhung der Angst vor Arbeitslosigkeit bei deutschen Erwachsenen zwischen 2002 und 2005 von 21% auf 29%. In diesem Zeitraum stiegen die Befürchtungen, dass sich die eigene wirtschaftliche Basis verschlechtern wird, von 24% auf 38%. Diese Entwicklung wurde durch die Einführung der Hartz IV-Gesetze forciert. Die Forscher konstatieren: „Die Ergebnisse zeigen ein Konglomerat aus Angst, Unsicherheit und Machtlosigkeit, das von wachsender Orientierungslosigkeit begleitet wird“ (Heitmeyer & Hüpping 2006, 11). Die Studie „Deutscher Angstindex“ der Versicherungsgruppe R+V zeigt deutliche Steigerungsraten der Lebensangst: Während 1991 25% der Deutschen der Zukunft mit „großer Angst“ gegenüber standen, waren dies 2005 mehr als 50%. Die Deutschen fürchten sich insbesondere vor eigener Arbeitslosigkeit, sinkendem Lebensstandard und schwerer Krankheit (zit. nach Greiner et al. 2006, 14). Von Bedeutung ist hierbei, dass es sich nicht um bereits exkludierte Personengruppen (die „Entkoppelten“) handelt, sondern dass eine wachsende Zahl von Befragten aus der sozialen Mitte diese Prekarisierungs- und Exklusionsängste hat: „40% der Befragten in mittleren sozialen Lagen und sogar ein Viertel in gehobener Position äußern große oder sehr große Angst vor Arbeitslosigkeit“ (Heitmeyer & Hüpping 2006). Diese Personen erleben sich selbst in einer bedrohlichen sozialen Lage. Auch bei Jugendlichen sind die Ängste in den vergangenen Jahren angestiegen. Die Shell Jugendstudie 2006 (Hurrelmann & Albert 2006) zeigt, dass der Anteil Jugendlicher, die befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren bzw. keine adäquate Beschäftigung zu finden, im Jahr 2002 noch bei 55% lag, 2006 waren es bereits 69%. Auch die allgemeine Angst vor der schlechten wirtschaftlichen Lage und vor steigender Armut nahm in den letzten vier Jahren von 62% auf 66% zu. Dieser Druck, so die Autoren, führe zu vermehrten gesundheitlichen Problemen. 11 Emotionale Belastungen entstehen offensichtlich sehr früh, weil mögliche Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse schon im Jugendalter antizipiert werden. Gefühle von Unsicherheit sind nicht nur bei den bereits „abgehängten“ Hauptschülern verbreitet (die sich oft schon im jugendlichen Alter als Verlierer erleben), sondern insbesondere auch bei der kommenden Generation, die eine mittlere oder obere 9 Dies kommt jedoch in den auf Arbeitsunfähigkeitsdaten basierenden Statistiken nicht zum Ausdruck, da Angststörungen seltener als Depressionen zu Krankschreibungen führen (Lademann et al. 2006). 10 Hier spielt die Steigerung des Alkoholkonsums eine herausragende Rolle. Zusätzlich ist der steigende Konsum von psychoaktiven Medikamenten, vor allem Beruhigungs- und Schmerzmitteln, zu berücksichtigen (Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren 2006; Huber 2007). 11 Mädchen reagieren darauf mit depressiven Verstimmungen und psychosomatischen Störungen, Jungen versuchen den Druck aggressiv nach außen loszuwerden (Hurrelmann & Albert 2006) 12 soziale Position anstreben: 38% der Hauptschüler, aber auch nur 57% der Gymnasiasten blicken mit Zuversicht in die Zukunft. Man kann von weit verbreiteten latenten Ängsten sprechen, die aber nicht etwa zu Renitenz und Auflehnung, sondern tendenziell eher zu Anpassung und extremer Leistungsorientierung führen. 2.2 Psychische Störungen, Erwerbsarbeit und Armut Untersuchungen zu psychischen Störungen und verschiedenen Aspekten der Erwerbsarbeit folgen dem klassischen Muster früher Arbeits- oder Arbeitslosenstudien. 12 Im Hinblick auf die oben geschilderten jüngsten Entwicklungen, wie Arbeitsverdichtung, instabile Beschäftigungen oder Erfahrungen dynamischer Arbeitslosigkeit gibt es Vermutungen, aber keine systematischen Studien. Die Ergebnisse vorhandener Studien sind jedoch durchaus aufschlussreich, weil sie nicht unbedingt den intuitiven Vorannahmen entsprechen. Zwar wird allgemein als Ursache für die steigende Inzidenz psychischer Störungen genannt: „Belastungen durch den Wegfall sozialer Strukturen, die steigende Arbeitslosigkeit, die wachsende Zahl unsicherer Arbeitsverhältnisse sowie die Zunahme von Arbeitsbelastungen“ (Lademann et al. 2006, 127); 13 auch eine Studie der EU geht davon aus, dass Stress am Arbeitsplatz und “schlechte Arbeitsbedingungen“ Gemeinschaft 2005, 9). 14 zu psychischen Störungen führen (Europäische Erwerbsarbeit entwickelt sich zu einem „Balanceakt zwischen Selbstverwirklichung und Erschöpfung“ (Unger 2008, o.S.). In aktuellen Untersuchungen wurden jedoch spezifischere Risikofaktoren identifiziert, die eine andere Gewichtung nahe legen (vgl. Unger 2008): - Geringer Handlungs- und Entscheidungsspielraum, ungerechte Entscheidungen: Es fehlen Einflussmöglichkeiten auf Gestaltung und Strukturierung der Arbeitsaufgaben, der Abläufe oder Zielstellungen; erschwert wird die Situation durch willkürliche oder ungerechte Entscheidungen von Vorgesetzten. - Fehlende soziale Unterstützung, soziale Isolation (auch „Mobbing“-Prozesse): Schlechte Teamarbeit, unbewältigte Konflikte oder mangelnde Kooperation stellen eine erhebliche Belastung dar. Abwertung, Ausgrenzung oder kollektive Gegnerschaft verschärfen die Problematik. 12 Psychische Auswirkungen der Arbeitslosigkeit werden in diesem Beitrag nicht behandelt – aber auch hier sind die allgemeinen Ergebnisse eindeutig, denn bei der Gruppe der Arbeitslosen ist in der EU der Prozentsatz psychischer Probleme doppelt so hoch wie bei Erwerbstätigen (European Community 2006 ; siehe auch Stoppe et al. 2006). Offen bleibt bei diesen Daten immer, ob Arbeitslose mehr emotionale Probleme haben oder ob sie sich durch diese stärker eingeschränkt fühlen; zumindest kann gefolgert werden, dass psychische Probleme die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erschweren (European Community 2006, 25). 13 “Work represents two major sources of stressors that can contribute to poor mental health: work stress and unemployment. Such stressors can increase the incidence of depression, anxiety, burnout, alcohol-related problems, cardiovascular illness and suicidal behaviour.” (WHO 2004, 32) 14 Anders herum formuliert: „Der Abbau von Stressoren im Arbeitsumfeld sind der Gesundheit und der Wirtschaftsentwicklung zuträglich“ (Europäische Gemeinschaft 2005, 9). 13 - Geringe Wertschätzung und Anerkennung, schlechte Entlohnung (unausgewogene Gratifikation): Wenn auf den Gratifikationsebenen (Geld, Anerkennung/Status) der „Gegenwert“ unangemessen erscheint, verursacht dies ein Gefühl der Wertlosigkeit. - Hohe persönliche Verausgabung und besonders starkes berufliches Engagement: intensives Commitment, fehlende Grenzziehungen und unausgewogene Work-LifeBalance stellen ein weiteres erhebliches Risiko dar. Es handelt sich hierbei vor allem um das das „innere“ Gefüge der sozialen Beziehungen und deren Gestaltungsmöglichkeiten sowie das Gefühl der eigenen Wertigkeit. Die üblicherweise genannten (Arbeitsverdichtung) Umstrukturierungen, Stress- und bzw. Belastungsfaktoren, Arbeitsplatzunsicherheit mangelnde sowie Aufstiegsmöglichkeiten oder wie Arbeitsbelastung schnelle fehlende betriebliche Fort- und Weiterbildung, also die „äußeren“ Bedingungen, folgen erst in zweiter Linie. Gleichzeitig ist die umgekehrte Wirkrichtung zu betonen, dass nämlich psychische Störungen wiederum die Arbeitsleistung beeinträchtigen. In einer Umfrage der European Community (2006) geben rund 10% der befragten Erwerbstätigen an, dass ihre Arbeitsleistung durch psychische Probleme eingeschränkt ist, 6% weisen deshalb auch Fehlzeiten auf. In Deutschland sinken seit Jahren die Krankmeldungen erwerbstätiger Personen, aber der Anteil von Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Störungen steigt kontinuierlich an; auch der Anteil psychischer und psychosomatischer Erkrankungen an der krankheitsbedingten Frühinvalidität/ Frühberentung hat zugenommen (Deutsches Ärzteblatt 2006). Dabei sind nach entsprechenden Studien der deutschen Krankenkassen die Arbeitsunfähigkeitstage auf Grund psychischer Störungen ungleich verteilt: sie steigen überproportional im Dienstleistungsbereich (Gesundheits- und Sozialbereich, Banken und Versicherungen), während sie im Verarbeitenden Gewerbe (vor allem im Baugewerbe) eher selten auftreten (Lademann et al. 2006). Wie für den Bereich der Erwerbsarbeit gilt auch für Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse, dass diese aus psychologischer Sicht nicht systematisch untersucht wurden. Zwar gibt es unzählige Studien zu Armut und Gesundheit bzw. psychische Erkrankung; es fehlt aber an psychologischen Forschungen, die die Dynamik von Armutsverläufen berücksichtigen oder prekäre Lebenslagen (Abstiegsbedrohung, Arbeitsbelastung) mit einbeziehen. Inzwischen wird nicht bezweifelt, dass soziale Lage und Gesundheit in einem engen Zusammenhang zu sehen sind: „Armut ist ungesund“ – so die prägnante Formulierung im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts (Riester 2007, 272). Dies gilt für körperliche ebenso wie für die psychische Gesundheit: „Ein niedriger sozialer und wirtschaftlicher Status erhöht die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen“ (Europäische Gemeinschaft 2005, 11). Eine Zusammenschau von 234 psychiatrischen internationalen Fachblättern zum Thema Armut und Gesundheit kommt zum Ergebnis: „Armut ist das Gesundheitsrisiko schlechthin“ (Bartens 2007, 18). Ein Survey des RobertKoch-Instituts aus den Jahren 2003-2005 zeigt, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien in allen Bereichen von Gesundheit und Lebensqualität schlechtere Ergebnisse 14 aufweisen. Auffällig ist zudem eine Verschiebung von akuten zu chronischen Krankheiten und von somatischen zu psychischen Störungen (Lampert & Kurth 2007). 15 2.3 Psychische Störungen im gesellschaftlichen Wandel Das in Gesamteuropa steigende Auftreten von Depressionen und Ängsten sowie der erhöhte Konsum von psychoaktiven (= die Befindlichkeit beeinflussende) Substanzen können als (fehlgeschlagene, dysfunktionale) Kompensationsversuche einer „Politischen Ökonomie der Unsicherheit“ (Beck) und daraus resultierender individueller An- bzw. Überforderungen verstanden werden. Dies wird deutlich, wenn die zentralen Symptome der drei gestiegenen Störungsbereiche und deren funktionale Bedeutung betrachtet werden: Zentrale Kriterien einer Depression sind Gefühle der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, negative Gedanken in Bezug auf sich selbst und die soziale Umwelt sowie fehlender Antrieb, Grübeln und sozialer Rückzug. Im Vordergrund steht das „passive Erleiden/ sich Fügen“. Ängste sind charakterisiert durch diffuse Gefühle der Bedrohung und (Über-)Forderung, durch innere Anspannung, den Sorgen vor nicht bewältigbaren Lebensaufgaben, unüberwindbaren Katastrophen oder einem Scheitern. Hier sind „Abwehr und versuchte Absicherung“ sowie oft auch „Über-Kompensation“ vorherrschend. Psychoaktive Substanzen ermöglichen Entspannung und emotionale Erleichterung sowie Steigerung der Funktionsfähigkeit; sie bedeuten aber auch eine innere Flucht aus belastenden Situationen – es geht folglich um „Vermeidung“. Allen drei Gruppen psychischer Störungen ist gemeinsam, dass sie eine aktive und eigenständige Lebensgestaltung verhindern. Die Daten zeigen deutlich, dass eine steigende Zahl von Menschen durch den Wandel von Inklusionsprozessen im Kern der Gesellschaft überfordert ist. Im Deutschen Ärzteblatt wird pointiert formuliert: „Als zwei wesentliche, gleichsam übergeordnete Bedingungen (als Auslöser oder zumindest manifestationsfördernden Faktor insbesondere bei depressiven Störungen, Anm. d. Verf.), die derzeit Gesellschaft und Arbeitswelt maßgeblich bestimmen, können das Primat der Ökonomie („McKinsey-Gesellschaft“) und die Instabilität (in nahezu allen Lebenswelten) angeführt werden. Jeder Lebensbereich wird nach ökonomischen Prinzipien ausgerichtet, wobei Effizienz die oberste Maxime darstellt. Die gesamte Gesellschaft ist gewissermaßen ein Unternehmen, Managerverhalten wird zum Rollenideal“ (Weber et al. 2006, 171). Insbesondere Beschäftigte im Dienstleistungssektor scheinen gefährdet zu sein. Dieser Wirtschaftsbereich ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es keinen sichtbaren Erfolg durch ein gelungenes Werkstück gibt und dass (oft diffuse) „soft skills“ Grundlagen einer befriedigenden Arbeitsplatzsituation sind. Den hohen Anforderungen an soziale Kompetenz und intrinsischer Motivation stehen geringe gesellschaftliche Anerkennung 15 Eine Sozialisation in Armut hat, auch nach einer Verbesserung der materiellen Lebenssituation, offenbar lang anhaltende psychische Folgeschäden: Zwei amerikanische Studien (Allen 2003; Costello et al. 2003) zeigen signifikante gesundheitliche Einschränkungen, wie Depressionen und Ängste, auch mehrere Jahre nach Beendigung materieller Armut. Untersucht wurden Kinder eines Stammes von Cherokee Indianern, deren Eltern durch den Bau eines Kasinos auf ihrem Territorium in kurzer Zeit vermögend wurden. 15 und oftmals niedrige Entlohnung (insbesondere in den sozialen Berufen) gegenüber. Somit bündeln sich gerade hier mehrere der oben geschilderten Risikofaktoren. Dies stimmt mit den oben genannten Untersuchungen überein, die auf die Bedeutsamkeit der sozialen Beziehungen und deren Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitsbereich hinweisen. Sennetts (2005) Überlegungen zur Gegenständlichkeit als eine Grundlage für das Gefühl der eigenen Wertigkeit finden hier ihre empirische Basis. Hinzu kommen die belastenden „äußeren“ Bedingungen, wie Arbeitsverdichtung und Beschäftigungsunsicherheit. Häufig bemühen sich die Beschäftigten, Leistungsanforderungen zu durch entsprechen; erhöhte sie Arbeitsintensität versuchen, den befürchtete Leistungseinschränkungen auszugleichen und einem möglichen Scheitern zuvor zu kommen. Genau dies führt aber wiederum zu einer erhöhten Konzentration auf die Erwerbsarbeit und zu einer Verschärfung einer ohnehin „schiefen“ Work-Life-Balance. 3. Sozialpolitik: Soziale und Psychische Auswirkungen 3.1 „Reform“ und Wandel Nach der Jahrtausendwende kam es in der Arbeitsmarktpolitik zu einem besonderen Einschnitt: Das alte, schon überwunden geglaubte Paradigma der Vollbeschäftigung wurde wieder entdeckt und zur Leitlinie der Beschäftigungspolitik (Wolfgang Clement: „Vollbeschäftigung ist möglich!“; Die Zeit 2004). Diese wiederum stellte das letzte Glied in der Kette: Beschäftigungspolitik-Arbeitsmarktpolitik-Wirtschaftspolitik-Finanzpolitik dar; somit folgte die Beschäftigungspolitik letztlich den vermeintlichen Erfordernissen der Wirtschafts- und insbesondere der Finanzpolitik und die durchaus nicht falsche Formel „Wirtschaftswachstum erzeugt Beschäftigung“ wurde zum zentralen, aber allerdings auch alleinigen Fokus der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Pikanterweise und unerwartet setzte gerade die „rot-grüne“ Koalition eine einseitig angebotsorientierte Wachstumspolitik durch: Die Unternehmenssteuern wurden gesenkt und das Arbeitskräfteangebot sollte zudem für die Unternehmen finanziell und qualitativ attraktiver werden. Hinzu kam eine Fokussierung auf den so genannten ersten Arbeitsmarkt, während andere Formen der Beschäftigungsförderung reduziert wurden. Selbst eindeutig beschäftigungswirksame Bereiche, wie der Dritte Sektor oder die Soziale Ökonomie, konnten sich deshalb kaum weiter entwickeln. Hingegen Beschäftigungsförderung Mikrounternehmen wurden implementiert, (Ich-AGs). Die so Folgen stark etwa sind individualisierte die Gründung bekannt: Formen der meist prekärer Zunahme prekärer Beschäftigungen und weiter steigende Arbeitslosigkeit, die erst ab 2006 durch günstige Weltwirtschaftsbedingungen gestoppt werden konnte. Komplementär dazu wurde Sozialpolitik zum verlängerten Arm der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Sie löste sich schrittweise von ihrer genuinen Funktion, Risiken des Erwerbsbereichs und andere soziale Gefährdungen zu flankieren und gegebenenfalls zu 16 kompensieren. Stattdessen stand erstens die „Re-Kommodifizierung“ der Arbeitskraft im Vordergrund. 16 Damit ist gemeint, dass die neuen „Kunden“ der Sozialpolitik überwiegend als eingeschränkt verwertbare Arbeitskräfte gesehen wurden, die man nur wieder „marktgängig“ machen müsse, um sie dem Erwerbssystem „zuzuführen“ (Nullmeiner 2004, folgenreichen 497: „Erziehung Paradigmenwechsel, wohlfahrtstaatlichen Versorung“ zum zu (Bude Markt“). einer & Zweitens „veränderten Willisch 2006, kam es zu Grammatik 11): einem unserer Während die Nachkriegssozialpolitik noch eindeutig ein vor- und fürsorgendes Verständnis aufwies und das Ziel verfolgte, Risiken der Erwerbsarbeit und Gefährdungen der Lebensführung abzuschwächen und den einmal erreichten sozialen Status bei Arbeitslosigkeit und anderen Wechselfällen des Lebens abzusichern, setzte sich nun eine gewährleistende Sozialpolitik der Exklusionsvermeidung durch. Es geht nun nicht mehr um eine Entschärfung von Risiken und Gefährdungslagen, sondern darum zu verhindern, dass Bürger durch die letzten Maschen des sozialen Netzes fallen. Somit wurde in Kauf genommen, dass ein einmal erreichter Wohlstand und sozialer Status – etwa im Falle langer Arbeitslosigkeit oder Krankheit – prekär wurden oder gar verloren gehen. Gleichzeitig wurde drittens – analog zur Beschäftigungspolitik – der individualisierende Charakter von Sozialpolitik verschärft: Der durchaus innovative Ansatz der sozialen Aktivierung und die Betonung einer eigenverantwortlichen Lebensführung wurden umgewendet in eine weit reichende Privatisierung sozialer Risiken – eine neoliberale Staatsauffassung lieferte die notwendige Rhetorik für diese Ausprägung der Sozialstaatsreform. Ein treffendes Beispiel aus diesem Reformpaket der frühen 2000er Jahre ist hier aufschlussreich: kann, sind „Hartz IV“ und „Ein-Euro-Jobs“, 17 die man als Kernstück betrachten Ausdruck des skizzierten Wandels mit den Bestandteilen: Re- Kommodifizierung, Paradigmenwechsel und Privatisierung sozialer Risiken. Zur Erinnerung: Die Hartz-Kommission wurde eingesetzt, um Defizite bei der Vermittlung von Arbeitslosen zu beseitigen. Es ging um eine schnelle und weniger bürokratische Integration der Arbeitslosen in eine reguläre Beschäftigung des ersten Arbeitsmarktes und gleichzeitig um die Frage, wie zusätzliche, finanziell „attraktive“ Beschäftigungen in den Kommunen und im Dritten Sektor geschaffen werden könnten. Das Verwaltungshandeln der Arbeitsämter sollte folglich optimiert werden. 18 Die zu Gesetz gewordenen Maßnahmen setzen jedoch nicht bei der Verwaltung an, sondern insbesondere bei den Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern selbst. Die Parole „Fordern und Fördern“ zielt auf die Marktgängigkeit der Arbeitskraft. Damit wird die Sozialpolitik zu einer der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik nachgeordneten Instanz der „Zurichtung“ – Kommodifizierung – von Arbeitskräften. Da der reguläre Arbeitsmarkt jedoch gar nicht in der Lage war, diese Arbeitskräfte zu 16 Offe weist darauf hin, dass der Begriff „Re-Kommodifizierung“ eigentlich unpräzise ist, weil der Wohlfahrtsstaat schon immer nicht nur dekommodifizierende und emanzipatorische Funktionen hatte, sondern zugleich auch soziale Kontrolle und Zurichtung für die Marktgesellschaft bedeutete; er spricht von „interne Exklusion“; siehe auch Bourdieu, der von „intern Ausgegrenzten“ spricht (Offe 1996; Bourdieu 1997). Der Erwerbszwang wurde niemals gänzlich ausgesetzt (vgl. Lessenich 1999). 17 Im Rahmen von Hartz IV werden die Leistungsempfänger unter Androhung von Leistungskürzungen verpflichtet, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Die Träger der Sozial-Jobs sind nicht zur Qualifikation verpflichtet; im Krankheitsfall gibt es keine Lohnfortzahlung und es ist keine Unfallrente vorgesehen. 18 Deswegen waren von Hartz IV auch niemals ernsthaft Beschäftigungsimpulse oder gar arbeitspolitische Integrationsleistungen zu erwarten. 17 absorbieren, wurde „Fordern und Fördern“ folgerichtig mit einem neuen Sozial-JobSystem verknüpft, das eindeutig jenseits des Erwerbssystems liegt und den Arbeitsmarkt nicht weiter belastet. Da es sich bei den „Ein-Euro-Jobs“ nicht um reguläre Beschäftigungen handelt, wurde in der Reformrhetorik zwar Integration proklamiert, verstärkt wurden aber Prekarisierungstendenzen. Die Betreffenden bleiben außerhalb der gesellschaftlichen Kern-Zone und Inklusion wird genau durch diese Konstruktion fast unmöglich gemacht. Allerdings wird gänzliche Exklusion dadurch vermieden, dass ein „Ein-Euro-Zuverdienst“ zu den Sozialleistungen möglich gemacht wurde. Diese „Gewährleistung“ ist allerdings verknüpft mit dem individuellen (Wohl-)Verhalten der betreffenden Personen – deshalb der Zwang zur Aufnahme von „Ein-Euro-Jobs“. Im Hinblick auf Prekarisierungstendenzen wirkt verschärfend, dass in sozialen Notlagen in einem weiten Umfange persönliche Vermögen eingesetzt werden müssen und auf die Sozialleistungen angerechnet werden. Auch hier wird wieder deutlich, dass Statuserhalt und damit ein „Abbremsen“ von Prekarisierungsprozessen gar nicht angezielt ist – im Gegenteil: Die Verwundbarkeit ist durch die aktuelle Sozialpolitik größer geworden und ebenso das Risiko, sehr schnell in die Zone der Exkludierten „abzurutschen“ – es kommt allenfalls zu einer neuen Form der „sekundären Integration“ (Land & Willisch 2006, 82). In diesem Sinne kann man durchaus von einer „Dynamisierung der Prekarität“ sprechen – die Sozialpolitik selbst wurde zum „Generator von Individualisierungsprozessen“ (Bude & Willisch 2006, 13). Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die Schere zwischen Reichen und Armen ohnehin weiter öffnet, wie die Bielefelder Langzeitstudie zeigt (Heitmeyer & Hüpping 2006): Das Nettoeinkommen hat demnach im Zeitraum von 1993 – 2004 bei dem reichsten Viertel Deutschlands um 28% zugenommen, während es bei dem ärmsten Viertel um 50% abgenommen hat. Besonders betroffen sind Frauen, vor allem allein erziehende Mütter und Kinder sowie Menschen mit Migrationshintergrund und Zuwanderer. Eine OECD-Studie (2007) warnt zudem vor einer steigenden Altersarmut in Deutschland. Hinzu komme, dass in Deutschland Beruf und Familie besonders schlecht vereinbar seien, was zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage von Familien führe. Hurrelmann & Albert (2006) schätzen, dass es etwa 15 Prozent definitiv überforderte Elternhäuser gibt; dies stehe in einem engen Zusammenhang mit mangelnder Bildung und materieller Armut: „Armut macht die Menschen unsouverän, Väter verlieren ihre Rolle, Mütter ihre Gelassenheit, es entsteht eine Atmosphäre der Haltlosigkeit, oft kommen Alkoholprobleme hinzu, und die Kinder wachsen an der Grenze der Verwahrlosung auf.“ Natürlich gebe es Jugendliche, die sich aus eigenen Kräften aus den schwierigsten Verhältnissen befreien könnten, aber auf zehn bis 15 Prozent müsse man die Zahl der schwer belasteten jungen Leute – darunter deutlich mehr Jungen als Mädchen – durchaus schätzen, so Hurrelmann und Albert (2006). Diese Entwicklung bestätigen Untersuchungen der Europäischen Gemeinschaft und es wird betont, wie eng der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und erhöhtem Erkrankungsrisiko ist, der sich bei Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit nur noch verstärkt. Sie könnten die „Selbstachtung beeinträchtigen und Depressionen verursachen“ (Europäische Gemeinschaft 2005, 11). 18 Zugleich wurden mit den Reformen die Mittel für psychosoziale Initiativen und Einrichtungen (wie sozialpsychiatrische Dienste, Beratungsstellen, Jugendämter etc.) deutlich eingeschränkt oder gar gestrichen – und dies, wie gezeigt, bei einem gleichzeitig steigenden gesetzlichen Bedarf. Durch Krankenkassen Psychotherapie für die Kostenübernahme wird Menschen zwar aus der allen von Psychotherapie einkommensunabhängige Bevölkerungsschichten durch die Zugang zu möglich; dennoch übersteigt selbst in gut versorgten Gebieten die Nachfrage das Angebot. Lange Suchphasen und Wartezeiten vor Therapiebeginn sind nicht selten. Epidemiologische Studien zeigen, dass jährlich zwei Drittel aller psychischen Störungen unbehandelt bleiben; nur einer von vier Betroffenen (26%) erhält zumindest eine minimale Intervention (z.B. eine kurze Beratung, ein kurzes Gespräch mit dem Hausarzt); lediglich 10% der Betroffenen erhalten eine angemessene Behandlung (vgl. Wittchen & Jacobi, 2002). Oft vergehen viele Jahre und manchmal Jahrzehnte, bevor eine erste einschlägige Behandlung eingeleitet wird. Häufig bekommen Betroffene ausschließlich medikamentöse Behandlung (ohne Psychotherapie) psychotherapeutischer psychische Störungen – dies gilt Versorgung wie Deutschland verlaufen häufig chronisch auch für (dies. und Länder 2005). es 19 mit guter Unbehandelte entstehen zusätzliche Komplikationen. Wittchen (2005) spricht von einer „Besorgnis erregend niedrigen Behandlungsrate von psychischen Störungen, die in keinem anderen Bereich der Medizin in diesem Ausmaß bisher beobachtet werden konnte.“ Als eine mögliche, aber nicht ausreichende Erklärung nennt er die anhaltende Stigmatisierung psychischer Störungen. Die deutliche psychosoziale Unterversorgung wird durch veränderte politische und mediale Stigmatisierungsprozesse verschärft. Während in den 1960er/70er Jahren aus einer Betroffenheitsperspektive „ausgeleuchtet“ und die die mangelnde soziale Notlage Inanspruchnahme in all ihren Dimensionen sozialpolitischer Leistungen beklagt wurde, steht in den vergangenen 20 Jahren (wieder) der Missbrauch öffentlicher Leistungen (Stichwort: „Sozialschmarotzer“) im Vordergrund – verknüpft mit der Behauptung, dass die Betroffenen gesellschaftliche Inklusionsangebote, insbesondere des Arbeitsmarktes, ohne erkennbaren Grund ablehnten.20 Dabei werden gerade in jüngster Zeit Überlastungsphänomene durchaus wahrgenommen: Extremfälle von vernachlässigten, schwer misshandelten und sogar getöteten Kindern völlig überforderter Eltern füllen die Medien. Dies mag einerseits sogar zu einer stärkeren Sensibilität führen, sie wird politisch jedoch dadurch „abgefangen“, indem ganze Bevölkerungsgruppen („die sozialistische Sozialisation der Ostdeutschen“) und/ oder Professionelle („die Behörden“) dafür verantwortlich gemacht werden; die Medien reagieren ihrerseits mit einer gleichsam ergänzenden Form öffentlicher Ersatzberatung: Auffallend ist beispielsweise, dass im Fernsehen nach Jahren der Selbstdarstellungen in unzähligen Talk-Shows 19 Die Kosten für psychotherapeutische Leistungen liegen in der EU weit unter 1% der durch psychische Störungen verursachten Gesamtkosten von jährlich fast 300 Milliarden Euro (European Brain Council und ECNPArbeitsgruppe, zit. nach Wittchen 2005). Eine Verbesserung der Versorgungslage würde sich demnach auch finanziell lohnen! 20 Dass diese Strategie zu einer Entlastung der politischen Systeme und deren Verantwortlichkeit durchaus seine Funktion hat, sei an dieser Stelle nur angemerkt. 19 unterschiedliche Sendungen mit konkreten Hilfestellungen (Erziehungsberatung der „Super-Nanny“, Lebensberatung, Schuldnerberatung etc.) angeboten werden. 3.2 Gestaltung des Sozialen: Für eine Psychotherapie, die Verwirklichungschancen schafft Die jüngsten Reformen der Sozialpolitik zielten dezidiert nicht, wie von vielen erhofft, auf eine Gestaltung des Sozialen: Dies wäre ein Paradigmenwechsel gewesen, der der gesellschaftlichen Entwicklung in Arbeitswelt und Lebensführung angemessen gewesen wäre. Ein solcher Paradigmenwechsel hätte mehr als ein politisches Verständnis dafür erfordert, dass eine ausschließlich vor- und fürsorgende Sozialpolitik historisch obsolet geworden ist: Eben weil das Soziale durch sich verschärfende Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse zunehmend gefährdet ist und sich sozialer Zusammenhalt immer weniger „von alleine“ einstellt, wäre eine gestaltende Sozialpolitik notwendig gewesen, die durch alternative Formen politischer und staatlicher Steuerung Arbeit und Soziales integriert. Beispielsweise hätten – als wesentliches Element zur Gestaltung des Sozialen – die Debatten um das bürgerschaftliche Engagement dem sozialpolitischen Reformprozess (der zeitgleich zur Enquete Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ von 2000 bis 2002 stattfand) wesentliche zivilgesellschaftliche Impulse geben können. Einer das Soziale gestaltende, zivilgesellschaftlich ausgerichteten Sozialpolitik auf der Makroebene entspricht eine psychotherapeutische Praxis auf der Mikroebene, die bei der Befähigung der Menschen einerseits und dem sozialen Umfeld andererseits gleichzeitig ansetzt – eine Herausforderung, der Psychotherapie in der derzeitigen Form nicht gewachsen ist. Psychosoziale Beratung und Psychotherapie sind als eine Form des „sozialen Geleitschutzes“ (Kieselbach, zit. nach Greiner et al. 2006, 15) auf der individuellen Ebene geeignet, auf den Wandel der Inklusionsmodi sowie veränderte Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse zu reagieren; 21 sie können „Verwirklichungschancen“ im Sinne des Nobelpreisträgers Amartya Sen schaffen. Er meint damit die Möglichkeiten und Fähigkeiten von Menschen, „ein Leben führen zu können, für das sie sich mit guten Gründen entscheiden konnten und das die Grundlagen der Selbstachtung nicht in Frage stellt“ (zit. nach: Deutscher Bundestag 2005, 9). Eine traditionelle Psychotherapie, die „kranke Individuen“ als Einzelpersonen behandelt, wie dies in unserem Krankenkassensystem vorgegeben ist, kann genau dies nicht leisten und kann deshalb langfristig nur in begrenztem Rahmen hilfreich sein. Erschwerend kommt hinzu, dass psychotherapeutische Praxis immer in einem Feld von gesellschaftlichen Stigmatisierungen und Vorurteilen stattfindet – dies gilt verschärft für den Personenkreis der von Prekarisierung Bedrohten oder gar bereits Exkludierten. Gerade ihnen wird 21 „Generell kann die Unterstützung vulnerabler Gruppen die psychische Gesundheit verbessern, den sozialen Zusammenhalt stärken und soziale und wirtschaftliche Belastungen vermeiden helfen“ (Europäische Gemeinschaft 2005, 11). 20 häufig unterstellt, sie seien selbst an ihrer Erkrankung schuld oder sie stellten eine Gefahr für andere dar (Bericht der Europakommission 2006); ihnen wird persönliche Schwäche, Unfähigkeit oder gar Faulheit vorgeworfen (Resolution der APA zu Armut und sozioökonomischem Status 2000). Armut und körperliche bzw. psychische Krankheit führen zu einer doppelten Stigmatisierung, die soziale Beziehungen beschädigt und die ohnehin geringen gesellschaftlichen Teilhabechancen verkleinert; die persönlich erlebte Scham und dadurch eingeschränkte Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten verstärken die Abwärtsspirale: „Stigma verschlimmert das persönliche Leiden und soziale Ausgrenzung kann den Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung verwehren. Die Angst, gebrandmarkt zu werden, hält Menschen oft davon ab, Hilfe zu suchen“ (Europäische Gemeinschaft 2005, 12). „Der Erkrankte selbst verinnerlicht oftmals die Stigmatisierung und Diskriminierung. Dieses Phänomen wird als eine ‚zweite Erkrankung’ bezeichnet“ (Deutsches Ärzteblatt 2006, 172). Diese Selbstabwertung verhindert ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und verringert die Motivation für Veränderungen. Derartige Schuldzuschreibungen demütigen, lähmen und/oder verärgern und beeinträchtigen sowohl die Suche nach adäquater Unterstützung als auch eine hilfreiche psychotherapeutische Praxis in erheblichem Maße. Der 2. Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung spricht von „Kooperationsblockaden“ (2005, 132), die es gerade Menschen in extremen Notlagen schwer mache, professionelle Hilfe zu suchen. Die Blockaden im medizinischen Versorgungssystem, in dem psychische Störungen überwiegend gar nicht oder medikamentös behandelt werden statt in Psychotherapie zu überweisen, erschweren die Situation, denn die Unterdrückung und Abschwächung der Symptome, wie sie durch Medikamente bewirkt werden, reichen in den meisten Fällen nicht zu einer nachhaltigen Bewältigung der hier skizzierten neuen Herausforderungen. Zunehmende und neuartige Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse sowie Wandel der Inklusionsformen bedeuten zunächst, dass sich der Kreis der Klienten erweitert und zugleich verändert: Insbesondere im ambulanten Bereich ist zu beobachten, dass nicht mehr nur die früher dominierende Mittelschicht, sondern zunehmend auch Personen in prekären oder exkludierten Lebenslagen eine Psychotherapie aufsuchen; insbesondere ist hier die Gruppe mit Migrationshintergrund zu nennen, die zumindest in urbanen Räumen häufiger als früher zu den Klienten gehört. Zusätzlich kommen auch Menschen in die Psychotherapie, die auf den ersten Blick gut integriert erscheinen, aber dennoch erhebliche Angst- oder Depressionssymptome aufweisen. Die Folge ist, dass sich die Form der psychotherapeutischen Praxis verändert: Die therapeutischen Aufgaben werden vielfältiger und sie erfordern eine weitere Spannbreite von Interventionen. Angesichts der geschilderten gesellschaftlichen Entwicklungen liegt es nahe, auch eine Veränderung des Selbstbilds von Psychotherapeuten anzuzielen. Das medizinische Krankheits- und Behandlungsmodell, das von einem behandlungsbedürftigen Individuum ausgeht, wird unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen zunehmend obsolet (vgl. Kühnlein 2001; 2002). Eine neue Form der psychotherapeutischen Offenheit ist gefordert: Es gilt, als Psychotherapeut sensibel für die Verschiedenartigkeit von „äußeren“ Arbeits- und Lebensbedingungen der Patienten zu sein, die die Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen objektiv einschränken – aber gleichzeitig der 21 psychotherapeutischen Praxis nicht unmittelbar zugänglich sind. Insbesondere bei der Behandlung von Ängsten und Depressionen sind, wie oben skizziert, nicht nur innerpsychische Vorgänge, sondern darüber hinaus stärker die gesellschaftlichen An- und Überforderungen (wie unausgewogene Gratifikation oder unsichere Beschäftigungsverhältnisse usw.) sowie das soziale Umfeld und kulturelle Besonderheiten der jeweiligen KlientInnen in die psychotherapeutischen Überlegungen einzubeziehen. 22 Es geht darum, die eigenen Anteile der KlientInnen einerseits und gesellschaftliche Rahmenbedingungen andererseits der persönlichen Einsicht zugänglich zu machen: In der Psychotherapie sollten die Betroffenen angeleitet werden, sich selbst und die eigene Lebenssituation im gesellschaftlichen Kontext angemessen verstehen zu können. Dies bedeutet jedoch, dass Psychotherapeuten selbst besser in der Lage sein müssen, die Besonderheiten sowie deren spezifische Formen der gesellschaftlichen Bearbeitung (durch Behörden, Jugendämter, Beratungsstellen usw.) moderner Inklusions- und Ausgrenzungsprozesse zu verstehen. Für spezifische Problemstellungen können stärkere beratenden Anteile oder sogar konkrete Hilfestellungen (wie gemeinsames Ausfüllen von Formularen, Verfassen von Schriftsätzen oder gar Begleitung bei Behördengängen) oder der Aufbau von psychosozialen Netzwerken sowie Kontakte zu anderen Personenkreisen und Organisationen notwendig werden, um das soziale Umfeld angemessen zu berücksichtigen. Dazu gilt es in der psychotherapeutischen Praxis Anknüpfungspunkte für die beratende Dimension zu finden und entsprechende Reflexionshorizonte zu eröffnen. Eine Integration der oben geschilderten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und deren Auswirkungen auf die Individuen in die psychotherapeutische Praxis bedeutet, nicht (mehr) nur vorrangig die Beseitigung einer diagnostizierten Erkrankung oder einer aktuellen Krise im Blick zu haben, sondern darüber hinaus eine grundlegende Fähigkeit zur Problembewältigung aufzubauen. Wenn die Analysen von Baumann (2008) oder Sennett (2005) zur „Flüchtigkeit der Zeit“ und damit verbundener weiter steigender Angst vor Unsicherheit zutreffend sind, dann muss die Notwendig der Flexibilität im Umgang mit ständig Neuem und Wechselndem erkannt und erarbeitet sowie daraus folgend die Antizipation immer wieder wechselnder Arbeits- und Lebensbedingungen „eingeübt“ werden. 23 Dabei geht es neben der Bewältigung von Defiziten zentral um Ressourcen- und Kompetenzüberzeugungen, d.h. eine Stärkung des Selbstvertrauens in die eigenen sozialen und psychischen Kräfte. Letzten Endes muss es darum gehen, Personen langfristig zu befähigen, eigene Wege selbstständiger Bewältigung zu finden und somit Autonomie zu gewinnen. Eine solche Befähigung zu aktiven Gestaltungsmöglichkeiten kann dabei zu einer Form der Identitätsarbeit werden, die eine Gratwanderung zwischen realistischer Anpassung und konstruktivem Widerstand bedeutet. Dazu gehört ebenso die Entfaltung einer „Kultur des Scheiterns“ (Keupp 2007b, 529): Misserfolg darf nicht nur 22 “Finally, it can be pointed out that those respondents who feel that information on psychological problems is easily found say somewhat more often that emotional problems have never caused them to accomplish less or to be more careless with normal activities than those who indicate that finding information is difficult” (European Commission 2006, 23). 23 So formuliert Kieselbach (2006) pointiert: „Wir müssen nicht nur Inflation oder Wirtschaftswachstum kontrollieren, sondern auch den Menschen besser auf kritische Lebensereignisse vorbereiten“ (zit. nach Greiner et al., 15). 22 als (trauriger) Fehlschlag, sondern muss auch als Chance zum Neuanfang und als Basis für Lernprozesse verstanden werden. Letztlich ist jedoch zu beachten, dass psychosoziale Beratung und Psychotherapie immer nur in begrenztem Maße zur Bewältigung der oben geschilderten gesellschaftlichen Entwicklungen hilfreich sein kann. Vielmehr sind die Inklusionsbedingungen selbst sowie Maßnahmen von Politik und Staat, insbesondere die Sozialpolitik, die derartige Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse auslösen und sogar verstärken, kritisch zu hinterfragen. Gerade auch im Hinblick auf die Prävention psychischer Belastungen und Erkrankungen darf der Diskurshorizont nicht auf den sozialen Nahbereich beschränkt bleiben, sondern muß sehr viel umfassender gesehen werden. Es geht im Kern um das Wirtschaftssystem selbst, das auf Konkurrenz beruht und den „Stärkeren“ belohnt und somit entsprechende Verhaltensweisen fördert. Darin eingebettet sind die Strukturen des Arbeitsmarktes zu sehen, der genau nach diesem Muster soziale Ungleichheiten produziert und manifestiert. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in diesem Konkurrenzgefüge nicht „mithalten“ können, geraten in der „Kultur des neuen Kapitalismus“ (Sennett) in eine Preakarisierungs- und Exklusionsspirale. Vielmehr bräuchte es wettbewerbsgeschützte Räume, in denen Prekarisierte und Exkludierte im Sinne von Hannah Arendt aktive Menschen sein können, sowie sichere Phasen der NichtErwerbstätigkeit, aus denen heraus der Wechsel in eine reguläre Beschäftigung immer wieder möglich ist. In diesem Sinne müßten sich Wirtschaftssystem und Arbeitsmarkt zivilisieren, damit Erwerbspersonen zugleich auch wirkliche Bürger sein können. Das Gegenteil passiert: Während sich Staat und Politik von wirtschaftlichen Aktivitäten (also aus dem Inklusionskern der Gesellschaft!) zurückziehen und Steuerungskompetenzen privatisiert werden (Stichwort: Deregulierung), wird in den Zonen der Prekärität und der Entkopplung um so mehr Einfluss genommen. Analog zur „Durchstaatlichung“ kann von einer „Durchregulierung“ gesprochen werden; politische und staatliche Maßnahmen haben in diesem Bereich „weit mehr Einfluss auf die Lebenskonstruktionen der Einzelnen … als zuvor“ (Bude & Willisch 2006, 12). In der Folge herrscht hier „Abhängigkeit von Markt und Staat“ (Kronauer 2006, 32, Herv. IK/GM). Bürgerstatus und soziale Bürgerrechte in diesen Zonen werden eben nicht gefördert oder aber auch nur gewährt – sondern zunehmend eingeschränkt. Das gleiche gilt im übrigen für die psychosoziale Versorgung: Durchstaatlichung und Durchregulierung haben nicht zu einer Ausweitung der Behandlungsmöglichkeiten, sondern zu deren Einschränkung geführt. 23 LITERATUR Allen, Colin (2003), Relieving Poverty For Mental Health, in: Psychology Today Online. Verfügbar unter: http://psychologytoday.com/articles/pto-20031021-000001.html [Letzter Zugriff am 12.03.2008]. American Psychological Association (APA) (2000), Resolution on Poverty and Socioeconomic Status, passed by Council August 6. Verfügbar unter: http://www.apa.org/pi/urban/povres.html [Letzter Zugriff am 12.03.2008]. Arendt, Hannah (2002< Erstausgabe 1958>), Vita activa oder vom tätigen Leben. München: Piper. Baumann, Zygmunt (2008), Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit. Hamburg: Hamburger Edition. Bartens, Werner (2007), Die größte Gefahr von allen, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 244 vom 23.10., S. 18 Beck, Ulrich (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/ M.: Suhrkamp. Beck, Ulrich/ Bonß, Wolfgang/ Lau, Christoph (2004), Entgrenzung erzwingt Entscheidung : Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung? in: Ulrich Beck / Christoph Lau, Entgrenzung und Entscheidung, Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 13-62. Beck, Ulrich/ Holzer, Boris (2004), Wie global ist die Weltrisikogesellschaft? in Beck, Ulrich / Lau, Christoph (Hrsg.), Entgrenzung und Entscheidung, Frankfurt/M: Suhrkamp, S. 421-439. Berger, Peter A. (1990), Ungleichheitsphasen. Stabilität und Instabilität als Aspekte ungleicher Lebenslagen, in: Peter Berger/ Stefan Hradil (Hrsg.): Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile. Sonderband 7, Soziale Welt, S. 319-350. Berger, Peter A./ Sopp, Peter (1995) (Hrsg.), Sozialstruktur und Lebenslauf. Opladen: Leske + Budrich. Bien, Walter/ Weidacher, Alois (Hrsg. 2004), Leben neben der Wohlstandsgesellschaft. Familien in prekären lebenslagen. Wiesbaden: VS-Verlag. Bilke, Oliver/ Haid, Oliver/ Willma, Stefan (2006), Materielle Armut als Risikofaktor bei kinder- und jugendpsychiatrischen Erkrankungen. 12. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit (Ms). Verfügbar unter: http://www.gesundheitberlin.de/download/Bilke_Haid_Willma.pdf [Letzter Zugriff am 12.03.2008]. Böhnke, Petra/ Delhey, Jan (1999), Lebensstandard und Armut im vereinten Deutschland. Verfügbar unter http://skylla.wz-berlin.de/pdf/1999/iii99-408.pdf [Letzter Zugriff am 10.11.07]. Bühring, Petra/ Merten, Martina (2007), Gefährdungen frühzeitig erkennen, in: Deutsches Ärzteblatt. Heft 1. S. 18-19. Bonß, Wolfgang/ Heinze, Rolf G. (1984), Arbeit, Lohnarbeit, ohne Arbeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Bourdieu, Pierre (1997), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz: UVK. Brinkmann, Ulrich / Dörre, Klaus/ Silke Röbenack (gemeinsam mit Klaus Kraemer und Frederic Speidel), Prekäre Arbeit – Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung. Bude, Heinz (2004), Das Phänomen der Exklusion. Der Widerstreit zwischen gesellschaftlicher Erfahrung und soziologischer Rekonstruktion, in: Mittelweg 36, 4, S. 3-15. Bude, Heinz/ Lantermann, Ernst-Dieter (2006), Soziale Exklusion und Exklusionsempfinden, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 2(58), S. 232-252. Bude, Heinz / Willisch, Andreas (2006), Das Problem der Exklusion, in: Heinz Bude/ Andreas Willisch (Hrsg.), Das Problem der Exklusion. Ausgegrenzte, Entbehrliche, Überflüssige. Hamburg: Hamburger Edition, S. 7-23. Buhr, Petra (1998), Verschwimmende Grenzen. Wo fängt Armut an und wann hört sie auf? in: Frank Hillebrandt/ Georg Kneer/ Klaus Kraemer (Hrsg), Verlust der Sicherheit? Lebensstile zwischen Multioptionalität und Knappheit. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 26-51. Buhr, Petra/ Leibfried, Stephan (1993), What a difference a day makes. Messung der Dauer des Sozialhilfebezugs und ihre sozialpolitische Bedeutung, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Jg. 73, 5, S. 179-184. Castel, Robert (2000), Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz: UVK. Club of Rome (2007), Der Club of Rome. Verfügbar unter: http://www.clubofrome.de/ [Letzter Zugriff am 04.03.2007]. Costello, E. Jane/ Compton, Scott N./ Keeler, Gordon/ Angold, Adrian (2003), Relationships Between Poverty and Psychopathology. A Natural Experiment, in: JAMA, Journal of the American Medical Association 290 (15). 2023-2029. Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (2006), Jahrbuch Sucht 2006. Geesthacht: Neuland. Deutscher Bundestag (2005), Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht. Berlin. Deutsches Ärzteblatt (2006), Gegen Stigmatisierung psychische Kranker. Heft 4, S. 172. Deutsches Ärzteblatt (2007), Armut ist ungesund. Heft 6, S. 272. Dietz, Berthold. (1997), Soziologie der Armut. Eine Einführung. Frankfurt/M.: Campus. Diewald, Martin (1991), Soziale Beziehungen. Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung in informellen Netzwerken. Berlin: Rainer Bohn Verlag. 24 Diewald, Martin (2003), Kapital oder Kompensation, Erwerbsbiografien von Männern und die sozialen Beziehungen zu Verwandten und Freinden, in: Berliner Journal für Soziologie, 13, 2, S. 213-238. Die Zeit (2004), Vollbeschäftigung ist möglich. Ein ZEIT-Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement über die Fortsetzung der Reformpolitik, die Proteste gegen Hartz IV und die Kontrolle der Energiepreise. Verfügbar unter http://www.zeit.de/2004/40/Clement-Interview [Letzter Zugriff am 05.03.2007]. Dörre, Klaus/ Kraemer, Klaus/ Speidel, Frederic (2003), Prekäre Beschäftigungsverhältnisse – Ursache von sozialer Desintegration und Rechtsextremismus. Projektbericht zur Zwischenbegutachtung. November 2003, Recklinghausen (Ms). Dörre, Klaus (2003), Neubildung von gesellschaftlichen Klassen. Zur Aktualität des Klassenbegriffs, in: Joachim Bischoff/ Paul Boccara/ Robert Castel/ Klaus Dörre (Hrsg.), Klassen und soziale Bewegungen. Strukturen im modernen Kapitalismus. Hamburg: VSA Verlag, S.18-32. Dörre, Klaus (2005), Prekäre Beschäftigung - subjektive Verarbeitungsformen Konsequenzen. Vortrag auf der Sektionstagung Industriesoziologie. http://www.industriesoziologie.de/downloads/08-sektionstagungen/03herbsttagung_2005/vortraege/Doerre_Vortrag.pdf [Letzter Zugriff am 05.05.2007]. und arbeitspolitische Verfügbar unter: Dörre, Klaus (2006), Arbeitnehmer zweiter Klasse? Politik der Entprekarisierung statt Klassenkampf zwischen Arbeitnehmern, in: spw 148, Dortmund. Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestages (2002) (Hrsg.), Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft. Schriftenreihe Band 1. Opladen: Leske + Budrich. Ehrenberg, Alain (2004), Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt/M.: Campus. Europäische Gemeinschaft (2005), Grünbuch. Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union. Brüssel. European Commission (2006), Special Eurobarometer 248: Mental well-being. Bruxelles. Gaschke, Susanne (2006), Mensch, Alter, in: Die Zeit Nr. 39 vom 21.09.2006 Greiner, Kerstin/ Baumann, Marc/ Müller, Frank (2006), Haus und vorbei. Die Angst vor dem sozialen Abstieg hat inzwischen auch die Mittelklasse erreicht, in: Süddeutsche Zeitung Magazin vom 31.03.2006, S. 8-15. Grünewald, Stephan (2007), Deutschland auf der Couch. Eine Gesellschaft zwischen Stillstand und Leidenschaft. Frankfurt/M: Campus. Habermas, Jürgen (1996), Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V., Frankfurt/ M.: Suhrkamp. Hacket, Anne/ Janowicz, Cedric/ Kühnlein, Irene / Mutz, Gerd (2001), Erwerbsarbeit, bürgerschaftliches Engagement und Eigenarbeit: Pluralisierung – Entgrenzung – Gestaltung. Interner Bericht der Münchner Projektgruppe für Sozialforschung (MPS) an den Sonderforschungsbereich 536 ‘Reflexive Modernisierung‘ der DFG. München. Heitmeyer, Wilhelm/ Hüpping, Sandra (2006), Auf dem Weg in eine inhumane Gesellschaft, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 243 vom 21./22.10.2006. Hradil, Stefan (1987), Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Von Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus. Opladen: Leske + Budrich. Huber, Brigitte (2007), Medikamentenabhängigkeit – die stille Sucht, in: Bayerisches Ärzteblatt 4/2007, S. 209. Hurrelmann, Klaus/ Albert, Mathias (2006), Jugend 2006. Die 15. Shell-Jugendstudie. Eine pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt/M.: Fischer. Keupp, Heiner (1999), Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek b.Hamburg: Rowohlt. Keupp, Heiner (2004), Von der Normal- zur Patchworkbiographie. Vortrag bei der Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing „Lebensgeschichte und Lebenssinn“ am 12. März 2004 in Rothenburg. Verfügbar unter www.ev-akademie-tutzing.de/doku/programm/get_it.php?ID=154 [Letzter Zugriff am 05.05.2007]. Keupp, Heiner (2007a), Und die im Dunklen sieht man nicht: Von der alten und der neuen Armut und ihren psychosozialen Konsequenzen, in: Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis 1/2007, S. 9-24. Keupp, Heiner (2007b), Wege aus einer erschöpften Gesellschaft – eine Empowermentperspektive, in: Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis 3/2007, S. 525-540. Kieselbach, Thomas/ Wacker, Ali (1987), Individuelle und gesellschaftliche Kosten der Massenarbeitslosigkeit. Psychologische Theorie und Praxis. Weinheim: Deutscher Studienverlag. Kronauer, Martin (2002), Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus. Frankfurt/M: Campus. Kronauer, Martin (2006), „Exklusion“ als Kategorie einer kritischen Gesellschaftsanalyse. Vorschläge für eine anstehende Debatte, in: Heinz Bude/ Andreas Willisch (Hrsg.), Das Problem der Exklusion. Ausgegrenzte, Entbehrliche, Überflüssige. Hamburg: Hamburger Edition, S. 27-45. 25 Kronauer, Martin (2007), Inklusion – Exklusion: ein Klärungsversuch. Vortrag auf dem 10. Forum Weiterbildung des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Bonn. Kronauer, Martin/ Vogel, Berthold (1998), Spaltet Arbeitslosigkeit die Gesellschaft?, in: Peter A. Berger/ Miachael Vester (Hrsg.), Alte Ungleichheiten. Neue Spaltungen. Opladen: Leske + Budrich. Kühnlein, Irene (2001), Psychotherapie, in: Keupp, Heiner/ Weber, Klaus (Hrsg.), Psychologie - Ein Grundkurs. Reinbek b. Hamburg: rororo, S. 331-339. Kühnlein, Irene (2002), Wie Psychotherapie verändert. Eine Langzeitstudie über Bedeutung und Auswirkungen psychotherapeutischer Behandlung im Lebensverlauf. Weinheim: Juventa. Lademann, Julia/ Mertesacker, Heike/ Gebhardt, Birke (2006), Psychische Erkrankungen im Fokus der Gesundheitsreporte der Krankenkassen, in: Psychotherapeutenjournal 2/2006, S. 123-139. Lampert, Thomas/ Kurth, Bärbel-Maria (2007), Sozialer Status und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 11, November 2007, 521-526. Land, Rainer/ Willisch, Andreas (2006), Das Problem mit der Exklusion. Das Konzept des „sekundären Integrationsmudus“, in: Heinz Bude/ Andreas Willisch (Hrsg.), Das Problem der Exklusion. Ausgegrenzte, Entbehrliche, Überflüssige. Hamburg: Hamburger Edition, S. 70-93. Leibfried, Stephan/ Voges, Wolfgang (Hrsg.) (1992), Armut im modernen Wohlfahrtsstaat, Sonderheft 32, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen 1992. Leibfried, Stephan/ Leisering, Lutz/ Buhr, Petra/ Ludwig, Monika/ Olk, Thomas/ Voges, Wolfgang (Hrsg.) (1995), Zeit der Armut. Lebensläufe im Sozialstaat. Frankfurt/M: Suhrkamp. Leisering, Lutz (1993), Zwischen Verdrängung und Dramatisierung. Zur Wissenssoziologie der Armut in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, in: Soziale Welt 44, S. 486-511. Lessenich, Stephan (1999), Vorwärts – und nicht vergessen. Die neue deutsche Sozialstaatsdebatte und die Dialektik sozialpolitischer Intervention, in PROKLA 29, S. 411-430. Ludwig, Monika (1996), Westdeutscher Verlag. Armutskarrieren: zwischen Abstieg und Aufstieg im Sozialstaat. Opladen: Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang (2001), Die Armut der Gesellschaft. Opladen: Leske + Budrich. Matthes, Joachim (Hrsg.) (1983), Krise der Arbeitsgesellschaft? Soziologentages in Bamberg 1982. Frankfurt/M./New York: Campus. Verhandlungen des 21. Deutschen Mückenberger, Ulrich (1985), Die Krise des Normalarbeitsverhältnis, in: Zeitschrift für Sozialreform 31, S. 415434, 457-475. Mutz, Gerd (1995), Erwerbsbiographische Diskontinuitäten in West- und Ostdeutschland. Eine Systematisierung ungleichheitsrelevanter Deutungsmuster, in: Peter A. Berger & Peter Sopp (Hrsg.), Sozialstruktur und Lebenslauf. Opladen: Leske + Budrich, S. 205-233. Mutz, Gerd (1997), Dynamische Arbeitslosigkeit und diskontinuierliche Erwerbsverläufe. Wie stehen die Chancen für eine zukünftige Tätigkeitsgesellschaft? in: Berliner Debatte Initial, 6, 5, S. 23-36. Mutz, Gerd (1999), Strukturen einer Neuen Arbeitsgesellschaft. Der Zwang zur Gestaltung der Zeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft B 9, S. 3-11. Mutz, Gerd/ Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/ Bonß, Wolfgang/ Eder, Klaus/ Koenen, & Elmar J. (1995). Diskontinuierliche Erwerbsverläufe. Analysen zur postindustriellen Arbeitslosigkeit. Opladen: Leske + Budrich. Mutz, Gerd/ Kühnlein, Irene/ Holzer, Boris (1997), Struktur der Erwerbsorientierungen und Beschäftigungserwartungen west- und ostdeutscher Erwerbspersonen. (Gutachten im Auftrag der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen). München: MPS. Nullmeier, Frank (2004), Vermarktlichung des Sozialstaats, in: WSI-Mitteilungen 57, 9/ S. 495-500. Offe, Claus (1996), Moderne ‚Barberei’: Der Naturzustand im Kleinformat? in: Max Miller/ Hans-Georg Soeffner (Hrsg.), Modernität und Barberei: Soziologische Zeitdiagnose am Ende des 20. Jahrhunderts. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 258-289. Putnam, Robert D. (2000): Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster. Riester, Sabine (2007), Armut ist ungesund, in: Deutsches Ärzteblatt, Juni 2007, S. 272. Schmid, Günther (2000), Arbeitsplätze der Zukunft: Von standardisierten zu variablen Arbeitsverhältnissen, in: Kocka, Jürgen/ Offe, Claus (Hrsg.), Geschichte und Zukunft der Arbeit. Frankfurt/M.: Campus S. 269-292. Sennett, Richard (2005), Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Berlin Verlag. Stoppe, Gabriela/ Bramesfeld, Anke/ Schwartz, Friedrich-Wilhelm Bestandaufnahme und Perspektiven. Springer: Heidelberg. (2006), Volkskrankheit Depression? Unger, Hans-Peter (2008): Bevor der Job krank macht. Wie uns die heutige Arbeitswelt in die seelische Erschöpfung treibt und was man dagegen tun kann. Vortrag auf der Fachveranstaltung „Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz“, 19.02.2008, München. Voß, G. Günter (1995), Entwicklung und Eckpunkte des theoretischen Konzepts, in: Projektgruppe "Alltägliche Lebensführung" (Hrsg.), Alltägliche Lebensführung. Arrangements zwischen Traditionalität und Modernisierung. Opladen: Westdeutscher Verlag. Wacker, Ali (1983), Arbeitslosigkeit. Soziale und psychische Folgen. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt. 26 Weber, Andreas/ Hörmann, Georg/ Köllner, Volker, Psychische und Verhaltensstörungen. Die Epidemie des 21. Jahrhunderts? in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 4, April 2006, S. 169-172. WHO (2001a), World Health Report 2001, 11. http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf [Letzter Zugriff am 12.03.2008]. Verfügbar WHO (2001b), Strengthening mental health promotion, Geneva. Verfügbar http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/ [Letzter Zugriff am 12.03.2008]. unter: unter: WHO (2004), Prevention of Mental Disorders. Geneva. Verfügbar unter: http://www.who.int/mental_health/evidence/en/prevention_of_mental_disorders_sr.pdf [Letzter Zugriff am 12.03.2008]. Wittchen, Hans-Ulrich/ Müller, N./ Pfister, H./ Winter, S./ Schmidtkunz, B. (1999), Affektive, somatoforme und Angststörungen in Deutschland – Erste Ergebnisse des bundesweiten Zusatzsurveys „Psychische Störungen“. Gesundheitswesen, 61, Sonderheft 2, S. 216-222. Wittchen, Hans-Ulrich/ Jacobi, F. (2002), Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland. Eine klinischepidemiologische Abschätzung anhand des Bundes-Gesundheitssurveys 1998. Psychotherapeutenjournal, 0, S. 6-15. Wittchen, Hans-Ulrich (2005), Psychische Störungen in Deutschland und der EU. Größenordnung und Belastung. Vortrag auf dem 1. Deutschen Präventionskongress. Wittchen, Hans-Ulrich & Jacobi, F. (2005). Size and burden of mental disorders in Europe – a critical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology, 15, 357-376. Woolcock, Michael (2001), The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, in: ISUMA, Spring, S.11-17. 27