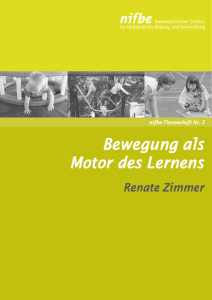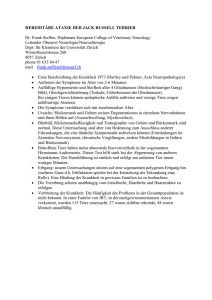Biologische Psychiatrie und Seele
Werbung

Forum Biologische Psychiatrie und Seele ■ F. Müller-Spahn Psychiatrische Klinik der Universität Basel Vortrag anlässlich der 32. Jahrestagung der Deutschsprachigen Gesellschaft für Kunst und Psychopathologie des Ausdrucks e.V. in Traben-Trabach vom 29.10.–01.11.1998, Prof. D. Bürgin zum 60. Geburtstag gewidmet. besondere der Schizophrenien und Hirnleistungsstörungen, geführt. Diesen modernen bildgebenden Verfahren verdanken wir faszinierende Einblicke in die Organisationsstruktur und Funktion des menschlichen Gehirns. Mit ihrer Hilfe ist es möglich geworden, die Aktivierung der verschiedenen Hirnareale beim Denken und der Wahrnehmung fotographisch abzubilden. Niemals zuvor hat sich unser Wissen über Prozesse der Informationsaufnahme und -verarbeitung, über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns sowie die Entstehungsbedingungen psychischer Störungen so vermehrt wie in der «Dekade des Gehirns», zu der der frühere Präsident der Vereinigten Staaten, George Bush, das letzte Dezennium dieses Jahrtausends deklariert hat. Ziel der neurowissenschaftlichen Techniken ist die Identifizierung genetischer, neuronaler, biochemischer und molekularer Mechanismen, d. h. der biologischen Organisation von normalen kognitiven und emotionalen Prozessen, und die Suche nach Modellen zur Erklärung ihrer Störungen bei psychisch Kranken. Droht nun die Neurobiologie, die Welt des Geistes auf physikalische Prozesse im Gehirn zu reduzieren, werden sich viele fragen. Unsere Kenntnisse über die biologischen Mechanismen von Wahrnehmung, Denken und Erinnern werden immer präziser, aber wissen wir damit, wie der immaterielle Geist Einfluss auf den materiellen Körper nimmt und umgekehrt? Mit der Molekularbiologie wurde der Aufbruch in ein neues Zeitalter der Medizin eingeleitet. Sie löste eine wissenschaftliche Revolution aus, machte aber auch die Janusköpfigkeit moderner Forschung deutlich: Einerseits ermöglicht sie bis dahin nicht vorstellbare Einblicke in die Organisationsstruktur des menschlichen Erbguts, anderseits birgt sie ein gewaltiges Potential an Missbrauchsmöglichkeiten in sich. Kritiker argwöhnen, die moderne Molekularbiologie habe sich längst des Menschen bemächtigt. Verkündete der Biophysiker Gregory Stock von der University of California in Los Angeles nicht unlängst, «wir übernehmen gerade die Kontrolle über unsere eigene Evolution»? Es gäbe keinen Weg, diese Technik aufzuhalten. Dämmert damit die Geburtsstunde einer neuen Ethik herauf? Entfachte nicht erst vor kurzem der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk eine heftige Diskussion mit seinen provo- zierenden Äusserungen über das «autoplastische Potential des Homo sapiens», über die «züchterische Steuerung der Reproduktion», er sprach sogar von «Menschenzucht» und «Anthropotechnik». In seinen «Regeln für den Menschenpark» entwarf er das Szenario einer zukünftigen Gesellschaftsform. Wäre demnach die Eugenik, ein Begriff, der übrigens nicht von den Nationalsozialisten geprägt wurde, sondern 1883 von Francis Galton, einem Vetter Darwins, der Königsweg für die Zukunft der menschlichen Entwicklung? Protagonisten träumen bereits von einer neuen Welt ohne Krankheit, frei von Aggressionen, einem humanistischen Weltbild verpflichtet. Droht Aldous Huxleys Roman «Schöne neue Welt» mit seinen Alpha- bis Epsilonmenschen Wirklichkeit zu werden? Ist die Züchtung von Zweitorganen für Schwerkranke aus Embryonalzellen nicht bereits das erklärte und wahrscheinlich technisch auch lösbare Ziel? Mit Hilfe der Gentechnologie wird erstmals die Entschlüsselung der molekularen Strukturen des gesamten menschlichen Erbguts mit seinen etwa 100 000 verschiedenen Genen möglich. Für viele wurde damit ein Pakt mit dem Teufel geschlossen, die Seele aus dem Mittelpunkt menschlicher Existenz verbannt und ein neuer Sündenfall eingeleitet. Die damit verbundene Entmythologisierung der Grundlagen menschlicher Existenz und das Vordringen in die letzten Geheimnisse des Lebens rüttelt an den ethischen Grundfesten eines traditionellen Wissenschaftsverständnisses. Das Dilemma zwischen technisch Machbarem und seiner moralischen Annehmbarkeit wurde von Papst Johannes Paul II. in seiner 13. Enzyklika «fides et ratio» 1998 aufgegriffen. Die Diskussion zwischen Anhängern und Gegnern der modernen Molekulargenetik gewinnt zunehmend an Schärfe und belebt aufs neue den alten, leidenschaftlich geführten Disput zwischen «Somatikern» und «Psychikern» mit der zentralen Frage, inwieweit psychische Störungen Folge von Erkrankungen des Gehirns seien oder Ausdruck primärer seelischer Störungen mit körperlichen Auswirkungen. Unter dem Diktat der Gene sei die Freiheit der menschlichen Selbstbestimmung bedroht, die Suche nach einem «biologischen Schlüssel zur Seele» wird als unzulässiger Eingriff in den Bauplan der Schöpfung und damit in das Werk Gottes erlebt. Fragen nach dem biologischen Substrat des Ich, des Bewusstseins SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE 151 ■ 1/2000 Die Psychiatrie lebt seit ihrer Geburtsstunde als klinisches Fach vor knapp 200 Jahren in dem Spannungsfeld zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Die z.T. sehr kontrovers geführte Leib/Seele-Diskussion hat die Forschung über die biologische Organisation des Denkens, der Gefühle und des Gedächtnisses enorm beflügelt. In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts vollzog die Psychiatrie einen wichtigen Wandel. Nach einer Epoche umfassender psychodynamischer, anthropologischer und daseinsanalytischer Forschungsansätze begann das Pendel in das andere Extrem zu schwingen, in Richtung der sogenannten biologischen Psychiatrie. Jede psychische Störung hat eine biologische, soziale und eine psychologische Dimension, insofern ist die ausschliessliche Fokussierung auf einen Teilaspekt menschlichen Denkens und Fühlens, wie sie in der Vergangenheit von orthodoxen Vertretern der psychoanalytischen Psychotherapie und Sozialpsychiatrie sowie der biologisch orientierten Psychiatrie gefordert worden ist, nicht gerechtfertigt. Letztere beschäftigt sich mit den organischen Grundlagen psychischer Störungen und versucht, Antworten darauf zu geben, wie das menschliche Gehirn arbeitet und wie sich psychische Erkrankungen als Folge biologischer Veränderungen beeinflussen lassen. Dies war zunächst verbunden mit einer intensiven und konsequenten Suche nach effizienten und biologisch begründbaren Therapiestrategien. So hat sich z. B. das Grundlagenwissen in der Psychopharmakologie in den letzten drei Jahrzehnten erheblich verbessert. Die stürmische Entwicklung neuartiger Untersuchungsmethoden im Bereich der bildgebenden Verfahren wie der Kernspintomographie und der Positronenemissionstomographie oder in der Molekularbiologie haben zu neuen Erkenntnissen über mögliche Ursachen psychischer Störungen, ins- Korrespondenz: Prof. Dr. med. Franz Müller-Spahn Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Klinik der Universität Basel Wilhelm Klein-Strasse 27 CH-4025 Basel 37 und der Persönlichkeit drängen immer mehr in den Mittelpunkt einer naturwissenschaftlich orientierten Forschung. Rückt damit auch der «Genchip» zur Identifizierung gesunder und kranker Erbanlagen bzw. risikomodulierender Gene in den Bereich der Wahrscheinlichkeit? Darf ein Mensch bereits als potentiell krank betrachtet werden, wenn er eine genetische Veränderung in sich trägt, die zu einem erhöhten Risiko z. B. für eine Alzheimersche Erkrankung ab dem 60. oder 70. Lebensjahr führen könne? Wie wird der Einzelne und die Gesellschaft mit einer derartigen Information umgehen? Ist das Gehirn lediglich eine Art biologischer Hochleistungsrechner, dessen filigrane Funktionsweise durch Computermodelle im Rahmen neuropsychologischer Forschung simuliert werden kann? Könnte nicht der Wunsch entstehen, genetische Tests für Charaktereigenschaften bzw. Intelligenz kommerziell anzubieten? Sind wir letztlich Sklaven unserer Gene und damit in unserem Verhalten festgelegt – Charaktereigenschaften als Reflexionen des Erbguts, die Seele als Schattenbild physikalisch-neurochemischer Prozesse? Auch wenn diese Fragen noch lange Rätsel aufgeben werden, scheint doch klar zu sein, dass sich die menschliche Persönlichkeit aus dem komplexen Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt, «nature und nurture» (Francis Galton, 1822–1911), herausbildet und sich psychische Phänomene nicht mit monogenetischen Modellen erklären lassen. Die Klonierung des Schafes Dolly 1997 markierte einen Wendepunkt in den bisherigen naturwissenschaftlichen Traditionen. Damit war erstmals die Schaffung eines Organismus ohne geschlechtliche Zeugung möglich geworden. Sind damit die Voraussetzungen für das Klonieren eines Menschen mit bestimmten, perfekt kontrollierten und geplanten Erbanlagen geschaffen? Wäre eine derartige ungeschlechtliche Fortpflanzung überhaupt im Sinne der biologischen Evolution? Würde dies nicht die notwendige Mischung von Erbanlagen und damit die Anpassung an veränderte Umweltbedingungen dramatisch erschweren? Kann es das Ziel genetischer Forschung sein, einen identischen Zwillingsbruder zu schaffen, der 30–50 Jahre jünger ist? Derartige, von einem hemmungslosen Fortschrittsglauben getragene Konzeptionen lösen Ängste, Misstrauen und Ablehnung aus. Für die einen bedeuten sie einen nicht akzeptablen Eingriff in die Schöpfung, für die anderen ist die Zurückführung der menschlichen Persönlichkeit auf seine Gene ein massiver und unzulässiger Reduktionismus. Ist die Hoffnung, das menschliche Bewusstsein, den Geist und die Seele als Funktion des Gehirns erklären zu können, nicht a priori zum Scheitern verurteilt? Sind sie mit Begriffen aus der Physik, der Molekularbiologie, Chemie und der Informatik überhaupt definierbar? Allen naturwissenschaftlichen Bemühungen zum Trotz sind diese fundamentalen Fragen des Zusammenspiels von Leib und Seele weitgehend ungeklärt und werden es vielleicht auch bleiben müssen. Auf letzteres 38 wies bereits Goethe (1789–1830) in seinen Betrachtungen über die Naturwissenschaft hin. «Die Natur hat sich soviel Freiheit vorbehalten, dass wir mit Wissen und Wissenschaft ihr nicht durchgängig beikommen oder sie in die Enge treiben können.» Frühversuche, dieses Rätsel zu entschlüsseln, wurden bereits von dem Stauffer Kaiser, Friedrich II., unternommen. Es wird berichtet, dass er Gefangene bei lebendigem Leib habe luftdicht einmauern lassen, bis sie verstorben seien. Er wollte damit in Erfahrung bringen, ob beim Öffnen der Kerker der Geist entweiche. Die kognitive Neurowissenschaft ist ein klassisches Beispiel für einen biologisch orientierten, interdisziplinären Forschungsansatz. Unter Kognition verstehen wir dabei jene Prozesse der Informationsaufnahme und -verarbeitung wie Wahrnehmung, Denken, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernen, Planen, die sprachliche Ausdrucksfähigkeit sowie die Urteilsfähigkeit. An die kognitiven Neurowissenschaften wurde die Hoffnung geknüpft, menschliches Verhalten durch physikalische und biochemische Prozesse im Gehirn erklären zu können. Sie basiert auf unterschiedlichen Forschungsstrategien: 1. In den sechziger Jahren wurden elektrophysiologische Verfahren entwickelt, um die Aktivität einzelner Gehirnzellen zu untersuchen. Damit war die Überprüfung von Informationsverarbeitungsprozessen auf zellulärer Ebene erstmals möglich geworden. 2. Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen komplexen kognitiven Leistungen, wie z. B. Aufmerksamkeit oder Entwicklung von Handlungsentwürfen, scheinen mit Aktivitätsmustern bestimmter Zellen in definierten Hirnregionen zu korrelieren. Damit war bereits eine differenziertere Analyse der Informationsverarbeitung möglich. 3. Mit Hilfe neuer bildgebender Verfahren wie der Positronenemissionstomographie wurde eine präzisere Darstellung normaler und pathologischer Hirnfunktionen während sensorischer, motorischer oder kognitiver Leistungen möglich. Damit verbunden ist die Hoffnung, neue, funktionsbezogene Kartierungen neuronaler Systeme zu entwickeln. 4. Auch die Informatik hat wesentlichen Anteil am enormen Wissenszuwachs in den kognitiven Neurowissenschaften. So versuchte man mit Hilfe von Computermodellen die Aktivität grosser Nervenzellverbände zu simulieren, um damit besser die Eigenschaften eines neuronalen Netzwerks verstehen zu können. Kognitive Prozesse sind in vielerlei Hinsicht mit Computerprogrammen vergleichbar, da beide Informationen aufnehmen, umwandeln, speichern und wiedergeben. Das Gehirn ist nur deshalb in der Lage, so herausragende Leistungen zu vollbringen, weil seine Bausteine, die Nervenzellen, mit einer geschätzten Speicherkapazität von mehr als 100 Billionen Bits exakt und geordnet miteinander verschaltet sind. Die kognitive Neurowissenschaft beschäftigt sich in erster Linie mit der neuronalen Repräsentation kognitiver Prozesse, d. h. jede Wahrnehmung, jeder psychische Vorgang ist mit einem charakteristischen Aktivitätsmuster in einer bestimmten Population miteinander vernetzter Nervenzellen korreliert. Das Gehirn verschafft sich mit Hilfe neuronaler Oszillationen bestimmte Aktivierungsmuster, diese gelten als die Voraussetzung für die Verarbeitung von Informationen. Sind damit aber Phänomene wie Intuition, Kreativität und Bewusstsein erklärbar? Wir vermuten heute, dass mindestens ein Drittel der etwa einer Billion Nervenzellen direkt an der Informationsverarbeitung beteiligt ist. Das Gehirn ist letztlich eine lebenslange Baustelle; Lernen und Gedächtnis und damit die personale Identität sind Folge permanenter Umstrukturierungen der Kontakte zwischen den Nervenzellen. Das ständige Oszillieren dieses engen Netzwerks von Nervenzellen und Nervenzellfortsätzen wurde von dem britischen Biochemiker und Nobelpreisträger Francis Crick und seinem Kollegen Christoph Koch als biologisches Substrat des Bewusstseins bzw. der Gedanken betrachtet. Vielleicht ist dies nur eine waghalsige Spekulation, es könnte aber auch ein ebenso simples wie geniales Erklärungsmodell für den Geist sein. Das philosophische Bild der Seele ist sehr vielgestaltig und empirisch nicht fassbar. Häufig wird – aus meiner Sicht unzulässig – der abstrakte Begriff Seele mit Psyche gleichgesetzt; hiesse dies doch ein immaterielles Phänomen mit der Endlichkeit des Seins – sofern die Psyche an die Funktion des Gehirns gebunden ist – in Beziehung setzen. Inwieweit in der Psyche die Gestaltungskraft der Seele wirksam wird – sofern man deren Existenz nicht grundsätzlich in Zweifel zieht –, lässt sich kaum ermessen. In diesem Sinne wäre die Seele letztlich die Matrix, aus der heraus sich die Eigenheiten der Persönlichkeit entwickelten. Wird die Psyche jedoch vor dem Hintergrund einer ausschliesslich biologisch-materialistischen Sichtweise lediglich als eine Funktion des Gehirns definiert – wie dies z. B. Eugen Bleuler 1921 in seiner «Naturgeschichte der Seele und ihres Bewusstwerdens» formulierte [1], stirbt sie mit dem Gehirn. Unser Wille und Handeln wäre demzufolge «begründet in der angeborenen Organisation und den auf diese einwirkenden Einflüssen». An Erklärungsversuchen zur Lokalisation der Seele im menschlichen Körper hat es in der Vergangenheit nicht gefehlt. Seit Jahrtausenden waren die Menschen davon überzeugt, dass ihr Verhalten durch einen Geist oder eine Seele gesteuert wird. Zu den ältesten uns überlieferten Hypothesen gehören jene von Alkmaion und Empedokles. Alkmaion war davon überzeugt, dass das Gehirn das Organ des Geistes sein müsse, und formulierte die sogenannte Gehirnhypothese. Empedokles dagegen sah das Herz als zentrales Organ geistiger Aktivität an, eine Vorstellung, die wir als Herzhypothese bezeichnen. Platon entwickelte SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE 151 ■ 1/2000 das Konzept einer dreigeteilten Seele und war davon überzeugt, dass der rationale Teil im Gehirn liegen müsse, da dieses Organ dem Himmel am nächsten gelegen sei. Die unsichtbare und unsterbliche Seele trete aus dem Reich der Ideen in den Körper ein. Der griechische Philosoph Aristoteles, der die Gehirnstrukturen gut kannte, vertrat die Auffassung, dass das Herz als Quelle geistiger Aktivitäten zu gelten habe, da es «warm und aktiv sei» und das Gehirn aufgrund seiner «Kälte und Inaktivität» zur Kühlung des Blutes dienen müsse, und unterschied die vegetative Seele von der sensitiven und rationalen. Psychische Störungen waren bereits in der Antike bekannt und wurden im Vorgriff auf heutige biologische Modelle von Hippokrates im Sinne einer Störung des VierSäfte-Gleichgewichts erklärt, z. B. die Depression bei Überwiegen der schwarzen Galle. August Bier [2] wies in seinem Buch «Die Seele» 1939 darauf hin, dass Hippokrates keineswegs, wie von vielen Geschichtsschreibern behauptet, das Gehirn als Sitz der Seele bezeichnet habe. «Die das Weltall erfüllende Seele werde vielmehr eingeatmet und in erster Linie vom Gehirn verarbeitet so wie der Magen die Nahrung verdaue. Aber neben dem Gehirn bemächtige sich auch der übrige Körper, insbesondere das Herz, das Ohr und das Zwerchfell der eingeatmeten Seele.» Im christlichen Mittelalter erfreute sich die empirische Forschung keines besonders hohen Ansehens, Krankheit wurde in erster Linie als Strafe Gottes für sündhaftes Verhalten aufgefasst. Psychische Störungen wurden vor allem im Zusammenhang mit dämonischen Einflüssen und Besessenheit gesehen. Unsere neuzeitlichen Vorstellungen von Geist und Verstand wurden im wesentlichen durch die dualistische Sichtweise des französischen Philosophen, Mathematikers und Naturwissenschaftlers René Descartes (1596–1650) geprägt. Platons Begriff einer dreigeteilten Seele wurde durch den eines einheitlichen freien, umfassenden und unsterblichen Geistes ersetzt. Dieser sei immateriell und damit von dem materiellen Körper zu trennen. Letzterer wurde als eine streng nach naturwissenschaftlichen Gesetzen arbeitende Maschine begriffen, die von der freien, unsterblichen Seele gesteuert werde. Der menschliche Leib wurde damit zum Objekt der naturwissenschaftlichen Forschung, während der menschliche Geist, die res cogitans, der Kirche überlassen wurde. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, dieses berühmte Diktum von Descartes wurde zum Credo der modernen Naturwissenschaften. Er lokalisierte den Geist in die Zirbeldrüse (Epiphyse) ausgehend von der Beobachtung, dass dies die einzige nicht bilateral angelegte Struktur des Nervensystems sei. Descartes dualistische Sichtweise übt noch heute einen beträchtlichen Einfluss auf die westliche Natur- und Geisteswissenschaft aus. Seine Trennung von Körper und Geist trug zur Verkümmerung des philosophischen Denkens und Wissens in der Medizin bei. Eine philosophische 39 Interpretation des Krankseins wurde damit erschwert, die Heilkunst im klassischen Sinne des Wortes zur biologischen Technik reduziert. Diese Betrachtungsweise habe nach Ansicht von Emil Kraepelin (1856– 1926), dem Nestor der deutschsprachigen Psychiatrie, «einer wissenschaftlichen Entwicklung der Psychiatrie ausserordentlich hindernd im Wege gestanden, da sie das Forschungsobjekt derselben aus dem Bereiche der Erfahrungswissenschaft in denjenigen der Spekulation verpflanzte». Psychische Folgen von somatischen Erkrankungen wurden in der Folgezeit ähnlich vernachlässigt wie körperliche Auswirkungen psychischer Konflikte, ein Umstand, auf den der amerikanische Neurologe Antonio Damasio wiederholt hingewiesen hat. Ohne Zweifel hat diese Sichtweise aber auch zu wichtigen Impulsen in der Naturwissenschaft geführt. Die Argumentation zugunsten einer Lokalisation von bestimmten Hirnfunktionen und damit der anatomischen Basis zur Beschreibung von Charaktereigenschaften begann mit der sogenannten phrenologischen Theorie der beiden Anatomen Franz Josef Gall und Caspar Spurzheim im 18. Jahrhundert. Bereits sehr früh machte Gall die Beobachtung, dass Menschen mit einem guten Gedächtnis grosse, hervortretende Augen hätten, und schloss daraus, dass ein besonders gut entwickeltes Gedächtnis hinter den Augen lokalisiert sein müsste. Davon ausgehend überprüften beide die äusseren Merkmale des Schädels auf Erhöhungen und Vertiefungen und brachten dies in engen Zusammenhang mit bestimmten Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen, die sie Vermögen nannten. Eine Vorwölbung des Schädels war damit Ausdruck einer besonders aktiven Hirnregion und demzufolge einer speziellen Fähigkeit. Ihrer These zufolge wies z. B. eine Person mit einer Vorwölbung im Bereich des Processus mastoideus bzw. der Hinterhauptschuppe ein besonders sinnliches Verhalten auf, andere Regionen wiesen auf eine erhöhte Streitlust oder Verschlossenheit hin. Die phrenologische Theorie geriet aber trotz ihrer zunächst bestechenden Argumentation schon bald in Verruf, nicht zuletzt deshalb, weil sich ihre Vermutung, das Gehirn sei aus unabhängig voneinander arbeitenden Einheiten zusammengesetzt, als falsch erwiesen hatte. Auch entsprach die sogenannte Vermögenspsychologie nicht dem tatsächlichen Verhalten. Die Funktion der Hirnrinde und des Hirnstamms war lange Zeit Gegenstand unterschiedlichster Spekulationen. Reichhardt [3] vermutete im Hirnstamm das Bindeglied zwischen Seele, Gehirn und Körper und vertrat die Auffassung, dass er in engen Beziehungen zu jenen seelischen Prozessen stünde, die «man als das Triebwerk zum Denken und Fühlen bezeichnen» könne. Für Ewald war der Cortex der Sitz der Intelligenz, der Thalamus dagegen für die höheren Gefühle sowie die Medulla oblongata und das Höhlengrau des dritten Ventrikels für die Triebe verantwortlich. Eugen Bleuler (1857–1939) [4] befürchtete 1925, dass der Hirnrinde nurmehr die Rolle eines «beratenden Konversationslexikons» zuge- billigt werde. Küppers [5] bot eine noch simplifiziertere Sichtweise an, indem er «die Seele» in «ein paar Ganglienzellen am Boden des dritten Ventrikels» lokalisierte. 1859 unternahm der Physiker, Psychologe und Philosoph Fechner (1801–1887) [6] den Versuch, eine «psychophysische Massformel» zu entwickeln, d. h. eine einfache mathematische Beziehung, mit der man den Übergang vom Körperlichen in das Seelische beschreiben könne. Dieser Versuch musste zwangsläufig scheitern, Seele als Lebenskraft, als Abbild der Harmonie des Körpers (Pythagoras), als selbstbewusster Geist (Eccles) [7], lässt sich nicht als einfach messbare Grösse beschreiben. Diese Folgerung zog Immanuel Kant (1724–1804) [8] bereits 50 Jahre vorher. Eine exakte psychologische Forschung sei problematisch, da man Seelisches nicht wissen könne, und nur was sich messen liesse, sei auch mathematisch berechenbar. Otto Creutzfeld, einer der führenden Naturwissenschaftler der Gegenwart, bestätigt diese Sichtweise und zieht folgenden Schluss: «Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, die Existenz von Bewusstsein und Geist in biochemischen, biophysikalischen oder anatomischen Begriffen zu definieren oder gar zu beweisen.» Heute wissen wir, dass Emotionen ein integraler Bestandteil kognitiver und biologischer Prozesse und auf die enge Wechselwirkung zwischen neokortikalen Regionen und den phylogenetisch sehr alten Strukturen des Stammhirns zurückzuführen sind, dabei scheinen der Hypothalamus und die Amygdala eine Schlüsselrolle einzunehmen. Ein Erklärungsmodell für dieses komplexe Zusammenspiel bot der australische Physiologe und Nobelpreisträger John Eccles mit seinen grundlegenden Arbeiten zur Erregungsübertragung an den Synapsen an; ihm zufolge hängt die Interaktion zwischen Geist und Gehirn von der Anordnung der zerebralen Neurone in sogenannten Modulen ab, die ihrerseits ein subtiles inneres dynamisches Leben besitzen, das auf der «kollektiven Interaktion seiner vielen Tausenden von Neuronenbestandteilen basiert». Die heutige naturwissenschaftlich orientierte Kognitionsforschung lässt häufig den Aspekt der untrennbaren Verbindung zwischen Denken und Gefühl ausser acht. Vielleicht hat Gustav Mahler recht, wenn er meint, «die einzige Wahrheit auf der Erde sei unser Gefühl». 1937 stellte der amerikanische Wissenschaftler Papez die gewagte Frage: «Ist Emotion ein Produkt der Magie oder ist es ein physiologischer Prozess, der von anatomischen Mechanismen abhängt?» Papez vermutete, dass das emotionale Gehirn in erster Linie ein Produkt des sogenannten limbischen Systems sei. Heute wissen wir, dass das limbische System nicht nur für das emotionale Gedächtnis, sondern auch für eine Vielzahl anderer kognitiver Prozesse wichtig ist. Die Kontroverse Soma versus Psyche hat die Diskussion über die inneren Beziehungen zwischen Medizin und Philosophie, zwischen naturwissenschaftlichem Grundverständnis und den Sinnfragen des Lebens SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE 151 ■ 1/2000 in den vergangenen 200 Jahren geprägt. Mit Wilhelm Griesingers (1817–1868) Postulat, dass psychische Störungen Folge von Erkrankungen des Gehirns seien, wurde die Psychiatrie in den Kreis der naturwissenschaftlichen medizinischen Fächer aufgenommen. Auch für Emil Kraepelin gehörte diese Fachdisziplin «dem Kreise der ärztlichen Wissenschaften an und bedient sich wie diese letzteren bei ihren Untersuchungen der Hülfsmittel und Methoden wissenschaftlicher Forschung». Während für Kant die Psychiatrie ein Teilgebiet der Philosophie war, für die Protagonisten des Animismus wie Johann Heinroth Geisteskrankheiten als Folge der Sünde begriffen wurden und erbliche Faktoren in diesem Kontext keine Rolle spielten, da die Seele immer wieder neu von Gott verliehen werde, versuchen moderne Molekulargenetiker psychische Störungen in Zusammenhang mit genetischen Veränderungen zu erklären. Die ausschliesslich biologisch orientierte Psychiatrie läuft dabei Gefahr, das Innenleben des Menschen, die Fragen nach der Entstehung von Intuition und Kreativität und den Ursprüngen des Geistes und des Bewusstseins auszuklammern und sich in einem strengen behavioristischen Sinne als Naturwissenschaft, die sich ausschliesslich auf die objektive Beobachtung menschlichen Verhaltens bezieht, zu definieren. Für den amerikanischen Psychologen J. B. Watson (1878–1958), einen klassischenVertreter des Behaviorismus, war die Gemütsbewegung lediglich eine ererbte, schablonenhafte Reaktion; bezüglich der Seele vertrat er die Auffassung, dass «kein Mensch sie je berührt und sie in einer Versuchsröhre gesehen habe» und teilte damit Rudolf Virchows (1821–1902) Meinung: «Ich habe bei tausenden Sektionen keine Seele gefunden». «Mit dem methodologischen Reduktionismus einer sich als angewandte Naturwissenschaft verstehenden Medizin musste folgerichtig auch das Atmosphärische eines philosophischen Denkens und Wissens mehr und mehr verkümmern» (Schipperges und von Engelhart 1980) [9]. Oswald Bumke (1877–1950) [10] wies in seinem Buch «Gedanken über die Seele» bereits 1941 darauf hin, dass die «naturwissenschaftliche Medizin die Tendenz habe, sich dem Exakten zu unterwerfen, statt es zu nutzen, der Arzt selber scheine zum Techniker» geworden zu sein. Diese Tendenz zur blossen Technik werde gesteigert mit der «Einschränkung der naturwissenschaftlichen Forschung auf das Exakte und der Verkümmerung des Sinnes für das Biologische, des morphologischen Sehens, des Erspürens im Lebendigen». Bumke war es auch, der geltend machte, dass es «ausser der naturwissenschaftlichen Erkenntnis in der Psychiatrie auch eine verstehende Einsicht» gäbe. Mit naturwissenschaftlicher Forschung würden Fortschritte erzielt, mit den Mitteln des Verstehens aber eine Welt von Sinngehalten eröffnet. Der Arzt der Seele sei für den modernen Menschen zum «Techniker der Seele geworden, der das Glück wieder herstellen könne». 40 Dieser Vortrag hat mehr Fragen aufgeworfen, als er imstande war, zu beantworten, aber dies liegt in der Natur der Grundproblematik der Faustschen Frage, «was die Welt im Innersten zusammenhält». Wenn man die Bedeutung von Denkprozessen und Empfindungen akzeptiert, und daran gibt es keinen Zweifel, sollte man sich auch bemühen, ihre komplexen biologischen und sozialen Mechanismen zu verstehen. Vor allem mit Hilfe molekularbiologischer Methoden haben wir sehr viel über die Kommunikation zwischen den Zellen und innerhalb der Zellen erfahren. Nach wie vor sind wir jedoch noch weit davon entfernt, das Zusammenspiel zwischen Geist und Körper voll zu begreifen. Vielleicht «atmet die Seele durch den Körper», wie dies der Neurologe Antonio Damasio [11] so treffend formuliert hat. So bleibt die Frage nach den inneren Beziehungen zwischen Körper und Seele nach wie vor ungeklärt. Darüber kann auch die atemberaubende Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in den Naturwissenschaften nicht hinwegtäuschen. Die uralte und immer wieder aktuelle Schicksalsfrage der Menschheit nach den inneren Verbindungen von Geist, Psyche und Soma, nach dem biologischen Substrat der menschlichen Persönlichkeit und nach der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen angesichts der Macht des Genoms wird zunächst weiterhin ein Mysterium bleiben. Es zu ergründen, ist die gemeinsame Aufgabe der Philosophie, Psychologie und Biologie. Die Empirie bedarf der Hermeneutik. Die moderne Naturwissenschaft ist ohne geisteswissenschaftliche Einbindung fragwürdig. Derzeit besteht offenbar eine allgemeine Tendenz, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Funktion des Gehirns überzubewerten. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Medizin wieder auf ihre tiefen metaphysischen Wurzeln besinnt. Die Seele wird nie eine mit naturwissenschaftlichen Methoden berechenbare Grösse sein. Verbunden mit der Explosion unseres genetischen Wissens ist der Wunsch nach Realisierung utopischer Ziele, etwa die Schaffung eines bestimmten Menschentypus mit sozial erwünschten Charaktereigenschaften, die jeweils Ausdruck des politischen und gesellschaftlichen Klimas und des daraus resultierenden Menschenbilds sein könnten. Ihn zu erfüllen, kann und darf nicht zur Aufgabe der Molekulargenetik werden. Ich möchte mit einem Zitat von Goethe in seinen Betrachtungen über die Naturwissenschaft schliessen: «Der Mensch muss bei dem Glauben verharren, dass das Unbegreifliche begreiflich sei, er würde sonst nicht forschen.» und an anderer Stelle: «Das schönste Glück des denkenden Menschen ist es, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren». Die unendliche Geschichte der inneren Beziehungen zwischen Leib und Seele wird noch um viele Kapitel verlängert werden. Die Vision, den Schleier über den letzten Geheimnissen des Lebens zu lüften, ist faszinierend, aber vermutlich nicht realisierbar. Die ausschliesslich biologische Fundierung seelischer Vorgänge dürfte ein Mysterium SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE bleiben. Möglicherweise verweigert sich die Biologie in dieser Hinsicht den in sie gesetzten Hoffnungen. Literatur 1 Bleuler E. Naturgeschichte der Seele und ihres Bewusstwerdens. Berlin: Julius Springer; 1921. 2 Bier A. Die Seele. München, Berlin: Lehmann; 1939. 3 Reichhardt M. Hirnstamm und Psychiatrie. Mschr Psychiatr 1928;68:470. 4 Bleuler E. Lokalisation der Psyche. Allg Z Psychiatr 1924;80:305. 5 Küppers E. Die Auflösung des Leib-SeeleProblems. Arch Psychiatr 1925;74:565. 6 Fechner GT. Elemente der Psychophysik. Leipzig: Breitkopf und Här tel; 1907. 7 Popper KR, Eccles JC. Das Ich und sein Gehirn. München, Zürich: Piper; 1982. 8 Kant I. Anthropologie. Sämtliche Werke, Bd VII. Leipzig: Voss; 1868. 9 von Engelhardt D, Schipperges H. Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20. Jahrhunder t. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft; 1980. 10 Bumke O. Gedanken über die Seele. Berlin: Springer; 1941. 11 Damasio AR. Descar tes’ Irr tum. München, Leipzig: List; 1996. 151 ■ 1/2000