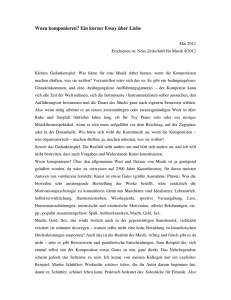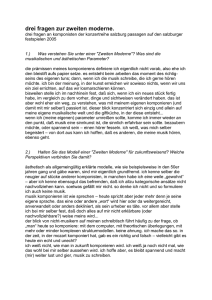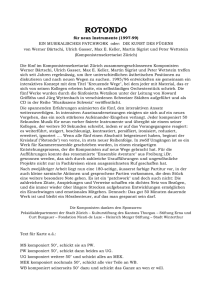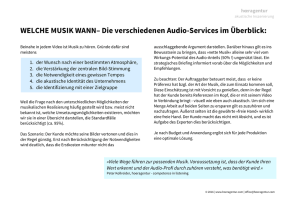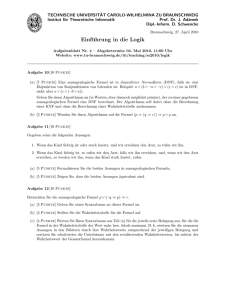David Paul im Gespräch mit Karlheinz Stockhausen
Werbung

David Paul im Gespräch mit Karlheinz Stockhausen David Paul: Als Sie jung waren, wollten Sie Dichter werden, und Sie korrespondierten mit Hermann Hesse. Karlheinz Stockhausen: Ja. Ich schrieb viele Gedichte und dazwischen Romane und kürzere Geschichten. Und er wollte er Sie dazu bewegen, damit nicht aufzuhören? Ja. Ich schickte ihm Gedichte und er antwortete sehr freundlich und schrieb, dass ich weitermachen solle, und ich war überzeugt davon, dass es sinnvoll ist, Gedichte zu schreiben. Schreiben Sie noch immer? Ich habe die Texte aller meiner Werke geschrieben, außer Das Lied der Lieder in Momente natürlich; auch der Text in Gesang der Jünglinge stammt aus der Bibel, und zwar aus dem Buch der Könige. Mein Libretto zu Unsichtbare Chöre basiert wiederum auf Texten aus der Apokalypse und ist zum Teil in Hebräisch. Sie haben sich aber stattdessen für die Musik entschieden. Ja. In dem Augenblick, da ich spürte, dass das musikalische Komponieren meinen Neigungen mehr entsprach, habe ich das Dichten aufgegeben und mein Leben der Komposition gewidmet. Sie schrieben Ihre Diplomarbeit über Bartóks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug und schienen überhaupt eine Zeit lang an Bartók interessiert zu sein. Als ich mein Staatsexamen als Pianist machte, spielte ich einige Werke von Bartók. Ich mochte seine Arbeit sehr und hatte während meiner Studienzeit mehrere Aufführungen der Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug gehört. Ich widmete mich ein ganzes Jahr lang diesem Werk, analysierte jede Note. Es klingt plausibel, dass man sich für Bartók interessiert, wenn man sich auf das Klavier konzentriert. Ja. Er war offenbar ein exzellenter Pianist und gab zusammen mit seiner Frau Konzerte. Danach haben Sie den Zauberer Adrion am Klavier begleitet. Ach, das war ein Teilzeitjob. Von 1947 bis 1951 spielte ich fast jeden Abend in Clubs und Bars in Köln, manchmal sogar am Nachmittag in Cafés, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und gegen Ende meines Studiums, 1950, kam ein Zauberer in das Studentenheim und bat mich zu improvisieren. Ich war ja dafür unter den Studenten und jüngeren Musikern in Köln bekannt. Ich improvisierte also für ihn und arbeitete danach mit ihm zusammen. Wir reisten durch ganz Deutschland, er führte seine Zauberkunststücke vor und ich spielte Klavier, improvisierte zu seinen verschiedenen Tricks. Folgten Sie dabei seinen Bewegungen? Ja. Und meistens lenkte ich das Publikum von seinen Bewegungen ab, damit es nicht mitbekam, was passierte. Sie haben also einen populärmusikalischen Background? Das kann man wohl sagen! Obwohl meine Familie sehr arm war, hatten wir bereits ein Radio und ein altes Pianino. Ich war damals neun oder zehn Jahre alt und spielte auf dem Pianino nach, was ich im Radio hörte. Ich konnte also Schlager und sehr populäre Melodien spielen. In Altenberg nahm mich mein Vater sonntags immer in ein Restaurant mit und sagte: «Los, spiel was.» Ich schämte mich anfangs, aber später war ich mutiger. Mein Klavierlehrer, Herr Kloth, ein wunderbarer Mensch, war nämlich mit der Besitzerin dieses Restaurants verheiratet. Und ich spielte dort, manchmal eine Stunde lang, und bekam dann etwas Geld. Und den Gästen machte es Spaß, mit mir mitzusingen. Hören Sie heute Ihren Einfluss in der Musik? In letzter Zeit haben viele Popmusiker behauptet, dass sie von meiner Arbeit einiges gelernt haben, vermutlich weil sich jetzt alle so für elektronische Musik und elektronische Klangsynthese interessieren. Die meisten sampeln Musik, bearbeiten aber dann die Samples. Die berühmtesten kennen meine Arbeit tatsächlich ziemlich gut. Einige von ihnen haben bei mir studiert. Auch in den Staaten, die Musiker von Grateful Dead oder Jefferson Airplane besuchten 1966– 67 meine Kompositionsklassen in Davis, Kalifornien. Et cetera. Unterscheiden Sie zwischen der sogenannten «ernsten» und der «populären» Musik? Das Wort «ernst» ist vielleicht etwas missverständlich. Ich bin nämlich todernst, wenn ich versuche, etwas zu erfinden oder etwas zu entdecken, das ich nicht kenne, und das ist jedesmal so, wenn ich eine neue Arbeit beginne. Die ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT Musik, die der Mode unterworfen ist, die also im Radio gespielt und von vielen Menschen gekauft wird und die auch von den Produzenten leicht verkauft werden kann – das ist eine Art von Musik; sie passt sich der Nachfrage, dem Geschmack, der Werbung etc. an. Wohingegen sich die Musik, die mir seit 1950 vorschwebt, einer derartigen Beziehung zwischen mir und den Menschen verweigert. Ich mache nämlich das, was ich im Inneren höre, was ich spannend finde und was mir selbst oft gänzlich neu ist. Es gibt also einen enormen Unterschied zwischen Gebrauchsmusik oder kommerzieller Musik und Kunstmusik. Ich sage dazu Kunstmusik, nicht «ernste» Musik. Oft ist es sehr humorvolle Musik; sie ist nicht nur ernst. Also, sie ist beides. Aber ich nenne sie Kunstmusik im Gegensatz zur kommerziellen Musik. Blickt man auf anerkannte Meister zurück, ist Mozart das augenfälligste Beispiel eines Künstlers, der sein Handwerk perfekt beherrschte, sich aber der kommerziellen Einschränkungen bewusst war. Nun ja, er war angestellt! [lacht] Solange er nur für den Erzbischof arbeitete, musste er sich stilistisch nach der Kirchenmusik richten. Und sowie er mit den aristokratischen Gesellschaftsschichten in verschiedenen Städten in Kontakt kam, insbesondere in Wien, wo ein Konkurrenzkampf mit den berühmten Italienern herrschte, passte er sich dem Stil an, der en vogue war. Sogar bei Johann Sebastian Bach, der vorsichtig sein musste, war es nicht anders. Corelli, Vivaldi und Rameau waren ja für ihn Modekomponisten. Er studierte sie und imitierte sie in hohem Maße. Was aber dann Bach zu Bach machte ist das, was er anders gemacht hat. Und genau das macht ihn auch heute noch zu jemandem, der einen wichtigen Beitrag zu unserer geistigen Entwicklung geleistet hat, und bei Mozart ist das im Hinblick auf ein paar Werke ebenfalls der Fall. Alle anderen sind modische Kompositionen im Stil seiner Zeit. Er hat sich, als Angestellter, einfach an den Stil des Hofes angepasst. Genau. Der Unterschied zwischen Kunstmusik und populärer Musik hat also eigentlich nichts mit Stil zu tun, sondern damit, wie man seine Energie auf etwas verwendet oder woher man seine Ideen bezieht. Mich hat ja glücklicherweise nie jemand als Komponist angestellt. Ich muss daher nicht auf Leute hören, die mich bezahlen, muss nicht darauf achten, was sie wollen oder was ihnen nicht gefällt. Ich habe meinen Lebensunterhalt mit anderen Arbeiten verdient, zum Beispiel als Dirigent. Ich habe viele, viele Jahre als Tontechniker fürs Radio gearbeitet, habe die Kompositionen von anderen im Studio für elektronische Musik umgesetzt, viele Texte für Spätprogramme geschrieben, Werke von anderen analysiert. Im Laufe der Zeit habe ich auch dirigieren gelernt, und jetzt bin ich ein Sound Projectionist, ich kann also genug verdienen, um von ein paar Konzerten im Jahr zu leben, und bin noch dazu von niemandem abhängig, der den Stil meiner Musik kritisiert – verstehen Sie, was ich meine? Sie neigen in Ihrer Arbeit dazu, das Kolossale anzustreben. Sie sind ein Idealist, verfolgen Ihre Pläne mit ungewöhnlicher Ausdauer, und Ihr Ansatz ist metaphysisch in dem Sinne, dass Sie über das Profane hinausgehen, die Grenzen des Menschseins überschreiten wollen. Richtig. Identifizieren Sie sich mit oder wurden Sie inspiriert von den metaphysischen Gedanken eines Schopenhauer, Beethoven, Bruckner, Goethe? Ja. Von allen spirituellen Künstlern – aber auch allen großen Wissenschaftlern und Philosophen, die wussten, dass das menschliche Denken und menschliche Produktion und Kreation nur ein winziges Abbild dessen sind, was wir in der Natur und im Universum oder in der Mikrowelt studieren können. Meine Arbeit ist ein bescheidener Versuch, die übergeordneten Prinzipien und Gesetze der Welt, das, was wir entdecken und studieren können, zu übertragen, und in diesem Sinne weiß ich, dass mein Komponieren nur ein winziges Modell dessen ist, was ich täglich in der Astronomie oder Genetik oder Biologie, Physik und Chemie sehen kann. In den letzten 30 oder 40 Jahre sind in der Mikrowelt und Makrowelt derart viele neue Entdeckungen gemacht worden, dass unser künstlerisches Schaffen dagegen verschwindend klein ist. Ja, man muss sehr bescheiden sein. Die Makro- und Mikrowelt scheinen die Essenz Ihrer Arbeit zu sein – von der Welt des Mikroklanges zur Expansion dieses Klanges in den Makrobereich. Das ist richtig. Aber auch andere Werke, wie die großartigen isorhythmischen Motetten, haben die Beziehung zwischen den Sternen und den Atomen widergespiegelt – und das Spätwerk Johann Sebastian Bachs entsprach überhaupt nicht dem Geschmack der Zeit, diese großartigen Werke wurden sicher nicht für einen praktischen Anlass geschrieben. Nicht nur Die Kunst der Fuge, sondern auch die Goldberg-Variationen oder das Musikalische Opfer. Die h-moll-Messe? Genau! Und ganz außergewöhnlich, weil er Protestant war – stellen Sie sich vor, was das bedeutet! Unglaublich! Als Protestant eine große katholische Messe zu komponieren war wirklich außergewöhnlich. Und sie wurde von der protestantischen Kirche bestimmt nicht ohne Weiteres angenommen. Da hat jemand Einblick in übergeordnete Beziehungen und Gesetze spirituellen Schaffens gewonnen. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der das Bewusstsein förmlich explodiert, sodass wir gar nicht über alles informiert sein können, weil unsere technischen Mittel so beschränkt sind. Glauben Sie, dass wir irgendwann einmal aufhören werden, uns zu entwickeln, weil unser Intellekt einfach nicht mehr Informationen aufnehmen kann? [lacht] Nein. Ich glaube, dass die Menschheit in einer Schule ist. Und sie wird weiterhin in unserer lokalen Galaxie in die Schule gehen. Aber ich weiß, dass ich vor diesem Leben viel gelernt habe, und ich möchte mich auch nach diesem Leben noch weiterentwickeln, weil es so kurz ist. Ich möchte ganz bestimmt weitermachen, und nicht nur auf diesem Planeten, weil ich glaube, dass der Planet ausgesprochen einfach und begrenzt ist. Außerdem setzt er sich selbst immer mehr Grenzen, weil die Menschen immer länger leben. Und das normale körperliche Leben verlangt nach körperlicher Befriedigung. Als Musiker, als Komponist sehe ich, dass mich dieser Planet mit ziemlicher Sicherheit nicht einlädt, meine Musik zu machen, Sie verstehen, was ich meine? Er verlangt als natürliche Reaktion auf diese Bevölkerungsexplosion nach etwas anderem. Was meinen Sie mit: Er verlangt nach etwas anderem? Essen! Essen und einen Unterschlupf und Energie etc. Ich meine damit körperliche Energie zum Überleben. Die Musik ist für die meisten Menschen nur Hintergrunduntermalung und Entertainment. Sie kommen nicht einmal auf den Gedanken, dass Musik auch eine geistige Nahrung sein könnte, weil sie so viele andere Probleme haben. Ein Problem ist einfach die Zeit, sich das alles anzuhören. Das stimmt. Vor zirka drei Wochen besuchte mich ein Amerikaner, Jerome Kohl aus Seattle, der Musik unterrichtet und ein sehr kluger Mensch ist, und er sagte: «Stockhausen, wissen Sie eigentlich, dass Sie bis jetzt über 80 Stunden Musik auf CD herausgebracht haben? Stellen Sie sich vor, wie lange es dauert, wenn man sich jedes Stück nur ein einziges Mal anhören möchte. Man braucht über zehn Tage, jeweils acht Stunden pro Tag, um alles nur einmal zu hören.» Da wurde ich mir dieser Situation bewusst: dass ich viel komponiert habe und es all diese CDs gibt, ganz zu schweigen von den Live-Aufführungen, die nur ganz wenige Menschen hören werden. Alle anderen haben nämlich gar keine Gelegenheit dazu, sie wissen nicht, wo die Konzerte stattfinden, und sie können nicht zu den Aufführungen anreisen, von denen es außerdem nur sehr wenige gibt. Sie haben einmal gesagt, die Musik in der Nachkriegszeit sei nicht ein Ausdruck menschlichen Gefühls, sondern ein Nachstellen der kosmischen Ordnung gewesen. Man habe sich damals nicht so sehr am Menschen orientiert. Ja, das ist richtig. Wenn ich etwas entdecke, das für mich geheimnisvoll ist, das neu ist, und wenn ich dem dann sehr behutsam musikalische Gestalt zu geben versuche, mache ich das bestimmt nicht, weil es meine menschliche Seite berührt hat. Es ist für mich nicht recht begreiflich. Ich fühle, dass es da etwas gibt, das ich nicht kenne; ich weiß nicht einmal, wie ich es fassen und in die instrumentale Welt übertragen kann, ob im elektronischen Studio oder mit traditionellen Instrumenten ist dabei zweitrangig. Die Musik, die ich komponiert habe und die ich in vielen Proben sehr langsam vervollkommne, erzeugt Gefühle, die ich vorher nicht hatte. Sie ist aber nicht ein Ausdruck meiner Gefühle. Ich habe also neue Gefühle. Neue Musik erzeugt neue Gefühle. Sie lässt uns völlig andere, ungewohnte Erfahrungen machen, die wir davor nicht gehabt haben. Deshalb ist sie auch so wichtig – sie erweitert uns. Sie erweitert uns? Ja, sie erweitert das Spektrum unserer Gefühle. Unserer Gedanken und Gefühle. Musik ist also immer eine Erweiterung? Nein, nein, nein [lacht]. Die meiste Musik berührt uns nur deshalb, weil es da bereits ein Gefühl dafür gibt, weil wir sie schon vorher auf ähnliche Weise gehört haben. Aber nur neue Musik, die unser Bewusstsein erweitert, kann uns wirklich überraschen, in Erstaunen versetzten. Das ist aber nicht oft der Fall. Hatten Sie in den späten 40er und 50er Jahren das Gefühl, dass Sie beim Komponieren ganz von vorne anfangen mussten? Dass es eigentlich keine Tradition gab und die Musik neu erfunden werden musste? Es gab sogar sehr viel Tradition, ich studierte alle Stile der traditionellen Musik und musste als Teil meiner Ausbildung an der Musikhochschule Stücke in allen Stilen der Vergangenheit schreiben. Strawinsky hörte ich zum ersten Mal in Köln im Studentenheim im Spätprogramm des Radios, und auch Aufführungen von Bartók, die ich noch nicht kannte. Hindemith spielte ich erst 1950 und 51, am Ende meines Studiums, seine Sonaten etc. Natürlich war diese Musik neu für mich, sie klang ganz anders als das, was ich vorher gehört hatte und was ich vorher als Pianist gespielt hatte und was ich im Chor der Musikhochschule sang. Aber 1951, als ich mein Studium beendete, hatte ich das Gefühl, dass die ganze Musik, die ich bis dahin gespielt und gesungen hatte, zu einem anderen Zeitalter gehörte. Und dieses Zeitalter war endgültig vorbei. Nach meiner ersten Komposition Kreuzspiel – die für mich sehr fremd klang, als ich sie das erste Mal dirigierte – da fühlte ich, dass ein neues Zeitalter begann, dass es ganz andere Kompositionstechniken gab. Die Musik stimmte mit meinem damaligen Seelenzustand überein. Ich komponierte sie, als wäre ich ein Astronom aus der Außenwelt, der Planeten und Klänge und Schaltkreise und Zeitproportionen neu ordnete. Ich identifizierte mich also nicht so sehr mit Klängen, sondern schuf neue Klangwelten. Und seither weiß ich, dass um 1951 eine neue Musik begann. Sind alle musikalischen Parameter gleich wichtig? Wenn Sie an unsere technischen Mittel denken, auf keinen Fall. Die ältesten datieren vom neunten und zehnten Jahrhundert, als ein paar Mönche das Notensystem für die Notation der Tonhöhe erfanden, wir haben aber jetzt in einem Halbton Mikrotöne, ich selbst komponiere seit 23 Jahren damit. Sogar für traditionelle Instrumente, ganz zu schweigen von den 42 verschiedenen Mikroskalen, mit denen ich Kontakte komponierte – und in Gesang der Jünglinge arbeitete ich mit etwa 30 verschiedenen Mikroskalen, die keine chromatischen Skalen sind. Der Parameter Tonhöhe ist natürlich der technisch am höchsten entwickelte. Unsere Notation der Dynamik ist für traditionelle Instrumente noch immer furchtbar primitiv. Die Dynamik wurde nämlich erst relativ spät zu einer eigenwertigen Klangkomponente. Was das Komponieren mit elektronischen Klangfarben betrifft, verwende ich meine eigenen Klangfarbenskalen, und ich habe tatsächlich hunderte von dynamischen Abstufungen, wenn ich im Studio mit ProTools arbeite. Aber die Menschen wissen das nicht, sie haben noch immer nicht gelernt, zwischen so vielen dynamischen Abstufungen oder den Klangfarbenskalen, mit denen ich arbeite, zu differenzieren, und dasselbe gilt für das Bewegen des Klanges im Raum. Ich arbeite jetzt mit einer Reihe von Klangkonstellationen, die sich im Raum bewegen oder in einer bestimmten Konstellation zueinander stehen. Ich arbeite mit einer Reihe von Raumkonstellationen. Aber die Notation ist noch immer relativ unterentwickelt im Vergleich zur Notation der Tonhöhen. Wegen all dieser Intervalle, die nicht mit chromatischen Tonleitern korrespondieren, verwende ich jedoch in der elektronischen Musik die traditionelle Notation nicht. Historisch betrachtet gibt es also eine Hierarchie von der Tonhöhe abwärts bis zum Raum – bis zu den Positionen oder Bewegungen im Raum. Im Hinblick auf die Wahrnehmung ist das aber anders. Wir können nicht so viele dynamische Abstufungen bewusst wahrnehmen, wie wir Tonhöhen wahrnehmen können. Und dasselbe trifft insbesondere auch auf den Rhythmus zu. Wir können unglaublich viele verschiedene rhythmische Werte akustisch wahrnehmen, aber bis heute ist es nur sehr begrenzt möglich, diese in der Notationen wiederzugeben. Mit Synthesizern ist das einfacher. Ich habe in den letzten zwei Jahren mit Metronomskalen gearbeitet, die in Mikrointervallen der metronomischen Geschwindigkeiten absteigen. Und es funktioniert. Es funktioniert sehr gut, wenn man verschiedene Periodizitäten übereinanderschichtet, sodass man die Schwebungen zwischen verschiedenen Periodizitäten der Tempi hören kann. Die Notenschrift ist jedoch immer das Ergebnis einer historischen Entwicklung, welche allerdings heute relativ schnell in Richtung einer Notation voranschreitet, die mehr und mehr eine Gleichberechtigung der verschiedenen Parameter der Wahrnehmung herstellt. Die Wahrnehmung beruht auf dem, was wir wissen, und was wir wissen, ist nur das, was wir schreiben können. Aber die Weiterentwicklung aller Parameter schreitet jetzt rasch voran. Die Ebenen der Dauer sind wahrscheinlich die abstraktesten Parameter, wenn es um die Differenzierung geht. Vielleicht. Hm … Sie glauben, abstrakter als Tonhöhen? Wenn ich heute Popmusik höre, stelle ich fest, dass sie sich zur modalen Musik des Mittelalters zurückbewegt, was mich sehr verwundert, verzichtet man dadurch doch auf die wunderbaren Möglichkeiten, mit vielen Intervallen zu arbeiten. Mit den Zeitdauern verhält es sich ähnlich. Tatsache ist, dass alle Musik der Vergangenheit auf den Rhythmen unserer Muskeln basiert. Was wir auf dem Tisch klopfen können oder wozu wir tanzen können, wie wir laufen oder gehen können, die Hände oder die Augen langsam bewegen können usw. – das ist die Grundlage des musikalischen Rhythmus. Alles ist mit einem rhythmischen Grundmuster verknüpft, das Herz, die Atmung, das Klopfen, das Tanzen. Ich habe 1951 begonnen, langsam, aber stetig den Rhythmus meines Körpers zu verlassen. Ich tanze sehr gerne – ich liebe es. Und ich spiele Tanzmusik, und die Luft ist voll elektrischer Energie. Dennoch verlasse ich ganz bewusst die Rhythmen des Körpers, meines Körpers und des Körpers der anderen – mein Körper unterscheidet sich ja kaum von anderen Körpern. Ich nehme mir die Freiheit, Rhythmen einzusetzen, die viel komplizierter sind und zu den periodischen Rhythmen des Körpers oft nicht mehr in Beziehung gesetzt werden können, was sehr interessant ist. Ich habe mehr und mehr mit unregelmäßigen Rhythmen komponiert, mit 11-tolen oder 13-tolen etc. Wenn sie auf Grundeinheiten basieren, die wir noch mit unserem Körper spüren können, die aber komplizierter und unregelmäßig unterteilt sind, dann können wir auch unsere Fähigkeit, zwischen verschiedenen Dauern zu unterscheiden, enorm erweitern. Das trifft auf die relativ kurzen rhythmischen Werte zu. Was allerdings ein Problem darstellt und auch noch lange ein Problem sein wird, ist die Zeitdauer von Werken. Ich komponiere nur Werke, die eine Einheit sind, nicht Werke in Sätzen. Zu Beginn der 50er Jahre gab es zwischen meinen Freunden und mir ständig Diskussionen in der Art: «Warum komponierst du noch immer Sätze? Das ist lächerlich. Du musst komponieren, als würdest du eine Kathedrale bauen, ein Werk als Entwicklung, als großer Bogen.» Sie meinten jedenfalls: «Ich brauche das.» Viele kleine Sätze zu schreiben steht in der französisch-italienischen Tradition. Ligeti macht das heute noch. Ich nenne es «Cookie music» – sie komponieren kleine Cookies. Tatsächlich muss man aber eine musikalische Komposition bauen, die einen sich stets erweiternden musikalischen Bogen spannt, weil das auch unseren Sinn für Evolution, für Entwicklung erweitert. Und das ist sehr, sehr wichtige. Aus diesem Grund sind meine Kompositionen seit Gruppen, das 25 Minuten dauert und ein durchgehendes, in sich geschlossenes Werk ist, immer länger geworden. Carré dauert 36 Minuten, Hymnen über zwei Stunden, Stimmung 70 Minuten, Sirius 96 Minuten, Fresco fünf Stunden, und Licht ist jetzt 27 Stunden lang. Die Dauer einer sogenannten musikalischen Komposition hat somit von Werk zu Werk zugenommen. Und das geht weit über unser Erinnerungs- und Differenzierungsvermögen hinaus. Man sollte niemals voraussetzen, dass wir einen Sinn für eine fixe Dauer von etwa einer Viertelstunde haben und dann eine Pause brauchen, etwas anderes brauchen – oder dass ein musikalisches Werk nicht viel länger als eine Stunde sein sollte. Ich habe mich von der Vorstellung, dass der Mensch für ein musikalisches Werk eine bestimmte Dauer braucht, bereits gelöst. Alles ist jetzt relativ. Und es ist sehr gut, sich mit zeitlichen Proportionen zu beschäftigen, die unser Gedächtnis erweitern, die über unser Erinnerungsvermögen hinausgehen. Auf lange Sicht, also nicht in einer Generation, sondern in zwei oder drei Jahrhunderten, wird sich durch Musik, welche die Zeitdauer mehr und mehr erweitert oder auf noch differenziertere aperiodische Rhythmen und kleine Proportionen setzt, auch die Wahrnehmung völlig verändern. Verstehen Sie? Ja! Weil wir gerade bei den Rhythmen des Körpers und der Wahrnehmung sind, was ist mit den mentalen Rhythmen – den Rhythmen des Denkens? Aha! Es ist tatsächlich so, dass bestimmte Teile meiner Werke an neun, zehn, elf, zwölf Pulse pro Sekunde herankommen, das ist ungefähr der Bereich der Alpha-Wellen, der sehr wichtig für Telepathie und Telekinese ist – ein sehr interessanter Bereich, in dem wir nicht mehr zwischen Rhythmus und Tonhöhe unterscheiden können. Er beginnt bereits bei sechs oder sieben pro Sekunde, und ab sechzehn pro Sekunde sind wir in einem neuen Bereich der Wahrnehmung, in dem wir von Tonhöhe sprechen, einem «tiefen Klang». Aber um auf die Alpha-Wellen zurückzukommen, ich habe ziemlich viel Musik komponiert, die sich in diesem Bereich bewegt, ich mache das sogar sehr gerne. Es ist eine Art Grauzone zwischen zwei Wahrnehmungsbereichen, zwischen Rhythmus und Tonhöhe. Das trifft übrigens auch auf einen Bereich zwischen Tonhöhe und Klangfarbe zu. Wenn es also über etwa 32.000 Pulse pro Sekunde geht, kommt man in einen Bereich, in dem die Tonhöhe allmählich zu dem wird, was wir Klangfarbe nennen, die hohen Teiltöne. Und wenn man von einem Sechzehntel einer Sekunde zu immer längeren Dauern übergeht, ist es nicht viel anders: Man kommt wieder in eine Grauzone und schließlich zum Rhythmus. Bei langsamen Bewegungen, langsamen Rhythmen und Metren haben wir es mit immer längeren Dauern zu tun; und wenn wir acht Sekunden überschreiten, dann verlieren wir das Gedächtnis, wir können uns nicht mehr genau erinnern, ob es elf Sekunden oder zwölf Sekunden sind. Unser Sinn dafür ist nicht entwickelt. Das Gedächtnis ist dann schwach. Und das ist sehr gut, sehr interessant. Wir beginnen nämlich, formale Unterteilungen wahrzunehmen, längere Dauern. Wir betrachten das, was sich darin befindet, als die Textur einer längeren formalen Dauer. Wir haben somit neue Musik, die manchmal von einem Bereich der Wahrnehmung zu einem anderen wechselt, und das ist tatsächlich etwas Neues. Was bedeutet: Das Leben ist nicht in der Zeit, sondern die Zeit ist im Leben? Viktor von Weizsäcker, ein sehr wichtiger Biologe, hat das in einem Buch mit dem Titel Gestalt und Zeit geschrieben. Es bedeutet, dass wir in der Neuzeit erkannt haben, dass es auf jedem Planeten im Universum eine andere Zeit gibt. Dass wir eine lokale, universelle Zeit haben, eine solare Zeit und – jetzt generalisiere ich – dass die Menschen im Vergleich zu Bienen oder Eintagsfliegen oder einer Eiche ihre eigene Zeit haben. Alle Lebewesen haben ihr eigenes Timing und ihre eigene Zeit. Die Zeit manifestiert sich somit in den Lebewesen, in allem, das existiert. In der Musik ist das ungemein wichtig geworden. In der traditionellen Musik wird Zeit im Spiel der Instrumente wahrgenommen, in den Klängen der Stimme. Die natürlichen Grenzen scheinen wie der Kalender, die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden zu funktionieren. Wir glauben ja, dass Zeit existiert. Schaut man auf die Uhr oder die Sonne oder den Mond, sieht man, dass sich alles in Zyklen bewegt, die von anderen Wesen bestimmt werden. Seit Beginn der elektronischen Musik habe ich jedoch viele Klänge entdeckt, für die ich ein rhythmisches Schema entwarf, in das sie dann aber nicht passten, ich musste also meine Schemata und metronomischen Tempi und mein chronometrisches Timing ändern, weil die Klänge ihre eigene Zeit eingefordert haben. Vor allem wenn man mit Klängen komponiert, die eine bestimmte Entwicklung in einem Körper, in einem Kopf und einem Schwanz haben, wie wir sagen. Man zerstört den Klang, wenn man ihn zu früh schneidet oder eine andere Dauer darüberlegt – verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube schon. Sie dürften von der Hüllkurve sprechen. Ja, auch. Bestimmte Klänge haben also ihre eigene Zeit. Man muss genau hinhören, um sie in einer Komposition an die richtige Stelle zu setzen. Vor allem bei Schlaginstrumenten gibt es in zunehmendem Maße viel neue Klänge, die, wie Sie sagen, ihre eigene Hüllkurve haben und ihre eigene innere Entwicklung, und dann muss man noch viel genauer hinhören – auch abhängig von der Intensität der Attack-Phase, die man gewählt hat –, um bestimmten Klängen ihre eigene Zeit zu geben. Um wieder zu verallgemeinern: Eine einheitliche Zeit ist nur etwas Abstraktes und kann für den Verkehr, für Züge und Flugzeuge und Gott weiß was noch bestehen. Aber in der Musik ist das nicht mehr wichtig. Die Zeit ist völlig relativ geworden und hängt vom verwendeten Material ab sowie dem zeitlichen Gesamtkonzept, das man für eine bestimmte Komposition entworfen hat. Als Sie 1958 Kontakte realisierten, haben Sie alles in Handarbeit zusammengeklebt – haben Sie am letzten Abschnitt wirklich drei Monate lang gearbeitet? Oh ja, mindestens, weil ich es zweimal machen musste. Sie haben die Sequenz abgespielt und festgestellt, dass es zu schnell ist. Ja. Schrecklich. Ich erinnere mich. Es ist ziemlich kompliziert. Es gibt hunderte Klebestellen. Wir sprechen schon wieder über die Zeit, das Tempo. Ich nehme an, Sie haben die Stücke zu kurz geschnitten? Richtig. Im Studio – damals wie auch heute – kann man in einer Woche nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Bandschnitten bewerkstelligen, und wenn man einen Strukturplan hat, der auf den Beziehungen zwischen den individuellen Dauern basiert – was in meiner Musik immer der Fall war –, dann macht man weiter und vertraut darauf, dass es organisch klingen wird. Wenn man dann aber zum Schluss alle Teile zusammengeklebt hat, all die verschiedenen Abschnitte, dann hört man zum ersten Mal, wie das Ganze in einem Durchlauf klingt, im ununterbrochenen Zusammenhang. Und hin und wieder kann man da ganz schön erschrecken. Wenn ich ein Stück mit einem Ensemble oder mit bestimmten Instrumenten einprobe, muss ich selbst nach all den Jahren immer wieder an bestimmten Stellen das Timing erheblich verändern. Ich bin des Öfteren zu schnell. Hätten Sie für Kontakte digitale Technologie zur Verfügung gehabt, wäre das die Lösung des Problems gewesen? Nein. Ich hätte Kontakte nie komponiert, ich hätte komponiert, was ich jetzt komponiere. Es gäbe Kontakte überhaupt nicht. Kontakte kann nur sein, was es ist, und das beruht auf den Werkzeugen, den Tools, die ich vor 40 Jahren hatte. Die Musiker, die ich treffe und die jetzt elektronische Musik machen, beneiden mich auch alle, weil Kontakte so frisch und authentisch klingt. Sie sagen: «Mein Gott, diese Sounds können wir nicht mehr machen.» Meine Antwort lautet dann immer: «Ich kann das sehr gut verstehen, weil es von den Tools abhängt.» Haben Sie Ihre Ansicht über die musikalische Zeit revidiert, als Sie 1967 die USA im Flugzeug überquerten? Ja, das habe ich wirklich. Ich weiß, worauf Sie anspielen. Auf Carré. Klar. Weil ich die Vereinigten Staaten zum ersten Mal 1958 im Rahmen einer sechswöchigen Vortragsreise besuchte. Ich war von 32 Universitäten eingeladen worden, Vorträge über elektronische Musik zu halten, was ich mit meinen Bändern und Zeichnungen auch tat. Ich musste fast täglich im Flugzeug sitzen und flog von einer Stadt in die nächste. Wenn man die Zeit zum Schlafen abzieht, habe ich an manchen Tagen tatsächlich mehr Stunden im Flugzeug verbracht als damit, Leute zu treffen. Zum ersten Mal in meinem Leben nahm ich Zeit auf eine völlig neue Weise wahr. Es war anders als in meinen Träumen, anders als jeder Zeitlupen-Effekt, den ich kannte. Es war viel langsamer als Zeitlupe. Manchmal nur für zwei oder drei Stunden – ein weißes Bett und ein blauer Himmel, sonst nichts. Und dann dieser Motor. Damals gab es noch propellerbetriebene Flugzeuge. Ich legte mein linkes Ohr – ich sitze gerne auf der linken Seite, weil meine linkes Ohr besser ist als mein rechtes –, ich legte also mein linkes Ohr an die Wand des Flugzeugs und konnte hören, wie der Motor das ganze Spektrum der Obertöne rauf und runter brummte. Es war phantastisch und interessant, denn ich hatte so was nie vorher gehört. Ich machte während dieser Flüge, sechs Wochen lang, immer Skizzen für die nächste Auftragskomposition Carré für vier Orchester und vier Chöre. Wenn man diese Musik heute hört, merkt man, dass es da vom Anfang bis zum Ende ein Timing gibt, das überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich davor komponiert habe oder was sonst jemand vorher komponiert hat, weil es auf diese Zeitlupenerfahrung zurückgeht. Wie kam es zum Übergang von der punktuellen Musik zur Gruppenform und weiter zur Momentform? Indem ich einfach dasselbe Prinzip, das ich auf einzelne Töne anwandte, auf Gruppen von Tönen übertrug, welche die gleichen Charakteristika hatten. Angenommen, man hat drei Töne, die sich in drei Parametern unterscheiden, aber dafür gemeinsam haben, dass sie alle fortissimo sind, dann bildet man eine Gruppe. Ich wollte eine besser Beziehung zu den organischen Formen herstellen, die ich in Büchern über Biologie und Statistik studierte. Gleichzeitig studierte ich an der Universität Bonn bei Meyer-Eppler, der Professor für Informationstheorie und Kommunikationswissenschaften war. Er machte dasselbe, ich lernte also vermutlich auch von ihm sehr viel. In seinem Seminar machten wir Textanalysen. Wir mussten zum Beispiel einen Zeitungsartikel hernehmen, zur Schere greifen und den Text in Wörter mit einer Silbe, Wörter mit zwei Silben, Wörter mit drei Silben und schließlich in zwei Wörter, drei Wörter, fünf Wörter, acht Wörter etc. schneiden. Als wir danach diese Silben oder Gruppen von Silben und Wörtern durcheinander mischten, wie bei einer Zufallsoperation, entdeckten wir, dass die Redundanz eines Textes von der Gruppierung abhängig ist. Das heißt, wenn wir nur einzelne Silben hatten, ergab das ein extrem hohes Maß an Unsinn. Und je mehr die Silben und Wörter in Gruppen geordnet waren, umso mehr Sinn ergab alles. Von da an, ab Ende 1953, arbeitete ich mit Stufen der Vorhersagbarkeit und Redundanz. Das war der natürliche Übergang von Punkten zu Gruppenformen. Und die Statistik führte mich direkt zu den Massenstrukturen. Wir beschäftigten uns nämlich in Statistik mit Massenstrukturen – den Grundprinzipien der Informationstheorie im Hinblick auf die Beziehung zwischen Punkten und Gruppen und Massen. Ich übertrug dieselben Prinzipien, die ich auf Gruppen und einzelne Töne anwandte, auf Massen. Und somit wurde eine ganze Skala entwickelt – Stufen der Vorhersagbarkeit, des aleatorischen Verhaltens und so weiter. Es lag damals einfach in der Luft. Hatten Sie zu der Zeit Kontakt zu Xenakis? Nein. Er war noch nicht Teil der Szene. Ich bin mit ihm übrigens nie in Verbindung gestanden. Später hörte und las ich, dass er das Wort «stochastisch» verwendet, das ähnliche Prinzipien aleatorischen Verhaltens in Massenstrukturen beschreibt. Er muss davon während seines Architekturstudiums gehört haben. In den Programmnotizen zu Momente haben Sie gesagt, dass Sie das dualistische Denken zugunsten eines polyvalenten Denkens verworfen haben. Also, das begann sehr langsam in den späten 50er Jahren. Es ist im Wesentlichen das Ergebnis von dem, was wir auch heute noch «serielles Denken» nennen. Es bedeutet, dass man in dem Augenblick, wo man bei Gegensätzen – bei Schwarz und Weiß zum Beispiel – in Grautönen zu denken beginnt, bereits wie ein serieller Komponist denkt, was wiederum bedeutet, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Grautönen äquidistant sein müssen. Und dann macht man eine Skala, interpoliert und permutiert die Stufen dieser Skala und hat serielle Musik. Dualistische Denken, wie Klang und Pause oder Geräusch und Klang, hoch und tief oder Musik und Nicht-Musik etc., ist eine traditionelle Art des Denkens. Aber seit den 50er Jahren fließt in unsere Art des Denkens auf allen Ebenen die Relativität ein. Und jetzt kann ich eine Maus in ein Glas verwandeln – verstehen Sie, was ich meine? Sie könnten somit eine Reihe zwischen Blau und Gelb festlegen und theoretisch behaupten, dass Gelb Blau ist. Ja. Und zwar dieses extreme Blau, wenn es zwischen den beiden Farben vermittelnde Abstufungen gibt. Wenn Sie nun eine Reihe zwischen der Zukunft und der Vergangenheit bilden wollten … Das sind Illusionen. Zukunft und Vergangenheit sind Illusionen in unseren Köpfen. Ich möchte mich nicht an alles erinnern, was mir in früheren Leben widerfahren ist – ich könnte mich nicht mehr bewegen. Für dieses Leben ist diese Beschränkung eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Trotzdem ist es eine Illusion. Ich bin nämlich felsenfest davon überzeugt, dass ich in dem Augenblick, wo ich mich von diesem Gehirn, das jetzt mit Ihnen spricht, trenne, mich wieder an alles werde erinnern können. Als Sie 1966/67 an der University of California waren, welchen Eindruck haben da die Hippies auf Sie gemacht? Nun ja, ich habe dazugehört! Ich ging natürlich oft ins Fillmore West. Und ich traf Ginsberg. In jener Zeit war für mich einfach alles aufregend. Auch die Popmusik, die sich damals entwickelte, unterschied sich enorm von der Popmusik, die ich kannte. Ich hörte diese neue Musik, und die Stimmung, die die Ashbury Street ausstrahlte, also das war Freiheit im wahrsten Sinn des Wortes. Eine neue Freiheit, die sogar zuließ, dass viele sie in einer Überdosis genossen und sich damit umbrachten. Aber es war eine gewaltige Explosion. Es war eine wunderbare Befreiung mit allen ihren Gefahren. Ich hatte viel Studenten, die wirklich ausflippten. Könnten Sie noch über das sprechen, was sie als «Formel» bezeichnen? Die Formel ist eine Erweiterung der Reihe, was bedeutet, dass die Reihe nicht nur mit den vier Grundparametern der Töne gebildet wird, mit denen man komponiert, sondern dass sie auch andere Elemente zulässt und diese in die Formel integriert, wie etwa eine kleine Improvisation über die vorhergehende Figur oder eine Skala von einem bestimmten Ton zum nächsten. Diese Skala kann ganz anders konstruiert sein, ich verwende also verschiedene Arten von Skalen. Oder ein doppeltes oder dreifaches oder vierfaches Echo von zwei Tönen oder drei Tönen, die vorher gespielt wurden. Oder eine sogenannte Modulation, das heißt, dass auf einen Ton verschiedene Modulationen dieses Tones folgen – eine Amplituden- oder Frequenzmodulation, die unterschiedlichsten rhythmischen Modulationen etc. Eine Formel enthält somit, wenn es eine einfache Formel ist, verschiedene Aspekte der kompositorischen Gestalt, die herkömmlicherweise nicht Bestandteil eines Themas waren. Johann Sebastian Bach verwendete eine Reihe, wenn er eine Fuge komponierte. Er hatte jedoch keine Ahnung von der Formel-Komposition in dem Sinne, dass eine Formel viel mehr organische Aspekte von Gestalten, von musikalischen Figuren, Gruppen etc. beinhaltet. Mein erstes Werk, dem eine Formel zugrunde lag, war das 1952 komponierte Formel für Orchester. Später schämte ich mich dafür. Ich hielt es für zu traditionell, weil es Formen und Figuren enthielt, die ich in meinem vorhergehenden Werken ausgeblendet hatte. 1970 versuchte ich jedoch, all diese unterschiedlichen Aspekte, die ich früher bei der seriellen Kompositionstechnik noch hinzufügen musste, in eine Reihe zu integrieren. Das setzte sich über viele Werke fort, bis ich 1977 eine dreischichtige Formel entwickelte, also drei sich überlagernde Formeln, deren wechselseitige harmonische Beziehungen sich wie organische Wachstums- und Verfallsprozesse im vertikalen Verlauf innerhalb der drei Schichten vollziehen. Mit dieser dreischichtigen Formel komponiere ich seit nunmehr fast zwanzig Jahren – ein einziges großes Werk zu schaffen wird mich heuer das 20. Jahr beschäftigen. Und ich könnte mit dieser Superformel noch eine unendliche Zeit neue Organismen erfinden. Sie sprechen von Ihrem Werk oft als einem Organismus. Ja, ich denke schon, dass es wie mein Körper sein sollte. Mit einem Herzen und einem Gehirn und Gliedmaßen. Ich verwende das Wort «Glieder» sehr oft für die Unterteilungen einer Formel. Wie die Glieder eines Körpers. Impliziert das Wort «Organismus» auch Bewusstsein? Oh ja. Er muss auch geistige Qualitäten haben. [lacht] Tatsächlich gibt es viel Organismen, die im Vergleich zum Menschen sehr einfach zu sein scheinen, aber ich bin davon überzeugt, dass es auch Organismen gibt, deren Komplexität und – wie sag ich das jetzt – transzendente Qualität weit über die eines menschlichen Organismus hinausgehen. Der ganze Planet ist ein Organismus. Und das Sonnensystem ist eine andere Entität etc. So ist es. Der Unterschied zwischen «organisch» und «unorganisch» ist allerdings ein rein künstlicher. Man weiß das von der normalen Materie, den Unterschieden in der Materie, den verschiedenen Zuständen der Materie. Trotzdem muss «organisch» irgendwie mit uns als Menschen in Beziehung stehen. Je mehr es mit den Menschen in Beziehung steht, umso mehr verstehen wir «organisch» als in Einklang sein. Auch wenn etwas ungeordnet ist, es sollte im besten Sinne mit dem menschlichen Organismus korrespondieren – auf jeden Fall! Übersetzung aus dem Englischen von Friederike Kulcsar David Paul im Gespräch mit Karlheinz Stockhausen, in: Katalog Wien Modern 2008, hrsg. von Berno Odo Polzer, Saarbrücken: Pfau 2008, S. 69-75.