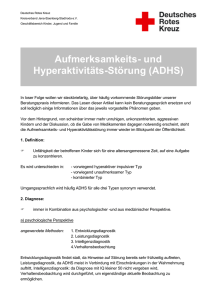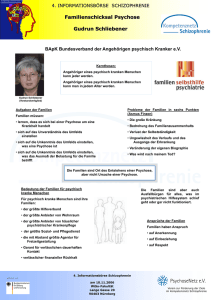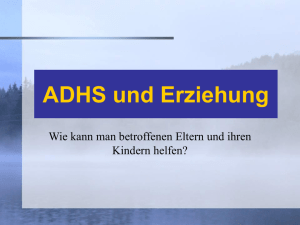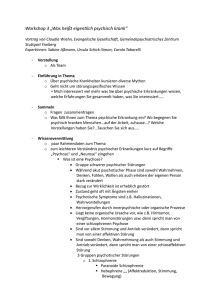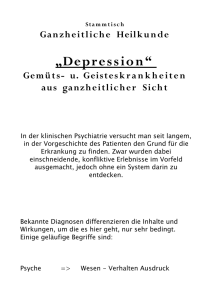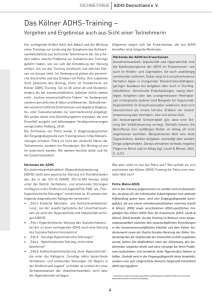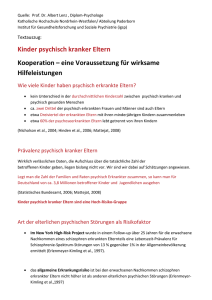Untitled - Zentralinstitut für Seelische Gesundheit
Werbung

Autorinnen und Autoren Dr. phil. Dipl.-Psych. Tanja Bernhardt, wissenschaftl. Mitarbeiterin in der Abt. Gerontopsychiatrie, E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Herta Flor, Leiterin Neuropsychologie, E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Peter Frankenberg, Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Prof. Dr. Lutz Frölich, Leiter Gerontopsychiatrie, E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Dr. em. Heinz Häfner, Leiter Arbeitsgruppe Schizophrenieforschung, E-Mail: [email protected] Dipl.-Psych. Anne Hinckers, wissenschaftl. Mitarbeiterin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Karl Mann, Direktor der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Dipl.-Psych. Manfred Oster, FH für Sozialwesen Mannheim, E-Mail: [email protected] Dr. med. Gerhard Ristow, wissenschaftl. Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Dr. phil. Dipl.-Psych. Regina Steil, Leitende Psychologin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, E-Mail: [email protected] Dr. sc. hum. Dipl.-Psych. Isabella Wolf, wissenschaftl. Mitarbeiterin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, E-Mail: [email protected] Impressum Herausgeber: Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 68159 Mannheim, J 5 Redaktion: Dr. Marina Martini Referat Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0621/17 03-1301, -1302 Telefax: 06 21/17 03-1305 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.zi-mannheim.de Nachdruck nur mit Genehmigung. Hinweis: Auch wenn in den folgenden Texten auf die weibliche Form bei der Benennung von Personen verzichtet wird, sind selbstverständlich immer Frauen und Männer gemeint. 2 Einweihung des Suchtzentrums Rede von Minister Prof. Dr. Peter Frankenfeld Nach verschiedenen Schätzungen sind rund 5 Prozent der Menschen in Deutschland suchtkrank, aufgrund der hohen Dunkelziffer aber wahrscheinlich deutlich mehr. Es ist also ein drängendes, millionenfaches Problem, dem sich die Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin hier in Mannheim widmet. Ich freue mich, dass ihr dafür nun zusätzliche Räume zur Verfügung stehen, und begrüße Sie alle zur Einweihungsfeier ganz herzlich. Im Mai des vergangenen Jahres habe ich unter dem Motto „Zukunft kann man bauen - und Zukunft baut auf Forschung“ die Einweihung des Laborgebäudes am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit vorgenommen. Nun ist unter der Gesamtverantwortung von Herrn Verwaltungsdirektor Busche nach zweijähriger Bauzeit mit dem neuen Suchtzentrum ein weiterer konsequenter Schritt in die Zukunft der Versorgungsforschung abgeschlossen. Denn wie heißt es bei Antoine de Saint-Exupery? „Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, man soll sie möglich machen.“ Minister Prof. Dr. Peter Frankenberg kannt: Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und anderen Geldgebern fördert mein Haus bereits seit einigen Jahren die Aktivitäten des Suchtforschungsverbundes Baden-Württemberg. Ihm gehören das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, die Universitäten Heidelberg, Tübingen und Freiburg an. Ziel des Suchtforschungsverbundes ist es, • das Zusammenspiel zwischen der Erforschung und der Versorgung von Suchterkrankungen zu verbessern, • das Erkrankungsrisiko zu senken, • den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Meine Damen und Herren, Sucht ist eine Leidenschaft, die Leiden schafft. Bedauerlicherweise findet sie erst seit einigen Jahren wachsende Beachtung in der Forschung. Umso mehr freut es mich, dass das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit sich mit dieser „Bürde der Menschheit“ bereits frühzeitig auseinander gesetzt hat. Es versteht als seinen besonderen Auftrag, den von der Sucht unmittelbar und mittelbar betroffenen Menschen der Region Hilfestellung zu leisten. Sie, lieber Herr Professor Mann, haben den „Baden-Württembergischen Suchtforschungsverbund“ vor vier Jahren initiiert. Dieser hat sich als einer von insgesamt 16 Verbünden für das BMBF-Programm „Gesundheit 2000“ beworben – mit Erfolg! Nach einer Begutachtung durch ein international besetztes Gutachtergremium wurden vier Verbünde in den Jahren 2001 bis 2004 finanziell gefördert, wobei der badenwürttembergische Verbund mit Abstand der größte war. Die erneute Begutachtung des Suchtforschungsverbundes im Jahre 2004 war ebenfalls von Erfolg gekrönt: In einer zweiten Periode wird der Verbund nun bis 2007 weiter gefördert. Die besondere Stellung der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin in Forschung, Lehre und Krankenversorgung kommt unter anderem darin zum Ausdruck, dass es hier den bundesweit einzigen Lehrstuhl für Suchtmedizin gibt. Sein Inhaber, Sie, lieber Herr Professor Mann, wurde in den Drogen- und Suchtrat des Bundesministeriums für Gesundheit berufen. Ihm wurde die Präsidentschaft des Weltkongresses für biomedizinische Alkoholforschung übertragen, der im Herbst 2004 in Heidelberg stattfand. Diese Klinik hat – davon bin ich überzeugt – alle Voraussetzungen, um noch vielen Betroffenen die Tür zu einer besseren, suchtfreien Zukunft zu öffnen. Die Gesamtfördersumme für den Verbund seitens des BMBF liegt bei 6,7 Millionen Euro. Hinzu kommen Mittel aus meinem Haus für sechs Jahre von rund 950.000 Euro. Diese Fördermittel sind im Wesentlichen für den Aufbau einer DNA-Bank vorgesehen, die auch verbundübergreifend einem intensiveren Studium der genetischen Grundlagen von Suchtverhalten dienen soll. Die Landesregierung hat bereits früh die zunehmende Bedeutung der Suchtforschung er- 3 cher Akteure zum Wohle der Patientenversorgung. Im April 2005 hat sich die Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin durch die Berufung von Herrn Professor Kiefer auf eine W 3Professur für Suchtforschung personell verstärkt. Ich bin überzeugt, dass die Klinik so ihre Spitzenstellung in der Suchtforschung aufrechterhalten kann. Ich möchte Ihnen, Herr Professor Kiefer, für Ihre Aufgaben alles Gute und viel Erfolg wünschen. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass das neue Suchtzentrum einen entscheidenden Fortschritt für die Versorgung Suchtkranker in Mannheim und im RheinNeckar-Dreieck bringt und seinen Nutzern Raum für weitere wissenschaftliche Höchstleistungen bietet. Die Substanz des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit zeigt sich auch in der neuesten, „Stein für Stein“ sichtbaren, baulichen Errungenschaft: dem neuen Suchtzentrum, das wir heute einweihen. Für diesen Neubau wurde die noch aus der Gründerzeit stammende, denkmalgeschützte Sandsteinfassade erhalten und saniert. Das Gebäude verbindet so „historisch Bestehendes“ mit einem grundsätzlich „neuen Kern“. Das neue Suchtzentrum mit der Tagesklinik schafft mit seiner zusätzlichen Fläche von rund 1.000 Quadratmetern neuen Raum für die Ausweitung der Forschungsaktivitäten und Versorgungsleistungen des ZI auf die teilstationäre beziehungsweise tagesklinische Behandlung von Suchtpatienten. Diese wird die bisherigen ambulanten und stationären Therapieangebote ergänzen. Die Suchttagesklinik mit 20 Plätzen wird die Lücke zwischen der immer wichtiger werdenden rein ambulanten Behandlung und der für schwerere Fälle nach wie vor notwendigen stationären Behandlung schließen. Ich möchte allen meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute die Einweihung des Suchtzentrums feiern können. Allen voran möchte ich stellvertretend für alle beteiligten Firmen den Handwerkern und den Arbeitskräften der Baufirma Bilfinger und Berger danken. Mein Dank gilt auch dem Architekturbüro Wessely + Partner, dem es gelungen ist, dieses Gebäude in gelungener Form in das Stadtbild einzupassen. Ebenso schließe ich in meinen Dank den Bund ein, der sich an der Finanzierung nach dem Hochschulbauförderungsgesetz beteiligt hat, und natürlich das Sozialministerium Baden-Württemberg sowie die Bauverwaltung. Allen, die hier im neuen Suchtzentrum arbeiten werden, und allen, die sich hier Hilfe suchend in Behandlung begeben werden, wünsche ich alles Gute. Peter Frankenberg Rede von Prof. Dr. med. Karl Mann Das neue Gebäude wird Forschungslabors und Arbeitsgruppen aufnehmen, die zu unterschiedlichen Fragen des Suchtverhaltens und zu damit verbundenen Therapieansätzen forschen werden. Die Therapiekonzepte der neuen Tagesklinik zielen vor allem darauf ab, neue Wege einer verbesserten Behandlung zu finden und diese wissenschaftlich zu evaluieren. Hier ist vor allem an die große Gruppe der rund 1,5 Millionen Medikamentenabhängigen in Deutschland gedacht. „Bezeichnend für diese Menschen ist es, dass sie nicht nur eine minderwertige Gesundheit haben sondern auch eine minderwertige Krankheit“. Prägnanter als Robert Musil in seinem Roman „der Mann ohne Eigenschaften“ kann man kaum ausdrücken, was wir heute als Stigmatisierung psychisch Kranker bezeichnen. Während wir diesen Umstand beklagen und Antistigmaprogramme z.B. für Schizophrene und Depressive entwickeln übersehen wir oft die in Jahrzehnten auch innerhalb der Psychiatrie herausgebildete Wertehierarchie mit höherwertigen und minderwertigen Krankheiten. Welchen Rang dabei Suchtkranke einnehmen, können Sie sich vorstellen. Vor diesem Hintergrund feiern wir etwas, was als stein-gewordenes Antistigmaprogramm für Suchtpatienten bezeichnet werden könnte. Die Eröffnung eines solchen Gebäudes an Suchtforschung und Suchttherapie wäre vor 10 oder 15 Jahren nirgendwo in Deutschland möglich gewesen. Auch nicht am ZI. Der Kostenaufwand für Sanierung und Umbau des vierstöckigen Suchtzentrums belief sich auf insgesamt 2,9 Millionen Euro. Der Bund und mein Haus beteiligten sich gemäß Hochschulbaufinanzierungsgesetz mit insgesamt knapp 1,7 Millionen Euro an den Baukosten des Suchtzentrums. Das Sozialministerium BadenWürttemberg steuerte einen Zuschuss nach Krankenhausfinanzierungsgesetz von rund 720.000 Euro bei. Hinzu kam ein Zuschuss der Stadt Mannheim für die Fassadenerhaltung von rund 510.000 Euro. Sie sehen, auch hinsichtlich der Finanzierung steht das Suchtzentrum für kooperatives Zusammenwirken unterschiedli- 4 malig ist. Er hat die institutionellen und räumlichen Bedingungen für ein erfolgreiches Forschen geschaffen, wie wir kürzlich bei der Einweihung des Laborgebäudes und jetzt bei der Eröffnung dieses Suchtzentrums mit Tagesklinik erleben dürfen. Mein Dank gilt neben Herrn Prof. Henn auch dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das seinen nicht unumstrittenen Ideen gefolgt ist. Was hat nun diesen Wandel der Einstellungen zur Sucht bewirkt? 1. Zur Beantwortung dieser Frage muss zunächst die Epidemiologie bemüht werden. Wir wissen heute aus übereinstimmenden Untersuchungen, dass etwa 20% der Patienten in den Praxen niedergelassener Ärzte therapie-relevante Suchtprobleme haben. Dies gilt auch für internistische und chirurgische Abteilungen von Allgemeinkrankenhäusern. In psychiatrischen Landeskrankenhäusern sind sogar 30 bis 40% der stationären Aufnahmen Suchtpatienten. Die Suchtforschung ist kein „autistisches Modul“, weder in der Forschungslandschaft des ZI, noch in den beiden medizinischen Fakultäten oder der Gesamtuniversität Heidelberg. Wir sind in der glücklichen Lage, die im Rhein-NeckarRaum angesiedelte Exzellenz für unsere Forschungsfragen nutzen zu können. Hier wären unter anderem zu nennen: Bildgebung, Molekulargenetik, Neuroendokrinologie und Neuropsychologie aber beispielsweise auch die Kinderund Jugendpsychiatrie. Ohne die hier geschaffene Forschungslandschaft wären Erfolge, wie die Einwerbung des BMBF-geförderten Suchtforschungsnetzes, oder die maßgebliche Beteiligung am nationalen Genomforschungsnetz, oder unsere zum Teil federführende Mitwirkung an EU-Projekten oder die erstmals in Deutschland geglückte Einwerbung von Geldern des National Institutes of Health (NIH) nicht denkbar. 2. Abhängiges Verhalten kann als heuristisches Modell verstanden werden, welches als Spezialfall das „Studium der Natur am Beispiel des Menschen“ (Karl Jaspers) erlaubt. Die Operationalisierung von Suchtphänomenen wie Toleranzentwicklung oder Kontrollverlust und ihre neurobiologische Aufklärung eröffnet auch Wege zum Verständnis menschlichen Verhaltens in seinen gesunden Spielarten. 3. Wesentlich vertieft wird dieser Forschungsansatz durch Tiermodelle süchtigen Verhaltens, wie sie in den letzten Jahren entwickelt wurden. Das Alles erscheint mir auch unabhängig von der Suchtforschung ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten eines kleinen und flexiblen Forschungsinstitutes, wie das ZI es darstellt. Man könnte also durchaus nicht nur sagen, „small is beautifull“ sondern auch „small is successfull“, oder „small is transparent“ usw. Heute können wir den Phänotyp abhängigen Verhaltens beispielsweise Toleranzentwicklung oder Kontrollverlust unmittelbar an Tieren modellieren und durch systematische Variation bestimmter Kontrollvariablen aufklären. Auch die Wirksamkeit pharmakologischer Therapieansätze kann mit diesem Modell geprüft werden. Nehmen wir noch die Möglichkeiten genetischer Analysen und die Entwicklung von Knock out und transgenen Tieren hinzu, so haben wir eine in der Neurobiologie einzigartige Konstellation zur systematischen Erforschung unseres Themas. Von „Exzellenz“ war bereits die Rede. In diese Diskussion möchte ich den Begriff der „gefühlten Exzellenz“ einführen, ganz ähnlich wie in der Meteorologie, wo wir unterscheiden in eine „gemessene Temperatur“ und eine „gefühlte Temperatur“. Gefühlte und gemessene Exzellenz können durchaus kontrastieren, wofür die Auswertungen der Medizin-Struktur-Kommission einige Beispiele liefert. Mit der Berufung von Herrn Prof. Henn zum Direktor des Zentralinstituts 1996 ging eine Bestandsaufnahme und Neuorientierung einher. Er hat die oben genannten Chancen einer abgestimmten klinischen und präklinischen Suchtforschung erkannt und konsequent eine entsprechende Berufungspolitik betrieben. Nach meiner Berufung auf den Lehrstuhl für Suchtforschung 1999 kam 2000 mit Herrn Prof. Spanagel ein international ausgewiesener präklinischer Suchtforscher als Leiter der Abteilung Psychopharmakologie hinzu. Professor Henn hat damit die Grundlage für den Aufbau eines Forschungszentrums gelegt, das in dieser Kombination und in dieser Form in Europa ein- So viel zur Suchtforschung. Natürlich wird dieses Gebäude auch in verstärktem Maße genutzt um gravierende Defizite in der Lehre bezüglich Sucht und abhängigem Verhalten zu bearbeiten. Neben einer Intensivierung in der Aus-, Weiter- und Fortbildung von Medizinern ist an Angebote für Psychologiestudentinnen und studenten gedacht. Zusätzlich bieten die Räume des Suchtzentrums auch eine verbesserte Möglichkeit für die regelmäßigen Kontakte mit Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 5 chen Modell der spezialisierten Behandlung anderer Abhängigkeiten folgen. Nun also zur Suchttherapie. Sie sollte in meinem Verständnis nie losgelöst betrachtet werden von der klinischen Suchtforschung. Die Eröffnung einer teilstationären Behandlungseinrichtung zur Akutversorgung von Suchtkranken war schon Gegenstand erster Planungen Mitte der 90er Jahre. Mit der neuen Tagesklinik schließt sich also der Kreis unseres Behandlungsangebotes, so dass wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit haben vergleichende Untersuchungen zur Allokation von Patienten durchzuführen. Dieses gesamte therapeutische Angebot ist eingebettet in eine erfolgreich kooperierende Beratungs- und Therapielandschaft in Mannheim und Umgebung. Essentiell hierfür ist die enge Kooperation mit den Hausärzten, Internisten, Psychiatern und Psychotherapeuten. Ebenso die fest etablierte Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Beratungsstellen, wie des Drogenvereins, der Caritas, der Diakonie und des Badischen Landesverbandes. Zusätzlich kooperieren wir eng mit verschiedenen Kliniken, wie beispielsweise dem Diakoniekrankenhaus und selbst-verständlich auch dem Universitätsklinikum Mannheim. Eine sehr enge und kollegiale Zusammenarbeit von Anfang an gab es mit der Abteilung für Suchttherapie des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch. Wer die jüngere Geschichte von ZI und PZN kennt, weiß, dass dies nicht selbstverständlich war. Die Tagesklinik stellt einen weiteren Meilenstein in der sucht-medizinischen Versorgung der Bevölkerung von Mannheim und Umgebung dar. Selbstverständlich wird es Aufgabe unserer Therapieforschung sein, zu untersuchen, welche Patienten zu welcher Zeit an welcher Stelle unserer gesamten Therapiepalette am effektivsten und am effizientesten behandelt werden können. Das wird auch die Krankenkassen interessieren mit denen wir in der Erforschung von Kosten-Nutzenaspekten beispielhaft kooperieren und die von Anfang an unserer Arbeit gegenüber sehr aufgeschlossen waren. Wir verfügen jetzt über ein umfassendes Therapieangebot von der stationären Behandlung über eine in den letzten Jahren stetig stärker nachgefragte allgemeine Suchtambulanz, eine spezialisierte Ambulanz zur Substitutionsbehandlung von Drogenabhängigen sowie über verschiedene Spezialambulanzen, beispielsweise zur Raucherentwöhnung oder für Konsumenten von Ecstacy und Partydrogen. Einzig die Medikamentenabhängigkeit, insbesondere von Benzodia-zepinen wurde noch nicht erwähnt. Nicht umsonst wird sie als „stille Sucht“ bezeichnet. Nach Schätzungen, hier gibt es keine genauen Zahlen in Deutschland, leiden hierunter etwa 1,4 Millionen Bundesbürger. Davon sind nur ca. 2000 in Behandlung. Überwiegend handelt es sich um Frauen im fortgeschrittenen Lebensalter. Sämtliche bisherigen Therapieangebote hier und andernorts haben diese unterversorgte Gruppe von Suchtpatientinnen noch nicht erreicht. Deshalb wird die neue Tagesklinik einen besonderen Schwerpunkt auf die Behandlung von Medikamentenabhängigen legen. Während die ambulante Entzugsbehandlung sehr häufig am endgültigen Absetzen der bereits reduzierten Medikation scheitert, ist auch die stationäre Behandlung unter den üblichen Rahmenbedingungen mit überwiegend Alkoholabhängigen oder jugendlichen Cannabiskonsumenten nicht geeignet, diese Patientinnen über die erforderlichen vier bis fünf Wochen zu behandeln. Hier versprechen wir uns einiges von dem therapeutischen Setting der Tagesklinik mit seinen sehr speziellen Möglichkeiten. Sofern diese Behandlung genügend nachgefragt wird, werden wir eine Therapiegruppe ausschließlich für Medikamentenabhängige bilden und somit dem erfolgrei- Nun haben Sie etwas zu den Themen Forschung, Lehre und Krankenversorgung in diesen neuen Räumen gehört. Es bleibt ein vierter Aufgabenbereich, dem sich das gesamte ZI von Anfang an verpflichtet fühlt. Es geht um die Politikberatung sowohl des Landes, wie auch des Bundes. Gerade die Drogen- und Suchtpolitik ist in den letzten Jahren radikal umgeschrieben und aus meiner Sicht verbessert worden. Dies geschah in enger Abstimmung mit den entsprechenden Mandatsträgern. Ich denke hier vor allem an die drogen- und suchtpolitischen Sprecher der Fraktionen in Stuttgart und Berlin. In diesem Zusammenhang freue ich mich ganz besonders über die Anwesenheit von Herrn Kollegen Lasotta, dem drogenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion. Wenn wir nun also ein weiteres Kapitel in der Antistigmakampagne bezüglich Suchterkrankungen eröffnen, dann auch mit dem Hinweis, dass derartige Aufgaben immer von einem Team getragen werden müssen. Ich habe das Glück mit kompetenten und hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Bereichen der Therapie, der Organisation, Verwaltung und der Forschung zusammen zu arbeiten. Auch Ihnen an dieser Stelle meinen herzlichen Dank. Karl Mann 6 Zwischen den Stühlen 20 Jahre therapeutische Wohngruppe Kettelerweg Nach Beendigung einer stationären Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kehren die meisten Jugendlichen nach Hause zurück. Die meisten, aber nicht alle. Eine kleine Gruppe von Jugendlichen ist leider noch so beeinträchtigt, dass eine Rückführung ins häusliche Umfeld eine Gefährdung des Behandlungserfolges darstellt. Doch wohin können diese Jugendlichen gehen? Aufgrund dieser Fragestellung wurde 1984 ein Modellprojekt mit Hilfestellung des damaligen Bürgermeisters Dr. Hans Martini von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kooperation mit dem Johann-Peter-Hebel-Heim ins Leben gerufen. Es wurde eine Übergangswohngruppe für psychisch kranke Jugendliche und junge Erwachsene im Kettelerweg gegründet. Zunächst musste die Finanzierung des Projektes individuell für jeden Jugendlichen erfolgen, in den folgenden Jahren konnten aber diverse Kostenträger von dem Konzept überzeugt und gewonnen werden. Aktuell ist die Jugendhilfe der Hauptkostenträger dieser Maßnahme. Daneben finden sich Sozialämter und Landeswohlfahrtsverbände als Kostenträger. Die Räumlichkeiten befinden sich im Kettelerweg in Mannheim - Gartenstadt. Aufnahme in die Wohngruppe im Anschluss an einen Klinikaufenthalt, aber sie kann auch von zu Hause aus initiiert werden. In diesem Zeitraum sind fast 200 Jugendliche in die Wohngruppe aufgenommen worden, die durchschnittlich 550 Tage dort verblieben. Das Alter bei Aufnahme in die Wohngruppe lag im Durchschnitt bei 17,5 Jahren. 56,7% der Jugendlichen kamen direkt aus Mannheim oder einem Umkreis bis zu 50km. Die Störungsbilder der Jugendlichen waren in 32% der Fälle dem psychotischen Formenkreis zuzuordnen, 21% litten an einer Essstörung (Magersucht oder Ess- Brechsucht) und bei 13% wurde eine affektive Störung festgestellt (z.B. Depression), siehe Abb. 2. Abb 2: Diagnosenverteilung Abb. 1: Das Haus im Kettelerweg Die Wohngruppe startete vor 20 Jahren mit acht Jugendlichen in einer Gruppe und wuchs mit der Zeit an. Aktuell befinden sich zwischen 15 und 17 Jugendliche und junge Erwachsene in zwei Gruppen. Aufgenommen werden Jugendliche, die dem § 35a SGB VIII entsprechen, einem Paragraphen, der die Wiedereingliederung von Kindern und Jugendlichen regelt, die in ihrer seelischen Gesundheit bedroht oder bereits beeinträchtigt sind. In der Regel erfolgt die Nach Abschluss der Behandlung gingen 39% nach Hause zurück, 17,6% zogen in die eigene Wohnung oder das betreute Wohnen und 5% verließen die Wohngruppe um zu ihren Partnern zu ziehen. 39 der Jugendlichen stammten aus Mannheim und blieben nach der Entlassung in Mannheim. 47 Jugendlichen kamen von außerhalb Mannheims und verblieben nach Entlassung in Mannheim. 54 Jugendliche kehrten im Anschluss an den Wohngruppenaufenthalt nach Hause zurück. 18 Jugendliche aus Mannheim zogen aus Mannheim weg, in 8 Fällen war der Verbleib leider undokumentiert (siehe auch Abb. 3). Ziel des Wohngruppenaufenthaltes ist eine Rehabilitation sowohl im seelischen wie auch psychosozialen Sinne. Konkret werden Fähigkeiten im Umgang mit der Erkrankung vermittelt (sogenanntes Selbstmanagement), falls noch nicht vorhanden der Abschluss der Schule gefördert, eine Integration in den Arbeitsmarkt initiiert und den Arzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie supervidiert wird. erste Schritte zur Verselbstständigung getan. Um diese Ziele verwirklichen zu können, werden verschiedene Dinge angeboten: Es besteht eine feste Tagesstruktur, die mit gemeinsamem Frühstück beginnt. Je nach Entwicklungsstand des Jugendlichen besucht er im Anschluss seine Schule, einen Kurs oder Praktikum beim Internationalen Bund (IB) oder seine Ausbildungsstelle. Jugendliche, die noch nicht so belastbar sind, verbringen den Vormittag in der Arbeitstherapeutischen Werkstatt (ATW), die sich fünf Minuten Fußweg von der Wohngruppe entfernt befindet. Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehen der Wohngruppe fand am 27. April 2005 eine Fachtagung im Johann-Peter-Hebelheim statt, die den Titel dieses Artikels trug. Rund 100 interessierten Gästen (Sozialarbeiter von Kliniken und Jugendämtern, Psychologen, Sozialpädagogen und Erziehern) wurden in fünf Vorträgen zunächst zu psychischen Störungen informiert. Dabei referierte Prof. Schmidt (Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters) über die Bedingungen, die den Verlauf der früh beginnenden Schizophrenie bestimmen. Dr. Maras, Ärztlicher Leiter des Bereichs Emotionale Störungen, CURIUM, KJPP-Uni Leiden, sprach über die berufliche Reintegration schizophrener Adoleszenter und Dr. Höschel (Psychologischer Psychotherapeut in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am ZI) stellte die Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT) im Netzwerk bei Borderline Störung vor. Frau Schmidt-Nieraese, Stellv. Amtsleiterin und Leiterin der Sozialen Dienste des Stadtjugendamts Mannheim, referierte über die Kooperation bei der Erstellung und Fortschreibung des Hilfeplans bei Maßnahmen nach § 35a SGB VIII und abschließend stellte Herr Späth, Referent für Erziehungshilfe des Diakonischen Werks der EKD, Stuttgart die Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungsträger bei Hilfen nach § 35a SGB VIII vor. Nachmittags erläuterte Frau Leyrer, Bereichsleiterin im Johann-PeterHebelheim und verantwortlich für die therapeutische Wohngruppe, den konzeptionellen Wechsel und die Behandlungsergebnisse der therapeutischen Wohngruppe. Anschließend stellten Teammitglieder in Kleingruppen Ausschnitte ihrer täglichen Arbeit dar. Die Vorträge stießen auf großes Interesse und die anschließenden Diskussionen zeigten, das die Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen in Kliniken und Jugendhilfe nach wie vor ein aktuelles Thema ist. Abb. 3: Entlassungsort Eine warme Mahlzeit wird je nach Gruppe mittags oder abends gemeinsam eingenommen. Nach einer Mittagspause wird nachmittags noch ein Gruppenprogramm angeboten, das für alle Jugendliche verpflichtend ist. Des weiteren müssen alltägliche Dinge wie Putzen, Besorgungen und Termine koordiniert werden und sind an bestimmten Tagen von den Jugendlichen durchzuführen. Für die Jugendlichen ist eine medizinische und/oder therapeutische Anbindung verpflichtend. Diese wird zum Teil bei niedergelassenen Kollegen (Kinder- und Jugendpsychiater, psychotherapeuten, Psychiatern und Psychologen) oder in der Ambulanz der Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie wahrgenommen. Das Medikamentenmanagement wird zunächst vom Mitarbeiter übernommen, im weiteren Verlauf ist es aber Ziel, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dieses in Eigenverantwortung übernehmen. Gerhard Ristow Bekommen wir alle Alzheimer? Die leichte kognitive Störung und der Übergang in die Demenz Die Mitarbeiter der Gruppen bestehen aus Sozialpädagogen, Erziehern und Fachkrankenpflegern. Jeder der Mitarbeiter verfügt über Erfahrung in der Betreuung von psychiatrischen Patienten, sei es aus Praktika oder aus der jeweiligen Fachausbildung. Die Mitarbeiter der Gruppen bilden sich therapeutisch weiter, z.B. zu systemischen Therapeuten. Einmal wöchentlich erfolgt eine Teambesprechung je Gruppe, die durch eine beratende Ärztin/einen beraten- Der Anstieg der Lebenserwartung, die Zunahme der älteren Menschen in der Bevölkerung und die zunehmende Erkrankungshäufigkeit im Alter bringen eine große gesellschaftliche Herausforderung mit sich. 1871 waren 4,6% der deutschen Bevölkerung älter als 65 Jahre, 1971 bereits 15,7 % und nach Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung wird der Anteil der 8 • die Kriterien einer Demenz dürfen nicht erfüllt sein über 65-jährigen im Jahre 2030 23,8% betragen (Bickel, 1999). Zu den alterskorrelierten Krankheiten gehören in erster Linie alle Formen von Demenz. Studien in mehreren Ländern fanden in der Altersgruppe der über 65-jährigen eine Prävalenz von Demenzerkrankungen zwischen 5 und 8% (Bickel, 1999). Die Untersuchung der Altersabhängigkeit zeigt, dass die Erkrankungshäufigkeit mit wachsendem Lebensalter steil ansteigt. Bis zu einem Alter von 74 Jahren beträgt die Prävalenzrate in der Bevölkerung weniger als 5% und steigt bei den über 85-jährigen auf 20-30% an. Diese Häufigkeitsangaben beziehen sich auf mittelschwere bis schwere Demenzfälle. Darüber hinaus gibt es noch eine große Zahl von Personen mit fraglichen bis leichten kognitiven Störungen. Tabelle 1 zeigt die Diagnosekriterien im Vergleich (Kurz et al., 2004). Ein wesentlicher Unterschied von DSM-IV und ICD-10 zu den Kriterien von Petersen ist, dass sie die leichte kognitive Störung als Phänomen einer vorübergehenden Erkrankung betrachten. Die leichte kognitive Störung und die Abgrenzung zur Demenz Die Abgrenzung der leichten kognitiven Störung zu altersbedingten kognitiven Einbußen und zu Demenz ist schwierig. Die kognitive Fähigkeit im Alter unterliegt einer starken interindividuellen Streuung und eine Abweichung von der Altersnorm muss nicht gleichbedeutend sein mit einer krankhaften Ursache (Kessler et al., 1997). Sowohl die Definition der leichten kognitiven Störung als auch der Demenz wird durch die unterschiedlichen Diagnosekriterien erschwert. Die leichte kognitive Störung Die leichte kognitive Störung bezeichnet eine häufig fortschreitende Leistungsminderung des Kurzzeitgedächtnisses, der Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit oder des Denkvermögens, die typischerweise nicht mit einer Beeinträchtigung der alltagspraktischen Fähigkeiten einhergeht. Zusätzlich zu Gedächtnisfunktionen können auch andere kognitive Funktionen betroffen sein. Die Leistungsabnahme geht über den normalen Alterungsprozess hinaus, erreicht jedoch nicht den Grad einer Demenz. Die Prävalenz des Syndroms wird auf 17% in der Bevölkerung der über 65-jährigen geschätzt. Bei 10-15% der Patienten schreitet die leichte kognitive Störung innerhalb ein bis zwei Jahren zur Demenz fort, in einigen Fällen bleibt sie unverändert oder bildet sich zurück (Kurz et al., 2004). Der Begriff des Mild Cognitive Impairment (MCI) wurde unter anderem von Ronald Petersen geprägt (Petersen et al., 1999 und 2001). Beschreibt man den zeitlichen Verlauf einer neurodegenerativen Demenzerkrankung auf einem Kontinuum der kognitiven Leistungsfähigkeit, erfolgt der Übergang zwischen leichter kognitiver Störung und Demenz nicht zu einem exakt feststellbaren Zeitpunkt. Für die Personen, die im Verlauf tatsächlich eine Demenz entwickeln, fällt der kognitive Status kontinuierlich vom gesunden Status ab, durchläuft das MCI-Stadium und erreicht schließlich das Stadium einer Demenz. Bei unterschiedlichen Personen wird die Grenze zwischen den Stadien vermutlich nicht zum selben Zeitpunkt überschritten, sondern ist abhängig von Faktoren wie prämorbider Intelligenz und Selbstwahrnehmung einer Person. Diagnose und Therapie Die Diagnostik des MCI unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der Diagnostik einer Demenz, denn es kommen sich die gleichen apparativen und psychologischen Untersuchungen wie bei der Diagnostik anderer neurodegenerativer Erkrankungen zur Anwendung. Typisch ist aber, dass sich in wenig sensitiven Tests wie zum Beispiel dem MMSE noch keine Einschränkungen zeigen. Klar ist inzwischen, dass viel Patienten tatsächlich nicht in einer Vor- oder Frühphase einer Demenz-Erkrankung leben, und es wird intensiv beforscht, ob es bestimmte Faktoren des MCI gibt, die eng mit einer späteren Demenz-Erkrankung assoziiert sind und somit als prädiktive Marker dienen könnten. Diagnostische Kriterien Zur Charakterisierung des MCI (deutsch = leichte kognitiven Störung) gibt es unterschiedliche Kriterien. Die Definitionen nach Petersen (1997), DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) und ICD-10 (Dilling et al., 1994) haben derzeit die größte praktische Bedeutung. Für wissenschaftliche Forschungsvorhaben wird die Definition von Petersen (1997) häufig eingesetzt und nennt folgende Merkmale des MCI: • subjektive Gedächtnisstörung (möglichst bestätigt von einer Bezugsperson) • unterdurchschnittlicher Gedächtnisleistung in neuropsychologischen Testverfahren • keine Einschränkung sonstiger kognitiver Funktionen • keine Einschränkung der Alltagsaktivitäten Um eine sichere Unterscheidung zwischen einer leichten kognitiven Störung und einer Demenz 9 Merkmal Leichte kognitive Störung DSM-IV Leichte kognitive Störung ICD-10 Mild Cognitive Impairment (MCI) Subjektive Beschwerden Bericht über kognitive Störung entweder durch Patient oder Bezugsperson Bericht über kognitive Störung entweder durch Patient oder Bezugsperson Subjektives Klagen über Gedächtnisstörungen Mindestdauer 2 Wochen 2 Wochen keine Festlegung Minderung gegenüber bisherigem Leistungsniveau Ja keine Festlegung keine Festlegung Gedächtnisstörungen obligat Nein Nein Ja Ätiologischer Faktor Nachweis eines ursächlich oder medizinischen Krankheitsfaktors Nachweis oder Anamnese einer zerebralen oder systematischen Krankheit als Ursache Keine Festlegung Objektivierung durch psychometrische Test Ja Ja Nicht vorgeschrieben Alltagsfunktionen Kognitive Defizite führen zu deutlichem Leiden oder sozialer/beruflicher Beeinträchtigung Keine Festlegung Alltagsbewältigung intakt Ausschluss Delir, Demenz, amnestische Störung, andere psychische Störung Delir, Demenz, amnestisches Syndrom, andere Ursachen Demenz Tabelle 1: Diagnosekriterien tomografisch nachweisbaren Veränderungen sind dann bei Patienten mit einer Alzheimer Demenz noch deutlich stärker ausgeprägt. Weitere diagnostische Verfahren zur sicheren Abgrenzung verschiedener Krankheitsätiologien, die wahrscheinlich in Zukunft eine größere Bedeutung erlangen werden, sind Untersuchungen von Blut, Liquor und Genotypisierungen (Blennow K., 2004; van Duijn C., 2004). Diskutiert wird auch, dass etwa das ApoE4Allel, erhöhte Homocystein- oder LDL-Spiegel oder erhöhte Entzündungs-Parameter, wie Interleukin 6, risikomodulierende Parameter sind. Zu klären ist noch, ob etwa Veränderungen im Hippocampus bei MCI allein oder in Kombination mit psychologischen und biologischen Parametern als Prädiktor für eine spätere Alzheimer-Demenz geeignet sind. zu treffen, werden die kognitiven Funktionen des Patienten mit altersnormierten Testverfahren erhoben und durch Befragung einer Bezugsperson die Beeinträchtigungen der alltagspraktischen Fähigkeiten objektiviert. Eine erhöhte Aussagekraft neuropsychologischer Testverfahren bieten Wiederholungsmessungen, die in einem Abstand von 6-12 Monaten durchgeführt werden sollten. Eine Verschlechterung der Testergebnisse macht eine krankheitswertige Ursache der leichten kognitiven Störung wahrscheinlich. Zur weiteren Diagnosesicherung, ätiologischen Zuordnung und prognostischen Beurteilung stehen die bildgebenden Verfahren zur Verfügung. Atrophie und Volumenabnahme, insbesondere des Hippocampus und anliegender Hirnstrukturen, sind bei Patienten mit leichter kognitiver Störung häufig zu finden und weisen auf eine frühe strukturelle Manifestation der Alzheimer Demenz hin (Jack et al., 1999; de Leon M., 2004). Diese Patientengruppe hat ein besonders hohes Risiko - innerhalb kurzer Zeit die Demenzkriterien zu erfüllen. Die kernspin- Pharmakotherapeutische Ansätze zur Behandlung kognitiver Störungen haben sich bisher auf die Behandlung der Alzheimer Demenz konzentriert. Zur Therapie der leichten kognitiven Störung werden zurzeit mehrere klinische Prüfungen mit Substanzen durchgeführt, die zuvor 10 schon ihre Wirksamkeit für die Behandlung einer Alzheimer Demenz unter Beweis gestellt haben. Im Juli 2004 sind hierzu erste Ergebnisse von zwei großen weltweiten durchgeführten klinischen Studien bekannt geworden. In den Untersuchungen mit den Wirkstoffen Donepezil und Galantamin zeigten sich zwar vereinzelt positive Testwerte, insgesamt aber keine Verzögerung der Progressionsrate zur Alzheimer Demenz (Salloway et al., 2004). "Psychose und Stigma" Ein Projekt der FH für Sozialwesen Mannheim in Kooperation mit dem ZI "Wer mit den Massenmedien entstigmatisieren will, kämpft nicht nur gegen den Zeitgeist.Er kämpft gegen Windmühlen." (Asmus Finzen) "Psychose und Stigma" – so lautet der Titel unseres zweisemestrigen Projekt-Studiums, im Rahmen dessen wir uns mit der Position Psychoseerfahrener in der Gesellschaft bzw. mit Einstellungen und Haltungen der Bevölkerung gegenüber psychisch kranken Menschen – dem Bild der psychischen Erkrankung in der Öffentlichkeit – befassen. Ausblick In unterschiedlichen nationalen und internationalen Studien werden derzeit erhebliche Anstrengungen unternommen, um eine geeignete Prädemenzdiagnostik zu entwickeln. Denn nur durch eine frühzeitige Diagnose kann der Weg zu einer gezielten Therapie eingeleitet werden. Das Phänomen der psychischen Erkrankung gleicht einem Januskopf mit zwei Gesichtern: Die eine Seite der Medaille spiegelt die Psychose an sich wider, während die andere Seite den Mythos der Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen trägt. Nach Robert Musil ("Der Mann ohne Eigenschaften") leiden psychisch kranke Menschen nicht nur unter ihrer minderwertigen Gesundheit, sondern auch an einer minderwertigen Krankheit. Genannt seien hier das Kompetenznetz Demenzen (www.kompetenznetz-demenzen.de) und die europäische DESCRIPA-Studie (Development of Screening Guidelines and Diagnostic Criteria for Predementia Alzheimer´s Disease, siehe http://eadc.alzheimer-europe.org), die sich aktuell mit dieser Thematik befassen. Zusätzlich sind weitere Ergebnisse aus klinischen Prüfungen nötig, um pharmakotherapeutische Behandlungsstrategien zur Therapie der leichten kognitiven Störung voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund zielt unser Projekt auf die Entmystifizierung des Phänomens "Psychose und Stigma". Dabei handelt es sich um eine sensible Thematik, welche uns alle angeht: Denn zum Erhalt der Gesundheit der Seele existiert kein Impfstoff, aufgrund dessen niemand zeitlebens gegen eine psychische Erkrankung immun oder geschützt ist; jeder kann im Laufe seines Lebens davon betroffen werden. Niemand darf aufgrund seiner Krankheit diskriminiert werden. Dieses Bewusstsein ist allerdings noch nicht integraler Bestandteil der Handlungs- und Verhaltenswei-sen der Bevölkerung. Aber: „Bekommen wir nun alle Alzheimer?“ Es ist festzuhalten, dass der häufigste Zustand im Alter noch immer die (relative) Gesundheit ist. Eine leichte kognitive Störung ist nicht nur ein subjektives Gefühl nachlassender Leistungsfähigkeit, sondern muss diagnostisch belegt werden. Und selbst wenn, dieser Phänotyp vorliegt, heißt es nicht, dass die leichte kognitive Störung zu einer Alzheimer Krankheit fortschreiten wird. Ein MCI ist als Risikostadium zu betrachten, dass zur Demenz fortschreiten oder unverändert bleiben oder sich auch zurückbilden kann. Aufgrund mangelnder Information bestehen in der Gesellschaft immer noch Vorurteile sowie Distanz gegenüber psychisch kranken Menschen. So werden Betroffene leider immer noch häufig als unheilbar kranke "Irre" oder "Verrückte" abgestempelt. Darüber hinaus gelten psychisch kranke Menschen als unberechenbar, gefährlich oder gar gewalttätig. Der Irrglaube gipfelt darin, dass die psychische Erkrankung als Ergebnis einer Charakter- oder Willensschwäche durch Schuldzuweisungen verurteilt wird, oder gar in der Vorstellung, Betroffene seien mit ihrer "Verrücktheit" ansteckend. Eine geradezu zwangsläufige Folge solcher Kognitionen ist die Stigmatisierung psychisch kranker Menschen. Als Präventions- und Therapiemaßnahmen gelten auch bei der leichten kognitiven Störung ein allgemeines Risikofaktor-Management und eine gesunde Lebensführung wie sportliche und geistige Betätigung, mäßiger Alkoholkonsum und Nichtrauchen. Lutz Frölich, Tanja Bernhardt (Literatur bei den Autoren) Stigmatisiert zu werden bedeutet, mit einem "Zeichen" behaftet zu sein. Es "haftet" oder 11 Öffentlichkeitsarbeit des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit sowie der Patientenfürsprecherin des Zentralinstituts, Monika Wolff. Unterstützung erhielten wir auch vom Leipziger Schulprojekt "Irrsinnig menschlich e. V." "bleibt kleben". Stigmatisierung spiegelt die benachteiligende Haltung und Einstellung eines Menschen gegenüber einer anderen Menschengruppe wider, welche sowohl verbal als auch nonverbal durch Gesten, Mimik, Körperhaltung oder Tonfall geäußert und im Zuge dessen weiter verbreitet werden. Die Etikettierung „Psychose“ wird somit zum Stigma psychischer Erkrankungen, welches sich nach Asmus Finzen als "die zweite Krankheit neben der Psychose" manifestiert. Dies führt zu einer Benachteiligung psychisch kranker Menschen im Vergleich zu körperlich Kranken im Sinne einer sozialen Ausgrenzung bis hin zur Isolation. Aus der Stigmatisierung erwächst also sowohl eine strukturelle wie soziale Diskriminierung in Form von Herabsetzung sowie Benachteiligung psychisch kranker Menschen auf mehreren Ebenen. Spannend war für uns darüber hinaus die Frage, ob wir mit dieser Thematik Jugendliche im Alter von 13/14 Jahren überhaupt erreichen können. Rahmenbedingungen Die Zielgruppe unseres Workshops setzte sich aus Konfirmanden der Gemeinde Neuostheim/Neuhermsheim zusammen. Die 31 Jungen und Mädchen, im Alter von 13 bis 15 Jahren, gehen auf unterschiedliche Schulen. Über die Hälfte der Jugendlichen besuchen das Gymnasium, sieben Schüler die Realschule, und ein Schüler geht auf die Hauptschule. Das Projekt fand an drei Terminen für jeweils zwei Stunden im Rahmen des Konfirmandenunterrichtes statt. Es ist demzufolge Aufgabe aller im Bereich der psychischen Gesundheit Tätigen, der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen entgegenzuwirken bzw. einen Beitrag zur Stigmabewältigung zu leisten. Bewusstmachung und Bekämpfung von Stigmatisierungen durch gezielte Aufklärungsmaßnahmen sind von zentraler Bedeutung, um das krankheitsspezifische Wissen in der Öffentlichkeit durch Sachinformationsvermittlung zu korrigieren. Diesem Credo folgt die weltweite Anti-Stigma-Bewegung zum Abbau von falschen Vorstellungen, Vorurteilen sowie Diskriminierung psychisch kranker Menschen, welcher diverse Anti-Stigma-Projekte wie beispielsweise das internationale Programm "Schizophrenia – Open the doors" des Weltverbandes für Psychiatrie (WPA, World Psychiatric Organization) angehören und welche darauf zielt, der Stigmatisierung und Ausgrenzung Psychoseerfahrener entgegenzuwirken sowie deren soziale Reintegration zu fördern. Entgegen Albert Einsteins Prognose, es sei leichter, ein Atom zu spalten als ein Vorurteil, fußen die Anti-Stigma-Kampagnen auf der Prämisse, dass menschliche Stigmatisierungsprozesse einer Entwicklung zugänglich und veränderbar sind. Ziele Im Vordergrund unseres Projekts stand die Aufklärungsarbeit und Wissensvermittlung, mit dem Ziel der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen entgegenzuwirken. Den Jugendlichen sollte möglichst viel Wissen über den Umgang mit psychisch kranken Menschen und deren Krankheitsbildern vermittelt werden. Über eventuell bestehende Vorurteile sollte diskutiert werden und ein Beitrag dazu geleistet werden, diese abzubauen. Eigene Vorurteile und Vorbehalte sollten wahrgenommen, überprüft und besser verstanden werden. Ein respektvoller, fairer und offener Umgang mit psychisch kranken Menschen stellte ein erstrebenswertes Ergebnis dar. Durchführung Zu Beginn des ersten Projekttages wurden die Jugendlichen gebeten, eigene Fragen zum Thema zu stellen und diese schriftlich auf Karten zu fixieren. Die Fragen wurden jeweils nach der Kleingruppenarbeit aufgegriffen und besprochen. Am Ende der Projekttage wurden die wenigen noch offenen Fragen beantwortet. Die Projektnachmittage gestalteten sich in Form von Kleingruppenarbeit sowie Informationsvermittlung mittels Filmsequenzen und Gesprächsrunden. Das Projekt "Anderssein – psychisch krank" Viele Einstellungen gegenüber Minderheiten werden während der Adoleszenz erworben, welche sich im Prozess der weiteren Sozialisation verfestigen. Daher haben wir, um von der Theorie ausgehend zur Praxis zu gelangen und gleichzeitig die Schwelle zur Psychiatrie zu senken, als unseren Beitrag zur Entstigmatisierung bzw. Stigmabewältigung psychisch kranker Menschen einen Workshop mit einer Konfirmandengruppe zum Thema "Anderssein – psychisch krank" durchgeführt, dessen Verlauf und Evaluation wir im Folgenden präsentieren möchten. Er fand statt in Kooperation mit Dr. med. Marina Martini, Leiterin des Referates Folgende Themen wurden ausführlich angesprochen, referiert bzw. diskutiert: • Psychische Krankheiten und Symptome sowie Reaktionen von Menschen auf psychisch kranke Menschen • Einstellung/Haltung gegenüber psychisch kranken Menschen, Stellung psychisch kranker Menschen in der Gesellschaft • Psychiatrische Klinik und Behandlung von psychischen Erkrankungen 12 Es erschien uns sehr wichtig, bei der Diskussion um die Vorurteilsbehaftung, immer wieder darauf hinzuweisen, dass jeder Mensch an einer psychischen Krankheit erkranken kann. Den Jugendlichen wurde nahe gebracht, dass prinzipiell jeder Mensch eine Veranlagung und/oder Anfälligkeit für den Ausbruch einer psychischen Erkrankung aufweist. Faktoren wie das soziale Umfeld, Gene, Persönlichkeit oder bestimmte Familiensituationen können bei der Entstehung einer Psychose eine Rolle spielen. We lc he N a m e n v o n ps yc his c he n Kra nk he it e n k e nns t du? 20 15 vorher 10 nachher 5 0 Abb. 1: Ergebnisdarstellung zur Frage "Welche Namen von psychischen Krankheiten kennst Du?" Der Film "Was ist Schizophrenie?" der Pharmafirma Janssen sowie Filmsequenzen zum Thema Magersucht, Bulimie, Depression, Manie und weiteren psychischen Erkrankungen sollten den Jugendlichen einen Einblick in mögliche Symptomkonstellationen sowie das Erleben einer psychischen Erkrankung gewähren. Die Jugendlichen erhielten ferner die Gelegenheit zum Besuch des Zentralinstituts, um eine psychiatrische Klinik mit eigenen Augen kennen zu lernen. Deutliche vorher-nachher-Veränderungen zeigen sich bei der Frage nach bekannten psychischen Krankheiten (siehe Abb. 1). Aus dem Diagramm geht deutlich hervor, dass die Anzahl der genannten Krankheiten stark gestiegen ist. So wurden bei der ersten Befragung durchschnittlich 2,14 Bezeichnungen genannt, bei der zweiten Befragung 4,05. In diesem Zusammenhang lernten die Jugendlichen die Patientenfürsprecherin Monika Wolff, kennen. Bei ihr hatten die Konfirmanden die Möglichkeit, direkt in Kontakt mit einer Betroffenen zu treten. Frau Wolff arbeitet seit acht Jahren als Patientenfürsprecherin im ZI und kennt sowohl die Seite einer Helfenden als auch die einer Patientin. Sie vermittelte authentisch und eindrucksvoll ihre Erfahrungen mit ihrer Krankheit. Auch qualitativ ist eine Verbesserung festzustellen. Die Krankheiten, die während unserer Treffen besprochen und durch Videos unterlegt wurden, wurden in der abschließenden Befragung am häufigsten benannt. Während Bulimie, Magersucht und Schizophrenie einigen wenigen Schülern schon vorher ein Begriff war, stiegen die Nennungen bei Manie von null auf elf an. Auffallend ist, dass (Drogen-)Sucht beim ersten Fragebogen sechsmal genannt wurde, beim zweiten Fragebogen allerdings nicht mehr. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass das Thema „Sucht“ in unserem Programm nicht weiter thematisiert wurde. Fragebogen Zu Anfang und Ende unseres Projektes wurde eine Umfrage in Form eines Fragebogens durchgeführt. Damit wollten wir den Wissensstand und die Einstellungen zum Thema "Psychisch kranke Menschen in unserer Gesellschaft" bei den Jugendlichen der Konfirmandengruppe Neuostheim/Neuhermsheim erheben. Der Fragebogen enthielt folgende Rubriken: eigene Erfahrungen, gegenwärtiger Wissensstand, subjektive Haltung/mögliche Vorurteile gegenüber psychisch kranken Menschen. Unsere eigenen Fragen wurden ergänzt mit einem Teil des Fragebogens, der beim Schulprojekt „Irrsinnig menschlich e.V.“ Verwendung findet. Die vorher-nachher- Befragung sollte einen direkten Vergleich liefern. Um die beiden Fragebögen trotz Anonymität einander zuordnen zu können, verwendeten wir einen Code. Wer könnte einem psychisch kranken Menschen helfen? 12 10 8 6 4 2 0 vor her nachher Abb. 2: Ergebnisdarstellung zur Frage "Wer könnte einem psychisch Kranken helfen?" Gefragt nach Hilfsmöglichkeiten (siehe Abb. 2) zeigt sich, dass der Einblick ins Spektrum der Hilfe eine quantitative Verbesserung gebracht hat. Der Zugewinn an Informationen trug wesentlich zur Vergrößerung des Repertoires der Hilfsmöglichkeiten bei. Die gravierendste Veränderung ist bei der Nennung der "Betroffenen" zu sehen, die von null auf acht anstieg. An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass der Begriff Ergebnisse Im Folgenden präsentieren wir die interessantesten Ergebnisse der Auswertung. Diese bezieht sich auf zehn Jungs und elf Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren aus Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Mehrfachnennungen waren möglich. 13 waren andere genauer formuliert. Zweimal wurde das Gespräch mit Psychologen genannt, ebenfalls zweimal Gespräche mit Ärzten. Jeweils einmal wurden Gespräche mit Freunden bzw. mit der Familie als Möglichkeit betrachtet. Auch die Therapie wurde häufig als einzelner Begriff aufgelistet. Einige enthielten Zusätze wie "Entzug", "Spiele", "Gruppentherapie" und "Beruhigungsmethode". "Betroffene" von den Schülern stammt, also genau so benannt wurde. Positiv zu bemerken ist, dass kranke Menschen nicht mehr nur als Kranke gesehen werden, sondern auch als Helfer. Zu dieser Entwicklung hat unserer Einschätzung nach insbesondere die Patientenfürsprecherin beträchtlich beigetragen. Als ebenfalls sehr positiv ist die Steigerung der Nennungshäufigkeit insgesamt zu bewerten. Am häufigsten wurde der Arzt als Helfer genannt. Hierbei ist fraglich, ob den Schülern der Unterschied zwischen Arzt und Psychiater klar ist. Aus den Fragebögen war der bewusste Umgang im Sinne einer wissentlichen Unterscheidung nicht ersichtlich. Lediglich dreimal wurde Arzt und Psychiater in einem Fragebogen von derselben Person genannt. Möglicherweise basieren die Nennungen von Arzt, Psychiater und Therapeut auf der Funktion dieser Personen in ihrer Arbeit mit psychisch kranken Menschen und nicht auf dem zugrunde liegenden Beruf. Die einzelne Nennung der "Hilfe durch Medikamente" ist vermutlich auf ein Missverständnis der Frage zurückzuführen, was sich in Abb. 3 bestätigt. Eine weitere Auswertung (siehe Abb. 4 bis 6) umfasst einen Teil des Fragebogens, in dem den Schülern Situationen vorgegeben wurden, zu denen sie eine Entscheidung fällen sollten – und zwar auf einer Punkteskala von eins bis fünf, wobei eins "die Aussage trifft voll zu" und fünf "die Aussage trifft nicht zu" repräsentiert. Situation 1 Es w ürde m ich nicht stören, m it jem andem , der psychisch krank ist, in eine Klasse zu gehen. 15 10 5 0 vor her nachher 1 Wie könnte diese Hilfe aussehen? 2 3 4 5 P un k t e v e r t e i l un g 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Abb. 4: Ergebnisdarstellung zur Situation 1 vorher nachher Ergebnis Situation 1 (Abb. 4): Der Mittelwert von 2,24 zeigt schon zu Anfang eine akzeptierende Grundhaltung der Schüler gegenüber psychisch kranken Menschen. Durch unser Projekt konnte sogar noch eine Besserung von 0,34 erreicht werden. Bei sechs der Jugendlichen hat sich die Einstellung verbessert, bei drei von drei Punkten auf fünf Punkte und von zwei Punkten auf drei Punkte verschlechtert. Die übrigen zwölf blieben bei ihrer ursprünglichen Meinung. Abb. 3: Ergebnisdarstellung zur Frage "Wie könnte diese Hilfe aussehen?" Als Fortschritt zu vermerken ist in erster Linie, dass wir durch Gespräche und Informationen Wissen an die Schüler weitergeben konnten, welches auch aufgenommen wurde. Dies zeigt sich deutlich darin, dass sich in der ersten Befragung fünf Jugendliche nichts unter einer Hilfeleistung vorstellen konnten, in der zweiten jedoch konnten alle mindestens eine nennen; die Anzahl der Nennungen ist deutlich gestiegen. Situation 2 Ich kann m ir nicht vorstellen, m ich m it jem andem , der psychisch krank ist, anzufreunden. 15 vorher 10 5 nachher 0 1 Der Begriff "Unterstützung" wurde als solcher einmal genannt, zweimal mit den Zusätzen "Krankheit akzeptieren" oder "aufmuntern". Die größte Zunahme ist bei der Hilfeleistung durch Medikamente zu verzeichnen; dies ist sicherlich darauf zurück zu führen, dass dieses Thema im Verlauf der Projekttage des öfteren zur Sprache kam. Schon vorher bekannt war die Bedeutung der Hilfeleistung durch Gespräche. Während viele Nennungen sich auf dieses eine Wort, das viele Interpretationen zulässt, beschränkten, 2 3 4 5 Punkt ever t ei lung Abb. 5: Ergebnisdarstellung zur Situation 2 Ergebnis Situation 2 (Abb. 5): Hier zeigt sich eine leichte Verschlechterung der Haltung. Da die Nennungen von zweimal eins und einmal zwei bei der zweiten Befragung jeweils von Schülern genannt wurden, die bei der ersten Befragung jeweils die vier bzw. fünf angekreuzt hatten und im gesamten Fragebogen eine 14 durchgängig positive Haltung zeigen, ist davon auszugehen, dass die Frage nicht korrekt gelesen und somit falsch beantwortet wurde. Alle anderen zeigen nur leichte Veränderungen von einem Punkt. Die Evaluation unserer schriftlichen Umfrageerhebung zeigt auf, dass wir sowohl das fachliche Sachwissen betreffend als auch bezüglich eventueller Vorurteile einen positiven Wandlungsprozess im Denken der Jugendlichen anzustoßen vermochten. Situation 3 Wenn jem and von m einen Freunden psychisch krank w erden w ürde, w ürde ich ihn/sie im Krankenhaus besuchen. Nach unserer abschließenden Veranstaltung im ZI, insbesondere dem unmittelbaren Kontakt mit der Patientenfürsprecherin Frau Wolff, hinterließen die Konfirmanden den Eindruck, sich mit der Thematik bewusst und in konstruktiver Weise auseinander gesetzt zu haben. 40 vorher 20 Im idealen Fall fungieren diese Schüler nun als Multiplikatoren, indem sie ihre neuen Erkenntnisse über die Konfirmandengruppe hinaus auch beispielsweise innerhalb der Schulklasse, des Freundeskreises und des näheren sozialen Umfeldes weiter tragen. nachher 0 1 2 3 4 5 Punkt ever t ei lung Abb. 6: Ergebnisdarstellung zur Situation 3 Ergebnis Situation 3 (Abb. 6): Hier positionieren sich alle Befragten sehr deutlich. Die Freundschaft scheint im Vordergrund zu stehen, die Krankheit spielt keine entscheidende Rolle. Schließlich bleibt noch festzuhalten, dass auch wir, die Gruppe der Studierenden, selbst zum Teil unser Bild von psychisch kranken Menschen korrigieren konnten. Auch wenn wir zu Beginn unseres Projekt-Studiums mit einem breit gefächerten Basiswissen antraten, hatten wir dennoch die eine oder andere Vorstellung, welche sich als nicht wahrheitsgemäß herausstellte – eine Erfahrung, welche zu guter letzt auch uns davor bewahren wird, in Stigmatisierungen zu verfallen. Wir hoffen, durch unsere Arbeit bewirkt zu haben, dass das Thema "Psychische Erkrankungen" zumindest von der Jugendgruppe, mit der wir zusammen gearbeitet haben, künftig weniger vorurteilsbelastet behandelt wird. Ferner wünschen wir uns, über den Workshop hinaus durch unser Wirken einen kleinen Beitrag zur Entstigmatisierung psychisch kranker Menschen geleistet zu haben, damit das Anliegen von psychisch kranken Menschen umgesetzt wird – nämlich angenommen zu werden wie jeder andere Mensch auch, sei er nun krank oder gesund. In dieser Botschaft ist der Schüssel zum Motor enthalten, welcher Stigmabewältigungsprozesse in Gang setzt. Allgemein ist zu der Güte des FragebogenBeantwortung zu sagen, dass die Schüler diese gewissenhaft ausgefüllt haben. Wenn auch, wie beschrieben, vereinzelt die Formulierungen der Fragen (Verneinungen) wohl zu Missverständnissen führen konnten, sehen wir die Antworten der Jugendlichen als korrekte Wiedergabe ihres Wissens bzw. ihrer Haltung an. Ein statistischer Zusammenhang zwischen Geschlecht, Alter und/oder Schulbildung konnte nicht hergestellt werden. Resümee und Ausblick Ein wesentliches Ergebnis unseres Projektes lautet dahingehend, dass Jugendliche im Alter von 13/14 Jahren in der Lage sind, sich nachhaltig mit dem Thema „Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen“ zu befassen. Trotz anfänglicher Unsicherheit und Unruhe waren die Jugendlichen sehr gut zu motivieren, sich einem für sie vordergründig eher wenig relevanten Anliegen anzunähern und sich mit großer Aufmerksamkeit damit zu befassen. Die Beiträge zeugten von adäquatem Verständnis für die Problematik einerseits sowie auch einem Gespür für die damit verbundenen Reaktionen in unserer Gesellschaft. Insofern wurde unser Anliegen gut verstanden. Entgegen der vorherrschenden Meinung scheint es also durchaus möglich zu sein, auch mit Adoleszenten dieser Altersstufe effizient zur Thematik "Psychische Erkrankungen" zu arbeiten und somit Vorurteile und Stigmatisierungen schon in einem sehr frühen Stadium aufzugreifen und in positiver Weise zu beeinflussen. Prof. Dr. Manfred Oster mit Projektgruppe (Claus Breuer, Mareike Dochat, Patricia Hirsch, Daniela Kenty, Nora Penner und Stephanie Rühe) 15 Früherkennung und Frühprävention von Psychosen Ein Projekt im Kompetenznetz Schizophrenie der Krankheit. Dazu muss die Symptomatik einer beginnenden Schizophrenie oder affektiven Psychose von anderen Krankheiten und von seelischer Gesundheit unterschieden werden. Zweitens muss das Fortschreiten der Krankheit und gegebenenfalls der Eintritt einer Psychose hinreichend verlässlich vorhergesagt werden. Im Rahmen der seit dem 1.1.1987 bis Ende 1998 im SFB 256 und seither im Einzelverfahren von der DFG geförderten ABC-Schizophreniestudie haben wir an einer bevölkerungsbezogenen und mit „gesunden“ nach Alter, Geschlecht und Erhebungsregion gematchten Kontrollen verglichenen Stichprobe von 232 ersten Episoden von Schizophrenie zeigen können, dass dem Höhepunkt der ersten psychotischen Episode eine präpsychotische Prodromalphase von durchschnittlich 4,8 Jahre (Median 2,3 Jahre) und eine nachfolgende psychotische Frühphase von 1,1 Jahren Dauer (Median 0,8 Jahre) vorausgeht. Die Krankenhausaufnahme wird erst durch die verwirrenden/belastenden Erlebnisse der akuten Psychose ausgelöst, und zwar im Mittel 2 Monate nach dem Höhepunkt der Episode. Die sozialen Folgen der Krankheit treten überwiegend bereits in der Prodromalphase und im psychotischen Frühverlauf auf. Zum Zeitpunkt der Erstaufnahme haben sie bereits ein erhebliches Ausmaß erreicht. Aus diesem Grunde lag es nahe, den Versuch einer frühzeitigen Intervention zu unternehmen mit dem Ziel, die Entwicklung einer psychotischen Episode nach Möglichkeit zu verhindern, sie wenigstens hinauszuschieben oder abzuschwächen und den sozialen Folgen der Krankheit frühzeitig vorzubeugen, noch bevor schwer aufholbare Verluste wie Schulabbruch, Arbeitsplatzverlust oder Scheidung eingetreten sind. Der Teilverbund I des Kompetenznetzes Schizophrenie hat sich zum Ziel gesetzt, das Psychoserisiko im Frühverlauf zu erkennen und die Wirksamkeit psychoseferner-psychologischer und psychosenaher– auch psychopharmakologischer– Intervention zu prüfen. Diese Interventionsprojekte werden an den Psychiatrischen Universitätskliniken Köln (Prof. Klosterkötter), Bonn (Prof. Maier), Düsseldorf (Prof. Gaebel) und München (Prof. Möller) im Rahmen der KNS-Förderung durch das BMBF seit dem 1.02.2000 gefördert. Der Schwerpunkt der Forschungen zur Früherkennung liegt in Händen der Arbeitsgruppe Schizophrenie am ZI (Prof. Häfner). Uns fiel die Aufgabe der Konstruktion und Validierung eines Früherkennungsinventars zu. Unter Aufnahme der Symptome mit hoher Unterscheidungskraft zwischen Frühsymptomen von Schizophrenie und solchen von „gesunden“ Kontrollen aus der ABC-Studie haben wir eine 17-Item-Checkliste als Screeninginstrument und eine Symptomliste mit 110 Items (Symptome und Indikatoren funktioneller Beeinträchtigung) zur Fallidentifikation entwickelt. In der Zwischenzeit haben wir eine repräsentative Substichprobe von 130 Erstaufnahmen wegen Schizophrenie mit jeweils dergleichen Zahl entsprechend gemachter Kontrollen von Erstaufnahmen mittelschwerer und schwerer depressiver Episoden und „gesunder“ Personen untersucht. Dabei wurde deutlich, dass beide Krankheiten mit nahezu derselben Prodromalsymptomatik beginnen. Sie sind von Gesunden früh, voneinander aber erst nach dem Auftreten der ersten positiven Symptome eindeutig unterscheidbar. Auch im Frühverlauf schwerer Depressionen kommt es lange vor der Erstaufnahme zu funktionellen Beeinträchtigungen, wenn auch in objektiv und nicht subjektiv geringerem Umfang als bei Schizophrenie. Die niedrige Basisrate des Schizophrenierisikos (jährliche Erkrankungsrate um 1/1000) zwingt zum mehrstufigen Vorgehen. Der erste Schritt ist die Selbstselektion bei leicht erhöhtem Risiko durch Konsultation von Allgemeinärzten, Beratungsstellen und Beratungslehrern (Gymnasium etc.). Mit der Checkliste werden aus diesem Risikopotential Personen mit mäßig erhöhtem Psychoserisiko erfasst. Beim Überschreiten eines gewichteten Scores werden die Risikopersonen derzeit an ein Früherkennungszentrum, später an psychiatrische Dienste, die über geeignete Interventionsangebote verfügen, zur Untersuchung mit der Symptomliste und gegebenenfalls zur Therapie überwiesen. Die Symptomliste aus der ABC-Studie - durch BSABS-Items aus der Studie Klosterkötter et al. in 2000 ergänzt – ist außerdem mit 4 Modulen (Pharmakotherapie, Substanz-/Drogenmissbrauch, Delinquenz und tägliche Lebensbewäl- Die Voraussetzungen einer Frühintervention bei drohender Psychose, die in zunehmendem Maße von Arbeitsgruppen in mehreren Ländern unternommen wurde – Pionier dieser Bewegung ist Prof. Patrick McGorry in Melbourne – ist die frühzeitige Entdeckung und Erkennung 16 tigung) ausgestattet. Um die Unterscheidungsund Vorhersagekraft anzureichern, wird die Symptomerfassung von der Arbeitsgruppe Prof. M. Wagner (Bonn) durch einen Set von 10 einfachen neuropsychologischen Tests ergänzt, mit denen die kognitive Beeinträchtigung erfasst wird. Über diese „State-Merkmale“ des erhöhten Risikos hinaus werden auch noch „Trait-Merkmale“ erfasst, d.h. Faktoren, die mit dem Krankheitsri- siko selbst assoziiert sind, wie familiäre Belastung mit mindestens einem an Schizophrenie erkrankten Angehörigen ersten Grades, Schwangerschaftskomplikation und Verzögerungen oder Anomalien der kindlichen Entwicklung. Sie dienen der „Anreicherung“ des Risikos, weil oder solange die Effektstärke des Früherkennungsinventars und seiner ergänzenden Instrumente noch keine hinreichende Vorhersagekraft oder NNT (Anzahl der zu behan- Abb. 1: Häufigkeiten der Checklistsymptome in den beiden Frühinterventionsgruppen durch die ‚Regione Lombardia’ und Israel/Early recognition of schizophrenia (Prof. Jonathan Rabinowitz)/gefördert durch DIP – geprüft. Bisher war nur eine vorläufige Auswertung sowohl der Brauchbarkeit und Aussagekraft des Früherkennungsinventars als der Durchführbarkeit und Wirksamkeit der beiden Interventionsprogramme möglich. delnden Individuen, um wenigstens bei einer Person Erfolgschancen zu haben) erreicht. Die Reliabilität des Früherkennungsinventars– durch Trainingsseminare erhöht- ist wiederholt getestet und als gut bis befriedigend befunden worden. Die Validität des Früherkennungsinventars wird prospektiv außer im KNS in Zusammenarbeit mit Partnerprojekten-Mailand/Programma 2000 (Prof. Angelo Cocci)/gefördert 17 Um die Frage zu klären, ob die Checkliste Psychosenähe abbildet, haben wir eine RASCHSkalierung der Items vorgenommen. Das Ergebnis zeigt die Abb.3. Vorläufige Ergebnisse der Früherkennung Die Abb. 1 zeigt die Häufigkeiten der 17 Checklistensymptome in den beiden Frühinterventionsgruppen. Zugrunde liegen insgesamt 172 untersuchte Fälle, 101 im präpsychotischen und 71 aus dem „psychosenahen“, d.h. frühpsychotischem Stadium. Die Zunahme von der frühen zur späten Verlaufsphase konzentriert sich auf psychosenahe und psychotische Symptome. Die präpsychotische Gruppe zeigt bereits relativ hohe Symptomwerte, vor allem bei den präpsychotischen Prodromi, was ihre Nähe zum psychotischen Frühstadium vermuten lässt. Die Symptome der Checkliste werden aufgrund der RASCH-Skalierung entlang einer Dimension angeordnet, wobei die Ordnung den Grad der Psychosenähe zum Ausdruck bringen soll. Das Symptom Nr. 8 „Anpassung / Nervosität / Unruhe“ beispielweise ist sehr unspezifisch und entspricht deshalb der geringsten Psychosenähe, das Symptom Nr. 17 „Halluzinationen“ ist bereits ein psychotisches Symptom. Es repräsentiert in der Checkliste den höchsten Grad an Psychosenähe und setzt sich von den übrigen Symptomen sichtbar nach oben ab. Auch mit der Checkliste beurteilte Personen werden entsprechend der erreichten Psychosenähe eingestuft. Mit steigender Psychosenähe erhöht sich die Auftretenswahrscheinlichkeit der Symptome. Der Sachverhalt, dass Personen im psychosefernen Prodrom zu einem hohen Anteil im linken Bereich der Skala lokalisiert sind und solche des psychosenahen Prodroms im rechten Teil ist als starker Hinweis auf die Validität der Checkliste als Instrument zur Erfassung der Psychosenähe zu werten. Die 10 häufigsten Merkmale der ERIraos Symptomliste im Frühverlauf zeigt die Abb. 4. Abb. 2 zeigt die ansteigende Akkumulation der Zahl aufgetretener Checklistensymptome in den Monaten vor Erreichen jenes Risikoniveaus, das zum letzten Schritt der Risikoerkennung zur Anwendung der Symptomliste führt. Die Frage, ob sich die beiden unterschiedlichen Stadien der Krankheitsentwicklung aufgrund der Checklistensymptome differenzieren lassen, ist positiv zu beantworten. Das Auftreten psychotischer Symptome differenziert eindeutig und hochsignifikant, was auch unsere doppelt kontrollierte Studie der Frühentwicklung von Schizophrenie und Depression deutlich machte. Von den präpsychotischen Merkmalen differenzieren einige „psychosenahe“ Items, nämlich Derealisation und Misstrauen, aber auch Eigenbeziehungstendenz, Gedankenjagen und in geringerem Umfang Reizbarkeit und fehlendes Interesse an der Arbeit, relativ gut. Von einer Zunahme der Häufigkeiten und vom Hinzutreten von Symptomen, die in der Checkliste nicht enthalten waren, abgesehen sind die Veränderungen gegenüber dem Symptomprofil der Checklisten relativ gering. Das Ergebnis der neuropsychologischen Tests lässt im Vergleich zwischen präpsychotischen Prodromalstadien und Frühverlauf der Psychose ebenfalls deutliche, überwiegend quantitative Unterschiede bei kognitiven Leistungen erkennen, was das frühe Auftreten funktioneller Be einträchtigung aus den Ergebnissen der ABC Studie bestätigt. 18 Abb. 3 Abb. 4 figen Ergebnisse (Bechdolf et al. 2004) umfassen 123 Personen mit Beobachtungsperioden von 16,3 Monaten für CBT (SD 8,5 Monate), CM 9,2 Monate (SD 8,6 Monate). Damit sind nur vorläufige Schritte der Validierung der drei Instrumentarien dargelegt, aber sie lassen die Entwicklung eines praktikablen Früherkennungsinventars mit befriedigender Effektstärke diagnostisch diskriminierender und prädiktiver Erkennung als Voraussetzung von Intervention im Prodromalstadium der Krankheit vermuten. Die Abb. 5 zeigt den Anteil des Übergangs in die Psychose oder in das psychotische Frühstadium bei insgesamt noch geringen Werten aber deutlichen – wenn auch nicht signifikanten - Hinweisen auf ein geringeres Psychoserisiko der Experimentalgruppe. Vorläufige Ergebnisse der Intervention im Präpsychotischen Prodromalstadium Die psychoseferne Frühintervention wird in den Zentren Köln, Bonn, Düsseldorf und München mit einer geplanten Stichprobenzahl von 200 im randomisierten Kontrolldesign mit kognitiver Verhaltenstherapie - cognitive behavioural treatment (CBT) - im Vergleich zu clinical management (CM) als Kontrollbedingung über 12 Monate durchgeführt (30 individuelle Sitzungen, 15 Gruppensitzungen, kognitive Auffrischung:12 Sitzungen, Psychoedukation der Angehörigen: 3 Sitzungen) (Bechdolf et al. 2002). Die vorläu- Vorläufige Ergebnisse der Intervention im frühen psychotischen Prodromalstadium In dieser Therapievergleichsstudie sind 130 Fälle in einem kontrollierten randomisierten Design vorgesehen mit einer Behandlungsperiode von 2 Jahren. Die Experimentalbedingung sieht außer cognitive behavioural treatment (CBT), eine psychopharmakologische Behandlung mit Amisulpride bei Dosen zwischen 50800 mg täglich vor. Die Wahl dieser Substanz 19 ten mancher Kinder, geprägt von Überaktivität und Störung der Aufmerksamkeit. In Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter wurden 1845 kindliche Verhaltensweisen beschrieben, die den Begriff des Zappelphilipps schon damals prägten. Die Zusammenfassung der beschriebenen Symptome, welche die kognitive, motorische und emotionale Verhaltensebene betreffen, in ein einheitlich zu beschreibendes Krankheitsbild, geschah erst später und durchlief bis heute eine lange Entwicklung verschiedener Konzeptualisierungen und Begrifflichkeiten. war aufgrund ihrer längerfristigen Wirkung auf negative und depressive Symptome in Verbindung mit dem antipsychotischen Effekt erfolgt. Auch hier ist das Ziel, Übergänge in die Psychose zu reduzieren. Als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wird heute ein klinisches Syndrom bezeichnet, das durch erhebliche Beeinträchtigungen der Konzentrations- und Daueraufmerksamkeitsfähigkeit, Störungen der Impulskontrolle sowie fakultativ motorische Hyperaktivität bzw. Unruhe gekennzeichnet ist. Liegen diese Symptome mindestens seit sechs Monaten vor und sind sie erstmals vor dem siebten Lebensjahr aufgetreten, so sind die Voraussetzungen für die Diagnose ADHS erfüllt (DSM-IVKriterien). Hierbei sollten deutliche Beeinträchtigungen für das Leben der betroffenen Person erkennbar sein. Mögliche andere Störungen, welche die hyperkinetischen Symptome besser erklären würden, müssen ausgeschlossen werden können (z.B. Störungen des Sozialverhaltens, manische Episoden u.a.). Ältere Bezeichnungen für das gleiche Krankheitsbild sind u.a. die „Frühkindliche leichte Hirnschädigung“ oder MCD (Minimal Cerebral Dysfunction), welche ein Hinweis auf die ursprünglich angenommene hirnorganische Ursache der Erkrankung ist und dem aktuellen Forschungsstand nicht mehr entspricht oder das „Psychoorgane Syndrom (POS), das auch heute noch die in der Schweiz gebräuchliche Formulierung darstellt. Die Bezeichnung der Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) nach der DSMIV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) hat sich englischsprachigen Raum schon seit längerem durchgesetzt und wird mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum häufiger zur Bezeichnung des Syndroms benutzt, als der Begriff der hyperkinetischen Störung der ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems). Tab. 5 Die bei Gelegenheit einer Durchführbarkeitsanalyse vorgenommene vorläufige Auswertung geht von 15 Fällen aus. Sie lässt eine signifikante Reduzierung der positiven/negativen und der gesamten Symptomatik sowie eine Verbesserung der funktionellen Beeinträchtigung erkennen. Wiederum ist eine endgültige Aussage nicht möglich, aber ebenso wie bei der Intervention im präpsychotischen Prodromalstadium ist eine positive Tendenz der Ergebnisse erkennbar, was die Fortführung der Projekte unterstützt und die Hoffnung auf die Entwicklung eines ebenso praktikablen wie erfolgversprechenden Therapiemanuals in Ergänzung zu dem ebenso aussichtsreichen Früherkennungsinventar unterstützt. Die Projekte befinden sich derzeit in der zweiten Förderphase. Ein vorläufiger oder endgültiger Transfer in die Praxis auf der Grundlage der bis dahin erarbeiteten Ergebnisse ist vorgesehen. Heinz Häfner (mit Kurt Maurer, Frank Hörrmann, Günter Trendler, Martin Schmidt) Häufigkeit des Auftretens: Die ADHS ist eine der häufigsten Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters mit einer Prävalenzrate von durchschnittlich 3-5%. Bei 30 bis 50% der Betroffenen persistiert sie bis ins Erwachsenenalter und kann berufliche, soziale und gesundheitliche Konsequenzen haben, durch welche diese Personen im Vergleich zu Gesunden Einschränkungen in einer erfolgreichen Lebensgestaltung erfahren können. Es handelt sich bei dieser Erkrankung um eine biologische Störung, die einer umfassenden Behandlung in Form Wo schaut Zappelphilipp hin? Augenbewegungsstörungen bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung Was ist ADHS? Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschrieb George Still erstmalig die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Schon damals vermutete er eine hirnorganische Ursache für das beobachtbare auffällige Verhal- 20 tern ADHS haben, sind über die Hälfte (60%) ebenfalls krank. Soziodemographische Rahmenbedingungen und andere Umwelteinflüsse werden aktuell diskutiert. Jedoch können entsprechende Studien zu diesem Thema bislang keinen ätiologischen Zusammenhang zwischen ADHS und sozialen, familiären oder anderen Umweltfaktoren belegen. Solche Faktoren wirken modifizierend, können aber nicht als Ursache identifiziert werden. Als Risikofaktoren bleiben sie jedoch weiterhin Gegenstand aktueller Forschung. In den letzten fünfzehn Jahren erfuhren neben Studien zur genetischen Komponente der ADHS insbesondere bildgebende Verfahren eine erhöhte Bedeutung in der Erforschung der neurophysiologischen und morphologischen Hintergründe dieser Erkrankung. Ein multifaktorieller Erklärungsansatz für ADHS ist nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft am wahrscheinlichsten. Genetisch-biologische Merkmale bewirken eine Störung des Neurotransmitterstoffwechsels, vor allem der sogenannten Katecholamine Dopamin und Noradrenalin, und darüber hinaus andere anatomische und funktionelle zerebrale Störungen. Insbesondere das Aufmerksamkeitsnetzwerk und solche Hirnregionen, die die Selbstregulation von Verhalten bedingen, weisen nach Ergebnissen bildgebender Verfahren anatomische und funktionelle Veränderungen im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden auf. pharmakologischer und psychotherapeutischer Interventionen bedarf. Symptome: Unabhängig von Alter und Intelligenz treten bei der ADHS die Kernsymptome wie Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, Störungen der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung sowie der Impulskontrolle, vermehrt in Situationen auf, die sich durch hohe Komplexität und Strukturiertheit präsentieren. Gerade dann, wenn die situativen Anforderungen eine erhöhte Verhaltenskontrolle und gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit verlangen, sind diese Patienten nicht in der Lage, ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Tätigkeiten können nicht zielgerichtet geplant und durchgeführt werden, da die Betroffenen äußeren und inneren Stimuli gleichzeitig zu folgen versuchen, in hohem Maße ablenkbar sind und somit keine adäquate Handlungsplanung und durchführung stattfinden kann. Diese Primärsymptome der ADHS können auch unter dem Begriff der Beeinträchtigung von „exekutiven Funktionen“ zusammengefasst werden. Sie beziehen sich auf das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher kognitiver Funktionen, die zur Bewältigung von Aufgaben bzw. der Entwicklung von Problemlösestrategien und der Steuerung von Aufmerksamkeit unabdingbar sind. Aufmerksamkeit setzt sich hierbei zusammen aus verschiedenen exekutiven Funktionen wie Alertness (Wachheit bzw. Vigilanz), selektiver Aufmerksamkeit, Inhibition hinsichtlich innerer nicht zielorientierter Handlungsimpulse und Automatisierung im Sinne der Fähigkeit, Regeln für eine automatisierte Reaktion zu abstrahieren. Fakultativ können eine motorische Hyperaktivität, eine erhöhte Impulsivität und eine ungenügende emotionale Steuerung die eigene Verhaltenskontrolle noch zusätzlich erschweren. Diese Symptome der ADHS treten in unterschiedlicher Ausprägung auf und können von einer Vielzahl komorbider Erkrankungen wie Störungen des Sozialverhaltens, Suchterkrankungen, Teilleistungsstörungen, affektiven Erkrankungen und Ticstörungen begleitet sein. Des Weiteren wird bei Kindern mit ADHS im Vergleich zu gesunden Kontrollen oftmals eine mäßige Störung der Feinmotorik, der Fähigkeit zur Balance und Geschicklichkeit berichtet. Insbesondere beim Schreiben verhalten sich die Kinder verkrampft und können nur unter großer Anstrengung ihre Schreibmotorik steuern. Dysgraphie sowie Dysorthographie fallen ebenfalls in diesem Zusammenhang auf. Ursachen: Die Ursachen der ADHS gelten nach dem heutigen Forschungsstand noch nicht als ausreichend geklärt. Die Erkrankung tritt systematisch familiär gehäuft auf, wobei bis zu einem Fünftel der Eltern von Kindern mit ADHS selbst von der Störung betroffen sind. Geschwister von Erkrankten haben ein vierfach erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken und bei Kindern deren El- Was haben die Augen damit zu tun? Inwieweit eine unzureichende Kontrolle der Blickmotorik eine Rolle im pathophysiologischen Erklärungsmodell von ADHS eine Rolle spielt, ist bisher in der aktuellen Forschung nur marginal untersucht worden. Ausgehend von der Erkenntnis, dass ADHS sich durch die verminderte Fähigkeit, Reaktionen auf externe Stimuli willentlich zu unterdrücken auszeichnet, erstaunt es kaum, dass genau diejenigen frontoparietalen Hirnstrukturen, welche bei ADHS auffällig sind, auch die visuelle Aufmerksamkeit steuern. Anatomische und funktionelle bildgebende Untersuchungen weisen darauf hin, dass genau die Areale von einer Volumenminderung und funktionalen Auffälligkeiten betroffen sind, welche auch maßgeblich an der Blicksteuerung beteiligt sind. So vor allem Nucleus Caudatus, Putamen, Thalamus, Cingulum, Kleinhirn und verschiedene Bereiche des frontalen Kortex. Psychiatrische Erkrankungen, die mit einer Störung frontaler Hirnstrukturen einher gehen, weisen überzufällig häufig eine dysfunktionale Blickmotorik auf. So wird zum Beispiel eine gestörte Augenfolgebewegung bei schizophrenen Patienten oder auch ein dysfunktionales sakkadisches System bei Ticstörungen und Autismus berichtet. Auch bei ADHS-Erkrankten lassen die Ergebnisse einzelner Studien jüngster Zeit auf eine inadäquate Kontrolle der Blickmotorik schließen. 21 können. Offensichtlich werden die Sakkaden nicht ausreichend unterdrückt, wenn der situative Kontext es verlangt. Ihre Initiierung und das motorische Timing scheinen ebenfalls nicht adäquat moduliert zu sein. Inwieweit dies mit einer verminderten selektiven Aufmerksamkeit in Zusammenhang steht, ist derzeit noch nicht ausreichend untersucht. Es wäre denkbar, dass eine unzureichende Kontrolle über Blickbewegungen, insbesondere die willkürlich gesteuerte Unterdrückung von visuellen Reaktionen auf irrelevante Reize, eine schwache Leistung bei Aufgaben, die eine gerichtete Aufmerksamkeit (z. B. Lesen) voraussetzen, mitbedingt. Woraus bestehen Augenbewegungen? Augenbewegungen sind eine Grundvoraussetzung, die visuelle Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes zu richten und werden rückwirkend ebenfalls durch Aufmerksamkeitsprozesse ähnlich einer Rückkopplungsschleife gesteuert. Sie dienen der Orientierung im Raum und präsentieren sich in einem ständigen dynamischen Wechsel von Fixationen und Sakkaden. Betrachtet man ein Objekt ohne die Augen zu bewegen, so spricht man von einer Fixation. Als Sakkade oder auch Sakkadensprung bezeichnet man die schnelle und ruckhafte Bewegung, mit der ein Auge bewusst von einem Fixationspunkt zum nächsten bewegt wird. Zusätzlich macht das Auge innerhalb einer Sekunde drei bis fünfmal kleine Blicksprünge, sogenannte Microsakkaden, durch die ungefähr alle 200 ms ein neues Bild auf der Netzhaut abgebildet wird. Diese Bilder müssen vom Gehirn wie bei einem Film in einer sinnvollen chronologischen Reihenfolge verarbeitet werden, wobei man vom „Dynamischen Sehen“ spricht. Eine ganze Kette von Fixationen und Sakkaden bildet die als Augenfolgebewegung (Smooth Pursuit) bezeichnete Bewegung. Bei dieser folgt der Blick einem beweglichen Objekt, indem sich Fixationen und Sakkaden abwechseln und große Sprünge, durch die das Objekt aus dem Fokus verschwinden würde, unterdrückt werden müssen. Die Hemmung von Reaktionen auf äußere oder auch innere Reize zählt zu den exekutiven Funktionen, welche von frontalen Hirnstrukturen gesteuert werden. Sie können unter anderem auch mit visuell dargebotenen Aufgaben gemessen werden. Verschiedene Studien zu exekutiven Funktionen von ADHS-Erkrankten konnten zeigen, dass hier Defizite vorliegen. Die Gründe hierfür sind noch nicht ausreichend belegt, aber derzeit werden verschiedene mögliche Erklärungen diskutiert. Einige Forscher gehen davon aus, das ADHS-Betroffeene ihre Aufmerksamkeit nicht aufrecht erhalten können. Eine weitere Erklärung ist, dass sie gerichtete Aufmerksamkeit nicht schnell auf andere Hinweisreize wechseln und somit nicht adäquat auf einen neuen Reiz reagieren können. Des weiteren wird vermutet, dass sie eine verminderte Kontrolle über ihre Blickmotorik haben. Welche der drei Annahmen die Dysfunktionalität der exekutiven Funktionen bei ADHD am besten erklären kann, ist mit dem heutigen Kenntnisstand noch nicht zu entscheiden. Die Einbeziehung der Blickmotorik ist dabei ein noch recht neuer Ansatz, zu dem es nur einige wenige Studien gibt. Diese können die Annahme aber gut untermauern. Die genauen neurobiologischen Hintergründe dieses Phänomens sind derzeit jedoch noch ungeklärt und entsprechende Studien, die eine genaue Analyse der Okulomotorik mit einer funktionell bildgebenden Darstellung kortikaler Funktionen verbinden, stehen noch aus. Augenbewegungstörungen bei ADHS Insbesondere die Kontrolle von Sakkaden scheint bei ADHS ungenügend ausgeprägt. So wird in verschiedenen Studien, zur sogenannten „Antisakkaden-Aufgabe“, bei der die Patienten die visuelle Reaktion auf einen peripher neu auftretenden Reiz nach der Fixation eines foveal (im Zentrum der Sehschärfe) präsentierten Reizes unterdrücken sollen, von einer erhöhten Fehlerrate der ADHS-Erkrankten im Vergleich zu gesunden Kontrollen berichtet. Bei der Untersuchung sogenannter Prosakkaden (schnelle Wechsel der Blickrichtung auf einen neu auftretenden Reiz) konnte außerdem festgestellt werden, dass die Kinder mit ADHS gegenüber der Vergleichsgruppe durchschnittlich langsamere Reaktionszeiten zeigten. Bei Fixationen kennzeichnet sich die ADHS-Gruppe durch vermehrte intrusive Sakkaden, was bedeutet, dass die Stabilität von Fixationen auf einen visuellen Reiz durch einen unerwünschten Drift des Auges von dem Reiz weg gestört wird. Auch das dynamische Sehen scheint nach aktuellen Forschungsergebnissen bei diesen Patienten beeinträchtigt Funktionelle Kernspintomographie und die Aufzeichnung von Blickbewegungen Ausgehend von der Erkenntnis, dass frontale Hirnstrukturen und insbesondere die Basalganglien, nicht nur eine entscheidende Rolle im neurophysiologischen Erklärungsmodell der ADHS im Hinblick auf exekutive Kontrolle spielen, sondern auch in der Steuerung der Blickmotorik eine zentrale Rolle besitzen, wäre es wünschenswert, diesen Zusammenhang mit funktioneller Bildgebung zu untersuchen. Mit funktionell bildgebenden Verfahren können Hirnstrukturen während bestimmter Tätigkeiten in „Funktion“ dargestellt werden. Neuronale Diese Ergebnisse zum sakkadischen System stellen einen Hinweis auf Dysfunktionen im okulomotorischen System von ADHS-Patienten dar, die vor allem mit dem bekannten Inhibitionsdefizit in Zusammenhang gesehen werden 22 dysfunktionaler Blicksteuerung, wie es zur Zeit z. B. im Blicklabor Freiburg durchgeführt wird, ist noch nicht ausreichender Evaluation an einer größeren Probandengruppe unterzogen worden, stellt sich aber aufgrund der Ergebnisse bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche und Kindern mit ADHS als interessanter Untersuchungsansatz dar. Isabella Wolf in Kooperation mit der Arbeitsgruppe NMR-Forschung i.d. Psychiatrie Aktivität wird von metabolischen Veränderungen in spezifischen Hirnregionen begleitet und durch diese Methode indirekt sichtbar gemacht. Zunehmende Stoffwechselaktivitäten äußern sich in einem erhöhtem Verbrauch von Sauerstoff und Glukose und einer nachfolgenden vermehrten Durchblutung. Bei der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) werden die verschiedenen magnetischen Eigenschaften von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut genutzt, um eine Serie von Schnittbildern zu erzeugen, die einen Rückschluss auf den Aktivierungszustand der gemessenen Hirnareale während der Bearbeitung einer vorgegebenen Aufgabe zulassen. Hierdurch besteht nun die Möglichkeit, bei ADHS-Patienten zu Beispiel während der Durchführung einer visuellen Aufgabe die kortikale Aktivierung abzubilden. „Und dann kam die Welle …“ Posttraumatische Belastungsstörungen Deutlich in Erinnerung verblieben sind die Bilder der Tsunami-Katastrophe und ihrer Opfer vom 26.12.04. Die Überlebenden wurden durch diese verheerende Naturkatastrophe geprägt. Viele der Heimkehrenden haben noch heute mit den Erinnerungen zu kämpfen. Ähnlich ergeht es auch Überlebenden anderer Traumata. Hierzu gehören Opfer von Kriegen und Folter, von Vergewaltigungen und sexuellem oder physischem Missbrauch in der Kindheit oder von schweren Verkehrsunfällen. Erste Beschreibungen von Symptomen nach traumatischen Erlebnissen gibt es seit dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Beobachtet wurden diese Symptome bei Überlebenden schwerer Eisenbahnunglücke, Soldaten der beiden Weltkriege und Überlebenden des Holocausts. Verschiedene Bezeichnungen wie z.B. „Schreckneurose“, „Kampf- oder Kriegsneurose“, „Granatenschock“ oder „Überlebenden-Syndrom“ wurden vorgeschlagen. Nach den Erfahrungen des Vietnam-Krieges und der erstarkenden feministischen Bewegung, welche die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Folgen interpersoneller Gewalt lenkte, konnte eine Einigung auf den Begriff der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTB) geschehen. Die meisten Studien zu Blickbewegungen und ihren neurobiologischen Korrelaten beschränken sich derzeit auf die Aufzeichnung von Augendaten außerhalb des Magneten und korrelieren die Daten im nachhinein miteinander. Im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim sind die technischen Voraussetzungen zur simultanen Erfassung von Augenbewegungen bei funktioneller Kernspintomographie mittlerweile gegeben und schon an unterschiedlichen Patientengruppen erprobt worden. Hierbei werden die visuellen Reize direkt auf einen LCD-Bildschirm in einer MR-tauglichen Präsentationsbrille projiziert, welche zusätzlich mit einer Kamera zur Aufzeichnung der Position des Kornealreflexes ausgestattet ist. Die Augenbewegungen von ADHS-Patienten können somit während der Darbietung visueller Reize im Kernspintomographen simultan zur Erhebung der funktionellen Daten bei unterschiedlichsten Aufgaben zur Erfassung exekutiver Funktionen aufgezeichnet werden. Die Untersuchung von dysfunktionalen Augenbewegungen und ihren neurobiologischen Hintergründen stellt darüber hinaus eine gute Möglichkeit dar, kognitive und die Aufmerksamkeit betreffende Störungen bei Kindern zu dokumentieren. Mit funktioneller Bildgebung in Kombination mit der Aufzeichnung von Augenbewegungen kann auf invasive Untersuchungsmethoden verzichtet werden. Die Tatsache, dass das visuomotorische System im Vergleich zu anderen Körperfunktionen recht lange dem Entwicklungsprozess unterworfen ist, legt nahe, bei der Erforschung von sich entwickelnden Hirnstrukturen die Okulomotorik mit einzubeziehen. Inwieweit die Steuerung der Augenbewegungen im Erklärungsmodell von ADHS einen Beitrag leisten kann, ist aufgrund der momentanen Forschungslage noch ungeklärt. Auch über die Auswirkung medikamentöser Behandlung auf die Blickmotorik ist derzeit noch zuwenig bekannt. Das gezielte Training zur Verbesserung Symptomatik: Eine PTB kann durch Ereignisse ausgelöst werden, bei denen die Betroffenen mit großer Furcht und Entsetzen direkt oder indirekt eine Situation erleben, die eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit ihrer selbst oder eines anderen Menschen beinhaltet. Kennzeichnend und notwendig für die Diagnose der Störung sind neben dem Vorliegen eines traumatischen Erlebnisses als Auslöser der Symptome belastendes Wiedererleben der traumatischen Ereignisse im Wachen (Intrusionen, belastende Erinnerungen) oder im Schlaf (Albträume) und die aktive Vermeidung dieses Wiedererlebens. Zu den weiteren typischen Symptomen gehört das Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit, Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosig- 23 tion sein oder sogenannte „recovered memories“. Dies sind Ereignisse in der Kindheit (z.B. unangemessener sexueller Kontakt), für die es eine teilweise bis vollständige Amnesie gab und die erst nach Jahren zum ersten Mal erinnert werden. Da diese Erinnerungen jedoch sehr anfällig für Verzerrungen, Fehlinterpretationen oder Suggestion sein können, sollte besondere diagnostische Vorsicht geboten sein. keit gegenüber der Umgebung, Anhedonie und Dissoziationen. Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten, werden vermieden. Patienten sind teilweise oder vollständig unfähig, sich an wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern. Es zeigen sich Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung wie z.B. Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit und erhöhte Schreckhaftigkeit. Eine PTB führt zu erheblicher Beeinträchtigung in Sozialkontakten, Familie oder Beruf. In der Folge einer PTB kommt es häufig zur Entwicklung sekundärer psychischer Störungen wie Depression oder Substanzabhängigkeit. Typische Symptome einer PTB können schon in den ersten Stunden und Tagen nach einem Trauma auftreten. Eine deutliche Besserung der Symptomatik kann spontan eintreten. In den ersten Tagen nach einer Belastungssituation kann daher die Diagnose einer akuten Belastungsstörung vergeben werden. Bei schweren Persönlichkeitsund Verhaltensstörungen bei prätraumatisch in ihrer Persönlichkeit unauffälligen Personen kann die Diagnose einer Andauernden Persönlichkeitsveränderung (nach ICD-10) vergeben werden. Neu eingeführt wurde die Diagnose einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Diese ist die Folge von wiederholten und sehr gravierenden Formen von Traumatisierung, meist durch interpersonelle/sexuelle Gewalt, und ist gekennzeichnet durch das Vorliegen von selbstschädigendem Verhalten, schwerer Dissoziation und einer Reihe weiterer Symptome. Erklärungsmodelle: Vorgestellt wird ein synthetisches Modell nach Ehlers und Clark, welches besonders relevant für die kognitivbehaviorale Behandlung der PTB ist. Laut der zentralen Hypothese verarbeiten die Betroffenen das traumatische Ereignis und/oder dessen Konsequenzen so, dass sie eine schwere gegenwärtige Bedrohung wahrnehmen. Nach diesem Modell interpretieren Menschen Erlebnisse individuell sehr unterschiedlich. Menschen, die an einer PTB erkranken, neigen zu negativen Interpretationen eines Traumas. Diese negativen Interpretationen resultieren in einer schweren gegenwärtigen Bedrohung (z.B. „Die Welt ist nicht sicher.“, „Ich bin nicht fähig, mich zu wehren.“) Negativ bewertet werden außerdem die Folgen, die ersten Symptome, die Reaktionen anderer Menschen und die körperlichen, beruflichen oder finanziellen Konsequenzen des Traumas. Auch das TraumaGedächtnis von Patienten mit einer PTB weist Besonderheiten auf. So werden die Informationen über das Traumata nur ungenügend elaboriert und nicht in einem Kontext von Raum, Zeit und weiteren autobiografischen Informationen verarbeitet. Des Weiteren sind die Assoziationen zwischen einzelnen Reizen (Auslösern) und den Traumainhalten sehr stark. Reize wie z.B. bestimmte Geräusche, Bewegungen und optische Reize, lösen schnell ein Wiedererleben aus. Die Strategien, mit denen die Patienten versuchen, ihre Symptome zu reduzieren, schaffen zwar kurzfristig Erleichterung, führen jedoch langfristig zu einer Verschlechterung ihrer Symptomatik. Beispielsweise versuchen Patienten, Erinnerungen an das Trauma zu unterdrücken oder sich abzulenken. Diese Strategien helfen kurzfristig, langfristig ist der Effekt jedoch paradox. Versuche, Albträume zu verhindern, indem der Patient nur sehr spät oder gar nicht ins Bett geht, führen zu erhöhten Konzentrationsschwierigkeiten, Interesselosigkeit oder Reizbarkeit. Auch das Grübeln über das Ereignis ist eine Strategie, nicht über den bedrohlichen Kern des Erlebten nachzudenken, indem sich der Betroffene mit übergeordneten Fragen beschäftigt. Langfristig führt dies jedoch zu weiteren negativen Gefühlen wie Hoffnungslosigkeit, Ärger und zu dem schon erwähnten Häufigkeit: Die PTB gehört mit einer Lebenszeitprävalenz von ca. 8% zu den häufigeren psychischen Störungen. Bei Frauen ist die Prävalenz deutlich erhöht (10% im Vergleich zu 5% bei Männern). Die höhere Prävalenz bei Frauen kann durch zwei mögliche Ursachen erklärt werden: Zum einen hatten die Frauen mehr schwerwiegende traumatische Ereignisse (wie Vergewaltigung oder Kindesmisshandlung) erlebt, zum anderen entwickelten sie mit höherer Wahrscheinlichkeit eine PTB nach einem traumatischen Erlebnis. Das Risiko, an einer PTB zu erkranken, sinkt mit steigendem Lebensalter. Besonders vulnerabel sind demnach Kinder und Jugendliche. Verlauf: Der Verlauf ist in ca. 40-50% der Fälle chronisch. Ohne Behandlung kann die Symptomatik über Jahrzehnte hinweg andauern. Der Beginn der Symptomatik kann auch verzögert, erst Jahre nach dem Ereignis erfolgen. Gründe dafür können z.B. neue Informationen über die Gefährlichkeit der traumatischen Situa- 24 umfasst folgende Behandlungmodule: Einzeltherapie (2 Sitzungen pro Woche), Bezugspflegegespräche (2 x 30 min pro Woche), Basisgruppe (1 x 60 min pro Woche), Bezugsgruppe (1 x 60 min pro Woche), Gestaltungstherapie (2 x 90 min pro Woche), Musiktherapie (2 x 60 min pro Woche), Bewegungstherapie (1 x 60 min pro Woche), Körpertherapie im Einzelsetting (1 x 60 min pro Woche, für einzelne Patienten), Flamenco (1 x 30 min pro Woche), Angebot der Sozialarbeit, Skillstraining (2 x 60 min pro Woche, Training sozialer Kompetenzen (1 x 90 min pro Woche), Achtsamkeit (3 x 30 min pro Woche). Termine für ambulante Vorgespräche können unter Telefon 0621/1703-4303) vereinbart werden. paradoxen Effekt der Vermeidung. Auch können frühere Erfahrungen, Überzeugungen und Persönlichkeitsfaktoren die spätere Entwicklung einer PTB beeinflussen. Therapieangebote am ZI: Das Behandlungskonzept der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin basiert auf einem kognitiv-behavioralen Ansatz. Außerdem orientiert es sich konzeptuell an den Behandlungsprinzipien der dialektisch-behavio-ralen Therapie nach Linehan, da zumeist Patienten mit einer komplexen PTB behandelt werden. Im Rahmen unserer Spezialambulanz werden Patienten auf Überweisung niedergelassener Kollegen diagnostiziert und die Indikation für ein entsprechendes Therapieangebot, wie z.B. einem stationären Aufenthalt, gestellt. Die stationäre Behandlung gliedert sich im idealen Behandlungsfall in insgesamt vier Phasen. Anne Hinckers, Regina Steil Nach einer Überprüfung der ambulant gestellten Diagnosen und Differentialdiagnosen, der Motivationssicherung und der Erarbeitung eines umfassenden Therapievertrages wird in der ersten Phase der Therapie eine ausführliche Psychoedukation zum Störungsbild und Behandlungskonzept durchgeführt. Gemeinsam mit dem Patienten werden die Therapieziele festgelegt und hierarchisiert. Neue Entwicklungen in der Verhaltenstherapie bei chronischen Schmerzen Verhaltenstherapeutische Ansätze beim chronischen Schmerzen basieren auf der Annahme, dass im Verlauf der Chronifizierung eines Schmerzproblems Lernprozesse immer wichtiger werden und die ursprünglich den Schmerz bedingenden somatischen Faktoren in den Hintergrund treten. Ein Beispiel: Ein Patient, der aufgrund eines Unfalls am Arbeitsplatz eine Kopfverletzung erlitt, hatte Jahre danach trotz kompletter Abheilung der Wunde noch immer massive Kopfschmerzen, die jedoch jetzt durch Verspannungen der Muskulatur im Kopfbereich aufrechterhalten wurden, die mit der ursprünglichen Verletzung nichts mehr zu tun hatten. Chronische Schmerzen müssen sich als therapieresistent erweisen, wenn sie wie eine akute Erkrankung therapiert werden, diese aber längst nicht mehr die Ursache der Beschwerden ist. Für den Patienten liegt es natürlich nahe, diese erste Ursache als Erklärung heranzuziehen, der Schmerztherapeut sollte jedoch zusätzliche Faktoren in Erwägung ziehen. Dies gilt natürlich weniger für chronische Schmerzen, bei denen eine eindeutige medizinisch-organische Pathologie vorhanden ist, wie z. B. den Krebsschmerz, jedoch können auch hier psychologische Faktoren den Schmerz unnötig verstärken. Zu den effektiven verhaltenstherapeutischen Verfahren bei chronischen Schmerzen gehören das Schmerzbewältigungstraining auf kognitivverhaltenstherapeutischer Basis, Biofeedback und Entspannungsverfahren und die operante Schmerztherapie. Da die operante Schmerzthe- Die zweite Phase der Therapie dient schwerpunktmäßig dem Erlernen von Techniken zur Emotionsregulation. Bearbeitet werden Verhaltensweisen und Kognitionen, die die Symptomatik aufrechterhalten, den Patienten schädigen oder der Behandlung der PTB entgegenstehen. Mit Hilfe verschiedenen Techniken lernen die Patienten, mit ihren belastenden Erfahrungen umzugehen. Eine Technik ist das Diskriminationstraining, mit dessen Hilfe Auslösereize für Intrusionen identifiziert und differenziert werden können. Besonders wichtig ist in dieser Phase das Skills-Training im Sinne der Dialektisch-Behavioralen Therapie, in dem die Patienten u.a. lernen, mit hohen Belastungen umzugehen. Gelingt dies den Patienten und haben sich keine Kontraindikationen zum konfrontativen Vorgehen ergeben (wie z.B. psychotische Symptomatik in der Vorgeschichte), werden die Patienten im Sinne des behavioralen Therapiekonzeptes mit ihren Erinnerungen an die traumatische Situationen konfrontiert. Parallel werden dysfunktionale Interpretationen des Traumas bearbeitet. Im letzten Schritt werden die Patienten erneut stabilisiert und eine Implementierung des in der Klinik erlernten im häuslichen Umfeld angestrebt. Die stationäre Therapie dauert im Regelfall acht bis zwölf Wochen. Sie 25 Arealen, die mit der affektiven Schmerzreaktion assoziiert sind. Aus diesen Befunden hat sich als eine Behandlungsstrategie die sogenannte „operante Schmerztherapie“ ergeben, die Schmerzverhalten durch systematische Verhaltensübungen sowie Übungen mit Bezugspersonen, die häufig den Schmerz verstärkendes Verhalten beim Patienten fördern (ihm z.B. Arbeit abnehmen), ab- und gesundes Verhalten aufbaut. Innerhalb des operanten Gruppentrainings wird versucht, die Schmerzerfahrung und körperliche Aktivität voneinander abzukoppeln. Patienten sollen nicht bis an die Schmerzgrenze gehen, sondern früh Pausen einlegen, um dann die Aktivität langsam Tag für Tag zu steigern. Dadurch wird nicht mehr Ruhe durch Schmerzfreiheit belohnt, sondern körperliche Aktivität. Diese Aktivität wird dann von Tag zu Tag erhöht. Außerdem versucht man, mit den Patienten angenehme Aktivitäten zu finden und diese in den Tagesablauf gut einzupassen. Eine Analyse der Tätigkeiten am Arbeitsplatz und ein Aufbau von arbeitsrelevanten Fertigkeiten erleichtert die Reintegration des Patienten in das Arbeitsleben. Schmerzstillende Medikamente werden nur noch zu festen Tageszeiten eingenommen und auf das absolut notwendige Maß reduziert. rapie in Deutschland kaum verwendet wird und diese zentraler Bestandteil der multizentrischen Therapiestudie die von der DFG geförderten Klinischen Forschergruppe 107 zum Thema Lernen, Plastizität und Schmerz ist, soll diese ausführlicher dargestellt werden. Operante Schmerztherapie Der Schmerzforscher Bill Fordyce an der Schmerzklinik der University of Washington in Seattle war der erste, der zeigte, dass der Schmerzausdruck ebenso wie anderes Verhalten den Gesetzen des operanten oder instrumentellen Lernens unterliegt. Wird der beobachtbare Schmerzausdruck - das sog. Schmerzverhalten, z. B. Stöhnen, Humpeln, Ausruhen - durch Aufmerksamkeit, Zuwendung oder Schmerzfreiheit bei Schonung belohnt, dann wird Schmerzverhalten häufiger gezeigt. Die Patienten erleben dadurch aber unnötige Einschränkungen im Alltag. Man kann dies anhand der körperlichen Aktivität verdeutlichen: Schmerzpatienten arbeiten oft bis an die Schmerzgrenze, um sich dann auszuruhen, z. B. sich hinzulegen. Das Ausruhen wird sofort durch eine Schmerzverminderung belohnt, d. h. durch die Inaktivität wird ein unangenehmer Zustand - starker Schmerz - beendet. Dadurch wird die Ruhe und das Sich-nicht-Bewegen als angenehm erlebt, und das Sich-Bewegen wird zunehmend gefürchtet, da man sich an den zuvor aufgetretenen Schmerz erinnert. Patienten vermeiden durch diesen Lernprozess zunehmend Bewegung, nehmen eine Schonhaltung ein und verstärken dadurch den Schmerz noch, weil nicht bewegte und trainierte Muskeln schmerzen. Ähnliche Lernprozesse können zum Medikamentenmissbrauch führen: Wird das Analgetikum regelmäßig nach Bedarf eingenommen, so wird durch die Medikamenteneinnahme ein unangenehmer Zustand – starke Schmerzen – beendet und die Einnahme des Medikaments quasi durch die Schmerzlinderung „belohnt“. Als Konsequenz nimmt der Patient immer häufiger und immer früher Schmerzmittel ein und kommt so leicht zum Missbrauch bzw. Abusus. Ein weiterer, wichtiger Verstärkungsfaktor sind Bezugspersonen wie der Partner oder Kinder, aber auch Angehörige der Gesundheitsversorgung. Wird auf den Ausdruck von Schmerz in der Umgebung des Patienten mit Aufmerksamkeit und Zuwendung reagiert, findet aber keine Zuwendung auf gesundes Verhalten statt, dann kommt es zu einem verstärkten Schmerzausdruck und als Folge auch zu einer verstärkten Schmerzempfindung. Dies geht so weit, dass nicht nur der Schmerzausdruck, sondern auch die physiologische Verarbeitung von Schmerzreizen verstärkt wird. So kommt es bei akuter Schmerzreizung in Anwesenheit eines schmerzverstärkenden Partners zu einer erhöhten Hirnantwort auf den Schmerzreiz in Die Partner der Patienten werden in die Behandlung miteinbezogen und lernen, den Patienten nicht mehr übermäßig zu schonen, sondern ihn zu aktivieren und mit ihm gemeinsam neue gemeinsame Ziele zu finden und zu verwirklichen. Zum operanten Training gehören auch Übungen in der Gruppe, in der gesundes Verhalten systematisch verstärkt und Schmerzverhalten systematisch bestraft wird (z.B. durch das Ausgeben von roten und grünen Karten, die später gegen ein gemeinsames Essen etc. eingetauscht werden können). Essentieller Bestandteil des Trainings sind Übungen zuhause, die aus körperlicher Aktivierung wie auch Aufgaben im Bereich sozialer Interaktion bestehen. Tabelle 1 zeigt eine Kurzübersicht über ein operantes Therapieprogramm, wie es in unserer Einrichtung ambulant (über 12 Wochen) durchgeführt wird. In einer von uns durchgeführten Meta-Analyse, in der die Effekte vieler Schmerzbehandlungen statistisch dargestellt wurden, erwiesen sich die operanten Ansätze mit 53% zusätzlicher Effektivität zur medizinischem Behandlung als am erfolgreichsten nicht nur in der Verminderung von Schmerz und Beeinträchtigung durch Schmerz, sondern auch hinsichtlich der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung und der Arbeitsfähigkeit. Auch in der Studie von 26 Tabelle 1: Ablauf der 12 Sitzungen der operanten Gruppentherapie 1. Sitzung: Einführung: Grundlagen der Behandlung Diskussion vorhergehender Schmerzerfahrungen Einführung in die operante Schmerztheorie: Schmerzverhalten, gesundes Verhalten, Verstärkung, Auszeit, Rolle anderer Diskussion der Medikation Diskussion der krankengymnastischen und arbeitsbezogenen Diagnostik Hausaufgaben: Erstellen einer Liste von Schmerzverhalten mit der Bezugsperson, Aktivitätenliste 3. Sitzung: Diskussion der Sitzung mit den Bezugspersonen Wiederholung der Prinzipien des operanten Modells Besprechung der Liste des Schmerzverhaltens und gesunden Verhaltens Gruppenbeobachtung des eigenen Schmerzverhaltens sowie des Schmerzverhaltens der Gruppenmitglieder (Video) Diskussion der Verstärkung gesunden Verhaltens und der Auszeit bei Schmerzverhalten in der Gruppe Weitere Diskussion des Fortschritts bezüglich der Therapieziele Übersicht über Fortschritte in der Krankengymnastik, Evaluation der Arbeitsfähigkeit Hausaufgaben: Aktivitätstagebuch, Medikamententagebuch, Liste mit gesundem Verhalten 5. Sitzung: Hausaufgabenbesprechung Gruppenverstärkung für Fortschritte Diskussion von alternativem Verhalten Individuelle Ziele, Verträge mit Gruppenmitgliedern und Therapeuten Rollenspiele zum gesunden Verhalten Hausaufgaben: Tagebuch mit Betonung der gesetzten Ziele 7. Sitzung: Hausaufgabenbesprechung Diskussion der Wochenziele, Betonung der Gruppenverstärkung, Auszeit bei Nichterfüllung Diskussion weiteren gesunden Verhaltens Verwendung einer Liste gesunder/spaßmachender Aktivitäten Auswahl und Übung schmerzinkompatibler Verhaltensweisen Ziele der kommenden Woche Problembesprechung Hausaufgaben: Selbstbeobachtung mit Betonung der Zielerreichung 9. Sitzung (mit Bezugsperson): Diskussion der Hausaufgaben Diskussion der Möglichkeiten, gesundes Verhalten zu verstärken Diskussion verbleibender Schmerzverhaltensweisen und der Möglichkeiten sie weniger zu beachten, Übungen dazu Diskussion spezifischer Probleme Hausaufgaben. Training in gesundem Verhalten 11. Sitzung: Hausaufgabenbesprechung Diskussion der Übungen mit der Bezugsperson Diskussion spezifischer Problembereiche Übersicht über Fortschritte in der KG und bezüglich der Arbeitsfähigkeit Vorbereitung des letzten Treffens; Pläne für die Zukunft und Probleme ansprechen Setzen spezifischer Verhaltensziele für die nächste Woche Hausaufgaben: weitere Selbstbeobachtung und Übungen 2. Sitzung (mit Bezugsperson): Diskussion erster Fortschritte Diskussion der Liste des Schmerzverhaltens Training in gesundem Verhalten, Möglichkeiten Schmerzverhalten zu reduzieren Hausaufgaben: Training in gesundem Verhalten 4. Sitzung: Wiederholung des operanten Modells Diskussion der Liste zu gesundem Verhalten Diskussion der Selbstbeobachtung jedes Patienten Verstärkung für Aktivität, auch in Krankengymnastik Zieldiskussion, Aufbau gesunden Verhaltens Hausaufgaben: Tagebuch der Aktivität, Krankengymnastikübungen, Medikamentenreduktion 6. Sitzung (mit Bezugsperson): Wiederholung des operanten Modells Diskussion des Verhaltens des Patienten zuhause: spezifische Beispiele, Probleme Diskussion der Selbstbeobachtung Verstärkung der Mitarbeit der Bezugsperson Hausaufgaben: gemeinsames Training in gesundem Verhalten 8. Sitzung: Hausaufgabenbesprechung Diskussion der Ziele der Woche Weitere Übung gesunden Verhaltens (auch z.B. Selbstsicherheit, Umgang mit Kollegen, Gesundheitsversorgung) Möglichkeiten der Selbstverstärkung Neue Ziele Allgemeine Diskussion Hausaufgaben: Selbstbeobachtung mit Betonung der Zielerreichung 10. Sitzung: Diskussion der Hausaufgaben Diskussion der Sitzung mit der Bezugsperson Diskussion spezifischer Problembereiche: -Haushalt, Familie, Verwandte Diskussion der Medikamentenreduktion Ziele für die folgende Woche Hausaufgaben: Tagebuch mit Zielerreichung, Übungen zu gesundem Verhalten mit der Bezugsperson 12. Sitzung: Besprechung der Hausaufgaben Besprechung des Fortschritts im Therapieprogramm Wiederholung des operanten Modells Diskussion von Möglichkeiten, Verbesserungen aufrechtzuerhalten Diskussion von Problembereichen Weitere Pläne und Ziele Übersicht über Abschlussuntersuchung und Katamnesen Abschluss des Programms Thieme et al. zur Effektivität operanter Therapie bei Fibromyalgie zeigten sich besonders deutliche Effekte bei der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung (Anzahl der Arztbesuche), die nach einer somatisch orientierten Therapie (Antidepressiva + passive Physiotherapie) in einem Zeitraum von 15 Monaten um mehr als 38% zunahm, während sie in der operanten Therapie um 54% abnahm. Neuere Entwicklungen Eine besondere Rolle bei der Chronifizierung spielt das Schmerzgedächtnis, das erst in den letzten Jahren verstärkt untersucht wurde. Das 27 Ähnlich könnte auch ein Schmerzextinktionstraining wirken, bei dem man gezielt den Schmerzausdruck verlernt und schmerzinkompatibles Verhalten aufbaut. Medikamente, die die Extinktion fördern (wie Cannabis) oder solche, die den Aufbau schmerzassoziierter plastischer Veränderungen hemmen (wie NMDA Rezeptor Antagonisten) könnten hier unterstützend eingesetzt werden. In der Klinischen Forschergruppe 107 wird die Kombination von Verhaltenstherapie und Cannabis überprüft. Vlaeyen hat ein Expositionstraining beschrieben, das schmerzassoziierte Angst löschen soll und mit graduierten Übungen arbeitet. Generell versucht man heute anhängig von der ausführlichen multiaxialen Schmerzdiagnostik eine differenzielle Indikation der verschiedenen schmerztherapeutischen Verfahren zu erreichen. Der frühe Einsatz einfacher verhaltenstherapeutischer Interventionen kann die Chronifizierung und damit den Aufbau eines somatosensorischen Schmerzgedächtnisses verhindern. sogenannte somatosensorische Schmerzgedächtnis zeigt sich in Veränderungen in der Repräsentation der Köperperipherie im primären somatosensorischen Kortex und anderen mit der Schmerzverarbeitung assoziierten Hirnarealen. So ließ sich zeigen, dass mit zunehmender Chronifizierung das kortikale Repräsentationsareal größer wird und das Gehirn eine erhöhte Reagibilität auf schmerzhafte, aber auch nicht-schmerzhafte taktile Reize zeigt, die die Grundlage der bei chronischen Schmerzpatienten oft beobachteten erhöhten Schmerzempfindlichkeit bilden könnten. Auch beim Phantomschmerz ließen sich Veränderungen der kortikalen Repräsentation des Amputationsareals und benachbarter Areale in enge Verbindung mit dem Phantomschmerz bringen. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die Löschung von Schmerzgedächtnisspuren und der Ausbau von schmerzinkompatiblen Gedächtnisinhalten besonders effektiv sein könnte. In vielen tier- und humanexperimentellen neurowissenschaftlichen Untersuchungen ließ sich die Plastizität des Gehirns durch massiertes Training, das den neuronalen Einstrom in das Gehirn verändert, beeinflussen. So kann man z.B. den Phantomschmerz, der eng mit Veränderungen der Repräsentation von dem Amputationsareal benachbarten kortikalen Repräsentationsareal zusammenhängt, durch Veränderung des neuronalen Einstroms in das Gehirn positiv beeinflussen. Appliziert man elektrische Reize auf dem Amputationsstumpf und lässt die Patienten die Reize nach Ort und Frequenz unterscheiden und gibt ihnen Rückmeldung, so lässt sich sowohl die kortikale Veränderung wie auch der Phantomschmerz zurückbilden (siehe Abbildung 1). Schlussfolgerungen Es herrscht immer noch das Missverständnis vor, dass psychische Probleme vor allem mit psychologischen Maßnahmen, körperliche Probleme vor allem mit medizinischen Maßnahmen behoben werden sollten. Psychologische Behandlung kann jedoch auch effektiv sein, wenn eindeutig somatische Probleme vorliegen, so wie umgekehrt medizinische Behandlung bei psychischen Problemen effektiv sein kann. Die von uns vertretene Auffassung, dass Verhaltenstherapie unabhängig vom körperlich messbaren Anteil einer Erkrankung wirksam sein kann und auf einen positiven psychologischen Befund anstatt auf die Abwesenheit eines organischen Befundes gestützt werden sollte, scheint sich auch bei der Behandlung des chronischen Schmerzes zu bewahrheiten. Generell empfiehlt sich somit bei Vorliegen der oben genannten Auffälligkeiten eine frühzeitige Zuziehung eines schmerztherapeutisch ausgebildeten Verhaltenstherapeuten. Darüber hinaus wäre eine verhaltenstherapeutisch orientierte Schulung des erstbehandelnden Arztes sinnvoll, um lernpsychologische Regeln der Prävention der Chronifizierung zu vermitteln. Abb. 1: Links die Anordnung der Elektroden für das Diskriminationstraining, rechts die Rückkehr der Repräsentation des Mundes im primären somatosensorischen Kortex in die korrekte Position nach erfolgreicher Verminderung der Phantomschmerzen Herta Flor 28