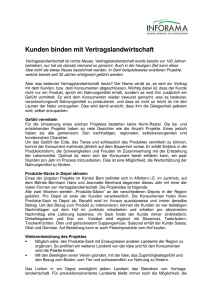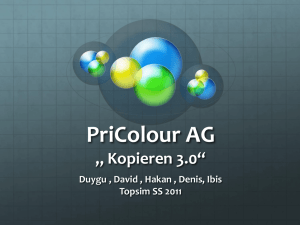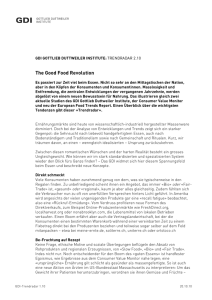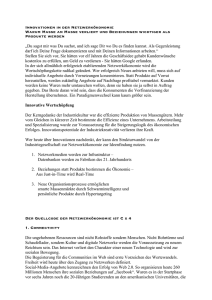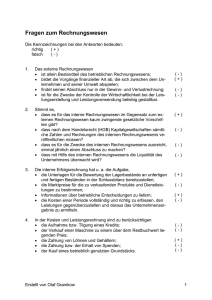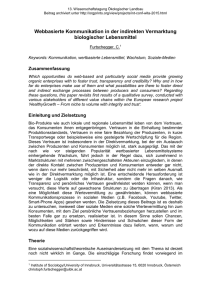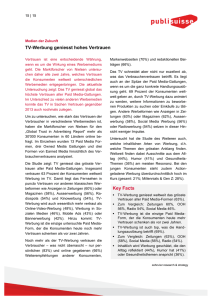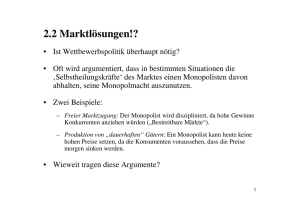Vorlesung Industrieökonomik I
Werbung
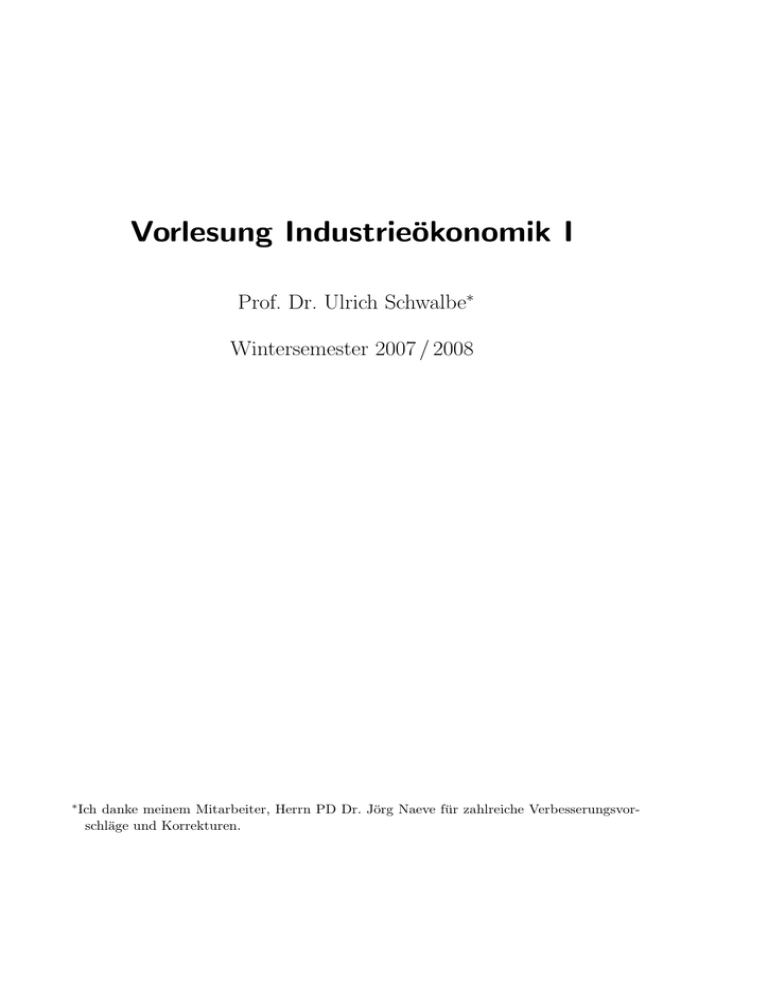
Vorlesung Industrieökonomik I
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe∗
Wintersemester 2007 / 2008
∗ Ich
danke meinem Mitarbeiter, Herrn PD Dr. Jörg Naeve für zahlreiche Verbesserungsvorschläge und Korrekturen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Gegenstand und Methoden der Industrieökonomik . . . . . . . . . . . . .
1.2 Die verschiedenen Ansätze der Industrieökonomik . . . . . . . . . . . . .
2 Grundlagen
2.1 Die Theorie der Firma . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Kosten und Nachfrage . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Märkte, Marktabgrenzung und Konzentrationsmaße
2.4 Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik
.
.
.
.
.
.
.
.
3 Theorie des Monopols
3.1 Vollständiger Wettbewerb als Referenzpunkt . . . . . .
3.2 Das Einprodukt–Monopol . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise . . . . . .
3.4 Dauerhafte Güter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Vermietendes versus verkaufendes Monopol . . .
3.5 Werbung und Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Das Mehrprodukt–Monopol . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Tie–ins und Bundling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 Differenzierte Güter und monopolistischer Wettbewerb
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4 Oligopole und strategisches Verhalten
4.1 Mengenwettbewerb bei homogenen Gütern . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Cournot und von Stackelberg–Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Mengenwettbewerb bei differenzierten Produkten . . . . . . . . . . . .
4.4 Preiswettbewerb — Das Modell von Bertrand . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Cournot vs. Bertrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Preiswettbewerb bei differenzierten Gütern . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Vergleich zwischen Cournot und Bertrand bei differenzierten Produkten
4.8 Sequentielle Preissetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Differenzierte Produkte als verschiedene ‘Standorte’ von Unternehmen .
1
1
1
.
.
.
.
5
5
8
16
20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
23
28
31
42
49
55
66
67
68
.
.
.
.
.
.
.
.
.
75
77
82
86
89
98
100
102
103
105
iii
Inhaltsverzeichnis
iv
Abbildungsverzeichnis
1.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
abnehmende, konstante und zunehmende Skalenerträge .
Durchschnitts– und Grenzkosten . . . . . . . . . . . . . .
Produktionsfunktion für γ = 12 , γ = 1, γ = 2 . . . . . . .
konvexe, lineare und konkave Kostenfunktionen . . . . .
zunehmende, konstante und fallende Durchschnittskosten
Preis-Absatz-Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elastizitätsbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
10
12
12
13
14
15
1.1
1.2
1.3
1.4
2.5
2.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
5.22
5.23
8.24
8.25
8.26
Nachfragefunktion und Stückkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grenz– und Durchschnittskosten: zunehmende Skalenerträge . . . . . .
Konsumentenrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximale Konsumentenrente bei p = c. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monopolgleichgewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wohlfahrt im Monopol– und im Wettbewerbsgleichgewicht . . . . . . .
Nachfrage auf zwei getrennten Märkten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preisdiskriminierung 3. Grades (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preisdiskriminierung 3. Grades (2) — grafisch . . . . . . . . . . . . . .
Preisdiskriminierung 3. Grades (3) — Gewinnvergleich . . . . . . . . .
Vollkommene Preisdiskriminierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurodisney ohne Preisdiskriminierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eurodisney ohne Preisdiskriminierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optimaler Two–part tariff für Eurodisney . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsumentenrente der verschiedenen Nachfragergruppen . . . . . . . .
Inverse Nachfrage nach einperiodiger Nutzung eines dauerhaften Gutes
Inverse Nachfrage bei Verkauf ausschließlich in Periode 1 . . . . . . . .
Vermietung eines dauerhaften Gutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nachfrage in Periode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkauf eines dauerhaften Gutes: Gewinnoptimum . . . . . . . . . . . .
Verkauf eines dauerhaften Gutes: myopisches Verhalten . . . . . . . . .
Konsumentenrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verschiedene Produktqualitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indifferenzkurve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durchschnitts- und Grenzkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
26
27
28
29
30
32
32
33
33
35
36
37
38
39
50
51
51
52
54
54
59
60
69
70
71
v
Abbildungsverzeichnis
vi
1 Einleitung
1.1 Gegenstand und Methoden der Industrieökonomik
Gegenstand der Vorlesung Industrieökonomik I ist die Untersuchung der Struktur von
Firmen und Märkten und ihrer Interaktion. Dabei ist ein Markt beschrieben durch die
Konsumenten und ihr Nachfrageverhalten sowie durch die Unternehmen und ihre Kostenstruktur. Das Schwergewicht der Analyse wird dabei auf Fragen gelegt, die in der
herkömmlichen mikroökonomischen Theorie nur am Rande behandelt werden. Hierzu
gehören insbesondere die Probleme aufgrund unvollständigen Wettbewerbs, wie sie
auf monopolistischen bzw. oligopolistischen Märkten, d. h. Märkten mit nur einem oder
wenigen Unternehmen auftreten. Andere Themen aus dem Bereich der Industrieökonomik sind z. B. Unternehmenszusammenschlüsse, die Produktwahl eines Unternehmens,
Forschungs– und Entwicklungsinvestitionen, Martkeintritts– und Marktaustrittsentscheidungen.
Es handelt sich bei der überwiegenden Mehrzahl der Modelle um sogenannte partialanalytische Ansätze, d. h. man betrachtet nur einen oder wenige Märkte und lässt die
Interdependenzen zwischen verschiedenen Märkten außer Betracht. Darin unterscheiden
sich die industrieökonomischen Modelle von denen der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts, in der sämtliche Interdependenzen zwischen allen Märkten in einer Volkswirtschaft betrachtet werden.
Was die Methoden der Industrieökonomik betrifft, so haben diese sich im Zeitablauf
erweitert und wurden durch neuere analytische Ansätze ergänzt. Während die traditionelle Industrieökonomik (vgl. Abschnitt 1.2) überwiegend empirisch ausgerichtet war
und die Untersuchungen sich auf Fallstudien stützten, hat sich in den letzten 25 Jahren
der Schwerpunkt auf Fragen des strategischen Verhaltens der Marktteilnehmer verlagert. Daher werden in vielen neueren industrieökonomischen Modellen Methoden aus der
Spieltheorie verwendet. Diese Methoden werden im Detail in der Vorlesung Spieltheo”
rie“ diskutiert, die grundlegenden Konzepte werden jedoch auch in dieser Veranstaltung
eingeführt.
1.2 Die verschiedenen Ansätze der Industrieökonomik
Die Industrieökonomik hat sich als überwiegend empirisch ausgerichtete Disziplin der
Mikroökonomik in den 50er Jahren entwickelt. Die Analysen basierten zumeist auf Fallstudien und man ging davon aus, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Marktstruktur (structure), d. h. der Anzahl und der Größe der in einem Markt befindlichen
1
1 Einleitung
Unternehmen, ihrer Technologien und auch der Elastizität der Nachfrage, dem Marktverhalten (conduct), d. h. den Investitionen, der Preissetzung etc. und dem Marktergebnis (performance), also den Gewinnspannen der Unternehmen, der resultierende Allokation und ihren Eigenschaften, der Rate der technischen Entwicklung usw.
besteht. Man spricht daher vom Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma (SVEParadigma, engl. structure-conduct-performance).
Dieser Zusammenhang wurde zumeist so gesehen, dass die Marktstruktur das Verhalten
und dieses wiederum das Marktergebnis determiniert. Das Verhalten war also nur eine
Zwischenstufe und wurde in vielen Untersuchungen nur sehr kursorisch abgehandelt,
d. h. das theoretische Fundament des Ansatzes war nur rudimentär entwickelt und es
wurden häufig ad hoc Annahmen hinsichtlich des Verhaltens getroffen, die nicht durch
eine Verhaltenstheorie gestützt werden konnten.
Dieser Mangel an einer theoretischen Basis führte zu einer zunehmenden Unzufriedenheit mit dem SVE-Paradigma. Im Rückgriff auf die theoretischen Untersuchungen von
Cournot (1838), Bertrand (1883) sowie die Modelle von Robinson (1933) und Chamberlin (1933)1 hat sich in den letzten Jahrzehnten ein neues, stärker theoretisch orientiertes
Konzept entwickelt, das den bestehenden Ansatz ergänzte und zum Teil in den Hintergrund drängte. Dieser neue Ansatz in der Industrieökonomik berücksichtigt die insbesondere bei unvollständigem Wettbewerb vorhandene strategische Interdependenz der
Akteure und greift daher auf Methoden aus der Spieltheorie zurück, mit deren Hilfe man
rationales Verhalten in strategischen Entscheidungssituationen analysieren kann. Grundlegendes Werk für die Spieltheorie ist von Neumann und Morgenstern (1944) (neueste
Auflage von Neumann und Morgenstern (1953), deutsch von Neumann und Morgenstern
(1961)). Sie wurde entscheidend vorangebracht durch die bahnbrechenden Arbeiten von
Nash (1950b,a), Selten (1965, 1975) und Harsanyi (1967, 1968a,b).2
Durch die neueren Analysen wurde zum einen der traditionelle empirische Ansatz theoretisch ergänzt, aber auch die postulierte Wirkungskette wurde in Frage gestellt. Theoretisch ist auch die Marktstruktur endogen bestimmt und nicht unabhängig vom Verhalten und vom Marktergebnis. Die Zahl der Anbieter und die gleichgewichtigen Mengen
und Preise werden selbst in einfachen Modellen des unvollständigen Wettbewerbs simultan bestimmt.
Allerdings hat die spieltheoretische Modellierung industrieökonomischer Sachverhalte
auch eine Schattenseite: Zum einen müssen für jede Industrie andere Modelle konstruiert
werden, da sich verschiedene Branchen hinsichtlich mehrerer Faktoren unterscheiden.
Dies hat zu einer kaum noch überschaubaren Vielzahl von Modellen geführt, die eine
einheitliche theoretische Grundlage vermissen lassen.
Zum anderen hängen die Ergebnisse von der exakten Modellierung des jeweiligen Problems ab, so dass zwischen robusten und weniger robusten Modellen unterschieden werden muss. Zum Beispiel wird sich zeigen, dass der Ansatz der sogenannten bestreitbaren
’
Märkte‘ (contestable markets) ein wenig robustes Konzept ist.
1
2
2
Die neuesten Auflagen dieser beiden Werke sind Robinson (1969) und Chamberlin (1962).
Für diese Leistung erhielten die drei genannten Autoren 1994 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.
Literaturverzeichnis
Aus diesen Gründen hat sich in den letzten Jahren wieder eine stärkere Berücksichtigung
empirischer Sachverhalte ergeben, so dass man die heutige Industrieökonomik als eine
Kombination der älteren, empirisch orientierten und der neuen, theoretisch fundierten
Industrieökonomik auffassen kann. Dies wird auch in unserer Vertiefung reflektiert, die
mit der Veranstaltung Marktanalysen und Fallstudien“ eine Veranstaltung umfasst, die
”
eine starke empirische Ausrichtung hat.
Literaturhinweis: Eine gute Darstellung der Geschichte der Industrieökonomik findet
sich in Hay und Morris (1986).
Literaturverzeichnis
Bertrand, J. (1883): “Théorie Mathématique de la Richesse Sociale,” Journal des
Savant, 67, 499–508, [English translation by J. Magnan de Bornier (1992): “The
‘Cournot–Bertrand Debate’: A Historical Perspective,” History of Political Economy,
24(3), 623–654.].
Chamberlin, E. H. (1933): Theory of Monopolistic Competition. Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts.
(1962): Theory of Monopolistic Competition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 8 Aufl.
Cournot, A. A. (1838): Recherches sur les Principes Mathématique de la Théorie de
Richesses. Hachette, Paris, [English translation by N. T. Bacon, 1897: Researches into
the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, McMillan, New York (1927),
reprint Augustus M. Kelley, New York (1971). Deutsche Übersetzung von W. G. Waffenschmidt: Untersuchungen über die mathematischen Grundlagen der Theorie des
Reichtums, Fischer, Jena (1924)].
Harsanyi, J. C. (1967): “Games with Incomplete Information Played by ‘Bayesian’
Players, I–III: Part I. The Basic Model,” Management Science, 14(3), 159–182.
(1968a): “Games with Incomplete Information Played by ‘Bayesian’ Players,
I–III: Part II. Bayesian Equilibrium Points,” Management Science, 14(5), 320–334.
(1968b): “Games with Incomplete Information Played by ‘Bayesian’ Players, I–
III: Part III. The Basic Probability Distribution of the Game,” Management Science,
14(7), 486–502.
Hay, D. A., und D. J. Morris (1986): Industrial Economics: Theory and Evidence.
Oxford University Press, New York.
Nash, J. F. (1950a): “Equilibrium Points in n-Person Games,” Proceedings of the National Academy of Sciences, 36, 48–49.
(1950b): “Non-Cooperative Games,” Ph.D. thesis, Princeton University.
3
Literaturverzeichnis
Robinson, J. (1933): The Economics of Imperfect Competition. Macmillan, London.
(1969): The Economics of Imperfect Competition. Macmillan, London, 2 Aufl.
Selten, R. (1965): “Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit, Teile I und II,” Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 121, 301–324,
667–689.
(1975): “Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points in
Extensive Games,” International Journal of Games Theory, 4(1), 25–55.
von Neumann, J., und O. Morgenstern (1944): Theory of Games and Economic
Behavior. Princeton University Press, Princeton.
(1953): Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press,
Princeton, 3 Aufl.
(1961): Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten. Physika Verlag, Würzburg,
Übersetzung nach der 3. Aufl. durch M. Leppig, hrsg. von F. Sommer unter Mitw. von
F. Docquier.
4
2 Grundlagen
Bevor wir mit der Untersuchung des Verhaltens von Unternehmen in unterschiedlichen
Marktformen beginnen, geben wir einen kurzen Überblick bzw. eine kurze Wiederholung der Theorie der Firma, die in der Grundstudiumsvorlesung Mikroökonomik II
behandelt wurde, denn Grundkenntnisse aus diesem Bereich sind für das Verständnis der
meisten industrieökonomischen Fragestellungen unabdingbar. Hierzu gehören in erster
Linie die zentralen Konzepte aus der Produktions- bzw. Kostentheorie, also die Produktionsfunktion und die Kostenfunktion sowie deren Eigenschaften.
Aber auch einige wesentliche Aspekte der Nachfrageseite sollen kurz diskutiert werden,
wie etwa Nachfrage- und Preis-Absatz-Funktion sowie Erlös- und Grenzerlösfunktion.
Darüberhinaus werden im Verlauf der Vorlesung auch Fragen des strategischen Verhaltens angesprochen, die vertiefend in der Vorlesung Spieltheorie“ behandelt werden, auf
”
deren Grundlage wir uns mit einigen dieser Themen und verwandten Fragestellungen in
der Vorlesung Industrieökonomik II näher befassen werden.
2.1 Die Theorie der Firma
Ein Unternehmen in der mikroökonomischen Theorie ist im allgemeinen vollständig charakterisiert durch seine technischen Möglichkeiten, Inputs in Outputs bzw. Produktionsfaktoren in Produkte zu verwandeln. Diese technischen Möglichkeiten werden meistens
durch eine Produktionsfunktion beschrieben´. Die grundlegende Annahme bezüglich
des Verhaltens eines Unternehmens ist die der Gewinmaximierung.
Betrachten wir im folgenden die einfache Situation, in der in einer Firma nur ein Gut
hergestellt wird, zu dessen Produktion die beiden Produktionsfaktoren Kapital (k) und
Arbeit (l) eingesetzt werden.
Eine Produktionsfunktion besagt nun, wie viele Einheiten des Produktes mit Hilfe der
beiden Produktionsfaktoren hergestellt werden kann. Dieser Zusammenhang wird formal
durch die Produktionsfunktion
y = f (l, k)
beschrieben.
Wir werden im weiteren unterstellen, dass diese Produktionsfunktion mindestens zweimal stetig differenzierbar ist, d. h. dass die ersten und zweiten partiellen Ableitungen
der Produktionsfunktion gebildet werden können.
Die erste partielle Ableitung der Produktionsfunktion z. B. nach dem Faktor Arbeit gibt
an, um welchen Betrag sich der Output der Firma verändert, wenn wir den Produktionsfaktor Arbeit marginal erhöhen. Analog kann man das auch für den Faktor Kapital
5
2 Grundlagen
durchführen. Diese beiden partiellen Ableitungen
GPl (l, k) =
∂f (l, k)
∂l
und GPk (l, k) =
∂f (l, k)
∂k
werden als die Grenzprodukte der Faktoren Arbeit und Kapital bezeichnet.
Wir werden im allgemeinen davon ausgehen, dass die Grenzprodukte aller Produktionsfaktoren positiv sind, d. h.
∂f (l, k)
> 0 und
∂l
∂f (l, k)
> 0.
∂k
Beispiel: Eine bekannte Produktionsfunktion
Produktionsfunktion, die wie folgt definiert ist
y = f (l, k) = lα k β ,
ist
die
Cobb–Douglas–
α, β > 0.
Die Grenzprodukte sind hier gegeben durch
GPl (l, k) = αlα−1 k β
und GPk (l, k) = βlα k β−1
Im weiteren unterscheiden wir zwei verschiedene Arten der Beziehung zwischen den
Produktionsfaktoren.
Definition 1
1. Zwei Produktionsfaktoren sind komplementär in einem gegebenen Produktionsprozess, wenn eine erhöhte Einsatzmenge des einen Faktors zu einem
erhöhten Grenzprodukt des anderen Faktors führt, d. h.
∂GPl (l, k)
> 0 und
∂k
∂GPk (l, k)
> 0.
∂l
2. Zwei Produktionsfaktoren sind substitutiv in einem bestimten Produktionsprozess, wenn eine erhöhte Einsatzmenge des einen Faktors zu einem geringeren Grenzprodukt des anderen Faktors führt, d. h.
∂GPl (l, k)
< 0 und
∂k
∂GPk (l, k)
< 0.
∂l
Im Beispiel der Cobb–Douglas–Produktionsfunktion sind die beiden Produktionfaktoren
komplementär, da
∂ βlα k β−1
∂ αlα−1 k β
=
= αβlα−1 k β−1 > 0.
∂k
∂l
6
2.1 Die Theorie der Firma
Ein weiteres zentrales Konzept, das im Verlauf der Vorlesung noch häufig verwendet
werden wird, ist das der Skalenerträge.
Definition 2
1. Eine Produktionsfunktion weist zunehmende Skalenerträge auf, wenn gilt
f (λl, λk) > λf (l, k),
∀λ > 1,
d. h. eine Erhöhung aller Produktionsfaktoren um den gleichen Faktor führt
dazu, dass sich der Output um mehr als diesen Faktor erhöht.
2. Eine Produktionsfunktion weist abnehmende Skalenerträge auf, wenn gilt
f (λl, λk) < λf (l, k),
∀λ > 1,
d. h. eine Erhöhung aller Produktionsfaktoren um den gleichen Faktor führt
dazu, dass sich der Output um weniger als diesen Faktor erhöht.
3. Eine Produktionsfunktion weist konstante Skalenerträge auf, wenn gilt
f (λl, λk) = λf (l, k),
∀λ > 1,
d. h. eine Erhöhung aller Produktionsfaktoren um den gleichen Faktor führt
dazu, dass sich der Output um den gleichen Faktor erhöht.
Grafisch kann man sich die drei Arten von Skalenerträgen wie in Abbildung 1.1 gezeigt
veranschaulichen. Dabei ist jeweils eine Produktionsfunktion mit einem Input, der auf
der Abszisse abgetragen wird, und einem Output, der auf der Ordinate abgetragen wird,
dargestellt.
fl
2
fl
2
fl
2
1
1
1
1
2
l
,
1
2
l
,
1
2
l
Abbildung 1.1: abnehmende, konstante und zunehmende Skalenerträge
In unserem Beispiel der Cobb–Douglas–Produktionsfunktion hängt es von den Parametern α und β ab, ob abnehmende, konstante oder zunehmende Skalenerträge vorliegen.
Es gilt
f (λl, λk) = (λl)α (λk)β = λα+β lα k β = λα+β f (l, k).
7
2 Grundlagen
Für λ > 1 ist
> λ
α+β
λ
=λ
<λ
für α + β > 1,
für α + β = 1,
für α + β < 1.
Daher besitzt eine Cobb–Douglas–Produktionsfunktion
• zunehmende Skalenerträge, falls α + β > 1,
• konstante Skalenerträge, falls α + β = 1 und
• abnehmende Skalenerträge, falls α + β < 1.
2.2 Kosten und Nachfrage
Die Kostenfunktion eines Unternehmens wird ermittelt, in dem man für ein gegebenes
Outputniveau, z. B. ȳ, feststellt, wie dieser Output mit den geringstmöglichen Kosten
hergestellt werden kann. Mit anderen Worten, die Kostenfunktion ergibt sich durch die
Lösung eines Minimierungsproblems.
Im Beispiel der Cobb–Douglas–Produktionsfunktion kann die Kostenfunktion wie folgt
bestimmt werden. Zunächst müssen wir Preise für die beiden Produktionsfaktoren einführen. In Anlehnung an den Lohn (wage) für den Produktionsfaktor Arbeit, verwenden
wir für Inputpreise häufig die Notation w. Hier ist wl der Preis für Arbeit und wk der
Preis für Kapital. Wenn ein Unternehmen mit der Cobb–Douglas–Produktionsfunktion
die Menge ȳ zu geringstmöglichen Kosten herstellen möchte, muss es folgendes Minimierungsproblem lösen.
min
(2.1)
l,k
wl l + w k k
u.d.N. lα k β = ȳ.
Die Zielfunktion sind die Kosten, d. h. die mit den jeweiligen Inputpreisen bewerteten
Mengen von Arbeit bzw. Kapitel, die das Unternehmen einsetzt. Die Nebenbedingung
ist, dass mit diesen Inputs gerade die gewünschte Menge ȳ produziert wird.
Die Lagrangefunktion für dieses Problem ist
L (l, k, λ) = wl l + wk k + λ ȳ − lα k β .
Die Bedingungen erster Ordnung lauten
∂L (l, k, λ)
= wl − λαlα−1 k β = 0
∂l
∂L (l, k, λ)
(2.3)
= wk − λβlα k β−1 = 0
∂k
∂L (l, k, λ)
(2.4)
= ȳ − lα k β = 0.
∂λ
(2.2)
8
2.2 Kosten und Nachfrage
Daraus erhält man durch Division von Gleichung 2.2 durch Gleichung 2.3
wl
λαlα−1 k β
α
αk
=
= lα−1 l−α k β k β−1 =
.
α
β−1
wk
λβl k
β
βl
Auflösen nach l ergibt
(2.5) l =
α wk
k.
β wl
Dies setzen wir in die Nebenbedingung (2.4 ein und erhalten
α
α
α wk
α wk
β
k k =
k α+β
ȳ =
β wl
β wl
Auflösen nach k ergibt
k = y
1
α+β
α wk
β wl
α
− α+β
.
Dies gibt an, welche Menge des Produktionsfaktors Kapital das Unternehmen einsetzen
wird, um bei gegebenen Faktorpreisen wl und wk die Menge ȳ mit geringstmöglichen
Kosten zu herzustellen. Diese Menge muss das Unternehmen am Markt kaufen, weshalb
wir sie als bedingte (auf den vorgegebenen Output ȳ) Faktornachfrage bezeichnen. Die
bedingte Faktornachfragefunktion gibt für alle Faktorpreise und Outputniveaus die
entsprechende bedingte Faktornachfrage an. Für Kapital lautet sie also
k (wl , wk , y) = y
1
α+β
α wk
β wl
α
− α+β
.
Wenn wir dies in Gleichung (2.5) einsetzen und vereinfachen erhalten wir auch die bedingte Faktornachfragefunktion für Arbeit
l (wl , wk , y) = y
1
α+β
α wk
β wl
β
α+β
.
Schließlich setzen wir diese beiden bedingten Faktornachfragefunktionen in die Zielfunktion unseres Minimierungsproblem ein, um die Kostenfunktion zu erhalten
C (wl , wk , y) = wl l (wl , wk , y) + wk k (wl , wk , y) .
Diese Funktion gibt für alle Faktorpreise wl und wk die minimalen Kosten an, die aufgewendet werden müssen, um ein vorgegebenes Outputniveau zu erzeugen.
In unserem Fall ist die Kostenfunktion gegeben durch
" β
#
α
− α+β
β
α
1
α α+β
α
C (wl , wk , y) =
+
wlα+β wkα+β y α+β
β
β
9
2 Grundlagen
Die Kosten, die pro hergestellter Einheit Output anfallen, sind durch die Durchschnittskostenfunktion bestimmt. Wenn also y Einheiten produziert werden, dann betragen
die Durchschnittskosten
AC (wl , wk , y) =
(wl , wk , y)
.
y
Die Änderung in den Kosten, die durch eine marginale Erhöhung des Outputs entstehen,
werden durch die Grenzkostenfunktion beschrieben
M C (wl , wk , y) =
∂C (wl , wk , y)
.
∂y
Um den Zusammenhang zwischen den Kosten, Durchschnitts- und Grenzkosten zu verdeutlichen, betrachten wir die Kostenfunktion
C(y) = F + cy 2 ,
F, c > 0.
Hierbei sind durch F die outputunabhängigen Fixkosten bezeichnet, also die Kosten
die aufgewendet werden müssen, um überhaupt etwas produzieren zu können. Die Kostenfunktion hat hier nur ein Argument, nämlich die Outputmenge. Das heißt, dass wir
implizit unterstellen, dass die Faktorpreise auf einem bestimmten Niveau konstant bleiben.
Offensichtlich sind die Durchschnittskosten gegeben durch
AC(y) =
F
+ cy
y
und die Grenzkosten durch
M C(y) = 2cy.
Beide Kostenfunktionen sind in Abbildung grafisch dargestellt.
AC
20
15
10
5
5
10
15
20
y
Abbildung 2.2: Durchschnitts– und Grenzkosten
10
2.2 Kosten und Nachfrage
Die Grenzkostenfunktion ist linear mit
pder Steigung 2c und die Durchschnittskostenp
funktion fällt für
Outputniveaus
y
<
F/c
und
steigt
für
Outputniveaus
y
>
F/c.
p
Im Punkt y = F/c erreichen die Durchschnittskosten ihr Minimum.
Man sieht, dass die Durchschnittskosten gerade dort ihr Minimum erreichen, wo sie die
Grenzkosten schneiden. Dies gilt auch allgemein, wie man sich leicht überlegt, wenn man
die Bedingungen erster Ordnung für die Minimierung der Durchschnittskosten betrachtet.
dAC(y)
= 0
dy
⇐⇒
d C(y)
y
= 0
dy
M C(y) C(y)
− 2 = 0
⇐⇒
y
y
C(y)
⇐⇒ M C(y) =
= AC(y).
y
Damit kann man leicht das Outputniveau bestimmen, das die Durchschnittskosten minimiert. y min ist gegeben durch
M C(y min ) = AC(y min ).
Man muss also nur Grenz– und Durchschnittskosten gleichsetzen und nach y auflösen.
In unserem Beispiel ergibt sich dieses Outputniveau aus der Gleichung
M C(y min ) = 2cy min =
F
y min
+ cy min = AC(y min ).
Daraus folgt
y min =
r
F
c
und damit
√
M C(y min ) = AC(y min ) = 2 cF .
Der Zusammenhang zwischen Produktions- und Kostenfunktion:
Dualität
Da wir die Kostenfunktion aus dem Minimierungsproblem (wie im Beispiel 2.1) hergeleitet haben, in dessen Nebenbedingung die Produktionsfunktion einging, besteht ein enger
Zusammenhang zwischen Kosten- und Produktionsfunktion. Diese Beziehung wird als
Dualität bezeichnet. Der Zusammenhang kann dazu herangezogen werden, um Informationen über die Produktionsfunktion zu erhalten, wenn die Kostenfunktion bekannt
ist und umgekehrt.
11
2 Grundlagen
Betrachten wir als Beispiel einen Produktionsprozess, bei dem nur ein Produktionsfaktor
(Arbeit) eingesetzt wird. Die Produktionsfunktion ist gegeben durch
y = f (l) = lγ ,
γ > 0.
Für unterschiedliche Werte von γ (γ < 1, γ = 1 und γ > 1), sieht die Produktionsfunktion aus wie in Abbildung 2.3 gezeigt.
fl
2
fl
2
fl
2
1
1
1
1
2
l
1
,
2
l
1
,
2
l
Abbildung 2.3: Produktionsfunktion für γ = 21 , γ = 1, γ = 2
Um daraus Informationen über die Kostenfunktion zu erhalten, invertieren wir die Produktionsfunktion.
l = y 1/γ
Wenn der Lohnsatz w beträgt, ergeben sich die Kosten zur Herstellung von y als
C(y) = wl = wy 1/γ .
Diese Kostenfunktion ist in Abbildung 2.4 ebenfalls für die drei Parameterwerte dargestellt.
Cy
2
Cy
2
Cy
2
1
1
1
1
2
y
,
1
2
y
,
1
2
y
Abbildung 2.4: konvexe, lineare und konkave Kostenfunktionen
Der Verlauf der Kosten- und Produktionsfunktion macht deutlich, dass zunehmende
Skalenerträge, d. h. eine konvexe Produktionsfunktion mit einer konkaven Kostenfunktion, konstante Skalenerträge, d. h. eine lineare Produktionsfunktion mit einer linearen
Kostenfunktion und abnehmende Skalenerträge, d. h. eine konkave Produktionsfunktion
mit einer konvexen Kostenfunktion verbunden sind.
12
2.2 Kosten und Nachfrage
AC
2
AC
2
AC
2
1
1
1
1
2
y
,
1
2
y
,
1
2
y
Abbildung 2.5: zunehmende, konstante und fallende Durchschnittskosten
Dies kann auch aus dem Verlauf der Durchschnittskosten entnommen werden, die in
Abbildung 2.5 dargestellt sind.
Im ersten Fall — steigende Skalenerträge — nehmen die Kosten pro Stück mit zunehmender Outputmenge ab, bei konstanten Skalenerträgen, d. h. linearer Kostenfunktion
bleiben sie konstant und bei abnehmenden Skalenerträgen nehmen sie zu.
Übung: Überprüfen Sie anhand der Cobb–Douglas–Produktionsfunktion und der
dazugehörigen Kostenfunktion den dargestellten Zusammenhang. Beachten Sie
dabei, dass die Summe der Parameter α und β Auskunft über die Skalenerträge der
Produktionsfunktion gibt.
Nachfrage– und Grenzerlösfunktion
Um das Verhalten von Firmen am Markt zu studieren, müssen wir auch die Nachfrageseite modellieren. Dies wird im allgemeinen durch eine Nachfragefunktion y(p) getan.
Eine Nachfragefunktion gibt zu jedem vorgegebenen Preis die nachgefragte Menge an.
Betrachten wir zum Beispiel die lineare Nachfragefunktion
y(p) =
a 1
− p,
b
b
wobei a und p positive Konstanten sind. Hier wird unterstellt, dass die Nachfrage nach
dem Produkt y nur vom Preis dieses Produktes abhängt; dies ist typisch für den partialanalytischen Ansatz vieler industrieökonomischer Modelle.
In der Industrieökonomik wird jedoch häufig nicht mit der Nachfrage, sondern mit der
inversen Nachfragefunktion gearbeitet. Diese Funktion gibt an, welchen Preis man
für eine gegebene Menge am Markt erzielen kann. Die inverse Nachfragefunktion — auch
als Preis-Absatz-Funktion bezeichnet — ist in unserem Fall
p(y) = a − by.
Eine grafische Darstellung ist in Abbildung 2.6 gegeben.
Eine wichtige Eigenschaft der Nachfragefunktion ist ihre Elastizität. Die Preiselastizität gibt an, um wieviel sich — prozentual — die Nachfrage ändert, wenn der Preis
13
2 Grundlagen
px
12
10
8
6
4
2
2
4
6
8
10
12
x
Abbildung 2.6: Preis-Absatz-Funktion
eine marginale prozentuale Erhöhung erfährt. Sie ist definiert als
ηp (y) =
dy(p) p
.
dp y
Definition 3 Für eine gegebene Menge y heißt die Nachfrage
1. elastisch, wenn ηp (y) < −1 (|ηp (y)| > 1);
2. unelastisch, wenn −1 < ηp (y) < 0 (|ηp (y)| < 1);
3. einheitselastisch, wenn ηp (y) = −1 (|ηp (y)| = 1).
Die Elastizität der linearen Nachfragefunktion ist gegeben durch
ηp (y) =
dy(p) p
1 a − by
a
=−
=1− .
dp y
b y
by
Die Funktion ist daher elastisch für y < a/(2b), unelastisch für y > a/(2b) und einheitselastisch für y = a/(2b). Diese Elastizitätsbereiche sind in Abbildung 2.7 in die
Preis-Absatz-Funktion eingezeichnet.
Erlös– und Grenzerlösfunktion
Die Erlösfunktion RE(y) gibt an, welchen Erlös ein Unternehmen bei der Menge y
erzielen kann, wenn der dazugehörige Preis über die Preis-Absatz-Funktion bestimmt
wird. Dieser Erlös ergibt sich im Beispiel der linearen Nachfragefunktion als
p(y)y = ay − by 2 .
14
2.2 Kosten und Nachfrage
p
ela
stis
ch
|ηp (y)| = 1
un
ela
stis
ch
a
2b
y
Abbildung 2.7: Elastizitätsbereiche
Man kann nun die Frage stellen, wie der Erlös eines Unternehmens sich ändert, wenn
die am Markt abgesetzte Menge etwas erhöht wird. Die Antwort darauf gibt die Grenzerlösfunktion M R(y). Sie ist definiert als die Ableitung der Erlösfunktion
M R(y) =
dRE(y)
.
y
Für den Fall einer linearen Nachfrage- bzw. Preis-Absatz-Funktion gilt der folgende
Zusammenhang.
Theorem 1 Ist die inverse Nachfragefunktion linear, dann ist auch die Grenzerlösfunktion linear und hat den selben Achsenabschnitt aber die doppelte (negative)
Steigung, d. h. M R(y) = a − 2by.
Dies ergibt sich unmittelbar aus der Ableitung der Erlösfunktion.
Man sieht auch, dass es einen Zusammenhang zwischen der Elastizität der Nachfragefunktion und der Grenzerlösfunktion gibt. Diesen Zusammenhang kann man wie folgt
herleiten.
dp(y)y
dp(y)
dRE(y)
=
=p+y
dy
dy
dy
"
#
y 1
1
.
= p 1 + dy(p) = p 1 +
p
ηp (y)
M R(y) =
(2.6)
dp
Der Grenzerlös ist also positiv im elastischen Bereich der Nachfragefunktion, gleich Null
an der Stelle, an der die Elastizität gleich 1 ist und negativ im unelastischen Bereich.
15
2 Grundlagen
2.3 Märkte, Marktabgrenzung und Konzentrationsmaße
In den Grundstudiumsvorlesungen zur Mikroökonomik wird das Konzept des vollkommenen Wettbewerbes behandelt. Dieser wird in der Literatur zumeist durch die folgenden Eigenschaften gekennzeichnet.
• eine große Zahl von Anbietern und Nachfragern auf einem Markt;
• ein homogenes Produkt, das auf dem Markt gehandelt wird;
• vollkommene Information über alle relevanten ökonomischen Variablen;
• keine Transaktionskosten;
• freier Marktzutritt und Marktaustritt.
Diese Bedingungen führen dazu, dass man Anbieter und Nachfrager als Preisnehmer
oder Mengenanpasser betrachten kann.
In der neueren Literatur (z. B. Shy (1995)) wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Anbieter oder Nachfrager keine Rolle für die Annahme eines Preisnehmerverhaltens spielt.
Entscheidend ist vielmehr, dass eine Firma annimmt, sie könne den Preis nicht beeinflussen. Wir werden später Beispiele betrachten, in denen wir vollkommenen Wettbewerb
betrachten obwohl es im Markt nur eine Firma gibt.
Die andere Marktform, die im Grundstudium betrachtet wird, ist das andere Extrem
des Monopols. Hier gibt es am Markt nur ein Unternehmen, d. h. die Industrie und das
Unternehmen sind identisch. Der Monopolist sieht sich der gesamten Marktnachfrage
gegenüber und hat die Möglichkeit, den Preis für sein Produkt (oder die abzusetzende
Menge) frei zu wählen. Der Monopolist ist also ein Preissetzer.
Märkte und Marktabgrenzung
In der Diskussion dieser beiden extremen Marktformen ist implizit immer der Begriff des
Marktes eingeflossen. Es stellt sich allerdings in einem ersten Schritt die Frage, was im
weiteren unter einem Markt verstanden werden soll und wie man verschiedene Märkte
voneinander abgrenzen kann. Wir werden dieses Thema hier nur kurz anreißen können.
Dass es von entscheidender Bedeutung ist, wird schon an einem einfachen Beispiel klar.
Stellen wir uns zwei Obstbauern vor, von denen einer Äpfel und der andere Birnen
anbaut. Wenn wir jeweils den Markt für Äpfel und den für Birnen als getrennte Märkte
ansehen, haben wir es mit zwei Monopolisten zu tun. Stellen wir uns hingegen auf den
Standpunkt, der relevante Markt sei der für Obst, stehen die beiden Obstbauern
zueinander in Konkurrenz, sind also Duopolisten.
Neben der eben diskutierten Frage, welches der sachlich relevante Markt sei, gibt es
auch noch die beiden Dimensionen des räumlich relevanten Marktes und des zeitlich relevanten Marktes. Um bei unseren Obstbauern zu bleiben, macht es sicherlich
einen Unterschied, ob beide ihren Betrieb in Linsenhofen (schwäbische Alb) betreiben,
oder ob die Äpfel im Alten Land (bei Hamburg) und nur die Birnen in Linsenhofen
16
2.3 Märkte, Marktabgrenzung und Konzentrationsmaße
wachsen, so dass beide Bauern verschiedene Wochenmärkte beschicken. Genauso ist es
wichtig, ob Äpfel und Birnen gleichzeitig reif sind, so dass die schwäbischen Hausfrauen beide nebeneinanderliegend auf dem Markt finden, oder ob die beiden Obstsorten
zu verschiedenen Zeiten angeboten werden; es ist ja eher unwahrscheinlich, dass eine
Konsumentin z. B. im August vom Kauf von Äpfeln absieht, weil sie weiß, dass es im
Oktober Äpfel billiger geben wird.
Worum es in den Fällen geht, in denen etwa beim Bundeskartellamt, der Monopolkommission oder der EU-Kommission der Begriff des Marktes eine fundamentale Rolle spielt,
ist ja, herauszufinden, ob Unternehmen zueinander im Wettbewerb stehen oder nicht.
Ein sinnvoll abgegrenzter relevanter Markt sollte alle Firmen umfassen, die tatsächlich
miteinander im Wettbewerb stehen, sollte aber alle Nicht–Wettbewerber ausschließen.
Um nun aber festzustellen, ob gegebene Firmen Wettbewerber sind oder nicht, spielt
die Substituierbarkeit der betrachteten Güter sowohl auf der Konsumenten- als auch auf
der Produzentenseite eine wichtige Rolle. Werden zwei Produkte von den Konsumenten
für ähnliche Zwecke verwendet, dann sollten Firmen, die diese Produkte herstellen, als
Wettbewerber betrachtet werden. Auch wenn zwei Produkte unter Verwendung ähnlicher Produktionsprozesse hergestellt werden, sind ihre Hersteller als Wettbewerber aufzufassen. Hat man zu wenige Firmen erfasst, dann wird die Marktmacht einer Firma
überschätzt — sind zu viele Firmen unter einem Markt subsummiert, dann wird der
Einfluss einer einzelnen Unternehmung unterschätzt.
In Deutschland ist das grundlegende System, nachdem die Erzeugnisse der verschiedenen
Industrien klassifiziert werden, die vom Statistischen Bundesamt herausgegebene Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003).1 Diese Klassifikation kann an
folgendem Beispiel verdeutlicht werden: Z.B. wird unter Kategorie D das Verarbeitende Gewerbe aufgeführt, unter DM der Fahrzeugbau, unter DM 34 die Herstellung
von Kraftwagen und Kraftwagenteilen usw. Insgesamt erstreckt sich die Klassifikation
auf sechs Ebenen. In den USA gibt es ein ähnliches System, das North American Industry Classification Scheme (NAICS), das 1997 den Vorgänger, die Standard Industrial
Classification (SCI) ablöste. Die aktuelle Version ist NAICS2002, mit ebenfalls sechs
Hierarchieebenen, allerdings gibt es bereits Pläne für eine revision NAICS2007.2
Ein Gefühl für die Bedeutung der Marktabgrenzung aber auch für die damit verbundenen
Schwierigkeiten werden auch die Anwendungen in der Vorlesung Marktanalysen und
”
Fallstudien“ geben.
Konzentrationsmaße
Nachdem wir etwas über die Klassifizierung der verschiedenen Märkte gelernt haben,
soll nun in einem weiteren Schritt untersucht werden, wie es um den Wettbewerb bzw.
den Grad des Wettbewerbs in den verschiedenen Industrien bzw. Märkten bestellt ist.
Bisher haben wir nur die beiden Extreme des vollkommenen Wettbewerbs bzw. des
1
2
Sie ist unter folgenden URL zu finden http://www.destatis.de/download/d/klassif/wz03.pdf.
Nähere Informationen finden sich auf der NAICS Homepage des U.S. Census Bureau mit folgender
URL http://www.census.gov/epcd/www/naics.html.
17
2 Grundlagen
Monopols angesprochen. Im allgemeinen finden wir aber in keiner Industrie eines dieser
beiden Extreme vor, sondern haben es mit Fällen zu tun, in der es zwar nicht nur ein
Unternehmen gibt, das auf einem Markt ohne Konkurrenten agieren kann, in denen aber
auch die Annahme vollkommener Konkurrenz keine gute Beschreibung der Realität ist.
Man kann daher die Frage stellen, wie man in Industrien, die weder der vollkommenen
Konkurrenz noch dem Monopol entsprechen, die Konzentration der Industrie messen
kann. Es kann aus zwei Gründen von Interesse sein, über ein derartiges Maß für die
Konzentration zu verfügen.
Erstens eröffnet ein solches Konzentrationsmaß die Möglichkeit, verschiedene Industrien
hinsichtlich des Grades der Konzentration zu vergleichen und zweitens kann es für eine
Regulierungsbehörde ein wichtiges Hilfsmittel sein, um festzulegen, ab wann sie in einer
Industrie tätig werden möchte, um den Grad der Konzentration zu senken bzw. eine
weitere Konzentration zu verhindern.
Beginnen wir mit der Frage, was denn eine Industrie mit hohem Konzentrationsgrad
wäre. Offensichtlich ist ein Monopol die am höchsten konzentrierte Industrie, da 100%
des Outputs von einer Unternehmung verkauft werden.
Gibt es jedoch in einer Industrie mehr als ein Unternehmen, dann gibt es zwei Faktoren, die die Konzentration beeinflussen: Zum einen die Zahl der Unternehmen in der
Industrie und zum anderen die Verteilung des Outputs zwischen diesen Unternehmen.
Ein vernünftiges Konzentrationsmaß sollte daher von beiden Faktoren abhängen.
Im folgenden werden wir einige Konzentrationsmaße betrachten, die für zahlreiche
empirische Untersuchungen aber auch für Entscheidungen des Kartellamts oder der EUKommission sowie die Berichte der Monopolkommission von zentraler Bedeutung sind.
Wir beginnen damit, uns auf Notation zu verständigen. Sei n die Zahl der Unternehmen
in einer Industrie und sei Y der aggregierte Output in der Industrie. Der Output des
Unternehmens i sei bezeichnet mit yi , i = 1, . . . , n. Es gilt also
n
X
yi .
Y =
i=1
Allerdings könnte im Fall nicht völlig homogener Produkte das Problem auftreten, dass
hier Äpfel und Birnen‘addiert werden. Im weiteren werden wir jedoch — wie das auch
’
in fast allen empirischen Untersuchungen der Fall ist — von diesem Problem absehen.
Wir können nun den prozentualen Anteil des Outputs eines Unternehmens am Gesamtoutput der Industrie schreiben als
yi
si = .
Y
Im weiteren bezeichnen wir si als den Marktanteil des Unternehmens i.3
Offensichtlich gilt:
Pn
n
X
yi
si = i=1 = 1.
Y
i=1
3
Der Marktanteil eines Unternehmens ist eine reelle Zahl si ∈ [0, 1]. In der Literatur wird der Marktanteil häufig in Prozent angegeben, also etwa statt si = 0.5 geschrieben si = 50%. Dies kann zur
Verwirrung beitragen.
18
2.3 Märkte, Marktabgrenzung und Konzentrationsmaße
Konzentrationsraten Bei den Konzentrationsraten handelt es sich um Maßzahlen, die
die absolute Konzentration beschreiben. Die absolute Konzentration ist auf die Ungleichverteilung der Größe einer bestimmten Anzahl der Unternehmen bezogen. Es werden zumeist Konzentrationsraten bezogen auf die 3, 6, 10, 25, 50 und 100 größten Unternehmen auf einem Markt betrachtet.
Um eine Konzentrationsrate bezogen auf die j größten Unternehmen (CRj ) zu ermitteln,
werden die Marktanteile dieser Firmen addiert, d. h.
CRj =
j
X
sj .
i=1
Der Wertebereich der Konzentrationsraten beträgt:
j
≤ CRj ≤ 1.
n
Zum Beispiel bedeutet CR3 = 30% (dies heißt in unserer Notation CR3 = 0.3), dass
die drei größten Unternehmen in einer Industrie zusammen einen Marktanteil von 30%
haben. Es handelt sich bei einer Konzentrationsrate um ein unvollständiges Konzentrationsmaß, da nur die j größten Unternehmen berücksichtigt werden.
Betrachten wir als Beispiel einmal die folgenden imaginären Industrien:
% Anteil
Industrie 1
Industrie 2
Industrie 3
Industrie 4
s1
60
20
s2
10
20
100
3
100
3
49
49
s3
5
20
s4 , s5
5
20
100
0
3
0.25 0.25
s6 . . . s8
5
0
0
0.25
s9 , s10
0
0
0
0.25
CR4
80
80
100
98.5
H
3850
2000
3333
4802
Hier ist als Konzentrationsrate CR4 ausgewiesen. Allerdings gibt es bei dieser Kennzahl
einige Probleme: In der Industrie 1 hat Unternehmen 1 einen Marktanteil von 60%. In der
Industrie 2 mit fünf Unternehmen haben alle Unternehmen den gleichen Marktanteil von
20%. Aber das Konzentrationsmaß CR4 ergibt 80% für beide Industrien. Da dieses vierFirmen-Maß linear ist, gehen Unterschiede in der Unternehmensgröße der vier größten
4 Firmen nicht in das Maß ein.
Zwischen den Industrien 3 und 4 ergibt sich ein ähnliches Problem: Eine Industrie, in der
sich die Marktanteile auf drei Unternehmen in gleicher Weise verteilen, wird als höher
konzentriert ausgewiesen als eine Industrie, die von zwei großen Firmen dominiert wird.
Herfindahl–Index
Der Herfindahl–Index ist eine konvexe Funktion der Marktanteile der Unternehmen.
Aus diesem Grunde hängt dieser Index auch von Unterschieden in den Marktanteilen
ab. Es handelt sich um ein absolutes summarisches Konzentrationsmaß, da alle
Unternehmen in der Industrie berücksichtigt werden.
19
2 Grundlagen
Formal ist der Herfindahl–Index definiert als:
n
X
(100si )2 ,
H=
i=1
d. h. die summierten Quadrate der Marktanteile aller Unternehmen (in Prozentzahlen,
daher die Multiplikation mit 100) in einer Industrie.
In unserem obigen Beispiel ist der Herfindahl–Index für die Industrie 1 fast zweimal so
groß wie für Industrie 2. Der Grund dafür liegt darin, dass das Quadrieren der Marktanteile sich bei den großen Unternehmen stärker auswirkt, was dazu führt, dass der Index
groß wird für Industrien, in denen die Marktanteile der Unternehmen unterschiedlich
groß sind.
Für die Industrien 3 und 4 gibt zwar CR4 eine höhere Konzentration für Industrie 3 an,
aber der Herfindahl–Index für die Industrie 4 ist höher als für Industrie 3. Aus diesem
Grund wird der Herfindahl–Index häufig für Regulierungsfragen herangezogen.
Neben diesen beiden absoluten Konzentrationsmaßen werden auch sogenannte relative Konzentrationsmaße betrachtet, die die Ungleichverteilung der Anteile an allen
Unternehmen erfassen.
Zum einen handelt es sich um Disparitätsraten. Ein Disparitätsrate ist der Anteil, mit
dem der Wert einer Konzentrationsrate auf der Ungleichverteilung der Unternehmensgrößen bzw. der Marktanteile der Unternehmen beruht. Formal ist eine Disparitätsrate
definiert als
CRj − 1/n
j
DRj =
=1−
.
CRj
n · CRj
Angenommen, die Konzentrationsrate der drei größten von insgesamt 100 Unternehmen
betrage 10%. Wären alle Anbieter gleich groß, betrüge die Konzentrationsrate CR3 3%.
Der Wert der Konzentrationsrate resultiert daher zu 70% — der Disparitätsrate DR3
— aus der ungleichen Größenverteilung.
Auch für summarische absolute Konzentrationsmaße wie den Herfindahl–Index gibt es
zugeordnete relative Konzentrationsmaße. So wird für den Herfindahl–Index häufig der
Variationskoeffizient verwendet. Hierbei handelt es sich um das Verhältnis der Standardabweichung der Marktanteile zu ihrem arithmetischen Mittelwert. Formal ist der
Variationskoeffizient definiert als
2
n X
1
2
si −
V =n
.
n
i=1
Ein großer Variationskoeffizient deutet auf starke Ungleichheiten in den Marktanteilen
hin. Hätten z. B. alle Unternehmen den gleichen Marktanteil, dann wäre der Variationskoeffizient gleich 0.
2.4 Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik
Im folgenden soll an einem Beispiel die Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik dargestellt werden. Hierzu verwenden wir Statistiken aus dem letzten Haupt-
20
Literaturverzeichnis
gutachten der Monopolkommission aus dem Jahre 1996/1997 (Monopolkomission, 1998,
Tabelle I.2, S. 92–95) über die Konzentration der Unternehmen bzw. der Anbieter. Bei
der Konzentration der Unternehmen wird eine Firma dem Bereich zugeordnet, in dem
das Unternehmen seinen Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Bei der Konzentration der Anbieter nach Güterarten werden nur diejenigen Teile der Produktion
zusammengefasst, die bestimmten Gütern entsprechen.
Wir betrachten die Konzentration im Bereich des produzierenden Gewerbes. Es zeigt
sich, dass der absolute höchste Konzentrationsgrad (gemessen mit dem Herfindahl-Index)
in den folgenden Bereichen herrscht.
11 Erdöl und Erdgas
710 Punkte
10 Kohle und Torf
480 Punkte
16 Tabakerzeugnisse
213 Punkte
Ein mittlerer Konzentrationsgrad liegt in den folgenden Industrien vor.
35 Fahrzeuge (ohne Kraftwagen und –teile)
46 Punkte
37 Sekundärrohstoffe
30 Punkte
24 Chemische Erzeugnisse
25 Punkte
Die geringste Konzentration herrscht in den folgenden Industrien.
36 Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte, Spielwaren und sonstige Erzeugnisse
2,5 Punkte
25 Gummi– und Kunststoffwaren
2,5 Punkte
29 Maschinen
2 Punkte
28 Metallerzeugnisse
1 Punkt.
Literaturverzeichnis
Monopolkomission (1998): Hauptgutachten 1996/97: Marktöffnung umfassend verwirklichen, Nr. XII in Hauptgutachten der Monopolkomission. Nomos, Baden-Baden.
Shy, O. (1995): Industrial Organization: Theory and Applications. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
21
Literaturverzeichnis
22
3 Theorie des Monopols
Man sieht empirisch, dass die tatsächlichen Markt- bzw. Industriestrukturen, die in
Deutschland vorherrschen, im großen und ganzen weder zur vollkommenen Konkurrenz
noch zum Monopol gehören, sondern in einem Zwischenbereich liegen, in dem es eine
überschaubare Anzahl von Unternehmen bzw. Anbietern gibt. Bevor wir jedoch diesen
Zwischenbereich des Oligopols näher betrachten, sollen zuerst die beiden Marktformen
der vollkommenen Konkurrenz und des Monopols noch einmal rekapituliert und näher
betrachtet werden.
3.1 Vollständiger Wettbewerb als Referenzpunkt
Im folgenden soll unter einem Wettbewerbsmarkt ein solcher Markt verstanden werden, in dem sich alle Anbieter und Nachfrager als Preisnehmer verhalten, d. h. jeder
Akteur soll davon ausgehen, dass er durch sein Verhalten keinen Einfluss auf den Marktpreis nehmen kann. Hierbei ist zu beachten, dass — wie bereits oben erwähnt — keine
Annahme über die Zahl der Akteure sondern lediglich eine über ihr Verhalten getroffen
wird.
Auf dem betrachteten Markt wird ein homogenes Produkt gehandelt. Der Preis des Produktes sei mit p und die Gesamtmenge des Produktes mit Y bezeichnet. Die aggregierte
Preis-Absatz-Funktion (bzw. inverse Nachfragefunktion) ist linear und gegeben durch
p(Y ) = a − bY,
mit a, b > 0.
Angenommen, es gibt auf diesem Markt zwei Unternehmen, die Unternehmen 1 und
2, die dieses homogene Produkt herstellen. Die von Unternehmen i hergestellte Menge
wird mit yi bezeichnet und die Kostenfunktion des Unternehmens i ist Ci (yi ). Im ersten
Schritt werden wir annehmen, dass die Technologie der Unternehmen durch konstante
Skalenerträge gekennzeichnet ist. In diesem Fall können die Kostenfunktionen geschrieben werden als
Ci (yi ) = ci yi
, i = 1, 2 mit c2 ≥ c1 ≥ 0.
In diesem Fall sind für beide Unternehmen die Grenzkosten und die Durchschnittskosten
gleich ci , d. h.
M Ci (yi ) = ACi (yi ) = ci ,
für alle yi .
Die Nachfrage und die Stückkosten für beide Unternehmen können dargestellt werden
wie in Abbildung 1.1 gezeigt.
23
3 Theorie des Monopols
c1 ,c2 ,p
c2
c1
y
Abbildung 1.1: Nachfragefunktion und Stückkosten
Ein Wettbewerbsgleichgewicht auf diesem Markt ist definiert durch eine Outputmenge yi∗ für jede Firma i und einen Preis p∗ derart, dass
1. jede Firma den bei diesem Preis gewinnmaximalen Output wählt;
2. bei diesem Preis die angebotene Menge gleich der nachgefragten Menge ist.
Definition 4 Der Vektor (p∗ , y1∗ , y2∗ ), mit p∗ , y1∗ , y2∗ ≥ 0 heißt Wettbewerbsgleichgewicht, wenn
1. für gegebenes p∗ die Menge yi∗ das Optimierungsproblem
max π( yi ) = p∗ yi − Ci (yi ),
yi
i = 1, 2
löst und
2. p∗ = a − b (y1∗ + y2∗ ) gilt.
Betrachten wir nun das Gleichgewicht für den Fall konstanter Skalenerträge.
Zuerst müssen die Angebotsfunktionen der beiden Firmen ermittelt werden.
Lemma 1 Die Angebotsfunktionen sind gegeben durch:
falls p < ci
0
∗
[0, ∞) falls p = ci
yi =
∞
falls p > ci
Der Beweis ist offensichtlich: Liegt der Preis unterhalb der Stückkosten, ist es für das
Unternehmen am besten, die Produktion einzustellen. Ist der Preis pro Stück größer als
die Stückkosten, dann sollte das Unternehmen eine unendlich große Menge herstellen.
24
3.1 Vollständiger Wettbewerb als Referenzpunkt
Bei Preis gleich Stückkosten ist die angebotene Menge unbestimmt — egal, wie viel
hergestellt wird, der Gewinn ist immer der gleiche, nämlich 0.
Offensichtlich sind Preise mit p > c2 bzw. mit p < c1 nicht mit einem Gleichgewicht
vereinbar. Im ersten Fall wäre das Angebot unendlich groß, aber die Nachfrage immer
endlich, im zweiten Fall wäre das Angebot gleich 0, aber die Nachfrage positiv. Aber
auch für Preise p > c1 ist das Angebot (des Unternehmens 1) unendlich, die Nachfrage
jedoch endlich. Der einzige Preis, mit dem ein Gleichgewicht vereinbar wäre, ist p∗ = c1 .
Theorem 2 Ist a > c2 ≥ c1 dann ist der einzige Gleichgewichtspreis p∗ = c1 und
1. falls c2 > c1 , y2∗ = 0 und y1∗ = (a − c1 )/b;
2. falls c1 = c2 , Y ∗ = y1∗ + y2∗ = (a − c1 )/b.
Ist a < c1 , so ist jeder Preis p, für den gilt a ≤ p ≤ c1 ein Gleichgewichtspreis, bei dem
sowohl Angebot als auch Nachfrage null sind. Dies ist allerdings ein degenerierter Fall
eines Gleichgewichts.
Bei Preisen niedriger als a wäre das Angebot null aber die Nachfrage positiv, während
bei preisen oberhalb von c1 das Angebot ∞ einer nachfrage von null gegenüber stände;
in beiden Fällen läge also kein Gleichgewicht vor.
Zunehmende Skalenerträge Betrachten wir nun die Situation, in der die Unternehmen
durch Technologien mit zunehmenden Skalenerträgen gekennzeichnet sind. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass es nur ein Unternehmen gibt, dessen Kostenfunktion gegeben
ist durch
F + cy falls y > 0
.
C(y) =
0
falls y = 0
Die Grenzkosten M C(y) = c und die Durchschnittskosten AC(y) = F/y + c sind in
Abbildung 1.2 grafisch dargestellt.
Theorem 3 Wenn die Technologien der Unternehmen durch zunehmende Skalenerträge gekennzeichnet sind, dann existiert kein Wettbewerbsgleichgewicht.
Beweis: Angenommen, es existiert ein Wettbewerbsgleichgewicht. Für den Gleichgewichtspreis pe muss gelten pe ≤ c oder pe > c.
Angenommen, der erste Fall liegt vor. Dann gilt auch pe < F/y + c = AC(y) für alle
y > 0. In diesem Fall würde das Unternehmen nichts produzieren, da es sonst Verluste
machen würde. Dies könnte aber keine Gleichgewichtsmenge sein, denn für diese Preise
ist die Nachfrage positiv.
25
3 Theorie des Monopols
p
pe2
pe1
y
Abbildung 1.2: Grenz– und Durchschnittskosten: zunehmende Skalenerträge
Angenommen, wir befinden uns im zweiten Fall. In diesem Fall gilt pe > F/y+c = AC(y)
für Werte von y, die ein bestimmtes Niveau überschreiten. Der Gewinn pro Outputeinheit
wächst mit y. Dies impliziert, dass das Unternehmen den Output y e = ∞ wählen wird.
Dies kann aber kein Gleichgewicht sein, da die nachgefragte Menge immer endlich ist.
Grenzkostenpreise und Wohlfahrt Im folgenden soll kurz auf die Wohlfahrtseigenschaften eines Wettbewerbsgleichgewichts eingegangen werden. Hierzu wird das Konzept
der Konsumentenrente eingeführt.
Das Konzept der Konsumentenrente kann man wie folgt erläutern: Die Nachfragefunktion misst ja die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten: Für die erste Einheit gibt es
einen Konsumenten, der bereit ist einen recht hohen Preis zu zahlen. Bei einem gegebenen Marktpreis muss dieser Konsument (und auch die anderen, die eine höhere
Zahlungsbereitschaft als den Marktpreis haben) jedoch nur den Marktpreis zahlen. Die
Differenz zwischen seiner Zahlungsbereitschaft und dem Preis der tatsächlich gezahlt
werden muss, ist seine Konsumentenrente. Die gesamte Konsumentenrente ergibt sich
dann, indem man die der einzelnen Konsumenten addiert.
Grafisch ergibt sich die Konsumentenrente als die Fläche unter der Preis-Absatz-Funktion
und oberhalb des Preises. Sie ist in Abbildung 1.3 für zwei Preise als blau bzw. rot schraffierte Fläche illustriert.
Offensichtlich nimmt die Konsumentenrente zu, wenn der Preis sinkt; wir können also
schreiben CS(p) (CS für consumer surplus).
26
3.1 Vollständiger Wettbewerb als Referenzpunkt
p
p1
p2
y
Abbildung 1.3: Konsumentenrente
Definition 5 Sei p der Marktpreis und sei die Zahl der Unternehmen auf dem
betrachteten Markt durch N ≥ 1 gegeben. Die Wohlfahrt ist definiert durch
W (p) = CS(p) +
N
X
πi (p),
i=1
wobei πi (p) der Gewinn des Unternehmens i beim Preis p ist.
In die Wohlfahrt gehen also sowohl die Konsumentenrente als auch die Gewinne der
Unternehmen ein.
Im folgenden soll gezeigt werden, dass die hergestellte und konsumierte Menge des Gutes
die Wohlfahrt maximiert, wenn der Marktpreis gleich den Grenzkosten der Unternehmen
ist, die das Gut produzieren.
Betrachten wir hierzu noch einmal die inverse Nachfragefunktion und einen Marktpreis
p0 . In diesem Fall ist die Konsumentenrente gleich dem in Abbildung 1.4 eingezeichneten
Dreieck α.
Die Produzentenrente ist hier durch die Fläche zwischen dem Marktpreis und den Stückkosten für die Menge y0 gegeben, bezeichnet durch die Fläche β. Die Wohlfahrt ist hier
also gegeben durch α + β.
Man beachte, dass die Fläche γ nicht in die Wohlfahrt eingeht. Dies ist der sogenannte
Wohlfahrtsverlust oder deadweight loss, der mit Preisen oberhalb der Grenzkosten
verbunden ist.
Man sieht, dass bei einem Preis p = c die gesamte Wohlfahrt maximiert wird. Zwar ist
hier die Produzentenrente gleich 0, aber die Zunahme an Konsumentenrente ist größer
als die Einbuße an der Produzentenrente.
27
3 Theorie des Monopols
p
α
p0
β
c
γ
y
y0
Abbildung 1.4: Maximale Konsumentenrente bei p = c.
Bei Preisen unterhalb der Grenzkosten würde eine Erhöhung des Preises zu einer Vergrößerung der Produzentenrente führen, die die Verringerung an Konsumentenrente
überkompensiert.
3.2 Das Einprodukt–Monopol
Im folgenden soll kurz die Theorie des Monopols rekapituliert und in einige Richtungen
erweitert werden. Bei einem Monopol handelt es sich um einen Anbieter, der sich der
gesamten Marktnachfrage gegenübersieht. Der Monopolist kann also beliebige Punkte
auf der Nachfragefunktion bzw. der Preis-Absatz-Funktion realisieren. Das Monopol wird
diejenige Menge anbieten, die seinen Gewinn maximiert.
Wir hatten gesehen, dass die Technologie, die dem Monopol zur Verfügung steht, auch
durch die Kostenfunktion C(y) ausgedrückt werden kann. Die Preis-Absatz-Funktion ist
durch p(y) bezeichnet. Der Erlös eines Monopols ist dann gegeben durch R(y) = p(y)y.
Das Gewinnmaximierungsproblem des Monopols ist
max π(y) = R(y) − C(y).
y
Die notwendige Bedingung für ein Gewinnmaximum ist
dπ(y)
dR(y) dC(y)
=
−
= 0.
dy
dy
dy
Bezeichnet man die Ableitung des Erlöses mit M R(y) und die Grenzkosten mit M C(y),
dann ist die Bedingung erster Ordnung für ein Gewinnmaximum also
(3.1) M R(y) = M C(y),
28
3.2 Das Einprodukt–Monopol
wobei gilt
M R(y) =
d (p(y)y)
dp(y)
=
y + p(y).
dy
dy
Aus Bedingung (3.1 können wir den gewinnmaximalen Output y m berechnen. Den resultierenden Preis findet man, indem man diese Menge in die Preis-Absatz-Funktion
einsetzt. Analog erhält man die Kosten, indem man y m in die Kostenfunktion einsetzt.
Schließlich sind noch diese ermittelten Größen in die Gewinngleichung einzusetzen. Ist
der Gewinn positiv, dann ist die Menge y m die Lösung des Gewinnmaximierungsproblems. Ist der Gewinn kleiner als 0, dann sollte das Unternehmen die Produktion einstellen.
Diese beiden Situationen sind in Abbildung 2.5 grafisch dargestellt.
p
p
pm
y
ym
y
Abbildung 2.5: Monopolgleichgewichte
Im linken Diagram produziert das Monopol die Menge y m , während im rechten Diagramm die Nachfrage so gering bzw. die Kosten so hoch sind, dass keine Produktion
stattfindet, d. h. y m = 0. Entscheidend ist die rot eingezeichnete Kurve, auf der diejenigen Preis-Mengen-Kombinationen liegen, für die das unternehmen einen Gewinn von
null macht.
Für die Preis-Absatz-Funktion p(y) = a − by und die Kostenfunktion C(y) = F + cy 2
können wir das Problem des Monopolisten explizit lösen.
max(a − by)y − F − cy 2 .
y
Die Bedingung erster Ordnung lautet
a − 2by = 2cy.
Aufgelöst nach y ergibt sich
a
.
ym =
2(b + c)
Der Gleichgewichtspreis pm ist
pm = a − by m =
a(b + 2c)
.
2(b + c)
29
3 Theorie des Monopols
Der Gewinn des Monopolisten ist also:
2
a2 (b + 2c)
a
a2
m
π(y ) =
−
F
−
c
=
− F.
4(b + c)2
2(b + c)
4(b + c)
Zusammenfassend können wir also feststellen:
(
a2
a
falls F ≤ 4(b+c)
m
2(b+c)
y =
0
sonst.
Monopol und Wohlfahrt Monopole werden im allgemeinen als eine Marktform betrachtet, die dazu geeignet ist, die Wohlfahrt in einer Ökonomie bzw. in einem Markt
im Vergleich zu anderen Marktformen zu verringern. Aus diesem Grund werden häufig
staatliche Maßnahmen ergriffen, um Monopole zu verhindern oder zu regulieren.
Betrachten wir hierzu das übliche Argument, das gegen Monopole ins Feld geführt wird.
Dies kann man sich anhand der Grafik in Abbildung 2.6 verdeutlichen.
p
p
pm
pc
ym
y
,
yc
y
Abbildung 2.6: Wohlfahrt im Monopol– und im Wettbewerbsgleichgewicht
In der linken Grafik sehen wir das Monopolgleichgewicht zusammen mit der Konsumentenrente und der Produzentenrente. Hier gibt es einen Wohlfahrtsverlust bzw. einen
deadweight loss in Höhe der Fläche des weißen Dreiecks.
Die rechte Grafik zeigt den Fall der vollkommenen Konkurrenz mit einem Preis gleich
den Grenzkosten. Hier tritt kein Wohlfahrtsverlust auf.
Zusätzlich wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass die sozialen Kosten, die mit
einem Monopol verbunden sind, bedeutend höher sein können als der deadweight loss.
Es wurde darauf hingewiesen, dass das Bestreben, einen Monopolgewinn zu erhalten
selbst eine ökonomische Aktivität ist, die Ressourcen verbraucht. Unternehmen, die eine
Monopolstellung erlangen oder erhalten möchten, werden Ressourcen hierzu aufwenden.
Hierzu gehören u.a. die folgenden Aktivitäten:
1. Werbung, die nur dem Zweck dient, andere Marken schlecht zu machen.
2. Ressourcen, die verwendet werden, um potentielle Konkurrenten vom Markteintritt abzuschrecken. Hierzu gehört auch eine Überinvestition in Kapital, um den
Markteintritt für potentielle Konkurrenten unprofitabel zu machen.
30
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise
3. Lobbykosten, die aufgewendet werden um den Gesetzgeber davon zu überzeugen,
dass ein bestimmtes Monopol nicht wohlfahrtsmindernd ist.
4. Exzessive Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufgrund eines Patentrennens.
Nicht zu solchen Aufwendungen gehören aber die folgenden:
1. Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die zu einem Patent führen, da hierdurch verbesserte Technologien und neue Produkte resultieren.
2. Bestechungsgelder an Politiker und Beamte, um exklusive Rechte zu erlangen – es
handelt sich hier nur um einen Transfer von Vermögen.
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise
Bisher wurde davon ausgegangen, dass der Monopolist von jedem Konsumenten den gleichen Preis verlangt. Es ist jedoch häufig so, dass durch Preisdiskriminierung der Gewinn
des Monopols erhöht werden kann. Preisdiskriminierung bedeutet, dass ein Unternehmen in der Lage ist, von verschiedenen Konsumenten verschiedene Preise für das gleich
Produkt zu verlangen. Konsumenten unterscheiden sich ja u.a. nach Alter, Einkommen,
Geschmack, Wohnort etc. Um aber unterschiedliche Preise verlangen zu können, muss
das Monopol in der Lage sein, Arbitragegeschäfte auszuschließen. Bei einem Arbitragegeschäft würde ein Konsument das Produkt zu einem günstigen Preis einkaufen und
es zu einem höheren Preis an einen anderen Konsumenten wieder verkaufen, der direkt
vom Monopolisten nur zu einem hohen Preis kaufen könnte.
Beispiele für preisdiskriminierendes Verhalten bei dem solche Arbitragegeschäfte relativ
leicht auszuschließen sind, sind u.a. die folgenden.
• Unternehmen verlangen unterschiedliche Preise an unterschiedlichen Orten; diese
Orte müssen durch die Geographie, hohe Steuern (Zölle) oder Transportkosten
getrennt sein.
• Dienstleistungsanbieter verlangen unterschiedliche Preise für verschiedene Altersgruppen (z. B. Seniorenkarte, Schülermonatskarte, die man nur unter Vorlage des
entsprechenden Ausweises erhält).
• Preisvergünstigungen für verschiedene soziale Gruppen (Studententarife).
• Preise für z. B. Zeitschriften sind für Bibliotheken höher als für Individuen.
Im weiteren wird davon ausgegangen, dass ein Monopol in der Lage ist, Arbitragegeschäfte auszuschließen. Wir untersuchen den Fall, in dem ein Monopol ein Produkt
auf zwei getrennten Märkten verkauft.
In den beiden Grafiken in Abbildung 3.7 sind die Nachfragesituationen auf den beiden Märkten dargestellt. Welche Mengen sollte der Monopolist auf den beiden Märkten
anbieten?
31
3 Theorie des Monopols
p1
p2
p1 (y1 )
MR
p2 (y2 )
2
)
(y 2
M R1 (y1 )
y1
y2
(a) Markt 1
(b) Markt 2
Abbildung 3.7: Nachfrage auf zwei getrennten Märkten
Formal lautet das Problem des Monopolisten
max π(y1 , y2 ) = R1 (y1 ) + R2 (y2 ) − C(y1 + y2 ).
y1 ,y2
Die Bedingungen erster Ordnung sind
∂π(y1 , y2 )
= M Ri (yi ) − M C(y1 + y2 ),
∂yi
i = 1, 2.
Der preisdiskriminierende Monopolist setzt also M R1 (y1m ) = M R2 (y2m ) = M C(y1m +y2m ),
d. h. auf beiden Märkten wird der Grenzerlös gleich den Grenzkosten gesetzt. Grafisch
ist diese Situation in Abbildung 3.8 dargestellt.
p1
p2
pm
1
pm
2
c
c
y1m
(a) Markt 1
y1
y2m
y2
(b) Markt 2
Abbildung 3.8: Preisdiskriminierung 3. Grades (1)
Die ökonomische Intuition ist die folgende: Wären die Mengen y1 und y2 so gewählt, dass
M R1 (y1 ) > M R2 (y2 ) gilt, dann könnte der Monopolist eine Einheit seines Outputs vom
Markt 2 zu Markt 1 transferieren und dadurch seinen Erlös steigern. Dadurch würde
natürlich auch sein Gewinn steigen, da die gesamte produzierte Menge gleich bleibt.
Wäre andererseits M R1 (y1 ) = M R2 (y2 ) aber M R1 (y1 ) 6= M C(y1 + y2 ), dann könnte
der Gewinn gesteigert werden, indem eine zusätzliche Einheit hergestellt und verkauft
32
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise
wird, nämlich dann, wenn die Grenzkosten geringer sind als der Grenzerlös, bzw. im
Falle, dass die Grenzkosten höher als der Grenzerlös sind, indem eine Einheit weniger
hergestellt und verkauft wird.
Um die gewinnmaximalen Outputniveaus zu ermitteln, sind zwei Gleichungen mit zwei
Unbekannten zu lösen. Allerdings kann man das Problem wie in Abbildung 3.9 dargestellt
auch grafisch lösen: Man betrachte den Schnittpunkt der Grenzkostenfunktion mit der
Grenzerlösfunktion auf dem Gesamtmarkt. Hierdurch kann man den gesamten Output
y m = y1m + y2m ermitteln. Nun betrachtet man eine Horizontale und die entsprechenden
Schnittpunkte mit den Grenzerlösfunktionen M R1 und M R2 . Hieraus ergeben sich die
Outputniveaus für die beiden Einzelmärkte.
p1
p2
p
pm
1
pm
2
c
c
y1
y1m
c
y2m
(a) Markt 1
y2
y1m + y2m
(b) Markt 2
y
(c) Gesamtmarkt
Abbildung 3.9: Preisdiskriminierung 3. Grades (2) — grafisch
Um nun noch die Preise auf den beiden Märkten zu bestimmen, muss man nur noch
jeweils den Wert der Preis-Absatz-Funktion für die Mengen y1m und y2m ablesen und
m
erhält so die Preise pm
1 und p2 .
Schließlich kann man noch die Summe der Gewinne, die das Unternehmen auf den beiden
getrennten Märkten macht, mit dem Gewinn vergleichen, der sich ergäbe, wenn es den
uniformen Monopolpreis pm auf dem Gesamtmarkt setzen würde, der sich aus der Menge
y m = y1m + y2m über die Preis-Absatz-Funktion des Gesamtmarkts ergibt. Grafisch sind
diese Gewinne in Abbildung 3.10 als grau unterlegte Flächen dargestellt.
p1
p2
p
pm
1
p
pm
2
c
c
y1m
(a) Markt 1
y1
c
y2m
(b) Markt 2
y2
y1m + y2m
y
(c) Gesamtmarkt
Abbildung 3.10: Preisdiskriminierung 3. Grades (3) — Gewinnvergleich
33
3 Theorie des Monopols
Zwar ist mit bloßem Auge nicht klar, dass die Summe der Flächen auf den beiden
Einzelmärkten größer ist als die Fläche auf dem Gesamtmarkt, dies ist aber der Fall.
Übungsaufgabe:
Den Grafiken liegen als Preis-Absatz-Funktionen für die beiden Märkte
p1 (y1 ) = 10 − y1
und
p2 (y2 ) = 6 − y2
sowie die Kostenfunktion
C(y) = C (y1 + y2 ) = 2 y
zugrunde. Dafür lässt sich nachrechnen, dass der Gewinn bei Preisdiskriminierung π1 +
π2 = 16 + 4 = 20 beträgt und der Monopolgewinn auf dem Gesamtmarkt nur π = 18.
m
m
(Zwischenergebnisse: y1m = 4, y2m = 2, pm
1 = 6, p2 = 4, p = 5.)
Wie hängen nun die Preise auf den beiden Märkten mit den Preiselastizitäten zusammen?
Wir hatten gesehen, dass der Grenzerlös geschrieben werden kann als:
1
M R(y) = p 1 +
.
ηp (y)
Für die Gleichgewichtspreise gilt also nun:
1
1
m
m
= p2 1 +
.
p1 1 +
η1
η2
m
Daraus folgt pm
2 > p1 wenn η2 > η1 bzw. |η2 | < |η1 |.
Dies kann man in folgendem Theorem zusammenfassen.
Theorem 4 Ein preisdiskriminierender Monopolist wird auf dem Markt mit geringerer Elastizität einen höheren Preis verlangen.
Dies lässt sich auch intuitiv nachvollziehen, geht doch bei niedrigerer Preiselastizität
der Nachfrage die Menge, die das Unternehmen bei einem höheren Preis absetzen kann,
weniger stark zurück. Daher wird sich auf diesem Markt eine Preisanhebung noch lohnen,
wenn auf dem Markt mit der höheren Elastizität der für das Unternehmen positive Effekt
höherer Erlöse pro Stück bereits durch den für das Unternehmen negativen Effekt des
Nachfragerückgangs überkompensiert wird.
Andere Arten der Preisdiskriminierung Diese Art der Preisdiskriminierung (zwischen
zwei getrennten Märkten) wird in der Literatur häufig als Preisdiskriminierung dritten Grades bezeichnet. Daneben gibt es aber auch noch andere Formen der Preisdiskriminierung: die Preisdiskriminierung ersten und die zweiten Grades.
Von Preisdiskriminierung ersten Grades oder von vollkommener Preisdiskriminierung spricht man, wenn dem Monopolisten von jedem Konsumenten ein Preis
34
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise
entsprechend seiner maximalen Zahlungsbereitschaft gezahlt wird. In diesem Fall kann
der Monopolist sich die gesamte volkswirtschaftliche Rente aneignen und wird dieselbe
Menge absetzen wie bei vollkommener Konkurrenz auf diesem Markt. Dies ist dargestellt
in Abbildung 3.11.
p
pm
ym
y
Abbildung 3.11: Vollkommene Preisdiskriminierung
Allerdings stellt diese Art der Preisdiskriminierung eine eher theoretische Möglichkeit
dar. Der Monopolist scheint unüberwindlichen Schwierigkeiten gegenüberzustehen: Er
müsste eine Fülle von Informationen haben und Arbitragegeschäfte ausschließen können.
Wenn das Gut nicht weiterverkauft werden kann und der Monopolist die Nachfragefunktion jedes Konsumenten kennt, zeigt sich jedoch, dass es sehr einfache Preissetzungsmechanismen gibt, mit denen eine Preisdiskriminierung ersten Grades erreicht bzw. implementiert werden kann. Ein effektiver Mechanismus ist ein nichtlineares Preisschema
bzw. ein sogenannter Two–part tariff.
Ein solches Schema besteht aus:
1. einer festen Gebühr, z. B. einer Eintrittsgebühr, die es einem Konsumenten ermöglicht, das Gut zu kaufen;
2. einem Preis, den der Konsument pro Einheit des konsumierten Gutes zu zahlen
hat.
Solche Preismechanismen beobachtet man häufig in Vergnügungsparks, wie z. B. Disneyland. Im folgenden wollen wir kurz ein Modell eines solchen Two–part tariffs betrachten
(vgl. Oi (1971)).
Wir nehmen an, dass sich die potentiellen Besucher von Eurodisney in ihrer Nachfrage
nach den angebotenen Leistungen nicht unterscheiden. Die inverse Nachfragefunktion
nach den Leistungen ist gegeben durch
p(y) = a − y.
35
3 Theorie des Monopols
Hier bezeichnet y die Zahl der Nutzungen von z. B. den Fahrgeschäften und a die maximale Zahlungsbereitschaft eines Konsumenten für eine Fahrt. Die Kostenfunktion von
Eurodisney ist
C(y) = F + cy.
Würde Eurodisney sich wie ein normales Monopol verhalten, dann würde Eurodisney
einen Output wählen, der die Bedingung
a − 2y = c
erfüllt, d. h.,
ym =
a−c
.
2
Der Monopolpreis in diesem Fall ist
pm =
a+c
2
und der Bruttogewinn pro Besucher ist
πb (y m ) =
(a − c)2
.
4
Grafisch kann man diese Situation wie in Abbildung 3.12 darstellen.
p
a
a+c
2
c
a−c
2
a
2
a y
Abbildung 3.12: Eurodisney ohne Preisdiskriminierung
Gibt es pro Tag n Besucher in Eurodisney, dann ist der Gewinn des Monopols
π(y m ) = nπb (y m ) − F = n
36
(a − c)2
− F.
4
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise
p
a
a+c
2
c
a−c
2
a
2
a y
Abbildung 3.13: Eurodisney ohne Preisdiskriminierung
Um zu untersuchen, wie Eurodisney seinen Gewinn erhöhen könnte, betrachten wir die
verbleibende Konsumentenrente, die in Abbildung 3.13 durch das hellblau markierte
Gebiet gekennzeichnet ist.
Diese Fläche kann man berechnen als:
1
a+c
(a − c)2
a−c
CS = · a −
=
.
·
2
2
2
8
Diese Konsumentenrente hat sich Eurodisney nicht aneignen können. Wir betrachten
daher ein anderes Preissetzungsschema, einen Two–part tariff. Eurodisney verlangt von
2
und einen Preis pro Fahrt von
jedem Konsumenten ein Eintrittspreis in Höhe von (a−c)
8
a+c
.
Die
Konsumenten
werden
weiterhin
Eurodisney
besuchen,
da ihre Konsumenten2
rente nicht negativ ist. Da der Eintrittspreis unabhängig von der konsumierten Menge an
Fahrten ist, wird jeder Konsument weiterhin dieselbe Anzahl von Fahrten konsumieren.
Dies führt dazu, dass Eurodisney sich die gesamte Konsumentenrente aneignen kann.
2
pro Konsument.
Der Gewinn des Monopols steigt also um (a−c)
8
Allerdings kann der Monopolist einen noch größeren Gewinn machen, indem er den
Preis pro Fahrt reduziert. Dadurch erhöht sich zunächst die Konsumentenrente. Indem
er den Eintrittspreis entsprechend erhöht, kann er sich aber erneut die gesamte Konsumentenrente aneignen und dadurch insgesamt seinen Gewinn erhöhen. Der optimale
Two–part tariff ist derjenige, der zunächst die Gesamtrente maximiert und dann über
den Eintrittspreis dafür sorgt, dass der Monopolist sich die komplette Rente aneignet.
Da wir bereits gesehen hatten, dass die Gesamtrente maximiert wird, wenn der Preis den
Grenzkosten des Unternehmens entspricht, ist damit klar, wie der optimale Two–part
tariff gestaltet werden muss. Dieser ist in Abbildung 3.14 grafisch illustriert.
1. Der Preis pro Fahrt wird gleich den Grenzkosten c gesetzt;
2. Bei diesem Preis ist die Konsumentenrente durch die hellblau eingefärbte Fläche
37
3 Theorie des Monopols
p
a
p =c
a y
−c
Abbildung 3.14: Optimaler Two–part tariff für Eurodisney
aa
2
gegeben; sie beträgt
(a − c)2
1
.
CS = (a − c)(a − c) =
2
2
Unter diesem Preisschema ist der Gewinn pro Fahrt gleich 0, da der Preis gleich den
2
(konstanten) Grenzkosten ist. Der Bruttogewinn ist gleich n (a−c)
; der Gewinn ist also
2
(a − c)2
− F.
π =n
2
∗
Man beachte, dass jeder Konsument die gleiche Menge an Fahrten kauft wie bei vollkommenem Wettbewerb. Hieran sieht man, dass ein vollständig preisdiskriminierender
Monopolist die Wettbewerbsmenge anbietet.
Eine andere Eigenschaft des two–part tariffs ist die folgende: Die Gesamtausgaben eines
Konsumenten setzen sich aus dem Eintrittspreis und den Ausgaben für die Fahrten
zusammen, d. h.,
(a − c)2
(a − c)
(a − c)
+ c(a − c) =
(a − c + 2c) =
(a + c).
2
2
2
Die Gesamtmenge an Fahrten, die von einem Konsumenten gekauft werden, ist a−c. Der
durchschnittliche Preis pro Fahrt ist also (a + c)/2. Dies entspricht dem Monopolpreis
p(y m ).
Betrachtet man als ein numerisches Beispiel etwa a = 10 und c = 2, dann ergeben
sich als optimale Menge und als optimaler Preis bei einem normalen Monopol 4 und 6.
Eurodisney macht dann einen Gewinn von (6 − 2)4 = 16 pro Besucher.
Würde das Monopol jedoch den optimalen Two–part tariff wählen, dann ergäbe sich
eine Eintrittsgebühr von 32 und ein Verkaufspreis von 2 pro Fahrt. Jeder Konsument
38
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise
macht 8 Fahrten und bezahlt insgesamt 48, d. h. 6 im Durchschnitt. In diesem Fall macht
Eurodisney einen Gewinn von 32 pro Besucher.
Man kann sich nun leicht überlegen, dass Two–part tariffs auch dann angewendet werden kann, wenn sich die Konsumenten unterscheiden. Voraussetzung ist hier natürlich
auch, dass Arbitragegeschäfte zwischen unterschiedlichen Gruppen von Konsumenten
ausgeschlossen werden, z. B. durch Alter (Seniorenpreis), soziale Gruppe (Studentenpreis) oder z. B. Geschlecht (unterschiedliche Eintrittspreise für Männer und Frauen in
einer Diskothek).
Angenommen, der Monopolist weiß, dass eine Gruppe der Konsumenten (die alten) die
Preis-Absatz-Funktion hat
pa (ya ) = 16 − ya ,
während die andere (die jungen) die Preis-Absatz-Funktion von
pj (yj ) = 12 − yj
hat. Die Grenzkosten des Monopols, z. B. die Kosten pro Getränk in einer Diskothek
sind 4.
Bei einem Preis von 4 werden die älteren Konsumenten 12 Getränke konsumieren und
eine Konsumentenrente von 72 bekommen. Dies kann man an der folgenden Grafik sehen.
p
16
p
12
72
32
4
4
12
16
y
,
8
12
y
Abbildung 3.15: Konsumentenrente der verschiedenen Nachfragergruppen
Die Jungen werden 8 Getränke konsumieren und eine Konsumentenrente in Höhe von
32 erhalten.
Der Eigentümer kann sich diese Konsumentenrenten aneignen, indem er entsprechende
Eintrittspreise verlangt und einen Preis pro Getränk in Höhe der Grenzkosten ansetzt.
Dies kann er durchsetzen, indem er z. B. am Eingang einen Altersnachweis verlangt.
Ein Problem besteht jedoch dann, wenn das relevante Kriterium, nach dem sich die
Konsumenten unterscheiden, für den Monopolisten nicht beobachtbar ist.
An diesem Punkt setzt die Preisdiskriminierung zweiten Grades an.
Angenommen, das relevante Kriterium, nach dem sich zwei Gruppen von Konsumenten unterscheiden, ist nicht Alter oder Geschlecht, sondern Einkommen. In diesem Fall
könnte der Monopolist keine Preisdiskriminierung ersten Grades durchführen. Würde
39
3 Theorie des Monopols
er von den Konsumenten Eintrittspreise von 72 bzw. 32 verlangen, dann würde dies
nicht funktionieren: Jeder Konsument würde behaupten, nur ein niedriges Einkommen
zu haben und daher nur den geringen Eintrittspreis zahlen wollen.
Der Monopolist könnte natürlich nur einen Eintrittspreis von 72 fordern und damit effektiv alle Bezieher niedriger Einkommen ausschließen. Angenommen, es gibt Nh Konsumenten mit hohem Einkommen und Nn Konsumenten mit niedrigem Einkommen, dann
wäre der Gewinn bei einem hohen Eintrittspreis Nh 72. Bei einem niedrigen Eintrittspreis
wäre er (Nh + Nn )32. Die letztere Strategie wäre profitabel, wenn 32Nn > 40Nh ist.
Anders ausgedrückt: Wenn das Verhältnis zwischen Konsumenten mit niedrigem und
hohem Einkommen größer ist als 1, 25 : 1, dann führt die restriktive Politik eines hohen
Eintrittspreises zu einem niedrigeren Gewinn für den Monopolisten.
Es gibt jedoch eine Alternative zu einem einheitlichen Preis, die als Preisdiskriminierung
zweiten Grades bekannt ist. Die Idee ist die folgende: Der Monopolist weiß, dass es zwei
Gruppen von Konsumenten gibt, die er nicht unterscheiden kann. Er konstruiert daher
ein Preisschema, das dazu führt, dass die Konsumenten durch ihre Entscheidung ihren
Typ enthüllen.
Das typische Beispiel für Preisdiskriminierung zweiten Grades ist ein Mengenrabatt für
bestimmte Gruppen von Konsumenten. Betrachten wir wieder unser numerisches Beispiel: Die Konsumenten mit hohem Einkommen haben die Preis-Absatz-Funktion
ph (yh ) = 16 − yh ,
die anderen, mit niedrigem Einkommen die Preis-Absatz-Funktion
pn (yn ) = 12 − yn .
Man könnte sich vorstellen, dass der Besitzer der Diskothek eine Preisdiskriminierung
ersten Grades in der folgenden Weise versucht: Er vergibt Getränkemarken, die einem
Konsumenten erlauben, Getränke zu kaufen; wer den niedrigen Eintrittspreis (32) zahlt,
erhält acht, wer den hohen Eintrittspreis (72) zahlt, erhält zwölf Getränkebons.
Dieser Mechanismus wird jedoch nicht funktionieren: Jemand mit hohem Einkommen
wird den niedrigen Eintrittspreis von 32 zahlen und acht Getränke á 4 kaufen, d. h.,
insgesamt 64 zahlen. Seine Zahlungsbereitschaft für acht Getränke ist jedoch 96. Aus
diesem Verhalten resultiert also eine Konsumentenrente von 32.
Würden er hingegen den hohen Eintrittspreis zahlen und 12 Getränke kaufen, dann wäre
die Gesamtzahlung 120 und die Konsumentenrente wäre 0. Die Konsumenten mit hohem
Einkommen wären also besser dran, den niedrigen Eintrittspreis zu zahlen und nur acht
Getränke zu konsumieren.
Ein besserer Mechanismus besteht darin, ein Paket aus dem Eintrittspreis und einer
Anzahl von Getränken in der folgenden Weise zu schnüren. Beginnen wir mit den Konsumenten mit niedrigem Einkommen. Der Besitzer weiß, dass diese Konsumenten insgesamt bereit sind, 64 für den Eintritt und acht Getränke zu zahlen. Er verlangt also für
ein Paket, bestehend aus dem Eintrittspreis und acht Getränken den Preis von 64. Aber
auch Konsumenten mit hohem Einkommen wären bereit, dieses Paket zu kaufen, denn
ihre Zahlungsbereitschaft für den Eintritt und acht Getränke liegt bei 96.
40
3.3 Preisdiskriminierung und nichtlineare Preise
Außerdem würden sie so noch eine Konsumentenrente von 32 erhalten. Der Gewinn des
Besitzers beträgt 32 pro verkauftem Paket.
Der Besitzer weiß, dass die Konsumenten mit hohem Einkommen bereit sind, 120 für
den Eintritt und zwölf Getränke zu zahlen. Wenn er jedoch versuchen würde, ein Paket
(120, zwölf Getränke) zu verkaufen, würden diese Konsumenten lieber das Paket (64,
acht Getränke) nehmen. Er muss daher ein zweites Paket konstruieren, das anreizkompatibel ist, d. h. derart, dass es für die Konsumenten mit hohem Einkommen keinen
Anreiz gibt, statt dieses Pakets das für die Konsumenten mit niedrigem Einkommen
vorgesehene Paket zu kaufen.
Der Besitzer müsste daher ein Angebot machen, das dem Konsumenten mit hohem
Einkommen ebenfalls eine Konsumentenrente von 32 garantiert. Er könnte das folgende
Paket anbieten. Eintritt und zwölf Getränke zum Preis von 120 - 32 = 88. Das würde
von den Konsumenten mit hohem Einkommen gekauft werden, aber nicht von denen
mit geringem Einkommen, denn deren Zahlungsbereitschaft beträgt ja nur 72. Diese
beiden Pakete führen dazu, dass sich die beiden Gruppen durch ihre Entscheidung selbst
sortieren. Man spricht hier von einer Selbstselektion.
Der Gewinn, den der Besitzer macht beträgt 32 für jedes Paket (64, acht Getränke) und
40 für jedes Paket (88, zwölf Getränke). Er konnte sich also die gesamte Konsumentenrente der Konsumenten mit niedrigem Einkommen und – bis auf 32 – die Konsumentenrente derjenigen mit hohem Einkommen aneignen. Diese 32 sind gewissermaßen der
‘ Preis‘ den der Monopolist zahlen muss, um die Anreizkompatibilität sicher zu stellen.
’
Ein weiteres Merkmal dieses Two–part tariffs ist das folgende: die Konsumenten mit niedrigem Einkommen zahlen im Schnitt 8 pro Getränk, während die mit hohem Einkommen
7.33 pro Getränk zahlen. Die letzteren erhalten also einen Mengenrabatt. Hieran sieht
man, dass Mengenrabatte nicht nur auf zunehmende Skalenerträge zurückgeführt werden
können. Bei F = 0 hat unsere Diskothek keine zunehmenden Skalenerträge — trotzdem
ist ein Mengenrabatt für die Konsumenten mit hohem Einkommen vorteilhaft für den
Besitzer.
Eine andere Eigenschaft der Preisdiskriminierung zweiten Grades kann wie folgt illustriert werden. Angenommen, der Besitzer bietet ein Paket für die Konsumenten mit
niedrigem Einkommen an, das nur noch den Konsum von sieben Getränken erlaubt. Die
maximale Zahlungsbereitschaft dieser Konsumenten wäre 59.50. In diesem Fall wäre der
Gewinn pro Paket (59.50, sieben Getränke) 31.50. Aber betrachten wir nun die Konsumenten mit hohem Einkommen. Ihre maximale Zahlungsbereitschaft für sieben Getränke
ist 87.50. Würden sie dieses Paket kaufen, dann erhielten sie eine Konsumentenrente
von 28. Daher kann der Besitzer den Preis für das Paket (Eintritt, zwölf Getränke) auf
120 − 28 = 92 erhöhen. Er bekommt dann einen Gewinn von 44 pro Paket.
Man sieht hier die Bedeutung der Anreizkompatibilitätsbeschränkung: Ein Paket, das
für Konsumenten mit niedrigem Einkommen attraktiv ist, beschränkt die Möglichkeiten,
sich Konsumentenrente von den Konsumenten mit hohem Einkommen anzueignen. Das
liegt daran, dass diese Konsumenten nicht gehindert werden können, das andere Paket
zu kaufen und etwas an Konsumentenrente zu realisieren.
Es kann sogar der Fall eintreten, dass der Besitzer sich entschließt, die Konsumenten mit
niedrigem Einkommen überhaupt nicht zu bedienen. Angenommen, es gibt Nh Konsu-
41
3 Theorie des Monopols
menten mit hohem und Nn Konsumenten mit niedrigem Einkommen und der Besitzer
bietet zwei Pakete an: (59.50, sieben Getränke) und (92, zwölf Getränke). Aus dem ersten Paket macht er einen Gewinn von Nn 31.50. Würde er nur die Konsumenten mit
hohem Einkommen attrahieren wollen, würde er ein Paket mit (120, zwölf Getränke)
anbieten. Will er jedoch beide Gruppen bedienen, dann muss er den Preis des letzteren
Paketes um 28 senken. Die Kosten, beide Gruppen zu versorgen betragen also Nh · 28.
Es lohnt sich also nur, beide Gruppen zu versorgen, wenn 31.50 · Nn > 28 · Nh , d. h.
Nh /Nn > 1.125.
Dieses Beispiel deutet auf eine Anzahl grundlegender Prinzipien hin, die bei der Preisdiskriminierung zweiten Grades zum Tragen kommen.
1. Die gesamte Konsumentenrente der Konsumenten mit der geringen Nachfrage wird
abgeschöpft, aber die Konsumenten mit hoher Nachfrage erhalten einen Teil ihrer
Konsumentenrente;
2. alle Konsumenten bis auf die mit der höchsten Nachfrage erhalten eine geringere
Menge als die effiziente;
3. die Pakete enthalten einen Mengenrabatt für die Konsumenten mit der höchsten
Nachfrage.
3.4 Dauerhafte Güter
Ein Monopolist, der ein dauerhaftes Gut herstellt, wird sich im allgemeinen anders verhalten, als ein Monopolist, der ein Gut produziert, das nur für eine Periode genutzt
werden kann. Auf diese Tatsache hat Ronald Coase im Jahre 1972 aufmerksam gemacht
(Coase, 1972). Er betrachtet den Extremfall, in dem jemand das gesamte Land in der
Welt besitzt und es für den größten abdiskontierten Gewinn verkaufen möchte.
Wäre Land ein Gut wie die, die wir bislang untersucht haben, dann würde das Monopol
nicht das gesamte Land verkaufen, sondern, da die Grenzkosten der Produktion gleich 0
sind, genau die Hälfte des vorhandenen Landes. Da Land jedoch ein dauerhaftes Gut ist,
besitzt der Monopolist wenn er die Hälfte des Landes verkauft in der nächsten Periode
immer noch die andere Hälfte des Landes.
Es gibt keinen Grund, warum der Monopolist nun diese verbleibende Hälfte des Landes
nicht in der nächsten Periode verkaufen sollte. Da jedoch die Nachfrage in der nächsten
Periode geringer sein wird als heute, wird auch der Monopolpreis in der nächsten Periode
niedriger sein, als der Monopolpreis heute.
Wenn das aber der Fall ist, dann würden diejenigen Konsumenten, die die Zukunft nicht
allzu stark diskontieren, eine Periode warten, um das Land in der nächsten Periode
zu einem günstigeren Preis erwerben zu können. Daher ist die Nachfrage, der sich der
Monopolist heute gegenübersieht geringer, als die Nachfrage eines Monopolisten, der ein
nicht dauerhaftes Gut herstellt.
Coase hat in seinem Artikel auch noch den Fall positiver Produktionskosten betrachtet
und kam auch für diesen Fall zu dem Ergebnis, dass der Monopolist, der ein dauerhaf-
42
3.4 Dauerhafte Güter
tes Gut verkauft, sich genauso verhalten wird wie ein Unternehmen bei vollkommener
Konkurrenz.
Diese Überlegungen können wir mit Hilfe eines einfachen Modells formalisieren.
Betrachten wir ein Monopol, das mit konstanten Grenzkosten in Höhe von 0 < c < 1
ein dauerhaftes Gut produziert, das eine unendliche Lebensdauer hat. Wir betrachten
allerdings nur zwei Perioden, 1 (heute) und 2 (morgen) in denen der Monopolist das Gut
zu Preisen p1 und p2 verkaufen kann.
Betrachten wir ein Kontinuum von Konsumenten, mit der Gesamtmasse 1, die verschiedene Zahlungsbereitschaften für die Leistungen eines dauerhaften Konsumgutes haben.
Die Zahlungsbereitschaft sei mit v bezeichnet und wir nehmen an, dass v auf dem Intervall [0, 1] gleichverteilt ist. Diese Zahlungsbereitschaft gibt die Wertschätzung des Gutes
über die gesamte Nutzungsdauer an, d. h. für die Nutzung vom Moment des Kaufs an,
bis in alle Ewigkeit. Damit unterscheiden sich die Zahlungsbereitschaft in der Periode 1
und die in der Periode 2 nicht voneinander.
Allerdings gehen wir davon aus, dass sowohl der Monopolist als auch die Konsumenten
zukünftige Erträge mit dem gleichen Diskontfaktor 0 < δ < 1 diskontieren. Damit ist
der Wert, den es heute für einen Konsumenten mit Zahlungsbereitschaft v hat, das Gut
ab morgen zu besitzen gerade δv.
Die Nachfrage eines Konsumenten kann nun wie folgt hergeleitet werden. Er kann das
Gut entweder in Periode 1 (heute) zum Preis p1 erwerben, oder in Periode 2 (morgen)
zum Preis p2 . Offensichtlich hängt also die Entscheidung eines Konsumenten, das Gut
heute zu kaufen auch von der Erwartung über den morgigen Preis ab. Diesen erwarteten
Preis bezeichnen wir mit pe2 . Es ist klar, dass es sich niemals lohnt, mit dem Kauf bis
morgen zu warten, wenn gilt pe2 > p1 . Es wird daher unterstellt, dass pe2 ≤ p1 ist.
Hat ein Konsument eine Zahlungsbereitschaft in Höhe von v > pe2 dann wird er das Gut
bereits heute kaufen, wenn gilt v − p1 ≥ δ(v − pe2 ) bzw.
v≥
p1 − δpe2
.
1−δ
Den Quotienten kann man auch als Funktion
v̄(p1 , pe2 ) =
p1 − δpe2
1−δ
auffassen.
In der ersten Periode werden nur die Konsumenten das Gut kaufen, deren Zahlungsbereitschaft den Wert v̄(p1 , pe2 ) übersteigt. Diese haben eine hohe Gegenwartspräferenz.
Aus den Annahmen über die Verteilung der Zahlungsbereitschaften folgt, dass die Nachfrage in der ersten Periode geschrieben werden kann als
D1 (p1 , pe2 ) = 1 − v̄(p1 , pe2 ) =
1 − δ − p1 + δpe2
,
1−δ
dies ist gerade die Masse der Konsumenten, deren Zahlungsbereitschaft die Schwelle von
v̄(p1 , pe2 ) übersteigt.
43
3 Theorie des Monopols
Die anderen Konsumenten, d. h., diejenigen mit einer Zahlungsbereitschaft in Höhe von
v < v̄(p1 , pe2 ) sind die potentiellen Nachfrager in der zweiten Periode (der Rest hat das
Gut ja bereits erworben). Wenn der Monopolist das Gut in Periode 2 zu einem Preis
p2 < v̄(p1 , pe2 ) anbietet, dann werden diejenigen Konsumenten das Gut kaufen, deren
Zahlungsbereitschaft v im Intervall [p2 , v̄(p1 , pe2 )) liegt. Diejenigen mit höherer Zahlungsbereitschaft haben schon in Periode 1 gekauft und die mit niedriger Zahlungsbereitschaft
werden gar nicht kaufen, weil ihnen das Gut zu teuer erscheint. Die Nachfrage in der
zweiten Periode ist also
D2 (p2 |p1 , pe2 ) = v̄(p1 , pe2 ) − p2 =
p1 − δpe2 − (1 − δ)p2
.
1−δ
Dies ergibt sich wieder daraus, dass wir angenommen haben, die Zahlungsbereitschaften
seien gleichverteilt auf [0, 1].
Nachdem wir nun die Nachfrage der Konsumenten in den beiden Perioden abgeleitet
haben, soll nun untersucht werden, wie der Monopolist seine Preise in den beiden Perioden setzen wird. Dabei sind zwei verschiedene Situationen zu unterscheiden: Zum einen
könnte der Monopolist in der Lage sein, schon heute seine Preise für beide Perioden festzulegen, zum anderen könnte der Monopolist seinen Preis für die zweite Periode erst zu
Beginn dieser Periode festlegen.
Angenommen, der Monopolist legt schon heute die beiden Preise p1 und p2 verbindlich
fest. In diesem Fall wissen die Konsumenten, dass sie in der zweiten Periode den Preis
p2 zu zahlen haben, d. h., pe2 = p2 .
Der Gewinn des Monopolisten in diesem Fall ist
π (p1 , p2 ) = (p1 − c) D1 (p1 , p2 ) + δ (p2 − c) D2 (p2 |p1 , p2 )
p1 − p2
1 − δ − p1 + δp2
+ δ (p2 − c)
= (p1 − c)
1−δ
1−δ
2
= p1 − δp1 − p1 + 2δp1 p2 − c − δc + cp1 − δp22 − δcp1 .
Die Bedingungen erster Ordnung für ein Gewinnmaximum lauten
∂π (p1 , p2 )
= 1 − δ − 2p1 + 2δp2 + c − δc = 0
∂p1
∂π (p1 , p2 )
(3.3)
= 2δp1 − 2δp2 = 0
∂p2
(3.2)
Aus der zweiten Gleichung (3.3) folgt p1 = p2 , also dass der Monopolist in beiden
Perioden den selben Preis setzt.1 Einsetzen in Gleichung (3.2) ergibt
1 − δ − 2p1 + 2δp1 + c − δc = (1 − δ) [1 + c − 2p1 ] = 0
1+c
⇔ p1 =
.
2
1
Im Grenzfall δ = 0 träfe diese Schlussfolgerung nicht zu. Dieser Fall würde bedeuten, dass sowohl
das Unternehmen als auch die Konsumenten in ihrer heutigen Entscheidung die Zukunft überhaupt
nicht mit einbeziehen. Das Unternehmen würde also heute seinen Monopolpreis setzen und morgen
erneut den Monopolpreis, der sich aus der Restnachfrage ergibt.
44
3.4 Dauerhafte Güter
Die gewinnmaximierenden Preise sind also
p̂1 = p̂2 =
1+c
.
2
Einsetzen in den Gewinn ergibt dann
π(p̂1 , p̂2 ) =
(1 − c)2
4
Als Nachfrage in der zweiten Periode erhalten wir
D2 (p̂2 |p̂1 , p̂2 ) = 0.
Dies ist auch intuitiv einleuchtend: Wenn der Preis in der zweiten Periode genauso hoch
ist wie in der ersten, dann lohnt es sich für die Konsumenten nicht, mit dem Kauf bis
morgen zu warten.
Wir angenommen, dass der Monopolist in der zweiten Periode an den Preis p̂2 gebunden
ist. Wenn dies nicht der Fall wäre, könnte er sich in der zweiten Periode verbessern:
In der Periode 2 haben alle Konsumenten mit v < p̂2 das Gut noch nicht erworben.
Da jedoch die Grenzkosten c kleiner sind als der Preis p̂2 , kann der Monopolist in der
zweiten Periode noch einen Gewinn machen. Senkt er nämlich den Preis auf ein Niveau
p2 ∈ (c, p̂2 ), dann könnte er das Produkt an einige Konsumenten verkaufen, die es bisher
noch nicht haben, und dabei noch einen Gewinn machen.
Wenn der Monopolist also nicht in der Lage ist, sich glaubwürdig auf Preise in den
beiden Perioden festzulegen, dann werden die Konsumenten dies antizipieren und damit
rechnen, dass der Monopolist in der zweiten Periode einen geringeren Preis verlangen
wird.
Betrachten wir im folgenden nun den realistischeren Fall, in dem der Monopolist den
Preis für die zweite Periode erst zu Beginn dieser Periode festlegt. In diesem Fall ist sein
Gewinn in der zweiten Periode
π(p2 ) = (p2 − c)D2 (p2 |p1 , pe2 ) = (p2 − c)
p1 − δpe2 − (1 − δ)p2
1−δ
Die Bedingung erster Ordnung für ein Gewinnmaximum lautet
−(1 − δ)
p1 − δpe2 − (1 − δ)p2
dπ(p2 )
+ (p2 − c)
= 0
=
p2
1−δ
(1 − δ)
1
⇐⇒
[p1 − δpe2 − (1 − δ)p2 − (1 − δ)(p2 − c)] = 0
(1 − δ)
⇐⇒ p1 − δpe2 + (1 − δ)c = 2(1 − δ)p2
p1 − δpe2 + (1 − δ)c
(3.4) ⇐⇒ p2 =
.
2(1 − δ)
Der Preis der zweiten Periode hängt also ab vom Preis der ersten Periode p1 sowie den
Erwartungen der Konsumenten über den Preis in der Periode 2. Wenn die Konsumenten
45
3 Theorie des Monopols
über die gleichen Informationen verfügen wie der Monopolist, — was wir im folgenden
unterstellen — dann können sie das Preissetzungsverhalten des Monopolisten in der
Periode 2 antizipieren.
Haben die Konsumenten rationale Erwartungen, dann werden die Preiserwartungen
durch den tatsächlichen Preis bestätigt, d. h. pe2 = p2 . Setzen wir dies in Gleichung 3.4
ein erhalten wir
p1 − δp2 + (1 − δ)c
2(1 − δ)
p1 + (1 − δ)c
δ
p2 =
⇐⇒ p2 +
2(1 − δ)
2(1 − δ)
⇐⇒ 2(1 − δ)p2 + δp2 = (2 − δ)p2 = p1 + (1 − δ)c
p1 + (1 − δ)c
(3.5) ⇐⇒ p2 =
2−δ
p2 =
Der optimale Preis in Periode 2 wird also durch den Preis in Periode 1 bestimmt: Je
höher der Preis in Periode 1 ist, desto größer wird die Restnachfrage in Periode 2 sein.
Also kann auch der Preis in Periode 2 umso höher sein, je höher der Preis in Periode
1 ist. Bei der Wahl des Preises in der Periode 1 wird der Monopolist natürlich diesen
Zusammenhang berücksichtigen.
Er maximiert seinen Gewinn über die beiden Perioden,
π (p1 , p2 , pe2 ) = (p1 − c) D1 (p1 , pe2 ) + (p2 − c) D2 (p2 |p1 , pe2 )
p1 − δpe2 − (1 − δ)p2
1 − δ − p1 + δpe2
+ (p2 − c)
,
= (p1 − c)
1−δ
1−δ
wobei er für p2 und für pe2 das Ergebnis einsetzt, das wir in Gleichung (3.5) erhalten
haben. Damit ergibt sich
1 − δ − p1 + δ p1 +(1−δ)c
2−δ
π (p1 , p2 (p1 ), p2 (p1 )) = (p1 − c)
1−δ
p1 − δ p1 +(1−δ)c
− (1 − δ) p1 +(1−δ)c
p1 + (1 − δ)c
2−δ
2−δ
+(
− c)
2−δ
1−δ
[−(2−δ)+δ]p1
(1−δ)[(2−δ)+δc]
+
2−δ
2−δ
= (p1 − c)
1−δ
2 ]c
[(2−δ)−δ−(1−δ)]p1
+ [−δ(1−δ)−(1−δ)
p1 + [(1 − δ) − (2 − δ)]c
2−δ
2−δ
+
1 −δ
2 − δ 1−δ 1−δ
c
2δ − 2 + 2−δ p1 + (1 − δ)(2 − δ) + (1 − δ)δ − 2−δ
= (p1 − c)
(2 − δ)(1 − δ)
2
2
(2 − δ) + (2δ − δ − 1)c + (2δ − 3)p1
= (p1 − c)
(2 − δ)2
46
3.4 Dauerhafte Güter
Als Bedingung erster Ordnung erhalten wir (Ableiten unter Anwendung der Produktregel und gleich null setzen)
(2 − δ)2 + (2δ − δ 2 − 1)c + (2δ − 3)p1
2δ − 3
+ (p1 − c)
= 0
2
(2 − δ)
(2 − δ)2
6 − 4δ
(2 − δ)2 + (2δ − δ 2 − 1 − 2δ + 3)c
=
p1
⇐⇒
2
(2 − δ)
(2 − δ)2
(2 − δ)2 + (2 − δ 2 )c (2 − δ)2
⇐⇒ p1 =
(2 − δ)2
6 − 4δ
2
2
(2 − δ) + (2 − δ )c
.
⇐⇒ p1 =
6 − 4δ
Der optimale Preis des Monopolisten in Periode 1 ist also
(3.6) pm
1 =
(2 − δ)2 + (2 − δ 2 )c
.
6 − 4δ
Wenn wir diesen Preis in die Gleichung (3.5) einsetzen erhalten wir
pm
2
=
=
=
=
=
(2−δ)2 +(2−δ 2 )c
6−4δ
+ (1 − δ)c
2−δ
2−δ 2 +(6−4δ)(1−δ)
(2 − δ) +
c
2−δ
6 − 4δ
2
2
c
(2 − δ) + 2−δ +6−4δ−6δ+4δ
2−δ
6 − 4δ
8−10δ+3δ 2
(2 − δ) + 2−δ c
6 − 4δ
(2 − δ) + (4 − 3δ)c
.
6 − 4δ
p2 (pm
1 )
=
Der optimale Preis in der zweiten Periode ist also
(3.7) pm
2 =
(2 − δ) + (4 − 3δ)c
6 − 4δ
Wenn wir die Differenz der Preise bilden, sehen wir, dass der Preis in der ersten Periode
stets größer ist als der in der zweiten.
(2 − δ)2 + (2 − δ 2 )c − (2 − δ) − (4 − 3δ)c
6 − 4δ
4 − 2δ + δ 2 − 2 − δ + (2 − δ 2 − 4 + 3δ)c
=
6 − 4δ
2
4 − 3δ + δ − (4 − 3δ + δ 2 )c
=
> 0,
6 − 4δ
m
pm
1 − p2 =
47
3 Theorie des Monopols
für alle δ ∈ (0, 1) (da c < 1).
Der Monopolist betreibt eine intertemporale Preisdiskriminierung: Erst verkauft er
das Gut an Konsumenten mit hoher Zahlungsbereitschaft; in der zweiten Periode senkt
er den Preis, um die Konsumenten mit geringerer Zahlungsbereitschaft zu erreichen.
Allerdings hängt das Ausmaß der Preisdiskriminierung vom Diskontfaktor δ ab: Je höher
δ, desto geringer ist das Ausmaß der Preisdiskriminierung – die Ungeduld derjenigen mit
höherer Zahlungsbereitschaft nimmt ab und sie sind eher bereit, das Gut auch in der
zweiten Periode zu erwerben.
Wenn δ gegen eins geht, nähert sich die Preisdifferenz null an, d. h. die Preise in beiden
Perioden werden gleich. Dies liegt daran, dass die Konsumenten in diesem Fall keinerlei
Gegenwartspräferenz haben, so dass niemand in der ersten Periode nachfragen würde,
wenn er wüsste, dass er das Gut in der Folgeperiode billiger bekäme. In diesem Fall gilt
m
pm
1 = p2 =
1+c
= p̂1 = pˆ2 ,
2
d. h., die Preise sind genau die selben wie in der Situation, in der der Monopolist sich an
einen Preis für die zweite Periode binden konnte. Damit ist natürlich auch der Gewinn
des Monopolisten der selbe.
m
Für δ < 1 gilt aber p̂1 > pm
1 (> p2 ). Dies erkennt man durch Ableiten des Ausdrucks für
pm
1 nach δ.
2
+(2−δ
∂ (2−δ)6−4δ
∂δ
2 )c
=
=
=
<
<
[−2(2 − δ) − 2δc] (6 − 4δ) − 4 [(2 − δ)2 + (2 − δ 2 )c]
(6 − 4δ)2
−24 + 12δ − 12δc + 16δ − 8δ 2 + 8δ 2 c − 16 + 8δ − 4δ 2 − 8 + 4δ 2 c
(6 − 4δ)2
−48 + 36δ − 12δc − 12δ 2 + 12δ 2 c − 4δ 2
(6 − 4δ)2
−12 − 12δc − 4δ 2
(6 − 4δ)2
0.
Die Ableitung ist negativ. Da für δ = 1 die beiden Preise p̂1 und pm
1 gleich sind, und
m
p̂1 = 1+c
nicht
von
δ
abhängt,
folgt
also,
dass
für
alle
δ
∈
(0,
1)
gilt
p̂
1 > p1 .
2
Da p̂1 den Gesamtgewinn des Monopolisten maximiert, folgt, dass offensichtlich der
Gewinn bei einer Selbstbindung, also bei p̂1 = p̂2 höher ist als wenn der Monopolist sich
nicht an einen bestimmten Preis in der zweiten Periode binden kann. Dies reflektiert die
Tatsache, dass der Monopolist im zweiten Fall nicht ausschließen kann, dass er in der
zweiten Periode einen niedrigeren Preis verlangen wird.
m
Die Tatsache, dass die Preise pm
1 und p2 geringer sind als p̂ liegt daran, dass bei sequentieller Festlegung der Preise der Monopolist mit sich selbst konkurriert: Wenn er
die Restnachfrage in der zweiten Periode ausnutzen will, schafft er sich in der ersten
Periode selbst eine Konkurrenz, da er mit einem künftigen niedrigeren Preis Konsumenten dazu bewegt, ihren Konsum in die zweite Periode zu verlagern. Es wäre für den
48
3.4 Dauerhafte Güter
Monopolisten besser, wenn er sein Gut nur in der ersten Periode verkaufen würde. Dies
setzt aber voraus, dass er sich daran binden kann.
Wenn nun nicht nur zwei, sondern mehr Perioden gegeben sind, dann besteht bei einem
Preis pm
2 > c auch in der dritten Periode noch eine Restnachfrage, die der Monopolist in
dieser Periode ausnutzen könnte. Allgemein: Wenn der Monopolist in einer Periode das
Gut zu einem Preis größer als die Grenzkosten verkauft hat, dann besteht in der Folgeperiode noch eine Restnachfrage, die er ausnutzen kann. Dies wird bei unbegrenztem
Zeithorizont solange gehen, bis der Preis gegen c konvergiert. Wenn die Konsumenten
dies antizipieren, dann werden sie — wenn der Diskontfaktor nahe bei 1 liegt — auch in
der ersten Periode nur bereit sein, einen Preis zu bezahlen, der in der Nähe von c liegt.
Im Grenzfall, d. h. bei δ = 1 wird der Preis in jeder Periode gleich c sein. In diesem Fall
gilt also die Coase–conjecture und der Monopolist macht einen Gewinn von null.
3.4.1 Vermietendes versus verkaufendes Monopol
Im folgenden soll nun anhand eines einfachen Beispiels untersucht werden, wie ein Monopolist, der sich nicht selbst an einen Preis in der zweiten Periode binden kann, durch
die Vermietung des Gutes den gleich Gewinn erzielen kann, wie ein Monopolist, der über
diese Selbstbindungsmöglichkeit verfügt (vgl. Shy (1995, Abschnitt 5.5.1, S. 81–85)).
Achtung: Wir ändern für diese Betrachtung unser Modell grundlegend, indem wir nun
tatsächlich nur noch zwei Perioden betrachten, d. h., das Unternehmen, die Konsumenten
und das Gut existieren heute und morgen und danach geht die Welt unseres Modells
unter. Vorher hatten wir zwar nur Entscheidungen in zwei Perioden betrachtet, dabei
aber implizit angenommen, dass das Gut unendlich lange existiert und die Konsumenten
es ebenso lange konsumieren können. Zusätzlich betrachten wir in diesem Modell keine
Diskontierung bzw. setzen δ = 1.
Angenommen, die Konsumenten leben für zwei Perioden, t = 1, 2 und der Monopolist
verkauft ein Gut, das zwei Perioden hält. Zur Vereinfachung nehmen wir an, die Produktion des Gutes erfolge kostenlos. Wenn der Konsument das Gut in Periode 1 erwirbt,
dann kann er dieses Gut für sein gesamtes Leben nutzen.
Die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften der Konsumenten für das Gut werden beschrieben durch die aggregierte inverse Nachfragefunktion für die Nutzung des Gutes in
einer Periode gegeben durch p(y) = 100 − y. Diese inverse Nachfragefunktion ist grafisch
in Abbildung 4.16 dargestellt.
Wir nehmen an, dass die Verteilung der Zahlungsbereitschaften für die Nutzung über die
beiden Perioden unverändert bleibt, d. h. Konsumenten, die in der ersten Periode eine
hohe Zahlungsbereitschaft haben, haben diese auch in der zweiten und ebenso für Konsumenten mit niedriger Zahlungsbereitschaft. Daraus ergibt sich die inverse Nachfrage
falls das Gut nur in der ersten Periode gekauft werden könnte wie in Abbildung 4.17
gezeigt. Dabei muss man daran denken, dass eine Kauf in der ersten Periode bedeutet,
das Nutzungsrecht an dem dauerhaften Gut für zwei Perioden zu erwerben.
Zusätzlich haben wir die sich ergebende Monopolmenge ŷ1 und den zugehörigen Monopolpreis p̂1 sowie den sich ergebenden Gewinn grafisch angegeben.
49
3 Theorie des Monopols
p
100
p(y)
100 y
Abbildung 4.16: Inverse Nachfrage nach einperiodiger Nutzung eines dauerhaften Gutes
Im folgenden werden wir zwei alternative Arten von Transaktion betrachten, die der
Monopolist durchführen könnte. Er könnte das Produkt verkaufen oder er könnte es
vermieten.
Definition 6
1. Durch den Verkauf eines Gutes an einen Konsumenten zum
Preis pS transferiert das Unternehmen das Eigentum und damit alle Rechte
an der Nutzung des Gutes vom Zeitpunkt des Kaufs an den Konsumenten für
die gesamte Zukunft.
2. Durch die Vermietung eines Gutes an einen Konsumenten zum Preis pR
behält das Unternehmen das Eigentum an dem Gut, aber transferiert das Recht
der Nutzung des Gutes für einen bestimmten Zeitraum an den Konsumenten.
Ein vermietendes Monopol Angenommen, der Monopolist vermietet das dauerhafte
Gut in jeder Periode für die Dauer einer Periode. (Man denke z. B. an das Leasing eines
Autos.) Gegeben die Preis-Absatz-Funktion in jeder Periode p(y) = 100 − y ist die
Bedingung für ein Gewinnmaximum für jede Periode t
M R(yt ) = 100 − 2yt = 0 = M C(yt ).
Daraus ergibt sich eine Menge pro Periode von ytR = 50, wobei das Superskript R für
Vermieten (‘rent’) steht. Der Monopolmietpreis ist pR
t = 50, der Gewinn pro Periode ist
R
πt (yt ) = 2500. Für beide Perioden beträgt der Gewinn also π R = 5000. Diese Situation
ist grafisch in Abbildung 4.18 dargestellt.
Ein Vergleich mit Abbildung 4.17 zeigt, dass das Ergebnis das selbe ist wie in dem Fall,
dass der Monopolist nur in der ersten Periode verkauft. Dies entspricht auch der im
vorigen Abschnitt analysierten Situation, in der er sich in Periode 1 auf einen Preis für
beide Perioden festlegen kann.
50
3.4 Dauerhafte Güter
p1
200
p(y)
p̂1
M R(y)
100 y1
ŷ1
Abbildung 4.17: Inverse Nachfrage bei Verkauf ausschließlich in Periode 1
Ein verkaufendes Monopol Ein Monopolist, der das Gut in Periode 1 verkauft, weiß,
dass die Konsumenten, die das Produkt in Periode 1 gekauft haben, es in der nächsten
Periode nicht mehr kaufen werden. Die Nachfrage in Periode 2 wird also um diesen Betrag niedriger ausfallen. Daher wird der Monopolist in Periode 2 aufgrund der geringeren
Nachfrage zu einem geringeren Preis verkaufen. Die Abhängigkeit der Nachfrage in Periode 2 von der in Periode 1 verkauften Menge sowie die optimale Wahl des Monopolisten
sind in Abbildung 4.19 angedeutet. Dabei verwenden wir für die optimale Menge und
den optimalen Preis das Superskript S für verkaufen (‘sell’).
Allerdings müssen wir auch berücksichtigen, dass der Preis in der zweiten Periode (oder
p1
p2
100
100
p1 (y1 )
pR
1
M R(y)
y1R
(a) Periode
1
p2 (y2 )
pR
2
M R(y)
100 y1
y2R
(b) Periode
2
100 y2
Abbildung 4.18: Vermietung eines dauerhaften Gutes
51
3 Theorie des Monopols
p2
100 − y1
pS2
p2 (y2 , y1 )
y2
y2S 100 − y1
Abbildung 4.19: Nachfrage in Periode 2
genauer gesagt die Erwartungen der Konsumenten über diesen Preis) Auswirkungen auf
die inverse Nachfrage in der ersten Periode hat.
Wir müssen also ein zwei Perioden Problem (bzw. zwei Perioden Spiel) untersuchen, das
wie folgt beschrieben ist: Die Auszahlung des Unternehmens ist der Gesamtgewinn aus
den beiden Perioden. Der Monopolist wählt in Periode 1 den preis p1 und in Periode
2, den Preis p2 ; zu diesem Zeitpunkt kennt er die in Periode 1 verkaufte Menge y1 und
damit die verbleibende Restnachfrage in Periode 2 (vgl. Abbildung 4.19) Die Konsumenten entscheiden sich in Abhängigkeit von den vom Monopolisten gewählten Preisen,
in Periode 1 bzw. in Periode 2 entweder zu kaufen oder nicht zu kaufen; dabei nehmen wir rationale Erwartungen an, d. h. in Periode 1 können die Konsumenten korrekt
vorhersagen, welchen Preis der Monopolist in der zweiten Periode wählen wird.
Dieses Problem wird mittels Rückwärtsinduktion (backward induction) gelöst.2 Man
untersucht zuerst, wie sich der Monopolist in der zweiten Periode für jede mögliche in
der ersten Periode verkaufte Menge y1 (also für die daraus resultierende Nachfrage in
Periode 2) verhält, und fragt sich dann, welchen Preis er in der ersten Periode verlangen
sollte, um seinen Gewinn über beide Perioden so groß wie möglich zu machen, wenn er
dabei seine eigene Reaktion in Periode 2 berücksichtigt.
Wir beginnen unsere Untersuchung also mit der zweiten Periode.
Grafisch haben wir dies ja schon in Abbildung 4.19 analysiert. Hier wollen wir es nochmals rechnerisch nachvollziehen. Die Restnachfrage nach dem Produkt des Monopolisten, der ȳ1 in der ersten Periode verkauft hat ist gegeben durch p2 = 100 − ȳ1 − y2 . Der
Monopolist wird also einen Menge anbieten, die durch
M R2 (y2 ) = 100 − ȳ1 − 2y2 = 0
charakterisiert ist. daraus erhalten wir
(3.8) y2 (ȳ1 ) = 50 −
ȳ1
.
2
Der Preis in der zweiten Periode ist
ȳ1 ȳ1
(3.9) p2 (ȳ1 ) = 100 − ȳ1 − 50 −
= 50 −
2
2
2
Anders gesagt, wir suchen teilspielperfekte Gleichgewichte (subgame-perfect equilibria) des betrachteten Spiels. Mehr dazu in der Vorlesung Spieltheorie.
52
3.4 Dauerhafte Güter
und der Gewinn
ȳ1 2
π2 (ȳ1 ) = p2 (ȳ1 ) y2 (ȳ1 ) = 50 −
.
2
Betrachten wir nun die erste Periode.
Angenommen, der Monopolist verkauft in der ersten Periode ȳ1 an die Konsumenten
mit der höchsten Zahlungsbereitschaft. Das heißt, der marginale Käufer‘, dessen Zah’
lungsbereitschaft für die Nutzung des Gutes pro Periode 100 − ȳ1 beträgt, ist indifferent zwischen dem Kauf in der ersten und dem Kauf in der zweiten Periode. Im ersten Fall erhält er einen Nutzen von 2(100 − ȳ1 ) − p1 , im zweiten einen Nutzen von
(100 − ȳ1 ) − p2 = (100 − ȳ1 ) − 50 − ȳ21 . Also muss gelten
ȳ1 2 (100 − ȳ1 ) − p1 = (100 − ȳ1 ) − 50 −
.
2
Auflösen nach p1 ergibt
(3.10) p1 = 150 −
3ȳ1
.
2
Dies ist die relevante Preis-Absatz-Funktion der sich das Unternehmen in der ersten
Periode gegenüber sieht. Im Vergleich zu der in Abbildung 4.17 dargestellten fiktiven
Preis-Absatz-Funktion, die gelten würde, falls es keine Verkäufe in Periode 2 gäbe, ist
der Preis den die Konsumenten zu zahlen bereit sind für jede Menge niedriger, da sie
den zu erwartenden niedrigeren Preis in der zweiten Periode mit in ihre Überlegungen
einbeziehen.
In einem (teilspielperfekten) Gleichgewicht wählt der Monopolist ein Outputniveau ȳ1 ,
das das folgende Maximierungsproblem löst.
y1 2
3y1
y1 + 50 −
max π1 + π2 = 150 −
y1
2
2
Die Bedingung erster Ordnung lautet
d (π1 + π2 )
3y1
1 y1 3
5
= 150 −
− y1 − 2 50 −
= 100 − y1 = 0.
dy1
2
2
2
2
2
Auflösen nach y1 ergibt y1S = 40. Eingesetzt in Gleichung (3.10) ergibt den Preis pS1 =
150 − 32 40 = 90. Für die zweite Periode erhalten wir die Menge aus Gleichung (3.8)
als
40
S
y2S = 50 − 40
=
30
und
den
Preis
aus
Gleichung
(3.9)
als
p
=
100
−
40
−
50
−
= 30.
2
2
2
Der sich ergebende Gewinn ist
π S = pS1 y1S + pS2 y2S = 90 · 40 + 30 · 30 = 3600 + 900 = 4500 < 5000 = π R .
Die Situation ist grafisch in Abbildung 4.20 dargestellt.
Es fällt auf, dass der Monopolist in der ersten Periode nicht die Monopolmenge gegeben
die relevante inverse Nachfrage wählt (dies wird deutlich durch die gepunktet eingezeichnete Grenzerlösfunktion). Dies liegt daran, dass er nicht nur den Gewinn in Periode 1
53
3 Theorie des Monopols
p1
p2
150
pS1
60
pS2
S
y1 Periode 1
(a)
100 y1
S
60
y(b)
Periode 2
2
y2
Abbildung 4.20: Verkauf eines dauerhaften Gutes: Gewinnoptimum
maximieren will, was durch diese Menge geschehen würde, sondern auch den negativen
Einfluss einer größeren in Periode 1 verkauften Menge auf seinen Gewinn in der zweiten
Periode berücksichtigt.
Abbildung 4.21 zeigt die Situation die sich ergäbe, wenn sich der Monopolist in Periode
1 myopisch verhielte, d. h., seinen Periodengewinn durch die Wahl der Monopolmenge
in dieser Periode maximieren würde, ohne die Auswirkungen auf Periode 2 zu beachten.
Die sich ergebenden Mengen, Preise und Gewinne wären y1 = 50, p1 = 75, y2 = 25,
p2 = 25, π1 = 50 · 75 = 3750 > 3600 = π1S , π2 = 252 = 625 < 900 = π2S und
π = π1 + π2 = 3750 + 625 = 4375 < 4500 = π S .
p1
p2
150
50
(a) Periode 1
100 y1
50
(b) Periode 2
y2
Abbildung 4.21: Verkauf eines dauerhaften Gutes: myopisches Verhalten
54
3.5 Werbung und Qualität
Wir haben also an unserem Beispiel gesehen, dass das Unternehmen durch das Vermieten
des dauerhaften Gutes einen höheren Gewinn erzielen kann, als durch seinen Verkauf.
Dies gilt auch allgemeiner, was uns zu folgender Aussage führt.
Theorem 5 Bei einer stetigen Preis-Absatz-Funktion erzielt ein Monopolist, der
ein dauerhaftes Gut verkauft, einen geringeren Gewinn als ein Monopolist, der ein
dauerhaftes Gut vermietet.
Die Voraussetzung einer stetigen inversen Nachfrage ist wichtig, wie Bagnoli, Salant, und
Swierzbinski (1989) demonstrieren. Sie konstruieren ein Modell mit diskreter Nachfrage
(also endlich vielen Konsumenten statt eines Kontinuums), in dem es für einen Monopolisten, der ein dauerhaftes Gut produziert profitabler ist, dieses Gut zu verkaufen als
es zu vermieten. In diesem Modell gilt also gerade das Gegenteil dessen, was wir oben
gezeigt haben (vgl. auch Shy (1995, Abschnitt 5.5.2, S. 85–89)).
3.5 Werbung und Qualität
Wenn Unternehmen mit differenzierten Produkten, d. h. Produkten die nicht wie im Fall
homogener Güter völlig identisch sind, sondern die sich voneinander unterscheiden, auch
wenn sie grundsätzlich ähnlich sind, miteinander im Wettbewerb stehen, dann müssen
die Unternehmen natürlich versuchen, den Konsumenten deutlich zu machen, dass sich
ihr Produkt tatsächlich von dem ähnlichen Produkt eines Konkurrenten unterscheidet.
Ein, wenn nicht das wichtigste Instrument hierzu ist die Werbung.
Wir wollen verstehen, wie Unternehmen über ihre Werbeausgaben entscheiden und unter
anderem die Frage beantworten, inwieweit diese Werbeausgaben soziale Kosten verursachen. Dazu unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Arten der Werbung. Hier
gibt es zum einen die informative Werbung wie z. B. Informationen über Preise und
bestimmte Eigenschaften des Produktes wie etwa technische Daten bei Haushaltsgeräten
oder Kraftfahrzeugen. Daneben gibt es aber noch — und diese Art von Werbung macht
den größeren Teil der Fernsehwerbung aus — sogenannte suggestive Werbung (persuasive advertising). Hierbei handelt es sich um Werbung für Produkte wie z. B. Getränke,
Parfüms, Waschmittel etc.
In einem engen Zusammenhang mit diesen beiden Arten der Werbung stehen zwei Gruppen von Konsumgütern: Es handelt sich dabei zum einen um sogenannte Suchgüter,
d. h. um solche Güter, deren Qualität und Eigenschaften vor dem Kauf festgestellt werden können, wie z. B. bei frischem Obst oder Gemüse, das man vor dem Kauf probieren
kann, Schuhen, die man anprobieren kann, Geschirr etc.
Zum anderen handelt es sich um Erfahrungsgüter, deren Qualität und Eigenschaften
erst nach dem Kauf festgestellt werden können. Hierzu gehören Bier, Zahnpasta, Seife
aber auch Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen.
Betrachten wir als Beispiel zwei verschiedene Sorten von Zahnpasta, beide erfolgreich
klinisch getestet. Die qualitativ hochwertige schmeckt hervorragend, die qualitativ min-
55
3 Theorie des Monopols
derwertige übel. Konsumenten kennen den Geschmack (DIE Qualität) vor dem Kauf
nicht.
Welches der beiden Unternehmen hat einen größeren Anreiz, Werbung zu betreiben?
Werbung für die übel schmeckende Zahnpasta kann die Konsumenten dazu bringen, das
Produkt einmal zu kaufen, aber nur wenige werden dies ein zweites Mal tun. Die gut
schmeckende Zahnpasta wird aber wiederholt gekauft werden. Der Hersteller des qualitativ hochwertigen Produktes hat demnach einen größeren Anreiz zu werben, da hier
mit wiederholten Käufen zu rechnen ist. Der des minderwertigen Produktes hat nur
einen geringen Anreiz zu werben, da mit anfänglichen Käufen, aber nicht mit Wiederholungskäufen zu rechnen ist.
Ein großer Werbeaufwand kann also für den Konsumenten ein Signal sein, dass es sich
um ein hochwertiges Produkt handelt, denn nur Hersteller solcher Produkte würden
verstärkt Werbung betreiben. Der andere Produzent würde nicht soviel in Werbung
investieren, da er die Konsumenten nur zu einem einmaligen Kauf veranlassen kann.
Solche Art der Werbung kann also dazu führen, dass die Vorliebe der Konsumenten für
ein bestimmtes Produkt verstärkt wird, d. h. sie erhöht die Nachfrage nach dem Gut.
Als Beispiel kann die Werbung für New Coke im Unterschied zu Coca Cola Classic
herangezogen werden. Viele Konsumenten hielten New Coke für qualitativ schlechter
als Coca Cola Classic. Daraufhin stoppte Coca Cola sofort die Werbeausgaben für New
Coke und erhöhte die Werbung für Coca Cola Classic dramatisch. Diese Werbestrategie
machte den Konsumenten deutlich, dass Coca Cola von der hohen Qualität von Coca
Cola Classic überzeugt war, aber der Qualität von New Coke nicht so recht traute. Es
ist daher kein Wunder, dass sich nur Coca Cola Classic auf dem amerikanischen Markt
halten konnte.
Werbung und Marktstruktur Betrachten wir im folgenden das frühe Modell von Dorfman und Steiner (1954). Sie untersuchen einen Monopolisten, der sich der folgenden
Nachfragefunktion y(p, a) gegenübersieht. Dabei bezeichnet y die Menge, p den Preis
und a die Ausgaben für Werbung.
Der Monopolist möchte seinen Gewinn maximieren.
max py(p, a) − c y(p, a) − a.
p,a
Es wird angenommen, dass die Werbeausgaben nur einen Einfluss auf die Menge y, nicht
aber auf den Preis p haben. Da der Monopolist zwei Variablen, Preis und Werbeausgaben
setzen kann, ergeben sich zwei Bedingungen erster Ordnung.
Der Monopolist wird seine Menge so wählen, dass sein Grenzerlös seinen Grenzkosten
entspricht, also M R = M C (vgl. Gleichung (3.1), diese Bedingung erhalten wir, indem
wir partiell nach p ableiten und diese Ableitung gleich null setzen. Dies kann — wie in
Gleichung (2.6) gezeigt wurde — geschrieben werden als
1
p 1−
= MC
|ηp (y)|
56
3.5 Werbung und Qualität
bzw.
(3.11)
p − MC
1
=
,
p
|ηp (y)|
dc
wobei M C = dy
.
Diese Gleichung gibt an, wie bei einem Monopol der Preis (prozentual) von den Grenzkosten abweicht. Dies ist umso stärker der Fall, je geringer die Preiselastizität der Nachfrage ist. Der Term |ηp1(y)| wird daher als Lernerscher Monopolgrad oder Lerner
Index bezeichnet.
Die zweite Bedingung für ein Gewinnmaximum, die wir durch partielles Ableiten nach
a und null setzen erhalten, ist
(3.12) M R(a) = p
∂y
dc ∂y
= M C(a) =
+1
∂a
dy ∂a
⇐⇒
1=p
∂y
dc ∂y
−
.
∂a dy ∂a
Nun erhalten wir
ηa (y)
=
|ηp (y)|
p−
dc
dy
!
ηa (y) (vgl. Gleichung (3.11))
p−
dc
dy
!
∂y a
∂a y(p, a)
p
=
p
(Definition von ηa (y))
a
a
∂y
dc ∂y
dc ∂y
= p
−
= p−
dy ∂a p y(p, a)
∂a dy ∂a p y(p, a)
a
(wegen Gleichung (3.12)).
=
p y(p, a)
Insgesamt erhalten wir also
ηa (y)
a
=
.
p y(p, a)
|ηp (y)|
Hieraus kann man das folgende Theorem ableiten.
Theorem 6 Die profitmaximierenden Werbeausgaben und der profitmaximierende
Preis eines Monopolisten werden so gewählt, dass das Verhältnis von Werbeausgaben
zum Umsatz gleich dem Verhältnis von Werbeausgaben–Elastizität der Nachfrage zu
Preiselastizität der Nachfrage ist.
Der Monopolist wird also das Verhältnis von Werbeausgaben zu Umsatz erhöhen, wenn
die Nachfrage bezüglich der Werbeausgaben elastischer wird und wenn die Preiselastizität der Nachfrage sinkt.
Darüberhinaus stellt dieses Modell einen Zusammenhang zwischen Marktmacht und
Werbeausgaben dar: Je größer die Marktmacht, d. h. der Lerner Index, desto größer
das Verhältnis von Werbeausgaben zu Umsatz.
57
3 Theorie des Monopols
Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse, zu ermitteln, ob ein Monopolist — gemessen am Optimum — zu viel oder zu wenig persuasive advertising betreibt.
Da solche Werbung das Gut für Konsumenten attraktiv macht, hat sie das Potential,
die Wohlfahrt zu erhöhen. Dies bedeutet nicht, dass diese Art der Werbung ‘wahr’ wäre.
Was durch diese Werbung erreicht wird, ist, dass die Konsumenten mit dem Gut ein
bestimmtes Image verbinden, und das Gut kaufen, um sich mit der Botschaft bzw. dem
Werbeträger zu identifizieren.
Eine einfache Methode, um die Wohlfahrtseffekte solcher Werbung abzuschätzen, wurde
von Dixit und Norman (1978) vorgeschlagen.
Betrachten wir die Nachfragefunktion
y(p, a) = 64a1/2 p−2
Die Preis-Absatz-Funktion ist daher
p(y, a) =
8a1/4
y 1/2
Die Elastizitäten sind ηa (y) = 1/2 und |ηp (y)| = 2.
Der Monopolist produziert mit konstanten Grenzkosten in Höhe von c = 1.
Der Monopolist maximiert
py − cy − a = 64a1/2 p−1 − 64a1/2 p−2 − a.
Die Bedingungen erster Ordnung in bezug auf den Preis ist
−64a1/2 128a1/2
+
= 0.
p2
p3
Daraus folgt pm = 2 und y m = 16a1/2 .
Da die Nachfragefunktion eine konstante Elastizität aufweist, ist der Monopolpreis unabhängig von der Höhe der Werbeausgaben.
Die Bedingung mit Bezug auf die Werbeausgaben ist
64
64
− 1/2 2 = 1.
1/2
2a p 2a p
Daraus ergibt sich am = 64 und y m = 16 · 641/2 = 128.
Um nun feststellen zu können, ob die Werbeausgaben eines Monopols sozial optimal sind,
müssen wir zuerst die Konsumentenrente für alle möglichen Werbeausgaben ermitteln.
Grafisch können wir uns die Konsumentenrente beim Monopolpreis pm = 2 wie folgt
verdeutlichen, wobei wir von einem gegebenen Niveau der Werbeausgaben ausgehen:
Formal ergibt sich die Konsumentenrente zu
Z 16a1/2 1/4
a
8 1/2 dy − 2 × 16a1/2
CS(a) =
y
0
16a1/2
= 2 × 8a1/4 y 1/2 0
− 32a1/2 = 32a1/2
58
3.5 Werbung und Qualität
pm
pm
ym
y
Abbildung 5.22: Konsumentenrente
Geht man von einem Monopolpreis von pm = 2 aus, dann ergibt sich der Gewinn des
Monopolisten als Funktion der Werbeausgaben durch
π(a, 2) = 2y(a) − y(a) − a = 32a1/2 − 16a1/2 − a
= 16a1/2 − a.
Sucht man nun die wohlfahrtsmaximierenden Werbeausgaben, dann ist beim Monopolpreis pm = 2 die Wohlfahrt zu maximieren, d. h.
max W (a) = CS(a) + π(a, 2) = 48a1/2 − a.
a
Die Bedingung erster Ordnung für ein Maximum ist
dW (a)
24
= 1/2 − 1 = 0.
da
a
Daraus ergibt sich das sozial optimale Niveau der Werbeausgaben als a∗ = 242 > 64 =
am . Man muss hierbei natürlich beachten, dass dieses soziale Optimum nicht das ‘first
best’ Optimum ist, da der Preis nicht gleich den Grenzkosten ist.
Es kann daher das folgende Theorem abgeleitet werden.
Theorem 7 Bei einer monopolistischen Marktstruktur sind die gleichgewichtigen
Werbeausgaben geringer als die gesellschaftlich optimalen Werbeausgaben.
Man muss natürlich berücksichtigen, dass hier nur eine Methode vorgestellt wurde, wie
man im Prinzip die Wohlfahrtseffekte von persuasive advertising bewerten kann. Allerdings gibt es dabei mehrere Probleme, die die Gültigkeit des Theorems in Frage stellen:
59
3 Theorie des Monopols
• Kann die Konsumentenrente als Maß für die Wohlfahrt herangezogen werden, wenn
die Nachfrage (bzw. der Nutzen) vom Niveau der Werbung abhängt?
• Auch wenn dieses Maß korrekt wäre, wird durch diesen Ansatz nicht die gesamte
Wohlfahrtsveränderung erfasst, da es sich nur um ein Partialmarktmodell handelt.
Steigt die Nachfrage nach dem Produkt aufgrund der Erhöhung der Werbeausgaben, dann wird die Nachfrage nach anderen Gütern (Substituten) abnehmen. Es
ist nicht klar, wie der Gesamteffekt aussieht.
Die Wahl der Produktqualität
Im weiteren wir angenommen, dass der Monopolist auch die Wahl der Produktqualität
bestimmen kann. Diese wird, neben dem Preis, die Nachfrage nach dem Produkt bestimmen. Im weiteren soll q die Qualität des Gutes bezeichnen und es wird angenommen,
dass die Produktion höherer Qualität auch höhere Kosten verursacht, d. h. c′ (q) > 0.
Betrachten wir in Abbildung 5.23 einmal das Entscheidungsproblem des Monopolisten
grafisch unter der Annahme, dass er entweder eine niedrige ql oder eine hohe Qualität
qh produzieren kann.
pl
ph
pm
h
pm
Bl
l
Al
pl (xl )
Cl
m
Bh
ph (xh )
Ah
Ch
c(qh )
c(ql )
l
(a)xniedrige
Qualität
xl
m
(b)xhhohe Qualität
xh
Abbildung 5.23: Verschiedene Produktqualitäten
Im ersten Fall sind die Grenzkosten gleich c(ql ) und die Preis-Absatz-Funktion ist p(ql , x).
Aus der Grafik wird deutlich, dass es für das Unternehmen optimal ist, die die Menge
m
xm
l mit der Qualität ql zum Preis pl anzubieten. Der Gewinn des Unternehmens ist
durch die Fläche Al gekennzeichnet, die Konsumentenrente durch die Fläche Bl und der
Wohlfahrtsverlust durch die Fläche Cl .
60
3.5 Werbung und Qualität
Im zweiten Fall sind die Grenzkosten des Unternehmens c(qh ), einem höheren Wert, da
die Qualität gestiegen ist. Bei gleicher Menge sind die Konsumenten natürlich bereit,
einen höheren Preis zu zahlen als bei niedrigerer Qualität, d. h. p(qh , x) > p(ql , x). Aus
der folgenden Grafik wird deutlich, dass der Gewinn des Unternehmens zugenommen
hat, denn er ist jetzt durch die Fläche Ah gekennzeichnet. Der Monopolist sollte also die
höhere Qualität wählen.
In dem dargestellten Fall ist die Entscheidung des Monopolisten auch sozial effizient.
Auch ein sozialer Planer würde die hohe Qualität wählen. Die potentielle volkswirtschaftliche Rente (Ah + Bh + Ch ) ist in diesem Fall größer als bei niedrigerer Qualität
(Al + Bl + Cl ) und die im Monopol erreichte Wohlfahrt (Ah + Bh ) ist in diesem Fall
ebenfalls größer als (Al + Bl ).
Allerdings ist im Modell zum einen ein spezielles Nachfrageverhalten unterstellt worden,
zum anderen wurden lineare Kosten angenommen. Man kann also nicht davon ausgehen,
dass das Monopol immer die sozial effiziente Qualität anbieten wird. Das Ergebnis wird
davon abhängen, wie die Qualitätswahl die Nachfrage und die Kosten beeinflusst.
Analysieren wir daher das Nachfrageverhalten etwas genauer. Jeder Konsument möchte
eine Einheit des Gutes kaufen. Dabei unterscheiden sich die Konsumenten hinsichtlich
ihrer Zahlungsbereitschaft θ. Die Zahlungsbereitschaft eines Konsumenten vom Typ θ
für ein Gut der Qualität q ist gegeben durch v(q, θ). Dabei wird angenommen, dass
diese Zahlungsbereitschaft mit der Qualität steigt. Außerdem seien die Konsumenten
entsprechend der Höhe ihrer Zahlungsbereitschaftgeordnet.
Es wird angenommen, dass
die Typen der Konsumenten auf dem Intervall θ, θ̄ gemäß der Verteilungsfunktion
F (θ) verteilt sind. Dabei bezeichnet F (θ) also für die Qualität q den Anteil der Konsumenten, deren Zahlungsbereitschaft nicht größer ist als v(q, θ). Die Gesamtmasse der
Konsumenten wird auf 1 normiert.
Die Kostenfunktion des Unternehmens linear, die Grenzkosten (und damit auch die
Stückkosten) für ein gut der Qualität q betragen c(q). Wenn das Unternehmen bei einer
Qualität q den Preis p festsetzt, dann werden alle Konsumenten mit v(q, θ) ≤ p das
Produkt nicht kaufen. Der Konsument θ̂, der gerade indifferent ist zwischen kaufen und
nicht kaufen, ist bestimmt durch
(3.13) v(q, θ̂) = p.
Alle Konsumenten mit θ > θ̂ werden das Gut zum Preis p kaufen. Die Nachfrage nach
dem Gut beim Preis p ist also: 1 − F (θ̂). Der Gewinn des Unternehmens ist dann
Π (p, q) =
p − c(q)
1 − F (θ̂) .
Dies kann wegen Gleichung (3.13) auch geschrieben werden als
Π (p, q) =
v(q, θ̂) − c(q)
1 − F (θ̂) .
61
3 Theorie des Monopols
Die Bedingungen für ein Gewinnmaximum des Monopolisten sind dann
⇐⇒
∂Π (q m , pm )
= 0
∂q
∂v(q m , θ̂m )
= c′ (q m )
∂q
und
⇐⇒
∂Π (pm , q m )
= 0
∂p
F ′ (q m , θ̂m )
∂v(q m , θ̂m )
=
(v(q m , θ̂m ) − c(q m ))
m
m
∂θ
1 − F (q , θ̂ )
Die Qualität wird also gemäß der ersten Bedingung so gewählt, dass die marginale Erhöhung der Zahlungsbereitschaft des marginalen Konsumenten‘ der marginalen
’
Erhöhung der Kosten pro Stück entspricht. Der Monopolist kann den Preis genau um
den Betrag erhöhen, den der marginale Konsument‘ für eine Erhöhung der Qualität zu
’
zahlen bereit ist.
Die zweite Bedingung besagt, dass der Monopolpreis höher ist als die Grenzkosten der
Produktion; dies spiegelt die bekannte Ineffizienz des Monopols wider. Dabei haben wir
diese Bedingung hier so geschrieben, als wähle der Monopolist den marginalen Konsumenten, also θ̂m . Dies tut er ja vermöge der Gleichung (3.13) auch indirekt, indem er
den Preis pm wählt.
Wie ist nun das Monopolergebnis im Vergleich zur wohlfahrtsoptimalen Lösung zu bewerten?
Wenn alle Konsumenten im Intervall [θ̂, θ̄] das Gut erhalten, ist die Wohlfahrt gegeben
durch die Differenz zwischen der gesamten Zahlungsbereitschaft und den Produktionskosten, d. h.
W =
θ̄
Z
θ̂
v(q, θ) − c(q) dF (θ).
Die erste Bedingung erster Ordnung für ein Wohlfahrtsmaximum ist gegeben durch
⇐⇒
∂W
= 0.
∂q
Z θ̄
∂v(q ∗ , θ)/∂q
θ̂
1−
F (θ̂∗ )
dF (θ) = c′ (q ∗ ).
Auf der linken Seite steht, um wie viel eine marginale Qualitätserhöhung die Zahlungsbereitschaft all derjenigen Konsumenten erhöht, die das Gut kaufen. Im Optimum
entspricht dieser Betrag den zusätzlichen Produktionskosten einer solchen Qualitätserhöhung.
62
3.5 Werbung und Qualität
Die zweite Bedingung erster Ordnung für ein Wohlfahrtsmaximum ist
∂W
= 0.
∂θhat
v(q ∗ , θ̂∗ ) = c(q ∗ ).
⇐⇒
Diese zweite Bedingung besagt, dass der marginale Konsument gerade bereit ist, die
Stückkosten des Gutes zu zahlen.
Offensichtlich wird auch in diesem Fall der Monopolist eine geringere Menge anbieten,
als dem sozialen Optimum entspräche. Darüberhinaus stimmt aber auch die Qualitätswahl des Monopolisten nicht mit dem sozialen Optimum überein. Für das Monopol
ist es entscheidend, wie viel der marginale Konsument‘ für eine marginale Qualitäts’
erhöhung zu zahlen bereit ist. Im Unterschied dazu ist das Wohlfahrtsoptimum durch
die durchschnittliche Erhöhung der Zahlungsbereitschaft für eine marginale Erhöhung
der Qualität bestimmt.
Im allgemeinen kann man nicht sagen, ob die monopolistische Entscheidung zu einer
zu hohen oder zu geringen Qualität führt. Einerseits hängt der Unterschied zwischen
der marginalen und der durchschnittlichen Zahlungsbereitschaft von der Funktion v ab,
zum anderen ist im allgemeinen θ̂m verschieden von θ̂∗ , so dass man die beiden Bedingungen (Monopol und Wohlfahrtsoptimum) nicht miteinander vergleichen kann. Man
kann lediglich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Qualitätswahl des Monopols auch
bei vorgegebenem marginalem Konsumenten ineffizient ist. Es hängt von der Nachfragestruktur und den Produktionskosten ab, ob das monopolistische Qualitätsangebot höher
oder niedriger als das soziale Optimum ausfällt. Ist jedoch ∂v(q, θ)/∂q unabhängig von θ,
d. h. ist die marginale Zahlungsbereitschaft für höhere Qualität bei allen Konsumenten
gleich, dann stimmen q m und q ∗ überein.
Beispiel:
Es sei v(q, θ) = q θ, wobei θ auf dem Intervall [0, 1] gemäß der Verteilungsfunktion
F (θ) = θ2 verteilt ist. Der Monopolist wählt q ∈ [0, 1]; seine Stückkosten betragen
c(q) = q 2 . Dann folgt aus den Bedingungen erster Ordnung, dass θ̂m = 2q m und q m =
2θ̂m (q m θ̂m − q m2 )/(1 − θ̂m2 ). Dies ergibt die Monopollösung
√
2
qm =
,
4
θ̂m =
√
2
.
2
Die beiden Gleichungen aus dem Wohlfahrtsmaximum sind äquivalent zu [2(1 + θ̂∗ +
θ̂∗2 )]/[3(1 + θ̂∗ )]. Im Wohlfahrtsoptimum gilt daher
∗
q =
√
3−1
,
2
∗
θ̂ =
√
3−1
.
2
Da q ∗ > q m und θ̂∗ < θ̂m ist sowohl die Angebotsmenge als auch die Qualität im Monopol
geringer als im sozialen Optimum.
63
3 Theorie des Monopols
Monopol als Hersteller einer Vorleistung
Im folgenden soll nun der Fall untersucht werden, dass ein Monopolist nicht an einen
Endverbraucher verkauft, sondern an ein anderes, möglicherweise ebenfalls monopolistisches Unternehmen. Ein Beispiel wäre der Verkauf eines Produktes durch ein Monopol
(A) an einen monopolistischen Einzelhändler (B). Ersterer bietet sein Produkt zum Preis
pA an, der dann das Gut zum Preis pB an den Endverbraucher weiterverkauft. Eine solche
Situation wird häufig mit dem Begriff vertikale Struktur bezeichnet. Wenn wir uns
die Konsumenten ganz unten vorstellen, liegen die verschiedenen Ebenen der Produktion
in Lagen darüber: ganz oben die Gewinnung von Rohstoffen und die Herstellung erster
Vorprodukte, darunter möglicherweise mehrere Ebenen der Weiterverarbeitung, dann
die Endproduktion der Konsumgüter (und darunter gegebenenfalls noch Groß- und Einzelhandel). Man spricht auch häufig von Upstream-Unternehmen (hier Unternehmen
A) und Downstream-Unternehmen (hier Unternehmen B).
Die Kosten von A seien durch C(x) = cx gegeben, B hat Kosten von 0. Die Nachfrage
der Konsumenten nach dem Gut sei x = D(p).
Wenn der Einzelhändler den Preis pB wählt, dann muss er D(pB ) Einheiten vom Hersteller kaufen. Der Gewinn des Produzenten ist daher
ΠA (pA , pB ) = (pA − c) D (pB ) .
Der Gewinn des Einzelhändlers beträgt
ΠB (pA , pB ) = (pB − pA ) D (pB ) .
Der Einzelhändler maximiert also seinen Gewinn, indem er den Preis pB so wählt, dass
m
′
m
(pm
B − pA ) D (pB ) + D (pB ) = 0
ist. Der Einzelhandelspreis hängt also implizit vom Einkaufspreis ab. Diese Abhängigkeit
können wir durch eine Funktion p̃B (pA ) beschreiben und die Lösung der Bedingung
erster Ordnung durch pm
B = p̃B (pA ). Je höher die Stückkosten des Einzelhändlers (pA ),
desto höher der Endverkaufspreis pB . Dies sieht man wie folgt: Für zwei unterschiedliche
Einkaufspreise p′A und p′′A impliziert die Gewinnmaximierung des Einzelhändlers
p̃B (p′A ) − p′A D p̃B (p′A ) > p̃B (p′′A ) − p′A D p̃B (p′′A )
sowie
p̃B (p′′A ) − p′′A D p̃B (p′′A ) > p̃B (p′A ) − p′′A D p̃B (p′A ) .
Die Addition beider Ungleichungen ergibt
h
i
p′′A − p′A
p̃B (p′A ) − D p̃B (p′′A ) > 0.
Für p′′A > p′A ist also D p̃B (p′A ) > D p̃B (p′′A ) . Wenn die Nachfrage fallend verläuft ist
also p̃B (p′A ) < p̃B (p′′A ).
64
3.5 Werbung und Qualität
Der Hersteller berücksichtigt bei seiner Entscheidung natürlich, dass der Einzelhändler
den Preis auf p̃B (pA ) festsetzen wird. Der optimale Preis des Herstellers folgt also aus
der Bedingung
′ m ∂ p̃B
pm
+ D (pm
A − c D (pB )
B ) = 0.
∂pA
m
Es gilt also pm
B > pA > c. Durch die vertikale Struktur erfolgt also eine doppelte Monopolpreisbildung, d. h. ein zweifacher Preisaufschlag, den man auch als doppelte Marginalisierung bezeichnet.
Der Endverbrauchspreis ist höher, als bei einem Direktverkauf des Gutes an den Konsumenten durch den Monopolistischen Produzenten. In diesem Fall ist der Monopolpreis
m
m
pm = p̃B (c). Da aber pm
Die doppelte Marginalisierung bedeutet also
A > c ist pB > p
eine Verschlechterung für die Konsumenten.
Erstaunlicherweise wird der Gesamtgewinn bei der doppelten Marginalisierung nicht
maximiert — der Monopolgewinn bei Direktverkauf ist höher als die Summe der Einzelgewinne
ΠA (pA , pB ) + ΠB (pA , pB ) = (pB − c) D (pB ) .
Diese Summe würde durch den Preis pm = p̃B (c) maximiert werden. Da jedoch der monopolistische Hersteller pm
A > c verlangt, wählt auch der monopolistische Einzelhändler
m
den höheren Preis p̃B (pA ). Die Produzentenrente ist geringer als bei einem integrierten
Monopol.
Für die Unternehmen gibt es die folgenden Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen:
• vertikale Integration: Beide Unternehmen schließen sich zusammen. Dies führt
zu einer Erhöhung der Produzentenrente und auch der Konsumentenrente.
• Franchise–Vertrag: Der Produzent verkauft das Gut zum Preis pA = c an den
Einzelhändler, der ihm eine von der Menge unabhängige Franchise–Gebühr in Höhe
von p̄ zahlt. Der Endverkaufspreis wird pm = p̃B (c) betragen. Wird der Preis p̄ so
m
m
m m
gewählt, dass gilt: ΠA (pm
A , pB ) < p̄ < Π(p ) − ΠB (pA , pB ) stellen sich sowohl
Hersteller als auch Einzelhändler besser.
• Preisbindung der zweiten Hand: Der Hersteller macht die Auflage, dass der
Einzelhändler das Gut zum Preis pm weiterverkaufen muss. Dies ist häufig gesetzlich untersagt, da dadurch der Wettbewerb unter den Einzelhändlern beschränkt
werden könnte.
• Konkurrenz unter Einzelhändlern: In diesem Fall wird der Einzelhandelspreis
bei pB = pA liegen. Der Hersteller muss nur pA = pm setzen, um den Gesamtgewinn
zu maximieren.
65
3 Theorie des Monopols
3.6 Das Mehrprodukt–Monopol
Bisher hatten wir unsere Analyse des Monopols immer auf den Fall beschränkt, in dem
der Monopolist nur ein Gut herstellt. Allerdings ist ein solcher Fall in der Realität recht
selten zu beobachten (am ehesten bei Monopolen auf bestimmte Rohstoffe). Viel häufiger
trifft man auf den Fall, in dem ein Monopol mehrere Güter herstellt. Dabei muss nicht
notwendigerweise gelten, dass das Unternehmen auf alle produzierten Güter ein Monopol
hat. Oftmals reicht es aus, wenn das Unternehmen auf einem Markt, d. h. für ein Gut
ein Monopol besitzt, um seine Monopolmacht auch auf andere Märkte ausdehnen zu
können.
Um die wesentlichen Effekte, die bei einem Mehrprodukt–Monopol auftreten können zu
analysieren, gehen wir zuerst von dem einfachen Fall aus, in dem der Monopolist über
nur zwei (monopolisierte) Güter verfügt.
Die Nachfragen nach den beiden Gütern seien gegeben durch
x1 = D1 (p1 , p2 )
und x2 = D2 (p1 , p2 ) .
Es wird angenommen, dass ∂Di (p1 , p2 ) /∂pi < 0 für i = 1, 2 gilt, d. h., dass die Nachfrage
im eigenen Preis abnimmt. Die Kreuzpreiseffekte ∂Di (p1 , p2 ) /∂pj (i = 1, 2) sind bei
Substituten positiv, bei komplementären Gütern negativ. Die Kosten der Produktion
sind gegeben durch C (x1 , x2 ). Der Gewinn des Monopolisten Π (p1 , p2 ) ergibt sich dann
als
Π (p1 , p2 ) = p1 D1 (p1 , p2 ) + p2 D2 (p1 , p2 ) − C D1 (p1 , p2 ) , D2 (p1 , p2 ) .
Die Bedingungen erster Ordnung für ein Gewinnmaximum sind
∂C ∂D1
∂C ∂D2
∂Π (p1 , p2 )
m
m
= p1 −
+ D1 + p 2 −
= 0
∂p1
∂x1 ∂p1
∂x2 ∂p1
und
∂Π (p1 , p2 )
=
∂p1
pm
2
∂C
−
∂x2
∂D2
∂C ∂D1
m
+ D2 + p 1 −
= 0.
∂p2
∂x1 ∂p2
Im Unterschied zum Einprodukt–Monopol wird die Abweichung von Preisen und Grenzkosten auch von den Kreuzpreiseffekten mitbestimmt: Wenn z. B. Gut 1 ein Substitut
für Gut 2 ist, dann schafft sich der Monopolist selbst eine Konkurrenz im Markt für
Gut 2, wenn er eine größere Menge von Gut 1 zu einem niedrigeren Preis anbietet. Dies
berücksichtigt er, indem er von Gut 1 noch weniger anbietet als im normalen Monopolfall. Bei komplementären Gütern führt eine Erhöhung von p1 zu einer Senkung der
Nachfrage nach Gut 2. Er kann die Nachfrage nach Gut 2 dadurch erhöhen, dass er Gut
1 in größerer Menge zu einem geringeren Preis anbietet. Dieser Effekt könnte sogar so
stark sein, dass er einen Preis verlangt, der unterhalb der Grenzkosten liegt.
Beispiel:
Die Kostenfunktion des Monopolisten sei C(x1 , x2 ) = c1 x1 + c2 x2 . Die Nachfragefunktionen seien gegeben durch
D1 (p1 , p2 ) =
66
b (a − p1 ) − g (a − p2 )
b2 − g 2
3.7 Tie–ins und Bundling
und
D2 (p1 , p2 ) =
b (a − p2 ) − g (a − p1 )
.
b2 − g 2
Aus den Bedingungen erster Ordnung ergibt sich dann die Lösung
pm
1 = 0.5 (a + c1 )
und pm
2 = 0.5 (a + c2 ) .
Wären z. B. die Grenzkosten gegeben durch c1 = 3/2, c2 = 0 und die Parameter durch
a = 1, b = 2, und g = −3/2, dann sind D1 = 1/7, D2 = 5/14 und pm
1 = 5/4 < c1 . Da
die beiden Güter Komplemente sind, nimmt der Monopolist Verluste bei Gut 1 in Kauf,
um den Absatz von Gut 2 zu erhöhen.
3.7 Tie–ins und Bundling
Ein Mehrprodukt–Monopolist kann unter Umständen seinen Gewinn erhöhen, indem er
die betreffenden Güter nicht einzeln, sondern nur zusammen, in einem Paket anbietet.
Man spricht hier von sogenannten Tie–in sales oder von Bundling. Dabei wird häufig
unterschieden, ob es zwei oder mehr Güter nur noch gebündelt gibt, was als Tying
bezeichnet wird, oder ob ein Paket als eine zusätzliche Option angeboten wird, die Güter
aber weiterhin auch einzeln erhältlich sind, was mit dem Begriff Bundling bezeichnet
wird. Die deutschen Begriffe wären etwa Kopplungsklauseln oder Paketangebote.
Beispiele hierfür wären etwa Menüs in Gaststätten, Pauschalreisen ( all inclusive‘), das
’
Office Paket‘ von Microsoft etc.
’
Betrachten wir das folgende einfache Beispiel, in dem der Monopolist zwei Güter anbietet
und die Konsumenten unterschiedliche Präferenzen über diese beiden Güter haben. Die
Produktionskosten betragen 0. Jeder Konsument kauft maximal eine Einheit von jedem
Gut. Seine Zahlungsbereitschaft für das Gut i, vi (θ), hängt von seinem Charakteristikum
θ ab.
Der Parameter θ sei auf dem Intervall [0, 1] gleichverteilt und die Gesamtmasse der
Konsumenten sei auf 1 normiert. Es wird angenommen, dass für die Konsumenten die
beiden Güter unabhängig sind. Die Zahlungsbereitschaft für den Erwerb beider Güter
ist für einen Konsumenten des Typs θ also v1 (θ) + v2 (θ). Im Beispiel sei
v1 (θ) = rθ
und v2 (θ) = r(1 − θ).
Das bedeutet, dass diejenigen Konsumenten, die eine hohe Zahlungsbereitschaft für Gut
1 haben, eine niedrige Zahlungsbereitschaft für Gut 2 aufweisen und umgekehrt. Die
Zahlungsbereitschaften für die beiden Güter sind bei jedem Konsumenten negativ korreliert.
Wenn der Monopolist die beiden Güter separat zu Preisen p1 und p2 anbietet, dann kauft
der Konsument θ das Gut 1, wenn gilt θ > p1 /r, und Gut 2, wenn gilt θ < 1 − p2 /r.
Aufgrund der Gleichverteilung von θ beträgt die Nachfrage nach Gut i also Di (p1 , p2 ) =
67
3 Theorie des Monopols
1 − pi /r. Der Monopolist maximiert seinen Gewinn p1 D1 + p2 D2 , wenn er die Preise
gleich
m
pm
1 = p2 =
r
2
setzt. Die Nachfragen sind dann
D1 (r/2) = D2 (r/2) = 1 −
1
r/2
= .
r
2
Der sich ergebende Gewinn ist damit
π=
r 1 r 1
r
+
= .
22 22
2
Hier kauft kein Konsument beide Güter. Ein Konsument mit θ ≤ 1/2 kauft nur Gut 2,
die übrigen Konsumenten kaufen nur Gut 1.
Wenn der Monopolist jedoch ein Paketangebot macht, dann kann er einen höheren Gewinn erzielen, wie die folgende Überlegung deutlich macht: Er bietet beide Güter nur
zusammen zu einem Preis p̄ an.
Da die Zahlungsbereitschaft jedes Konsumenten für dieses Bündel v1 (θ) + v2 (θ) = r
beträgt, ist der Monopolpreis offensichtlch
p̄m = r.
Zu diesem Preis erwerben alle Konsumenten das Bündel und der Monopolist macht einen
Gewinn von r. Diese Strategie ist also bedeutend profitabler, da er dadurch die Konsumentenrente besser abschöpfen kann. Man kann zeigen, dass ein solches Paketangebot
eine implizite Form der Preisdiskriminierung darstellt.
Der Monopolist schränkt durch solche Paketangebote die Wahlfreiheit der Konsumenten
ein. Eine allgemeine Form stellen die Kopplungsklauseln dar, die einen Konsumenten
zwingen bei der Anmietung bzw. dem Kauf eines Gutes gleichzeitig noch ein anderes Gut
mitzuerwerben bzw. anzumieten. Durch solche Maßnahmen kann der Monopolist neben
einer besseren Abschöpfung der Konsumentenrente auch versuchen, seine Marktmacht
auf andere Märkte auszudehnen.
3.8 Differenzierte Güter und monopolistischer
Wettbewerb
In diesem Abschnitt diskutieren wir einen Modellrahmen, der in der Literatur als monopolistische Konkurrenz bekannt ist. In diesem Modell ist die Zahl der differenzierten
Produkte endogen bestimmt. Es werden die folgenden Annahmen getroffen:
1. Die Konsumenten sind homogen bzw. es gibt einen repräsentativen Konsumenten;
2. es gibt eine potentiell unendliche Anzahl verschiedener Marken;
68
3.8 Differenzierte Güter und monopolistischer Wettbewerb
3. es gibt freien Marktzutritt.
Betrachten wir eine Industrie, in der i = 1, 2, 3, . . . , N verschieden Marken eines Produktes hergestellt werden. Dabei wird N endogen bestimmt.
Konsumenten Der Nutzen des repräsentativen Konsumenten ist gegeben durch die
Nutzenfunktion
∞
X
√
u (y1 , y2 , . . .) =
yi .
i=1
Bei einer solchen Nutzenfunktion sehen die Indifferenzkurven so aus wie in Abbildung
8.24 dargestellt.
80
60
40
20
20
40
60
80
100
Abbildung 8.24: Indifferenzkurve
Man beachte, dass die Indifferenzkurven die Achsen berühren, d. h. ein Konsument kann
auch dann Nutzen erzielen, wenn manche Marken nicht produziert werden.
Das Einkommen des Konsumenten
(I) besteht aus den Lohnzahlungen der Firmen W
PN
und den Gewinnen Π = i=1 πi . Es handelt sich also bei diesem Modell um ein Modell des allgemeinen Gleichgewichts, in dem die Unternehmen den Konsumenten
gehören. Der Lohnsatz ist auf 1 normiert.
Die Konsumenten maximieren ihren Nutzen unter der Budgetbeschränkung
N
X
pi yi = I = W + Π.
i=1
Bilden der Lagrangefunktion (L) und deren partieller Ableitungen, die dann gleich null
gesetzt werden ergeben die Bedingungen erster Ordnung
∂L
1
= √ − λpi = 0,
∂yi
2 yi
69
3 Theorie des Monopols
für alle i = 1, 2, . . . , N und
N
X
∂L
pi yi = 0.
=I−
∂λ
i=1
Wir erhalten für die nachgefragten Mengen in Abhängigkeit von den Preisen bzw. für
die Preis-Absatz-Funktionen
yi (pi ) =
1
4λ2 p2i
bzw. pi (yi ) =
1
√ .
2λ yi
Die Preiselastizität der Nachfrage ist:
ηp (y) =
dyi (pi ) pi
= −2.
dpi yi
Achtung: Wir haben die letzte Bedingung erster Ordnung nicht benutzt. Stattdessen
wurde λ in der Rechnung als Konstante behandelt; λ hängt aber in diesem Modell
eigentlich auch von N ab — die Annahme, es sei konstant wäre nur dann völlig korrekt,
wenn es ein Kontinuum von Marken geben würde. Aber als Approximation ist diese
Annahme akzeptabel.
Firmen Jede Marke wird von einem Unternehmen produziert. Alle Unternehmen haben
die gleiche Kostenfunktion gegeben durch
F + cyi falls yi > 0
.
Ci (yi ) =
0
falls yi = 0
Grafisch kann man die Kostenfunktion (mit Durchschnitts– und Grenzkosten) darstellen
wie in Abbildung 8.25 gezeigt.
AC,MC
y
Abbildung 8.25: Durchschnitts- und Grenzkosten
70
3.8 Differenzierte Güter und monopolistischer Wettbewerb
Gleichgewicht auf einem Markt mit monopolistischer Konkurrenz Gleichgewichte
bei monopolistischer Konkurrenz können nun wie folgt definiert werden.
Definition 7 Das Tripel
o
n
mk
mk
mk
N , pi , yi i=1,...,N mk
heißt Gleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz wenn die folgenden
Bedingungen erfüllt sind
1. Unternehmen: Jedes Unternehmen verhält sich als Monopolist bezüglich seiner Marke, d. h. gegeben die Nachfrage nach Marke i wählt das Unternehmen
die Menge yimk die ihren Gewinn πi = pi (yi ) yi − Ci (yi ) maximiert.
2. Konsumenten: Jeder Konsument betrachtet Einkommen und Preise als gegeben und maximiert seinen Nutzen unter Berücksichtigung der Budgetbeschränkung.
3. Freier Marktzutritt: Freier Marktzutritt führt
dazu, dass jedes Unterneh
mk
men einen Gewinn von 0 macht, d. h. πi yi
= 0.
4. Ressourcenbeschr
änkung: Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage sind
PN
gleich, d. h. i=1 (F + cyi ) = L.
Das Gleichgewicht ist in Abbildung 8.26 grafisch illustriert.
p
pmc
ymc
y
Abbildung 8.26: Gleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz
Die Nachfrage nach dem Produkt eines existierenden Unternehmens hängt u. a. von
der Zahl der Marken N ab. Mit zunehmender Zahl von Produkten verringert sich die
Nachfrage für jedes produzierende Unternehmen, d. h. die Nachfragefunktion verschiebt
sich nach unten, da die Konsumenten eine geringere Menge von jeder Marke, aber eine
größere Anzahl verschiedener Marken konsumieren. Daher führt freier Marktzutritt zu
71
3 Theorie des Monopols
einer Zunahme an differenzierten Produkten bis die Nachfragefunktion tangential an
der Durchschnittskostenfunktion anliegt. In diesem Punkt macht jedes produzierende
Unternehmen einen Gewinn von 0 und der Marktzutritt hört auf. Dieses Gleichgewicht
wird auch als Chamberlains Tangentiallösung bezeichnet.
Die Berechnung eines Gleichgewichts mit monopolistischer Konkurrenz Das Problem eines Unternehmens i ist identisch mit dem Problem, das wir im Abschnitt 3.2
über das Monopol diskutiert haben. Wir haben dort gesehen, dass in diesem Fall gilt
1
pi
M Ri (yi ) = pi 1 +
=
= c = M C (yi ) .
η
2
Der Gleichgewichtspreis für jede Marke ist daher gegeben durch pmc
= 2c. Die Nulli
Gewinn-Bedingung impliziert nun, dass
mc
mc
0 = πi (yimc ) = (pmc
i − c) yi − F = cyi − F.
Daraus folgt
yimc =
F
.
c
Schließlich ist noch zu ermitteln, wie viele differenzierte Produkte angeboten werden.
Dies ergibt sich aus der Ressourcen–Beschränkung
N F + c (F/c) = L.
Einsetzen ergibt
N=
L
.
2F
Die Ergebnisse können im folgenden Theorem zusammengefasst werden.
Theorem 8
1. In einem Gleichgewicht mit monopolistischer Konkurrenz bei
strikt positiven Fix- und Grenzkosten wird nur eine endliche Anzahl von differenzierten Produkten hergestellt. Das Gleichgewicht ist gegeben durch
pmc
= 2c; yimc = F/c; N mc = L/2F.
i
2. Wenn die Fixkosten hoch sind, gibt es nur eine geringe Anzahl verschiedener
Marken und jede Marke wird in einer großem Menge hergestellt und konsumiert. Sind die Fixkosten gering, dann gibt es eine große Anzahl differenzierter
Produkte, die in geringen Mengen produziert und konsumiert werden.
72
Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bagnoli, M., S. Salant, und J. Swierzbinski (1989): “Durable-Goods Monopoly
with Discrete Demand,” Journal of Political Economy, 97, 1459–1478.
Coase, R. H. (1972): “Durability and Monopoly,” Journal of Law and Economics,
15(1), 143–149.
Dixit, A., und V. Norman (1978): “Advertising and Welfare,” Bell Journal of Economics, 9, 1–17.
Dorfman, R., und P. Steiner (1954): “Optimal Advertising and Optimal Quality,”
American Economic Review, 44, 826–836.
Oi, W. (1971): “A Disneyland Dilemma: Two-Part Tariffs for a Mickey Mouse Monopoly,” Quarterly Journal of Economics, 85, 77–96.
Shy, O. (1995): Industrial Organization: Theory and Applications. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
73
Literaturverzeichnis
74
4 Oligopole und strategisches
Verhalten
Nachdem wir nun die Marktformen der vollkommenen Konkurrenz, bei der man
im allgemeinen eine große Anzahl von Anbietern unterstellt, und des Monopols, bei
dem es nur einen Anbieter gibt, untersucht haben, wollen wir uns in diesem Abschnitt
mit dem interessantesten Fall befassen, dem Oligopol. Dieser Fall ist deshalb am interessantesten, da es hier eine kleine Anzahl von Anbietern gibt. In einer solchen Situation
muss jeder Anbieter bei seiner Entscheidung das Verhalten seiner Konkurrenten mitberücksichtigen, d. h., es handelt sich hierbei um eine Situation, in der sich die Anbieter
strategisch verhalten. Strategisches Verhalten wird in der Veranstaltung Spieltheo”
rie“ genauer untersucht. In dieser Veranstaltung werden wir auf einige der zentralen
Ergebnisse der Spieltheorie zurückgreifen.
In der Oligopoltheorie werden von der Literatur verschiedene Modelle untersucht.
Eine grundlegende Unterscheidung betrifft die Güter, die von den Marktteilnehmern
angeboten werden. Dabei kann es sich um
1. Märkte für homogene Güter oder
2. Märkte für differenzierte Produkte
handeln.
Eine andere Unterscheidung verschiedener Oligopolmodelle bezieht sich auf die von den
Unternehmen gewählten Variablen, d. h. der Menge (Mengenwettbewerb) oder dem
Preis (Preiswettbewerb).
Eine weitere Unterscheidung betrifft den zeitlichen Ablauf, der Entscheidungen der
Oligopolisten. Diese können entweder simultan oder sequentiell erfolgen.
Wir beginnen mit der Unterteilung in Märkte für homogene bzw. differenzierte Produkte und werden dann in jeder dieser Kategorien die angesprochenen Unterscheidungen
genauer untersuchen.
Zunächst führen wir kurz die wichtigsten spieltheoretischen Konzepte ein, die wir in
der Analyse der verschiedenen Modelle anwenden werden. In den genannten Modellen
kann die Wahl eines Preises oder einer Menge durch ein Unternehmen als die Wahl einer
Strategie aufgefasst werden.
Allgemein ist unter einer Strategie eine Handlungsanweisung zu verstehen, die
dem Unternehmen (oder allgemein: einem Spieler) für jede im Spiel mögliche
Situation angibt,, was der Spieler tun soll. Insbesondere gehen in die möglichen
Situationen die Verhaltensweisen der jeweils anderen Spieler ein.
75
4 Oligopole und strategisches Verhalten
In einem Spiel determinieren die Strategien aller Spieler (wir nennen dies auch eine
Strategienkombination) die Auszahlungen, die die einzelnen Spieler erhalten; etwa
den Gewinn eines Unternehmens.
Ein Gleichgewicht in einer solchen strategischen Entscheidungssituation ist eine
Strategienkombination derart, dass das Verhalten jedes Unternehmens eine
beste Antwort auf das Verhalten der anderen Unternehmen ist.
In einer solchen Situation würde keiner der Spieler seine Entscheidung bereuen. Für
jeden Spieler gilt: Gegeben das, was der andere getan hat, war mein Verhalten darauf
eine beste Antwort.
Dieses Gleichgewichtskonzept stammt aus der Spieltheorie und wird nach seinen ‘Erfinder’ John F. Nash als Nash–Gleichgewicht bezeichnet.
Beispiele für strategische Entscheidungssituationen: Das Gefangenendilemma
(die Zahlen bedeuten ‘Jahre im Gefängnis’, die Strategien sind d, gestehen (deviate)
und c, schweigen (cooperate)):
d
c
d 5, 5 0, 20
c 20, 0 1, 1
Wir gehen davon aus, dass jeder Gefangene möglichst kurz im Gefängnis sitzen will. Besser ist es, das Gefangenendilemma durch eine Auszahlungsmatrix zu beschreiben, wobei
Auszahlungen etwas positives sind, jeder Spieler also danach strebt, eine möglichst hohe
Auszahlung zu erreichen. Eine derartige Auszahlungsmatrix könnte etwa so aussehen.
d
c
d 1, 1 4, 0
c 0, 4 3, 3
Die Strategie d ist für jeden Spieler eine dominante Strategie; d. h. unabhängig davon,
was der andere tut, ergibt die Strategie d für jeden Spieler die beste Auszahlung. Daher ist das Nash–Gleichgewicht dieses Spiels die Strategienkombination (d, d) mit einer
Auszahlung von 1 (entspricht ‘5 Jahren Gefängnis’) für jeden Spieler.
Battle of the Sexes
links rechts
oben
2, 1
0, 0
1, 2
unten 0, 0
Wie ist das Nash–Gleichgewicht in diesem Spiel zu finden?
Es gibt keine dominanten Strategien, die beste Antwort hängt von der Strategie des
anderen Spielers ab.
76
4.1 Mengenwettbewerb bei homogenen Gütern
Wir wissen, dass im Nash–Gleichgewicht jede Strategie eine beste Antwort auf die Strategie des Gegners sein muss. Die Strategienkombination (oben, rechts) wäre kein Nash–
Gleichgewicht.
Gegeben dass Spieler 1 die Strategie ‘oben’ wählt, könnte Spieler 2 sich verbessern, wenn
er ‘links’ statt ‘rechts’ spielt und eine Auszahlung in Höhe von 1 (statt 0) Geldeinheiten
bekommt.
Analoges gilt bei der Kombination (unten, links). Bei den beiden Strategienkombinationen (oben, links) bzw. (unten, rechts) kann keiner der beiden Spieler — bei gegebener
Strategie des anderen — profitabel abweichen. In diesem Spiel gibt es also zwei Nash–
Gleichgewichte (in reinen Strategien).
Matching Pennies
Kopf
Zahl
Kopf Zahl
1, −1 −1, 1
−1, 1 1, −1
In diesem Spiel gibt es weder dominante Strategien noch ein Nash–Gleichgewicht in
reinen Strategien. Bei jeder Strategienkombination gibt es für einen Spieler einen
Anreiz, von seiner Strategie abzuweichen.
Es kann jedoch gezeigt werden, dass es in vielen Situationen, in denen kein Nash–
Gleichgewicht in reinen Strategien existiert, es dennoch ein solches Gleichgewicht in
gemischten Strategien gibt. Eine gemischte Strategie bedeutet, dass ein Spieler eine reine Strategie nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit spielt. Im obigen Spiel
besteht das Nash–Gleichgewicht etwa darin, dass jeder Spieler seine beiden reinen Stra1
tegien jeweils mit der Wahrscheinlichkeit spielt.
2
4.1 Mengenwettbewerb bei homogenen Gütern
Das Cournot–Modell
Das erste Modell, das wir im weiteren untersuchen werden, stammt von dem französischen Ökonomen Augustin Cournot aus dem Jahr 1838.
Hier wird die folgende Situation untersucht: Es gibt zwei Unternehmen, deren Kostenfunktionen wie folgt spezifiziert sind.
Ci (yi ) = ci yi
i = 1, 2 mit c1 , c2 ≥ 0.
Die Preis-Absatz-Funktion für das homogene Produkt ist gegeben durch
p(Y ) = a − b Y,
a, b > 0,
wobei Y = y1 + y2 ist.
Der Marktpreis ist also von der Gesamtmenge abhängig. Aufgrund dieser Tatsache besteht zwischen den beiden Unternehmen eine Interdependenz. Optimales Verhalten
77
4 Oligopole und strategisches Verhalten
in solchen interdependenten oder strategischen Entscheidungssituationen wird mit
Hilfe der Spieltheorie untersucht.
Im Cournot–Modell wird davon ausgegangen, dass die Aktionen oder die strategischen Variablen der Unternehmen die am Markt angebotenen Mengen yi sind. Die
Unternehmen wählen ihre Aktionen oder Strategien simultan, d. h. in Unkenntnis des
Verhaltens des Konkurrenten. Jedes Unternehmen wählt also ein yi ∈ Si , wobei Si die
Menge der möglichen Strategien für Unternehmen i bezeichnet. Bei dieser Menge handelt
es sich in unserem Fall um das Intervall [0, ∞).
Der Gewinn eines Unternehmens ist gegeben durch
πi (y1 , y2 ) = p (y1 + y2 ) yi − Ci (yi ).
Durch die Angabe
• der Spielermenge {1, 2},
• der Strategienmengen Si , für alle i ∈ I,
• und der Auszahlungsfunktionen πi (y1 , y2 ), für alle i ∈ I
wird ein Spiel in Normalform definiert.
Ein Gleichgewicht in diesem Spiel kann nun wie folgt charakterisiert werden:
Definition 8 Ein Cournot–Nash Gleichgewicht besteht aus Mengen y1∗ und y2∗
sowie einem Preis p∗ , so dass
1. die Menge y1∗ das Maximierungsproblem
max π(y1 , y2∗ )
y1
löst
2. die Menge y2∗ das Maximierungsproblem
max π(y1∗ , y2 )
y2
löst sowie
3. p∗ = a − b (y1∗ + y2∗ ) gilt.
In Worten: Ein Cournot–Nash Gleichgewicht besteht aus Outputmengen derart, so dass
— gegeben das Outputniveau des Konkurrenten — kein Unternehmen in der Lage ist,
seinen Profit durch Wahl einer anderen Menge zu erhöhen. Die gewählten Mengen sind
also wechselseitig beste Antworten. Zudem ergibt sich der Marktpreis als Wert der Preis–
Absatz–Funktion bei der aggregierten angebotenen Menge.
78
4.1 Mengenwettbewerb bei homogenen Gütern
Im folgenden wollen wir das Cournot–Nash Gleichgewicht für unser Modell berechnen.
Die Gewinnmaximierungsprobleme der beiden Unternehmen führen zu den Bedingungen
erster Ordnung
(4.1)
∂π1 (y1 , y2∗ )
= a − 2 b y1 − b y2 − c1 = 0
∂y1
und
(4.2)
∂π2 (y1∗ , y2 )
= a − b y1 − 2 b y2 − c2 = 0.
∂y2
Löst man die erste Gleichung nach y1 als Funktion von y2 auf, ergibt die die sogenannte
Reaktionsfunktion
y1 = R1 (y2 ) =
a − c1 1
− y2 .
2b
2
Diese Funktion gibt für jede Menge y2 des Spielers 2 die beste Antwort, d. h. die
gewinnmaximierende Menge y1 des Spielers 1 an.
Analog kann man die Reaktionsfunktion für Spieler 2 ermitteln:
y2 = R2 (y1 ) =
a − c2 1
− y1 .
2b
2
Diese beiden Reaktionsfunktionen kann man in das folgende Diagramm einzeichnen.
y2
R1 (y2 )
y2∗
R2 (y1 )
y1∗
y1
An der Stelle, an der die beiden Reaktionsfunktionen sich schneiden sind also die gewählten Mengen wechselseitig beste Antworten.
79
4 Oligopole und strategisches Verhalten
Keiner der Spieler hat ein Interesse, bei der gegebenen Strategie des anderen, von seiner
gewählten Menge abzuweichen. Dies ist aber genau die Eigenschaft eines Cournot–Nash
Gleichgewichts.
Die Reaktionsfunktionen haben eine negative Steigung: Wenn die ein Unternehmen seinen Output erhöht, dann führt das zu einer Verringerung des Preises. Es ist also für das
andere Unternehmen sinnvoll, die Menge zu senken, um den Preis zu stützen.
Algebraisch kann man die wechselseitig besten Antworten berechnen, indem man das
Gleichungssystem löst.
Dabei ergeben sich als die gleichgewichtigen Mengen
y1∗ =
a − 2 c1 + c2
3b
und y2∗ =
a − 2 c2 + c1
.
3b
Die Gesamtmenge ist also
Y ∗ = y1∗ + y2∗ =
2 a − c1 − c2
3b
und der Gleichgewichtspreis ist
p∗ = a − b Y ∗ =
a + c1 + c2
.
3
Der Gewinn des Cournot–Duopolisten i ist
a − 2 ci + cj
a + ci + cj
∗ ∗
∗
− ci
p yi − c i yi =
3
3b
2
(a − 2 ci + cj )
=
= b yi∗ 2 .
9b
Man sieht, dass bei einer Senkung der Kosten von c1 auf c′1 , einer sogenannten Prozessinnovation, die Menge y1∗ wächst, während y2∗ geringer wird.
Außerdem wird der Gleichgewichtspreis p∗ fallen, und der Gewinn für Unternehmen 1
wird steigen, während der Gewinn für Unternehmen 2 abnehmen wird.
Das Cournot–Modell mit N Unternehmen
Betrachten wir nun ein Oligopol mit N Unternehmen. Zur Vereinfachung nehmen wir
an, dass alle Unternehmen die gleiche Kostenfunktion haben. d. h. ci = c für alle i =
1, . . . , N .
In diesem Fall können wir den Output eines repräsentativen Unternehmens als Funktion
der Outputmengen aller anderen Unternehmen bestimmen.
Wir ermitteln daher die Reaktionsfunktion des Unternehmens 1.
!
N
X
max π1 = p(Y ) y1 − c y1 = a − b
yi y1 − c y 1 .
y1
80
i=1
4.1 Mengenwettbewerb bei homogenen Gütern
Die Bedingung erster Ordnung lautet
N
X
∂π1
yi − c = 0.
= a − 2 b y1 − b
∂y1
i=2
Daraus ergibt sich
N
y1 = R1 (y2 , y3 , . . . , yN ) =
a−c 1X
−
yi .
2b
2 i=2
Wenn wir von einer symmetrischen Lösung ausgehen, können wir in der Reaktionsfunktion yi = y für alle i = 1, . . . , N setzen und erhalten
N
a−c
a−c
∗
∗
∗
.
sowie Y = N y =
y =
(N + 1) b
b
N +1
Gleichgewichtspreis und Gewinn für jedes Unternehmen sind
p∗ = a − b Y ∗ =
a+Nc
N +1
und
πi∗ =
(a − c)2
= b (y ∗ )2 .
2
(N + 1) b
Im Rahmen dieses Modells kann man die Frage stellen, was mit den Gleichgewichtsmengen, dem Gleichgewichtspreis und den Gewinnen passiert, wenn man die Zahl der
Unternehmen variiert.
Angenommen, die Zahl der Unternehmen wird immer größer. Dann gilt
lim y ∗ = 0
N →∞
sowie
lim Y
N →∞
∗
= lim
N →∞
a−c
b
N
N +1
=
a−c
b
.
Wenn die Zahl der Unternehmen über alle Grenzen wächst, dann wird der Output jedes
einzelnen Unternehmens immer geringer und der Gesamtoutput erreicht das Niveau wie
bei vollkommenem Wettbewerb.
Für den Gleichgewichtspreis gilt
a
Nc
∗
lim p = lim
+
= c,
N →∞
N →∞
N +1 N +1
d. h., wenn im Cournot–Modell die Zahl der Unternehmen immer größer wird, dann
konvergiert das Marktergebnis gegen das Marktergebnis bei vollkommener Konkurrenz.
Hierin liegt einer der Gründe, weshalb man bei vollkommener Konkurrenz immer von
einer großen Zahl von Unternehmen ausgeht.
81
4 Oligopole und strategisches Verhalten
4.2 Cournot und von Stackelberg–Modell
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass in einem Oligopol bzw. Duopolmodell die beiden
Unternehmen ihre Outputniveaus simultan wählen. Es gibt jedoch Situationen, die
man besser durch sequentielle Entscheidungen beschreiben kann. Hier legt also ein
Unternehmen sein Outputniveau fest, bevor der Konkurrent eine Produktionsmenge
wählt.
In einer solchen sequentiellen Entscheidungssituation wählt zuerst ein Unternehmen seine Produktionsmenge. Das andere Unternehmen beobachtet diesen Output und trifft
seinerseits seine Mengenentscheidung. Dann bildet sich der Marktpreis und der Output
wird verkauft.
Eine solche sequentielle Entscheidungsstruktur liegt z. B. dann vor, wenn sich bereits
ein Unternehmen im Markt befindet und eine andere erst noch in den Markt eintreten
möchte.
Wie wir bereits beim Monopol auf ein dauerhaftes Gut gesehen haben, werden wir ein
solches sequentielles Problem mit Hilfe der Rückwärtsinduktion lösen und werden dabei
hauptsächlich die folgenden Fragen untersuchen:
1. Ist es für ein Unternehmen besser, Stackelberg–Führer zu sein, d. h. zuerst die
Menge festzulegen, oder Stackelberg–Folger, als zweiter sein Outputniveau festzulegen?
2. Welches Marktergebnis im Vergleich zu Cournot–Wettbewerb wird sich herausbilden?
Ein derartiges sequentielles Entscheidungsproblem entspricht einem Spiel in Extensivform. Eine Strategie für das zweite Unternehmen legt in diesem Fall für jede Menge y1
des ersten Unternehmens fest, welche Menge das zweite anbietet, wenn es y1 beobachtet.
Für derartige Spiele existiert eine Verfeinerung des Nash–Gleichgewichts, das von Reinhard Selten eingeführte teilspielperfekte Nash–Gleichgewicht.
Um ein teilspielperfektes Nash–Gleichgewicht zu ermitteln, verwenden wir die Rückwärtsinduktion.
Wir beginnen unsere Analyse also mit der zweiten Periode. Hier hat der Stackelberg–
Führer (Unternehmen 1) bereits eine Produktionsmenge y1 gewählt. Der Stackelberg–
Folger (Unternehmen 2) wird nun seinen Output y2 so festlegen, dass er seinen Gewinn
— gegeben y1 — maximiert.
Dieses Problem ist identisch zu dem Problem von Unternehmen 2 im Cournot–Modell.
Gewinnmaximierung führt zur Reaktionsfunktion
R2 (y1 ) =
a − c2 1
− y1 .
2b
2
Unternehmen 2 wählt also seinen Output gemäß seiner Reaktionsfunktion.
Dies weiß Unternehmen 1, wenn es in der ersten Periode seine Mengenentscheidung trifft.
Dieses Wissen wird Unternehmen 1 bei der Wahl seiner Produktionsmenge berücksichtigen.
82
4.2 Cournot und von Stackelberg–Modell
Es hat also das folgende Optimierungsproblem
max π1 = p y1 + R2 (y1 ) y1 − c y1
y1
a − c y1
= a − b y1 +
y1 − c y 1 .
−
2b
2
Die Bedingung 1. Ordnung lautet
dπ1
a−c
= a − 2by1 +
+ by1 − c = 0
dy1
2
a−c
=⇒ a − c −
− by1 = 0.
2
Hieraus ergibt sich
y1s =
a−c
3
= y1∗ > y1∗ .
2b
2
Im Vergleich zum Cournot–Modell wird Unternehmen 1 im einer sequentiellen Entscheidungsstruktur einen höheren Output wählen.
Einsetzen dieses Wertes in die Reaktionsfunktion von Unternehmen 2 ergibt
y2s =
3
a−c
= y2∗ < y2∗ .
4b
4
Die Produktionsmenge von Unternehmen 2 ist geringer als im Cournot–Fall.
Wie kann man sich dieses Situation grafisch klarmachen?
Wir wissen, dass Unternehmen 2 sich immer auf seiner Reaktionsfunktion befinden wird.
Unternehmen 1 kann nun aber, da es seinen Output zuerst festlegen kann, einen Punkt
auf der Reaktionsfunktion der Unternehmen 2 wählen. Es maximiert seinen Gewinn also
auf der Reaktionsfunktion der Unternehmen 2.
Welcher Punkt auf der Reaktionsfunktion maximiert aber den Gewinn?
Um diesen Punkt zu ermitteln, führen wir das Konzept der Isoprofitlinien ein, die wir
schon in die Grafik zum Cournot–Nash–Gleichgewicht eingezeichnet hatten.
Eine Isoprofitlinie gibt alle Mengenkombinationen der beiden Unternehmen an, die zum
gleichen Gewinn für ein Unternehmen führen.
Für Unternehmen 1 besteht sie aus allen (y1 , y2 )–Kombinationen, die die Gleichung
π̄1 = a y1 − b y1 y2 − b y12 − c y1
erfüllen und für Unternehmen 2 aus allen für die gilt
π̄2 c = ay2 − by1 y2 − by22 − cy2 .
Eine Isoprofitlinie für Unternehmen 1 sieht so aus.
83
4 Oligopole und strategisches Verhalten
y2
R1 (y2 )
y1
Höhere Gewinne für Unternehmen 1 liegen unterhalb der Isoprofitlinie, darüber liegen
niedrigere Gewinne.
Die folgt daraus, dass für jeden Output von Unternehmen 1 eine Senkung des Outputs
durch Unternehmen 2 über die Preis–Absatz–Funktion der Preis steigt, so dass Unternehmen 1 seinen Gewinn erhöht.
Erhöht hingegen Unternehmen 2 seinen Output sinkt der Preis und damit der Gewinn
für Unternehmen 1.
Man sieht, dass die Isoprofitlinie ihr Maximum auf der Reaktionsfunktion des Unternehmens 1 annimmt, denn auf dieser Kurve liegt ja die beste Antwort auf jede Menge von
Unternehmen 2. Daher muss der Gewinn zurückgehen, wenn sich die Menge y1 von der
Reaktionsfunktion entfernt.
Für Unternehmen 2 sieht eine Isoprofitlinie so aus.
y2
R2 (y1 )
y1
Die von Stackelberg–Lösung sieht grafisch so aus.
84
4.2 Cournot und von Stackelberg–Modell
y2
y2S
R2 (y1 )
y1
y1S
Die niedrigste erreichbare Indifferenzkurve für Unternehmen 1 ist diejenige, die die Reaktionsfunktion des Unternehmens 2 gerade tangiert.
Höhere Isoprofitlinien sind nicht gewinnmaximierend und niedrigere sind nicht erreichbar.
Das von Stackelberg–Gleichgewicht ist grafisch der Tangentialpunkt.
Man erkennt, dass sich der Stackelberg–Führer gegenüber dem Cournot–Nash–Gleichgewicht
verbessert, während der Stackelberg–Folger einen niedrigeren Gewinn macht.
Der gleichgewichtige Marktpreis im Stackelberg–Modell ergibt sich als
a−c a−c
s
p = a−b
+
2b
4b
3(a − c)
= a−b
4b
a + 2c
a + 3c
<
= p∗ .
=
4
3
Für die Gleichgewichtsmenge ergibt sich:
Ys =
3(a − c)
2(a − c)
>
= Y ∗.
4b
3b
Wir können diese Ergebnisse im folgenden Theorem zusammenfassen.
Theorem 9 In einer Situation mit sequentieller Mengenwahl ergibt sich ein höherer
aggregierter Output und ein geringerer Marktpreis als im statischen Cournot–Modell.
Außerdem kann man sich leicht überlegen, dass der Gewinn des Stackelberg–Führers
höher sein muss als im Cournot–Modell: Er könnte ja die gleiche Menge anbieten wie im
Cournot–Modell. Darauf würde das andere Unternehmen gemäß ihrer Reaktionsfunktion ebenfalls mit der Cournot–Menge reagieren. Beide Unternehmen erhielten in einer
solchen Situation den gleichen Gewinn wie im Cournot–Modell.
85
4 Oligopole und strategisches Verhalten
Im Stackelberg–Modell wählt Unternehmen 1 aber eine andere Menge. Dies tut sie deshalb, weil sie sich auf diese Weise einen höheren Gewinn garantieren kann.
Dies sieht man auch unmittelbar, wenn man die Gewinne ausrechnet:
π1s =
(a − c)2
(a − c)2
> π1∗ und π2s =
< π2∗ .
8b
16b
Der Gewinn des Stackelberg–Führers ist also höher als im Cournot–Fall, während der
Gewinn des Stackelberg–Folgers geringer ist.
Man spricht in diesem Fall von einem first mover advantage.
Man kann in diesem Zusammenhang natürlich die Frage stellen, warum ein Unternehmen
nicht auch im Cournot–Modell damit drohen würde, die Stackelberg–Menge anzubieten.
Man kann sich leicht überlegen, dass eine solche Drohung nicht ernst genommen werden würde: Angenommen, Unternehmen 1 würde einen solchen Output ankündigen und
überlegen, dass Unternehmen 2 dann einen Punkt auf seiner Reaktionsfunktion wählen
würde.
In diesem Fall aber wäre die Stackelberg–Menge keine beste Antwort, d. h., diese Outputkombination wäre bei simultaner Entscheidung kein Cournot–Nash–Gleichgewicht.
Dies kann man sich anhand der folgenden Zeichnung verdeutlichen.
y2
y2S
R2 (y1 )
y1
y1S
4.3 Mengenwettbewerb bei differenzierten Produkten
Bisher sind wir in den Oligopolmodellen immer davon ausgegangen, dass die Unternehmen homogene Güter herstellen. Allerdings ist diese Annahme aus mehreren Gründen
recht restriktiv.
1. Viele Industrien produzieren eine große Menge von ähnlichen, aber nicht identischen Gütern.
86
4.3 Mengenwettbewerb bei differenzierten Produkten
2. Nur eine kleine Zahl aller möglichen Varianten differenzierter Güter wird tatsächlich
hergestellt.
3. Die meisten Industrien, in denen differenzierte Güter hergestellt werden, sind konzentriert, d. h., es gibt dort zwischen 2 und 5 Unternehmen.
4. Die Konsumenten kaufen nur eine kleine Teilmenge der angebotenen Varianten.
Die Modelle oligopolistischen Wettbewerbs mit differenzierten Gütern werden in zwei
große Kategorien eingeteilt: solche mit einer endogenen Anzahl von Produktvarianten
und solche mit einer fest gegebenen Zahl von differenzierten Gütern. Die letzteren können
dann wieder — wie bekannt — in solche mit Mengen- bzw. Preiswettbewerb sowie simultane oder sequentielle Strategiewahl unterteilt werden.
Wir betrachten zuerst ein einfaches Modell mit fixer Zahl von Produktvarianten und
simultaner Mengenwahl, d. h., es handelt sich um das Cournot–Modell mit differenzierten
Gütern.
Gegeben seien 2 Unternehmen, deren Produktion kostenlos ist (diese Annahme dient
nur der Vereinfachung).
Die Preis-Absatz-Funktionen lauten
p1 (y1 , y2 ) = α − βy1 − γy2
und
p2 (y1 , y2 ) = α − βy2 − γy1 .
Dabei gilt β > 0 und β 2 > γ 2 (oder |β| > |γ|).
Es gibt also zwei verschiedene Marken des Produkts.
Die Annahme dass β 2 > γ 2 ist wichtig, denn sie besagt, dass der Einfluss von y1 auf p1
größer ist als der Einfluss von y2 . Anders ausgedrückt: Der Eigenpreiseffekt dominiert
den Kreuzpreiseffekt.
Man überlegt sich leicht, dass die Güter sehr stark differenziert sind, wenn der Parameter
γ sehr klein ist. Sind jedoch β und γ ungefähr gleich groß, dann sind die beiden Güter
eher homogen.
Um das Cournot–Nash–Gleichgewicht für Märkte mit differenzierten Gütern zu ermitteln, gehen wir genauso vor wie im normalen Cournot–Modell:
Wir maximieren den Gewinn des Unternehmens i für gegebene Strategie yj des anderen
Unternehmens j = 3 − i und ermitteln so die Reaktionsfunktion.
max πi (y1 , y2 ) = (α − βyi − γyj ) yi .
yi
Die Bedingung 1. Ordnung ist
∂πi
= α − 2βyi − γyj = 0.
∂yi
Die Reaktionsfunktion ist also
α − γyj
yi = Ri (yj ) =
.
2β
Diese Reaktionsfunktionen sehen ähnlich aus wie im normalen Cournot-Modell.
87
4 Oligopole und strategisches Verhalten
y2
R1 (y2 )
R2 (y1 )
y1
Man beachte, dass die Reaktionsfunktionen umso steiler verlaufen, je homogener die
Produkte sind. Die Reaktionen eines Unternehmens auf Outputerhöhungen des Konkurrenten werden dann stärker.
Je differenzierter die Produkte (γ → 0), desto flacher verlaufen die Reaktionsfunktionen,
da die beiden Unternehmen nicht mehr stark konkurrieren.
Die gleichgewichtigen Mengen, Preise und Gewinne ergeben sich als
y1∗ = y2∗ =
α
2β + γ
p∗1 = p∗2 =
αβ
2β + γ
π1∗ = π2∗ =
α2 β
.
(2β + γ)2
Wenn γ steigt (die Differenzierung also abnimmt), dann fallen die Mengen, Preise und
Gewinne.
Daraus ergibt sich das folgende Theorem.
Theorem 10 In einem Cournot–Oligopol mit differenzierten Gütern steigen die
Gewinne, wenn die Differenzierung zwischen den Gütern zunimmt.
Dies ist ein Grund, warum bei differenzierten Gütern große Summen in Werbung etc.
investiert werden: Die Unternehmen möchten, dass ihre Produkte sich von denen der
Konkurrenten stark unterscheiden bzw. als sehr unterschiedlich von den Konsumenten
empfunden werden, da dadurch ihre Gewinne steigen.
88
4.4 Preiswettbewerb — Das Modell von Bertrand
4.4 Preiswettbewerb — Das Modell von Bertrand
Bisher haben wir Modelle unvollständigen Wettbewerbs betrachtet, in denen die Unternehmen die angebotenen Mengen als strategische Variable einsetzen. Im Modell von
Bertrand wird davon ausgegangen, dass die Unternehmen durch die von ihnen gesetzten
Preise miteinander konkurrieren, nicht aber durch die Outputmengen. Dies ist eine für
manche Märkte sinnvolle Annahme, denn häufig ist es für ein Unternehmen einfacher,
Preise anzupassen als Mengen. Letzteres erfordert u.U. eine Änderung in der Produktionskapazität. Kurzfristig können Mengenänderungen daher nicht möglich oder sehr
teuer sein. Preisänderungen können jedoch recht einfach durchgeführt werden, denn es
müssen nur die Preisschilder geändert werden.
Das Modell von Bertrand stammt aus dem Jahre 1883 und ist in einer Rezension des
Buches von Cournot (1838) enthalten. Heute sind sich die meisten Ökonomen einig,
dass beide Ansätze notwendig sind, um verschiedene Arten von Märkten zu verstehen.
Für einige Märkte erklärt das Cournot–Modell mit Mengensetzung die beobachteten
Ergebnisse — für andere Märkte liefert das Bertrand Modell eine bessere Erklärung des
Marktergebnisses. Die Aufgabe des Ökonomen ist es nun festzustellen, welcher Modelltyp
besser geeignet ist, die beobachteten Mengen und Preise zu erklären.
Wir betrachten ein Modell mit zwei Unternehmen, deren Kostenfunktionen wie im
Cournot–Modell spezifiziert sind.
Ci (yi ) = ci yi ,
für i = 1, 2,
mit c1 , c2 ≥ 0.
Die Preis-Absatz-Funktion für das homogene Produkt ist gegeben durch
(4.3) p(Y ) = a − b Y,
mit a, b > 0 und Y = y1 + y2 .
Hier untersuchen wir ein Nash–Gleichgewicht, in dem die Strategien der Unternehmen
die von ihnen verlangten Preise sind. Bisher war angenommen worden, dass sich ein
einheitlicher Preis einstellt, der durch die Preis–Absatz–Funktion determiniert ist. Im
Bertrand–Modell verlangt jedoch jedes Unternehmen seinen eigenen Preis für sein Produkt.
Es werden dabei zwei Annahmen über das Verhalten der Konsumenten für alle möglichen
Preiskombinationen getroffen.
1. Die Konsumenten kaufen immer beim billigsten Anbieter.
2. Wenn beide Unternehmen den gleichen Preis verlangen, kauft die eine Hälfte der
Konsumenten bei Unternehmen 1, die andere Hälfte bei Unternehmen 2.
Die insgesamt nachgefragte Menge ergibt sich aus der Nachfragefunktion, die wir durch
Invertieren der Preis–Absatz–Funktion (4.3) erhalten
(4.4) Y (p) =
a−p
,
b
89
4 Oligopole und strategisches Verhalten
wobei p der niedrigste Angebotspreis ist.
Damit lautet die Nachfrage für Unternehmen i
0
falls pi ≥ a
0
falls pi > p3−i
(4.5) yi (pi , p3−i ) =
a−p
falls pi = p3−i = p < a
2b
a−p
i
falls pi < min{a, p3−i }.
b
Diese Art der Nachfragefunktion enthält eine sogenannte Rationierungsregel, die besagt, wie bei gleichen Preisen die Nachfrage auf die beiden Unternehmen aufgeteilt wird
(hier hälftig).
Das Bertrand–Nash–Gleichgewicht ist wie folgt definiert.
Definition 9 Ein Bertrand–Nash–Gleichgewicht besteht aus Mengen y1b und
y2b sowie Preisen pb1 und pb2 derart, dass gilt
1. der Preis pb1 löst das Maximierungsproblem
max π p1 , pb2 ,
p1
2. der Preis pb2 löst das Maximierungsproblem
max π pb1 , p2
p2
3. und y1 und y2 sind durch die Nachfragefunktion bestimmt.
Bei gegebener Strategie des anderen Unternehmens kann also kein Unternehmen profitabel von der Gleichgewichtsstrategie abweichen.
Wir untersuchen nun zwei Varianten des Modells. dabei wird zunächst angenommen,
dass jedes der beiden Unternehmen beliebige Mengen des Gutes herstellen kann. Im
Anschluss betrachten wir ein Modell mit Kapazitätsbeschränkungen.
Das Bertrand–Modell ohne Kapazitätsschranken
Ein wichtiger Punkt im Bertrand–Modell ist die Unstetigkeit des Gewinns bzw. der
Auszahlungsfunktionen. Sobald die von beiden Unternehmen gesetzten Preise gleich sind,
ändert sich die Auszahlung unstetig: Bei einem auch nur etwas höheren Preis eines
Unternehmens ist dessen Marktanteil gleich 0. Eine geringe Senkung des Preises führt
dazu, dass es einen Marktanteil von 50% erhält. Wir werden im weiteren unterstellen,
dass die Unternehmen ihre Preise kontinuierlich ändern können, d. h., dass es keine
kleinste Geldeinheit gibt.
Für symmetrische Unternehmen ist das Bertrand–Nash–Gleichgewicht wie folgt charakterisiert.
90
4.4 Preiswettbewerb — Das Modell von Bertrand
Theorem 11 Wenn die Unternehmen die gleiche Kostenstruktur aufweisen (c1 =
c2 = c) und a > c gilt, dann ist das eindeutige Bertrand–Nash–Gleichgewicht durch
pb1 = pb2 = c
und
y1b = y2b =
a−c
2b
gegeben.
Beweis:
Wir beginnen mit zwei Vorüberlegungen.
Da jedes Unternehmen sich Nullgewinne sichern kann (etwa durch überbieten des Konkurrenten) können die Gewinne im Gleichgewicht nicht negativ sein. Daher muss für
i = 1, 2 gelten, dass pi ≥ ci ist.
Der niedrige der beiden Preise im Gleichgewicht wird niemals über dem Monopolpreis
liegen, da das Unternehmen mit diesem Preis ja die gesamte Nachfrage erhält und unter
diesen Umständen der Monopolpreis gewinnmaximierend ist.
Als nächstes wird gezeigt, dass im Bertrand–Nash–Gleichgewicht beide Unternehmen
den gleichen Preis setzen werden. Angenommen, dies sei nicht der Fall, d. h. o. B. d. A.,
dass pb1 > pb2 .
Falls pb2 > c ist, könnte Unternehmen 1 seinen Preis auf p̃1 mit pb2 > p̃1 > c setzen, den
gesamten Markt bekommen und einen positiven Gewinn (statt Nullgewinn) machen, sich
also verbessern.
Falls pb2 = c ist, könnte Unternehmen 2 seinen Preis etwas erhöhen und dennoch unter
dem Preis von Unternehmen 1 bleiben. Damit würde es einen positiven Gewinn (statt
Nullgewinn) machen, sich also verbessern.
Wir wissen nun, dass gelten muss pb1 = pb2 .
Angenommen, es wäre pb1 = pb2 > c. Dies kann kein Gleichgewicht sein, denn in diesem
Fall kann ein Unternehmen seinen Preis etwas senken, um dadurch die gesamte Nachfrage
(statt der Hälfte) zu erhalten und so seinen Gewinn zu erhöhen.
Q.E.D.
Wenn also die beiden Unternehmen die gleiche Kostenstruktur haben, dann ergeben
sich im Bertrand–Nash–Gleichgewicht — genau wie bei vollständiger Konkurrenz — für
beide Unternehmen Preise gleich den Grenzkosten und die angebotene Menge ist die
gleiche wie bei vollkommenem Wettbewerb.
Die ökonomische Erklärung ist die folgende: Wenn beide Unternehmen Preise oberhalb
der Grenzkosten setzen, dann könnte ein Unternehmen den gesamten Markt erhalten,
wenn es den Preis nur um einen infinitesimalen Betrag unterbieten würde. Der Erlös pro
Stück würde sich daher nicht (bzw. fast nicht) verändern, aber die abgesetzte Menge
würde sprunghaft ansteigen.
Das andere Unternehmen würde dann seinerseits den Preis des Konkurrenten unterbieten. Dieses gegenseitige Unterbieten führt dazu, dass die Preise sich immer mehr den
Grenzkosten annähern. Erreichen die Preise die Grenzkosten, lohnt sich ein weiteres
Unterbieten nicht mehr, da es zu Verlusten führen würde.
Dieses Ergebnis des Bertrand–Modells ist sehr bemerkenswert und steht in krassem
91
4 Oligopole und strategisches Verhalten
Gegensatz zu unseren Erkenntnissen aus der Analyse des Mengenwettbewerbs.
Dort hatten wir gesehen, dass wir mit zunehmender Zahl der Unternehmen eine schrittweise Entwicklung mit sinkendem Preis und steigender Menge vom Monopol über das
Duopol und Oligopol bis hin zum vollkommenen Wettbewerb hatten, den wir als Grenzfall eines Oligopols mit unendlich vielen Unternehmen erhalten.
Während es beim Monopol keinen Unterschied macht, ob wir es als preis- oder mengensetzendes Unternehmen modellieren, ergibt sich ein völlig anderes Bild, sobald wir
mehrere Unternehmen betrachten: Schon im Duopol führt Bertrand–Wettbewerb zum
gleichen Ergebnis wie vollkommener Wettbewerb.
Wenn wir die Symmetrieannahme aufgeben, d. h. zwei Unternehmen mit unterschiedlichen Grenzkosten betrachten, handeln wir uns technische Probleme ein.
Wir nehmen im Folgenden an, dass c2 > c1 ist.
Intuitiv scheint klar zu sein, was das Ergebnis des Bertrand–Wettbewerbs sein wird: Das
effiziente Unternehmen 1 kann Unternehmen 2 unterbieten, indem es seinen Preis knapp
unter dessen Grenzkosten setzt. Dadurch erhält es einen positiven Gewinn, der um so
höher ausfällt, je größer die Kostendifferenz c2 − c1 ausfällt.
Es stellt sich aber heraus, dass diese Intuition im Modell nicht so leicht zu fassen ist.
Wenn wir an der Annahme kontinuierlich veränderbarer Preise und der Rationierungsregel festhalten, gibt es kein Gleichgewicht. Das Problem ist, dass es keine beste Antwort
von Unternehmen 1 gibt, da die Idee eines Preises knapp unter c2“ nicht wohldefiniert
”
ist.
Nehmen wir an, Unternehmen 2 wählt p2 = c2 . Dann kann Unternehmen 1 eine Preis p1 =
c2 −ε wählen, mit sehr kleinem positiven ε. So lange c2 aber unterhalb des Monopolpreises
von Unternehmen 1 liegt, könnte Unternehmen 1 sich noch weiter verbessern, indem es
den Preis leicht auf p′1 = c2 − 2ε erhöht. Aus analogen Gründen ist aber auch p′1 keine
beste Antwort.
Es gibt zwei mögliche Auswege, aus dieser Situation:
1. Wir können die Rationierungsregel ändern.
2. Wir können eine kleinste Geldeinheit einführen, d. h. statt kontinuierlicher nur
noch diskrete Preisänderungen zulassen. Dadurch wäre klar, was ein Preis knapp
”
unter c2“ bedeutet, nämlich ein Preis exakt eine kleinste Geldeinheit darunter.
Wir beginnen mit der Änderung der Rationierungsregel. Bisher hatten wir angenommen,
dass, falls p1 = p2 = p gilt, beide Unternehmen exakt die Hälfte der Gesamtnachfrage
Y (p) =
a−p
b
erhalten.
Nun unterstellen wir stattdessen, dass bei Preisgleichheit alle Konsumenten bei Unter-
92
4.4 Preiswettbewerb — Das Modell von Bertrand
nehmen 1 kaufen. Die Nachfragefunktionen der beiden Unternehmen sind also
0
0
(4.6) y1 (p1 , p2 ) =
a−p
b
a−p
1
falls
falls
falls
falls
p1
p1
p1
p1
≥a
> p2
= p2 = p < a
< min{a, p2 }.
0
0
(4.7) y2 (p1 , p2 ) =
0
a−p2
falls
falls
falls
falls
p2
p2
p2
p2
≥a
> p1
= p1 = p < a
< min{a, p1 }.
b
und
b
Mit dieser Rationierungsregel erhalten wir wieder ein Bertrand–Nash–Gleichgewicht.
Theorem 12
1
≥ c2 > c1 gilt und die Rationierungsregel zu den Nachfragefunktionen
Wenn a+c
2
gemäß den Gleichungen (4.6) und (4.7) führt, ist ein Bertrand–Nash–Gleichgewicht
gegeben durch
pb1 = pb2 = c2
sowie
y1b =
a − c2
b
und
y2b = 0.
Beweis:
Wir müssen lediglich zeigen, dass sich keines der beiden Unternehmen durch Abweichen
verbessern kann.
Unternehmen 1 macht positiven Gewinn. Würde es seinen Preis erhöhen, verlöre es
die gesamte Nachfrage an Unternehmen 2 und sein Gewinn wäre null. Da es bei den
gegebenen Preisen bereits die gesamte Marktnachfrage erhält und der Preis unterhalb des
1
Monopolpreises a−c
liegt, kann es sich auch durch eine Preissenkung nicht verbessern.
2
Unternehmen 2 macht einen Gewinn von null. Durch eine Preiserhöhung würde es weiterhin nichts verkaufen und der Gewinn wäre immer noch null. Eine Preissenkung würde
hingegen zwar dazu führen, dass Unternehmen 2 die gesamte Marktnachfrage erhält, da
der Preis dann aber unter den Grenzkosten, die gleichzeitig die Durchschnittskosten sind,
läge, würde es einen Verlust erleiden.
Q.E.D.
Leider verlieren wir aber auch mit der neuen Rationierungsregel die Eindeutigkeit des
Bertrand–Nash–Gleichgewichts. Es existiert nämlich noch ein Kontinuum von (allerdings
unplausiblen) Gleichgewichten, nämlich alle Preiskombinationen p1 = p2 = p mit c2 >
p ≥ c1 .1
1
Wir verzichten auf den Beweis, dass weitere Gleichgewichte nicht existieren.
93
4 Oligopole und strategisches Verhalten
In diesen Gleichgewichten macht Unternehmen 2 jeweils einen Nullgewinn. Jedes Abweichen nach unten führt zu Verlusten, während ein Abweichen nach oben ebenfalls einen
Nullgewinn ergibt.
Unternehmen 1 macht (außer für p = c1 ) einen positiven Gewinn, der durch Abweichen
nach unten sinkt. Durch Abweichen nach oben würde auch Unternehmen 1 einen Gewinn
von null machen.2
Wenn wir wollten, könnten wir allerdings das unerwünschte unplausible Gleichgewicht
durch eine erneute Änderung der Rationierungsregel eliminieren, indem wir für gleiche
Preise unterhalb c2 annehmen, dass wieder beide Unternehmen je die Hälfte der Nachfrage erhalten.
Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, dass wir je nach Bedarf verschiedene
Rationierungsregeln aus dem Hut zaubern. Wir müssen uns aber klar machen, dass
jede solche Regel im Grunde willkürlich ist. Wenn die beiden Unternehmen das selbe
homogene Produkt zu gleichen Preisen anbieten, gibt es für die Konsumenten keinen
Grund, lieber bei dem einen oder dem anderen zu kaufen. Entweder stellen wir uns also
eigentlich differenzierte Güter vor, oder jede Aufteilung der Gesamtnachfrage auf die
beiden Unternehmen ist so plausibel wie jede andere.
Diese Überlegung motiviert uns zu einer alternativen Interpretation der Definition des
Bertrand–Nash–Gleichgewichts.
Die Definition lautete wie folgt.
Definition 1 Ein Bertrand–Nash–Gleichgewicht besteht aus Mengen y1b und
y2b sowie Preisen pb1 und pb2 derart, dass gilt
1. der Preis pb1 löst das Maximierungsproblem
max π p1 , pb2 ,
p1
2. der Preis pb2 löst das Maximierungsproblem
max π pb1 , p2
p2
3. und y1 und y2 sind durch die Nachfragefunktion bestimmt.
Bislang hatten wir den dritten Punkt so interpretiert, dass die Mengen beider Unternehmen sich aus ihrer jeweiligen Nachfragefunktion ergeben muss, in der eine Rationierungsregel eingebaut ist. Im Grunde war ein Bertrand–Gleichgewicht also durch die
Strategien, also pb1 und pb2 gegeben, die Menge ergaben sich daraus. Dies entspricht der
spieltheoretischen Denkweise, etwa der Definition des Nash–Gleichgewichts, die ja auch
2
Weicht Unternehmen 1 nach oben ab, macht Unternehmen 2 Verluste, daher ist das Gleichgewicht
unplausibel, es ist z. B. nicht trembling hand‘ perfekt (vgl. Selten (1975)).
’
94
4.4 Preiswettbewerb — Das Modell von Bertrand
nur eine Strategiekombination festlegt, aus der dann die Ergebnisse und Auszahlungen
folgen.
Die Art, wie die Definition formuliert ist, erinnert aber eher an die Definition eines
Walras–Gleichgewichts in der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts. Ein Gleichgewicht
besteht demnach aus Mengen und Preisen, die konsistent mit der Annahme an das
individuelle Optmierungsverhalten sind.
In diesem Sinne interpretieren wir den dritten Punkt nun als
y1b + y2b = Y min pb1 , pb2 ,
d. h., wir fordern nur noch, dass die Gesamtmenge der gesamten Nachfrage entspricht, die
sich ihrerseits aus dem niedrigsten Preis ergibt. Dadurch taucht die Rationierungsregel
nur noch implizit durch die Angabe der Mengen y1b und y2b auf.
Unsere obigen Analysen laufen dann auf die folgenden Aussagen hinaus.
1. Die Kombination y1b =
Gleichgewicht.
a−c2
,
b
y2b = 0, pb1 = pb2 = c2 ist ein Bertrand–Nash–
, y2b = 0, pb1 = pb2 = p, mit p ∈ [c1 , c2 ), ist ein Bertrand–
2. Jede Kombination y1b = a−p
b
Nash–Gleichgewicht (aber kein perfektes).
3. Die Kombination y1b =
Gleichgewicht.
a−c2
,
2b
4. Keine Kombination y1b =
Gleichgewicht.
y2b =
a−pb1
,
2b
a−c2
,
2b
pb1 = pb2 = c2 ist kein Bertrand–Nash–
y2b = 0, pb1 < pb2 = c2 ist ein Bertrand–Nash–
Unser zweite Ausweg aus dem Dilemma, dass für unterschiedliche Grenzkosten kein
Bertrand–Nash–Gleichgewicht existiert, eine kleinste Geldeinheit einzuführen, liefert
zwar das gewünschte Ergebnis, aber wieder tauchen zugleich eine Reihe zusätzlicher
Gleichgewichte auf, von denen die meisten unplausibel erscheinen.
Wir machen uns dies an einem Beispiel klar. Sei c1 = 3, c2 = 4 und die kleinste Geldeinheit 0.01.
Dann können wir uns überlegen, dass p1 = 3.99 und p2 = 4 ein Bertrand–Nash–
Gleichgewicht ist. Um dies zu tun, müssen wir für beide Unternehmen überprüfen, ob
es eine Möglichkeit gibt, profitabel abzuweichen.
Unternehmen 1 erhält die gesamte Nachfrage, verkauft zu einem Preis oberhalb seiner Stückkosten und macht daher einen positiven Gewinn. Erhöht es seinen Preis um
0.01, erhält es nur noch die Hälfte der Nachfrage, die zudem durch die Preiserhöhung
zurückgeht, dadurch sinkt sein Gewinn. Weitere Preiserhöhungen resultieren in einem
Nullgewinn, da dann die Nachfrage für Unternehmen 1 verschwindet.
Bezüglich einer Preissenkung ist der Effekt auf Unternehmen 1 wie der auf einen Monopolisten: Der Preis sinkt, die Menge steigt und der Effekt auf den Gewinn hängt von
der Elastizität der Nachfrage ab. Da wir angenommen haben, dass der Monopolpreis für
Unternehmen 1 oberhalb von c2 liegt, folgt aber, dass im relevanten Bereich der Gewinn
von Unternehmen 1 bei einer Preissenkung zurückgeht.
95
4 Oligopole und strategisches Verhalten
Unternehmen 2 verkauft nichts, macht also eine Gewinn von null. Erhöht es seinen Preis,
ändert sich an dieser Situation nichts. Eine Preissenkung durch Unternehmen 2 verschafft
ihm zwar Nachfrage, da der Preis dann unterhalb der Stückkosten läge, würde dies aber
zu Verlusten führen.
Wir haben also ein Bertrand–Nash–Gleichgewicht gefunden.
Mit den selben Argumenten ergibt sich aber, dass auch p1 = 4 und p2 = 4.01 ein
Bertrand–Nash–Gleichgewicht ist.
Bei höheren Preisen würde sich stets ein Unternehmen durch Unterbieten des Konkurrenten um 0.01 verbessern können.
Allerdings gibt es noch viele weitere Gleichgewichte, in denen Unternehmen 2 Preise
p2 < c2 , also unterhalb seiner Grenzkosten setzt. So lange der Preis aber oberhalb des
Preises p1 des Konkurrenten liegt, verkauft Unternehmen 2 nichts und macht daher
erneut einen Gewinn von null.
Dass die folgenden Kombinationen (p1 , p2 ) Gleichgewichte sind, sieht man mit den selben
Argumenten wie oben. Sie sind sämtlich nicht trembling hand‘ perfekt: Würde Unter’
nehmen 1 nach oben abweichen, wäre die Strategie von Unternehmen 2 keine beste
Antwort mehr.
Hier haben wir alle zusätzlichen Gleichgewichte aufgelistet. (3.98, 3.99), (3.97, 3.98), (3.96, 3.97),
(3.95, 3.96), (3.94, 3.95), (3.93, 3.94), (3.92, 3.93), (3.91, 3.92), (3.90, 3.91), (3.89, 3.90), (3.88, 3.89),
(3.87, 3.88), (3.86, 3.87), (3.85, 3.86), (3.84, 3.85), (3.83, 3.84), (3.82, 3.83), (3.81, 3.82), (3.80, 3.81),
(3.79, 3.80), (3.78, 3.79), (3.77, 3.78), (3.76, 3.77), (3.75, 3.76), (3.74, 3.75), (3.73, 3.74), (3.72, 3.73),
(3.71, 3.72), (3.70, 3.71), (3.69, 3.70), (3.68, 3.69), (3.67, 3.68), (3.66, 3.67), (3.65, 3.66), (3.64, 3.65),
(3.63, 3.64), (3.62, 3.63), (3.61, 3.62), (3.60, 3.61), (3.59, 3.60), (3.58, 3.59), (3.57, 3.58), (3.56, 3.57),
(3.55, 3.56), (3.54, 3.55), (3.53, 3.54), (3.52, 3.53), (3.51, 3.52), (3.50, 3.51), (3.49, 3.50), (3.48, 3.49),
(3.47, 3.48), (3.46, 3.47), (3.45, 3.46), (3.44, 3.45), (3.43, 3.44), (3.42, 3.43), (3.41, 3.42), (3.40, 3.41),
(3.39, 3.40), (3.38, 3.39), (3.37, 3.38), (3.36, 3.37), (3.35, 3.36), (3.34, 3.35), (3.33, 3.34), (3.32, 3.33),
(3.31, 3.32), (3.30, 3.31), (3.29, 3.30), (3.28, 3.29), (3.27, 3.28), (3.26, 3.27), (3.25, 3.26), (3.24, 3.25),
(3.23, 3.24), (3.22, 3.23), (3.21, 3.22), (3.20, 3.21), (3.19, 3.20), (3.18, 3.19), (3.17, 3.18), (3.16, 3.17),
(3.15, 3.16), (3.14, 3.15), (3.13, 3.14), (3.12, 3.13), (3.11, 3.12), (3.10, 3.11), (3.09, 3.10), (3.08, 3.09),
(3.07, 3.08), (3.06, 3.07), (3.05, 3.06), (3.04, 3.05), (3.03, 3.04), (3.02, 3.03), (3.01, 3.02).
Das Bertrand–Modell mit Kapazitätsschranken
(Oz Shy, S. 110 ff.)
Wir hatten bereits diskutiert, dass das Ergebnis des Bertrand–Modells, dass Preiswettbewerb schon im Duopol zu dem selben Ergebnis führt, wie vollständiger Wettbewerb
bemerkenswert ist. Es heißt nämlich, dass die Zahl der Unternehmen für das Marktergebnis keine Bedeutung hat. Unabhängig von der Anzahl der Unternehmen realisiert
sich immer das gleiche Ergebnis wie bei vollkommener Konkurrenz.
Dies hätte die Konsequenz, dass falls Preiswettbewerb herrscht selbst in hochkonzentrierten Märkten keine Notwendigkeit zu staatlichen Eingriffen bestehen würde.
Dies erschien vielen Ökonomen nicht zufriedenstellend. Sie kritisierten insbesondere die
unrealistische Annahme, dass jedes Unternehmen jede beliebige Menge zu gleichen Stückkosten anbieten kann.
96
4.4 Preiswettbewerb — Das Modell von Bertrand
Es erscheint sicherlich realistischer, davon auszugehen, dass die Unternehmen bei größeren Outputmengen nur mit steigenden Grenzkosten produzieren können. Im Extremfall
können Kapazitätsschranken dazu führen, dass ein Unternehmen maximal die seiner Kapazität entsprechende Menge produzieren kann. Dies lässt sich auch so auffassen, dass
die die Grenzkosten einer Produktion, die über der Kapazität der Unternehmen liegen,
unendlich groß sind.
Betrachten wir das folgende Beispiel mit 4 Konsumenten, von denen der erste maximal
einen Preis von 3, der zweite von 2 und der dritte und der vierte von 0 für eine Einheit
des Gutes zu zahlen bereit ist.
Grafisch stellt sich die Nachfrage wie folgt dar.
p
3
2
1
Y
1
2
3
4
Angenommen, es gibt zwei Unternehmen, die mit konstanten Grenzkosten c1 = c2 = c =
0 produzieren.
Ohne Kapazitätsschranken wäre das Bertrand–Nash–Gleichgewicht durch Preise pb1 =
pb2 = 0 charakterisiert.
Wenn die Unternehmen eine Kapazitätsschranke von einer Einheit haben, dann sind
Preise p1 = p2 = 0 kein Gleichgewicht mehr. Unternehmen 1 könnte seinen Gewinn
erhöhen, wenn es den Preis von 0 auf 3 erhöhen würde und eine Einheit des Gutes an
den Konsumenten mit dem höchsten Reservationspreis verkaufen würde. Unternehmen
2 verkauft seine Produktion an einen der anderen Konsumenten zum Preis von 0.
Allerdings wäre dies auch kein Gleichgewicht. Denn bei p1 = 3 und p2 = 0 würde
Unternehmen 2 einen Preis von p1 − ε verlangen. In diesem Fall verkauft Unternehmen 1
nichts und Unternehmen 2 verkauft eine Einheit an den Konsumenten mit der höchsten
Zahlungsbereitschaft.
Diese Form des gegenseitigen Unterbietens würde weitergehen, bis p1 = p2 = 2 gilt.
Dann würden beide Unternehmen eine Einheit verkaufen. Nun lohnt es sich aber wieder
auf p1 = 3 abzuweichen und eine Einheit an Konsument 1 zu verkaufen. Es existiert im
Rahmen dieses Modells kein Gleichgewicht.
Ein derartiges zyklische Verhalten der Preise wurde bereits von dem englischen Ökonomen Francis Edgeworth beobachtet. Das Resultat wird daher als Edgeworth–Zyklus
(Edgeworth cycle) bezeichnet.
Allerdings sind Kapazitätsschranken nicht die einzige Möglichkeit, bei Preiswettbewerb
höhere als Grenzkostenpreise zu erklären.
Alternativen dazu sind differenzierte Produkte oder wiederholte Interaktionen.
97
4 Oligopole und strategisches Verhalten
4.5 Cournot vs. Bertrand
(Oz Shy, S. 110 ff.)
Wenn man das Cournot–Modell und das Bertrand–Modell vergleicht, ist es irritierend,
dass eine einfache Änderung in den strategischen Variablen (von Mengen- zu Preissetzung) zu derart dramatischen Änderungen in den Marktergebnissen führt.
Kreps und Scheinkman (1983) haben daher versucht, zwischen den beiden Modellen
einen Zusammenhang herzustellen. In ihrem Modell wird das folgende zwei-PeriodenSpiel konstruiert.
In der ersten Periode wählen die Unternehmen ihre produzierte Menge, d. h., sie bauen
Lagerbestände auf. In der zweiten Periode können nur noch die Preise gewählt werden,
die Mengen sind die in der ersten Periode festgelegten Lagerbestände. Es zeigt sich, dass
in diesem Spiel die Ergebnisse die gleichen sind, wie im Cournot–Modell, in dem die
Unternehmen nur die Mengen wählen.
Das Modell soll hier nur an einem einfachen Beispiel illustriert werden.
Die Preis–Absatz–Funktion ist gegeben durch
p(Y ) = 10 − Y.
Beide Unternehmen habe die selbe Kostenfunktionen, nämlich
ci (yi ) = yi .
Wie immer wird zur Analyse eines zwei-Perioden-Spiels die Methode der Rückwärtsinduktion herangezogen. Zuerst wird untersucht, welche Preise die Unternehmen in der
zweiten Periode für unterschiedliche produzierte Mengen verlangen. Danach wird dann
die optimale Menge bestimmt, die sie in der ersten Periode produzieren.
Die zweite Periode Angenommen, die Unternehmen haben in der ersten Runde die
Kapazitäten (Mengen) y1c = y2c = 3 gewählt. Der Gesamtoutput ist dann Y = 6.
Im Nash–Gleichgewicht in der zweiten Periode wählen die beiden Unternehmen Preise,
die für die gewählten Mengen den Markt räumen. Jedes Unternehmen setzt also pi =
4 = p∗ .
Dieses Ergebnis kann man grafisch wie folgt darstellen.
p
10
4
6
98
10
Y
4.5 Cournot vs. Bertrand
Zwar können die Unternehmen beliebige Preise verlangen, aber andere Preise als p1 =
p2 = p∗ = 4 können kein Gleichgewicht sein.
Angenommen, Unternehmen 2 senkt seinen Preis auf p2 < 4 — gegeben den Preis p1 = 4.
In diesem Fall führt die Preissenkung nicht zu einer Erhöhung der Verkaufsmenge, denn
die Kapazität war ja in der ersten Periode auf 3 festgelegt worden.
Eine Preiserhöhung auf p2 > 4 führt zu einer geringeren Verkaufsmenge y2 < 3 und
erhöht ebenfalls nicht den Gewinn.
Wenn Unternehmen 2 den Preis erhöht, dann bekommt es nur noch die Restnachfrage,
die nach der von Unternehmen 1 verkauften Menge übrig bleibt. Da y1∗ = 3 ist, bleibt
als Restnachfrage für Unternehmen 2
y2 (p2 ) = Y (p2 ) − 3 = 7 − p2 .
Die entsprechende Preis–Absatz–Funktion ist p2 = 7 − y2 .
Grafisch kann man sich diese Restnachfrage wie folgt verdeutlichen.
p
p2
10
10
7
7
Grenzerlös
4
Restnachfrage
3
10 Y
33.5
7
10 y2
Entscheidend ist, dass die Grenzerlöskurve für diese Restnachfrage positiv ist für alle
Outputmengen, die kleiner sind als 3,5. In diesem Bereich ist die Restnachfrage also
elastisch. Eine Preiserhöhung führt daher zu einer Senkung des Erlöses für Unternehmen
2.
Wir können diesen Sachverhalt im folgenden Lemma festhalten.
Lemma 2 Wenn für die in Periode 1 gewählten Outputniveaus gilt y1 + y2 ≤ 6,
dann werden im Nash–Gleichgewicht in der zweiten Periode die Unternehmen die
Preise so wählen, dass der Markt geräumt wird.
Die erste Periode Wenn die Preise, die in der zweiten Periode gewählt werden, die
markträumenden Preise sind, ist die Wahl der Kapazität, d. h. der Menge in der ersten
Periode genau die gleiche, wie im üblichen Cournot–Modell. Das bedeutet, dass die
Unternehmen in der ersten Periode die Cournot–Mengen y1 = y2 = 3 wählen.
99
4 Oligopole und strategisches Verhalten
Die ökonomische Erklärung ist die folgende: In der ersten Periode wissen die Unternehmen, dass die Preise in der zweiten Periode so gewählt werden, dass der Markt —
gegeben die in der ersten Periode produzierten Mengen — geräumt wird. Aufgrund dieser
Tatsache ist das Problem in der ersten Periode identisch zum üblichen Cournot–Problem.
Das obige Lemma ist jedoch kein Beweis für diese Behauptung, denn es gilt nur für den
Fall y1 + y2 ≤ 6. Für den Fall y1 + y2 > 6 wurde keine Aussage getroffen. Auch für diesen
Fall lässt sich eine entsprechende Aussage zeigen. Der Beweis ist jedoch aufwändiger
und setzt die Verwendung gemischter Strategien voraus. Daher werden wir ihn hier
nicht durchführen.
4.6 Preiswettbewerb bei differenzierten Gütern
(Oz Shy, S. 139 ff.)
In diesem Abschnitt untersuchen wir nun, was bei Preiswettbewerb passiert, wenn wir
statt homogener Güter differenzierte Güter betrachten.
Ausgangspunkt unserer Analyse des Mengenwettbewerbs mit differenzierten Gütern waren die beiden folgenden Preis–Absatz–Funktionen
p1 (y1 , y2 ) = p1 = α − βy1 − γy2
und
p2 (y1 , y2 ) = p2 = α − βy2 − γy1 ;
wobei wir angenommen hatten, dass β > 0 und β 2 > γ 2 (oder |β| > |γ|) ist.
Wenn der Preis die strategische Variable ist, ist es sinnvoll, aus den gegebenen Preis–
Absatz–Funktionen zunächst die Nachfragefunktionen herzuleiten.
Dazu betrachten wir die beiden obigen Preis–Absatz–Funktionen als lineares Gleichungssystem in den Variablen y1 und y2 , das mittels der Cramer–Regel nach y1 und y2 als
Funktion der Preise p1 und p2 aufgelöst werden kann. (Oz Shy, S. 136 und S. 162 ff.)
Die Lösungen lauten:
y1 (p1 , p2 ) = a − b p1 + c p2
und
y2 (p1 , p2 ) = a − b p2 + c p1 .
Dabei ist
a=
β
γ
α(β − γ)
, b= 2
, und c = 2
.
2
2
2
β −γ
β −γ
β − γ2
Das Maximierungsproblem des Duopolisten i ist dann
max π( p1 , p2 ) = (a − b pi + c pj ) pi
pi
Die Bedingung 1. Ordnung ist
∂πi
= a − 2 b pi + c pj .
∂pi
100
i, j = 1, 2; i 6= j.
4.6 Preiswettbewerb bei differenzierten Gütern
Daraus ergibt sich die Reaktionsfunktion
pi (pj ) = Ri (pj ) =
a + c pj
.
2b
Grafisch kann man sich die Reaktionsfunktionen wie folgt vorstellen.
p2
R1 (p2 )
R2 (p1 )
pb2
a
2b
a
2b
pb1
p1
Genau wie im Modell mit Mengenwettbewerb ergibt sich das Gleichgewicht als Schnittpunkt der beiden Reaktionsfunktionen.
Rechnerisch können wir es ermitteln, indem wir die Reaktionsfunktionen ineinander einsetzen. Wir erhalten für das Bertrand–Nash–Gleichgewicht die folgenden Preise, Mengen
und Gewinne.
a
α (β − γ)
=
,
2b − c
2β − γ
ab
α β (β − γ)
yib =
=
2b − c
(2 β − γ) (β 2 − γ 2 )
α2 β (β − γ)
a2 b
=
und πib =
(2b − c)2
(2 β − γ)2 (β + γ)
pbi =
Auch hier sieht man, dass die Gewinne fallen, wenn γ wächst, d. h., wenn die Differenzierung geringer wird. Im Grenzfall γ = β ist der Gewinn — wie im Bertrand–Gleichgewicht
bei homogenen Produkten — null, denn die Produkte sind dann homogen.
Theorem 13 In einem Bertrand–Modell mit differenzierten Produkten nehmen die
Gewinne der Unternehmen mit steigender Produktdifferenzierung zu.
Dies liegt daran, dass mit zunehmender Produktdifferenzierung die Monopolmacht eines
Unternehmens zunimmt.
Wenn wir differenzierte Produkte betrachten, weisen Cournot– und Bertrand–Modell
also stärkere Ähnlichkeiten auf, als bei homogenen Produkten.
101
4 Oligopole und strategisches Verhalten
Der entscheidende Unterschied liegt in der Gestalt Reaktionsfunktionen: Im Cournot–
Modell verlaufen sie fallend, im Bertrand–Modell hingegen steigend. Das bedeutet, dass
im Cournot–Modell die strategischen Variablen zueinander entgegengesetzt verlaufen:
Wenn ein Unternehmen seine Menge senkt (bzw. erhöht), wird das andere seine Menge
erhöhen (bzw. senken) und vice versa, während sie im Bertrand–Modell in die selbe
Richtung weisen: Wenn ein Unternehmen seinen Preis senkt (bzw. erhöht), wird auch
das andere Unternehmen seinen Preis senken (bzw. erhöhen).
Diesen Unterschied fassen wir in folgende Definition.
Definition 2
1. Die Strategien der beiden Spieler sind strategische Substitute, wenn die Reaktionsfunktionen eine negative Steigung haben;
2. sie sind strategische Komplemente, wenn die Reaktionsfunktionen eine
positive Steigung haben.
4.7 Vergleich zwischen Cournot und Bertrand bei
differenzierten Produkten
(Oz Shy, S. 140 f.)
Wir hatten gesehen, dass im Falle differenzierter Produkte, der Unterschied zwischen
dem Modell mit Mengen- und dem mit Preiswettbewerb nicht mehr so augenfällig sind,
wie bei homogenen Produkten. Es stellt sich die Frage, wie sich Mengen, Preise und
Gewinne in den beiden Modellen im Vergleich verhalten.
Vergleicht man die Preise in den beiden Marktstrukturen, ergibt sich
p∗i − pbi =
αβ
α (β − γ)
−
=
2β + γ
2β − γ
α
4 β2
γ2
−1
,
d. h., die Gleichgewichtspreise bei Mengenwettbewerb sind höher als die bei Preiswettbewerb.
Damit verhalten sich die Mengen umgekehrt, d. h., sie sind bei Mengenwettbewerb geringer als bei Preiswettbewerb. Dies können wir auch berechnen.
yi∗ − yib =
αβ
α
α
.
−
= − 2
4β
2 β + γ (2 β − γ) (β + γ)
−
1
(β
+
γ)
2
γ
Schließlich sind die Gewinne bei Mengenwettbewerb höher als die bei Preiswettbewerb.
πi∗ − πib =
α2 β
α2 β (β − γ)
2 α2 β 3 γ
−
=
(2 β + γ)2 (2 β − γ)2 (β + γ)
(2 β + γ)2 (2 β − γ) (β + γ)
Aus diesen Überlegungen können wir folgendes Ergebnis ableiten.
102
4.8 Sequentielle Preissetzung
Theorem 14 In einer Industrie mit differenzierten Gütern gilt:
1. Die Preise bei Mengenwettbewerb sind höher als bei Preiswettbewerb, die Mengen bei Mengenwettbewerb sind niedriger als bei Preiswettbewerb und die Gewinne bei Mengenwettbewerb sind höher als bei Preiswettbewerb.
2. Je stärker die Güter differenziert sind, desto kleiner sind die Differenzen zwischen den Preisen, Mengen und Gewinnen in beiden Marktstrukturen.
3. Wenn die Produkte unabhängig werden (γ → 0), dann verschwinden die Unterschiede.
Was ist die ökonomische Intuition hinter diesem Theorem?
Für den letzten Punkt ist sie klar: Der Extremfall differenzierter Produkte entspricht
zwei völlig unabhängigen Märkten, auf denen jeweils ein Unternehmen Monopolist ist. Im
Monopol wissen wir aber, dass Preissetzung und Mengensetzung auf das selbe Ergebnis
führen.
Im Lichte dieser Beobachtung und eingedenk des prononcierten Unterschieds zwischen
Cournot– und Bertrand–Modell für homogene Produkte, erscheint dann auch der zweite
Punkt einsichtig.
Wenn wir schließlich eine Intuition für den ersten Teil des Theorems entwickeln wollen, stellen wir uns in beiden Modellen vor, ein Unternehmen erwäge, seine Menge zu
erhöhen. Im Cournot–Modell geht das Unternehmen bei seiner Entscheidung implizit davon aus, dass das andere seinen Output konstant hält. Daher würde eine Erhöhung des
eigenen Outputniveaus zu einem Fallen des Marktpreises führen, was für das Unternehmen schlecht ist. Im Unterschied dazu nimmt im Bertrand–Modell jedes Unternehmen
implizit an, dass der Konkurrent den Preis konstant hält. In diesem Fall würde eine
Outputerhöhung also nicht zu einem fallenden Preis führen. Daher erscheint eine Outputerhöhung im Bertrand–Modell stets attraktiver als im Cournot–Modell, was dazu
führt, dass bei Preiswettbewerb ein höherer Output produziert wird als bei Mengenwettbewerb.
4.8 Sequentielle Preissetzung
(Oz Shy, S. 140 f.)
Betrachten wir nun ein Stackelberg–Modell‘, in dem die Strategien nicht die Mengen
’
sondern die Preise sind.
Dass wir dies für Preiswettbewerb erst im Kontext differenzierter Produkte tun, liegt
daran, dass sequentielle Preissetzung für homogene Produkte zu ähnlichen Problemen
führt, wie die, mit denen wir uns bei asymmetrischen Unternehmen und simultaner
Preissetzung herumgeschlagen haben.
Dies kann man sich leicht überlegen: Das Unternehmen, dass als zweites seinen Preis
setzt, wird einen Preis wählen wollen, der knapp unterhalb‘ des Preises liegt, den das
’
103
4 Oligopole und strategisches Verhalten
zuerst ziehende Unternehmens gesetzt hat. . . Auf der anderen Seite ist das Ergebnis des
Modells mit simultaner Preissetzung auch bei sequentieller Preissetzung ein Gleichgewicht: Wenn beide Unternehmen ihren Preis gleich den Grenzkosten setzen, kann sich
keines von beiden durch Abweichen verbessern.
Das Modell sequentieller Preissetzung bei differenzierten Produkten illustrieren wir anhand des folgenden numerischen Beispiels.
Die Nachfragefunktionen sind gegeben durch:
y1 (p1 , p2 ) = 168 − 2 p1 + p2
und y2 (p1 , p2 ) = 168 + p1 − 2 p2 .
Bei simultaner Preissetzung ergeben sich die Gleichgewichtspreise pb1 = pb2 = 56, die
Mengen y1b = y2b = 112 sowie die Gewinne π1b = π2b = 6272.
Betrachten wird nun die Situation, in der Unternehmen 1 seinen Preis vor Unternehmen
2 setzt.
Unternehmen 1 bezieht dabei die Reaktionsfunktion von Unternehmen 2 in seine Entscheidung mit ein und wählt daher einen Preis p1 , der das folgende Maximierungsproblem
löst
168 + p1
max π1 p1 , R (p1 ) = 168 − 2 p1 +
p1 .
p1
4
Die Bedingung 1. Ordnung lautet
∂π1
7
= 210 − p1 = 0.
∂p1
2
Daraus folgt ps1 = 60 und daher ps2 = 57. Die resultierenden Mengen sind y1s = 105 und
y2s = 114. Die Gewinne sind dann π1s = 60 · 105 = 6300 > π1b und π2s = 57 · 114 = 6498 >
π2b .
Dieses überraschende Ergebnis wird in dem folgenden Theorem allgemeiner ausgedrückt.
Theorem 15 Ein einer Situation mit sequentieller Preissetzung gilt:
1. Beide Unternehmen erhalten einen größeren Gewinn als im simultanen
Bertrand–Wettbewerb, d. h. πis > πib , für i = 1, 2.
2. Das Unternehmen, das seinen Preis zuerst setzt, macht einen geringeren Gewinn als das Unternehmen, das seinen Preis als zweites setzt.
3. Im Vergleich zu den Gewinnen bei simultanem Bertrand–Wettbewerb ist die
Zunahme im Gewinn für den Preisführer geringer als für den Preisfolger, d. h.
π1s − π1b < π2s − π2b .
Die ökonomische Intuition hinter diesem Ergebnis ist die folgende: Wenn das Unternehmen 1 in der ersten Periode den Preis berechnet, den es setzen soll, berücksichtigt es
104
4.9 Differenzierte Produkte als verschiedene ‘Standorte’ von Unternehmen
dabei, dass Unternehmen 2 diesen Preis leicht unterbieten wird, um sich einen größeren Marktanteil als Unternehmen 1 zu sichern. Dies bringt Unternehmen 1 dazu, einen
relativ hohen Preis zu setzen, da der Anreiz, den Preis zu senken, weniger stark ausgeprägt ist als im simultanen Preiswettbewerb, in dem Unternehmen 1 implizit annimmt,
Unternehmen 2 lasse den Preis konstant.
Daher werden beide Unternehmen Preise oberhalb der simultanen Bertrand–Preise verlangen. Unternehmen 1 macht allerdings einen etwas geringeren Gewinn, da Unternehmen 2 seinen Preis leicht unterbieten wird und damit höhere Marktanteile erhält.
4.9 Differenzierte Produkte als verschiedene ‘Standorte’
von Unternehmen
Es gibt eine Reihe von Modellen, in denen (horizontal) differenzierte Güter als räumlich differenziert aufgefasst werden. Diese Modelle gehen sämtlich auf eine Arbeit von
Hotelling (1929) zurück, in dem er eine ‘Straße’ betrachtet, in der die Konsumenten
leben. Es gibt zwei Unternehmen, die sich in dieser Straße angesiedelt haben. Die von
den Unternehmen hergestellten, physisch gleichen Produkte stellen für die Konsumenten
differenzierte Güter dar, weil sie — je nach Hausnummer — unterschiedliche Entfernungen zu den Unternehmen zurücklegen müssen und daher verschiedene Transportkosten
haben.
Formal stellt sich das Modell wie folgt dar.
• Auf dem Intervall [0, L] ⊂ R+ L lebt ein Kontinuum identischer Konsumenten, die
auf dem Intervall gleichverteilt sind und deren Gesamtmasse L ist.
• Es gibt zwei Unternehmen, A und B, die sich an den Stellen a und L − b befinden.
O. B. d. A. nehmen wir an, dass a ≤ 12 und b ≤ 21 , d. h., Unternehmen B liegt nicht
links von Unternehmen A.
• Die Produktion erfolgt kostenlos.
• Um eine Einheit des einzigen Gutes im Modell zu kaufen, muss ein Konsument
x ∈ [0, L] zusätzlich zu dem Preis, den er an das verkaufende Unternehmen bezahlt,
Transportkosten aufwenden, die das τ -fache der Entfernung zwischen ihm und dem
Unternehmen betragen, bei dem er kauft.
• Jeder Konsument kauft genau eine Einheit des Gutes und wird diese stets bei
einem Unternehmen nachfragen, für das die Summe aus Verkaufspreis und Transportkosten minimal ist.
Wir können das beschriebene Verhalten der Konsumenten auch beschreiben, indem wir
annehmen, der Nutzen des Konsumenten x ∈ [0, L] betrage
(
−pA − τ |x − a| ,
wenn er bei A kauft
Ux =
−pB − τ |x − (L − b)| wenn er bei B kauft.
105
4 Oligopole und strategisches Verhalten
Betrachten wir den Konsumenten x̂, der indifferent ist, ob er bei A oder B kauft. Dabei
gehen wir davon aus, dass a ≤ x̂ ≤ L − b ist.3
Indem wir den Nutzen gleichsetzen, der jeweils aus dem Kauf bei Unternehmen A und
Unternehmen B resultiert, ergibt sich
−pA − τ (x̂ − a) = −pB − τ (L − b) − x̂ .
Dies können wir nach x̂ auflösen und erhalten
x̂ =
pB − pA L − b + a
+
.
2τ
2
Dies entspricht der Nachfrage, der sich Unternehmen A gegenübersieht, da alle Konsumenten links von x̂ relativ näher bei Unternehmen A wohnen un daher dort kaufen
werden. Wegen der Gleichverteilung ist die Masse dieser Konsumenten gerade x̂.
Die Nachfrage für Unternehmen B ist aus analogen Überlegungen
L − x̂ =
pA − pB L + b − a
+
.
2τ
2
Wir betrachten nun das Bertrand–Nash–Gleichgewicht in diesem Modell, wenn wir obige
Nachfragen unterstellen.
Unternehmen A maximiert über die Wahl seines Preises pA seinen Gewinn, löst also
max πA =
pA
pA pB − p2A pA (L − b + a)
+
2τ
2
Die Bedingung erster Ordnung ist
∂πA
pB − 2 pA L − b + a
=
+
= 0.
∂pA
2τ
2
Unternehmen B löst
max πB =
pB
pA pB − p2B pB (L + b − a)
+
2τ
2
Die Bedingung erster Ordnung ist
∂πB
pA − 2 pB L + b − a
=
+
= 0.
∂pB
2τ
2
Im Gleichgewicht betragen die Preise also
p∗A =
3
τ (3 L − b + a)
3
und p∗B =
τ (3 L + b − a)
.
3
Dies wird sicher der Fall sein, wenn beide Unternehmen den selben Preis setzen: Dann kaufen alle
Konsumenten links von Unternehmen A dort und alle rechts von Unternehmen B kaufen bei diesem
Unternehmen.
106
Literaturverzeichnis
Die gleichgewichtigen Mengen sind
3L − b + a
3L + b − a
und x∗B = L − x̂∗ =
.
6
6
Wenn sich also beide Unternehmen in der Mitte der Straße ansiedeln (a = b = 12 ), dann
wird der Markt zwischen den beiden Unternehmen zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die
selbe Aufteilung ergibt sich für alle symmetrischen Standorte (a = b).
Die Gewinne im Gleichgewicht betragen
x∗A = x̂∗ =
τ (3 L − b + a)2
τ (3 L + b − a)2
und πB∗ = p∗B x∗B =
.
18
18
Dies zeigt, dass der Gewinn für jedes Unternehmen mit zunehmendem Abstand zwischen
ihnen ansteigt. Dies ist nicht sonderlich überraschend, da wir bereits gesehen haben, dass
der Gewinn mit wachsender Differenzierung zunimmt.
Die obigen Berechnungen basierten auf der Annahme, dass ein Gleichgewicht existiert
und im Gleichgewicht beide Unternehmen positive Preise verlangen.
Eine Charakterisierung der Gleichgewichte und Bedingungen für ihre Existenz werden
im folgenden Theorem gegeben:
πA∗ = p∗a x∗A =
Theorem 16
1. Wenn sich beide Unternehmen am gleichen Ort befinden (a =
1
b = 2 ), ist pA = pB = 0 das einzige Gleichgewicht.
2. Ein eindeutiges Gleichgewicht existiert und ist durch die oben angegebenen
Gleichgewichtspreise und -mengen charakterisiert genau dann, wenn die beiden
Unternehmen nicht zu dicht‘ nebeneinander liegen; formal: genau dann, wenn
’
2
a−b
4L(a + 2b)
L+
>
3
3
und
2
4L(b + 2a)
b−a
>
.
L+
3
3
Wenn die beiden Unternehmen zu dicht nebeneinander liegen, dann werden sie anfangen,
den von dem jeweils anderen Unternehmen gesetzten Preis zu unterbieten. Dies führt zu
einem Prozess, der — ähnlich wie beim Edgeworth–Zyklus, den wir bei Preiswettbewerb
mit Kapazitätsschranken diskutiert hatten — nicht zu einem Gleichgewicht konvergiert.
In diesem Fall entsteht also das Problem der Nichtexistenz eines Gleichgewichts.
Literaturverzeichnis
Bertrand, J. (1883): “Théorie Mathématique de la Richesse Sociale,” Journal des
Savant, 67, 499–508, [English translation by J. Magnan de Bornier (1992): “The
107
Literaturverzeichnis
‘Cournot–Bertrand Debate’: A Historical Perspective,” History of Political Economy,
24(3), 623–654.].
Cournot, A. A. (1838): Recherches sur les Principes Mathématique de la Théorie de
Richesses. Hachette, Paris, [English translation by N. T. Bacon, 1897: Researches into
the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, McMillan, New York (1927),
reprint Augustus M. Kelley, New York (1971). Deutsche Übersetzung von W. G. Waffenschmidt: Untersuchungen über die mathematischen Grundlagen der Theorie des
Reichtums, Fischer, Jena (1924)].
Hotelling, H. (1929): “Stability in Competition,” Economic Journal, 39, 41–57.
Kreps, D., und J. Scheinkman (1983): “Quantity Precommitment and Bertrand
Competition Yield Cournot Outcomes,” Bell Journal of Economics, 14, 326–337.
Selten, R. (1975): “Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points
in Extensive Games,” International Journal of Games Theory, 4(1), 25–55.
Shy, O. (1995): Industrial Organization: Theory and Applications. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
108