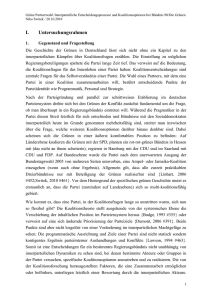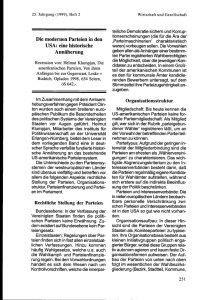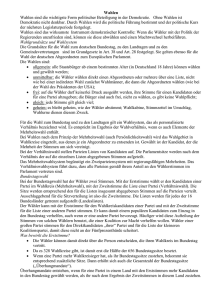Wahlrechtsfragen vor dem Hintergrund "Hessen"
Werbung
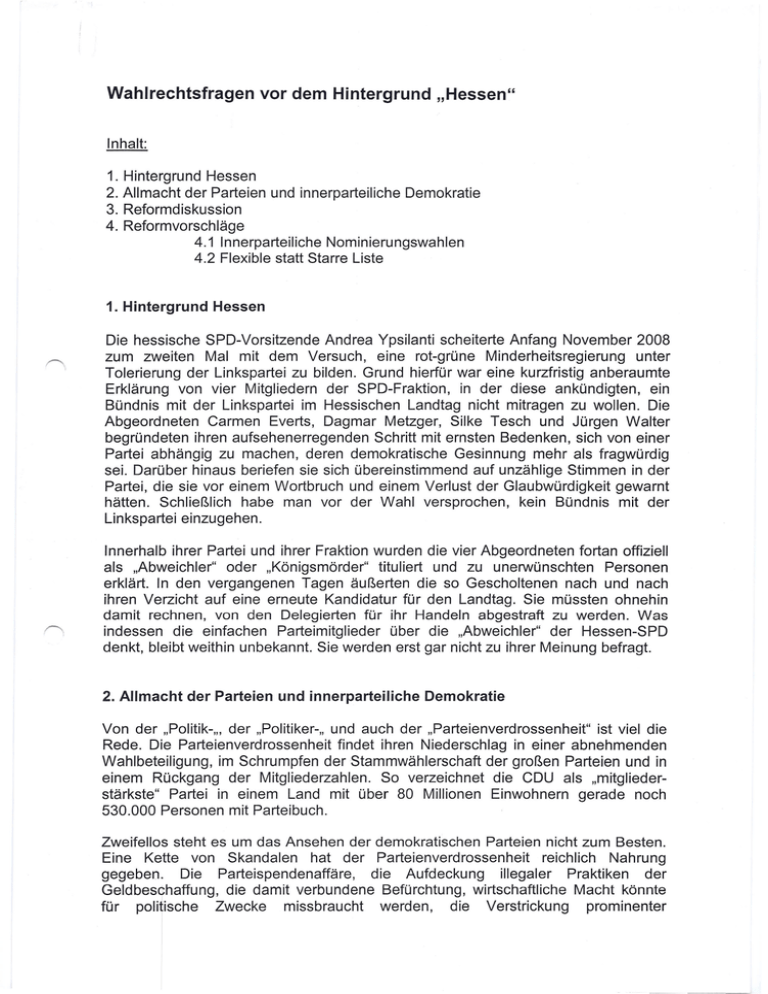
Wahlrechtsfragen vor dem Hintergrund "Hessen" Inhalt: 1. Hintergrund Hessen 2. Allmacht der Parteien und innerparteiliche Demokratie 3. Reformdiskussion 4. Reformvorschläge 4.1 Innerparteiliche Nominierungswahlen 4.2 Flexible statt Starre Liste 1. Hintergrund Hessen Die hessische SPD-Vorsitzende Andrea Ypsilanti scheiterte Anfang November 2008 zum zweiten Mal mit dem Versuch, eine rot-grüne Minderheitsregierung unter Tolerierung der Linkspartei zu bilden. Grund hierfür war eine kurzfristig anberaumte Erklärung von vier Mitgliedern der SPD-Fraktion, in der diese ankündigten, ein Bündnis mit der Linkspartei im Hessischen Landtag nicht mitragen zu wollen. Die Abgeordneten Carmen Everts, Dagmar Metzger, Silke Tesch und Jürgen Walter begründeten ihren aufsehenerregenden Schritt mit ernsten Bedenken, sich von einer Partei abhängig zu machen, deren demokratische Gesinnung mehr als fragwürdig sei. Darüber hinaus beriefen sie sich übereinstimmend auf unzählige Stimmen in der Partei, die sie vor einem Wortbruch und einem Verlust der Glaubwürdigkeit gewarnt hätten. Schließlich habe man vor der Wahl versprochen, kein Bündnis mit der Linkspartei einzugehen. Innerhalb ihrer Partei und ihrer Fraktion wurden die vier Abgeordneten fortan offiziell als "Abweichler" oder .Köniqsrnörder" tituliert und zu unerwünschten Personen erklärt. In den vergangenen Tagen äußerten die so Gescholtenen nach und nach ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Landtag. Sie müssten ohnehin damit rechnen, von den Delegierten für ihr Handeln abgestraft zu werden. Was indessen die einfachen Parteimitglieder über die "Abweichler" der Hessen-SPD denkt, bleibt weithin unbekannt. Sie werden erst gar nicht zu ihrer Meinung befragt. 2. Allmacht der Parteien und innerparteiliche Demokratie Von der .Polltik-; der .Politiker-, und auch der .Parteienverdrossenheit" ist viel die Rede. Die Parteienverdrossenheit findet ihren Niederschlag in einer abnehmenden Wahlbeteiligung, im Schrumpfen der Stammwählerschaft der großen Parteien und in einem Rückgang der Mitgliederzahlen. So verzeichnet die CDU als "mitgliederstärkste" Partei in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern gerade noch 530.000 Personen mit Parteibuch. Zweifellos steht es um das Ansehen der demokratischen Parteien nicht zum Besten. Eine Kette von Skandalen hat der Parteienverdrossenheit reichlich Nahrung gegeben. Die Parteispendenaffäre, die Aufdeckung illegaler Praktiken der Geldbeschaffung, die damit verbundene Befürchtung, wirtschaftliche Macht könnte für politische Zwecke missbraucht werden, die Verstrickung prominenter Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft - all dies hat den Ruf der Parteien in der Öffentlichkeit schwer beschädigt. Hinzu kommt ein in der Gesellschaft weit verbreitetes Desinteresse an Politik und politischen Prozessen, die Abneigung gegen eine innerparteiliche .Ochsentour" und die zumindest in Teilen nachvollziehbare Meinung, als Einzelner ohnehin nichts bewegen zu können. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker nährte zu Beginn der 1990er Jahre die Kritik an den Parteien mit seiner Bemerkung, unser Parteienstaat sei .rnachtversessen auf den Wahlsieg und machtvergessen bei der Wahrnehmung der inhaltlichen und konzeptionellen politischen Führungsaufgabe". Ein Urteil, das viele Bundesbürger vorbehaltlos unterschrieben. Obwohl das Parteiengesetz die Mitwirkung der Mitglieder an der Willensbildung der Partei ausdrücklich betont, existiert eine Neigung der Parteibürokratie, sich von der Basis abzukapseln. Wenn von innerparteilicher Willensbildung die Rede ist, wird mit Kritik deshalb selten gespart. "Die da oben" - so die landläufige Auffassung erdrücken die Basis, geben ihr keine Entfaltungsmöglichkeiten oder übergehen ihre Wünsche. Einerseits ist die Kritik an den Parteien unberechtigt, gibt es doch unverzichtbare Sachzwänge einer großen und modernen Parteiendemokratie, die einer entschiedenen Führung und schnellen Entscheidunqsstrukturen bedürfen. Andererseits aber sind die Führungsetagen der Parteien bestrebt, nicht zu viel Macht und Gestaltungsspielraum aus den Händen zu geben. So existiert in den Parteizentralen eine breite Front gegen Mitgliederentscheide in Personal- und Sachfragen. Es ergibt sich folglich die gegenwärtige Situation, in der die Kandidaten für eine Wahl nur von einem kleinen Teil der Partei (Delegierte) gekürt werden. Durch die starren Listen, die vom Wähler nicht mehr verändert werden können, steht oftmals bereits nach Parteitagen fest, wer in den Landtag bzw. in den Bundestag gewählt wird. Der "Parteitag" läuft dem "Wahltag" gewissermaßen den Rang ab. Das faktische Monopol der Parteien bei der Kandidatenaufstellung schränkt somit die Auswahlfreiheit der Bürger stark ein. 3. Reformdiskussion Die Diskussion über mögliche Reformen des Wahlrechts und des Prozesses der innerparteilichen Willensbildung ist schon sehr alt. Reformvorschläge, wie sie etwa die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquetekommission .Verfassunqsreform" in ihrem Schlussbericht 1976 vorgelegt hat, sind jedoch gar nicht oder nur halbherzig umgesetzt worden. Gedacht war damals an eine stärkere Teilnahme der .Parteibürqer" am Prozess der Kandidatenaufstellung (zum Beispiel Direktwahl der Kandidaten durch alle Parteimitglieder). Um den Einfluss der "Wahlbürger" zu erhöhen, wurde ferner die Einführung "halb offener" Listen vorgeschlagen. Die Wählerinnen und Wähler sollen mit ihrer Zweitstimme die Möglichkeit erhalten, die von den Parteien aufgestellte Reihenfolge der Listenkandidaten zu verändern (Präferenzstimme). Obschon diese Variante durch einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss im Deutschen Bundestag leicht in das Bundeswahlgesetz (BWahIG) integriert werden könnte, fand sich dafür bis heute keine Lobby. Da die Gestaltung des Wahlrechts mehr als nur eine Frage der Verfahrenstechnik bedeutet, ist es nicht verwunderlich, dass die Parteien der Bundesrepublik diesem Gesichtspunkt zwar ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben, sich dabei aber oftmals von parteipolitischen Nützlichkeitserwägungen leiten ließen, die sie freilich häufig mit dem Mantel staatspolitischer Notwendigkeit verhüllten. Anders sieht es mit den Elementen direkter Demokratie in den Parteien aus. Mit Ausnahme der CSU schufen die etablierten Parteien in den 1990er Jahren neue plebiszitäre Instrumente: von der Mitgliederbefragung über den Mitgliederentscheid bis hin zur Urwahl des Kanzlerkandidaten wurden den Parteimitgliedern verstärkte Mitwirkungsrechte eingeräumt. Die SPD etwa hat entsprechende Regelungen in ihr Statut aufgenommen. Im November 1993, nach dem Rücktritt des Parteivorsitzenden Björn Engholm, befragte sie ihre Mitglieder, welche Persönlichkeit sie als dessen Nachfolger bevorzugten (Rudolf Scharping, Gerhard Schröder oder Heidemarie Wieczorek-Zeul). An dieser Abstimmung haben 56% der Mitglieder teilgenommen, was als beeindruckender Mobilisierungserfolg angesehen werden muss. Allerdings demonstrierten die Delegierten des Mannheimer SPD-Parteitages von 1995 überdeutlich, wie wenig sie von dieser Stärkung der Basis hielten: sie wählten den 1993 auch durch eine Mitgliederbefragung legitimierten Parteivorsitzenden Rudolf Scharping in einem handstreichartigen Verfahren ab und ersetzten ihn - ohne jegliche Einbeziehung der Parteibasis - durch Oskar Lafontaine. In den letzten Jahren hat es keine Wiederholung der Mitgliederbefragung von 1993 gegeben. Der Kanzlerkandidat des Jahres 2009 wurde erneut auf herkömmliche Weise, nämlich durch den Parteivorstand, gekürt. In der Union trafen in der Vergangenheit innerparteiliche Reformvorschläge auf noch größeren Widerstand. Als der damalige CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Friedrich Merz, und der Generalsekretär der Partei, Ruprecht Polenz, den Vorschlag machten, den CDU/CSU-Kanzlerkandidaten von den Mitgliedern der beiden Parteien Wählen zu lassen, stießen sie auf eine breite Front der Ablehnung. Vor allem die CSU erblickte hierin keine sinnvolle Reform, sondern eine Sicherung des Kanzlerkandidatenmonopols der größeren Schwester. Darüber hinaus gibt es weiterreichende Vorschläge, wie die Gestaltungsmöglichkeiten der Parteimitglieder und der Bürger gestärkt werden könnten. So wurden wiederholt Vorwahlen nach amerikanischem Muster ins Spiel gebracht, bei denen sich alle Wähler ("open primary" / "offene Vorwahlen") oder nur die Anhänger einer Partei ("closed primary" / .Jnnerparteiliche Nominierungswahlen") beteiligen können. Für offene Vorwahlen hat sich der heutige SPD-Vorsitzende im April 2000 ausgesprochen. Deren Einführung würde für die Parteien allerdings einen radikalen Schritt bedeuten, hieße dies doch, Parteien gegenüber allen Wählerinnen und Wählern zu öffnen. Auch Nicht-Mitglieder könnten bei offenen Vorwahlen an der Nominierung der Kandidaten einer Partei für Wahlämter teilnehmen. Offene Vorwahlen haben keine reelle Chance, rasch umgesetzt zu werden. Die Parteien würden damit ihr ureigenstes Recht, Kandidaten für öffentliche Funktionen zu nominieren, aus der Hand geben. Zudem entspricht das Modell der offenen Vorwahl nicht der Logik des deutschen Parteienstaates, der - im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika - gut strukturierte und dauerhaft organisierte Parteien kennt. 4. Reformvorschläge Ohne Zweifel sind die Parteien heute die "Spinne im Netz" politischer Kommunikation, aber auch im Netzwerk der Legitimierung und Ausübung politischer Macht. Man mag das Bestreben der Parteien, ihre politische Macht auch personell abzusichern verstehen. Aber die gegenwärtige Praxis gibt den Parteien und allen voran den Parteistrategen zu viel Macht 4.1 Innerparteiliche Nominierungswahlen ("membership primaries") Um den Einfluss der Parteibasis auf Personalentscheidungen zu erhöhen, könnten innerparteiliche Nominierungswahlen, in Ahnlehnung an die englischen Termini als .rnernbership primaries" bezeichnet, verpflichtend im Parteiengesetz (PartG) verankert werden. Hierfür genügt ein Mehrheitsbeschluss im Deutschen Bundestag. Innerparteiliche möglich: 1"\ Nominierungswahlen sind bei folgenden Personalentscheidungen a) Bestellung von Spitzenkandidaten für Landtags(Ministerpräsidenten-/ Kanzlerkandidat).· . und Bundestagswahlen b) Bestellung des Kandidaten für das Direktmandat bei Bundestagswahlen c) Aufstellung der Listen für Landtags- und Bundestagswahlen. Die Punkte a) und b) lassen sich technisch relativ einfach bewerkstelligen. Vor dem Ablauf der gesetzlichen Frist für das Einreichen von Wahlvorschlägen ist in allen Ortsvereinen eine entsprechende Abstimmung (Wahllokal/Briefwahl) durchzuführen, für die ein Wahlvorstand gewählt wird. Das Ergebnis wird an den Landesverband übermittelt, der die Ergebnisse anschließend öffentlich verkündet. Die jeweils gewählten Kandidaten gehen für ihre Partei ins Rennen. Natürlich setzt ein solches Verfahren einen gewissen innerparteilichen "Wahlkampf" voraus, doch stärkt dieses Verfahren den demokratischen Gedanken, der im Meinungspluralismus - also im fairen Wettstreit der Ideen - seinen stärksten Ausdruck findet. Die Position zu Sachthemen von Bewerbern für Wahlämter wird deutlicher und transparenter. Die Aufstellung von Listen für Landtags- und Bundestagswahlen (Punkt e)) gestaltet sich hingegen weit komplizierter. Hier könnte sich ein Mischsystem aus Delegierten- und Urwahlprinzip als praktikabel erweisen, das in zwei Schritten vorgeht: Schritt 1: Auf einem Nominierungsparteitag nach herkömmlichen Muster entscheiden die Delegierten über geeignete Kandidaten und formulieren eine "Vorschlagsliste" für die Parteibasis. Schritt 2: Die Vorschlagsliste wird den Parteimitgliedern nachfolgend zur Abstimmung vorgelegt. Dabei erhält jedes Parteimitglied so viele Stimmen, wie Kandidaten auf der Liste geführt werden; jeder Kandidat auf der Liste kann mit maximal drei Stimmen bedacht werden (Kumulieren). Auf diese Weise können die Parteimitglieder die Reihung der Liste aktiv verändern. Dass dieses Verfahren keineswegs unrealisierbar ist, zeigt seine Anwendung bei Kommunalwahlen in Bayern. Auf die Vorgänge in Hessen bezogen bedeutet dies, dass die Basis der Landes-SPD die "Abweichler" in der Fraktion, die die Wahl Andrea Ypsilantis zur Ministerpräsidentin verhindert haben, für ihr Verhalten bestrafen- aber auch belohnen könnte. Sehr schnell und eindeutig würde sich zeigen, welchen Rückhalt, auf den sich Carmen Everts, Dagmar Metzger, Silke Tesch und Jürgen Walter bei ihrer umstrittenen Entscheidung berufen, in ihrer Partei tatsächlich hatten. 4.2 Flexible statt Starre Liste Wie unter Punkt 3 bereits erwähnt, wurde über diesen Vorschlag bereits mehrmals diskutiert. So könnte die Starre Liste bei Bundestagswahlen durch eine Flexible Liste ersetzt werden, auf der die Platzierung durch die Parteien wiederum nur Vorschlagscharakter hat und die endgültige Reihung erst durch den Wähler bestimmt wird. Eine entsprechende Änderung des Bundeswahlgesetzes (BWahIG) wäre ohne größere Verfassungshürden denkbar. Diese Lösung wurde auch von Bundespräsident Horst Köhler in seiner "Berliner Rede" des Jahres 2008 angeregt. Auf den Fall Hessen bezogen bedeutet dies, dass auch die Wähler die Möglichkeit besäßen, das Verhalten der SPD-Abgeordneten direkt zu beurteilen. 03.12.2008 Michael Scheithauer Wissenschaftlicher Bü roleiter