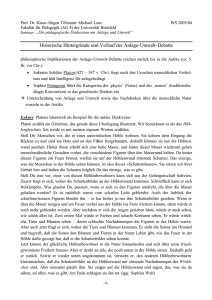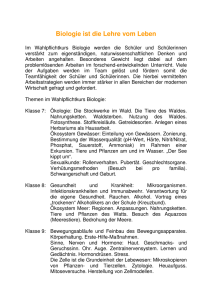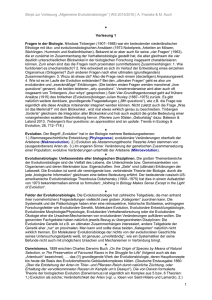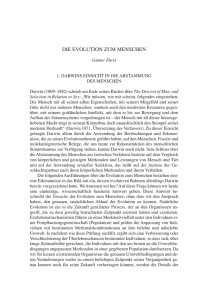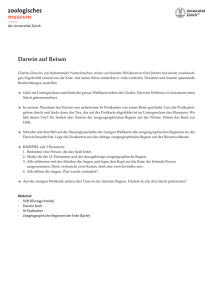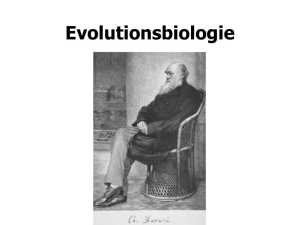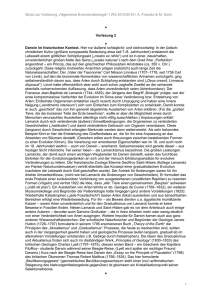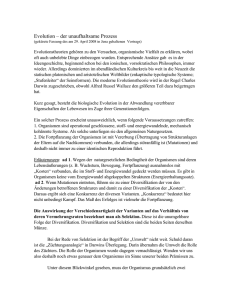Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt - ANTI
Werbung
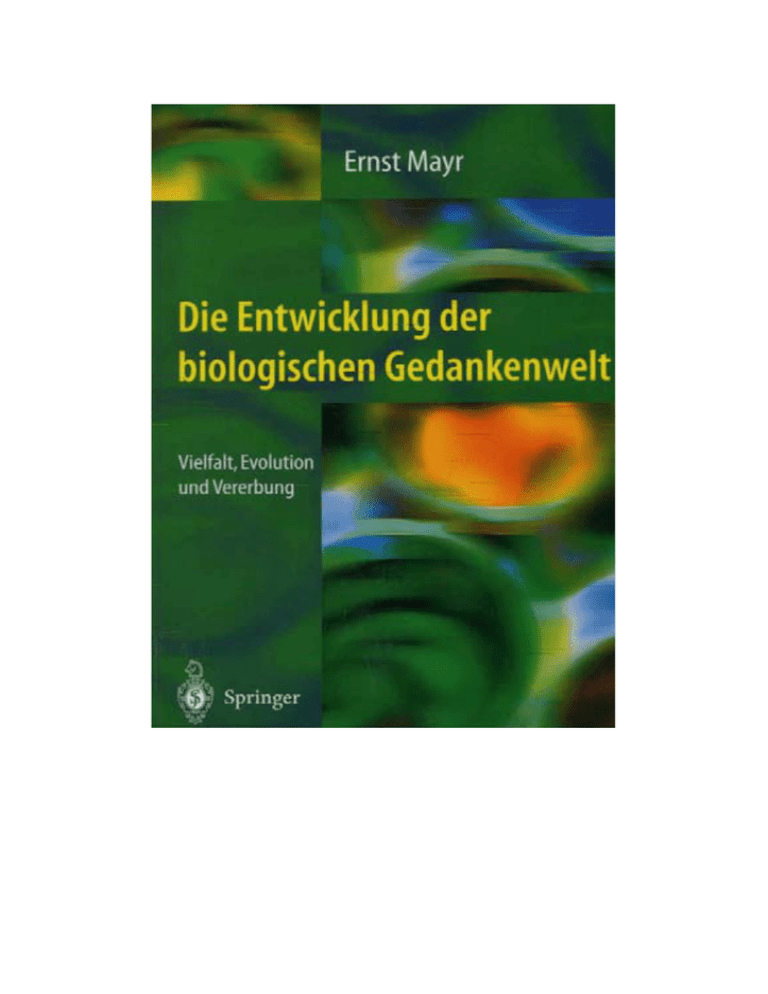
„Ein einzigartiges Buch, das nur von einem Mann wie Ernst Mayr geschrieben werden konnte, der nicht
nur einer der bedeutendsten Evolutionsbiologen dieses Jahrhunderts, sondern auch ein großer Philosoph,
Biologiehistoriker und außergewöhnlicher Schriftsteller ist. Kein anderes Buch erzählt so klar und
kritisch die Evolution der Ideen, die zur modernen Biologie führten."
Nobelpreisträger Francis Jacob
„Die Zahl der aufgegriffenen und vorläufig beantworteten Fragen
ist atemberauschend,die der historischen Einzelheiten überwältigend.
... Das Buch sollte in der Privatbibliothek jedes Biologen und
Biologiestudenten, aber auch jedes Naturwissenschaftshistorikers
zu finden sein. Dies ist ein außergewöhnliches, episches Werk, in
dem Mayr sich einmal mehr als Meister des Details, der Interpre
tation und Synthese zeigt."
DJ. Futuyama, Science
Ernst Mayr
Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt
Vielfalt, Evolution und Vererbung
Übersetzt von K. de Sousa Ferreira
Springer
Professor Dr. ERNST MAYR Museum of Comparative Zoology Harvard University
Cambrigde, MA 02138 USA
Übersetzt von
KARIN DE SOUSA FERREIRA Rua Nova da Piedade 64,1 °D 1200 Lissabon Portugal Titel
der englischen Originalausgabe:
Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought
© 1982 by The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts;
London, England ISBN 3-540-43213-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York
Nachdruck der Auflage von 1984
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Mayr, Ernst:
Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt: Vielfalt, Evolution und Vererbung / Ernst
Mayr. Übers, von K. de Sousa Ferreira. – Nachdr. der Ausg., Berlin, Heidelberg, New York,
Springer, 1984. – Berlin ; Heidelberg ; New York ; Barcelona ; Hongkong ; London ; Mailand ;
Paris ; Tokio : Springer, 2002 Einheitssacht.: The growth of biological thought ‹dt›
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben auch bei nur auszugsweiser Verwertung
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung
zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den
Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York ein Unternehmen der BertelsmannSpringer
Science+Business Media GmbH http:/www.springer.de
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002
Printed in Germany
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Satz: Appl, Wemding Einbandgestaltung: design & production GmbH, Heidelberg SPIN
10864244 31/3130 – 5 4 3 2 1 0 – Gedruckt auf säurefreiem Papier
Geleitwort zur Ausgabe 2002
Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt von ERNST MAYR ist ein zeitloses Buch,
das – wie man im Englischen sagt – „eternal shelf life" hat. Die amerikanische Ausgabe
erschien 1982, seit 1985 gibt es auch eine broschierte Version und sie erfreut sich bis heute
eines lebhaften Interesses bei stets neuen Generationen von Biologen, Wissenschaftshistorikern
und Philosophen. Der Autor war glücklich, als der Springer-Verlag 1984 eine ins Deutsche
übertragene und von Hansjochem Autrum stilistisch wie fachlich durchgesehene Ausgabe
herausgab, denn dieses Buch „beschäftigt sich mit Problemen der Ideengeschichte, die seit
Hunderten von Jahren in der deutschen Gedankenwelt eine wichtige Rolle gespielt haben".
Leider war die deutsche Ausgabe seit Jahren vergriffen. Um so erfreulicher ist es, dass der
Springer-Verlag jetzt eine neue broschierte Ausgabe aufgelegt hat.
Dieses Werk behandelt zwar Aspekte der Geschichte der Biologie, ist aber dennoch kein
Geschichtsbuch der Biologie im engeren Sinne. Vielmehr bietet es eine umfangreiche Analyse
der Entstehung und des Wandels der Ideenwelt der Biologie, die schließlich zur
konzeptionellen Synthese der modernen organismischen Biologie und Evolutionsbiologie
führte. Dieses Jahrhundertwerk ist bisher einzigartig geblieben, und jeder Biologe,
Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftsphilosoph sollte es besitzen. Mit dem zunehmenden
öffentlichen Interesse an allgemeinen Fragen der Evolutionsbiologie wird es sicherlich auch
aufgeschlossene Laien als Leser finden.
Würzburg, Januar 2002
BERT HÖLLDOBLER
Geleitwort
Meinen akademischen Lehrer RICHARD HESSE (1868-1944) faszinierte als Studenten die
Abstammungslehre. Sie stand zu seiner Zeit im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses
und war – weit über die Biologie hinaus – Gegenstand zuweilen heftiger öffentlicher
Diskussionen. Sie befruchtete alle Gebiete der Natur- und Geisteswissenschaften. HESSE
wurde Zoologe; von ihm stammen die grundlegenden Beiträge zur Evolution der
Lichtsinnesorgane. Er war aber nicht nur Spezialist auf diesem Gebiet: Er kannte die gesamte
zoologische Literatur, seine Kenntnisse von Tieren und Pflanzen waren erstaunlich; er war
Tiergeograph und Ökologe. Diesem vielseitigen Lehrer verdanke ich das Interesse für das
gesamte Gebiet der Biologie. Daher mein Mut, die Übersetzung des vorliegenden Werkes
durchzusehen, als ich vom Springer-Verlag (Herrn Dr. DIETER CZESCHLIK) gefragt wurde,
ob ich bereit sei, die Übersetzung des Werkes stilistisch zu überprüfen. Es kam noch anderes
dazu: Zoologisches Universitätsinstitut und Museum waren in Berlin in einem Gebäude
vereint. Das forderte geradezu einen regen Gedankenaustausch aller Mitarbeiter heraus. Noch
als Student lernte ich Professor ERWIN STRESEMANN, den Lehrer von ERNST MAYR und
diesen selbst kennen. Die Freundschaft überstand den Krieg und die Trennung:
STRESEMANN blieb in Berlin, ERNST MAYR ging in die USA, ich wurde 1946 Assistent
bei dem Entwicklungsphysiologen KARL HENKE in Göttingen und erhielt 1952 einen Ruf
nach Würzburg. Zum Studium von ERNST MAYRS Arbeiten war ich gezwungen, weil von
1952 bis in die 70er Jahre – wie allgemein üblich – die einführende Vorlesung über
„Allgemeine Zoologie" von mir allein gelesen wurde, obwohl der Gegenstand meiner eigenen
Forschung nur einen kleinen Ausschnitt daraus darstellte. Eine einführende „Grundvorlesung",
auf viele Spezialisten verteilt, gleicht einer Landschaft mit kleinen Gipfeln, und niemand –
weder der Vortragende noch der Student – kommt leicht von einem Gipfel zum anderen.
Freilich erfordert es Mühe, viel Mühe, den höchsten Gipfel zu ersteigen, um sich und anderen
eine wirkliche Übersicht zu verschaffen. Gerade das ist in diesem Werk gelungen. Die in
diesem Buch beschworene Einheit der Biologie und ihrer Wissenschaftstheorie und ihrer
Auswirkungen auf die Philosophie muß erreicht und dem Studenten vermittelt werden. Wir
müssen wieder lernen, vor Bäumen nicht nur den Wald, sondern die ganze Landschaft zu
sehen. Forschung erfordert Spezialisten, Lehre verlangt mehr. Es genügt nicht, mit dem Lift
auf seinen eigenen Berg zu fahren; man muß sich und den Studenten schon die beschwerliche
Mühe machen, zu Fuß, wenn auch schnaufend auf den höchsten Gipfel zu steigen, um den Weg
zur Spitze den Hörern zu zeigen und schließlich von oben die Landschaft zu überblicken. So
hat ein Sinnesphysiologe physikalischer Richtung das vorliegende Buch im deutschen
Manuskript redigiert, ohne an Tenor und Aussagen etwas zu ändern, auch da nicht, wo er
anderer Meinung ist. Ungenauigkeiten in der Übersetzung der Fachtermini gehen auf mein
Konto. Originalität soll man nicht nivellieren, gerade dann nicht, wenn sie zu Widerspruch und
Diskussion Anlaß gibt. Aus allen diesen Gründen gehört das Buch in die Hand eines jeden
Biologen, der mehr seih will als nur ein Spezialist.
München, im Mai 1984
HANSJOCHEM AUTRUM
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Es ist mir eine besondere Freude, daß mein englisches Werk jetzt auch dem deutschen Leser
zugänglich wird, zumal dieser Band teilweise der deutschen Gedankenwelt entsprungen ist;
meine ganze akademische Ausbildung habe ich in Deutschland erlebt. Die deutsche Ausgabe
verdanke ich der Großzügigkeit des Verlages Springer, im besonderen dem persönlichen
Interesse von Herrn Dr. KONRAD F.SPRINGER. Ich verdanke sie der Bereitwilligkeit von
Frau KARIN DE SOUSA FERREIRA (Lissabon), die Riesenaufgabe zu übernehmen, 892
Seiten des englischen Textes zu übersetzen, obwohl sie nicht Biologin ist. Ganz besonders bin
ich meinem Freund HANSJOCHEM AUTRUM (München) dafür dankbar, daß er das deutsche
Manuskript Zeile für Zeile sorgfältig durcharbeitete, für alle Fachausdrücke das beste deutsche
Wort suchte und mit feinem Sprachgefühl den Text so fließend gestaltete, wie es die Materie
zu läßt. Ihnen allen bin ich zu tiefstem Dank verpflichtet.
Einer der Gründe, dieses Werk deutschen Lesern zu unterbreiten, ist: Es beschäftigt sich mit
Problemen der Ideengeschichte, die seit hunderten von Jahren in der deutschen Gedankenwelt
eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich hoffe, daß diese meine Synthese mit der
englischamerikanischen Einstellung zu diesen Problemen, sowie die von mir neu eingeführten
Gedanken zu einer erneuten Betrachtung auch in der deutschen Literatur führen werden. Vor
allem hoffe ich, daß Philosophen es unternehmen, sich mit Problemen vertraut zu machen, die
außerhalb des Gedankenkreises von KANT, HEGEL, HARTMANN, HUSSERL und
HEIDEGGER liegen. Die unselige Kluft, die heutzutage zwischen Naturwissenschaft, vor
allem Biologie, und Philosophie zu existieren scheint, kann nur überbrückt werden, wenn beide
Lager sich mit der Gedankenwelt des anderen Lagers vertraut machen.
Mai 1984
ERNST MAYR
Vorwort der englischen Ausgabe
Große Teile der modernen Biologie, insbesondere die Kontroversen zwischen den
verschiedenen Denkschulen, sind ohne eine Kenntnis des geschichtlichen Hintergrundes der
Probleme nicht völlig zu verstehen. Immer, wenn ich dies meinen Studenten klarzumachen
versuchte, fragten sie mich, in welchen Büchern sie über diese Dinge nachlesen könnten. Und
ich mußte zu meiner Bestürzung zugeben, daß keines der auf dem Markt erhältlichen Werke
diesem Bedürfnis entsprach. Gewiß gibt es eine Menge Schrifttum über das Leben von
Biologen und ihre Entdeckungen, aber diese Schriften sind durchweg unzureichend, sobald
man eine Geschichte der Konzepte und Ideen der Biologie sucht. Gewiß sind einige
Geschichten einzelner Disziplinen, wie etwa der Genetik oder der Physiologie, auch
Ideengeschichten. Aber für die Biologie als Ganzes gibt es nichts. Diese Lücke in der Literatur
zu füllen, ist das Ziel dieses Buches. Dieser Band ist keine Geschichte der Biologie – das muß
hervorgehoben werden – und nicht in der Absicht geschrieben worden, bestehende
Geschichtswerke der Biologie, etwa das von NORDENSKIÖLD, ZU ersetzen. Der Ton liegt
auf dem Hintergrund und der Entwicklung der Ideen, die die moderne Biologie beherrschen.
Mit anderen Worten, es ist eine entwicklungsgeschichtliche, keine deskriptive Darstellung.
Eine solche Behandlung rechtfertigt, ja erfordert geradezu die Vernachlässigung mancher
vorübergehender Entwicklungen in der Biologie, die keinen Einfluß auf die weitere
Ideengeschichte hatten.
Als ich zum ersten Mal den Plan faßte, eine Ideengeschichte der Biologie zu
schreiben/schien mir das Ziel unendlich fern. Die ersten Jahre (1970-1975) waren dem Lesen,
Notizensammeln und der Vorbereitung des ersten Entwurfs gewidmet. Bald wurde deutlich,
daß das Gebiet für einen einzigen Band zu weit war, und ich entschloß mich, zuerst einen Band
über die Biologie „letzter" (evolutionärer) Ursachen vorzubereiten, Doch selbst dieses
begrenzte Ziel ist ein hoffnungslos umfangreiches Unterfangen. Wenn ich überhaupt
erfolgreich gewesen bin, dann nur, weil ich auf den meisten in diesem Band behandelten
Gebieten selbst intensiv geforscht habe. Hier kannte ich also die Probleme und die meiste
Literatur. Ich hoffe, die Biologie der „unmittelbaren" (funktionalen) Ursachen in einem
späteren Band zu behandeln, der die Physiologie in allen ihren Aspekten, die
Entwicklungsbiologie und die Neurobiologie umfassen soll. Wenn eine biologische Disziplin,
wie etwa die Genetik, sowohl mit letzten als auch mit unmittelbaren Ursachen zu tun hat, so
werden in diesem Band nur die letzten Ursachen behandelt. Zwei Bereiche der Biologie hätten
(wenigstens zum Teil) in diesen Band aufgenommen werden können, wurden
es jedoch nicht: die Begriffsgeschichte der Ökologie und die der Verhaltensbiologie
(insbesondere der Ethologie). Zum Glück ist diese Unterlassung nicht allzu schmerzlich, da
gegenwärtig andere Autoren Werke über die Geschichte der Ökologie und Ethologie schreiben.
Der Berufshistoriker wird aus den Kapiteln 1 und 3 wahrscheinlich nicht viel lernen, ja er
wird sie vermutlich als etwas amateurhaft empfinden. Ich habe diese zwei Kapitel zum Nutzen
der Nichthistoriker eingefügt, da ich glaube, daß sie ihnen helfen werden, den rein
wissenschaftlichen Entwicklungen der anderen Kapitel mit einem tieferen Verständnis zu
folgen.
Einer ganzen Reihe von Personen und Institutionen bin ich zu größtem Dank verpflichtet.
PETER ASHLOCK, F. J. AYALA, JOHN BEATTY, WALTER BOCK, ROBERT
BRANDON, ARTHUR CAIN, FRED CHURCHILL, BILL COLEMAN, LINDLEY
DARDEN, MAX DELBRÜCK, MICHAEL GHISELIN, JOHN GREENE, CARL GUSTAV
HEMPEL, SANDRA HERBERT, JON HODGE, DAVID HÜLL, DAVID LAYZER,
E.B.LEWIS, ROBERT MERTON, J.A.MOORE, RON MUNSON, EDWARD REED,
PHILLIP SLOAN, FRANK SULLOWAY, MARY WILLIAMS und andere haben
Rohfassungen verschiedener Kapitel gelesen, auf Irrtümer und Auslassungen aufmerksam
gemacht und zahlreiche konstruktive Vorschläge vorgebracht. Ich bin ihrem Rat nicht immer
gefolgt und für verbliebene Fehler und Unzulänglichkeiten allein verantwortlich. P.Ax,
MURIEL BLAISDELL und B.WERNER habe ich für nützliche faktische Information zu
danken.
GILLIAN BROWN, CHERYL BURGDORF, SALLY LOTH, AGNES I.MARTIN,
MAUREEN SEPKOSKI und CHARLOTTE WARD haben unzählige Fassungen des
Manuskripts getippt und bei der Bibliographie geholfen. WALTER BORAWSKI tippte nicht
nur vorläufige Versionen, sondern auch die gesamte endgültige Fassung des Manuskripts und
der Bibliographie und bereitete außerdem das Manuskript für das Sachverzeichnis vor.
RANDY BIRD half bei der Vervollständigung der Verweise. SUSAN WALLACE redigierte
das gesamte Manuskript und merzte dabei zahlreiche Ungereimtheiten, Redundanzen und
stilistisch nicht sehr glückliche Wendungen aus. Sie alle trugen wesentlich zur Qualität des
endgültigen Werkes bei. Es versteht sich von selbst, daß meine Dankesschuld ihnen gegenüber
groß ist.
Das Museum of Comparative Zoology hat mir durch das Entgegenkommen seines Direktors,
Professor A. W.CROMPTON, Büroraum, Sekretariatshilfe und Bibliothekseinrichtungen auch
noch nach meiner Emeritierung zur Verfügung gestellt. Forschungsaufenthalte am Institute for
Advanced Study (Princeton, Frühjahr 1970), an der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für
Biologie (Tübingen, 1970), ein Seniorstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung
(Würzburg, 1977), ein Stipendium der Rockefeller Foundation (Villa Serbelloni, Bellagio,
1977) sowie ein Zuschuß (Nr. GS 32176) seitens der National Science Foundation haben meine
Arbeit in hohem Maße gefördert.
In allen Fällen, in denen keine Sekretariatshilfe zur Verfügung stand, hat sich meine Frau
der Arbeit angenommen, Diktate übertragen, Literatur exzerpiert und auf vielerlei Weise zum
Manuskript beigetragen. Ihr Beitrag an diesem Band ist unschätzbar und übersteigt jeden Dank.
Museum of Comparative Zoology, Harvard University
ERNST MAYR
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung: Wie schreibt man eine Geschichte der Biologie?
Subjektivität und Voreingenommenheit
1
8
Fallstricke und Schwierigkeiten
13
Warum befassen wir uns mit der Geschichte der Biologie?
16
2 Begriffsstruktur und Stellung der Biologie in der Naturwissenschaft
Das Wesen der Wissenschaft
18
18
Neue Fakten oder neue Ideen?
20
Die Methode in der Wissenschaft
21
Die Stellung der Biologie innerhalb der Naturwissenschaft
27
Wie und warum ist die Biologie verschieden?
30
Besondere Merkmale der lebenden Organismen
42
Reduktion und Biologie
49
Emergenz
52
Die Begriffsstruktur der Biologie
56
Historische Darstellungen und die Evolutionsbiologie
59
Eine neue Philosophie der Biologie
61
Die Biologie und das Denken des Menschen
63
Biologie und menschliche Wertmaßstäbe
65
3 Das wechselnde geistige Milieu der Biologie
69
Vorzeit und Antike
70
Aristoteles
73
Das christliche Weltbild
76
Die Renaissance
78
Descartes
Die Entdeckung der Vielfalt
Naturtheologie
Leben und Fortpflanzung
Die Biologie in der Zeit der Aufklärung
Paris von Buffon bis zu Cuvier
Der Aufstieg der Wissenschaft vom 17. bis zum 19. Jahrhundert
Das Wesen der wissenschaftlichen Veröffentlichung
Trennende Entwicklungen im 19. Jahrhundert
80
82
85
87
88
88
90
91
92
Die Physiologie reift heran
Der Darwinismus
93
95
Die Biologie im 20. Jahrhundert
98
Ethologie und Ökologie
98
Das Entstehen der Molekularbiologie
100
Hauptperioden in der Geschichte der Biologie
102
Biologie und Philosophie
104
Biologie heute
107
Teil I: Vielfalt des Lebens
Die Entdeckung des Ausmaßes der Vielfalt
110
Die Systematik, die Wissenschaft der Vielfalt
114
4 Makrotaxonomie, die Wissenschaft der Klassifikation
Aristoteles
119
121
Die Klassifikation der Pflanzen in der Antike und zur Zeit der
Verfasser der Kräuterbücher
Die Klassifikation bei den Verfassern der Kräuterbücher
125
126
Abwärtsklassifikation mittels logischer Zweiteilung
128
Die vor-linnaeischen Zoologen
134
Carl Linnaeus
138
Linnaeus und die höheren Kategorien
140
Die Gattung
141
Das linnaeische Sexualsystem
Buffon
143
144
Ein Neubeginn in der Tierklassifikation
146
Cuvier und die Korrelation von Merkmalen
147
Lamarck
148
Taxonomische Merkmale
Polythetische Taxa
Aufwärtsklassifikation durch empirische Gruppierung
Adanson und die Verwendung multipler Merkmale
Die Übergangsperiode (1758-1859)
Die Suche nach einem natürlichen System
Hierarchische Klassifikationen
Die Realität der höheren Kategorien und Taxa
149
152
153
156
157
159
165
166
5 Gruppieren nach gemeinsamer Abstammung
Der Niedergang der makrotaxonomischen Forschung
Die Notwendigkeit einer neuen Methodik
168
175
177
Die numerische Phänetik
178
Die Kladistik
182
Kladistische Analyse
183
Kladistische Klassifikation
184
Die traditionelle oder evolutionäre Methodik
187
Neue taxonomische Merkmale
189
Die Erkenntnistheorie der Klassifikation
191
Erleichterung der Informationswiedergewinnung
192
Gegenwärtige Situation und Zukunft der Systematik
195
Das Studium der organischen Vielfalt
197
6 Mikrotaxonomie, die Wissenschaft von den Arten
Frühere Artkonzepte
Der essentialistische Artbegriff
202
204
206
Linnaeus
207
Buffon
209
Der nominalistische Artbegriff
212
Darwins Artbegriff
213
Das Entstehen des biologischen Artbegriffs
Die Eigenschaften der biologischen Art
217
219
Die neue Systematik
221
Die Gültigkeit des biologischen Artbegriffs
224
Die Anwendung des biologischen Artbegriffs auf multidimensionale
229
Arttaxa
Variation in der Raum-Dimension
Variation in der Zeitdimension
Die Bedeutung der Art in der Biologie
230
235
237
Teil II: Evolution
7 Entstehungsgeschichten ohne Evolution
240
Platon
242
Aristoteles
243
Der Einfluß des Christentums
Das Entstehen des Evolutionsdenkens
245
247
Die Rolle der Kosmologie
249
Die Rolle der Geologie
251
Die Rolle der Naturgeschichte
253
Weitere Entwicklungen in der Biologie
Die französische Aufklärung
Die Ideen Fortschritt und Evolution
256
256
258
Maupertuis
261
Buffon
262
Diderot
268
Entwicklungen in anderen Teilen Europas
Linnaeus
Das Erbe der Vor-Lamarckschen Epoche
8 Evolution vor Darwin
Lamarck
269
271
272
273
273
Lamarcks neues Paradigma
275
Ausgestorbene Arten
276
War Lamarck der erste konsequente Evolutionist?
280
Lamarcks Mechanismen des evolutiven Wandels
281
Der Unterschied zwischen den Theorien Lamarcks und Darwins
285
Lamarck im Rückblick
286
Von Lamarck zu Darwin
Frankreich
Cuvier
287
288
289
295
England
Progressionismus
298
Lyell und der Uniformitarianismus
299
Chambers' Vestiges of the Natural History of Creation
304
Spencer
307
Deutschland
Unger
Die Windstille vor Darwin
9 Charles Darwin
Darwin und die Evolution
Die Entwicklung von Darwins Begriffswelt
308
311
312
314
319
320
Der Ursprung neuer Arten
Darwin wird Evolutionist
Geographische Speziation
Alfred Rüssel Wallace
Darwins Zaudern
Die Veröffentlichung von Darwins Über die Entstehung der Arten
10 Darwins Beweismaterial für Evolution und gemeinsame Abstammung
Das Beweismaterial für die Evolution des Lebens
321
325
328
333
335
338
340
341
Die Unvollständigkeit des Fossilienmaterials
341
Beweismaterial zugunsten der gemeinsamen Abstammung
347
Gemeinsame Abstammung und das natürliche System
Gemeinsame Abstammung und Muster geographischer
Verbreitung
Die Morphologie als Beweis für Evolution und gemeinsame
Abstammung
Die Embryologie als Beweis für Evolution und gemeinsame
Abstammung
11 Die Ursache der Evolution: natürliche Auslese
348
350
364
375
382
Die Logik der Theorie der natürlichen Auslese
Die Hauptkomponenten der Theorie der natürlichen Auslese385
384
Fruchtbarkeit
Der Kampf ums Dasein und das Gleichgewicht der Natur
Künstliche Zuchtwahl . . .
Populationsdenken und die Rolle des Individuums
386
386
389
390
Die Entstehung der Idee der natürlichen Auslese
Darwins Dankesschuld an Malthus
A. R. Wallace und die natürliche Auslese
Vorläufer der natürlichen Auslese
Die Wirkung der Darwinschen Revolution
Darwins fünf Theorien
Der Widerstand gegen die natürliche Auslese
391
393
395
399
401
404
409
Gründe für die Heftigkeit des Widerstandes gegen die Auslese
412
Alternative Evolutionstheorien
421
Evolutive Progression, Regelmäßigkeiten und Gesetze
426
12 Vielfalt und Synthese des Evolutionsdenkens
430
Neo-Darwinismus
431
Die immer größer werdende Spaltung unter den Evolutionisten
433
Allmähliche Evolution oder Saltationen?
Fortschritte in der Evolutionsgenetik
Chetverikov
Fortschritte in der Evolutionssystematik
Speziation
Die Synthese der Evolutionsbiologie
Die Architekten der synthetischen Theorie der Evolution
13 Die Entwicklung nach der Synthese der Evolutionsbiologie
436
442
446
449
451
454
455
459
Populationsgenetik
461
Molekularbiologie
461
DNA-Sorten
464
Die Entstehung des Lebens
467
Natürliche Auslese
Ungelöste Fragen der natürlichen Auslese
470
475
Artbildungsmodi
483
Makroevolution
488
Die Evolution des Menschen
Eugenik
499
501
Ungelöste Probleme in der Evolutionsbiologie
502
Die Evolution im modernen Denken
503
Teil III: Variation und ihre Vererbung
14 Frühe Theorien und Züchtungsversuche
507
Vererbungstheorien im Altertum
508
Neuanfänge
511
Mendels Vorläufer
513
Die Arthybridenzüchter
514
Die Pflanzenzüchter
520
15 Die Keimzellen, Träger der Vererbung
523
Die Schwann-Schleiden'sche Zelltheorie
525
Die Bedeutung von Sexualität und Befruchtung
528
Das Wesen der Befruchtung
529
Der Befruchtungsprozeß
531
Die Rolle des Zellkerns
533
Die materielle Grundlage von Variation und Vererbung
Vorläufer des Genkonzepts
Die Chromosomen und ihre Rolle
535
536
539
Mitose
540
Vom Zellkern zu den Chromosomen
543
16 Die Natur der Vererbung
545
Darwin und die Variation
545
Indirekte oder direkte Vererbung
550
Darwin und die indirekte Vererbung
552
Darwins These der Pangenesis
555
Der Niedergang der Annahme einer indirekten Vererbung
556
August Weismann
Weismanns Vererbungstheorie
559
561
Eine alternative Vererbungstheorie
563
Die Bedeutung der Sexualität
564
Hugo de Vries
566
Genetische Einheiten
567
Gregor Mendel
568
Mendels Resultate
571
Mendels signifikantester Beitrag
576
Warum Mendels Werk unbeachtet geblieben war
578
17 Die Blütezeit der Mendelschen Genetik
582
Die Wiederentdecker Mendels
582
Die klassische Periode der Mendelschen Genetik
586
Fortschritte in der Mendelschen Genetik
588
Der Ursprung neuer Variation (Mutation)
Das Entstehen der modernen Genetik
591
596
Die Chromosomen und die Mendelsche Vererbung
596
Die Sutton-Boveri Chromosomentheorie
598
Geschlechtsbestimmung
600
Morgan und das Fliegenzimmer
602
Unabhängige Merkmalskombination und Koppelung
605
Meiose
607
Morgan und die Chromosomentheorie
614
Die Chromosomenforschung
618
18 Gentheorien
620
Mischvererbung (Blending Inheritance)
621
Der Unterschied zwischen Phänotyp und Genotyp
623
Konkurrierende Vererbungstheorien
625
Die Mendelsche Erklärung der kontinuierlichen Variation
630
Das Ende der indirekten Vererbung
632
Unsicherheit über das Wesen des Gens
634
Positionseffekte
636
Experimentelle Mutation und die Natur des Gens
639
Verschiedene Genkonzepte
643
19 Die chemische Basis der Vererbung
Die Natur des Keimplasmas
Die wechselnden Geschicke der Nukleinsäuretheorie der Vererbung
645
649
651
Die Entdeckung der Doppelhelix
655
Die Genetik im modernen Denken
659
20 Epilog: Auf dem Wege zu einer Wissenschaft der Wissenschaft
Die Wissenschaftler und das wissenschaftliche Klima
662
663
Forschungsstrategien
665
Die Macht der Ideologien
666
Miteinander unvereinbare Komponenten
667
Verfrüht oder unmodern?
668
Die Form der Veröffentlichung
669
Die Reifung von Theorien und Begriffen
670
Konstruktive Beiträge zur Reifung von Theorien und
Begriffen
Hindernisse für die Reifung von Theorien und Begriffen
Die Wissenschaften und das äußere Milieu
670
673
678
Vorspiegeln falscher Tatsachen oder echte Einflüsse?
679
Die Einflußquellen
680
Die Rolle des technischen Fortschritts in der wissenschaftlichen Forschung 682
Fortschritt in der Wissenschaft
684
Anmerkungen
686
Glossar (einschließlich Erklärung englischer Fachausdrücke)
712
Literaturverzeichnis
716
Personen- und Sachverzeichnis
755
1 Einführung: Wie schreibt man eine Geschichte der
Biologie?
Alles, was sich im Laufe der Zeit verändert, hat definitionsgemäß eine Geschichte – das
Universum, Länder, Dynastien, Kunst, Philosophie, Ideen. Auch die Wissenschaften sind, seit
sie sich aus Mythen und frühen Philosophien entwickelt haben, einer ständigen geschichtlichen
Veränderung unterworfen gewesen und somit ein rechtmäßiges Forschungsobjekt für den
Historiker. Ihrem Wesen nach ist Wissenschaft ein fortwährendes Problemlösen, ein
ununterbrochenes Beantworten von Fragen auf der Suche nach einem Verständnis der Welt, in
der wir leben. Daher ist eine Geschichte der Wissenschaften zunächst eine Geschichte der
Probleme, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen, und eine
Geschichte der Lösungen oder Lösungsversuche. Zugleich ist ihre Geschichte auch eine
Geschichte der Entwicklung der Prinzipien, die den Vorstellungsrahmen der Wissenschaft
bilden. Weil die großen Streitfragen der Vergangenheit häufig bis in die moderne Wissenschaft
hineinreichen, lassen sich viele heutige Argumente nicht völlig verstehen, solange man nicht
ihre Geschichte kennt.
Geschriebene Geschichte bedarf, wie die Wissenschaft selbst, der ständigen Korrektur.
Irrige Interpretationen eines früheren Autors werden schließlich zu Mythen, die ohne zu fragen
akzeptiert und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Es ist mein besonderes
Anliegen gewesen, möglichst viele dieser Mythen aufzuzeigen und auszumerzen – ohne, wie
ich hoffe, allzu viele neue geschaffen zu haben. Der wichtigste Grund jedoch, weshalb
geschriebene Geschichte ständig überarbeitet werden muß, ist der, daß sie zu jeder gegebenen
Zeit jeweils nur den gegenwärtigen Stand des Verständnisses widerspiegelt. Sie hängt zum
einen davon ab, wie der Autor den damaligen Zeitgeist der Biologie interpretiert, zum anderen
wird die Darstellung auch von seinem eigenen Vorstellungsrahmen und Hintergrund bestimmt.
Somit ist das Schreiben von Geschichte zwangsläufig subjektiv und ephemer [1].
Der Vergleich der vorliegenden Werke der wissenschaftsgeschichtlichen Literatur zeigt
sofort: die einzelnen Historiker haben sehr unterschiedliche Auffassungen von Wissenschaft
und Geschichtsschreibung. Zwar bemühen sich letztlich alle, das Anwachsen der
wissenschaftlichen Kenntnisse und die Veränderungen in den erklärenden Begriffen
darzustellen, doch haben nicht alle versucht, die sechs Hauptfragen zu beantworten, die jeder
stellen muß, der den Fortschritt der Wissenschaft kritisch und umfassend beschreiben will:
Wer? Wann? Wo? Was? Wie? und Warum? Je nach der Auswahl, die der Autor unter diesen
Fragen trifft, lassen sich die meisten Geschichtswerke, die ich kenne, in die im folgenden
genannten Klassen einteilen (vgl. Passmore, 1965: 857-861), obgleich ich zugeben muß, daß in
fast allen dieser Werke eine Kombination der verschiedenen Ansätze und Strategien zu finden
ist.
Lexikographische Geschichtswerke
Hier handelt es sich um mehr oder weniger beschreibende Werke mit dem Schwergewicht
auf den Fragen Was? Wann? und Wo? Was waren die wichtigsten wissenschaftlichen
Leistungen zu einem beliebigen Zeitraum in der Vergangenheit? Welches waren die Zentren
der Wissenschaft, wo arbeiteten die führenden Forscher, und wie verlagerten sich diese Zentren
im Laufe der Zeit? Niemand wird den Wert solcher Geschichtsschreibung bezweifeln. Eine
korrekte Darstellung der Fakten ist unerläßlich, denn ein großer Teil der traditionellen
Wissenschaftsgeschichte (wie auch ihrer Standardtexte) ist mit Mythen und erfundenen
Anekdoten verbrämt. Jedoch eine rein beschreibende Geschichte gibt nur einen Teil des
Ganzen wieder.
Chronologische Geschichtswerke
Eine Betrachtung der zeitlichen Abfolge ist für jede Art der Geschichtsschreibung
unerläßlich. Tatsächlich kann man die Chronologie sogar zum wichtigsten
Organisationskriterium machen; einige Autoren haben dies auch getan. Sie haben zum Beispiel
gefragt: Was ist in den Jahren zwischen 1749 und 1789 oder zwischen 1789 und 1830 in der
Biologie geschehen? Eine chronologische Geschichtsschreibung gibt uns eine Reihenfolge von
Querschnitten durch die Gesamtheit der Entwicklungen in allen Bereichen der Biologie. Es ist
eine legitime und aufschlußreiche Methode. Sie weckt ein Empfinden für den Zeitgeist und die
Gesamtheit der zeitgenössischen Einflüsse. Mit dieser Methode läßt sich untersuchen, wie sich
die Entwicklungen in anderen Bereichen der Wissenschaft auf die Biologie ausgewirkt haben
und wie innerhalb der Biologie Fortschritte in der experimentierenden Forschung das Denken
der Naturbeobachter beeinflußt haben und umgekehrt. Das Verständnis vieler Probleme in der
Entwicklung der Biologie wird durch diese chronologische Betrachtung wesentlich erleichtert.
Der Nachteil dieser Methode ist jedoch, daß jedes große wissenschaftliche Problem an
zahlreichen Stellen aufgeführt und damit „atomisiert" wird.
Biographische Geschichtswerke
In diesen Werken wird der Fortschritt der Wissenschaft anhand der Lebensbeschreibungen
führender Wissenschaftler porträtiert. Die Methode ist gerechtfertigt, denn die Wissenschaft
wird von Personen gemacht und nicht selten ist der Vorstoß einzelner Wissenschaftler wie
Newton, Darwin und Mendel eine Art Revolution gewesen. Allerdings ist die Methode mit
dem gleichen schwerwiegenden Mangel behaftet wie der rein chronologische Ansatz: sie
„atomisiert" jede große wichtige Frage. Das Artproblem zum Beispiel wird unter Platon,
Aristoteles, Cesalpino sowie Buffon, Linnaeus, Cuvier, Darwin, Weismann, Nägeli, de Vries,
Jordan, Morgan, Huxley, Mayr, Simpson usw. behandelt werden müssen; getrennt sind dann
dabei alle Erörterungen derselben Frage durch viele Seiten, wenn nicht Kapiel.
Kulturelle und soziologische Geschichtswerke
Das Schwergewicht liegt auf der Feststellung, daß Wissenschaft eine Form menschlicher
Betätigung und daher von dem geistigen und institutionellen Milieu ihrer Zeit nicht zu trennen
ist. Dieser Blickwinkel ist vor allem für diejenigen faszinierend, die von der allgemeinen
Geschichte zur Wissenschaftsgeschichte kommen. Er erlaubt es ihnen, Fragen zu stellen, wie
z.B. die, warum die britische Wissenschaft in den Jahren von 1700 bis 1850 so stark
experimentell und technisch ausgerichtet war, während die zeitgenössische französische
Wissenschaft eher zu Mathematik und Rationalismus neigte. Warum die Wissenschaft in
England ein Dreivierteljahrhundert länger von der Naturtheologie beherrscht war als auf dem
Kontinent. In welchem Maße Darwins Theorie der natürlichen Auslese ein Kind der
industriellen Revolution war.
Auch wenn der Autor einer Geschichte der Biologie sich gegen diesen Ansatz entscheidet,
muß er doch die kulturelle und intellektuelle Umwelt eines Wissenschaftlers sorgfältig
untersuchen, wenn er die Ursachen für das Entstehen seiner Vorstellungen bestimmen will. Für
das vorliegende Buch ist dies von herausragender Bedeutung, da eins der Hauptziele meiner
Abhandlung gerade darin besteht, die Gründe für Veränderungen in biologischen Theorien zu
finden. Wodurch wurde es einem Forscher möglich, eine Entdeckung zu machen, die seinen
Zeitgenossen entgangen war? Aus welchem Grunde lehnte er die herkömmlichen
Interpretationen ab und schlug eine neue Erklärung vor? Woher bezog er die Inspiration, mit
einem neuen Ansatz an die Dinge heranzugehen? Fragen dieser Art müssen immer wieder
gestellt werden.
Die meisten frühen Werke der Wissenschaftsgeschichte, insbesondere jene, die sich mit
speziellen wissenschaftlichen Disziplinen befassen, wurden von Wissenschaftlern geschrieben,
die auf diesem speziellen Gebiet arbeiteten; für sie stand es außer Frage, daß der intellektuelle
Anstoß für die Veränderung in der Wissenschaft von innerhalb dieser Wissenschaft selbst
(„interne" Einflüsse) kam. Später, als die Geschichte der Wissenschaft mehr „berufsmäßig"
betrieben wurde und Historiker und Soziologen den Fortschritt des wissenschaftlichen Denkens
zu analysieren begannen, neigte man dazu, den Einfluß des allgemeinen geistigen, kulturellen
und gesellschaftlichen Milieus der Epoche zu betonen („externe" Einflüsse). Niemand würde
bezweifeln wollen, daß beide Arten von Einflüssen bestehen; über ihre relative Bedeutung,
insbesondere für spezifische Entwicklungen, z. B. Darwins Theorie der natürlichen Auslese,
gehen die Meinungen jedoch stark auseinander.
Häufig ist es gar nicht leicht, externe und interne Faktoren überhaupt voneinander zu
unterscheiden. Die scala naturae z.B. war ein philosophisches Konzept, das ohne jeden
Zweifel einen Einfluß auf die Ideenbildung bei Lamarck und anderen frühen
Evolutionsbiologen ausgeübt hat. Doch Aristoteles hatte diesen Begriff auf der Grundlage der
empirischen Beobachtung von Organismen entwickelt. Andererseits gehören allgemein
anerkannte Ideologien zu den am wenigsten umstrittenen externen Faktoren. Das christliche
Dogma von der Weltschöpfung durch einen allmächtigen Schöpfer und der teleologische
Gottesbeweis aus der Naturtheolögie haben das biologische Denken jahrhundertelang
beherrscht. Eine weitere einflußreiche Ideologie war der Essentialismus (Plato).
Interessanterweise erfolgte ihre Verdrängung durch Darwin weitgehend aufgrund der
Beobachtungen von Tierzüchtern und Taxonomen – d.h. aufgrund interner Faktoren.
Externe Faktoren haben nicht unbedingt ihren Ursprung in der Religion, in der Philosophie,
im kulturellen Leben oder der Politik, sie können – soweit es die Biologie betrifft – auch aus
einer anderen Wissenschaft stammen. Der extreme Physikalismus (zu dem auch der
Determinismus und extreme Reduktionismus gehören), der nach der wissenschaftlichen
Revolution im westlichen Denken vorherrschend war, hat die Theorienbildung in der Biologie
mehrere Jahrhunderte lang beeinflußt, nicht selten zu ihrem Nachteil, wie wir jetzt erkennen.
Die scholastische Logik, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hat die taxonomische Methodik
von Cesalpino bis Linnaeus beherrscht. Diese Beispiele, denen sich noch viele andere
hinzufügen ließen, belegen ohne Zweifel die Bedeutung externer Einflüsse auf die
Theorienbildung in der Biologie. Sie werden in den entsprechenden Kapiteln ausführlich
analysiert werden.
Es darf nicht übersehen werden, daß externe Faktoren Wissenschaft auf zwei völlig
verschiedene Arten beeinflussen: sie können entweder das allgemeine Niveau der
wissenschaftlichen Betätigung an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit
beeinflussen – oder aber, sie können sich auf eine spezifische wissenschaftliche Theorie
auswirken, diese sogar hervorbringen. Allzu häufig hat man es in der Vergangenheit versäumt,
die beiden Aspekte zu unterscheiden, was zu zahllosen Meinungsverschiedenheiten über die
relative Bedeutung externer gegenüber internen Faktoren geführt hat.
Der Effekt der Umweltbedingungen bei wissenschaftlicher Betätigung hat manchen
gefesselt, seit es eine Geschichte der Wissenschaft gibt. Man hat endlos darüber spekuliert,
warum sich die Griechen so stark für wissenschaftliche Fragen interessiert haben und warum es
in der Renaissance zu einem Wiederaufleben der Wissenschaft gekommen ist. Wie wirkte sich
der Protestantismus auf die Wissenschaft aus (Merton, 1938)? Warum erlebte die Wissenschaft
im 19. Jahrhundert eine hohe Blüte in Deutschland? Zuweilen lassen sich wichtige externe
Faktoren im einzelnen spezifizieren; das sind (wie Merz 1896-1914 ausführt), die Abschaffung
des Latein zugunsten der deutschen Sprache an der Universität Halle im Jahre 1694 sowie die
Gründung der Göttinger Universität 1737, an der „Wissenschaft" eine wichtige Rolle spielte.
Institutionelle Veränderungen aller Art, einschließlich der Gründung der Royal Society,
politische Ereignisse wie Kriege und der Sputnik, auch technologische Erfordernisse wirken
sich stimulierend oder hemmend auf die Intensität wissenschaftlicher Aktivität aus. Doch all
dies läßt die höchst umstrittene Frage unbeantwortet, in welchem Ausmaß externe Faktoren
spezifische wissenschaftliche Theorien gefördert oder verhindert haben.
In letzter Zeit haben vor allem marxistische Historiker die These aufgestellt, daß
gesellschaftliche Ideologien die Gedanken eines Wissenschaftlers beeinflussen, und daß die
Wissenschaftsgeschichte, wie sie bisher betrieben worden sei, den gesellschaftlichen Kontext
völlig vernachlässigt habe. Das Resultat ist ihrer Meinung nach eine „bürgerliche" Geschichte
der Wissenschaft, die ganz anders aussieht, als eine proletarische Geschichte der Wissenschaft
aussehen würde. Stattdessen ist, so sagen sie, eine „radikale" Geschichte notwendig. Diese
Forderung geht letztlich auf die Behauptung von Marx zurück, herrschende Ideen und
herrschende Klassen seien nicht voneinander zu trennen. Aus diesem Grunde seien bourgeoise
und proletarische Wissenschaftsgeschichte zwei völlig verschiedene Dinge.
Die Behauptung, es gäbe eine proletarische Art, Wissenschaftsgeschichte zu schreiben, steht
im Widerspruch zu drei Tatsachen: Erstens stellen die Massen keine wissenschaftlichen
Theorien auf, die sich von denen der „Klasse" der Wissenschaftler unterscheiden. Wenn es
einen Unterschied gibt, so höchstens den, daß der „kleine Mann" häufig noch an Ideen festhält,
die von der Wissenschaft schon längst verworfen worden sind. Zweitens ist die
gesellschaftliche Mobilität unter Wissenschaftlern üblich, ein Viertel bis ein Drittel jeder neuen
Wissenschaftlergeneration kommt aus den sozioökonomisch unteren Klassen. Drittens ist es im
allgemeinen so, daß nicht Stand, sondern die Geburtsreihenfolge innerhalb einer
gesellschaftlichen Klasse dafür bestimmend ist, wer rebellische neue Ideen hervorbringt
(Sulloway, 1984). Alles dies steht im Gegensatz zu der These, die sozioökonomische Umwelt
übe einen dominierenden Einfluß auf die Geburt spezieller neuer wissenschaftlicher Ideen und
Begriffe aus. Die Beweislast liegt eindeutig bei denen, die solche Behauptungen aufstellen, und
bisher ist es ihnen nicht gelungen, konkrete Beweise irgendeiner Art vorzubringen (s. Kap. 11).
Niemand lebt in einem Vakuum; jeder, der viel liest, wie zum Beispiel Darwin nach seiner
Reise mit der Beagle, wird von seiner Lektüre zwangsläufig beeinflußt (Schweber, 1977).
Darwins Tagebücher legen ein Zeugnis dafür ab. Dies beweist nicht die These der Marxisten,
wie Hodge (1974) zeigt, derzufolge „Darwin und Wallace das kapitalistische laissezfaire-Ethos
von der Gesellschaft auf die gesamte Natur ausgedehnt haben". Offenkundig ist der Einfluß
sozialer Faktoren auf die Entwicklung spezifisch biologischer Fortschritte gering. Das
Gegenteil ist natürlich nicht richtig. Doch das Studium der Anstöße und Einflüsse der
Naturwissenschaften auf Sozialtheorie, auf gesellschaftliche Institutionen und Politik gehört in
den Bereich der Geschichte, Soziologie und Politischen Wissenschaft, und nicht in die
Wissenschaftsgeschichte. Ich stimme Alexander Koyre (1965, S. 856) darin zu, daß es
hoffnungslos ist, „die Existenz" bestimmter Wissenschaftler und Wissenschaften aus ihrer
Umwelt „abzuleiten". „Athen erklärt Plato ebenso wenig, wie Syracus eine Erklärung für
Archimedes oder Florenz eine solche für Galileo liefert. Nach derartigen Erklärungen zu
suchen, ist ein ganz und gar aussichtsloses Unterfangen, so aussichtslos wie der Versuch, die
zukünftige Entwicklung der Wissenschaft oder Wissenschaften als eine Funktion der Struktur
des sozialen Kontextes vorherzusagen." Auch Thomas Kuhn (1971, S.280) hat festgestellt, daß
der Historiker beständig „der Rolle des umgebenden Klimas außerwissenschaftlicher Ideen ein
übermäßiges Gewicht" beimißt (siehe auch Passmore, 1965).
Problembezogene Geschichtswerke
Vor mehr als hundert Jahren riet Lord Acton den Historikern: „Untersucht Probleme, nicht
Epochen!". Dieser Rat ist für die Geschichte der Biologie ganz besonders angebracht, deren
Charakteristikum die Langlebigkeit ihrer wissenschaftlichen Probleme darstellt. Die meisten
großen Kontroversen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gehen auf Probleme zurück, die
bereits Aristoteles bekannt waren. Solche Streitfragen setzen sich von Generation zu
Generation und von Jahrhundert zu Jahrhundert fort. Es sind Prozesse, keine Ereignisse; sie
lassen sich nur aus ihrer Geschichte verstehen. R.G.Collingwood sagte von der Geschichte
(1939, S.38): „Sie hat es nicht mit Ereignissen, sondern mit Prozessen zu tun, die weder
beginnen noch enden, sondern ineinander übergehen". Dies muß besonders angesichts der
statischen Ansichten des logischen Positivismus betont werden, für dessen Vertreter die
logische Struktur das eigentliche Problem der Wissenschaft war: „Die Philosophie der
Wissenschaft wird von ihnen primär als eine sorgfältige und ins Einzelne gehende Analyse der
logischen Struktur und der begrifflichen Probleme der zeitgenössischen Wissenschaft
verstanden" (Laudan, 1968). Tatsächlich lassen sich wissenschaftliche Probleme jedoch weit
besser
verstehen,
wenn man nicht so sehr ihre Logik, sondern ihre Geschichte untersucht. Allerdings darf man
nicht vergessen, daß die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Probleme kein Ersatz für
die chronologische Geschichtsschreibung ist. Beide Ansätze ergänzen sich. Bei der
problembezogenen Methode liegt das Hauptgewicht auf der Geschichte der Versuche,
Probleme zu lösen, z. B. des Versuches, das Wesen der Befruchtung oder den
richtunggebenden Faktor in der Evolution zu erklären. Dargestellt wird die Geschichte nicht
nur der erfolgreichen, sondern auch der gescheiterten Versuche, diese Probleme zu lösen. Bei
der Behandlung der wichtigsten Kontroversen eines Gebiets wird versucht, sowohl die
Ideologien (oder Dogmen) als auch das spezielle Beweismaterial zu analysieren, das die
jeweiligen gegnerischen Parteien zur Untermauerung ihrer gegensätzlichen Theorien anführten.
Bei der problembezogenen Geschichtsschreibung liegt der Nachdruck auf dem arbeitenden
Wissenschaftler und seiner Vorstellungswelt. Welches waren die wissenschaftlichen Probleme
seiner Epoche? Über welche begrifflichen und technischen Werkzeuge verfügte der Forscher
bei seiner Suche nach einer Antwort? Welche Methoden standen ihm zur Verfügung? Welche
vorherrschenden Ideen seiner Zeit lenkten ihn bei seiner Forschungsarbeit und beeinflußten
seine Entscheidungen? Bei der problembezogenen Geschichtsschreibung bestimmen Fragen
dieser Art die Behandlung der Thematik.
Es ist dies die Methode, die ich für das vorliegende Buch gewählt habe. Wenn der Leser
dieses Buch in die Hand nimmt, so sollte er sich dessen bewußt sein, daß es keine traditionelle
Geschichte der Wissenschaft ist. Da es sich auf die Geschichte wissenschaftlicher Probleme
konzentriert, vernachlässigt es zwangsläufig die biographischen und soziologischen Aspekte
der Geschichte der Biologie. Es sollte daher zusammen mit einer allgemeinen Geschichte der
Biologie (wie Nordenskiöld, 1928), mit dem Dictionary of Scientific Biography und mit
verfügbaren geschichtlichen Darstellungen biologischer Spezialgebiete benutzt werden. Als
Biologe bin ich besser dazu befähigt, eine Problem- und Ideengeschichte als eine
biographische oder soziologische Geschichte der Biologie zu schreiben.
Das wichtigste bei dieser Art von Geschichtsschreibung ist die Frage Warum? Warum
wurde die Theorie der natürlichen Auslese in England entwickelt, und zwar tatsächlich viermal
unabhängig voneinander? Warum entstand die Populationsgenetik in Rußland? Warum waren
Batesons Erklärungsversuche in der Genetik fast durchweg falsch? Warum hat sich Correns
von Randproblemen aller Art ablenken lassen und daher so wenig zur Lösung der
Kernprobleme der Genetik nach 1900 beigetragen? Warum galten die Anstrengungen der
Morgan'schen Schule so viele Jahre lang der Festigung der bereits sicher etablierten
Chromosomentheorie der Vererbung, statt neue Fronten zu eröffnen? Warum hatten de Vries
und Johannsen so viel weniger Erfolg bei ihren Versuchen, Evolutionsprobleme zu lösen, als
bei ihrer rein genetischen Arbeit? Der Versuch, derartige Fragen zu beantworten, erfordert das
Zusammentragen und Prüfen großer Mengen von Belegmaterial, und dies führt fast immer zu
neuen Einsichten, selbst wenn es sich herausstellen sollte, daß die ursprüngliche Frage falsch
gestellt war. Antworten auf Warum-Fragen sind zwangsläufig etwas spekulativ und subjektiv,
aber in Einklang mit der hypothetischdeduktiven Methode zwingen sie zum Ordnen von
Beobachtungen und zum ständigen Testen aller Schlußfolgerungen. Heute, wo selbst in der
wissenschaftlichen Forschung (insbesondere in der Evolutionsbiologie) die Legitimität von
Warum-Fragen anerkannt wird, sollte die Zulässigkeit solcher Fragen in der
Geschichtsschreibung noch weniger bezweifelt werden. Im schlimmsten Fall kann die zur
Beantwortung einer solchen Frage notwendige detaillierte Analyse ergeben, daß die der Frage
zugrunde liegenden Annahmen falsch waren. Aber selbst dies würde unserem Verständnis
einen Schritt weiterhelfen.
Überall in diesem Werk habe ich mich darum bemüht, die jeweiligen Probleme so
weitgehend wie möglich zu analysieren, und heterogene Theorien und Begriffe in ihre
einzelnen Komponenten zu zerlegen. Nicht immer sind sich die Historiker dessen gewahr
gewesen, wie komplex viele biologische Begriffe tatsächlich sind, ja, wie komplex die Struktur
der Biologie als Ganzes ist. Das hatte zur Folge, daß einige recht verworrene Darstellungen der
Geschichte der Biologie veröffentlicht wurden. Ihre Autoren hatten nicht verstanden, daß es
zwei Biologien gibt – eine Biologie der funktionalen und eine Biologie der evolutionären
Kausalzusammenhänge. Ebenso wird niemand den Darwinismus kompetent erörtern können,
der über „Darwins Evolutionstheorie" im Singular schreibt, ohne zwischen den einzelnen
Theorien der schrittweisen Evolution, der gemeinsamen Abstammung, der Artbildung, sowie
den Mechanismen der natürlichen Auslese zu unterscheiden. Die meisten großen Theorien der
Biologie waren, als sie zum ersten Mal vorgeschlagen wurden, solche Konglomerate. Ihre
Geschichte und ihre Wirkung lassen sich nicht verstehen, solange nicht die verschiedenen
Komponenten herausgelöst und voneinander unabhängig erforscht werden. Sie gehören häufig
sehr unterschiedlichen Vorstellungskreisen an.
Es ist meine Überzeugung, daß man die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt nicht
verstehen kann, wenn man die Denkstruktur der Biologie nicht versteht. Ich habe mich daher
um eine relativ ausführliche Darstellung der Erkenntnisse und Vorstellungen der Biologie
bemüht. Besonders notwendig war dies bei der Behandlung der organischen Mannigfaltigkeit
(Teil I), denn es gab bisher keine befriedigende Darstellung der Wissenschaft der
organismischen Vielfalt und ihrer Gedankenstruktur. Ich bin mir darüber im klaren, daß ich
Gefahr laufe, von einem Kritiker vorgeworfen zu bekommen: „Aber dies ist ja ein BiologieLehrbuch – nur historisch angeordnet!" Vielleicht sollte eine problemorientierte Geschichte der
Biologie eben gerade so sein.
Vermutlich die größte Schwierigkeit, mit der jede Ideengeschichte der Biologie zu kämpfen
hat, ist die Langlebigkeit der Kontroversen. Viele der heutigen Differenzen sind schon vor
Generationen oder sogar Jahrhunderten entstanden, einige gehen in der Tat bis auf die
Griechen zurück. Eine mehr oder weniger „zeitlose" Darstellung der Fragen ist in solchen
Fällen konstruktiver als eine chronologische.
Ich habe jeden der drei Hauptabschnitte dieses Buches (Vielfalt, Evolution, Vererbung) so
darzustellen versucht, daß er ein in sich geschlossenes Ganzes bildet. Auch innerhalb jedes
dieser großen Gebiete habe ich jedes einzelne Problem wiederum in sich geschlossen zu
erörtern gesucht. Allerdings waren einige Überschneidungen und Wiederholungen dabei nicht
zu vermeiden, da zwischen den verschiedenen Themen zahlreiche Querverbindungen bestehen
und darüber hinaus jedes von ihnen in den gleichen aufeinander folgenden Epochen und im
Kontext des jeweils herrschenden Zeitgeistes zu untersuchen war. Ich habe mich besonders
bemüht, zu einem lesbaren Kompromiß zwischen unvermeidlichen Wiederholungen und
angemessenen Verweisen auf andere Kapitel zu kommen.
Subjektivität und Voreingenommenheit
Ein bekannter marxistischer Theoretiker in Rußland hat meine Arbeiten einmal als „puren
dialektischen Materialismus" bezeichnet. Nun bin ich kein Marxist und kenne die jüngste
Definition des dialektischen Materialismus nicht, aber ich gebe zu, daß ich einige von Engels
antireduktionistischen Ansichten teile, wie sie in seinem AntiDühring dargestellt sind, und daß
ich mich stark von dem Hegeischen Schema der These-Antithese-Synthese angezogen fühle.
Außerdem glaube ich, daß eine Antithese am leichtesten durch eine kategorische Formulierung
einer These provoziert wird und daß ein Problem durch eine derartige Gegenüberstellung von
unzweideutiger These und Antithese eher gelöst, und somit die endgültige Synthese am
schnellsten erreicht wird. In der Geschichte der Biologie lassen sich zahlreiche Beispiele dafür
finden.
Diese Auffassung ist für meine Darstellung bestimmend gewesen. Wann immer möglich,
habe ich mich um eine Synthese gegensätzlicher Gesichtspunkte bemüht (es sei denn, einer von
ihnen war deutlich falsch). Wo die Situation noch völlig ungeklärt ist, habe ich die sich
gegenüberstehenden Ansichten in kategorischer, gelegentlich fast einseitiger Manier
beschrieben, um eine Erwiderung zu provozieren, wenn dies gerechtfertigt ist. Ich hasse es, um
die Dinge herumzureden. Man hat mich daher zuweilen als dogmatisch bezeichnet. Ich finde,
das ist das falsche Epitheton für meine Haltung. Ein dogmatischer Mensch besteht darauf,
Recht zu haben, gleichgültig, wie viele Beweise gegen ihn sprechen. So habe ich mich niemals
verhalten. Ich bin, im Gegenteil, in der Tat stolz darauf, meine Ansicht häufig geändert zu
haben, wenn es nötig war. Doch ist es richtig, daß es meine Taktik ist, allumfassende
kategorische Feststellungen zu treffen. Ob dies in der freien Welt des wissenschaftlichen
Gedankenaustausches ein Fehler ist oder nicht, darüber läßt sich streiten. Ich bin jedenfalls der
Überzeugung, daß es rascher zur schließlichen Lösung wissenschaftlicher Probleme führt als
ein vorsichtiges Sich-nicht-Festlegen. Ja, ich stimme mit Passmore (1965) darin überein, daß
Geschichtswerke sogar polemisch sein sollten. Eine solche Geschichtsschreibung provoziert
Widerspruch und fordert den Leser zur Widerlegung heraus. Durch einen dialektischen
Vorgang wird damit die Synthese beschleunigt. Das entschiedene Eintreten für einen
definitiven Standpunkt sollte nicht mit Subjektivität verwechselt werden.
Seit jeher werden Geschichtsschreiber ermahnt, strikt objektiv zu sein. Dieses Ideal hat der
große Historiker Leopold von Ranke sehr treffend formuliert, als er sagte, der Historiker solle
„zeigen, wie es wirklich gewesen ist". Für ihn war die Geschichte die genaue Rekonstruktion
einer Reihe vergangener Ereignisse. Eine derartige Objektivität ist völlig angemessen, wenn
man die Fragen „wer", „was", „wann" und „wo" zu beantworten sucht, obgleich daraufhin
gewiesen werden muß, daß sich der Historiker, sogar wenn er Tatsachen darstellt, subjektiv
verhält. Denn er kann Werturteile nicht vermeiden, wenn er Tatsachen zusammenträgt. Und er
trifft eine Auswahl, wenn er entscheidet, welche Tatsachen er sich zu eigen macht, und wie er
sie zueinander in Beziehung setzt.
In jeder Phase der Geschichtsschreibung schleicht sich Subjektivität ein, besonders wenn
man – wie das bei der problembezogenen Geschichte nötig ist – Erklärungen sucht und nach
dem Warum fragt. Man kann zu keinen Erklärungen gelangen, ohne sich seines eigenen,
persönlichen Urteilsvermögens zu bedienen – und das ist zwangsläufig subjektiv. Eine
subjektive Abhandlung ist gewöhnlich weitaus anregender als eine kühl objektive Darstellung,
da ihr heuristischer Wert größer ist.
In welchem Maße ist Subjektivität zulässig, und wo wird sie zu Voreingenommenheit? Radi
(1907-08) zum Beispiel war derart stark antidarwinistisch voreingenommen, daß er nicht
einmal imstande war, die Darwinsche Theorie adäquat darzustellen. Das geht offensichtlich zu
weit. Subjektivität wird leicht immer dann zu Voreingenommenheit, wenn es um die
Beurteilung von Wissenschaftlern der Vergangenheit geht. Hier neigen Historiker dazu,
entweder in das eine oder in das andere Extrem zu verfallen. Entweder machen sie sich eine
strikt retrospektive Methode zu eigen, bei der die Vergangenheit ausschließlich im Licht des
gegenwärtigen Wissens und Verständnisses bewertet wird, oder aber sie unterdrücken
jeglichen Rückblick und beschreiben frühere Ereignisse streng innerhalb der Grenzen des
Denkens jener Periode. Es will mir scheinen, als sei keiner dieser beiden Ansätze völlig
zufrieden stellend.
Man könnte besser so vorgehen, daß man die besten Aspekte der beiden Methoden
miteinander verbindet. Dabei müßte man zuerst das geistige Milieu der Zeit so genau wie
möglich zu rekonstruieren suchen. Aber es wäre nicht genug, die Kontroversen der
Vergangenheit ausschließlich innerhalb der Grenzen der zu jener Zeit verfügbaren Information
zu erörtern. Denn dann blieben diese Kontroversen ebenso ungelöst und dunkel wie zu ihrer
eigenen Zeit. Stattdessen sollte man das moderne Wissen heranziehen, wann immer dies zum
Verständnis früherer Schwierigkeiten beiträgt. Nur auf solche Weise werden wir ermitteln
können, welche Gründe dafür verantwortlich waren, daß der Meinungsstreit ausbrach und daß
es nicht gelang, ihn beizulegen. War es eine semantische Schwierigkeit (beispielsweise die
Verwendung desselben Wortes in unterschiedlichen Bedeutungen), ein philosophischer
Gegensatz (wie Essentialismus kontra Populationsdenken) oder einfach ein Irrtum (etwa die
Verwechslung von unmittelbaren und mittelbaren Ursachen)? Das Studium früherer
Kontroversen ist besonders aufschlußreich, wenn man die Argumente und gegensätzlichen
Standpunkte im Licht unserer heutigen Erkenntnisse analysiert.
Besonders lästig sind semantische Probleme, da sie so oft nicht erkannt werden. Die
Griechen z. B. besaßen ein sehr begrenztes technisches Vokabular und verwendeten häufig
denselben Ausdruck für recht verschiedene Dinge oder Begriffe. Sowohl Platon als auch
Aristoteles benutzten den Ausdruck eidos (und zumindest Aristoteles gebraucht ihn sogar in
mehreren Bedeutungen!), doch die Hauptbedeutung des Wortes ist bei den beiden Autoren
völlig verschieden. Piaton war Essentialist, Aristoteles jedoch war das nur in sehr begrenztem
Umfang (Balme, 1980). Aristoteles benutzte den Terminus genos gelegentlich als
Sammelbegriff (in der Bedeutung der „Gattung" der Taxonomen), aber viel häufiger im Sinne
von „Art". Als Aristoteles gegen Ende des Mittelalters wiederentdeckt und ins Lateinische und
in die westeuropäischen Sprachen übersetzt wurde, wurden seine Ausdrücke in die
„entsprechenden" Wörter übertragen, wie sie in den damaligen Wörterbüchern zur Verfügung
standen. Diese irreführenden Übersetzungen haben unser Verständnis von Aristoteles' Denken
in sehr unglücklicher Weise beeinflußt. Einige moderne Autoren haben den Mut gehabt, sich
moderner Fachausdrücke zu bedienen, um das Denken von Aristoteles zu verdeutlichen,
Ausdrücke also, die Aristoteles höchstwahrscheinlich selbst gebraucht hätte, wenn er heute
lebte. Ich denke da an Delbrücks Verwendung des Begriffes „genetisches Programm", um
klarzumachen, was Aristoteles beabsichtigte, als er den Begriff eidos bei der Beschreibung der
individuellen Entwicklung benutzte. In ähnlicher Weise sollte man das Wort „Teleonomie"
(statt „Teleologie") verwenden, wenn Aristoteles die von einem eidos (Programm) gesteuerte
Zielstrebigkeit erörtert. Dies ist nicht anachronistisch; es ist einfach die beste Weise, mit Hilfe
einer für den modernen Leser eindeutigen Terminologie zu verdeutlichen, was ein antiker
Autor im Sinn hatte.
Es wäre jedoch völlig fehl am Platze, wollte man von unserem heutigen Wissen
zurückblickend Werturteile abgeben. Wenn man Lamarck zum Beispiel auf der Basis der ihm
bekannten Fakten und der zu seiner Zeit vorherrschenden Ideen beurteilt, so hatte er nicht
annähernd so unrecht, wie es uns heute vorkommt, die wir mit der Selektionstheorie und der
Mendelschen Genetik vertraut sind. Der Ausdruck „whiggische Geschichtsinterpretation"
wurde von dem Historiker Herbert Butterfield (1931) für die Gewohnheit einiger englischer
Verfassungsgeschichtler geprägt, die neuere Geschichte als ein fortschreitendes Ausdehnen der
Menschenrechte zu verstehen, wobei gute „vorwärts blickende" Liberale sich in beständigem
Kampf mit den „rückwärts blickenden" Konservativen befanden. Später (1962) wandte
Butterfield den Ausdruck whiggisch auf jene Art der Wissenschaftsgeschichte an, bei der jeder
Wissenschaftler nach der Größe seines Beitrags zur Festigung unserer gegenwärtigen
Interpretation der Wissenschaft beurteilt wird. Statt einen Wissenschaftler unter
Berücksichtigung des geistigen Milieus, in dem er tätig war, zu beurteilen, wird er streng nach
Maßgabe heutiger Vorstellungen bewertet. Der gesamte Problem- und Ideenkontext, in dem
der Wissenschaftler der Vergangenheit gearbeitet hat, bleibt bei dieser Methode
unberücksichtigt. Die Geschichte der Wissenschaft ist reich an derartigen voreingenommenen
„whiggischen" Interpretationen.
Bei einem wissenschaftlichen Meinungsstreit geben die Sieger fast ausnahmslos später ein
falsches Bild von den Ansichten der unterlegenen Partei. Beispiele dafür sind die Behandlung
Buffons durch die Anhänger von Linnaeus, Lamarcks durch die Cuvier-Anhänger, Linnaeus'
durch die Darwinisten, der Biometriker durch die Mendelisten usw. Der Biologiehistoriker
muß sich bemühen, einen besser ausgewogenen Bericht zu liefern. Viele heute indiskutable
Theorien, beispielsweise die von Lamarck verfochtene Vererbung erworbener Merkmale,
schienen früher derart im Einklang mit den bekannten Fakten zu stehen, daß kein Autor dafür
kritisiert werden sollte, sich solche vorherrschenden Ideen zu eigen gemacht zu haben, selbst
wenn sie sich inzwischen als falsch erwiesen haben. Fast immer hatten diejenigen, die eine
falsche Theorie vertraten, scheinbar triftige Gründe dafür. Fast immer versuchten sie, auf etwas
aufmerksam zu machen, was von ihren Gegnern übersehen wurde. Die Anhänger der
Präformationstheorie z. B. versuchten etwas zur Geltung zu bringen, was später als das
genetische Programm wieder zu Anerkennung kam. Die Biometriker verteidigten Darwins
Ansichten von der allmählichen Evolution gegen die saltationistische Evolutionstheorie der
Anhänger des Mendelismus. In beiden Fällen wurden richtige Ideen mit falschen
zusammengeworfen, und gingen mit den falschen zusammen unter. Ich habe mir
vorgenommen, besondere Aufmerksamkeit solchen Personen und Theorien zu widmen, die
sich nicht durchgesetzt haben, sind sie doch früher häufig ungerecht oder zumindest nicht
angemessen behandelt worden.
Der Pfad der Wissenschaft ist niemals geradlinig. Immer gibt es konkurrierende Ideen, und
es mag sogar sein, daß die Hauptaufmerksamkeit einer Periode auf eine weniger wichtige
Frage gerichtet gewesen ist, sozusagen auf eine Seitenstraße, die sich schließlich als Sackgasse
herausgestellt hat. Diese Entwicklungen sind oft aufschlußreicher, d.h. lassen den Zeitgeist
einer Periode viel besser erkennen als die geradeaus verlaufenden Fortschritte der
Wissenschaft. Leider schließt Platzmangel eine angemessene Erörterung vieler dieser
Entwicklungen aus. Keine Geschichte kann es sich leisten, sich mit jeder verlorenen Sache und
jeder Kursabweichung zu befassen. Doch es gibt Ausnahmen! Mißerfolge und Irrtümer der
Vergangenheit enthüllen manchmal Aspekte des damaligen, zeitgenössischen Denkens, die uns
sonst entgehen würden. Macleays und Swainsons Quinarianismus beispielsweise, der durch
Darwins Entstehung der Arten völlig in den Schatten gedrängt wurde, war ein ernsthaftes
Bemühen, die anscheinend chaotische Vielfalt der Natur mit der damals vorherrschenden
Meinung in Einklang zu bringen, es müsse irgendeine „höhere" Ordnung in der Natur geben.
Er zeigt außerdem, wie stark der alte Mythos noch verankert war, daß alle Ordnung auf der
Welt letztlich numerischer Art sei. So falsch und kurzlebig die Theorie des Quinarianismus
auch war, sie trägt trotzdem zu unserem Verständnis des Denkens ihrer Zeit bei. Das Gleiche
läßt sich von nahezu jeder Theorie oder Schule der Vergangenheit sagen, die heute als nicht
mehr gültig angesehen wird. Die Interessen, die ein Historiker hat, beeinflussen unvermeidlich
seine Entscheidung darüber, welche Themen er ausführlich und welche er eher summarisch
behandelt. Ich bin geneigt, Schuster zuzustimmen, der in seinem Buch The Progress of Physics
(1911) sagte: „Ich ziehe es vor, offen subjektiv zu sein und möchte Ihnen zum Voraus sagen,
daß mein Bericht fragmentarisch und zum größten Teil eine Wiedergabe von selbst Gesehenem
und Erlebtem sein wird."
Historiker kontra Naturwissenschaftler
Zwei Gruppen von Gelehrten mit völlig verschiedenen Standpunkten und ganz anderer
Vorbildung – Historiker und Naturwissenschaftler – erheben Anspruch auf die Geschichte der
Wissenschaft als ihr ureigenstes Gebiet. Bedingt durch Unterschiede in ihren Interessen und
Kompetenzen sind ihre jeweiligen Beiträge etwas verschieden. Ein Naturwissenschaftler wählt
im allgemeinen andere Probleme zur Analyse und Erörterung aus als ein Historiker oder
Soziologe. Hierzu ein Beispiel: in jüngeren Darstellungen der Evolution, die aus der Feder von
Evolutionsbiologen stammen, findet H.Spencer kaum Beachtung, und es gibt gute Gründe
dafür. Nicht nur war Spencer vage und konfus, die Ideen, die er vertrat, waren darüber hinaus
die Ideen anderer und bereits überholt, als er sie aufgriff. Daß Spencers ausgeborgte Ideen sehr
populär und einflußreich waren, soweit es die allgemeine Öffentlichkeit betrifft, ist zweifellos
richtig, aber es ist nicht die Aufgabe des naturwissenschaftlichen Historikers, in den Bereich
des Soziologen überzugreifen. Den Biologen fehlt gewöhnlich die Befähigung zur Erörterung
der Sozialgeschichte. Andererseits wäre es genauso lächerlich, von einem Sozialhistoriker zu
verlangen, daß er eine fachkundige Analyse von naturwissenschaftlichen Problemen vorträgt.
Die Geschichte der Wissenschaft bezieht Inspiration, Information und methodologische
Hilfestellung sowohl von der Naturwissenschaft als auch von der Geschichte und trägt mit
ihren Ergebnissen ihrerseits wieder zu beiden Gebieten bei.
Daß sich Historiker ebenso wie Naturwissenschaftler für Wissenschaftsgeschichte
interessieren, hat triftige Gründe. Die Griechen besaßen keine Wissenschaft in unserem
heutigen Sinne. Was sie an Wissenschaft hatten, wurde von Philosophen und Ärzten getrieben.
Nach Ende des Mittelalters machte sich ein kontinuierlicher Trend zur Emanzipation der
Wissenschaft von der Philosophie und dem allgemeinen Zeitgeist bemerkbar. In der
Renaissance und während des 18. Jahrhunderts wurden die wissenschaftlichen Vorstellungen
stark von der Einstellung der Wissenschaftler zu Religion und Philosophie beeinflußt. Ein
Kartesianer, ein orthodoxer Christ oder ein Deist hatte zwangsläufig verschiedene
Vorstellungen von Kosmologie, Entstehung und anderen Aspekten der Erklärung von Leben,
Materie und Ursprüngen. Nichts hat die Emanzipation der Wissenschaft von Religion und
Philosophie gründlicher verdeutlicht als die Darwinsche Revolution. Seitdem ist es völlig
unmöglich geworden, aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu schließen, ob der Autor
gottesfürchtiger Christ oder Atheist ist. Mit Ausnahme einiger weniger Fundamentalisten gilt
dies sogar für die Schriften von Biologen über das Thema Evolution.
Dieser Trend zur Emanzipation der Wissenschaft hatte eine beträchtliche Auswirkung auf
die Darstellung der Wissenschaftsgeschichte. Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, um so
unwichtiger ist der Bestand an wissenschaftlichen Erkenntnissen des Zeitalters und um so
wichtiger das allgemeine intellektuelle Klima. Soweit es die Biologie betrifft, beginnen sich die
wissenschaftlichen Probleme erst nach etwa 1740 von den allgemeinen intellektuellen
Kontroversen ihrer Zeit abzulösen. Ohne Zweifel sind Historiker besonders gut dafür
qualifiziert, die frühere Zeitspanne in der Geschichte der Biologie abzuhandeln. Dagegen ist
die Geschichte spezieller biologischer Disziplinen im 19. und 20. Jahrhundert ursprünglich
völlig von Fachbiologen beherrscht gewesen. Neuere Geschichtswerke über spezielle
biologische Fachgebiete dokumentieren dies sehr gut, zum Beispiel die Werke von Dünn,
Stubbe und Sturtevant über Genetik, die von Fruton, Edsall und Leicester über Biochemie,
Needham und Oppenheimer über Embryologie, Baker und Hughes über Zytologie oder
Stresemann über Ornithologie, um nur einige wenige Namen aus der umfangreichen Literatur
zu nennen. Sie bescheinigen den Naturwissenschaftlern die Befähigung zur historischen
Forschung.
Die Voreingenommenheit der Physiker
Die meisten generellen Geschichtswerke über die „Naturwissenschaft" sind von
Physikhistorikern geschrieben worden, die sich niemals ganz von der engstirnigen Auffassung
freimachen konnten, alles, was nicht auch für die Physik zutrifft, sei keine Wissenschaft.
Physiker neigen dazu, die Biologen danach zu beurteilen, in welchem Maße sie „Gesetze",
Messungen, Experimente und andere in der Physik hochangesehene Elemente der
wissenschaftlichen Forschung benutzt haben.
Das Ergebnis ist, daß man in der Literatur Urteile über biologische Fachgebiete aus der
Feder gewisser Physikgeschichtler finden kann, die so absurd sind, daß man nur lächeln kann.
Wer zum Beispiel weiß, daß Darwin seine Evolutionstheorie weitgehend auf der Grundlage
seiner Erfahrung als Naturbeobachter entwickelt hat, kann über die folgende Aussage eines
bekannten Newton-Historikers nur staunen: „Der Naturforscher ist in der Tat ein geübter
Beobachter, aber seine Beobachtungen unterscheiden sich von denen eines Wildhüters
lediglich in der Quantität, nicht in der Qualität; seine einzigen esoterischen Qualifikationen
sind Vertrautheit mit der systematischen Nomenklatur." Diese Art von voreingenommenem
physikalischem Denken ist beim Studium der Evolutionsbiologie völlig fehl am Platze, wie in
Kapitel 2 noch zu sehen sein wird. Die Theorienbildung und ihre Geschichte in der
Evolutionsbiologie und Systematik erfordern eine radikal andere Methode, eine Methode, die
in gewisser Hinsicht eher der eines Erforschers der Geschichte der Archäologie oder eines
Interpreten der modernen Weltgeschichte ähnelt.
Andere Vorurteile Jeder Fachwissenschaftler, nicht nur der Physiker, hält völlig
selbstverständlich sein spezielles Arbeitsgebiet für das interessanteste, und die dort
gebräuchlichen Methoden für die produktivsten. Infolgedessen herrscht zwischen den
einzelnen Gebieten und sogar innerhalb eines Fachs (z. B. der Biologie) häufig eine gehässige
Art von Chauvinismus. Beispielsweise ist es Chauvinismus, wenn Hartmann (1947) 98 Prozent
seiner großen Allgemeinen Biologie der physiologischen Biologie und nur 2 Prozent der
Evolutionsbiologie widmete. Es ist Chauvinismus, wenn gewisse Historiker das
Zustandekommen der evolutionären Synthese ausschließlich den Erkenntnissen der Genetik
zuschreiben und die Beiträge aus der Systematik, Paläontologie und anderen Zweigen der
Evolutionsbiologie völlig ignorieren (Mayr und Provine, 1980).
Gelegentlich gibt es auch einen nationalen Chauvinismus, der einen Autor dazu veranlaßt,
die Bedeutung der Wissenschaftler seines eigenen Landes zu übertreiben oder sogar falsch
darzustellen, während er die Wissenschaftler anderer Länder unbeachtet läßt oder
unterbewertet. Dies geschieht nicht unbedingt aus unangebrachtem Patriotismus, es ist auch
häufig das Ergebnis der Unfähigkeit, die Sprachen zu lesen, in denen wichtige Beiträge von
Wissenschaftlern anderer Länder veröffentlicht worden sind. Bei meiner eigenen Arbeit bin ich
mir sehr der Wahrscheinlichkeit einer Einseitigkeit bewußt, weil ich weder die slawischen
Sprachen noch Japanisch lesen kann.
Fallstricke und Schwierigkeiten
Die größte Schwierigkeit, die es zu überwinden gilt, wenn man die enorme Vielzahl der
Probleme erkennen und die Entwicklung ihres begrifflichen Rahmens rekonstruieren will, ist
die gewaltige Materialmenge, die durchforscht werden muß. Im Prinzip umfaßt sie den
gesamten Bestand an biologischem Wissen, einschließlich aller von Biologen veröffentlichten
Bücher und Zeitschriftenartikel, ihrer Briefe und Biographien, aller Tatsachen über die
Institutionen, mit denen sie verbunden waren, der zeitgenössischen Sozialgeschichte und noch
vieler Dinge mehr. Selbst der gewissenhafteste Historiker wäre nicht in der Lage, auch nur ein
Tausendstel all dieses Materials zu bearbeiten. Erschwert wird die Situation außerdem durch
das exponentielle Wachstum der heutigen wissenschaftlichen Produktion. In einer erstaunlich
kurzen Spanne von Jahren werden heute mehr Schriften (und Seiten!) publiziert als in der
gesamten vorangehenden Geschichte der Wissenschaft. Sogar Fachwissenschaftler beschweren
sich, sie könnten nicht länger mit der Lawine an Forschungsergebnissen in ihrem eigenen
Spezialgebiet Schritt halten. Genau das Gleiche gilt für die Geschichtsschreibung. In den USA
gibt es heute vielleicht fünfmal so viele Historiker der Biologie wie noch vor 25 Jahren.
Obwohl ich mich redlich bemüht habe, die wichtigsten Veröffentlichungen zu lesen, ist mir
klar, daß jeder Spezialist in meiner Abhandlung allerlei Lücken und vermutlich auch nicht
selten Irrtümer entdecken wird. Der erste Entwurf des größten Teils des Manuskriptes wurde in
den Jahren 1970 bis 1976 geschrieben und die seither erschienene Literatur ist nicht immer so
ausführlich eingefügt worden, wie es zu wünschen gewesen wäre. Meine Aufgabe wäre
überhaupt unmöglich zu bewältigen gewesen, hätte ich nicht auf die reiche und ausgezeichnete
moderne Sekundärliteratur zurückgreifen können. Die ältere Literatur war häufig ziemlich
oberflächlich; ein Autor nach dem anderen pflegte die gleichen Mythen oder Irrtümer wieder
abzuschreiben, wie man feststellen kann, wenn man die Originalveröffentlichungen zu Rate
zieht. Es liegt auf der Hand, daß es bei einem Buch wie diesem hier, das mehr als 20000
einzelne Informationen enthalten dürfte, unmöglich ist, sie alle in der Originalquelle zu
überprüfen. Da es sich hier jedoch nicht um eine lexikographische Geschichte handelt, ist ein
gelegentlicher faktischer Fehler keine Katastrophe. Mein Hauptziel ist es gewesen, aus einer
enormen Literaturmenge eine Synthese zu erarbeiten, wobei ich das Gewicht konsequent auf
die Interpretation und Analyse der Kausalzusammenhänge gelegt habe.
Zeitlosigkeit
Wissenschaftshistoriker bekommen häufig – und nicht zu Unrecht – die Kritik zu hören, sie
beschäftigten sich zu ausschließlich mit der „Prähistorie" der Wissenschaft, d.h. mit Zeitaltern,
deren Ereignisse für die moderne Wissenschaft weitgehend irrelevant seien. Um diesem
Vorwurf zu entgehen, habe ich die Geschichte so nahe wie möglich an die Gegenwart
heranzubringen versucht. In einigen Fällen, etwa der Entdeckung zahlreicher DNA-Familien in
der Molekularbiologie in den letzten fünf bis zehn Jahren, sind die theoretischen
Konsequenzen (zum Beispiel für die Evolution) immer noch zu ungewiß, um hier behandelt zu
werden.
Ich wehre mich gegen die kürzliche Behauptung eines Historikers, daß „Gegenstand der
Wissenschaftsgeschichte Forschungen und Dispute seien, die bereits abgeschlossen sind, und
nicht so sehr Probleme, die heute lebendig sind". Das ist ein gewaltiger Irrtum. Die meisten
wissenschaftlichen Kontroversen ziehen sich über weit längere Zeiträume hin, als man sich
gewöhnlich vorstellt. Selbst die h6utigen Auseinandersetzungen haben Wurzeln, die
gewöhnlich weit in die Vergangenheit zurückreichen. Es ist gerade das geschichtliche Studium
derartiger Kontroversen, das häufig wesentlich zu einer begrifflichen Klärung beiträgt und
somit schließlich die Lösung ermöglicht. Analog zum Fachgebiet der Weltgeschichte, wo
„zeitgenössische Geschichte" als ein legitimes Fach anerkannt ist, gibt es auch in der
Geschichte der Wissenschaft eine „zeitgenössische Geschichte". Nichts wäre irreführender als
die Annahme, die Geschichte der Wissenschaft befasse sich lediglich mit gelösten Problemen.
Im Gegenteil, man könnte sogar so weit gehen, die Darstellung längst gelöster Fragen früherer
Jahrhunderte und Jahrtausende als „wissenschaftliche Prähistorie" zu betrachten.
Vereinfachung
Ein Historiker, der sich mit einem derart weiten Bereich befaßt, wie er in diesem Buch
behandelt wird, ist gezwungen, seinen Bericht zu straffen und von allem unnötigen Ballast zu
befreien. Ich möchte den Leser warnen: die scheinbare Einfachheit vieler Entwicklungen ist
höchst irreführend. Wenn er die ganze Fülle, die ganze Atmosphäre der vielen
Querströmungen, Fehlstarts und erfolglosen Hypothesen genießen will, die zu einer
bestimmten Zeit herrschte, so muß er ausführliche Berichte heranziehen, die sich auf spezielle
Entwicklungen oder kurze Zeitspannen konzentrieren. Im Grunde genommen war keine
Entwicklung jemals derart geradlinig und logisch, wie sie es in einer vereinfachten
rückblickenden Darstellung gewesen zu seinscheint. Besonders schwer ist es, die manchmal
geradezu lähmende Macht fest verwurzelter Vorstellungen richtig einzuschätzen, wenn diese
mit neuen Entdeckungen oder neuen Ideen konfrontiert wurden. Ungenauigkeit schleicht sich
auch dann ein, wenn man bestimmte Autoren als Vitalisten, Präformisten, Teleologen,
Saltationisten oder Neodarwinisten etikettiert, als ob diese Namen einheitliche Typen
bezeichneten. Tatsächlich bestehen diese Kategorien aus Individuen, von denen vermutlich
auch nicht zwei die gleichen Ansichten vertraten. Ganz besonders gilt dies für die Beinamen
„Lamarckisten" und „Neolamarckisten", hatten doch viele von ihnen nicht mehr miteinander
gemein als die Überzeugung von einer Vererbung erworbener Eigenschaften.
Stillschweigende Annahmen
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich für den Historiker daraus, daß die meisten
Wissenschaftler sich ihres eigenen Denkrahmens nicht voll bewußt sind. Sie bringen selten
zum Ausdruck (wenn sie überhaupt darüber nachdenken), welche Wahrheiten oder Ideen sie
ohne zu fragen akzeptieren und welche anderen sie ebenso unbesehen radikal ablehnen. In
vielen Fällen kann der Historiker dies nur in der Weise zusammenstückeln, daß er das gesamte
geistige Milieu der Epoche rekonstruiert. Und doch ist ein Verständnis dieser stillschweigend
zugrunde gelegten Annahmen manchmal notwendig, um die Antwort auf zuvor unbegreifliche
Fragen zu finden. In der Wissenschaft hat man es immer mit Prioritäten und Wertsystemen zu
tun; sie bestimmen nach Abschluß einer Untersuchung die neue Richtung der weiteren
Forschung; sie bestimmen, welche Theorien der Forscher am eifrigsten entweder bestätigen
oder widerlegen will; sie bestimmen auch, ob er ein Forschungsfeld für erschöpft hält oder
nicht. Und doch ist gerade eine Untersuchung der für solche Prioritäten oder Wertsysteme
ausschlaggebenden Faktoren bisher weitgehend unterblieben. Der Historiker muß
herauszufinden suchen, was im Kopf eines Forschers vor sich ging, als er einer seit langem
vertrauten Reihe von Fakten eine neue Interpretation gab. Vielleicht ist sogar die Behauptung
gerechtfertigt, daß die wirklich entscheidenden Ereignisse in der Geschichte der Wissenschaft
immer im Geist eines Wissenschaftlers stattfinden. Man muß sozusagen den Versuch machen,
so zu denken, wie der Wissenschaftler gedacht hat, als er die Arbeit leistete, die man zu
analysieren sucht.
Die meisten Wissenschaftler konzentrieren sich in ihren Veröffentlichungen gern auf neue
Fakten oder besser auf neue Entdeckungen, und insbesondere auf alles, was spektakulär ist. Oft
sind damit zugleich Wandlungen im Inhalt der Begriffe oder Neubewertungen verbunden, die
anzuführen sie aber versäumen. Es ist sogar möglich, daß sie derartige Veränderungen gar
nicht erkennen oder sie zwar wahrnehmen, aber für unwichtig halten. Wenn der moderne
Historiker derartige Wandlungen in vergangenen Jahrhunderten zu rekonstruieren versucht,
kann er oft nicht umhin, die Interessen und Wertmaßstäbe der Gegenwart in die Geschichte zur
projizieren. Diese Gefahr bei der Interpretation läßt sich nur dadurch auf ein Minimum
beschränken, daß sich der Historiker völlig dessen bewußt ist, was er tut.
Warum befassen wir uns mit der Geschichte der Biologie?
Mein Interesse an der Geschichte der Wissenschaft wurde durch die Lektüre von A.O.
Lovejoys The Great Chain of Being geweckt. Der Autor unternimmt den – übrigens überaus
erfolgreichen – Versuch, der Lebensgeschichte einer einzelnen Idee (oder eines
zusammenhängenden Komplexes von Ideen) vom klassischen Altertum bis hin zum Ende des
18. Jahrhunderts nachzuspüren. Ich habe aus diesem einen Band mehr gelernt als aus fast
allem, was ich sonst gelesen habe/Einer ähnlichen Methode haben sich auch Ernst Cassirer und
Alexander Koyre bedient und damit völlig neue Maßstäbe für die wissenschaftliche
Geschichtsschreibung gesetzt.
Zwar liegt der Schwerpunkt im Fall der Geschichte der Wissenschaft eher auf Problemen als
auf Ideen, doch unterscheidet sich die Methode des Wissenschaftshistorikers nur unwesentlich
von der eines Ideengeschichtlers wie Lovejoy: Er versucht, wie Lovejoy das getan hat, das
Problem bis zu seinen Ursprüngen zurückzuverfolgen und sein Schicksal und seine
Verzweigungen von diesen Anfängen an entweder bis zu seiner Lösung oder bis zur
Gegenwart zu verfolgen.
Hauptziel dieses Buches ist es, für jeden Zweig der Biologie und für jeden Zeitraum
herauszufinden,
1.
welches die ungelösten Probleme waren und welche Vorschläge zu ihrer Lösung
gemacht wurden,
2.
welches die herrschenden Vorstellungen, ihre Veränderungen sowie die Ursachen
für deren Wandel und für die Entwicklung neuer Ideen waren, und schließlich
3.
wie sich vorherrschende oder neu entstehende Ideen hemmend oder beschleunigend
auf die Lösung der offenen Fragen der Zeit ausgewirkt haben.Im Idealfall würde
man mit dieser Methode ein Portrait der gesamten Lebensgeschichte jedes Problems
in der Biologie zeichnen.
Die Beschäftigung mit dieser Art von Ideengeschichte der Wissenschaft wird gelegentlich
als ein Hobby emeritierter Professoren abgetan. Dabei werden jedoch die mannigfachen
Beiträge übersehen, die dieser Forschungszweig leistet. Die Geschichte der Wissenschaft
eignet sich, wie schon häufig hervorgehoben worden ist, vorzüglich als eine erste Einführung
in die Wissenschaft. Sie trägt dazu bei, die Kluft zwischen „allgemeinen Überzeugungen" und
den tatsächlichen Erkenntnissen der Wissenschaft zu überbrücken, zeigt sie doch, auf welche
Weise und aus welchen Gründen die Wissenschaft über die volkstümlichen Überzeugungen
hinaus fortschreiten konnte. Das sei an der Geschichte der Lehre von der Vererbung erläutert:
Sie zeigt, mit welchen Entdeckungen und Argumenten weit verbreitete falsche Auffassungen
widerlegt werden konnten, etwa die Vorstellung, daß erworbene Merkmale vererbt werden;
daß das genetische Material von Vater und Mutter sich „vermischt"; daß das „Blut" eines
Weibchens durch Schwangerschaft verunreinigt wird, so daß dieses niemals wieder „reine"
Nachkommen hervorbringen kann, wenn es einmal (und sei es auch nur ein einziges Mal)
geschwängert worden ist; daß ein einzelnes Ei gleichzeitig von dem Sperma mehrerer
Männchen befruchtet wird, oder daß Unfälle einer schwangeren Mutter zur Entstehung
erblicher Merkmale führen können. Ähnliche, aus dem Volk kommende, aus Mythen,
religiösen Dokumenten oder frühen Philosophien abgeleitete, falsche Vorstellungen gab es
ursprünglich in vielen Bereichen der Biologie. Die historische Darstellung der allmählichen
Verdrängung dieser vor- oder frühwissenschaftlichen Überzeugungen durch besser fundierte
wissenschaftliche Theorien und Ideen trägt erheblich zum Verständnis des theoretischen
Gerüsts der heutigen Biologie bei.
Der Laie entschuldigt seine mangelnde Kenntnis der Wissenschaft häufig mit der
Bemerkung, die Wissenschaft sei ihm zu fachtechnisch oder zu mathematisch. Ich möchte
jedem, der dieses Buch zur Hand nimmt, versichern, daß er auf diesen Seiten kaum
Mathematik finden wird, und daß das Werk nicht in dem Maße fachtechnisch ist, daß ein Laie
Schwierigkeiten mit der Darstellung haben würde. Die Ideengeschichte der Biologie hat einen
großen Vorteil: man kann sie studieren, ohne die Namen einzelner Tier- oder Pflanzenarten
oder der wichtigsten taxonomischen Gruppen und ihrer Klassifizierung zu kennen. Was man
jedoch braucht, ist eine gewisse Kenntnis der wichtigsten Begriffe in der Biologie, wie
Vererbung, Programm, Population, Variation, Emergenz oder organismisch. Kapitel 2 dient
dem Zweck, eine Einführung in die Welt der wichtigsten biologischen Begriffe zu geben. Viele
dieser Begriffe (und die damit verbundenen Fachausdrücke) sind auch in mehreren Zweigen
der Geisteswissenschaften eingeführt worden, und es ist schlicht eine Frage der Bildung
geworden, sie zu kennen. Alle diese Begriffe sind unerläßlich für ein Verständnis des
Menschen und der Welt, in der er lebt. Jedes Bemühen, Licht in Ursprung und Natur des
Menschen zu bringen, muß von einem gründlichen Verständnis der biologischen Begriffe und
Theorien ausgehen. Schließlich ist es hilfreich, wenn sich der Leser mit einer Reihe von
Fachwörtern vertraut macht wie Gamet, Zygote, Art, Gen, Chromosom usw., die im
Glossarium definiert sind. Das gesamte Fachvokabular ist jedoch weitaus weniger
umfangreich, als man es in irgendeinem Zweig der Geisteswissenschaften lernen muß, ob es
sich nun um Musik, Literatur oder Zeitgeschichte handelt.
Nicht nur der Laie wird seinen Horizont durch das Studium der Ideengeschichte der
Biologie erheblich erweitern. In vielen Zweigen der Biologie überstürzen sich die Fortschritte
heutzutage so sehr, daß selbst der Fachwissenschaftler nicht mehr in der Lage ist, mit den
Entwicklungen in anderen Bereichen der Biologie außer in seinem eigenen Schritt zu halten.
Der weitgespannte Überblick über die Biologie und ihre leitenden Ideen, wie er in diesem
Buch vorgelegt wird, dürfte dazu beitragen, einige dieser Lücken zu schließen. Meine
Darstellung richtet sich auch an alle diejenigen, die in den letzten Jahren von anderen
Fachgebieten, etwa von der Chemie, Physik, Mathematik oder anderen verwandten
Disziplinen, zur Biologie gestoßen sind. Steht doch leider in den meisten Fällen das
Verständnis der biologischen Begriffswelt dieser Neobiologen nicht auf derselben hohen Stufe
wie ihre fachspezifische Erfahrung. In der Tat kann man, wenn man Organismen in der Natur
kennt und die Pfade der Evolution versteht, häufig nur den Kopf schütteln über die Naivität der
Verallgemeinerungen, wie man sie in einigen molekularbiologischen Schriften findet.
Zugegeben, es gibt keine schnelle und leichte Methode, um diesem Mangel abzuhelfen. Ich bin
aber mit Conant der Ansicht, daß das Studium der Geschichte einer Disziplin der beste Weg
ist, sich ein Verständnis zu erarbeiten. Nur dadurch, daß man noch einmal alle Schwierigkeiten
nachempfindet, denen zum Trotz diese Ideen entwickelt wurden, daß man alle früheren
falschen Annahmen kennenlernt, die eine nach der anderen widerlegt werden mußten, anders
ausgedrückt, indem man um alle Fehler weiß, die in der Vergangenheit gemacht wurden, kann
man hoffen, ein wirklich gründliches und echtes Verständnis zu erwerben. In der Wissenschaft
lernt man nicht nur aus den eigenen Fehlern, sondern auch aus der Geschichte der Fehler
anderer.
2 Begriffsstruktur und Stellung der Biologie in der
Naturwissenschaft
Man würde sich vergeblich bemühen, wollte man die Entwicklung irgendeines speziellen
Begriffs oder Problems in der Geschichte der Biologie zu verstehen suchen, ohne zuvor die
folgenden Fragen gestellt und beantwortet zu haben: Was ist Naturwissenschaft? Welchen
Platz nimmt die Biologie unter den Wissenschaften ein? Und wie sieht die Begriffsstruktur der
Biologie aus? Auf alle drei Fragen sind, insbesondere von Philosophen und anderen
Nichtbiologen, ganz und gar irreführende Antworten gegeben worden, was dazu geführt hat,
daß das Begriffsgefüge der Biologie weitgehend unverstanden geblieben ist. Die erste Aufgabe
meiner Analyse besteht also darin, eine richtige Antwort auf diese grundlegenden Fragen zu
finden. Damit wird das Studium der Geschichte spezifischer Begriffe in der Biologie auf eine
solide Grundlage gestellt.
Das Wesen der Wissenschaft
Seit Urzeiten stellt der Mensch Fragen über Ursprung und Sinn der Welt und häufig auch
über den Sinn seiner Existenz. In den Mythen aller Kulturen, selbst der primitivsten, finden wir
seine tastenden Antworten. Als der Mensch über diese einfachen Anfänge hinauswuchs, tat er
dies auf zweierlei sehr verschiedene Weisen. Zum einen festigten sich seine Ideen in Form von
Religionen, die eine Reihe von gewöhnlich auf Offenbarung beruhenden Glaubenssätzen
verkünden. So war das Abendland im ausgehenden Mittelalter völlig von einem blinden
Vertrauen in die Lehren der Bibel und darüber hinaus von einem universellen Glauben an das
Übernatürliche beherrscht.
Die andere, zweite Form der Auseinandersetzung mit den Geheimnissen der Welt war die
Philosophie und später die Naturwissenschaft, obwohl die Wissenschaft in den Anfängen ihrer
Geschichte nicht scharf von einer Religion getrennt war. Die Wissenschaft stellt diesen
Geheimnissen Fragen, Zweifel, Wissensdurst und Erklärungsversuche entgegen, nimmt also
eine ganz andere Haltung ein als die Religion. Die vorsokratischen (ionischen) Philosophen
waren die ersten, die sich dieser zweiten Methode bedienten, sie suchten nach „natürlichen"
Erklärungen im Sinne beobachtbarer Naturkräfte wie Feuer, Wasser und Luft (Kap. 3). Dieses
Bemühen um das Verständnis der Ursachen von Naturerscheinungen war der Anfang der
Naturwissenschaft. Während vieler Jahrhunderte nach dem Untergang Roms war diese
Tradition praktisch in Vergessenheit geraten, gegen Ende des Mittelalters und während der
sogenannten wissenschaftlichen Revolution gewann sie jedoch neues Leben. Es wuchs die
Überzeugung, daß uns die Göttliche Wahrheit nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern auch in
Gottes Schöpfung offenbart werde.
Wir alle kennen die Formulierung, in der Galileo Galilei diese Ansicht zum Ausdruck
brachte: „Ich meine, daß wir bei der Diskussion von Fragen der Natur nicht bei der Autorität
von Bibelstellen beginnen sollten, sondern mit vernünftigen Experimenten und notwendigen
Demonstrationen. Denn die Heilige Schrift wie auch die Natur haben ihren Ursprung
gleichermaßen im Worte Gottes." Und er fuhr fort: „Gott offenbart sich uns in ebenso
wunderbarer Weise in den Handlungen der Natur wie in den ehrwürdigen Sätzen der Heiligen
Schrift." Seiner Überzeugung nach flößt ein Gott, der die Welt mit ewigen Gesetzen regiert,
mindestens ebensoviel Vertrauen und Glauben ein wie ein Gott, der fortwährend in den Lauf
der Dinge eingreift. Dieser Gedanke war das auslösende Moment für die Geburt der
Naturwissenschaft, wie wir sie heute verstehen. Wissenschaft war für Galilei nicht eine
Alternative zur Religion, sondern ein untrennbarer Bestandteil von ihr. In gleicher Weise haben
viele große Philosophen vom siebzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert, unter anderen
auch Kant, Gott in ihr erklärendes System mit einbezogen. Die sogenannte Naturtheologie war,
ihrem Namen zum Trotz, ebenso sehr Wissenschaft wie Theologie. Ein Konflikt zwischen
Wissenschaft und Theologie entwickelte sich erst später, als die Naturwissenschaft immer
mehr Naturvorgänge und Erscheinungen durch „Naturgesetze" zu erklären begann – Vorgänge,
die man früher nur durch das Eingreifen des Schöpfers oder durch von Ihm angeordnete
spezielle Gesetze erklären zu können glaubte [1].
Ein grundlegender Unterschied zwischen Religion und Naturwissenschaft liegt darin, daß
Religion gewöhnlich aus einer Reihe von Dogmen, häufig „offenbarten" Dogmen, besteht, bei
denen es weder eine Alternative noch viel Deutungsspielraum gibt, wohingegen in der
Naturwissenschaft geradezu ein Preis für alternative Erklärungen ausgesetzt ist und jederzeit
die Bereitschaft besteht, eine Theorie durch eine andere zu ersetzen. Die Entdeckung eines
alternativen erklärenden Schemas ruft häufig freudige Erregung hervor. Die Qualität einer
wissenschaftlichen Idee wird nur in relativ geringem Maße nach außerwissenschaftlichen
Kriterien beurteilt, da sie im großen und ganzen einzig und allein daran gemessen wird, wieviel
sie erklären und – zuweilen – was sie voraussagen kann.
Seltsam: Wissenschaftler drücken sich bei ihren Aussagen darüber, um was es bei der
Wissenschaft eigentlich geht, recht ungenau aus. In der Blütezeit des Empirizismus und
Induktionismus wurde als Ziel der Wissenschaft am häufigsten die Ansammlung neuer
Kenntnisse genannt. Liest man dagegen die Schriften von Wissenschaftsphilosophen, so
gewinnt man den Eindruck, daß für sie Wissenschaft eine Methode ist. Und obwohl niemand in
Frage stellen dürfte, daß die Methodenlehre unerläßlich ist, hat die nahezu ausschließliche
Beschäftigung einiger Wissenschaftsphilosophen mit Methodik die Aufmerksamkeit von dem
wesentlicheren Zweck der Wissenschaft abgelenkt, der darin liegt, zu einem größeren
Verständnis der Welt, in der wir leben, und unserer selbst zu gelangen.
Wissenschaft dient einer Reihe von Zielen. Ayala (1968) beschreibt sie folgendermaßen: (1)
Wissenschaft bemüht sich um die systematische Ordnung des Wissens, es geht ihr um das
Auffinden von Beziehungsmustern zwischen Erscheinungen und Prozessen.
(2)Wissenschaft ist bestrebt, Erklärungen für das Auftreten von Ereignissen zu liefern.
(3)Wissenschaft stellt erklärende Hypothesen auf, die überprüfbar sein müssen, d. h. bei
denen grundsätzlich die Möglichkeit bestehen muß, sie zu widerlegen. Um es allgemeiner
auszudrücken: Wissenschaft versucht, die gewaltige Vielfalt von Naturerscheinungen und Vorgängen unter eine sehr viel kleinere Zahl von erklärenden Prinzipien einzuordnen.
Neue Fakten oder neue Ideen?
In den Augen der Öffentlichkeit sind Entdeckungen das Symbol der Wissenschaft. Die
Entdeckung einer neuen Tatsache ist gewöhnlich leicht zu berichten, und so sehen auch die
Nachrichtenmedien die Wissenschaft unter dem Aspekt neuer Entdeckungen. Als Alfred Nobel
die Bedingungen für die Verleihung der Nobelpreise ausschrieb, dachte er dabei ausschließlich
an neue Entdeckungen, insbesondere solche, die für die Menschheit von Nutzen sind. Dennoch
ist es völlig irreführend, wenn man unter Wissenschaft lediglich eine Ansammlung von Fakten
versteht. In der Biologie – und dies gilt vielleicht noch mehr für die Evolutionsbiologie als für
die funktionale Biologie – sind die meisten großen Fortschritte der Einführung neuer Begriffe
oder der Verbesserung bestehender Begriffe zu verdanken gewesen. Zu einem Verständnis der
Welt gelangen wir wirksamer durch Verbesserung unserer Vorstellungen und Konzepte als
durch die Entdeckung neuer Fakten, obgleich sich dies nicht gegenseitig ausschließt.
Lassen Sie mich dies anhand von ein oder zwei Beispielen erläutern. Bereits vor Mendel
hatten die Pflanzenzüchter schon viele Male das Verhältnis 3:1 entdeckt. Sogar Darwin war
beim Züchten seiner Pflanzen auf eine Vielzahl solcher 3:1-Verhältnisse gestoßen. Dennoch
war dies ohne tiefere Bedeutung, solange Mendel nicht die Theorien dazu aufgestellt hatte und
Weismann zusätzlich Ideen einführte, die der Mendelschen Segregation noch mehr Bedeutung
verliehen. Ebenso waren auch die Erscheinungen, die heute mit natürlicher Auslese erklärt
werden, bereits lange vor Darwin weithin bekannt, ergaben aber keinen Sinn, solange nicht der
Begriff der aus einzigartigen Individuen bestehenden Population eingeführt worden war. Dann
aber gewann die natürliche Auslese einen hohen Wert als erklärendes Prinzip. Die
Vorstellungen des Denkens in Populationen und der Begriff der geographischen Variation
waren ihrerseits (zusammen mit dem Begriff der Isolation) die Voraussetzungen für die
Entwicklung der Theorie der geographischen Speziation. Daß der Erwerb der
Fortpflanzungsisolation eine entscheidende Komponente im Artbildungsprozeß darstellt, wurde
erst nach Klärung des Begriffs der Isolationsmechanismen in seinem ganzen Ausmaß erkannt.
Und welche Rolle die Isolationsmechanismen tatsächlich spielen, blieb wiederum
unverstanden, solange man geographische Schranken zu den Isolationsmechanismen zählte,
wie es Dobzhansky (1937) noch tat.
Man kann fast jeden einzelnen Fortschritt herausgreifen, sei es in der Evolutionsbiologie
oder in der Systematik, und zeigen, daß er nicht so sehr durch die Entdeckung neuer Fakten,
sondern vielmehr durch die Einführung verbesserter Begriffe bedingt war. Für
Wissenschaftshistoriker ist das nichts Neues, unter Nicht-Wissenschaftlern ist diese Tatsache
jedoch leider viel zu wenig bekannt. Natürlich machen Entdeckungen einen wesentlichen Teil
des wissenschaftlichen Fortschritts aus, und einige gegenwärtig in der Biologie bestehenden
Engpässe – wie die Frage nach dem Ursprung des Lebens und die Organisation des
Zentralnervensystems – sind in erster Linie durch die mangelnde Kenntnis von gewissen
Grundtatsachen begründet. Dennoch ist der Beitrag, den neue Begriffe oder die mehr oder
weniger radikale Umformulierung alter Begriffe leisten, ebenso wichtig wie Fakten und ihre
Entdeckung und häufig sogar wichtiger. In der Evolutionsbiologie haben Begriffe wie
Evolution, gemeinsame Abstammung, geographische Speziation, Isolationsmechanismen oder
natürliche Auslese zu einer drastischen Neuorientierung in einem zuvor verworrenen Bereich
der Biologie und zur Bildung neuer Theorien sowie zu unzähligen neuen Forschungsarbeiten
geführt. Ganz unrecht haben, diejenigen nicht, die darauf beharren, der Fortschritt der
Wissenschaft bestehe hauptsächlich im Fortschritt wissenschaftlicher Begriffe.
Die Verwendung von Begriffen ist natürlich nicht auf die Naturwissenschaft beschränkt,
denn es gibt sie in der Kunst, in der Geschichte (und anderen Bereichen der
Geisteswissenschaften), in der Philosophie, ja eigentlich bei jeder Tätigkeit des menschlichen
Geistes. Welche Kriterien – außer dem, daß Begriffe verwendet werden – kann man dann also
zugrundelegen, um die Naturwissenschaft von diesen anderen menschlichen Bemühungen
abzugrenzen? Die Antwort auf diese Frage ist nicht so leicht, wie man erwarten könnte. Dies
wird deutlich, wenn man fragt, in welchem Maße z. B. die Sozialwissenschaften
Wissenschaften sind. Versuchsweise könnte man als Merkmale der Wissenschaft die Strenge
ihrer Methoden, die Möglichkeit des Überprüfens oder Falsifizierens ihrer Schlußfolgerungen
und die Möglichkeit der Aufstellung widerspruchsfreier „Paradigmen" vorschlagen. Die
Methode ist zwar nicht alles, was Wissenschaft ausmacht, aber sie ist einer ihrer wichtigen
Aspekte, insbesondere deshalb, weil sie in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
jeweils etwas verschieden ist.
Die Methode in der Wissenschaft
Die Griechen suchten stets nach rationalen Erklärungen in der Welt der Phänomene. Wenn
die Schule von Hippokrates zum Beispiel die Ursache einer Krankheit festzustellen suchte, so
suchte sie diese nicht in einem göttlichen Einfluß, sondern in natürlichen Ursachen wie Klima
oder Ernährung. In gleicher Weise bemühten sich die ionischen Philosophen, rationale
Erklärungen für die Erscheinungen der unbelebten und lebenden Welt zu geben. Aristoteles,
zweifellos der Vater der wissenschaftlichen Methode, gibt in seinen „Analytica posteriora"
eine derart bemerkenswerte Beschreibung davon, wie man eine wissenschaftliche Erklärung in
Angriff zu nehmen habe (McKeon, 1947; Foley, 1953; Vogel, 1952), daß, wie Laudan (1977,
S.13) es etwas extrem ausdrückt, fast bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein „die
Wissenschaftsphilosophen immer noch weitgehend innerhalb der Grenzen der
methodologischen Probleme arbeiteten, wie sie Aristoteles und seine Kommentatoren
erörterten". Die griechischen Philosophen, einschließlich Aristoteles, waren in erster Linie
Rationalisten. Sie meinten (Empedokles ist ein typisches Beispiel dafür), sie könnten
wissenschaftliche Probleme lediglich durch scharfes logisches Denken lösen, wobei sie sich
gewöhnlich eines Verfahrens bedienten, das wir heute Deduktion nennen würden. Der
unbezweifelbare Erfolg dieser antiken Ärzte und Philosophen bei ihren Erklärungen hatte eine
Überschätzung des rein rationalen Ansatzes zur Folge, die in Descartes ihren Höhepunkt
erreichte. Obgleich Descartes etwas empirische Forschung betrieb (beispielsweise sezierte er),
hören sich viele Aussagen dieses Philosophen so an, als sei er davon überzeugt, daß alle Fragen
lediglich durch konzentriertes Denken lösbar seien.
Die nachfolgenden Angriffe der Induktivisten und Experimentalisten gegen den
Cartesianismus ließen keinen Zweifel daran, daß man der Methode in der Wissenschaft große
Bedeutung beimaß. Dies trifft heute ebenso zu wie im siebzehnten Jahrhundert. Leider
beharrten allzu viele Philosophen bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein auf der
Überzeugung, sie könnten die Rätsel des Universums durch bloßes Nachdenken und
Philosophieren lösen. Wenn ihre Schlußfolgerungen sich im Widerspruch zu den
Erkenntnissen der Naturwissenschaft befanden, so bestanden einige von ihnen darauf, daß sie
recht und die Naturwissenschaft unrecht hätten. Diese Haltung veranlaßte Helmholtz, sich
bitter über die Arroganz der Philosophen zu beklagen. Die Reaktion einiger heutiger
Philosophen auf natürliche Auslese, Relativität und Quantenmechanik zeigt, daß diese
Einstellung auch heute noch nicht völlig überwunden ist.
Descartes bemühte sich, lediglich solche Schlüsse und Theorien vorzutragen, die die
Gewißheit eines mathematischen Beweises hatten. Und obwohl es immer einige
Andersdenkende gegeben hat, ist die Ansicht, ein Wissenschaftler habe den absoluten Beweis
für alle seine Ergebnisse und Theorien vorzulegen, bis in unsere heutige Zeit hinein weit
verbreitet gewesen. Sie beherrschte nicht nur die Physik, wo es häufig möglich ist, einen dem
Wesen nach mathematischen Beweis vorzubringen, sondern auch die Biologie. Selbst hier sind
die Folgerungen oft so schlüssig, daß sie als Beweis akzeptiert werden können, z.B. die
Behauptung, daß das Blut im Körper zirkuliert oder daß eine spezielle Art von Raupe das
Larvenstadium einer bestimmten Schmetterlingsart ist. Die Tatsache, daß man auch bei der
gründlichsten Erforschung der Erdoberfläche keinerlei Spur lebender Dinosaurier gefunden
hat, kann als Beweis dafür angesehen werden, daß diese Tiere ausgestorben sind. Bisher habe
ich Tatsachen genannt, und gewöhnlich läßt sich der Beweis erbringen, ob eine Feststellung
einer Tatsache entspricht oder nicht. In vielen Fällen jedoch – und vielleicht bei der Mehrheit
der Schlüsse, zu denen die Biologen gelangen – ist es unmöglich, Beweise von solcher
Gewißheit anzuführen (Hume, 1738). Wie sollen wir „beweisen", daß die natürliche Auslese
der richtunggebende Faktor ist, der die Evolution der Organismen lenkt?
Schließlich erkannten auch die Physiker, daß sie nicht immer absolute Beweise vorlegen
können (Lakatos, 1976), und die heutige Wissenschaftstheorie verlangt dies nicht mehr.
Stattdessen gibt man sich damit zufrieden, entweder die auf der Grundlage des verfügbaren
Belegmaterials am wahrscheinlichsten erscheinende Hypothese als wahr anzusehen, oder aber
eine solche, die mit mehr oder mit überzeugenderen Tatsachen in Einklang steht als etwa
konkurrierende Hypothesen. In der Erkenntnis, daß es bei vielen wissenschaftlichen Schlüssen
unmöglich ist, den absoluten Beweis anzutreten, hat der Philosoph Karl Popper stattdessen
deren Falsifizierbarkeit zum Prüfstein ihrer Gültigkeit gemacht. Eine Hypothese ist
falsifizierbar, wenn Effekte zumindest denkbar sind, die – wenn sie eintreten – die Hypothese
widerlegen und zu einer umfassenderen Hypothese führen. Damit wird die Beweislast dem
Gegner einer wissenschaftlichen Theorie zugeschoben und dementsprechend diejenige Theorie
als gültig angenommen, die erfolgreich der größten Zahl und Vielfalt von
Widerlegungsversuchen standgehalten hat. Poppers Methode erlaubt darüber hinaus eine
saubere Abgrenzung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft: Jede These, die im Prinzip nicht
falsifizierbar ist, liegt außerhalb des Bereichs der Wissenschaft. So ist die Behauptung, es gäbe
Menschen auf dem Andromedanebel keine wissenschaftliche Hypothese.
Eine These als falsch zu beweisen, ist jedoch manchmal ebenso schwierig wie das Erbringen
eines positiven Beweises. Falsifikation gilt daher nicht als einziges Maß dafür, ob eine
wissenschaftliche These akzeptabel ist. Wie die Wissenschaftsgeschichte zeigt, sind
wissenschaftliche Theorien häufig nicht deshalb abgelehnt worden, weil sie eindeutig widerlegt
wurden, sondern vielmehr deshalb, weil eine alternative neue Theorie wahrscheinlicher,
einfacher oder eleganter schien. Außerdem werden verworfene Theorien häufig trotz
anscheinend erfolgreicher Widerlegungen immer noch hartnäckig von einer Minderheit von
Anhängern verfochten.
Die heutige Wissenschaftstheorie interpretiert Ergebnisse mit probabilistischen Methoden.
Daher ist es unangebracht, von der Wahrheit oder von einem Beweis als etwas Absolutem zu
sprechen. Dies ist für einige Zweige der Biologie wichtiger als für andere. Jeder
Evolutionsbiologe, der schon einmal mit Laien diskutiert hat, hat die Frage zu hören
bekommen: „Gibt es denn einen Beweis für die Evolution?" Oder: „Wie beweisen Sie denn
nun, daß der Mensch vom Affen abstammt?" Er sieht sich dann erst einmal gezwungen, das
Wesen des wissenschaftlichen Beweises zu erörtern.
Im Gegensatz dazu war und ist der praktisch arbeitende Wissenschaftler immer ein
Pragmatiker. Er war stets verhältnismäßig glücklich mit einer Theorie, solange es keine bessere
gab. Faktoren, die sich nicht erklären ließen, wurden wie ein „schwarzer Kasten" behandelt.
Darwin zum Beispiel hat dies mit dem Ursprung der genetischen Variabilität getan, einer der
Hauptkomponenten seiner Theorie der natürlichen Auslese. Die Wissenschaftler haben sich
niemals besonders daran gestört – und tun das auch heute nicht -, daß viele ihrer
Verallgemeinerungen lediglich probabilistischer Natur sind und daß viele, wenn nicht die
meisten, natürlichen Prozesse eine bemerkenswert große stochastische Komponente enthalten.
Sie akzeptieren eine große Flexibilität als eins der Attribute wissenschaftlicher Theorien und
sind daher bereit, zahlreiche Theorien nachzuprüfen, Elemente verschiedener Theorien
miteinander zu kombinieren und manchmal sogar mehrere alternative Theorien gleichzeitig in
Erwägung zu ziehen (vielfache Arbeitshypothesen), während sie nach Beweismaterial suchen,
das es ihnen erlaubt, einer Theorie gegenüber den anderen den Vorzug zu geben (Chamberlin,
1890). Man darf allerdings nicht verschweigen, daß die Aufgeschlossenheit der
Wissenschaftler nicht unbegrenzt ist. Wenn Theorien „fremdartig" oder für das vorherrschende
geistige Milieu ungewohnt sind, so werden sie gern ignoriert oder mit Schweigen übergangen.
Dies trifft zum Beispiel, wie wir noch sehen werden, auf die Emergenztheorie und die Theorie
niveauspezifischer Eigenschaften von Hierarchien zu.
Interessanterweise befand sich Darwins Methode völlig im Einklang mit der modernen
Theorie. Er erkannte, daß er niemals in der Lage sein würde, evolutionsbiologische
Schlußfolgerungen mit der Sicherheit eines mathematischen Beweises vorzubringen.
Stattdessen stellte er an etwa zwanzig verschiedenen Stellen in seinem Werk Über die
Entstehung der Arten die Frage: „Läßt sich dieser spezielle Befund – ob geographische
Verbreitung oder anatomische Struktur – leichter mit einem speziellen Schöpfungsakt oder mit
evolutionärem Opportunismus erklären?" Beharrlich bestand er darauf, daß die zweite
Alternative wahrscheinlicher ist. Darwin nahm viele der wichtigsten Lehrsätze der
gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie voraus. Obwohl sich die Wissenschaftler heute
allgemein zu der probabilistischen Interpretation der wissenschaftlichen Wahrheit bekennen,
ja, die völlige Unmöglichkeit eingestehen, die Mehrzahl ihrer Schlüsse mit mathematischer
Beweissicherheit nachzuweisen, ist diese neue Einsicht vielen Nicht-Wissenschaftlern immer
noch unbekannt. Es wäre zu wünschen, daß diese neue Vorstellung von wissenschaftlicher
Wahrheit in viel stärkerem Maße zu einem Bestandteil des wissenschaftlichen Unterrichts
gemacht würde.
Manches weist aber darauf hin, daß man der Wahl der Methode übertrieben viel Bedeutung
zugeschrieben hat. In diesem Punkt stimme ich Koyre zu (1965), nach dessen Ansicht „die
abstrakte Methode für die konkrete Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens von relativ
geringer Bedeutung ist." Goodfield (1974) konnte unter Physiologen keinen Unterschied
zwischen Reduktionisten und Anti-Reduktionisten in Bezug auf wissenschaftlichen Erfolg und
Theorienbildung feststellen. Gleichermaßen haben auch
Kuhn und andere die Bedeutung der Methodenwahl als geringfügig hingestellt. Bei ihrer
eigentlichen Forschungstätigkeit wechseln die Wissenschaftler häufig ab zwischen einer Phase,
in der sie Material sammeln oder rein deskriptiv oder klassifizierend arbeiten, und einer
anderen, in der sie Thesen aufstellen oder Theorien nachprüfen.
Induktion
Jahrhunderte lang hat man darüber diskutiert, welcher Methode größeres Verdienst zukomme,
der induktiven oder der deduktiven (Medawar, 1967). Inzwischen hat sich gezeigt, daß diese
Diskussion relativ irrelevant ist. Der Vertreter der Induktion behauptet, ein Wissenschaftler
könne durch einfaches Aufzeichnen, Messen und Beschreiben dessen, was er vorfindet, zu
objektiven, vorurteilsfreien Schlußfolgerungen gelangen, ohne zuvor irgendwelche Hypothesen
oder vorgefaßte Erwartungen zu haben. Francis Bacon (1561-1626) war der wichtigste
Verfechter der induktiven Methode, obwohl er selbst bei seiner Arbeit sie niemals konsequent
anwandte. Darwin, der sich damit brüstete, er folge „der wahren Baconschen Methode", war
alles andere als ein Induktionist. Ja, er machte sich sogar über diese Methode lustig, sagte er
doch, wenn man an sie glaube, so „könne man genausogut in eine Kiesgrube gehen und die
Kieselsteine zählen oder ihre Farben beschreiben". Dennoch ist Darwin in der philosophischen
Literatur oft als Anhänger des Induktionismus eingestuft worden. Die induktive Methode
erfreute sich im 18. und 19. Jahrhundert großer Beliebtheit, aber wir wissen heute, daß ein rein
induktiver Ansatz recht steril ist. Veranschaulichen läßt sich dies am Beispiel des
Pflanzenzüchters Gärtner, der geduldig Zehntausende von Kreuzungen durchführte und
aufschrieb, ohne je zu einer Verallgemeinerung zu gelangen. Liebig (1863) war der erste
prominente Wissenschaftler, der die Baconsche Induktion ablehnte und überzeugend
argumentierte, kein Wissenschaftler habe je die in Bacons Novum Organon beschriebene
Methode angewandt – und könne dies auch niemals. Liebigs scharfe Kritik führte zum Ende
der Herrschaft der induktiven Methode (Laudan, 1968).
Hypothetisch-deduktive Methode
Immer bewußter begann man, sich anstelle der induktiven der sogenannten
hypothetischdeduktiven Methode zu bedienen [2]: Der erste Schritt besteht darin, eine
Hypothese aufzustellen, zu „spekulieren", wie Darwin es nannte. Der zweite Schritt ist dann
das Experiment oder das Sammeln von Beobachtungen zum Nachprüfen dieser Hypothese.
Wie Darwin diese Methode angewandt hat, ist von Ghiselin (1969), Hull (1973) und Ruse
(1975 b) ausgezeichnet beschrieben worden. Die Methode enthält ein starkes Element
gesunden Menschenverstandes. Implizite ist sie bereits in der aristotelischen Methode und mit
Sicherheit in einem Großteil der Anwendungen der sogenannten deduktiven Methode von
Descartes und seinen Anhängern enthalten gewesen. Wenn auch während der Herrschaft des
Induktionismus im 18. Jahrhundert vorübergehend in den Schatten gedrängt, wurde die
hypothetischdeduktive Methode im 19. Jahrhundert zur vorherrschenden Methode der
Wissenschaft.
Ihre weite Verbreitung beruht darauf, daß sie zwei große Vorteile besitzt. Erstens paßt sie
nahtlos zu der sich immer weiter ausbreitenden Überzeugung, daß es keine absolute Wahrheit
gibt und daß unsere Schlußfolgerungen und Theorien der fortwährenden Überprüfung
bedürfen. Zweitens ermutigt sie im Zusammenhang mit dem heutigen Relativismus dazu,
ständig neue Theorien aufzustellen und nach neuen Betrachtungen und Experimenten zu
suchen, mit denen neue Hypothesen entweder bestätigt oder widerlegt werden. Sie läßt die
Wissenschaft flexibler und kühner werden und hat einigen wissenschaftlichen Streitfragen
etwas von ihrer Schärfe genommen, da es nicht mehr um den Sieg im Kampf um die letzte
Wahrheit geht.
Allerdings läßt sich darüber streiten, in welchem Umfang die hypothetischdeduktive
Methode von den Wissenschaftlern tatsächlich angewandt wird. Wie Collingwood (1939) sehr
richtig festgestellt hat, ist eine Hypothese immer der Versuch einer Antwort auf eine Frage,
und das Stellen einer Frage wiederum ist tatsächlich der erste Schritt zu einer Theorie. Die
Geschichte der Wissenschaft kennt eine Unzahl von Fällen, in denen ein Forscher im Besitz
sämtlicher wichtiger Fakten für eine neue Theorie war, es aber einfach versäumt hat, die
richtige Frage zu stellen. Bejaht man die Bedeutung des Fragestellens, so wirft dies allerdings
sofort neue Zweifel auf: Erstens einmal, warum wurde die Frage gestellt? Die Antwort darauf
muß lauten: Weil ein Wissenschaftler etwas beobachtet hat, das er nicht verstand, oder etwas,
dessen Ursprung ihm rätselhaft war, oder weil er auf scheinbar widersprüchliche
Erscheinungen gestoßen war, und den Widerspruch klären wollte. Mit anderen Worten: Anlaß
zum Fragestellen war die Beobachtung von Fakten.
Die Gegner der induktiven Methode haben völlig recht, wenn sie behaupten, daß Fakten von
sich aus niemals zu einer Theorie führen. Der schöpferische Geist ist, wie Schopenhauer es
ausgedrückt hat, in der Lage, „etwas zu denken, das niemand zuvor gedacht hat, wenn er etwas
sieht, was jeder sieht." Somit ist die Vorstellungskraft, die Phantasie, letzten Endes die
wichtigste Voraussetzung für den wissenschaftlichen Fortschritt.
Im wesentlichen entspricht die hypothetischdeduktive Methode also der modernen
wissenschaftlichen Methode der Entdeckung, obgleich Beobachten und Fragestellen stets dem
Aufstellen einer provisorischen Hypothese vorausgehen.
Experiment versus Vergleich
Der Unterschied zwischen physikalischer und biologischer Forschung ist nicht, wie oft
behauptet wird, ein Unterschied in der Methode. Das Experiment zum Beispiel ist keineswegs
auf die exakten Wissenschaften beschränkt, vielmehr stellt es eine wichtige Methode der
Biologie dar, insbesondere der funktionalen Biologie (siehe unten). Beobachtung und
Klassifikation sind ohne Zweifel in der Biologie wichtiger als in der Physik, aber es liegt auf
der Hand, daß sie in solchen Zweigen der exakten Wissenschaften wie der Geologie,
Meteorologie und Astronomie die vorherrschenden Methoden sind. Die Analyse ist, wie wir
noch sehen werden, in den exakten Wissenschaften von gleichgroßer Bedeutung wie in der
Biologie.
In wissenschaftsphilosophischen Werken, die aus der Feder von Physikern stammen, wird
das Experiment häufig als die Methode der Naturwissenschaft bezeichnet [3J. Das ist nicht
richtig, denn in manchen naturwissenschaftlichen Gebieten, wie etwa der Evolutionsbiologie
und der Ozeanographie, sind andere, streng wissenschaftliche Methoden von großer
Bedeutung. Jeder Zweig der Wissenschaft erfordert seine eigenen, ihm angemessenen
Methoden. Für Galilei, den Erforscher der Mechanik, waren Messen und Quantifizieren von
allergrößter Bedeutung. Für Aristoteles, der sich mit lebenden Systemen und der Vielfalt der
Organismen befaßte, waren die Analyse der Vorgänge, die wir heute als teleonomische
Prozesse bezeichnen, sowie das Aufstellen von Kategorien die bevorzugten Methoden. In der
Physiologie und anderen funktionalen Wissenschaften ist der experimentelle Ansatz nicht nur
eine geeignete Methode, sondern auch nahezu die einzige, die zu Resultaten führt.
Die meisten Autoren, die sich mit der Geschichte der Naturwissenschaften befassen, legen
eine außerordentliche Unkenntnis an den Tag, wenn sie andere Methoden als die
experimentellen erörtern. Morgan (1926) ist ein gutes Beispiel für die Arroganz der
Experimentalisten, sprach er doch z. B. den Paläontologen jede Kompetenz der
Theorienbildung ab: „Mein guter Freund, der Paläontologe [er bezog sich dabei zweifellos auf
H.F.Osborn] befindet sich in größerer Gefahr, als ihm bewußt ist, sobald er die Beschreibung
verläßt und eine Erklärung versucht. Er hat keine Möglichkeit, seine Spekulationen zu
überprüfen… und der Genetiker sagt [wenn er die Lücken in den Fossilienreihen betrachtet] zu
dem Paläontologen: Da du nicht weißt, und bei der Natur der Sache auch niemals wissen
kannst, ob die Unterschiede, die du feststellst, einer einzigen Veränderung [einer einzigen
Mutation] oder aber tausend Veränderungen zu verdanken sind, so kannst du uns nichts
Sicheres über die Erbeinheiten sagen, die den Evolutionsprozeß gebildet haben." Als ob der
Paläontologe aus seinem Material nicht durchaus gültige Schlüsse ableiten könnte, Schlüsse,
die sich auf vielerlei Weise nachprüfen lassen. Abgesehen davon ist es irreführend, die Dinge
so darzustellen, als sei experimentelles Arbeiten niemals deskriptiv. Der experimentell
arbeitende Wissenschaftler, wenn er über die Resultate seiner Experimente berichtet,
beschreibt ebenso wie der Naturbeobachter seine Beobachtungen. Beobachten ist zweifellos
eine Alternative zum Experimentieren. Und in vielen Wissenschaftszweigen hängt der
Fortschritt von Beobachtungen ab, die durchgeführt werden, um sorgfältig gestellte Fragen zu
beantworten. Die moderne Evolutionsbiologie, Verhaltensforschung und Ökologie haben
überzeugend bewiesen, daß diese weitgehend beobachtenden Wissenschaften alles andere als
deskriptiv sind. Tatsächlich sind viele Arbeiten über Experimente, die ohne geeignete
Fragestellung ausgeführt wurden (wovon es leider bei weitem zu viele gibt!), weit stärker
deskriptiv als die Mehrheit der nichtexperimentellen Arbeiten in der Evolutionsbiologie.
Doch bloße Beobachtung ist nicht genug. Erst im späten 18. Jahrhundert wurde eine
Methode zum ersten Mal ernsthaft angewandt, die für das Studium der Diversität besonders
geeignet ist, nämlich die vergleichende Methode. Obwohl es einige Vorläufer gab, war Cuvier
ohne jede Frage der erste große Vertreter des vergleichenden Ansatzes (siehe Kap. 4). Die
Anwendung der vergleichenden Methode setzt, was häufig übersehen wird, eine Klassifikation
der zu vergleichenden Elemente voraus. Ja, der Erfolg der vergleichenden Analyse hängt in
hohem Maße von der Güte der vorausgehenden Klassifikation ab. Umgekehrt führen beim
Vergleich festgestellte Nichtübereinstimmungen häufig zu einer besseren Klassifikation der
Phänomene. Eine derartige gegenseitige Beeinflussung von zwei Methoden ist für viele Zweige
der Wissenschaft kennzeichnend und bedeutet keineswegs, daß man sich im Kreis bewegt
(Hull, 1967).
Der Unterschied zwischen der experimentellen und der vergleichenden Methode ist nicht so
groß, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Bei beiden Methoden werden Daten
gesammelt, und bei beiden spielt die Beobachtung eine entscheidende Rolle (obgleich der
Experimentator gewöhnlich nicht erwähnt, daß seine Ergebnisse der Beobachtung der
durchgeführten Experimente zu verdanken sind). Bei den sogenannten beobachtenden
Wissenschaften studiert der Beobachter Experimente der Natur. Der Hauptunterschied
zwischen den beiden Gruppen von Beobachtungen liegt darin, daß man beim künstlichen
Experiment die Bedingungen wählen kann und somit in der Lage ist, die das Ergebnis
bestimmenden Faktoren einzeln nachzuprüfen. Bei einem Experiment der Natur, ob es sich
dabei nun um ein Erdbeben oder um den Ursprung einer Inselfauna handelt, ist es unsere
Hauptaufgabe, die Bedingungen zu erschließen oder zu rekonstruieren, unter denen dieses
Experiment der Natur stattgefunden hat. Bei der Suche nach der richtigen
Faktorenkonstellation ist es bei einer „kontrollierten" Beobachtung manchmal fast möglich, die
Zuverlässigkeit eines kontrollierten Experiments zu erreichen. Wie Pantin (1968, S. 17)
feststellte: „In der Astronomie, in der Geologie und auch in der Biologie kann die Beobachtung
von Naturereignissen zu ausgewählten Zeiten und an ausgewählten Orten gelegentlich
Erkenntnisse liefern, die für das Ziehen von Schlußfolgerungen ebenso völlig ausreichen wie
experimentell erzielte Daten."
Es ist vor allem auch deshalb wichtig, die wissenschaftliche Legitimität der beobachtend
vergleichenden Methode zu unterstreichen, weil experimentelle Methoden auf viele
wissenschaftliche Probleme nicht anwendbar sind, Die auf die vergleichende Methode
angewiesenen Wissenschaftszweige sind keineswegs zweitrangig, obgleich einige Physiker das
Gegenteil behaupten. E. B.Wilson, ein Weiser unter den Wissenschaftlern, drückte es vor
langer Zeit so aus: „Die Experimente, die wir in unseren Laboratorien durchführen, ergänzen
lediglich diejenigen Experimente, die in der Natur stattgefunden haben und immer in der Natur
stattfinden, und ihre Resultate müssen in dasselbe Gewebe eingepaßt werden." Wilson
widersprach beharrlich allen Stimmen, die behaupteten, der Fortschritt in der Biologie könne
„allein durch das Experiment" erreicht werden. Beobachtung führte zur Entdeckung fremder
Faunen und Floren und wurde zur Grundlage der Biogeographie; Beobachtung offenbarte die
Vielfalt der organischen Natur und führte zur Aufstellung des Linnaeischen Systems und der
Theorie der gemeinsamen Abstammung; Beobachtung führte zur Gründung der Ethologie und
Ökologie. Das Beobachten hat in der Biologie wahrscheinlich mehr Einsichten hervorgebracht
als alle Experimente zusammen.
Die Stellung der Biologie innerhalb der Naturwissenschaft
Der Mythologie oder Religion gegenüber zeigt die Wissenschaft eine geschlossene Front.
Ungeachtet mannigfaltiger Unterschiede, ist allen Wissenschaften das Bemühen gemein, die
Welt zu verstehen. Die Wissenschaft will erklären, will verallgemeinern, will die Ursachen von
Dingen, Ereignissen und Prozessen bestimmen. In diesem Ausmaß zumindest besteht eine
Einheit der Wissenschaft (Causey, 1977).
Aus dieser Feststellung wird häufig gefolgert, was für die eine Wissenschaft (etwa die
Physik) gelte, müsse in gleicher Weise auch für alle anderen Wissenschaften zutreffen. Um ein
Beispiel zu nennen: In meinem Bücherschrank dürften etwa sechs oder sieben Bände stehen,
deren Autoren alle behaupten, sie behandelten die „Philosophie der Wissenschaft", die sich
aber tatsächlich alle nur mit der Philosophie der exakten Wissenschaften befassen. Die
Wissenschaftsphilosophen – die meisten aus der Physik kommend – gründeten ihre
Behandlung der Philosophie und Methode der Wissenschaft bedauerlicherweise fast
ausschließlich auf die Physik und verwandte Naturwissenschaften. Solche Abhandlungen sind
sehr unvollständig, versäumen sie es doch, das reiche
Feld der Erscheinungen und Prozesse abzudecken, das wir in der Welt der lebenden
Organismen finden. Wenn Philosophen und Geisteswissenschaftler die „Naturwissenschaft"
beschreiben oder kritisieren, so denken sie dabei fast ausnahmslos an die Physik (oder sogar
Technik). Historiker, die von der Revolution der Wissenschaft sprechen, die in erster Linie eine
Revolution der Mechanik war, gehen allzu oft stillschweigend davon aus, daß diese Revolution
in gleicher Weise auch die Biologie erfaßt.
Die wichtigen Unterschiede zwischen Biologie und exakten Wissenschaften werden allzu oft
übersehen. Für die meisten Physiker scheint es absolut sicher zu sein, daß die Physik das
Paradigma der Wissenschaft ist; sobald man die Physik verstehe, könne man auch jede andere
Wissenschaft begreifen, einschließlich der Biologie. Die „Arroganz der Physiker" (Hull, 1973)
ist unter den Wissenschaftlern sprichwörtlich geworden. Der Physiker Ernst Rutherford
beispielsweise nannte die Biologie „Briefmarkensammeln". Selbst V. Weisskopf, ein relativ
unvoreingenommener Physiker, hat sich vor kurzem so weit vergessen, zu behaupten, „die
wissenschaftliche Weltsicht beruht auf den großen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts über die
Natur der Elektrizität und Wärme und die Existenz von Atomen und Molekülen" (1977,
S.405), als ob Darwin, Bernard, Mendel und Freud (ganz zu schweigen von Hunderten anderer
Biologen) nicht einen gewaltigen Beitrag zu unserer wissenschaftlichen Weltsicht geleistet
hätten, vielleicht sogar einen größeren als die Physiker.
Als Gegengewicht zu dieser Haltung ist es manchmal lohnend oder sogar notwendig, die
Pluralität der Wissenschaft zu betonen. Allzu häufig setzt man Newton und die Naturgesetze
gleich Naturwissenschaft. Ein Blick auf die geistige Szene des 16., 17. und 18. Jahrhunderts
zeigt, daß außer der Newtonschen noch mehrere andere Traditionen bestanden, die ganz und
gar nicht das Geringste miteinander oder mit der Mechanik zu tun hatten. Die Botanik der
Autoren der Kräuterbücher, die großartigen Tafeln in Vesalius' Anatomie, die überall
vorhandenen Naturalien-Kabinette, die großen Forschungsreisen, die jardins des plantes, die
Tierschauen – was hatte all dies mit Newton zu tun? Und doch inspirierte gerade diese andere
Naturwissenschaft Rousseaus Romantik und die These vom edlen Naturmenschen.
Erst in den jüngsten Jahren ist deutlich geworden, wie naiv und irreführend die Annahme
von der Wesensgleichheit von Physik und Biologie ist. Der Physiker C. F. von Weizsäcker
(1971) räumt ein, daß die konventionelle physikalische Erklärung „und die abstrakte
mathematische Form, in die sie gekleidet ist, unser Bedürfnis nach einem wirklichen
Verständnis der Natur nicht befriedigt. Außerdem sind die großen Gruppen von
Wissenschaften nicht mehr durch eine gemeinsame Weltsicht vereint… Der Physiker findet
eine autonome Biologie vor."
Das Studium biologischer Phänomene führt somit zu der berechtigten Frage: Wie weit sind
Methodologie und begrifflicher Rahmen der exakten Wissenschaften geeignete Modelle für die
Biologie? Diese Frage betrifft nicht nur solche eher speziellen Probleme wie die Frage des
„Bewußtseins" oder des „Geistes", sondern jede biologische Erscheinung oder jeden
biologischen Begriff, wie Population, Art, Adaptation, Verdauung, Auslese, Konkurrenz und
dergleichen. Gibt es in den exakten Wissenschaften irgendwelche Äquivalente zu diesen
biologischen Phänomenen und Begriffen?
Nirgendwo tritt der Unterschied zwischen verschiedenen Wissenschaften auffälliger zutage
als bei ihren philosophischen Anwendungen. Viele Philosophen haben betont, daß es keine
vorstellbare Verbindung zwischen Physik und Ethik gäbe. Dagegen ist offensichtlich durchaus
ein Potential für eine Verbindung zwischen Biologie und Ethik vorhanden: Der
Sozialspencerianismus ist ein Beispiel dafür, die Eugenik ein anderes. Die Behauptung des
Physikers, daß, es für die Physik keinen Zusammenhang mit der Ethik gäbe, hat eine gewisse
Richtigkeit (allerdings denke man an die Kernphysik!). Wenn er jedoch proklamiert, es gäbe
keine Verbindung zwischen „Naturwissenschaft" und Ethik, so zeugt das von provinzlerischer
Engstirnigkeit. Politische Ideologien haben bei weitem mehr Interesse an der Biologie als an
der Physik. Der Lysenkoismus und die tabula rasa- Lehren des Behaviorismus (und seiner
marxistischen Anhänger) sind nur einige Beispiele. Aus all diesen Gründen ist es falsch, von
der Philosophie der Naturwissenschaft zu sprechen, wenn man die Philosophie der Physik
meint.
Die Überzeugung vieler Physiker und anderer Naturwissenschaftler, alle biologischen
Erkenntnisse ließen sich auf die Gesetze der Physik reduzieren, hat viele Biologen – sozusagen
in Selbstverteidigung – dazu veranlaßt, für die Autonomie der Biologie einzutreten. Obwohl
diese Emanzipationsbewegung der Biologen selbstverständlich auf beträchtlichen Widerstand
nicht nur seitens der Physiker, sondern auch seitens der essentialistischen Philosophen stieß,
hat sie in den letzten Jahrzehnten stetig an Stärke zugenommen. Eine leidenschaftslose
Erörterung der Frage, ob die Prinzipien, Theorien und Gesetze der Physik alle Phänomene der
Biologie erklären können, oder ob die Biologie, wenigstens zum Teil, als eine autonome
Wissenschaft zu gelten hat, ist durch eine offensichtliche Rivalität ja sogar gegenseitige
Feindseligkeit – der Wissenschaften, und zwar sowohl innerhalb der Physik sowie der Biologie
als auch zwischen diesen beiden Disziplinen, sehr erschwert worden. Zahlreiche Versuche
wurden gemacht (z.B. Comte), den Wissenschaften eine Rangordnung zu geben, wobei die
Mathematik (insbesondere die Geometrie) zur Königin der Wissenschaften ernannt wurde. Die
Rivalität zeigt sich deutlich in der Konkurrenz um Ehrungen wie Nobelpreise, um Universitätsund Staatshaushalten, um die Stellung in der Gesellschaft und allgemein um das Ansehen bei
Nicht-Wissenschaftlern.
Diese Darstellung könnte den Eindruck erwecken, als plädierte ich ebenfalls für eine völlige
Autonomie der Biologie, mit anderen Worten, als wollte ich die Idee von der Einheit der
Wissenschaft radikal aufgeben und sie durch die Idee zweier getrennter Wissenschaften
ersetzen, den exakten und den biologischen Wissenschaften. Doch das ist keineswegs meine
Absicht. Ich möchte lediglich geltend machen, daß die Physik kein geeigneter Maßstab für die
Bewertung der Naturwissenschaft ist. Sie ist für diese Rolle sogar höchst ungeeignet, da, wie
der Physiker Eugene Wigner sehr richtig festgestellt hat, „die heutige Physik sich mit einem
Grenzfall befaßt". Unter Anwendung einer Analogie kann man sagen, die Physik entspreche
der euklidischen Geometrie, die der Grenzfall aller Geometrien (einschließlich der
nichteuklidischen) ist. Niemand hat diese Situation treffender beschrieben als G.G.Simpson
(1964b, S. 106-107): „Darauf zu bestehen, daß das Studium der lebenden Welt zusätzliche
Prinzipien außer denen der Physik erfordert, bedeutet keine dualistische oder vitalistische
Auffassung der Natur. Das Leben wird dadurch nicht zwangsläufig als nichtphysikalisch oder
nichtmateriell angesehen. Es ist einfach so, daß die Lebewesen seit Milliarden von Jahren
durch geschichtliche Prozesse beeinflußt worden sind. Das Ergebnis dieser Prozesse sind
qualitativ von allen nicht lebenden Systemen verschiedene und fast unvergleichlich
kompliziertere Systeme. Daraus folgt nicht zwangsläufig, daß sie darum ihrer Natur nach auch
nur im geringsten weniger materiell oder weniger physikalisch sind. Der springende Punkt ist,
daß alle bekannten materiellen Prozesse und erklärenden Prinzipien auf die Organismen
zutreffen, während nur eine begrenzte Zahl von ihnen für nichtmaterielle Systeme gilt. Die
Biologie ist dann also die Wissenschaft, die sich im Herzen aller Wissenschaft befindet. Und
hier in dieser Disziplin, in der die Prinzipien aller Wissenschaften verkörpert sind, kann die
Wissenschaft wahrhaft vereinigt werden."
Die Einsicht, daß wir es in der Biologie mit Erscheinungen zu tun haben, die bei unbelebten
Objekten unbekannt sind, ist keineswegs neu. Seit Aristoteles ist die Geschichte der
Wissenschaft eine Geschichte der Bemühungen gewesen, die Autonomie der Biologie geltend
zu machen, wie auch der Versuche, gegen den Strom oberflächlicher
mechanistischquantitativer Erklärungen anzukämpfen. Doch jedesmal, wenn Naturbeobachter
und andere Biologen wie auch einige Philosophen die Bedeutung von Qualität, Einzigartigkeit
und Geschichte in der Biologie betonten, wurden ihre Bemühungen ins Lächerliche gezogen
und einfach als „schlechte Wissenschaft" beiseitegelegt. Dieses Los widerfuhr sogar Kant, der
in seiner Kritik der Urteilskraft (1790) überzeugend argumentierte, die Biologie unterscheide
sich von der Physik, und lebende Organismen unterschieden sich von unbelebten Objekten [4].
Leider wurden solche Versuche häufig als Vitalismus und somit als außerhalb der Grenzen der
Wissenschaft liegend abgetan. Erst in der jüngsten Generation, d.h. nach der endgültigen
Absage an jeden echten Vitalismus, beginnt man die Forderungen nach Autonomie der
Biologie ernst zu nehmen.
Es zeigt sich immer deutlicher, daß es uns nicht möglich sein wird, allgemein gültige
Feststellungen über die Wissenschaft im allgemeinen zu treffen, bevor wir nicht die
verschiedenen Wissenschaften miteinander verglichen und ihre Gemeinsamkeiten und
Unterschiede herauskristallisiert haben.
Wie und warum ist die Biologie verschieden?
Das Wort „Biologie" ist eine Schöpfung des 19. Jahrhunderts. Vorher gab es keine solche
Wissenschaft. Als Bacon, Descartes, Leibniz und Kant über Wissenschaft und Methode
schrieben, existierte Biologie als solche noch nicht, man kannte lediglich Medizin
(einschließlich Anatomie und Physiologie), Naturgeschichte und Botanik (ein ziemliches
Gemisch). Anatomie, d.h. das Sezieren des menschlichen Körpers, war bis weit in das 18.
Jahrhundert hinein ein Zweig der Medizin, und auch Botanik wurde in erster Linie von Ärzten
betrieben, die sich für Heilkräuter interessierten. Die Naturgeschichte der Tiere wurde
hauptsächlich als Teil der Naturtheologie erforscht, um den Gottesbeweis zu untermauern. Die
Revolution in der Physik und verwandten Naturwissenschaften hatte die Biologie praktisch
unberührt gelassen. Die wichtigsten Innovationen im biologischen Denken fanden erst im 19.
und 20. Jahrhundert statt. Es überrascht daher keineswegs, daß sich die
Wissenschaftsphilosophie, als sie sich im 17. und 18. Jahrhundert herausbildete, ausschließlich
auf die Physik gründete, und es später sehr schwierig gewesen ist, sie derart umzugestalten,
daß sie auch die Biologie mit einschließt. Erst in den letzten Jahrzehnten haben mehrere
Philosophen (u.a. Scriven, Beckner, Hull und Campbell) die Unterschiede zwischen Biologie
und Physik und verwandten Naturwissenschaften zu definieren versucht (Ayala, 1968). Das
Nachdenken über dieses Problem ist noch derart neu, daß man nur provisorische Feststellungen
treffen kann. Die folgende Erörterung dient mehr dem Zweck, das Wesen des Problems zu
umreißen als definitive Lösungen zu liefern.
Gesetze in der Physik und in der Biologie
In der exakten Wissenschaft spielen Gesetze eine wichtige erklärende Rolle. Ein
Geschehnis gilt als erklärt, wenn sich zeigen läßt, daß es durch besondere ursächliche Faktoren
bedingt ist, die mit allgemeinen Gesetzen vereinbar sind. Einige Philosophen haben die
Aufstellung von Gesetzen als das diagnostische Kriterion der Wissenschaft bezeichnet. Man
betrachtet diese Gesetze als strikt deterministisch, geht also davon aus, daß sie präzise
Voraussagen erlauben.
In den letzten Jahren ist die Frage aufgeworfen worden, ob Gesetze in der Biologie ebenso
wichtig sind, wie sie es in der Physik zu sein scheinen. Einige Philosophen, wie Smart (1963;
1968), sind so weit gegangen, zu leugnen, daß es in der Biologie überhaupt universelle Gesetze
gibt, wie sie für die Physik charakteristisch sind. Andere Philosophen, wie Ruse (1973) und in
geringerem Maße auch Hull (1974), haben die Existenz biologischer Gesetze mit Nachdruck
verteidigt. Die Biologen haben dieser Diskussion allerdings praktisch keinerlei
Aufmerksamkeit geschenkt, was darauf schließen läßt, daß diese Frage für den praktizierenden
Biologen von geringer Bedeutung ist.
Blickt man auf die Geschichte der Biologie zurück, so stellt man fest, daß im 19.
Jahrhundert Autoren wie Lamarck, Agassiz, Darwin, Haeckel, Cope und die meisten ihrer
Zeitgenossen sich häufig auf Gesetze bezogen. Wenn man jedoch ein modernes Lehrbuch,
gleichgültig für welchen Zweig der Biologie, durchblättert, so findet man den Ausdruck
„Gesetz" vielleicht nicht einmal ein einziges Mal. Das heißt nicht, daß es in der Biologie keine
Regelmäßigkeiten gibt; es bedeutet lediglich, daß sie entweder zu offenkundig sind, um
erwähnt zu werden, oder aber zu trivial sind. Dies läßt sich gut an den hundert
Evolutions„gesetzen" erläutern, wie Rensch sie aufzählt (1968, S.109-114). Sie beziehen sich
alle auf adaptive Trends, wie sie von der natürlichen Auslese hervorgebracht werden. Bei
einem Großteil von ihnen gibt es gelegentliche oder häufige Ausnahmen, und es sind lediglich
„Regeln", keine universellen Gesetze. Sie haben erklärenden Wert, soweit sie vergangene
Ereignisse betreffen, aber keine voraussagende Bedeutung, außer im statistischen
(probabilistischen) Sinne. Wenn ich sage: „Ein männlicher Singvogel mit Revier hat eine
Chance von 98,7% (oder wie immer die korrekte Zahl lauten mag), einen Eindringling
siegreich zu vertreiben", so kann ich kaum behaupten, ein Gesetz aufgestellt zu haben. Wenn
die Molekularbiologen sagen, daß Proteine keine Information zurück in Nukleinsäuren
übersetzen, so ist das in ihren Augen eine Tatsache und kein Gesetz.
Verallgemeinerungen in der Biologie sind fast ausschließlich probabilistischer Natur. Mit
den Worten eines Witzbolds ausgedrückt, gibt es in der Biologie überhaupt nur einziges
allgemeines Gesetz, nämlich: „Kein biologisches Gesetz ohne Ausnahme!" Diese
probabilistische Auffassung steht in krassem Gegensatz zu der während der Anfänge der
wissenschaftlichen Revolution geltenden Ansicht, derzufolge die Kausalität in der Natur von
Gesetzen geregelt wird, die sich in mathematischer Form ausdrücken lassen. Tatsächlich
scheint diese Idee von Pythagoras zu stammen. Sie ist, insbesondere in der Physik, bis zum
heutigen Tag vorherrschend geblieben. Immer wieder ist die mathematische Methodik zur
Grundlage einer umfassenden Philosophie gemacht worden, hat aber in der Hand der
verschiedenen Autoren sehr unterschiedliche Gestalt angenommen. Bei Platon hat sie den
Essentialismus entstehen lassen, bei Galilei ein mechanistisches Weltbild und bei Descartes die
deduktive Methode. Alle drei Philosophen hatten einen tiefgreifenden Einfluß auf die Biologie.
Platons Denken war das eines Gelehrten, der sich mit Geometrie beschäftigt: Ein Dreieck,
gleichgültig, welches die Kombination seiner Winkel, hat immer die Form eines Dreiecks und
ist somit diskontinuierlich anders als ein Viereck oder ein anderes Vieleck. Analog dazu war
die veränderliche Welt der Phänomene für Platon nichts anderes als die Widerspiegelung einer
begrenzten Zahl von beständigen und unveränderlichen Formen, eide (wie er sie nannte) oder
Wesenheiten (Essenzen), wie sie von den Thomisten im Mittelalter genannt wurden. Diese
Wesenheiten sind das, was auf dieser Welt wirklich und wichtig ist. Als Ideen können sie
unabhängig von allen Objekten bestehen. Besonderes Gewicht legen die Essentialisten auf
Konstanz und Diskontinuität. Variation entsteht für sie durch unvollkommene Manifestation
der zugrunde liegenden Essenzen. Diese Vorstellung war die Grundlage nicht nur für den
Realismus der Thomisten, sondern auch für den sogenannten Idealismus oder für den
Positivismus späterer Philosophen bis ins 20. Jahrhundert hinein. Whitehead, der eine
sonderbare Mischung von Mathematiker und Mystiker war (vielleicht sollte man ihn
Pythagoreer nennen), sagte einmal: „Die treffendste allgemeine Beschreibung der europäischen
philosophischen Tradition ist, daß sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht." Diese
Behauptung, soweit sie überhaupt wahr ist, war zweifellos als Lob gemeint, bedeutete in
Wirklichkeit jedoch eine Verurteilung, denn eigentlich besagt sie, daß die europäische
Philosophie während all der Jahrhunderte nicht in der Lage war, sich aus der Zwangsjacke des
platonischen Essentialismus zu befreien. Der Essentialismus mit seiner Betonung von
Diskontinuität, Konstanz und typischen Werten („Typologie") beherrschte das abendländische
Denken in einem Ausmaß, das von den Ideengeschichtlern immer noch nicht in vollem
Umfang gewürdigt wird. Darwin, einer der ersten Denker, der den Essentialismus (wenigstens
zum Teil) ablehnte, wurde von den zeitgenössischen Philosophen (die alle Essentialisten
waren) überhaupt nicht verstanden, und seine These von der Evolution durch natürliche
Selektion daher als unannehmbar befunden. In essentialistischer Sicht ist eine echte
Veränderung nur durch saltationistische, sprunghafte Entstehung neuer Wesenheiten möglich.
Da die Evolution, wie Darwin sie erklärt, zwangsläufig allmählich, in fast unmerklichen
Schritten erfolgt, ist sie mit dem Essentialismus absolut unvereinbar. Andererseits aber paßte
die Philosophie des Essentialismus gut mit dem Denken der Physiker zusammen, deren
„Klassen" aus identischen Entitäten (Einheiten) bestehen, gleichgültig, ob es sich dabei um
Natriumatome, Protonen oder Pi-Mesonen handelt.
Auch für Galilei war die Geometrie der Schlüssel zum Verständnis der Naturgesetze. Doch
wandte er sie weitaus mathematischer an als Platon: „Die Philosophie steht in diesem
großartigen Buch, dem Universum, geschrieben, das aufgeschlagen vor unseren Augen liegt.
Aber das Buch läßt sich nicht verstehen, solange man nicht zuerst die Sprache, in der es
gedruckt ist, verstehen, und die Buchstaben lesen lernt. Es ist in der Sprache der Mathematik
geschrieben, und seine Schriftzeichen sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren,
ohne die es menschenunmöglich ist, auch nur ein einziges Wort des Buches zu verstehen; ohne
diese irrt man in einem dunklen Labyrinth umher" (Der Goldwäger, 1623). Er betrachtete
jedoch nicht nur die Geometrie als grundlegend, sondern alle Aspekte der Mathematik und
insbesondere jede Art der Quantifizierung von Messungen.
Die „Mechanisierung des Weltbildes", die Vorstellung von einer in hohem Grade
geordneten Welt, die man erwarten würde, wenn sie von einem Schöpfer dazu entworfen
worden war, einer begrenzten Menge ewiger Gesetze zu gehorchen (Maier, 1938; Dijksterhuis,
1961), machte in den darauf folgenden Jahrhunderten rasche Fortschritte und erreichte ihren
größten Triumph in Newtons Vereinigung der Erd- und Himmelsmechanik. Diese glänzenden
Erfolge verliehen der Mathematik ein nahezu unbegrenztes Ansehen. Das veranlaßte Kant zu
seinem berühmten – oder berüchtigten – Ausspruch, demzufolge „in jeder besonderen
Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin
Mathematik anzutreffen ist". Wenn dies wahr wäre, welchen Platz würde dann Darwins Origin
of Species als wissenschaftliches Werk einnehmen? Es verwundert keineswegs, daß Darwin
eine relativ schlechte Meinung von der Mathematik hatte (Hull, 1973, S.12). Der blinde Glaube
an die Magie der Zahlen und Mengen erreichte seinen Höhepunkt vielleicht in der Mitte des
19. Jahrhunderts. Selbst ein so scharfsinniger Denker wie Merz (1896) meinte: „Die moderne
Wissenschaft bestimmt die Methode, nicht das Ziel ihrer Arbeit. Sie beruht auf dem Zählen
und Rechnen – kurz gesagt, auf mathematischen Verfahren; und der Fortschritt der
Wissenschaft hängt ebenso stark davon ab, daß mathematische Begriffe auf Gebiete angewandt
werden, die allem Anschein nach nicht mathematischer Natur sind, wie von der
Fortentwicklung mathematischer Methoden und Begriffe selbst."
Diese Behauptung ist von Ghiselin (1969, S.21) eindeutig widerlegt worden. Trotzdem
klammern sich die aus der Mathematik oder Physik kommenden Philosophen immer noch an
den Mythos von der Mathematik als der Königin der Wissenschaften. So behauptete z.B. der
Mathematiker Jacob Bronowski (1960, S.218): „Bis heute ist unser Vertrauen in eine
Wissenschaft, grob gesehen, proportional zu der Menge an Mathematik, die sie verwendet. Wir
haben das Gefühl, die Physik sei wirklich eine Wissenschaft, wohingegen der Chemie
irgendwie der weniger formale Geruch (oder Makel) des Kochbuches anhafte. Und wenn wir
weitergehen zur Biologie, dann zur Ökonomie und zuletzt zu den Sozialwissenschaften, so
merken wir, daß wir rasch einen Abhang hinunterrutschen, fort von der Wissenschaft." Hier
werden qualitative und historische Wissenschaften sowie solche, deren Komplexheit sie
mathematischer Formulierung entzieht, falsch eingestuft. Das kulminiert in der arroganten
Behauptung, die Biologie sei eine zweitrangige Wissenschaft. Die Folge waren oberflächliche
und völlig irreführende mathematische Erklärungen in verschiedensten Bereichen der Biologie.
Niemand war von der Bedeutung der Mathematik stärker beeindruckt als Descartes, aber
diese Bewunderung wirkte sich auf sein Denken völlig anders aus als auf Galilei oder Newton.
Descartes war beeindruckt von der Strenge der mathematischen Beweise und von der
Sicherheit, mit der die Schlußfolgerungen aus eindeutigen Aussagen hervorgehen. Er ging so
weit zu behaupten, die Gesetze der Mathematik seien von Gott in gleicher Weise verfügt
worden, wie ein König in seinem Königreich Gesetze erläßt. Descartes entwickelte eine Logik,
bei der die Methoden der Mathematik in strikt deduktiver Weise zum Erwerb rationalen
Wissens benutzt wurden. Es war eher die Denkstruktur, die mathematisch war, als daß es sich
um eine Sprache der Gleichungen und mathematischen Formeln handelte. Trotzdem
begünstigte sie strikt deterministische Erklärungen und essentialistisches Denken. Leibniz, der
Descartes' Methode anwandte, war der Begründer der mathematischen Logik.
So überwältigend die Herrschaft der Mathematik über die Naturwissenschaften auch
mehrere Jahrhunderte lang war, so gab es doch fast von Anfang an andere Meinungen. Pierre
Bayle (1647-1706) war anscheinend der erste, der die Behauptung zurückwies, mathematisches
Wissen sei die einzige Art von Wissas, die durch die wissenschaftliche Methode erreichbar sei.
Er machte geltend, daß zum Beispiel die historische Gewißheit nicht weniger wert, sondern
lediglich anders als die mathematische Gewißheit sei. Historische Fakten, etwa die Tatsache,
daß es das römische Reich gegeben habe, seien ebenso sicher und unbezweifelbar wie
irgendeine mathematische Aussage. Desgleichen würde ein Biologe darauf bestehen, daß die
Existenz von Dinosauriern und Trilobiten in der Frühgeschichte ebenso gewiß sei wie jedes
mathematische Theorem. Ein weiterer Autor, der einen vernichtenden Angriff auf Descartes'
mathematischgeometrische Auslegungen der Welt führte, war Giambattista Vico. Er vertrat die
Ansicht, die Methoden der Beobachtung, Klassifizierung und Hypothese seien in der Tat in der
Lage, ein echtes, wenn auch bescheidenes „äußeres" Wissen der materiellen Welt zu
vermitteln.
Die Naturgeschichte war eine zweite Quelle der Rebellion gegen Galileis mathematisches
Ideal der Wissenschaft. Vor allem Buffon betonte nachdrücklich {Oeuvr. Phil, S.26), einige
Fragen seien für eine sinnvolle Anwendung der Mathematik weitaus zu kompliziert. Zu diesen
Fragen gehörten seiner Ansicht nach alle Aspekte der Naturgeschichte. Hier seien Beobachtung
und Vergleich die geeigneten Methoden. Buffons Histoire Naturelle hatte ihrerseits einen
entscheidenden Einfluß auf Herder und über ihn auf die Romantiker und die Naturphilosophie.
Selbst Kant hatte sich um 1790 herum von der Hörigkeit von der Mathematik losgesagt. Wenn
die Ungültigkeit des mathematischen Wissenschaftsideals nicht schon vorher auf der Hand
gelegen hatte, so wurde sie mit der Veröffentlichung von Darwins Origin of Species über alle
Zweifel hinaus deutlich.
Nebenbei sei erwähnt, wie irreführend der Beiname „Königin der Wissenschaften" für die
Mathematik ist. Denn natürlich ist Mathematik ebenso wenig eine Wissenschaft, wie
Grammatik eine Sprache ist (wie etwa Latein oder Russisch); die Mathematik ist eine Sprache,
die es, wenn auch in sehr unterschiedlichem Grad, mit allen Wissenschaften zu tun hat, oder
aber mit keiner. Es gibt einige Wissenschaften (wie die Physik und verwandte
Naturwissenschaften sowie ein Gutteil der funktionalen Biologie), bei denen die
Quantifizierung oder andere mathematische Ansätze einen hohen erklärenden oder
heuristischen Wert haben. Es gibt andere Wissenschaften, wie die Systematik und ein Großteil
der Evolutionsbiologie, bei denen der Beitrag der Mathematik recht gering ist.
In der Tat hat eine unkluge Anwendung der Mathematik in diesen Zweigen der Biologie
gelegentlich zu typologischem Denken und somit zu falschen Auffassungen geführt. Der
Genetiker Johannsen, zum Beispiel, unterlag dieser Versuchung und „vereinfachte" genetisch
variable Populationen zu „reinen Linien", wobei die wahre Bedeutung des Begriffes
„Population" verloren ging und er zu falschen Schlüssen über die Bedeutung der natürlichen
Auslese gelangte. Um überhaupt Mathematik anwenden zu können, haben auch die Begründer
der mathematischen Populationsgenetik die Faktoren zu stark vereinfacht, die in ihre Formeln
eingingen. Die Folge davon war eine Betonung der absoluten Fitnesswerte von Genen, eine
Überbewertung additiver Geneffekte sowie die Annahme, die natürliche Auslese setze nicht am
Individuum, sondern vielmehr am Gen an. Dies hat zwangsläufig zu unrealistischen Resultaten
geführt.
Als Darwin ausrechnete, die Erde müsse mehr als eine Milliarde Jahre alt sein, damit die
Phänomene der Geologie und Phylogenie erklärbar seien, stellte Lord Kelvin aufgrund von
Berechnungen des Wärmeverlustes einer Kugel von der Größe der Sonne mit Nachdruck fest,
Darwin habe unrecht: 24 Millionen Jahre seien das Höchstalter, das er der Erde zugestehen
könne (Burchfield, 1975). Es ist geradezu amüsant, mit welcher Sicherheit Kelvin annahm,
seine Altersbestimmungen seien richtig und die der Naturforscher falsch. Da die Biologie eine
zweitrangige Wissenschaft war, konnte es keinen Zweifel geben, wo der Fehler lag. Kelvin
räumte nie auch nur die Möglichkeit ein, dass es vielleicht einen unbekannten physikalischen
Faktor geben könne, der schließlich die Schätzungen der Biologen bestätigen würde. In diesem
geistigen Klima taten die Biologen ihr Möglichstes, um ihre Ergebnisse in Form einfacher
Physik
zu
interpretieren.
Weismann
(in
seinen
frühen
Werken)
machte
„Molekularbewegungen" und Bateson „Wirbelbewegungen" für die Vererbung verantwortlich
– Erklärungen, die einfach den wissenschaftlichen Fortschritt verzögerten.
Dies Bild hat sich in den letzten fünfzig Jahren recht drastisch verändert. Es gibt keinen
scharfen Gegensatz mehr zwischen der Indeterminiertheit der meisten strikt biologischen
Prozesse und einer strikten Determiniertheit physikalischer Vorgänge. Das Studium der
Auswirkungen von Turbulenzen in Galaxien und kosmischen Nebeln wie auch in den
Meeresströmungen und Wettersystemen hat gezeigt, wie häufig und wie gewaltig stochastische
Prozesse in der unbelebten Natur sind. Dieses Ergebnis war für einige Physiker inakzeptabel
und hat Einstein beispielsweise zu dem Ausruf veranlaßt: „Gott * spielt doch keine
Glücksspiele!" Nichtsdestoweniger kommen stochastische Prozesse auf jeder Hierarchiestufe
vor, und zwar vom Atomkern bis hin zu den Systemen, wie sie aus dem Urknall
hervorgegangen sind. Zwar sind bei stochastischen Prozessen keine absoluten Voraussagen
möglich, das heißt, jegliche Voraussage ist probabilistisch (oder unmöglich), dennoch sind
diese Prozesse ebenso kausal wie deterministische Prozesse. Lediglich absolute Vorhersagen
sind unmöglich, wegen der Komplexität der hierarchischen Systeme, der Vielzahl möglicher
Entscheidungen bei jedem Schritt und der zahlreichen Wechselwirkungen gleichzeitiger
Vorgänge. Wettersysteme und kosmische Nebel unterscheiden sich in dieser Beziehung nicht
prinzipiell von lebenden Systemen. Die Zahl potentiell möglicher gegenseitiger
Beeinflussungen in derartig hochkomplexen Systemen ist bei weitem zu groß, um Vorhersagen
darüber zu erlauben, welche von ihnen tatsächlich eintreten wird. Wissenschaftler, die auf dem
Gebiet der natürlichen Auslese und anderer Evolutionsprozesse, der Quantenmechanik und der
Astrophysik arbeiten, sind zu verschiedenen Zeitpunkten und mehr oder weniger unabhängig
voneinander zu diesem Schluß gekommen.
Aus all diesen Gründen ist die Physik nicht mehr länger das Maß der Naturwissenschaft.
Insbesondere, wenn es um die Erforschung des Menschen geht, ist die Biologie diejenige
Disziplin, die Methode und Begriffe liefert. Ein französischer Staatspräsident hat dieser
Überzeugung vor kurzem mit den folgenden Worten Ausdruck verliehen: „Es ist keine Frage,
daß die Mathematik, Physik und andere Naturwissenschaften, die man ziemlich unüberlegt als
„exakte Wissenschaften" bezeichnet, weiterhin überraschende Entdeckungen liefern werden -,
doch kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, daß die wirkliche wissenschaftliche
Revolution der Zukunft aus der Biologie kommen muß."
Begriffe in der Biologie
Statt Gesetze zu formulieren, ordnen Biologen ihre Verallgemeinerungen gewöhnlich in
einen Begriffsrahmen ein. Es ist behauptet worden, der Unterschied zwischen Gesetzen und
Begriffen sei lediglich formaler Natur, da sich jeder Begriff in ein Gesetz oder mehrere
Gesetze übersetzen ließe. Selbst wenn dies formal richtig wäre, wovon ich keineswegs
überzeugt bin, würde eine derartige „Übersetzung" dem Biologen bei der praktischen
Durchführung seiner biologischen Forschungstätigkeit nicht weiterhelfen. Dem Gesetz fehlt die
Flexibilität und heuristische Brauchbarkeit des Begriffs.
Der Fortschritt in der Biologie ist vielleicht weitgehend eine Frage der Entwicklung dieser
Begriffe oder Prinzipien. Der Fortschritt in der Systematik war durch das Herauskristallisieren
und Verfeinern von Begriffen wie Klassifikation, Art, Kategorie, Taxon usw. gekennzeichnet;
in der Evolutionslehre durch die Weiterentwicklung von Begriffen wie Abstammung, Auslese
und Fitness; ähnliche Schlüsselbegriffe lassen sich für jeden Zweig der Biologie anführen [5].
Der wissenschaftliche Fortschritt besteht im Herausbilden neuer Vorstellungen (wie Auslese
oder biologische Art) und der immer wiederholten Verfeinerung der Definitionen, mit denen
diese Ideen ausgedrückt werden. Besonders wichtig ist die gelegentliche Einsicht, daß ein mehr
oder weniger technischer Ausdruck, von dem man angenommen hatte, er kennzeichne oder
bezeichne einen bestimmten Begriff, in Wirklichkeit für eine Mischung von zwei oder mehr
Begriffen benutzt worden ist, etwa der Ausdruck „Isolation" für geographische und
reproduktive Isolation, oder „Varietät" (zum Beispiel wie Darwin das Wort benutzte) für
Individuen und Populationen, oder „teleologisch" für vier verschiedene Erscheinungen.
Es ist Seltsam, wie wenig Aufmerksamkeit die Wissenschaftsphilosophie bisher der
überwältigenden Bedeutung der Begriffe geschenkt hat. Aus diesem Grunde sind wir heute
noch nicht in der Lage, im Einzelnen zu beschreiben, wie der Verlauf von der Entdeckung, d.
h. vom ersten Auftreten eines Begriffs bis zu seinem Ausreifen aussieht. So viel jedoch liegt
auf der Hand, daß die wichtigste Leistung, mit der die führenden Köpfe in der Biologie zu ihrer
Wissenschaft beigetragen haben, die Entwicklung und Verfeinerung von Begriffen,
gelegentlich auch die Abschaffung falscher Begriffe gewesen ist. Die Evolutionsbiologie
verdankt einen bemerkenswert großen Teil ihrer Begriffe Charles Darwin und die Ethologie
Konrad Lorenz.
Die Geschichte der Begriffe, die bisher so stark vernachlässigt worden ist, steckt voller
Überraschungen. Die Termini „Affinität" oder „Verwandtschaft", wie sie vor der
Evolutionslehre in der Systematik benutzt wurden, um nicht viel mehr als einfache Ähnlichkeit
zu bezeichnen, wurden nach 1859 zur „Abstammungsnähe", ohne daß dies irgendwelche
Verwirrungen oder Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte. Andererseits führte Hennigs
Versuch, dem Ausdruck „monophyletisch", zuvor zur Beschreibung einer taxonomischen
Gruppe benutzt, die Bedeutung einer Beschreibung eines Abstammungsweges zu geben, zu
schmerzlichen Umwälzungen in der Taxonomie. Das Studium der Begriffe bringt zudem
manchmal schwerwiegende terminologische Mängel in einer Sprache zum Vorschein. Für den
englischen Ausdruck „resource" beispielsweise, der für die Ökologie so wichtig ist (Aufteilung
von, Konkurrenz um usw.), gab es im Deutschen kein Äquivalent, bis er schließlich als
„Ressource" eingedeutscht wurde.
Es gibt Begriffe unterschiedlichster Art. Die Biologie hat zum Beispiel viel von einer
Verfeinerung quasiphilosophischer oder methodologischer Begriffe (wie unmittelbare und
evolutionäre Ursachen) oder von der deutlichen Abgrenzung der vergleichenden von der
experimentierenden Methode profitiert. Die Anerkennung der Existenz der vergleichenden
Methode bedeutete die Einführung eines neuen Begriffes in die Biologie.
Besonders groß sind die Schwierigkeiten in einer Wissenschaft, wenn ein wirklich neuer
Begriff eingeführt wird. Dies war zum Beispiel der Fall bei Einführung des
Populationsdenkens anstelle von Platons Essenzbegriff, oder bei der Einführung von Begriffen
wie Auslese oder wie (geschlossene bzw. offene) genetische Programme. Zum Teil war es das,
was Kuhn meinte, als er von wissenschaftlichen Revolutionen sprach.
Gelegentlich
hat
einfach
die Einführung eines
neuen Ausdrucks
wie
„Isolationsmechanismen", „Taxon" oder „teleonomisch" viel dazu beigetragen, eine zuvor
unklare begriffliche Situation zu bereinigen. Häufiger jedoch mußte zunächst der begriffliche
Morast beseitigt werden, bevor die Einführung einer neuen Terminologie überhaupt Erfolg
haben konnte. Dies gilt für Johannsens Ausdrücke „Genotypus" und „Phänotypus" (wenngleich
Johannsen selbst von Zeit zu Zeit durcheinander kam: s.Roll-Hansen, 1978 a).
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, daß derselbe Ausdruck in verschiedenen
Wissenschaften, oder sogar in verschiedenen Fachrichtungen derselben Wissenschaft, für
verschiedene Begriffe benutzt werden kann. Der Ausdruck „Evolution" hatte für die
Embryologen des 18. Jahrhunderts (Bonnet) oder für Louis Agassiz (1874) eine völlig andere
Bedeutung als für die Darwinisten; ebenso bedeutete er für die meisten Anthropologen
(zumindest jene, die direkt oder indirekt von Herbert Spencer beeinflußt waren) etwas ganz
anderes als für Anhänger der Selektionstheorie. Viele berühmte Kontroversen in der
Geschichte der Wissenschaft gingen fast ausschließlich darauf zurück, daß die Gegner mit
demselben Ausdruck völlig verschiedene Dinge meinten.
In der Geschichte der Biologie hat sich die Formulierung von Definitionen häufig als recht
schwierig erwiesen, und die meisten Definitionen sind wiederholt umformuliert worden. Dies
ist insofern nicht verwunderlich, als Definitionen zeitbedingte Formulierungen von Begriffen
sind, und Begriffe – insbesondere schwierige Begriffe – werden gewöhnlich häufig revidiert, je
mehr unser Wissen und Verständnis wächst. Dies läßt sich an den Definitionen solcher
Begriffe wie Art, Mutation, Territorium, Gen, Individuum, Adaptation und Fitness zeigen.
Ein sehr wichtiger methodologischer Aspekt der Wissenschaft wird häufig falsch verstanden
und gehört zu den Hauptgründen für Kontroversen über Begriffe wie Homologie oder
Klassifikation. Das ist der Zusammenhang zwischen einer Definition und dem Beweis, daß die
Definition in einem bestimmten Fall zutrifft (Simpson, 1961, S.68-70). Am besten läßt sich das
anhand eines Beispiels zeigen: Der Ausdruck „homolog" war bereits vor 1859 bekannt, aber er
erhielt seine heute gültige Bedeutung erst, nachdem Darwin die Theorie der gemeinsamen
Abstammung aufgestellt hatte. In dieser Theorie ist die biologisch sinnvollste Definition von
„homolog" folgende: „Ein Merkmal in zwei oder mehr Taxa ist homolog, wenn es von
demselben (oder einem entsprechenden) Merkmal ihrer gemeinsamen Vorfahren abgeleitet
ist." Welcher Art ist das Beweismaterial, anhand dessen man in einem gegebenen Fall eine
wahrscheinliche Homologie aufzeigen kann? Es gibt eine ganze Reihe solcher Kriterien (wie
die Lage einer Struktur in Beziehung zu anderen Strukturen), aber es ist völlig irreführend,
derartiges Beweismaterial in die Definition des Wortes „homolog" aufzunehmen, wie einige
Autoren das getan haben. Die gleiche Beziehung zwischen Definition und dem Beweis, daß die
Definition zutrifft, besteht bei der Definition praktisch aller in der Biologie gebrauchten
Fachausdrücke. Zum Beispiel kann ein Autor versuchen, eine „phylogenetische Klassifikation"
vorzunehmen, sich dabei aber völlig auf morphologische Beweise stützen, um eine
Verwandtschaft abzuleiten. Dadurch wird diese Klassifikation nicht zu einer morphologischen.
Die heutzutage am weitesten akzeptierte Definition des Begriffes Art enthält das Kriterium der
Fortpflanzungsgemeinschaft („interbreeding"). Ein Paläontologe kann dieses „interbreeding" in
seinem Fossilienmaterial nicht nachweisen, aber er kann gewöhnlich mehrere andere Arten von
Beweisen zusammentragen (Zusammenleben, Ähnlichkeit usw.), um die Wahrscheinlichkeit
der Zugehörigkeit zu derselben Art zu untermauern. Eine Definition drückt einen Begriff aus,
braucht aber nicht den Beweis einzuschließen, daß die Definition zutrifft.
Im folgenden möchte ich nun einige der Begriffe erörtern, die in der Biologie von
besonderer Bedeutung sind.
Populationsdenken kontra Essentialismus
Mehr als zweitausend Jahre lang nach Platon ist das abendländische Denken von dessen
Essentialismus beherrscht gewesen. Erst im 19. Jahrhundert begann eine neue und andere Art
von Naturphilosophie an Boden zu gewinnen, das sogenannte Populationsdenken. Was ist
Populationsdenken, und wie unterscheidet es sich vom Essentialismus? Die Anhänger des
Populationsdenkens unterstreichen die Einzigartigkeit von allem, was in der organischen Welt
existiert. Wichtig ist für sie das Individuum, nicht der Typus. Sie betonen, daß jedes
Individuum in einer sich geschlechtlich fortpflanzenden Art einzigartig und verschieden von
allen anderen Individuen ist; sogar bei Arten, die sich uniparental fortpflanzen, ist die
Individualität groß. Es gibt keine „typischen" Individuen; Mittelwerte sind Abstraktionen. Was
man früher in der Biologie als „Klassen" bezeichnet hat, sind zum großen Teil Populationen
aus einzigartigen Individuen (Ghiselin, 1974b; Hull, 1975).
Ein Ansatz zum Populationsdenken war bereits in Leibniz' Monadenlehre vorhanden, denn
Leibniz postulierte, jede Monade unterscheide sich als Individuum von jeder anderen Monade
– ein wichtiges Abgehen vom Essentialismus. Aber dieser war so stark in Deutschland, daß der
Leibnizsche Vorschlag zu keinerlei Populationsdenken führte. Als es sich schließlich anderswo
entwickelte, hatte es zwei Wurzeln: Zum einen hatten die englischen Tierzüchter (Bakewell,
Sebright und viele andere) erkannt, daß jedes einzelne Tier in ihren Herden von anderen
verschiedene erbliche Merkmale besaß, und sie suchten auf der Grundlage dieser Merkmale die
Zucht- und Muttertiere für die nächste Generation aus. Die zweite Wurzel war die Systematik.
Alle praktizierenden Naturkundler machten die verblüffende Beobachtung, daß beim Sammeln
einer „Serie" von Exemplaren einer einzigen Art niemals zwei ganz und gar gleich waren.
Nicht nur Darwin hob dies in seiner Arbeit über die Rankenfußkrebse hervor; sogar seine
Kritiker stimmten in diesem Punkt mit ihm überein. Wollaston (1860) schrieb z.B., „unter den
Millionen von Menschen, die in diese Welt hineingeboren wurden, sind, dessen sind wir
gewiß, niemals zwei in jeder Hinsicht genau gleich gewesen; analog dazu ist es nicht
übertrieben, das gleiche von allen lebenden Kreaturen zu behaupten, die jemals existiert haben
(so ähnlich einige von ihnen unserem ungeschulten Auge auch erscheinen mögen)." Ähnlich
lautende Feststellungen wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts von vielen Taxonomen
getroffen. Diese Einzigartigkeit trifft nicht nur auf Individuen zu, sondern sogar auf Stadien im
Lebenszyklus jedes Individuums und ebenso auf Ansammlungen von Individuen, ob dies nun
Deme, Arten oder Pflanzen oder Tiergesellschaften sind. Angesichts der gewaltigen Zahl von
Genen, die in einer gegebenen Zelle entweder an- oder ausgeschaltet werden, ist es gut
möglich, daß noch nicht einmal zwei Zellen eines Körpers völlig identisch sind. Diese
Einzigartigkeit biologischer Individuen bedeutet, daß wir mit einer ganz anderen Einstellung an
Gruppen biologischer Entitäten herangehen müssen, als wenn wir es mit Gruppen identischer
inorganischer Entitäten zu tun haben. Dies ist die Grundbedeutung des Populationsdenkens.
Die Unterschiede zwischen den biologischen Individuen sind real, wohingegen die Mittelwerte,
mit denen wir beim Vergleich von Individuengruppen (beispielsweise Arten) rechnen, vom
Menschen gemachte Ableitungen sind. Dieser grundlegende Unterschied zwischen den Klassen
des Physikers und den Populationen des Biologen hat verschiedene Konsequenzen. Zum
Beispiel ist jemand, der die Einzigartigkeit der Individuen nicht begreift, nicht in der Lage, die
Wirkungsweise der natürlichen Auslese zu verstehen [6].
Die Statistik des Essentialisten ist etwas völlig anderes als die Statistik der
Populationstheoretiker. Wenn wir eine physikalische Konstante messen, etwa die
Lichtgeschwindigkeit, so wissen wir, daß sie unter gleichen Bedingungen konstant ist und daß
jede Abweichung in den Beobachtungsergebnissen durch ungenaue Messung bedingt ist, daß
die Statistik also einfach den Grad der Zuverlässigkeit unserer Ergebnisse angibt. Die frühe
Statistik, von Petty und Graunt bis hin zu Quetelet (Hill, 1973) war essentialistische Statistik,
die zu wahren Werten zu gelangen versuchte, um die verwirrenden Effekte der Variation zu
überwinden. Quetelet, ein Anhänger von Laplace, war an deterministischen Gesetzen
interessiert. Er hoffte, mit seiner Methode in der Lage zu sein, die Merkmale des
„Durchschnittsmenschen" zu berechnen, d.h. die „Essenz" des Menschen zu entdecken.
Variation war nichts anderes als „Fehler" rund um den Mittelwert.
Francis Galton war vielleicht der erste, der völlig klar erkannte, daß der Mittelwert variabler
biologischer Populationen ein Konstrukt ist. Unterschiede in der Körpergröße einer Gruppe
von Menschen sind real und nicht das Ergebnis ungenauer Messungen. Der interessanteste
Parameter in der Statistik natürlicher Populationen ist die tatsächlich vorhandene Variation, ihr
Umfang und ihre Natur. Das Ausmaß der Variation ist von Merkmal zu Merkmal und von Art
zu Art verschieden. Darwin hätte keine Theorie der natürlichen Auslese aufstellen können,
wenn er sich nicht das Populationsdenken zu eigen gemacht hätte. Die maßlosen
Verallgemeinerungen der rassistischen Literatur beruhen fast ausnahmslos auf
essentialistischem (typologischem) Denken.
Ebenso wichtig wie die Einführung neuer Begriffe (wie Populationsdenken) war die
Elimination öder Korrektur falscher Begriffe. Das läßt sich am Begriff der Teleologie sehr gut
zeigen.
Das Problem der Teleologie
Seit Platon, Aristoteles und den Stoikern war der Glaube weitverbreitet (den die Epikuräer
ablehnten), daß es in der Natur und in ihren Abläufen einen Zweck, ein vorherbestimmtes Ziel
gäbe. Die Verfechter dieser Überzeugung im 17. und 18. Jahrhundert – die Teleologen – sahen
den offenkundigen Ausdruck eines Zwecks nicht nur in der scala naturae, die ihren Höhepunkt
im Menschen hat, sondern auch in der vollkommenen Einheit und Harmonie der Natur und
ihren mannigfachen Anpassungen. Eine den Teleologen entgegengesetzte Position nahmen die
Anhänger einer streng mechanistischen Theorie ein, für die das Universum ein nach
Naturgesetzen funktionierender Mechanismus war. Die anscheinende Zweckmäßigkeit des
Universums, der zielgerichteten Prozesse in der Entwicklung von Individuen und der
Adaptation von Organen war jedoch zu auffällig, als daß die Anhänger der mechanistischen
Theorie sie übersehen konnten. Wie konnte ein Mechanismus lediglich aufgrund von Gesetzen,
ohne Rückgriff auf finale (auf einen Endzweck gerichtete) Ursachen all diese Eigenschaften
besitzen? Niemand erkannte dieses Dilemma vielleicht klarer als Kant. Während des ganzen
19.Jahrhunderts und bis mitten in unsere moderne Zeit hinein blieb für oder gegen die
Teleologie zu sein ein Schlachtruf.
Erst in den letzten 25 Jahren etwa wurde das Problem gelöst. Heute ist klar, daß es in der
Natur scheinbar zielgerichtete Prozesse gibt, die keineswegs im Widerspruch zu einer strikt
physikalischchemischen Erklärung stehen. Die Lösung wurde – wie oft in der Geschichte der
Wissenschaft – dadurch erreicht, daß man ein komplexes Problem in seine Bestandteile
auflöste. Es stellte sich heraus (Mayr, 1974 d), daß der Ausdruck „teleologisch" auf vier
verschiedene Begriffe oder Vorgänge angewandt worden war.
1. Teleonome Vorgänge.
Die
Entdeckung,
daß
es
genetische
Programme
gibt,
machte
es
möglich, eine Klasse teleologischer Erscheinungen mechanistisch zu erklären. Ein
physiologischer Prozeß oder ein Verhalten, das sein Zielgerichtetsein dem Ablaufen eines
Programms verdankt, kann als „teleonom" bezeichnet werden (Pittendrigh, 1958). Alle
individuellen Entwicklungsvorgänge (Ontogenie) sowie auch alle scheinbar zielgerichte
ten Verhaltensweisen von Individuen fallen in diese Kategorie und sind durch zwei
Komponenten charakterisiert: sie werden erstens durch ein Programm gelenkt und sind
zweitens von der Existenz eines Endpunktes oder Ziels abhängig, das in dem das Verhalten
steuernden Programm vorgesehen ist. Dieser Endpunkt kann eine Struktur sein, eine
physiologische Funktion oder ein Fließgleichgewicht, das Erreichen eines neuen
geographischen Standorts oder eine triebbefriedigende Endhandlung. Jedes einzelne Programm
ist das Ergebnis der natürlichen Auslese und wird durch den Auslesewert des erreichten
Endpunktes ununterbrochen angepaßt (Mayr, 1974 d). Aristoteles nannte diese Ursachen
causae finales (Gotthelf, 1976). Unter dem Blickpunkt der Kausalität muß man betonen, daß
sowohl das Programm als auch die das zielsuchende Verhalten auslösenden Reize dem
scheinbar zweckmäßigen Verhalten zeitlich vorangehen. Gewöhnlich existieren mannigfache
Rückkoppelungsmechanismen, die die Genauigkeit des teleonomen Prozesses verbessern; der
wirklich charakteristische Aspekt des teleonomen Verhaltens ist jedoch die Existenz von
Mechanismen, die dieses zielsuchende Verhalten auslösen oder „verursachen". Teleonome
Prozesse sind in der Ontogenie, Physiologie und der Verhaltenslehre von besonderer
Wichtigkeit. Sie gehören in den Bereich der unmittelbaren Ursachen, obgleich die Programme
im Laufe der evolutionären Geschichte erworben wurden. Die Endpunkte erzeugen den
Selektionsdruck, der im Laufe der Geschichte zum Bau des genetischen Programms geführt
hat.
2. Teleomatische Prozesse.
Jeder Prozeß (insbesondere ein Prozeß, der sich auf unbelebte Objekte bezieht), bei dem
ausschließlich infolge physikalischer Gesetze ein bestimmtes Ziel erreicht wird, kann
„teleomatisch" genannt werden (Mayr, 1974 d). Wenn ein fallender Stein seinen Endpunkt, den
Boden, erreicht, so hat dies nichts mit zielsuchendem oder beabsichtigtem oder
programmiertem Verhalten zu tun, sondern gehorcht lediglich dem Gesetz der Schwerkraft.
Das gleiche gilt für einen Fluß, der unbeirrbar zum Ozean fließt. Wenn ein rotglühendes
Eisenstück einen Endzustand erreicht, bei dem seine Temperatur gleich der umgebenden
Temperatur ist, so wird dieser Endpunkt wiederum nur aufgrund eines physikalischen
Gesetzes, des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik, erreicht. Der gesamte Prozeß der
kosmischen Evolution, vom ersten Urknall bis heute, beruht ausnahmslos auf einer Abfolge
von teleomatischen Vorgängen, die von stochastischen Störungen überlagert sind. Die Gesetze
der Schwerkraft und der Thermodynamik gehören zu den Naturgesetzen, die am häufigsten
teleomatische Prozesse bestimmen. Bereits Aristoteles war sich der getrennten Existenz dieser
Klasse von Vorgängen bewußt, er nannte sie von der „Notwendigkeit" verursacht.
3. Angepaßte Systeme.
Die Naturtheologen waren besonders beeindruckt von der Zweckmäßigkeit aller Strukturen,
die für physiologische Funktionen verantwortlich sind: das Herz, das dafür gebaut ist, das Blut
durch den Körper zu pumpen; die Nieren, die dafür gemacht sind, die Nebenprodukte des
Eiweißstoffwechsels zu beseitigen; der Darmtrakt, der für die Verdauung verantwortlich ist
und dem Körper Nährstoffe zu führt, und so weiter. Es war eine von Darwins entscheidensten
Leistungen, zu zeigen, daß die Entstehung und allmähliche Verbesserung dieser Organe mit der
natürlichen Auslese erklärt werden konnte. Es ist daher ratsam, den Ausdruck teleologisch
(„zielgerichtet") nicht zur Bezeichnung von Organen zu benutzen, die ihre Angepaßtheit
einemAuslesevorgang in der Vergangenheit verdanken. Eine Sprache, die Begriffe aus dem
Bereich der Adaptation oder Selektion verwendet, ist hier besser geeignet (Munson,
1971a; Wimsatt, 1972) als eine teleologische Sprache, die unterstellen könnte, es gäbe
orthogenetische Kräfte, die für die Entstehung dieser Organe verantwortlich wären.
Man erforscht angepaßte Systeme, indem man Warum-Fragen stellt. Warum haben die
Venen Klappen? Sherrington (1906, S.235) betonte dies sehr richtig für den Reflex: „Wir
können… keinen wirklichen Gewinn aus dem Studium eines speziellen Typs von Reflex
ziehen, solange wir nicht seinen unmittelbaren Zweck als angepaßten Akt diskutieren
können… Der Zweck eines Reflexes scheint ein ebenso legitimer und notwendiger Gegenstand
der Naturforschung zu sein wie der Zweck der Färbung eines Insekts oder einer Blüte. Und der
Reflex kann für den Physiologen nicht wirklich verständlich sein, solange er sein Ziel nicht
kennt."
4. Kosmische Teleologie.
Aristoteles
war
zu
seinem
Begriff
der
Teleologie
aufgrund
des
Studiums der individuellen Entwicklung gelangt, wo dieser Begriff völlig gerechtfertigt
ist; doch wandte er ihn schließlich auch auf das Universum als Ganzes an. Dies war
zweitausend Jahre vor der Theorie der natürlichen Auslese, und als Aristoteles Fälle von
Anpassung vorfand, konnte er sich nur zwei Alternativen vorstellen: Zufall oder Ab
sicht. Da es kein Zufall sein kann, daß die Backenzähne immer flach und die Schneide
zähne immer scharfkantig sind, muß man den Unterschied einem Zweck zuschreiben.
„Es ist dann also Absicht in dem, was ist, und in dem, was in der Natur geschieht." In
der Tat spiegelt so vieles im Universum scheinbare Absicht wider, daß man eine Endursache
postulieren muß. [7]
Mit der Zeit wurde dieser Begriff der kosmischen Teleologie, insbesondere in Verbindung
mit dem christlichen Dogma, zum vorherrschenden Begriff der Teleologie. Es ist diese
Teleologie, die die moderne Wissenschaft uneingeschränkt ablehnt. Es gibt kein Programm –
und hat es nie gegeben -, das für den Ablauf sowohl der kosmischen als auch der biologischen
Evolution verantwortlich sein könnte. Wenn es den Anschein hat, als gäbe es in der
biologischen Evolution einen Fortschritt, von den Prokaryoten vor 2 oder 3 Milliarden Jahren
zu den höheren Tieren und Pflanzen, so läßt sich dies ausschließlich als Resultat von
Selektionskräften erklären, wie sie aus der Konkurrenz zwischen Individuen und Arten und aus
der Kolonisierung neuer Adaptationszonen entstanden.
Als die natürliche Auslese noch nicht völlig verstanden war, postulierten viele
Evolutionsbiologen von Lamarck bis zu H. F. Osborn und Teilhard de Chardin die Existenz
einer nichtphysikalischen (vielleicht sogar nichtmateriellen) Kraft, die die lebendige Welt
aufwärts und in Richtung immer größerer Vollkommenheit treibe (Orthogenese). Es fiel den
materialistischen Biologen nicht schwer zu zeigen, daß es keinerlei Beweis für eine derartige
Kraft gibt, sowie ferner, daß die Evolution selten Vollkommenheit hervorbringt und daß der
offenkundige Fortschritt in Richtung auf größere Vollkommenheit recht gut durch die
natürliche Auslese erklärt werden kann. Die Geradlinigkeit vieler evolutiver Trends ist durch
zahlreiche Begrenzungen bedingt, die der Reaktion auf Selektionsdrucke durch den Genotypus
und das epigenetische System gesetzt sind.
Eigen (1971) ist in seiner Theorie der Hyperzyklen davon überzeugt, „daß die Evolution des
Lebens… ungeachtet seines indeterministischen Verlaufs als ein unvermeidlicher Prozeß
anzusehen ist." Eigen ist sich völlig bewußt, daß das keine orthogenetische oder
deterministische Theorie ist, denn die von ihm postulierten Vorgänge sind dadurch erklärt, daß
rein stochastische Prozesse immer wieder durch die Selektion ausgerichtet werden.
Mit dieser Aufteilung der Begriffe, die unter dem Ausdruck „teleologisch" zusammengefaßt
worden waren, in vier Gruppen dürfte die Teleologie als Quelle von Kontroversen weitgehend
ausgeschaltet worden sein. Es wäre jedoch zu wünschen, daß die Kenntnis dieser jüngsten
Fortschritte unter Nicht-Biologen weiter verbreitet wäre. Viele Psychologen zum Beispiel
operieren bei der Diskussion von zielgerichtetem Verhalten immer noch mit solch
undefinierbaren Ausdrücken wie „Absichten" und „Bewußtsein", die eine objektive Analyse
unmöglich machen. Da es für uns keine Möglichkeit gibt, festzustellen, welche Tiere (und
Pflanzen) Absichten oder Bewußtsein haben, hilft die Verwendung dieser Ausdrücke bei der
Analyse keinen Schritt weiter, ja, sie stiftet nur Verwirrung. Jeder Fortschritt bei der Lösung
dieser Probleme der Psychologie setzt eine Neufassung der Begriffe Absicht oder Bewußtsein
im Sinne unserer neuen evolutionsbiologischen Einsichten voraus.
Besondere Merkmale der lebenden Organismen
Die Frage, warum die einen Objekte der Natur unbelebt, andere dagegen lebendig sind, und
durch welche besonderen Merkmale sich die lebenden Organismen auszeichnen, hat bereits im
Altertum die Gedanken der Menschen beschäftigt. Seit den Tagen der Epikuräer und seit
Aristoteles bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein hat es immer zwei
gegensätzliche Interpretationen der Lebensphänomene gegeben. Nach der einen, der
mechanistischen Schule, sind Lebewesen nichts anderes als Maschinen, deren Funktionieren
sich mit den Gesetzen der Mechanik, Physik und Chemie erklären läßt. Viele mechanistische
Denker des 17. und 18. Jahrhunderts sahen keinen signifikanten Unterschied zwischen einem
Felsen und einem Lebewesen. Hatten nicht beide die gleichen Merkmale Schwerkraft,
Trägheit, Temperatur und so weiter gemeinsam, und gehorchten sie nicht denselben
physikalischen Kräften? Als Newton sein Schwerkraftgesetz in rein mathematischer Form
aufstellte, postulierten viele seiner Anhänger eine unsichtbare, aber rein materialistische
Schwerkraft zur Erklärung der Planetenbewegungen wie auch der Schwerkraft der Erde. In
analoger Weise riefen einige Biologen eine gleichfalls materialistische und gleichfalls
unsichtbare Kraft (vis viva) zur Erklärung der Lebensprozesse zu Hilfe.
Spätere Autoren glaubten jedoch an eine Lebenskraft außerhalb des Bereiches der
physikalischchemischen Gesetze. Sie setzten damit eine Tradition fort, die bei Aristoteles und
anderen Philosophen der Antike begonnen hatte. Die vitalistische Schule lehnte die
mechanistische Theorie ab und glaubte, in den Lebewesen fänden Prozesse statt, die nicht den
Gesetzen der Physik und Chemie gehorchten. Der Vitalismus hat bis ins 20. Jahrhundert hinein
Anhänger gefunden. Einer der letzten war der Embryologe Hans Driesch. Doch unter den
Biologen wurde der Vitalismus nach den zwanziger und dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts
schließlich fast überall abgelehnt; und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen. Erstens, weil er
durch Zuflucht zu einem unbekannten und vermutlich jenseits menschlicher Erkenntnis
liegenden Faktor tatsächlich den Boden der Wissenschaft verläßt, und zweitens, weil es
schließlich möglich wurde, alle Phänomene im Rahmen der Physik und Chemie zu erklären,
die nach Ansicht der Vitalisten eine vitalistische Erklärung „forderten". Man kann heute zu
Recht feststellen, daß für die Biologen der Vitalismus seit mehr als fünfzig Jahren ein
erledigtes Problem ist. Seltsamerweise hat es während jenes Zeitraums immer noch eine Reihe
von Physikern und Philosophen gegeben, die Vitalisten waren.
Möglich wurde diese Ablehnung des Vitalismus durch die gleichzeitige Ablehnung der sehr
groben Vorstellung, „Tiere seien nichts anderes als Maschinen". Wie Kant in seinen späteren
Jahren, erkannten die meisten Biologen, daß Lebewesen etwas anderes sind als unbelebte
Materie, und daß der Unterschied nicht durch Postulieren einer Vitalkraft, sondern durch eine
recht drastische Änderung der mechanistischen Theorie erklärt werden mußte. Eine solche
neue Theorie beginnt mit der Feststellung, daß es in den Prozessen, Funktionen und Aktivitäten
lebender Organismen nichts gibt, was im Widerspruch zu irgendeinem Gesetz der Physik und
Chemie steht oder außerhalb des Gültigkeitsbereichs dieser Gesetze liegt. Alle Biologen sind
Erz„materialisten" in dem Sinne, daß sie keine übernatürlichen oder immateriellen, sondern
lediglich physikochemische Kräfte anerkennen. Aber sie akzeptieren keineswegs die naive
mechanistische Erklärung des 17. Jahrhunderts und weisen energisch die Vorstellung zurück,
Tiere seien „lediglich" Maschinen. Die Biologen, die Organismen als Ganzes betrachten, heben
hervor, daß Lebewesen viele Merkmale besitzen, für die es in der Welt unbelebter Objekte
keine Parallele gibt. Das in den exakten Wissenschaften vorhandene erklärende
Instrumentarium reicht zur Erklärung komplexer lebender Systeme nicht aus, insbesondere
nicht zur Erklärung des Wechselspiels zwischen historisch erworbener Information und den
Reaktionen dieser genetischen Programme auf die physische Welt. Die Welt der Phänomene
des Lebens ist sehr viel weiter als die der relativ einfachen Erscheinungen, mit denen sich die
Physik und Chemie befaßt. Daher ist es ebenso unmöglich, die Biologie in die Physik mit ein
zu beziehen, wie es unmöglich ist, die Physik in die Geometrie einzubeziehen.
Immer wieder hat man versucht, „Leben" zu definieren. Diese Bemühungen sind ziemlich
zwecklos, besteht doch heute keinerlei Zweifel mehr daran, daß es keine spezielle Substanz,
keinen Gegenstand und keine Kraft gibt, von der man sagen kann sie sei Leben. Doch man
kann definieren, was es bedeutet, zu leben. Ohne Frage besitzen lebende Organismen
bestimmte Attribute, die bei unbelebten Objekten nicht oder nicht in derselben Weise zu finden
sind. Verschiedene Autoren haben verschiedene Merkmale hervorgehoben, es ist mir aber nicht
gelungen, in der Literatur eine angemessene Zusammenstellung solcher Eigenschaften zu
finden. Die von mir hier angeführte Liste ist vermutlich gleichzeitig sowohl unvollständig als
auch etwas redundant. In Ermangelung einer besseren mag sie jedoch zur Veranschaulichung
der Art von Merkmalen dienen, durch die sich lebende Organismen von unbelebter Materie
unterscheiden.
Komplexität und Organisation
Komplexität an sich ist kein grundlegender Unterschied zwischen organischen und
inorganischen Systemen. Es gibt einige hochgradig komplexe unbelebte Systeme (die
Luftmassen des Weltwettersystems oder jede beliebige Galaxie), andererseits gibt es auch eine
ganze Menge relativ einfacher organischer Systeme, z. B. viele Makromoleküle. Systeme
können jeden Grad von Komplexität besitzen, im Durchschnitt jedoch sind die Systeme in der
Welt der Organismen unendlich komplexer als die unbelebter Objekte. Simon (1962) hat
komplexe Systeme definiert als Systeme, in denen „das Ganze mehr ist als die Summe der
Teile, und zwar nicht in einem letzten, metaphysischen Sinne, sondern in dem wichtigen
pragmatischen Sinn, daß auch, wenn die Eigenschaften der Teile und die Gesetze ihres
Wechselspiels gegeben sind, das Ableiten der Eigenschaften des Ganzen keine triviale
Angelegenheit ist." Ich akzeptiere diese Definition mit einer Ausnahme, daß wir nämlich
einige relativ einfache Systeme (das Sonnensystem beispielsweise) auch weiterhin als komplex
ansehen können, selbst wenn es uns gelungen ist, ihre Komplexität zu erklären. Komplexität in
lebenden Systemen existiert auf jeder Ebene, vom Zellkern (mit seinem DNA-Programm) über
die Zelle, über jedes beliebige Organsystem (wie Niere, Leber oder Gehirn), zum Individuum
bis hin zum Ökosystem oder zur Gesellschaft. Lebende Systeme sind ausnahmslos durch
hochkomplizierte Rückkoppelungsmechanismen gekennzeichnet, die in solcher Präzision und
Komplexität in keinem unbelebten System bekannt sind. Sie sind in der Lage, auf externe
Reize zu reagieren, sie besitzen einen Stoffwechsel (d.h. können Energie binden oder
freisetzen) und sie haben die Fähigkeit, zu wachsen und sich zu differenzieren.
Die Komplexität der lebenden Systeme ist nicht willkürlich, sondern im Gegenteil
hochorganisiert. Die meisten Strukturen eines Organismus sind ohne den jeweiligen Rest des
Organismus sinnlos; Flügel, Beine, Köpfe, Nieren können nicht auf sich allein gestellt leben,
sondern nur als Teil des Ganzen. Folglich haben alle Teile eine adaptive Bedeutung und sind
möglicherweise in der Lage, teleonomische Tätigkeiten zu leisten. Eine derartige
wechselseitige Anpassung von Teilen ist in der unbelebten Welt unbekannt. Diese koadaptierte
Funktion von Teilen war bereits Aristoteles bekannt, der sagte: „Da jedes Werkzeug seinen
Zweck hat und ebenso jedes Glied des Körpers, dieser Zweck aber in einer Verrichtung
besteht, so ist klar, daß auch der ganze Leib als Zweck eine umfassende Tätigkeit hat" (De
Partibus I.5.645a 10-15).
Chemische Einzigartigkeit
Lebende Organismen bestehen aus Makromolekülen mit den außergewöhnlichsten
Eigenschaften. Da sind Nukleinsäuren, die in Polypeptide übersetzt werden können; Enzyme,
die in Stoffwechselprozessen als Katalysatoren fungieren; Phosphate, die die Übertragung von
Energie erlauben, und Lipide, die Membranen bauen können. Viele dieser Moleküle sind derart
spezifisch und in so einzigartiger Weise für die Erfüllung einer speziellen Funktion geeignet –
wie das Rhodopsin bei der Photorezeption -, daß sie immer dann vorkommen, wenn diese
spezielle Funktion im Pflanzen- wie auch im Tierreich
_________
* Zitiert nach Über die Glieder der Geschöpfe, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1959, S.44
benötigt wird. Diese organischen Moleküle unterscheiden sich nicht prinzipiell von anderen
Molekülen. Sie sind jedoch weitaus komplexer als die Moleküle mit niedrigem
Molekulargewicht, die gewöhnlich die Bestandteile der unbelebten Natur ausmachen. Die
größeren organischen Makromoleküle finden sich normalerweise nicht in unbelebter Materie.
Qualität
Die physikalische Welt ist eine Welt der Qualifikation (Newtons Bewegungen und Kräfte)
und Massenwirkungen. Im Gegensatz dazu kann man die Welt des Lebens als eine Welt der
Qualitäten beschreiben. Individuelle Unterschiede, Kommunikationssysteme, gespeicherte
Information, Eigenschaften der Makromoleküle, Wechselbeziehungen in Ökosystemen und
viele andere Aspekte der lebenden Organismen sind ihrer Natur nach vorwiegend qualitativ.
Zwar kann man diese qualitativen Aspekte in quantitative übersetzen, doch geht dabei die
wirkliche Bedeutung der entsprechenden biologischen Phänomene verloren, gerade so, als
wollte man ein Gemälde von Rembrandt dadurch beschreiben, daß man die Wellenlängen der
Farben aufzählt, die von jedem Quadratmillimeter des Bildes reflektiert werden.
Ähnlich haben sich immer wieder in der Geschichte der Biologie mutige Versuche,
qualitative biologische Erscheinungen in mathematische Ausdrücke zu übersetzen, letzten
Endes als totale Fehlschläge erwiesen, da sie den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hatten.
Gleicherweise waren frühere Bemühungen (etwa von Galen, Paracelsus und van Helmont), die
Bedeutung der Qualität zu betonen, zum Scheitern verurteilt, da man falsche Parameter
gewählt hatte; immerhin waren es die ersten Schritte in der richtigen Richtung. Die Verfechter
der Quantifizierung betrachten das Anerkennen der Qualität gern als etwas
Unwissenschaftliches oder bestenfalls als etwas rein Deskriptives und Klassifizierendes. Sie
zeigen durch dieses Vorurteil, wie wenig sie das Wesen biologischer Erscheinungen verstehen.
Das Quantifizieren ist in vielen Gebieten der Biologie wichtig, es schließt aber nicht alle
qualitativen Aspekte aus.
Die sind besonders wichtig bei Beziehungsphänomenen, und gerade diese sind in der
lebendigen
Natur
vorherrschend.
Arten,
Klassifikation,
Ökosysteme,
Kommunikationsverhalten, Regulation und beinah jeder andere biologische Vorgang hat mit
Relationsmerkmalen zu tun. In den meisten Fällen lassen sich diese nur qualitativ und nicht
quantitativ ausdrücken.
Einzigartigkeit und Variabilität
In der Biologie hat man es selten mit Klassen identischer Entitäten zu tun, sondern
untersucht fast immer Populationen, die aus einzigartigen Individuen bestehen. Dies gilt für
jede Hierarchieebene, von der Zelle bis hin zum Ökosystem. Viele biologische Erscheinungen,
insbesondere Populationsphänomene, sind durch extrem hohe Schwankungen gekennzeichnet.
Evolutionsraten oder Speziationsraten können um drei bis fünf Größenordnungen voneinander
differieren, ein Grad der Variabilität, der bei physikalischen Phänomenen selten, wenn
überhaupt, verzeichnet wird.
Während die Einheiten in der Physik – sagen wir einmal Atome oder Elementarteilchen –
konstante Merkmale besitzen, ist für die biologischen Einheiten gerade die Veränderlichkeit
charakteristisch. Zellen zum Beispiel ändern fortwährend ihre Eigenschaften, und das gleiche
gilt für Individuen. Jedes Individuum macht von seiner Geburt bis zu seinem Tod, von der
ursprünglichen Zygote, über Jugend, Erwachsenenalter, Greisenalter bis zum Tod, einen
drastischen Wandel durch. Wieder gibt es in der unbelebten Natur nichts, das dem ähnlich ist,
mit Ausnahme des radioaktiven Zerfalls, des Verhaltens hochgradig komplexer Systeme (wie
Golfstrom und Wettersysteme) und einiger entfernter Analogien in der Astrophysik.
Besitz eines genetischen Programms
Alle Organismen besitzen ein im Laufe der Geschichte entstandenes genetisches Programm,
das in der DNA des Zygotenkerns (oder bei einigen Viren in der RNA) aufgezeichnet ist. In
der unbelebten Welt existiert nichts, was damit vergleichbar wäre – abgesehen von Computern,
die der Mensch gemacht hat. Das Vorhandensein dieses Programms verleiht den Organismen
eine ihnen eigene Dualität, die aus einem Phänotypus und einem Genotypus besteht (s. Kap.
16). Zwei Gesichtspunkte sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben. Erstens ist das
Programm das Resultat einer Geschichte, die bis zum Ursprung des Lebens zurückreicht, und
schließt somit die „Erfahrungen" aller Vorfahren ein (Delbrück, 1949). Zweitens stattet es die
Organe mit der Fähigkeit zu teleonomen Vorgängen und Tätigkeiten aus, eine Fähigkeit, die in
der unbelebten Welt völlig fehlt. Sieht man von der Urdämmerung ab, in der das Leben
entstand, so stellt der Besitz eines genetischen Programms einen absoluten Unterschied
zwischen Lebewesen und unbelebter Materie dar.
Eine der Eigenschaften des genetischen Programms besteht darin, daß es seine eigene
korrekte Replikation und die anderer lebender Systeme wie Organellen, Zellen und ganzer
Organismen überwachen kann. In der unbelebten Natur gibt es nichts genau Gleichwertiges,
Gelegentlich kann es vorkommen, daß bei der Replikation ein Fehler unterläuft (sagen wir
einmal, ein Irrtum auf 10000 oder 100000 Replikationen). Wenn eine derartige Mutation
einmal stattgefunden hat, so wird sie zu einem konstanten Bestandteil des genetischen
Programms. Mutation ist die Hauptquelle aller genetischen Variation.
Voll verstanden wurde das Wesen des genetischen Programms von der Molekularbiologie
erst in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts, nachdem die Struktur der DNA entdeckt
worden war. Daß es irgendetwas geben mußte, was das Rohmaterial in die Form der
strukturierten Systeme von Lebewesen ordnete, hatte man jedoch schon im Altertum geglaubt.
Wie Delbrück (1971) sehr richtig aufzeigte, war Aristoteles' eidos (wenn es auch, da
unsichtbar, als immateriell galt) als Begriff praktisch mit dem ontogenetischen Programm der
Entwicklungsphysiologen identisch. Ein ähnlicher Ordnungsmechanismus war Buffons moule
interieure. Doch erst mußte die Computerwissenschaft entstehen, bis der Begriff eines
derartigen Programms gesellschaftsfähig wurde. Von besonderer Bedeutung ist, daß das
genetische Programm selbst unverändert bleibt, wenn es seine Instruktionen an den Körper
aussendet. Der ganze Begriff des Programms ist derart neu, daß viele Philosophen sich immer
noch dagegen sträuben.
Geschichtliches Gewachsensein
Eine Folge dessen, daß Lebewesen ein ererbtes genetisches Programm besitzen, ist die, daß
Klassen von Lebewesen nicht primär aufgrund ihrer Ähnlichkeit zusammengestellt oder
erkannt werden, sondern aufgrund ihrer gemeinsamen Abstammung, d.h. aufgrund einer Reihe
gemeinsamer, durch eine gemeinsame Geschichte bedingter Eigenschaften. Daher passen viele
der von den Logikern anerkannten Attribute von Klassen keineswegs auf die Merkmale von
Arten oder höheren Taxa. Dies trifft sogar auf Zelllinien in der Ontogenie zu. Mit anderen
Worten: die „Klassen" des Biologen entsprechen häufig nicht den „Klassen" des Logikers.
Dies darf man bei vielen Diskussionen über Definitionen nicht vergessen, am allerwenigsten
aber bei der Diskussion darüber, ob Arttaxa „Individuen" sind oder Klassen.
Natürliche Auslese
Die natürliche Auslese, die unterschiedliche Fortpflanzung von Individuen, die sich in ihrer
adaptiven Überlegenheit in einzigartiger Weise unterscheiden, ist ein Vorgang, für den es unter
den Veränderungsprozessen in der unbelebten Welt nichts genau Entsprechendes gibt. Wenn
wir bedenken, wie häufig die natürliche Auslese immer noch mißverstanden wird, dann lohnt
es sich, die folgende scharfsinnige Bemerkung von Sewall Wright (1967) zu zitieren: „Der
Darwinsche Prozeß des kontinuierlichen Wechselspiels eines zufälligen und eines selektiven
Prozesses liegt nicht in der Mitte zwischen reinem Zufall und reinem Determinismus, sondern
ist in seinen Konsequenzen qualitativ völlig verschieden von jedem der beiden."
Dieser Prozeß ist, zumindest bei Arten mit geschlechtlicher Fortpflanzung, darüber hinaus
durch die Tatsache gekennzeichnet, daß in jeder Generation durch Rekombination ein neuer
Genpool zusammengestellt wird, und daß damit ein neuer und unvorhersagbarer Anfang für
den Auslesevorgang der nächsten Generation gemacht worden ist.
Indeterminiertheit
Seit langem sind sich die Biologen und Philosophen darüber uneinig, ob sich biologische
Prozesse von physikalischen tatsächlich in Determiniertheit und Vorhersagbarkeit
unterscheiden. Bedauerlicherweise hat man dabei ständig erkenntnistheoretische
(epistemologische) und ontologische Aspekte miteinander verwechselt, was einige Verwirrung
in dieser Frage gestiftet hat.
Das Wort Voraussage wird in zwei völlig verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Wenn die
Wissenschaftsphilosophen von Voraussage sprechen, so meinen sie logische Voraussage, d.h.
das Übereinstimmen einzelner Beobachtungen mit einer Theorie oder einem
wissenschaftlichen Gesetz. Darwins Theorie der gemeinsamen Abstammung beispielsweise
erlaubte Haeckel die Voraussage, daß man im Fossilienmaterial „fehlende Glieder" zwischen
Affe und Mensch finden würde. Theorien werden an den Voraussagen getestet, die sie
erlauben. Da Physik und verwandte Naturwissenschaften in viel höherem Maße ein System
von Theorien sind, spielt die Vorhersage bei ihnen eine weitaus größere Rolle als in der
Biologie.
Im täglichen Sprachgebrauch bedeutet eine Voraussage einen Schluß von der Gegenwart auf
die Zukunft; sie hat es mit einer Abfolge von Ereignissen zu tun, es ist eine zeitliche
Voraussage. Bei streng deterministischen physikalischen Gesetzen sind absolute zeitliche
Voraussagen häufig möglich, etwa Voraussagen über das Auftreten von Eklipsen. Zeitliche
Voraussagen sind in der Biologie sehr viel seltener möglich. Das Geschlecht des nächsten
Kindes in einer Familie läßt sich nicht voraussagen. Niemand hätte zu Beginn der Kreidezeit
voraussagen können, daß die blühende Gruppe der Dinosaurier vor Ende des Zeitalters
aussterben würde. Voraussagen in der Biologie sind im Durchschnitt weitaus probabilistischer
als in der Physik.
Bei der Erörterung von Ursache und Erklärung darf man die Existenz dieser beiden Arten
von Voraussagen nicht vergessen. G. Bergmann definiert eine kausale Erklärung als eine
Erklärung, „die aufgrund eines Naturgesetzes Voraussagen über zukünftige Zustände eines
Systems erlaubt, wenn sein gegenwärtiger Zustand bekannt ist." Im wesentlichen ist dies
lediglich eine andere Formulierung von Laplaces notorischer Prahlerei. Solche Aussagen sind
von Scriven (1959, S.477) abgelehnt worden, der feststellt, daß die (zeitliche) Voraussage nicht
zur Kausalität gehört und „daß man Erklärungen nicht als unbefriedigend ansehen kann, wenn
sie… nicht so sind, daß sie die Voraussage des betreffenden Ereignisses erlaubt hätten."
In der Biologie und insbesondere in der Evolutionsbiologie haben die Erklärungen
gewöhnlich mit geschichtlichen Darstellungen zu tun. Schon 1909 nannte Baldwin zwei
Gründe, warum biologische Ereignisse so oft unvorhersagbar sind: die große Komplexität
biologischer Systeme und die Häufigkeit, mit der auf höheren Hierarchieebenen unerwartete
Neuerungen entstehen. Ich kann mir noch mehrere andere Gründe denken. Einige davon
könnte man als ontologische, andere als epistemologische Indeterminiertheiten bezeichnen.
Diese Faktoren bedeuten keine Schwächung des („rückwärtsblickend" verstandenen)
Kausalitätsprinzips [8].
Zufälligkeit eines Ereignisses in bezug auf seine Bedeutung. Die durch einen Fehler in der
DNA-Replikation hervorgerufene spontane Mutation ist ein gutes Beispiel dieser Ursache für
Indeterminiertheit. Es besteht nicht der geringste Zusammenhang zwischen dem molekularen
Ereignis und seiner möglichen Bedeutung. Das gleiche gilt für Ereignisse wie Crossing over,
Chromosomenteilung, Gametenselektion, Partnerwahl und viele für das Überleben wichtige
Faktoren. Weder die zugrunde liegenden molekularen Phänomene, noch die bei einigen dieser
Prozesse erfolgenden mechanischen Bewegungen stehen in irgendeiner Beziehung zu ihren
biologischen Auswirkungen.
Einzigartigkeit. Die Merkmale eines einzigartigen Ereignisses oder einer neu produzierten
einzigartigen Entität lassen sich nicht voraussagen (siehe oben).
Größenordnung stochastischer Störungen. Man kann den Effekt dieses Faktors anhand eines
Beispiels erläutern. Nehmen wir einmal an, eine Art bestehe aus einer Million von Individuen,
die alle in einzigartiger Weise verschieden sind. Für jedes dieser Individuen besteht die
Möglichkeit, daß es von einem Feind getötet wird, einem Krankheitserreger erliegt, einer
Wetterkatastrophe ausgesetzt ist, unter Unterernährung leidet, keinen Partner findet oder seine
Jungen verliert, bevor diese fortpflanzungsreif geworden sind. Dies sind einige der zahlreichen
Faktoren, die den Fortpflanzungserfolg bestimmen. Welcher dieser Faktoren wirksam wird,
hängt von hochgradig variablen Umweltkonstellationen ab, die einzigartig und nicht
vorhersagbar sind. Wir haben es also mit zwei hochgradig variablen Systemen zu tun
(einzigartigen Individuen und einzigartigen Umweltkonstellationen), die in Wechselwirkung
zueinander stehen. Wie sie sich miteinander verknüpfen, wird zu einem großen Teil vom Zufall
bestimmt.
Komplexität. Jedes organische System ist so reich an Rückkoppelungen, homöostatischen
Mechanismen und potentiellen Parallelpfaden, daß es völlig unmöglich ist, es vollständig zu
beschreiben; somit ist eine Voraussage dessen, was es hervorbringen wird, ebenfalls
unmöglich. Abgesehen davon würde die Analyse eines derartigen Systems seine Zerstörung
erfordern und dadurch sich selbst unmöglich machen.
Emergenz neuer und nicht vorhersagbarer Qualitäten in hierarchischen Systemen. (Dies wird
weiter unten ausführlich erörtert.)
Die hier genannten acht Eigenschaften wie auch die bei der folgenden Erörterung des
Reduktionismus noch zur Sprache kommenden zusätzlichen Merkmale lassen keinen Zweifel
daran, daß ein lebendes System etwas ganz anderes ist als ein unbelebtes Objekt. Gleichzeitig
jedoch befindet sich keine einzige dieser Eigenschaften im Widerspruch zu einer streng
mechanistischen Interpretation der Welt.
Reduktion und Biologie
Der Anspruch auf eine Autonomie der Wissenschaft von lebenden Organismen, wie er sich
in den oben aufgeführten acht einzigartigen oder besonderen Merkmalen manifestiert, fand bei
vielen Physikern und Physikphilosophen wenig freundliche Aufnahme. Sie reagierten mit der
Feststellung, die scheinbare Autonomie der Welt des Lebens existiere nicht wirklich, vielmehr
ließen sich alle Theorien der Biologie – wenigstens im Prinzip – auf physikalische Theorien
reduzieren. Dies, so behaupteten sie, stelle die Einheit der Wissenschaft wieder her.
Der Anspruch, der Reduktionismus sei der einzige berechtigte Ansatz, wird häufig durch die
zusätzliche Behauptung untermauert, die Alternative dazu sei Vitalismus. Das ist nicht wahr.
Auch wenn einige Gegner des Reduktionismus in der Tat Vitalisten gewesen sind, so haben
praktisch alle Gegner des Reduktionismus in jüngerer Zeit den Vitalismus entschieden
abgelehnt.
Tatsächlich läßt sich schwer ein vieldeutigeres Wort finden als das Wort „reduzieren".
Untersucht man die Literatur der Reduktionisten, so stellt man fest, daß der Ausdruck
„Reduktion" dort in mindestens drei verschiedenen Bedeutungen benutzt worden ist
(Dobzhansky und Ayala, 1974; Hüll, 1974; Schaffner, 1969a, b; Nagel 1961).
Konstitutiver Reduktionismus
Dieser Auffassung liegt die Annahme zugrunde, die materielle Zusammensetzung von
Organismen sei genau die gleiche, die man in der inorganischen Welt vorfindet. Darüber
hinaus postuliert der konstitutive Reduktionismus, keins der Ereignisse und Prozesse, die man
in der Welt der lebenden Organismen findet, stünde in irgendeinem Widerspruch zu den
physikalischchemischen Erscheinungen auf der Ebene der Atome und Moleküle. Diese
Feststellungen werden von den modernen Biologen akzeptiert. Der Unterschied zwischen
anorganischer Materie und lebenden Organismen liegt nicht in dem Stoff, aus dem sie
bestehen, sondern in der Organisation der biologischen Systeme. Der konstitutive
Reduktionismus ist daher nicht umstritten. Praktisch alle Biologen akzeptieren die Thesen des
konstitutiven Reduktionismus und haben dies (mit Ausnahme der Vitalisten) auch während der
letzten zweihundert oder mehr Jahre getan. Autoren, die die konstitutive Reduktion bejahen,
andere Formen der Reduktion jedoch ablehnen, sind keine Vitalisten, auch wenn einige
Philosophen dies behaupten.
Erklärender Reduktionismus
Die Verfechter dieser Art von Reduktionismus gehen davon aus, daß man ein Ganzes nicht
verstehen kann, solange man es nicht in seine Bestandteile zerlegt hat, und diese Bestandteile
wiederum in ihre, bis hinunter zur untersten Hierarchieebene der Integration. Bei biologischen
Erscheinungen würde dies bedeuten, daß man das Studium aller Phänomene auf die molekulare
Ebene reduziert, d.h. „Molekularbiologie ist die ganze Biologie." Tatsächlich ist es richtig, daß
eine solche erklärende Reduktion gelegentlich aufschlußreich ist. Man verstand die
Funktionsweise der Gene erst, nachdem Watson und Crick die DNA-Struktur ausgeknobelt
hatten. Auch in der Physiologie kann man die Funktionsweise eines Organs gewöhnlich nicht
restlos verstehen, solange die Molekularprozesse auf der Zellebene nicht geklärt sind.
Es gibt jedoch eine Reihe ernstzunehmender Einschränkungen bei einer derartigen
erklärenden Reduktion. Die eine ist die, daß Vorgänge auf der höheren hierarchischen Ebene
häufig weitgehend unabhängig sind von denen auf den darunter liegenden Ebenen. Die
Einheiten der unteren Ebenen werden möglicherweise so völlig integriert, daß sie auf den
höheren Ebenen als Einheiten wirksam sind. Die Funktionsweise eines Gelenks beispielsweise
kann ohne Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Knorpels erklärt werden. Darüber
hinaus kann das Ersetzen der Gelenkoberfläche durch Plastik, wie es in der modernen
Chirurgie getan wird, das normale Funktionieren eines Gelenks völlig wiederherstellen.
Wahrscheinlich gibt es ebenso viele Fälle, in denen das Zerlegen eines Funktionssystems in
seine Bestandteile nicht weiterhilft oder zumindest irrelevant ist, wie es Fälle gibt, wo dies von
erklärendem Wert ist. Eine unkritische Anwendung der erklärenden Reduktion in der
Geschichte der Biologie hat häufig mehr Schaden angerichtet als es Vorteile gebracht hat.
Beispiele dafür sind die frühe Zelltheorie, demzufolge die Organismen als „eine Ansammlung
von Zellen" interpretiert wurden, oder die frühe Populationsgenetik, für die der Genotypus ein
Aggregat unabhängiger Gene mit konstanten Fitnesswerten war.
Der extreme analytische Reduktionismus versagt, da er der Wechselwirkung der
Komponenten eines komplexen Systems nicht das ihr zukommende Gewicht beimessen kann.
Isoliert hat eine Komponente fast immer andere Eigenschaften als wenn sie Teil eines Ganzen
ist, und in isoliertem Zustand enthüllt sie nicht, welchen Beitrag sie zu den Wechselwirkungen
leistet. Warum der „atomisierte" Ansatz außerordentlich unproduktiv ist, wenn man ihn auf
komplexe Systeme anwendet, hat Rene Dubos (1965, S.337) ausgezeichnet beschrieben: „Bei
den am weitesten verbreiteten und wahrscheinlich auch wichtigsten Lebensphänomenen sind
die Bestandteile derart interdependent, daß sie ihren Charakter, ihre Bedeutung, ja sogar ihre
Existenz selbst verlieren, wenn sie von dem funktionalen Ganzen abgetrennt werden. Um sich
mit Problemen organisierter Komplexität zu befassen, ist es daher entscheidend wichtig,
Situationen zu erforschen, bei denen mehrere interrelationierte Systeme in integrierter Weise
funktionieren."
Die wichtigste Schlußfolgerung, die man aus einer kritischen Studie des erklärenden
Reduktionismus ziehen kann, ist die, daß in Hierarchien oder Systemen die unteren Ebenen nur
eine begrenzte Menge an Information über die Eigenarten und Prozesse der höheren Ebenen
liefern. Wie der Physiker P.W. Anderson sagte (1972, S.393-396): „Je mehr die
Elementarteilchen-Spezialisten uns über die Natur der grundlegenden Gesetze mitteilen, um so
weniger Bedeutung scheinen sie für die realen Probleme der restlichen Wissenschaft,
geschweige denn der Gesellschaft, zu haben." Abgesehen davon ist es ziemlich irreführend,
den Ausdruck „Reduktion" auf eine analytische Methode anzuwenden.
Es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten, wie man die Analyse komplexer biologischer
Systeme erleichtern kann. Tiergenetik zum Beispiel wurde ursprünglich an Pferden, Rindern,
Hunden und anderen großen Säugetieren studiert. Später stiegen die Genetiker auf Geflügel
und mehrere Nagetierarten um. Um eine größere Zahl von Generationen pro Jahr und vielleicht
auch einfachere genetische Systeme zu erhalten, wurden die Nagetiere nach 1910 in den
meisten genetischen Laboratorien durch Drosophila melanogaster und andere DrosophilaArten ersetzt. Dem folgte in den dreißiger Jahren eine Umstellung auf Neurospora und andere
Fungusarten (Hefepilze). Heute schließlich arbeitet die Molekulargenetik überwiegend mit
Bakterien (z. B. Escherichia coli) und verschiedenen Viren. Abgesehen von einer raschen
Generationenfolge ging es dabei darum, immer einfachere genetische Systeme zu finden und
von ihnen auf die komplexeren Systeme zu extrapolieren. Im großen und ganzen erfüllte sich
diese Hoffnung ; allerdings stellte sich schließlich heraus, daß das genetische System von
Prokaryoten (Bakterien) und Viren nicht ganz mit dem der Eukaryoten vergleichbar ist, bei
denen das genetische Material in komplexen Chromosomen angeordnet ist. Man muß bei der
Vereinfachung also mit Bedacht vorgehen. Es besteht immer die Gefahr, daß man zu einem
System übergeht, das in seiner Einfachheit immerhin so verschieden ist, daß kein Vergleich
mehr möglich ist.
Theorie-Reduktionismus
Diese Art von Reduktionismus postuliert, die in einem Gebiet der Wissenschaft
(gewöhnlich einem komplexeren oder einem in der Hierarchie höher stehenden Gebiet)
formulierten Theorien und Gesetze ließen sich als Sonderfälle der in einem anderen Zweig der
Wissenschaft formulierten Theorien und Gesetze nachweisen. Wenn man dies erfolgreich
durchführt, so hat man – in der seltsamen Sprache gewisser Wissenschaftsphilosophen – einen
Zweig der Wissenschaft auf einen anderen „reduziert". Greifen wir einen spezifischen Fall
heraus: Die Biologie gilt als auf die Physik reduziert, wenn die Ausdrücke der Biologie in
Ausdrücken der Physik definiert sind und die Gesetze der Biologie von den Gesetzen der
Physik abgeleitet werden.
Eine derartige Reduktion der Theorie ist in der Physik und verwandten Naturwissenschaften
wiederholt versucht worden, aber laut Popper (1974) niemals ganz gelungen. Ich kenne keine
biologische Theorie, die jemals auf eine physikalischchemische Theorie reduziert worden
wäre. Die Behauptung, die Genetik sei nach Entdeckung der Strukturen der DNA, der RNA
und bestimmter Enzyme auf die Chemie reduziert worden, ist nicht berechtigt. Zwar wurde
damit die chemische Natur einer Reihe sogenannter „schwarzer Kästen" geklärt, doch berührte
dies in keiner Weise den Charakter der Theorie der Transmissionsgenetik. So erfreulich es
auch ist, die klassische genetische Theorie nunmehr durch eine chemische Analyse ergänzen zu
können, so bedeutet dies nicht im geringsten eine Reduktion auf die Chemie. Die wesentlichen
Begriffe der Genetik, wie Gen, Genotypus, Mutation, Diploidie, Heterozygotie, Segregation,
Rekombination usw., sind ganz und gar keine chemischen Begriffe, und man würde in einem
Chemielehrbuch vergeblich nach ihnen suchen.
Dem Theorie-Reduktionismus liegt ein Irrtum zugrunde, denn er verwechselt Prozesse und
Begriffe. Wie Beckner (1974) hervorgehoben hat, sind biologische Vorgänge wie Meiose,
Gastrulation und Symbiose zwar gleichzeitig auch chemische und physikalische Prozesse, doch
sind sie keine chemischen oder physikalischen, sondern ausschließlich biologische Begriffe
und können nicht auf physikalischchemische Begriffe reduziert werden. Darüber hinaus ist jede
angepaßte Struktur das Resultat der Selektion, aber auch das ist wiederum ein Begriff, der sich
nicht in strikt physikalischchemischer Form ausdrücken läßt.
Diese Art von Reduktionismus ist ein Irrtum, da er es unterläßt, die Tatsache zu erwägen,
daß dasselbe Ereignis in mehreren verschiedenen Begriffsschemata völlig verschiedene
Bedeutungen haben kann. Das Werben eines männlichen Tieres z. B. läßt sich völlig in der
Sprache und innerhalb des Begriffsrahmens der Physik und verwandten Naturwissenschaften
beschreiben (Lokomotion, Energieumsatz, Stoffwechselvorgänge und so weiter), aber es kann
ebenso im Rahmen der Verhaltensbiologie oder der Fortpflanzungsbiologie beschrieben
werden. Das gleiche gilt für viele andere Ereignisse, Eigenschaften, Beziehungen und
Vorgänge, die lebende Organismen betreffen. Arten, Konkurrenz, Revier, Migration und
Überwinterung sind Beispiele organismischer Erscheinungen, bei denen eine rein physikalische
Beschreibung bestenfalls unvollständig und gewöhnlich biologisch irrelevant ist.
Zu dieser Erörterung des Reduktionismus läßt sich zusammenfassend sagen, daß die
Analyse von Systemen zwar eine wertvolle Methode ist, daß die Versuche einer „Reduktion"
rein biologischer Phänomene oder Begriffe auf Gesetze der Physik und verwandter
Naturwissenschaften jedoch selten, wenn überhaupt jemals, zu irgendwelchen Fortschritten
unseres Verständnisses geführt haben. Die Reduktion ist bestenfalls ein nichtssagender, noch
häufiger aber ein irreführender und nutzloser Ansatz. Diese Nutzlosigkeit zeigt sich in
besonders aufschlußreicher Weise bei dem Phänomen der Emergenz.
Emergenz
Systeme haben fast immer die Besonderheit, daß sich die Eigenschaften des Ganzen nicht
(und zwar nicht einmal in der Theorie) aus einer auch noch so vollständigen Kenntnis der
Bestandteile, einzeln genommen oder in anderen Teilkombinationen, ableiten lassen. Man
bezeichnet dieses Auftreten neuer Eigenschaften in einem Ganzen als Emergenz [9] und zieht
diesen Begriff häufig bei dem Versuch heran, so schwierige Phänomene wie Leben, Geist und
Bewußtsein zu erklären. Tatsächlich jedoch ist die Emergenz für inorganische Systeme nicht
weniger charakteristisch. Schon 1868 stellte T.H.Huxley fest, die besondere Eigenschaft des
Wassers, seine „Wässerigkeit", ließe sich nicht aus unserer Kenntnis der Eigenschaften von
Wasserstoff und Sauerstoff ableiten. Mehr als jeder andere war Lloyd Morgan (1894) für die
Anerkennung der Bedeutung der Emergenz verantwortlich. Es besteht kein Zweifel daran,
sagte er, „daß materielle Gebilde auf verschiedenen Organisationsstufen neue und unerwartete
Phänomene aufweisen und daß diese die überraschendsten Züge von Anpassungsmechanismen
einschließen". Solche Emergenz ist eine durchaus universelle Erscheinung. Wie Popper sagte,
„leben wir in einem Universum entstehender Neuartigkeit" (1974, S.281). Emergenz ist ein
beschreibendes Konzept, das – vor allem in komplexeren Systemen – der Analyse nicht
zugänglich zu sein scheint. Wenn man einfach sagt, wie einige Autoren dies getan haben,
Emergenz sei durch Komplexität bedingt, so ist das natürlich keine Erklärung. Vielleicht die
zwei interessantesten Merkmale neuer „Ganzheiten" sind (1) daß sie ihrerseits wiederum zu
Bestandteilen von auf noch höherem Niveau eingestuften Systemen werden und (2) daß die
„Ganzheiten" die Eigenschaften von Bestandteilen auf niedrigeren Ebenen beeinflussen
können. Das letzte Phänomen wird gelegentlich als „Abwärtskausalität" bezeichnet (Campbell,
1974, S. 182). Die Theorie von der Emergenz ist eine durch und durch materialistische
Philosophie. Wer sie ablehnt, wie Rensch (1971; 1974), sieht sich gezwungen, panpsychische
oder hylozoische Materietheorien heranzuziehen.
Zwei Einwände gegen die Emergenztheorie müssen als falsch zurückgewiesen werden. Der
erste besagt, die Anhänger der Emergenzlehre seien Vitalisten. Tatsächlich traf dieser Vorwurf
auf einige der Anhänger der Emergenztheorie im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu, doch gilt
er nicht für die modernen Vertreter dieser Theorie, die uneingeschränkt die konstitutive
Reduktion verfechten und somit per definitionem Nicht-Vitalisten sind. Der zweite Vorwurf
ist, die Emergenztheorie schließe die Überzeugung ein, Organismen könnten nur als
„Ganzheiten" untersucht werden und jede Analyse, die darüber hinaus gehe, sei abzulehnen. Es
mag sein, daß es ein paar Holisten gegeben hat, die einen solchen Anspruch erhoben haben,
aber diese Ansicht ist mit Sicherheit 99 Prozent aller Vertreter der Emergenzlehre fremd. Sie
behaupten nicht mehr, als daß die erklärende Reduktion unvollständig ist, da in hierarchischen
Systemen auf höheren Komplexitätsebenen neue und zuvor nicht erkennbare Merkmale
auftreten. Daher müssen komplexe Systeme auf jeder Ebene untersucht werden, da jede Ebene
Eigenschaften besitzt, die auf darunterliegenden Ebenen nicht zutagetreten.
Einige neuere Autoren haben den Ausdruck „Emergenz" als mit einem unerwünschten
metaphysischen Beigeschmack belastet abgelehnt. Simpson (1946 b) hat sie als
Kompositionsmethode („compositional" method) bezeichnet, Lorenz (1973 a) als Fulguration.
Heutzutage haben jedoch so viele Autoren den Ausdruck „Emergenz" übernommen und dieser
ist, wie der Ausdruck „Selektion", durch die häufige Benutzung derart „gereinigt" worden
(durch Ausschaltung vitalistischer und finalistischer Begriffsinhalte), daß ich keinen Grund
sehe, ihn nicht zu übernehmen.
Die hierarchische Struktur lebender Systeme
Komplexe Systeme haben sehr oft eine hierarchische Struktur (Simon, 1962), die Einheiten
einer Ebene werden zu neuen Einheiten der nächst höheren Ebene verbunden, wie Zellen zu
Geweben, Gewebe zu Organen und Organe zu Funktionssystemen. Die hierarchische
Organisation findet sich auch in der unbelebten Welt, denken wir z. B. an Elementarteilchen,
Atome, Moleküle, Kristalle usw., bei lebenden Systemen aber ist sie von besonderer
Bedeutung. Pattee (1973) postuliert, daß alle Probleme der Biologie, insbesondere jene, die mit
der Emergenz zu tun haben (siehe unten), letztlich Probleme der hierarchischen Organisation
seien.
Trotz des weit verbreiteten Interesses an Hierarchien herrscht immer noch relative
Unsicherheit hinsichtlich der Klassifikation von Hierarchien und hinsichtlich der speziellen
Eigenschaften verschiedener Arten von Hierarchien. In der Biologie haben wir es anscheinend
mit zwei Typen von Hierarchien zu tun. Das eine sind die konstitutiven Hierarchien, wie die
Reihe Makromolekül, Zellorganelle, Zelle, Gewebe, Organ und so weiter. In einer derartigen
Hierarchie werden die Elemente einer niedrigeren Ebene, sagen wir einmal der Gewebe, zu
neuen Einheiten (Organen) verbunden, die einheitliche Funktionen und durch Emergenz
entstandene Merkmale besitzen. Die Bildung konstitutiver Hierarchien ist eins der
charakteristischsten Merkmale lebender Organismen. Auf jeder Ebene treten andere Probleme
auf, werden andere Fragen gestellt und andere Theorien formuliert. Jede dieser Ebenen hat zur
Entstehung eines getrennten Zweiges der Biologie geführt: Moleküle zur Molekularbiologie,
Zellen zur Zytologie, Gewebe zur Histologie usw. bis hin zur Biogeographie und der
Erforschung von Ökosystemen. Herkömmlicherweise ist die Anerkennung dieser
Hierarchiestufen eine der Methoden der Unterteilung der Biologie in einzelne Gebiete
gewesen. Welcher besonderen Stufe ein Forscher sich zuwendet, hängt von seinen Interessen
ab. Ein Molekularbiologe ist einfach nicht an den Problemen des Funktionsmorphologen oder
des Zoogeographen interessiert, und umgekehrt. Die Probleme und Resultate auf anderen
Ebenen sind gewöhnlich für die auf einem anderen Hierarchieniveau arbeitenden Forscher
weitgehend irrelevant. Um ein volles Verständnis der Lebenserscheinungen zu erwerben, ist es
erforderlich, jede Ebene zu erforschen; allerdings tragen, wie schon weiter oben betont, die auf
den niedrigeren Ebenen erzielten Ergebnisse gewöhnlich sehr wenig zur Lösung der auf den
höheren Ebenen auftretenden Probleme bei. Wenn ein bekannter Nobelpreisträger der
Biochemie sagte: „Es gibt nur eine Biologie, und das ist die Molekularbiologie", bewies er
damit lediglich seine Unkenntnis und sein mangelndes Verständnis der Biologie.
Angesichts so vieler Komponenten, die zum Funktionieren eines biologischen Systems
beitragen, ist es für den arbeitenden Wissenschaftler eine Frage der Strategie und seiner
Interessen, zu entscheiden, welche Ebene er erforschen will, um damit unter den
gegenwärtigen Umständen den größten Beitrag zum vollen Verständnis des Systems zu leisten.
Dazu gehört auch die Entscheidung, bestimmte „schwarze Kästen" unangetastet zu lassen.
Eine völlig andere Art von Hierarchie können wir als Aggregationshierarchie bezeichnen.
Das bekannteste Paradigma dafür ist das Linnaeische System taxonomischer Kategorien, von
den Arten über Gattung und Familie bis hin zu Stamm und Reich. Diese Anordnung ist
ausschließlich aus Bequemlichkeitsgründen vorgenommen worden. Die Einheiten der unteren
Ebene, z. B. die Arten einer Gattung, oder die Gattungen einer Familie, werden nicht durch
irgendeine Wechselwirkung zu neu entstehenden Einheiten, neuen „Ganzheiten", einer höheren
Ebene verbunden. Stattdessen ordnen die Taxonomen Gruppen von Taxa in immer höhere
Kategorien ein. Die Gültigkeit dieser Feststellung wird nicht durch die Tatsache geschmälert,
daß die Mitglieder eines (natürlichen) höheren Taxons Abkömmlinge von einem gemeinsamen
Vorfahren sind. Derartige Hierarchien, die dadurch entstehen, daß man Kategorien dem Rang
nach anordnet, dienen im wesentlichen lediglich der Klassifikation. Es ist mir nicht bekannt, in
welchem Maße es noch weitere Typen von Hierarchien geben mag.
Holismus-Organizismus
Tiefdenkende Biologen sind, schon seit Aristoteles, mit einem rein atomistischreduktionistischen Herangehen an die Probleme der Biologie unzufrieden gewesen. Die
Mehrheit der Biologen betonte einfach die Ganzheit, d.h. die Integration von Systemen. Andere
wichen der wissenschaftlichen Erklärung aus, indem sie Zuflucht zu metaphysischen Kräften
nahmen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Vitalismus die bevorzugte Erklärung. Als
Smuts (1926) den passenden Ausdruck „Holismus" einführte, um auszudrücken, daß das Ganze
mehr ist als die Summe seiner Teile, verband er ihn mit vitalistischen Vorstellungen, die leider
den sonst so geeigneten Namen „Holismus" von Anfang an belastet haben. Die Ausdrücke
„organismisch" und „Organizismus" wurden anscheinend von Ritter (1919) geprägt und
werden heute in relativ weiten Kreisen benutzt, beispielsweise von Beckner (1974, S.163).
Bertalanffy (1952) führte etwa dreißig Autoren an, die ihr Einverständnis mit einem holistisch
organismischen Ansatz bekundet hatten. Diese Liste ist jedoch höchst unvollständig, enthält sie
doch noch nicht einmal die Namen Lloyd Morgan, Jan Smuts und J. S. Haidane. Francis Jacobs
(1970) Idee des „Integron" ist eine außerordentlich überzeugend vorgebrachte Bejahung des
organismischen Denkens.
Im Gegensatz zu den früheren holistischen Vorschlägen, die gewöhnlich mehr oder weniger
vitalistisch waren, sind die neueren Theorien streng materialistisch. Sie betonen, daß die
Einheiten auf höheren hierarchischen Ebenen mehr sind als die Summe ihrer Teile und daß
somit eine Zerlegung in die Bestandteile immer einen ungelösten Rest übrigläßt, mit anderen
Worten, daß die erklärende Reduktion zu keinem Erfolg führt. Wichtiger ist, daß sie die
Autonomie der Probleme und Theorien auf jeder dieser Ebenen und letztlich die Autonomie
der Biologie als Gesamtheit hervorheben. Die Wissenschaftsphilosophie kann es sich nicht
länger leisten, die organismische Vorstellung der Biologie als etwas Vitalistisches und daher
zur Metaphysik Gehörendes zu ignorieren. Eine Wissenschaftsphilosophie, die sich auf das an
unbelebten Objekten Beobachtbare beschränkt, ist beklagenswert unvollständig.
Viele Wissenschaftler konzentrieren sich auf das Studium isolierter Objekte und Vorgänge
und behandeln diese, als ob sie in einem Vakuum existierten. Vielleicht der wichtigste Aspekt
des Holismus ist der, daß er Gewicht auf Beziehungen legt. Ich persönlich bin immer der
Meinung gewesen, daß man sich nicht genügend mit Beziehungen befaßt. Aus diesem Grund
habe ich den Artbegriff einen Beziehungsbegriff genannt, und aus diesem Grund befassen
meine Arbeiten über die genetische Revolution (1954) und über den Zusammenhalt des
Genotypus (1975) sich beide mit Beziehungsphänomenen. Auch mein Angriff auf die
„Bohnensack"-Genetik (1959 d) geht auf dieselbe Wurzel zurück (siehe Kap. 13).
Ich stehe mit dieser Meinung nicht allein. Der Maler Georges Braque (1882-1963) hat
erklärt: „Ich glaube nicht an Dinge, ich glaube nur an ihre Beziehungen zueinander." Und
natürlich hat Einstein seine gesamte Relativitätslehre auf der Betrachtung der Beziehung
aufgebaut. Bei der Erörterung der sich verändernden Auslesewerte von Genen in
unterschiedlichen Genumwelten habe ich diese Vorstellung – etwas scherzhaft die
Relativitätstheorie der Gene genannt.
Die Begriffsstruktur der Biologie
Bei meinem Vergleich zwischen Biologie und den exakten Wissenschaften habe ich bisher
die Biologie so behandelt, als sei sie eine homogene Wissenschaft. Das ist natürlich nicht
richtig. Tatsächlich ist die Biologie diversifiziert und auf mehrere wichtige Arten heterogen.
Jahrtausende hindurch sind die biologischen Phänomene unter zwei Überschriften
zusammengefaßt worden: Medizin (Physiologie) und Naturgeschichte. Dies war in der Tat eine
bemerkenswerte kluge Aufteilung, weit scharfsichtiger als spätere Bezeichnungen wie
Zoologie, Botanik, Mykologie, Zytologie oder Genetik. Denn man kann die Biologie einteilen
in das Studium der unmittelbaren Ursachen, d. h. in den Gegenstand der physiologischen
Wissenschaften (im weiteren Sinne), und in das Studium der letzten (evolutionären) Ursachen
als den Gegenstand der Naturgeschichte (Mayr, 1961).
Was unmittelbare und evolutionäre Ursachen sind, läßt sich am besten anhand eines
konkreten Beispiels erläutern. Warum begann ein bestimmter Baumsänger im klimatisch
gemäßigten Nordamerika seinen Flug in den Süden in der Nacht vom 25. August? Die
unmittelbaren Ursachen sind, daß der Vogel, da er zu einer auf den Photoperiodismus
reagierenden Zugvogelart gehört, zu diesem Zeitpunkt physiologisch bereit geworden war,
fortzuziehen, denn die Anzahl der Tageslichtstunden war unter eine bestimmte Schwelle
abgesunken; darüber hinaus begünstigten die Wetterbedingungen (Wind, Temperatur,
Luftdruck) den Abflug im Laufe dieser Nacht. Doch eine Zwergohreule und ein Kleiber, die in
demselben Waldstück lebten und derselben Abnahme des Tageslichts und denselben
Wetterbedingungen ausgesetzt waren, zogen nicht in den Süden; tatsächlich blieben diese
anderen Arten, da ihnen der Wanderdrang fehlt, während des ganzen Jahres in der gleichen
Gegend. Es liegt also auf der Hand, daß es eine völlig andere zweite Gruppe ursächlicher
Faktoren geben muß, die für die Unterschiede zwischen den Zug- und Standvogelarten
verantwortlich ist. Sie besteht in einem während Jahrtausenden und Jahrmillionen der
Evolution durch die natürliche Auslese erworbenen Genotypus, der bestimmt, ob eine
Population oder Art seßhaft ist oder nicht. Ein insektenfressender Baumsänger oder
Fliegenschnäpper wird zum Zugvogel ausgelesen worden sein, da er andernfalls im Winter
verhungern würde. Bei anderen Arten, die den ganzen Winter über ihre Nahrung finden
können, wird die Selektion dahingehend gewirkt haben, daß sie den gefährlichen und für sie
unnötigen Vogelzug vermeiden.
Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Für den sexuellen Dimorphismus dürften hormonale
oder genetische Wachstumsfaktoren die unmittelbare Ursache sein, während die sexuelle
Auslese oder ein Auslesevorteil einer abweichenden Nutzung der Nahrungsnische vielleicht die
mittelbare Ursache ist. Jedes biologische Phänomen ist durch diese beiden voneinander
unabhängigen Arten von Kausalität bedingt.
Über den Ursprung der Termini unmittelbarmittelbar (proximateultimate) herrscht
erhebliche Ungewißheit. Herbert Spencer und George Romanes haben diese Ausdrücke
ziemlich vage gebraucht, während John Baker anscheinend der erste war, der zwischen
eindeutig mittelbaren Ursachen, die für die Evolution eines gegebenen genetischen Programms
verantwortlich sind (Selektion), und unmittelbaren Ursachen unterschieden hat, die sozusagen
für das Auslösen der gespeicherten genetischen Information als Reaktion auf momentane
Umweltreize verantwortlich sind: „So ist vermutlich die reiche Fülle an Insekten als Nahrung
für die Jungen [in bestimmten Monaten] die mittelbare, und die Tageslänge die unmittelbare
Ursache einer Fortpflanzungsperiode." (Baker, 1938, S. 162).
Die beiden Biologien, die sich mit jeweils dem einen oder anderen dieser zwei Typen von
Kausalität befassen, sind bemerkenswert eigenständig. Die unmittelbaren Ursachen beziehen
sich auf die Funktionen eines Organismus und seiner Bestandteile sowie auf seine
Entwicklung, von der funktionalen Morphologie bis hinunter zur Biochemie. Dagegen
versuchen evolutionäre, historische oder mittelbare Ursachen zu erklären, warum ein
Organismus so ist, wie er ist. Organismen gehorchen also – im Gegensatz zu unbelebten
Gegenständen – zwei verschiedenen Reihen von Kausalitäten, weil sie ein genetisches
Programm besitzen. Unmittelbare Ursachen haben mit dem Entschlüsseln des Programms eines
gegebenen Individuums zu tun; evolutionäre Ursachen haben mit den Veränderungen
genetischer Programme im Laufe der Zeit und mit den Gründen für diese Veränderungen zu
tun.
Der Funktionsbiologe befaßt sich im wesentlichen mit der Wirkungsweise und den
wechselseitigen Beziehungen struktureller Elemente, von den Molekülen bis hin zu Organen
und ganzen Individuen. Die Frage, die er immer wieder stellt, lautet: „Wie?" Wie arbeitet
etwas, wie funktioniert es? Der Funktionsanatom, der ein Gelenk untersucht, bedient sich der
gleichen Methode und geht in gleicher Weise vor wie der Molekularbiologe, der die
Wirkungsweise der DNA-Moleküle bei der Übertragung genetischer Information studiert. Der
Funktionsbiologe versucht, die spezielle Komponente, die er studiert, zu isolieren, und befaßt
sich bei seinen Untersuchungen gewöhnlich jeweils nur mit einem einzelnen Lebewesen,
einem einzelnen Organ, einer einzelnen Zelle oder einem einzelnen Teil einer Zelle. Er
versucht, alle Variablen auszuschalten oder unter Kontrolle zu bringen und wiederholt seine
Experimente unter konstanten oder geplant wechselnden Bedingungen so lange, bis er die
Funktion des untersuchten Elements geklärt zu haben glaubt. Die Haupttechnik des
Funktionsbiologen ist das Experiment, und er geht im wesentlichen genauso an seine Aufgabe
heran wie der Physiker oder Chemiker. Ja er kann, wenn er das untersuchte Phänomen gut
genug von den Komplikationen des Organismus isoliert, sogar das Ideal eines rein
physikalischen oder chemischen Experiments erreichen. Ungeachtet gewisser Grenzen dieser
Methode, muß man dem Funktionsbiologen zustimmen, daß eine solche vereinfachte Methode
eine absolute Notwendigkeit ist, will er sein Ziel erreichen. Der spektakuläre Erfolg der
biochemischen und biophysikalischen Forschung beweist die Berechtigung dieses direkten,
wenn auch deutlich vereinfachenden Vorgehens (Mayr, 1961). Methodik und Leistungen der
funktionalen Biologie, von William Harvey über Claude Bernard bis hin zur Mokularbiologie,
sind kaum umstritten.
Jeder Organismus, ob ein einzelnes Lebewesen oder eine Art, ist das Produkt einer langen
Geschichte, einer Geschichte, die mehr als drei Milliarden Jahre zurückreicht. Wie Max
Delbrück (1949, S.173) sagte: „Ein erfahrener Physiker, der zum ersten Mal die Probleme der
Biologie kennenlernt, findet es unfaßbar, daß es in der Biologie keine »absoluten Phänomene'
gibt. Alles ist zeitgebunden und raumgebunden. Das Tier, die Pflanze oder der
Mikroorganismus, mit dem er arbeitet, ist nichts als ein Glied in einer Evolutionskette sich
wandelnder Formen, von denen keine eine bleibende Gültigkeit besitzt."
Es gibt in einem Organismus kaum eine Struktur oder Funktion, die man völlig verstehen
kann, solange man diesen geschichtlichen Hintergrund nicht mit in Betracht zieht. Die
Ursachen für die bestehenden Merkmale und vor allem für die Anpassungen von Organismen
zu finden, ist die Hauptbeschäftigung des Evolutionsbiologen. Er ist von der enormen
Vielseitigkeit der organischen Welt beeindruckt und nicht weniger von dem Weg, auf dem sie
entstanden ist. Er erforscht die Kräfte, die die Änderungen in Faunen und Floren hervorrufen
(wie sie zum Teil durch die Paläontologie belegt sind), und die einzelnen Schritte, mit denen
sich die wunderbaren Anpassungen entwickelt haben, die für jeden Aspekt der organischen
Welt so bezeichnend sind.
In der Evolutionsbiologie werden fast alle Erscheinungen und Vorgänge durch Schlüsse
erklärt, die auf der Grundlage vergleichender Studien gezogen werden. Diese wiederum bauen
auf sehr sorgfältigen und ins Einzelne gehenden beschreibenden Studien auf. Man übersieht
gelegentlich, eine wie wesentliche Komponente in der Methode der Evolutionsbiologie die
zugrunde liegende beschreibende Arbeit ist. Die begrifflichen Durchbrüche eines Darwin,
Weismann, Jordan, Rensch, Simpson und Whitman wären ohne die solide Grundlage der
beschreibenden Forschung, auf der diese ihre theoretischen Gebäude aufbauen konnten,
praktisch unmöglich gewesen (Lorenz, 1973). In ihren Anfängen war die Naturgeschichte
zwangsläufig rein beschreibend, und das gleiche gilt für die frühe Anatomie. Die Bemühungen
der Systematiker des 18. und 19. Jahrhunderts, die Vielfalt der Natur zu klassifizieren,
wuchsen mehr und mehr über die einfache Beschreibung hinaus. Nach 1859 stand die
Autonomie der Evolutionsbiologie als einer legitimen biologischen Disziplin nicht mehr in
Frage.
Die funktionale Biologie ist oft als quantitativ bezeichnet worden, wohingegen es in vielen
Fällen gerechtfertigt ist, die Evolutionsbiologie als qualitativ zu bezeichnen. Während der
Aristotelesfeindlichen Periode der naturwissenschaftlichen Revolution hatte der Ausdruck
„qualitativ" eine abwertende Bedeutung. Trotz der Anstrengungen von Leibniz und anderen
weit blickenden Autoren blieb dies so bis zur Darwinschen Revolution, unter deren
befreiendem Einfluß ein Wandel im geistigen Klima stattfand, der die Entstehung der
Evolutionsbiologie möglich machte.
Diese Revolution war nicht sofort erfolgreich. Viele Physiker und Funktionsbiologen
weigerten sich beharrlich, das besondere Wesen der Evolutionsbiologie zu verstehen. Driesch
bemerkt in seiner Autobiographie, die er in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts schrieb,
mit beträchtlicher Genugtuung, „heute werden die biologischen Professuren eigentlich nur
noch an "experimentelle" vergeben, ja das systematische Problem tritt wohl gar allzu sehr in
den Hintergrund." Die Existenz der Evolutionsbiologie nahm er gar nicht zur Kenntnis. Diese
Einstellung war unter Experimentalbiologen weit verbreitet.
Haeckel (1877) war vermutlich der erste Biologe, der sich heftig der Auffassung
widersetzte, alle Naturwissenschaft müsse wie die Physik sein oder sich auf Mathematik
gründen. Er beharrte darauf, die Evolutionsbiologie sei eine historische Wissenschaft.
Insbesondere die Erforschung der Embryologie, Paläontologie und Phylogenie seien
historischer Natur, sagte er. Statt „historisch" würden wir heutzutage vielleicht sagen, „durch
historisch erworbene genetische Programme und deren Veränderungen in der geschichtlichen
Zeit gesteuert". Leider setzte sich dieser Standpunkt nur sehr langsam durch. Als Baldwin im
Jahre 1909 darauf hinwies, wie sehr sich das Denken der Biologen gewandelt habe, seit der
Darwinismus akzeptiert werde, schloß er mit den Worten: „Jetzt, zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ist die Herrschaft der Physik und der Gesetze der Mechanik über den
wissenschaftlichen und philosophischen Geist vorbei." Mit diesem Optimismus täuschte er
sich: heute noch schreiben viele Philosophen so, als hätte es nie einen Darwin gegeben und als
sei die Evolutionsbiologie nicht ein Teil der Naturwissenschaft.
Historische Darstellungen und die Evolutionsbiologie
Als sich die Wissenschaftsphilosophie zu entwickeln begann, gründete sie sich fest und
sicher auf die Physik, insbesondere auf die Mechanik, in der man Prozesse und Ereignisse als
Folge spezifischer Gesetze erklären kann und in der Voraussage und Kausalität symmetrisch
sind. Geschichtlich bedingte wissenschaftliche Phänomene dagegen passen nicht gut in diesen
Begriffsrahmen. Der Physiker Hermann Bondi (1977, S.6) bemerkte sehr richtig: „Jede Theorie
über den Ursprung des Sonnensystems, den Ursprung des Lebens auf der Erde, den Ursprung
des Universums ist [verglichen mit den konventionellen physikalischen Theorien] insofern
exzeptioneller Natur, als sie ein in gewissem Sinne einzigartiges Ereignis zu beschreiben
versucht." In der Tat ist die Einzigartigkeit das hervorragende Charakteristikum jedes
Ereignisses im geschichtlichen Ablauf der Evolution.
Mehrere Wissenschaftsphilosophen haben daher argumentiert, Erklärungen in der
Evolutionsbiologie würden nicht von Theorien geliefert, sondern von „historischen
Darstellungen" (historical narratives). So sagte zum Beispiel T. A.Goudge (1961, S.65-79):
„Darstellende Erklärungen kommen an solchen Stellen in die Evolutionstheorie hinein, an
denen einzelne Ereignisse von großer Bedeutung für die Geschichte des Lebens erörtert
werden… Darstellende Erklärungen werden ohne Erwähnung irgendeines allgemeinen
Gesetzes konstruiert…. Wann immer eine darstellende Erklärung eines Ereignisses in der
Evolution notwendig wird, ist dieses Ereignis kein Fall unter vielen derselben Art [Klasse],
sondern ein einzelnes Geschehnis, etwas, das nur ein einziges Mal geschehen ist und sich nicht
[auf die gleiche Weise] wiederholen kann… Historische Erklärungen bilden einen
wesentlichen Bestandteil der Evolutionstheorie." Morton White (1963) hat diese Gedanken
weiterentwickelt. Die Vorstellung von Zentralthemen ist für die logische Struktur historischer
Darstellungen von entscheidender Bedeutung. Jede phyletische Linie, jede Fauna (in der
Zoogeographie) oder jedes höhere Taxon ist ein Zentralthema im Sinne der Theorie der
historischen Darstellung und besitzt Kontinuität in der Zeit. Zu den Zweigen der
Naturwissenschaft, in denen historische Darstellungen eine wichtige Rolle spielen, gehören
Kosmogonie, Geologie, Paläontologie (Phylogenese) und Biogeographie.
Historische Darstellungen besitzen einen erklärenden Wert, weil frühere Ereignisse in einer
historischen Abfolge gewöhnlich einen kausalen Beitrag zu späteren Ereignissen leisten. Ein
Beispiel: Das Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit ließ eine große Zahl
ökologischer Nischen frei werden und bereitete der spektakulären Ausbreitung der Säugetiere
während des Paläozän und Eozän den Weg. Historische Darstellung dient also unter anderem
dem Entdecken von Ursachen für die nachfolgenden Ereignisse.
Den Axiomen der essentialistischen Logik verhaftete Philosophen scheinen große
Schwierigkeiten zu haben, die besondere Natur der Einzigartigkeit und der historischen
Abfolge von Ereignissen zu verstehen. Ihren Versuchen, die Bedeutung historischer
Darstellungen zu leugnen oder sie im Sinne umfassender Gesetze zu axiomatisieren, fehlt es
an Überzeugungskraft.
Der charakteristischste Aspekt der Evolutionsbiologie sind die Fragen, die sie stellt. Statt
sich auf das Was? und Wie? zu konzentrieren, wie es die Biologie der unmittelbaren Ursachen
tut, fragt sie nach dem Warum: Warum sind bestimmte Organismen einander sehr ähnlich,
während andere völlig verschiedenartig sind? Warum haben die meisten Arten von Lebewesen
zwei Geschlechter? Warum gibt es eine solche Vielfalt von Tier- und Pflanzenleben? Warum
sind die Faunen einiger Gegenden reich an Arten und die anderer Gegenden arm?
Die Merkmale eines Lebewesens müssen entweder von einem Vorfahren stammen oder im
individuellen Leben erworben worden sein, weil sie einen Selektionsvorteil hatten. Die Frage
„warum?" in der Bedeutung von „zu welchem Zweck" ist in der Welt der unbelebten Objekte
sinnlos. Man kann fragen „warum ist die Sonne heiß?", aber nur in dem Sinne von „wie kommt
es, daß sie heiß ist?" In der lebenden Welt dagegen hat die Frage nach dem „wofür" einen
großen heuristischen Wert. Die Frage „Warum haben die Venen Ventile?" trug zu Harveys
Entdeckung des Blutkreislaufs bei. Mit der Frage „warum machen die Zellkerne während der
Mitose den komplexen Vorgang der Reorganisation durch, statt sich einfach in der Hälfte zu
teilen?" gelangte Roux (1883) zur ersten richtigen Interpretation der Zellteilung. Er hatte
erkannt: „Die Frage nach der Bedeutung eines biologischen Vorganges kann in zweifacher
Beziehung gestellt werden. Einmal in Beziehung auf die Funktion desselben für das
biologische Gebilde, an welchem er vorkommt; zweitens aber kann die kausale Bedeutung,
können die Ursachen, denen er seine Entstehung und seinen Fortgang verdankt, Gegenstand
unseres Interesses und unserer Forschung sein." Daher muß der Evolutionsbiologe bei seinem
Bemühen, evolutionäre Kausalitäten zu analysieren, immer Warum-Fragen stellen.
Alle biologischen Prozesse haben sowohl eine unmittelbare als auch eine evolutionäre
Ursache. Es hat in der Geschichte der Biologie schon viel Verwirrung gestiftet, wenn sich
Autoren ausschließlich entweder auf unmittelbare oder auf mittelbare Ursachen konzentriert
haben. Nehmen wir z. B. die Frage „Was ist der Grund für sexuellen Dimorphismus?".
T.H.Morgan (1932) spottete über die Evolutionsbiologen, weil sie über die Frage spekulierten,
wo, wie er sagte, die Antwort doch so einfach sei: männliche und weibliche Gewebe reagieren
während der Ontogonie auf jeweils unterschiedliche hormonale Einflüsse. Er hat sich niemals
über die evolutionsbiologische Frage Gedanken gemacht, warum die Hormonsysteme von
Männchen und Weibchen verschieden sind. Die Rolle des geschlechtlichen Dimorphismus bei
der Werbung und anderen Verhaltensweisen sowie in ökologischen Zusammenhängen war für
ihn ohne Interesse.
Oder ein anderes Beispiel: Was ist die Bedeutung der Befruchtung? Verschiedene
Funktionsbiologen ließen sich bei Betrachtung dieser Frage von der Tatsache beeindrucken,
daß das unbefruchtete Ei in einem Ruhezustand ist, während die Entwicklung (erkennbar an
der ersten Furchungsteilung) fast unmittelbar nach Eindringen des Spermatozoons in das Ei
einsetzt. Der Zweck der Befruchtung, so stellten einige Funktionsbiologen fest, sei daher das
Auslösen der Entwicklung. Dagegen wiesen die Evolutionsbiologen daraufhin, daß bei
parthenogenetischen Arten keine Befruchtung nötig sei, um die Entwicklung beginnen zu
lassen; sie kamen zu dem Schluß, der wahre Zweck der Befruchtung sei eine Neukombination
von väterlichen und mütterlichen Genen; diese Rekombination erzeugt die genetische
Variabilität, also das Material der natürlichen Auslese (Weismann, 1886).
Aus diesen Beispielen geht ohne jeden Zweifel hervor, daß kein biologisches Problem
restlos gelöst ist, solange nicht sowohl die unmittelbare als auch die evolutionäre Kausalität
geklärt sind. Das Studium der evolutionären Ursachen ist ein ebenso legitimer Bestandteil der
Biologie wie das Studium der gewöhnlich physikalischchemischen unmittelbaren Ursachen.
Die Biologie des Ursprungs genetischer Programme und ihrer Veränderungen im Laufe der
Evolution, der Geschichte ist genauso wichtig wie die Biologie der Übersetzung
(Entschlüsselung) genetischer Programme, d. h. wie das Studium der unmittelbaren Ursachen.
Die Annahme von Julius von Sachs, Jacques Loeb und anderen unkritischen Mechanisten, die
Biologie bestehe ausschließlich aus der Erforschung unmittelbarer Ursachen, ist
erwiesenermaßen falsch.
Eine neue Philosophie der Biologie
Heute ist klar, daß eine neue Philosophie der Biologie notwendig ist. Diese sollte die
kybernetischfunktionalorganisatorischen Vorstellungen der funktionalen Biologie beinhalten
und verbinden mit den Begriffen der Evolutionsbiologie, also mit Populationsgeschichte,
Programm, Einmaligkeit und Angepaßtsein. Zwar sind die wesentlichen Umrisse der neuen
Philosophie der Biologie erkennbar, doch ist sie gegenwärtig eher ein Manifest von etwas, das
erreicht werden muß, als die Darstellung eines ausgereiften Begriffssystems. Am
entschiedensten ist sie in ihrer Kritik am logischen Positivismus, Essentialismus, Physizismus
und Reduktionismus; in ihren Hauptthesen ist sie jedoch noch zögernd und unfertig. Zwischen
den Autoren, die sich in den letzten Jahren mit dem Gegenstand beschäftigt haben, wie
Simpson, Rensch, Mainx, die Mitarbeiter an dem Band von Ayala und Dobzhansky (1974),
und den Autoren von biologiephilosophischen Werken (Beckner, Campbell, Hull, Munson)
bestehen immer noch weite Unterschiede nicht nur in der Betonung, sondern auch in einigen
Grundsätzen (zum Beispiel Annahme oder Ablehnung der Emergenztheorie). Allerdings zeigt
sich eine ermutigende Entwicklung. Alle Wissenschaftler, die sich nicht nur oberflächlich,
sondern kritisch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, lehnen die extremen Ansichten der
Vergangenheit ab: Keiner akzeptiert mehr den Vitalismus, gleichgültig in welcher Form; keiner
vertritt irgendeine Art atomistischen oder erklärenden Reduktionismus. Die Grenzen einer
neuen Philosophie der Biologie sind klar abgesteckt; also besteht berechtigte Hoffnung, in
nicht allzu ferner Zukunft zu einer echten Synthese zu gelangen.
Wissenschaftsphilosophen haben, wenn sie sich mit dem Thema Biologie befaßten,
beträchtliche Zeit und Aufmerksamkeit auf die Problematik von Geist, Bewußtsein und Leben
verwendet. Meiner Ansicht nach haben sie sich damit unnötige Schwierigkeiten geschaffen.
Was Bewußtsein ist, kann man nicht definieren. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin,
daß selbst niedrige Wirbellose Bewußtsein besitzen, vielleicht sogar die Protozoen bei ihren
Ausweichreaktionen. Ob man diese Frage bis hinunter zu den Prokaryonten (zum Beispiel
magnetischen Bakterien) weiterverfolgen will, ist eine Frage des Geschmacks. Jedenfalls läßt
sich der Begriff Bewußtsein nicht annähernd definieren. Eine ausführliche Behandlung ist
daher nicht möglich.
Die Worte „Leben" und „Geist" sind bloße Substantivierungen von Tätigkeiten und besitzen
keine getrennte Existenz als Entitäten. „Geist" bezieht sich nicht auf einen Gegenstand,
sondern auf geistige Tätigkeit; da geistige Aktivitäten in einem Großteil des Tierreichs
vorkommen (je nachdem, wie wir „geistig" definieren), kann man sagen, dass Geist überall
dort vorkommt, wo man Organismen findet, in denen sich nachweislich geistige Vorgänge
abspielen. Ebenso bedeutet Leben Substantivierung von Lebensvorgängen. Man kann Kriterien
dafür aufstellen und übernehmen, was es bedeutet „zu leben", aber so etwas wie ein
unabhängiges ,"Leben" in einem lebenden Organismus gibt es nicht. Die Gefahr ist zu groß,
daß einem solchen „Leben" eine getrennte Existenz zugeschrieben wird analog zur Existenz
einer Seele (Blandino, 1969). Wenn man Substantive vermeidet, die nichts anderes sind als
Vergegenständlichungen von Prozessen, so erleichtert man damit weitgehend die Analyse von
Erscheinungen, die für die Biologie charakteristisch sind.
Eine autonome Philosophie der Biologie hat sich in einem langen, langwierigen und
schmerzlichen Prozeß allmählich herausgebildet. Frühe Versuche waren zum Scheitern
verurteilt; es fehlten die Kenntnisse der biologischen Fakten, und ungeeignete und irrige
Begriffe beherrschten das Bild. Das läßt sich gut an Kants Philosophie der Biologie erläutern.
Kant erkannte nicht, daß der Gegenstand der Biologie erst von den Biologen selbst (von der
Naturwissenschaft!) durchdacht werden mußte. Ein Beispiel: es war die Aufgabe der
Systematiker, das Linnaeische System kausal zu erklären (was Darwin mit seiner Theorie der
gemeinsamen Abstammung getan hat); oder es war die Aufgabe der Evolutionsbiologen, das
Entstehen der Anpassung ohne Rückgriff auf übernatürliche Kräfte zu erklären (was Darwin
und Wallace mit ihrer Theorie der natürlichen Auslese getan haben). Erst als diese Erklärungen
zur Verfügung standen, hätten die Philosophen sich dem Unternehmen wieder anschließen
können. Das taten sie auch, aber leider – im allgemeinen – in der Form, daß sie Darwin
bekämpften und für biologisch zweifelhafte Theorien eintraten. Das hat bis in die moderne Zeit
hinein gedauert.
Ich glaube, es ist gerecht, wenn ich sage, daß Biologen wie Rensch, Waddington, Simpson,
Bertalanffy, Medawar, Ayala, Mayr und Ghiselin einen weitaus größeren Beitrag zu einer
Philosophie der Biologie geleistet haben als die gesamte ältere Generation von Philosophen
einschließlich Cassirer, Popper, Russell, Bloch, Bunge, Hempel und Nagel. Erst die jüngste
Philosophengeneration (Beckner, Hull, Munson, Wimsatt, Beatty, Brandon) war endlich
imstande, sich von den veralteten biologischen Theorien des Vitalismus, der Orthogenese,
Makrogenese und des Dualismus sowie von den positivistisch reduktionistischen Theorien der
älteren Philosophen zu befreien [10]. Man braucht nur zu lesen, was ein sonst so glänzender
Philosoph wie Ernst Cassirer über Kants Kritik der Urteilskraft schreibt, um zu erkennen, wie
schwierig es für einen traditionellen Philosophen ist, die Probleme der Biologie zu begreifen.
Zu seiner Entschuldigung muß gesagt werden, daß die Biologen nicht ganz schuldlos daran
waren, haben sie es doch versäumt, eine klare Analyse der begrifflichen Probleme der Biologie
vorzulegen. Sie haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Welche Prinzipien oder Begriffe wären eine gute Grundlage, auf der man eine Philosophie
der Biologie aufbauen könnte? Ich möchte noch nicht einmal den Versuch machen, diese Frage
erschöpfend zu beantworten; aus der vorangegangenen Erörterung sollte klar sein,
1.
daß ein volles Verständnis der Organismen nicht allein aufgrund der Theoriender
Physik und Chemie gewonnen werden kann;
2.
daß die gesamte geschichtliche Natur der Lebewesen berücksichtigt werden muß,
ins besondere ihr im Laufe der Geschichte erworbenes genetisches Programm;
3.
daß die Individuen auf den meisten Hierarchieebenen, von der Zelle aufwärts,
einzigartig sind und Populationen bilden, deren wichtigstes Merkmal unter anderen
ihre Mannigfaltigkeit ist;
4.
daß es zwei Biologien gibt, die funktionale Biologie, die unmittelbare Fragen stellt,
und die Evolutionsbiologie, die mittelbare Fragen stellt;
5.
daß ein großer Teil der Geschichte der Biologie die Einführung von Begriffen,
deren Reifung, deren Wandel und, gelegentlich, deren Ablehnung ist;
6.
daß die strukturierte Komplexität lebender Systeme hierarchisch geordnet ist und
höhere Ebenen in der Hierarchie charakterisiert sind durch die Emergenz von
Neuem;
7.
daß Beobachtung und Vergleich als Methoden der biologischen Forschung
durchaus ebenso wissenschaftlich und heuristisch sind wie das Experiment;
8.
daß ein Insistieren auf der Autonomie der Biologie nicht bedeutet, man akzeptiere
Vitalismus, Orthogenese oder irgendwelche anderen Theorien, die sich im
Widerspruch zu den Gesetzen der Chemie und Physik befinden.
Eine Philosophie der Biologie muß eine Betrachtung aller wichtigen spezifisch biologischen
Begriffe einschließen, nicht nur die der Molekularbiologie, Physiologie und
Entwicklungsbiologie, sondern auch jene der Evolutionsbiologie (etwa natürliche Auslese,
einschließlich Fitness, Anpassung, Fortschritt, Abstammung), der Systematik (Arten,
Kategorie, Klassifikation), Verhaltensforschung und Ökologie (Konkurrenz, Nutzung von
Ressourcen, Ökosystem).
Ich könnte einige Verbotsschilder aufstellen, um zu zeigen, was eine Philosophie der
Biologie nicht tun oder sein soll. Sie sollte keine Zeit mit einem fruchtlosen Versuch der
Theorie-Reduktion verschwenden. Sie sollte nicht von einer bestehenden Philosophie der
Physik ausgehen. (Es ist deprimierend, wenn man sieht, wie wenig einige angesehene Werke
auf diesem Gebiet mit der tatsächlichen Praxis der wissenschaftlichen Forschung zu tun haben,
zumindest in der Biologie.) Sie sollte nicht unnötig große Aufmerksamkeit auf Gesetze richten;
denn diese spielen tatsächlich in einem großen Teil der biologischen Theorie nur eine geringe
Rolle. Mit anderen Worten: was wir brauchen, ist eine ungebundene, unabhängige Philosophie
der Biologie, die sich vom Vitalismus und anderen unwissenschaftlichen Ideologien ebenso
fernhält wie von einem physikalischen Reduktionismus, der den spezifisch biologischen
Erscheinungen und Systemen nicht gerecht wird.
Die Biologie und das Denken des Menschen
C. P. Snow hat in einem berühmten Essay (1959) behauptet, zwischen der Kultur der
Naturwissenschaft und der der Geisteswissenschaften bestünde eine nicht zu überbrückende
Kluft. In Bezug auf die Kommunikationskluft zwischen Physikern und Geisteswissenschaftlern
hat er zweifellos recht; doch «eine fast genauso große Kluft besteht zwischen, sagen wir
einmal, Physikern und Naturbeobachtern. Auch zwischen den Vertretern der funktionalen
Biologie und denen der Evolutionsbiologie gibt es einen recht ausgeprägten Mangel an
Kommunikation. Die funktionale Biologie hat wie die Physik und die ihr verwandten
Naturwissenschaften ein Interesse an Gesetzen, Vorhersage, allen Aspekten der Quantität und
Quantifizierung und den funktionalen Aspekten von Vorgängen, wohingegen die
Evolutionsbiologie besonders interessiert ist an Fragen wie Qualität, Geschichtlichkeit,
Information und Selektionswert, Fragen, die auch in der Verhaltensforschung und in den
Sozialwissenschaften, nicht aber in der Physik, von Bedeutung sind. Es ist daher keineswegs
unvernünftig, die Evolutionsbiologie als so etwas wie eine Brücke zwischen den physikalisch
orientierten Wissenschaften einerseits und den Sozial- und Geisteswissenschaften andererseits
anzusehen.
In einem Vergleich zwischen Geschichte und Naturwissenschaft schreibt Carr (1961, S.62),
man gehe allgemein davon aus, daß sich Geschichte von allen Naturwissenschaften in fünf
Aspekten unterscheide: (1) die Geschichte beschäftigt sich ausschließlich mit dem Einmaligen,
die Naturwissenschaft mit dem Allgemeinen; (2) die Geschichte erteilt keine Lektionen; (3) die
Geschichte ist nicht in der Lage, Vorhersagen zu machen; (4) die Geschichte ist zwangsläufig
subjektiv, und (5) die Geschichte hat (anders als die Naturwissenschaft) auch mit Fragen der
Religion und Moral zu tun. Diese Unterschiede gelten nur für die Physik. Die Feststellungen 1,
3, 4 und 5 treffen weitgehend auch auf die Evolutionsbiologie zu, und eigentlich gelten, wie
Carr selbst zugibt, einige dieser Behauptungen (Punkt 2 z. B.) gar nicht einmal richtig für die
Geschichte. Mit anderen Worten: der scharfe Bruch zwischen der Naturwissenschaft und den
Nicht-Naturwissenschaften existiert gar nicht.
Welcher Art die Auswirkungen sind, die die Naturwissenschaft auf den Menschen und sein
Denken gehabt hat, war und ist umstritten. Daß Kopernikus, Darwin und Freud das Denken des
Menschen tief greifend verändert haben, läßt sich kaum bestreiten. Der prägende Einfluß der
Physik und verwandten Naturwissenschaften während der letzten Jahrhunderte hat sich in
erster Linie auf dem Weg über die Technologie bemerkbar gemacht. Kuhn (1971) zufolge muß
ein Wissenschaftler, damit er wirklichen Einfluß auf das Denken der Menschen ausübt, vom
Nichtfachmann gelesen werden. So hervorragend manche theoretischen Physiker
(einschließlich Einstein und Bohr) auch waren, „keiner von ihnen hat, soweit ich das beurteilen
kann, mehr als einen höchst dürftigen und indirekten Einfluß auf die Entwicklung des Denkens
außerhalb der Wissenschaft ausgeübt." Ob Kuhn nun recht hat oder nicht, eins kann man mit
Sicherheit behaupten, daß nämlich einige Wissenschaftler mehr Einfluß auf das Denken des
intelligenten Laien gehabt haben als andere. Wahrscheinlich hängt das davon ab, in welchem
Maße der Forschungsgegenstand des Wissenschaftlers für den Laien von unmittelbarem
Interesse ist. Daher beeinflussen Biologie, Psychologie, Anthropologie und damit verwandte
Wissenschaften natürlich das Denken der Menschen viel stärker als Physik und verwandte
Wissenschaften.
Vor dem Entstehen der Naturwissenschaften waren es die Philosophen, die sozusagen die
Last der Aufgabe trugen, das Verständnis über diese unsere Welt zu verbessern. Seit dem 19.
Jahrhundert hat sich die Philosophie mehr und mehr auf das Studium der Logik und der
wissenschaftlichen Methodik zurückgezogen und weite Bereiche, denen früher ihr
Hauptinteresse zu gelten pflegte, großteils aufgegeben, wie etwa Metaphysik, Ontologie und
Epistemologie. Die bedauerliche Folge: Ein großer Teil dieses Bereichs ist praktisch zum
Niemandsland geworden, da sich die Mehrheit der Wissenschaftler völlig damit zufrieden gibt,
in ihren speziellen Fachgebieten Studien zu betreiben, und sich nicht im geringsten dafür
interessiert, wie die aus diesen Studien ableitbaren allgemeinen Schlußfolgerungen die
Grundfragen der menschlichen Existenz und der allgemeinen Erkenntnislehre beeinflussen
mögen. Für die Philosophen, andererseits, ist es schwer, wenn nicht sogar unmöglich, mit den
raschen Fortschritten der Wissenschaft Schritt zu halten, und das führt dazu, daß sie sich
trivialen oder esoterischen Fragen zuwenden. Gelegenheiten für ein gemeinsames Vorgehen
von Philosophen und Wissenschaftlern, so gewinnbringend dies auch sein würde, bieten sich
leider nur allzu selten.
Biologie und menschliche Wertmaßstäbe
Gelegentlich hört man, die Wissenschaft habe – im Gegensatz zu religiösen Auslegungen –
den großen Vorteil, unpersönlich, unvoreingenommen, nicht emotional und somit völlig
objektiv zu sein. Dies mag zwar sehr wohl für die Mehrheit der Erklärungen in der Physik
gelten, aber auf einen Gutteil der Auslegungen in der Biologie trifft es ganz und gar nicht zu.
Die Ergebnisse und Theorien der Biologen befinden sich ziemlich oft im Widerspruch zu den
herkömmlichen Werten unserer Gesellschaft. Ein Beispiel: Darwins Lehrer Adam Sedgwick
lehnte die Theorie der natürlichen Auslese heftig ab, da sie die Ablehnung des Gottesbeweises
aus der Zweckmäßigkeit bedeutete und somit eine materialistische Erklärung der Welt erlauben
würde, d.h. in seinen Augen eine Ausschaltung Gottes aus der Auslegung der Ordnung und
Anpassung in der Welt. Die biologische Theorie ist in der Tat häufig sehr wertbeladen. Als
Beispiel könnten wir Darwins Theorie von der gemeinsamen Abstammung anführen, die dem
Menschen seine einzigartige Stellung im Universum nahm. Geeignete Beispiele aus der
jüngeren Zeit sind Diskussionen darüber, ob und in welchem Ausmaß der Intelligenzquotient
genetisch bestimmt ist (insbesondere wenn man diese Frage mit der Rassenfrage verknüpft),
und die Diskussion über die Soziobiologie. In all diesen Fällen entstand ein Konflikt zwischen
bestimmten naturwissenschaftlichen Ergebnissen oder Interpretationen und bestimmten
traditionellen Wertsystemen. So objektiv die naturwissenschaftliche Forschung auch sein mag,
ihre Resultate führen oft zu Schlußfolgerungen, die alles andere als wertfrei sind.
Literaturkritiker sind schon seit langem des Einflusses gewahr, den die Schriften einiger
Wissenschaftler auf die Romanciers und Esssayisten und über diese auf das breite Publikum
gehabt haben. Die Berichte, wie glücklich und unschuldig der primitive Eingeborene
exotischer Länder sei, die die Entdecker des 18. Jahrhunderts mit nach Hause brachten, hatten
– so falsch sie auch waren – großen Einfluß auf die Schriftsteller und letzten Endes sogar auf
die politischen Ideologien des 18. und 19. Jahrhunderts.
Es war eine Tragödie für die Biologie wie auch für die Menschheit, daß der gegenwärtig
maßgebende Rahmen unserer gesellschaftlichen und politischen Ideale sich zu einer Zeit
entwickelte und durchsetzte, als das Denken des abendländischen Menschen weitgehend von
den Ideen der naturwissenschaftlichen Revolution beherrscht war, d.h. von einer Reihe von
Ideen, die sich auf die Grundsätze der Physik und verwandten Naturwissenschaften gründeten.
Hierzu gehörte das essentialistische Denken und ergänzend dazu ein Glaube an die essentielle
Identität der Mitglieder einer Klasse. Zwar war die ideologische Revolution des 18.
Jahrhunderts in hohem Maße eine Rebellion gegen den Feudalismus und die
Klassenprivilegien, doch läßt sich nicht leugnen, daß die Ideale der Demokratie zum Teil von
den anerkannten Prinzipien des Physikalismus abgeleitet waren. Folglich kann man die
Demokratie so interpretieren, als behaupte sie nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz, sondern
auch die essentialistische Identität in jeder Beziehung. Ausgedrückt wird dies in der
Behauptung, daß „alle Menschen gleich geschaffen seien", was etwas gänzlich anderes ist als
die Feststellung „Alle Menschen haben gleiche Rechte und sind vor dem Gesetz gleich". Jeder,
der von der genetischen Einzigartigkeit des Individuums überzeugt ist, glaubt damit zugleich
auch an die Schlußfolgerung, daß „es keine zwei Individuen gibt, die gleich geschaffen sind".
Als sich die Evolutionsbiologie im 19. Jahrhundert entwickelte, bewies sie die
Nichtanwendbarkeit dieser physikalischen Prinzipien auf einzigartige biologische Individuen,
heterogene Populationen und evolutionäre Systeme. Trotzdem hat die ideologische
Verschmelzung von Physikalismus und Antifeudalismus, die man gewöhnlich als Demokratie
bezeichnet (tatsächlich gibt es nicht zwei Personen, die unter Demokratie ganz genau das
gleiche verstehen), in der westlichen Welt in solchem Maße die Überhand gewonnen, daß
sogar die leiseste, zwischen den Zeilen (z. B. zwischen diesen) anklingende Kritik gewöhnlich
mit absoluter Intoleranz zurückgewiesen wird. Demokratische Ideologie und Evolutionsdenken
haben gemeinsam, daß sie dem Individuum einen hohen Stellenwert einräumen, ansonsten aber
unterscheiden sie sich in vielen Aspekten unseres Wertsystems voneinander. Die jüngste
Kontroverse über die Soziobiologie ist ein trauriges Beispiel der Intoleranz, die ein Teil unserer
Gesellschaft an den Tag legt, wenn Aussagen eines Wissenschaftlers mit politischen Doktrinen
in Konflikt geraten. Orwell (1972) hat dies sehr schön beschrieben: „Zu jedem gegebenen
Zeitpunkt gibt es ein orthodoxes Denken, eine Reihe von Ideen, von denen man annimmt, sie
würden von allen rechtdenkenden Menschen fraglos akzeptiert. Es ist nicht geradezu verboten,
dies oder jenes oder etwas anderes zu sagen, aber man ,tut es´ sozusagen »einfach nicht´…
Jeder, der Zweifel an der geltenden orthodoxen Denkweise laut werden läßt, findet sich mit
überraschender Effizienz zum Schweigen verurteilt. Einer wirklich ketzerischen Meinung gibt
man fast niemals eine gerechte Chance, gehört zu werden, weder in der gewöhnlichen Presse
noch in den schöngeistigen oder intellektuellen Zeitschriften." Die Wissenschaftler, so fürchte
ich, sind an einer derartigen Intoleranz nicht ganz schuldlos.
Alle Sozialreformer, von Helvetius, Rousseau und Robert Owen bis hin zu bestimmten
Marxisten (Karl Marx selbst jedoch nicht) haben sich Lockes Behauptung zu eigen gemacht,
der Mensch sei bei seiner Geburt eine tabula rasa, auf der sich alle beliebigen Merkmale
einprägen ließen. Da alle Individuen potentiell identisch seien, könne man durch richtige
Umgebung und Erziehung aus jedem Individuum alles machen. Dies veranlaßte Robert Owen
(1813) zu der Behauptung, „die Kinder jeder beliebigen Klasse in der Welt könnten durch
wohlüberlegte Erziehung zu Erwachsenen jeder anderen Klasse gemacht werden." Da die
Klassen sozioökonomisch definiert waren (zumindest stillschweigend), besaß Owens
Ausspruch erhebliche Gültigkeit. Dehnt man ihn aber auf Individuen aus und formuliert ihn ein
wenig extremer, wie das der Behaviorist John B. Watson im Jahre 1924 getan hat, so wird
diese Behauptung sehr zweifelhaft. Kein Wunder, daß die Vertreter derart optimistischer
Ansichten die Behauptungen derer ablehnten, die die Genetik der menschlichen Eigenschaften
anhand von Zwillings- und Adoptionsstudien erforschten.
Der Beweis durch Systematik, Anthropologie, Genetik und Verhaltensbiologie, daß es in
keiner Art (einschließlich der menschlichen) zwei völlig identische Individuen gibt und
gegeben hat, hat tiefgreifende Beunruhigung unter all denen gestiftet, die ernsthaft von dem
Prinzip der menschlichen Gleichheit überzeugt sind. Wie Haidane und Dobzhansky gezeigt
haben, kann man das Dilemma umgehen, wenn man Gleichheit entsprechend den modernen
biologischen Erkenntnissen definiert. Alle Individuen sollten vor dem Gesetz gleich sein und
ein Recht auf gleiche Chancen haben. In Anbetracht ihrer biologischen Ungleichheit benötigen
sie jedoch unterschiedliche Umwelten (zum Beispiel verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten),
um wirklich gleiche Chancen zu haben. Paradoxerweise ist ein Identizismus, der die
biologische NichtIdentität ignoriert, der schlimmste Feind der Demokratie, wenn es darum
geht, die Ideale der Chancengleichheit in der Praxis zu verwirklichen.
Die Biologie trägt eine schwere Verantwortung. Man kann kaum leugnen, daß sie dazu
beigetragen hat, die herkömmlichen Überzeugungen und Wertmaßstäbe zu unterminieren.
Viele der optimistischsten Ideen der Aufklärung, darunter die Gleichheit und die Möglichkeit
einer perfekten Gesellschaft, waren letztlich (obwohl stark unterbewußt) Bestandteil der
Physiko-Theologie. Gott war es, der diese nahezu perfekte Welt gemacht hatte. Der Glaube an
eine solche Welt mußte zwangsläufig zusammenbrechen, als der Glaube an Gott als
Konstrukteur der Welt untergraben wurde. Daher Sedgwicks berechtigte Angst. Der Verlust
des Glaubens an Gott hatte ein existentielles Vakuum und eine antwortheischende Frage nach
dem Sinn des Lebens zur Folge. Führende Denker seit der Aufklärung waren der festen
Ansicht, die Biologie solle nicht nur die herkömmlichen Werte zerstören, sondern auch neue
Wertsysteme schaffen. Praktisch alle Biologen sind religiös in der tieferen Bedeutung dieses
Wortes, auch wenn es eine Religion ohne Offenbarung sein mag, wie Julian Huxley es nannte.
Das Unbekannte und vielleicht jenseits der möglichen menschlichen Erkenntnis Liegende flößt
uns ein Gefühl der Demut und Ehrfurcht ein; die Mehrheit derer jedoch, die den Glauben an
Gott durch den Glauben an den Menschen zu ersetzen suchten, schlugen den falschen Weg ein.
Sie definierten den Menschen als das Ich, das persönliche Ego, und propagierten eine Ideologie
des Eigeninteresses und des Egoismus, die den Menschen nicht nur nicht glücklich macht,
sondern darüber hinaus auf lange Sicht total zerstörerisch ist.
Natürlich wäre es ebenso einfältig und gefährlich, den Menschen einfach als eine
biologische Kreatur zu behandeln, d.h. so zu tun, als wäre er nichts als ein Tier. Dank seiner
vielen einzigartigen Merkmale besitzt der Mensch die Fähigkeit, Kultur zu entwickeln und
erworbene Informationen ebenso wie Wertsysteme und ethische Normen an nachfolgende
Generationen weiterzugeben. Man würde daher eine sehr einseitige und in der Tat irreführende
Vorstellung vom Menschen bekommen, wollte man ihn ganz und gar auf der Grundlage des
Studiums tierischer Kreaturen beurteilen. Und dennoch hat uns das Studium der Tiere zu
einigen der entscheidensten Einsichten in die Natur des Menschen verholfen, selbst dort, wo
diese Untersuchungen nichts anderes ergeben haben als die Erkenntnis, wie sehr sich der
Mensch in einigen Merkmalen von seinen nächsten Verwandten, den Menschenaffen,
unterscheidet.
Wenn man den Menschen weder als das persönliche Ich noch als eine bloße biologische
Kreatur definiert, sondern als Menschheit, so wird eine ganz andere Ethik und Ideologie
möglich. Eine solche Ideologie wäre völlig mit dem traditionellen gesellschaftlichen Wert
vereinbar, der darin besteht, die „Menschheit bessern" zu wollen, und stimmte doch
gleichzeitig mit jeder neuen Erkenntnis der Biologie überein. Wählt man diese Methode, so
gibt es keinen Widerspruch zwischen der Naturwissenschaft und den höchsten menschlichen
Werten (Campbell, 1974, S.183-185; Rensch, 1971).
Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als stünde ein solcher Ansatz im Widerspruch zu
dem Prinzip der Verwandtschaft umfassenden Fitness („inklusive fitness"). Das ist jedoch nicht
zwangsläufig der Fall, und zwar aus zwei Gründen. Erstens kann es in der anonymen
Massengesellschaft der modernen Menschheit sehr wohl zur eigenen umfassenden Fitness
beitragen, wenn man für die Verbesserung der Gesellschaft als Ganzes arbeitet. Zweitens ist
der Mensch insofern eine einzigartige Spezies, als zu seinem biologischen Erbe eine große
Menge an kulturellem „Erbe" hinzukommt und das Wesen dieses kulturellen Erbes die
Darwinsche Fitness wirkungsvoll beeinflussen kann. Die Forscher, die sich mit den
Auswirkungen des Darwinismus auf die menschliche
Evolution befassen, haben diese Wechselwirkung bisher nicht in ausreichendem Maße in
Erwägung gezogen. Meiner persönlichen Überzeugung nach ist der scheinbare Konflikt
zwischen umfassender Fitness, kulturellem Erbe und einer gesunden Ethik sehr wohl lösbar.
3 Das wechselnde geistige Milieu der Biologie
Eine Ideengeschichte kann geschrieben werden, indem die Wissenschaft eines gegebenen
historischen Zeitalters in ihre wichtigsten Probleme unterteilt und der Entwicklung einer jeder
dieser Fragen im Zeitablauf nachgespürt wird. Eine solche streng nach thematischen
Schwerpunkten ausgerichtete Behandlung hat ihre Vorteile, sie reißt aber jedes Problem
sowohl aus seinem Zusammenhang mit anderen zeitgenössischen Fragestellungen in der
Wissenschaft, als auch aus dem gesamten kulturellen und intellektuellen Milieu der Zeit. Um
diesen schwerwiegenden Nachteil auszugleichen, möchte ich in diesem Kapitel eine knappe
Geschichte der Biologie als Ganzes darstellen und sie zu dem geistigen Klima ihrer Zeit in
Beziehung zu setzen versuchen. Die in den späteren Kapiteln folgende speziellere Behandlung
einzelner biologischer Probleme, sollte vor dem Hintergrund dieses Überblicks über die
gesamte Biologie gelesen werden. In diesem einführendem Kapitel werden auch einige
Zusammenhänge mit Bereichen der funktionalen Biologie (Anatomie, Physiologie,
Embryologie, Verhaltenslehre) hergestellt, die in diesem Band sonst nicht mehr zur Sprache
kommen [1].
Jedes Zeitalter hat seine eigene „geistige Grundhaltung" oder seinen philosophischen
Rahmen, der zwar alles andere als einheitlich ist, dennoch aber fast alles Denken und Handeln
irgendwie beeinflußt. Die Kultur Athens im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., das Jenseits gerichtet
sein eines großen Teils des Mittelalters oder die wissenschaftliche Revolution des 17.
Jahrhunderts sind Beispiele auffallend unterschiedlicher geistiger Umwelten. Es wäre jedoch
ein Irrtum anzunehmen, jede Ära sei jeweils nur von einem einzigen Zeitgeist beherrscht, d.h.
von einem einzigen erklärenden Rahmen oder einer einzigen Ideologie, die dann schließlich
durch einen neuen und häufig völlig anderen Vorstellungsrahmen ersetzt wird. Im
18.Jahrhundert z.B. unterschied sich der geistige Rahmen von Linnaeus in nahezu jeder
Hinsicht von dem seines Zeitgenossen Buffon. Zwei gänzlich verschiedene
Forschungstraditionen können nebeneinander existieren und ihre Anhänger jeweils in
intellektueller Isolation arbeiten. Zum Beispiel bestand der von einem essentialistischen
Fundament ausgehende Positivismus der Physiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Seite an Seite mit dem Darwinismus der Naturforscher, der auf dem Populationsdenken
aufbaute und Fragen nach Anpassungen stellte, die für einen positivistischen Physiker ohne
jede Bedeutung waren [2].
Vorzeit und Antike
Alle primitiven Menschen sind eifrige Naturbeobachter, nicht weiter überraschend, denn ihr
Überleben hängt von ihrer Kenntnis der Natur ab. Sie müssen potentielle Feinde und
Nahrungsquellen kennen; sie nehmen regen Anteil an Leben und Tod, Krankheit und Geburt,
und stellen Fragen nach der „Seele" und den Unterschieden zwischen dem Menschen und den
anderen Lebewesen. Nahezu universell ist unter den primitiven Völkern der Erde der Glaube
verbreitet, die ganze Natur sei „lebendig", sogar Felsen, Berge und der Himmel seien von
Geistern, Seelen oder Göttern bewohnt. Die Kräfte der Götter seien ein Teil der Natur, und die
Natur selbst sei aktiv und schöpferisch. Alle Religionen vor dem Judentum waren mehr oder
weniger animistisch, und ihre Einstellung gegenüber dem Göttlichen unterschied sich ganz und
gar vom Monotheismus der jüdischen Religion. Das Bild, das der Mensch der Frühzeit von der
Welt hatte, war eine unmittelbare Folge seiner animistischen Überzeugungen (Sarton,
Thorndike).
Es liegen Gründe für die Annahme vor, daß die Wissenschaft der frühen Zivilisationen sich
beträchtlich über diesen primitiven Zustand hinaus entwickelt hatte, doch mit Ausnahme
einiger überlieferter medizinischer Kenntnisse wissen wir nahezu nichts über die biologischen
Kenntnisse der Sumerer, Babylonier, Ägypter und anderer Zivilisationen vor den Griechen.
Nichts weist darauf hin, daß man für die Fakten, die man angesammelt hatte – welcher Art
auch immer sie gewesen sein mögen – irgendwelche erklärenden Schemata aufzustellen
versucht hat.
Die griechischen Dichter Homer und Hesiod hinterließen uns in ihren Epen eine lebendige
Beschreibung des Polytheismus der frühen Griechen, der in krassem Gegensatz zu dem
Monotheismus des Judentums, Christentums und Islams steht. Es scheint, als habe dieser
Polytheismus die Entstehung der Philosophie und der frühen Wissenschaft ermöglicht. Für die
Griechen gab es keinen mächtigen einzigen Gott mit einem „offenbarten" Buch, das das
Nachdenken über natürliche Ursachen zu einem Sakrileg machte. Ebenso wenig gab es eine
mächtige Priesterschaft, wie in Babylon, Ägypten und Israel, die das Monopol für alles
Nachdenken über das Natürliche und Übernatürliche für sich in Anspruch nahm. Nichts also
hinderte die verschiedenen Denker in Griechenland daran, zu verschiedenen Ergebnissen zu
gelangen.
In der Biologie der Griechen können wir drei große Traditionen unterscheiden. Die erste ist
die naturgeschichtliche Tradition. Sie beruht auf der Kenntnis der am Ort vorgefundenen
Pflanzen- und Tierwelt und reicht bis zu unseren vormenschlichen Vorfahren zurück. Diese
Kenntnisse wurden von Generation zu Generation mündlich weitergegeben, und es ist ziemlich
sicher, daß das wenige, was wir aus Aristoteles' Historia animalium und den
pflanzenkundlichen Schriften des Theophrastos über sie wissen, nur ein flüchtiger Blick auf
einen weit größeren Wissensbestand ist. Die Kenntnis wildlebender Tiere erfuhr in vielen
Kulturen eine wertvolle Ergänzung durch die Erfahrungen mit Haustieren. Individuelles
Verhalten, Geburt, Wachstum, Ernährung, Krankheit, Tod und viele andere Erscheinungen von
biologischer Bedeutung lassen sich weitaus leichter an Haustieren als an wildlebenden Tieren
beobachten. Da die meisten dieser Lebensäußerungen bei Tieren dieselben sind wie beim
Menschen, ermutigten sie zu vergleichenden Untersuchungen. Als die Zeit dafür reif war,
leistete dies einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Forschung in Anatomie und
Medizin.
Die zweite Tradition der Griechen ist die der Philosophie. Sie begann mit den ionischen
Philosophen Thaies, Anaximander, Anaximenes und ihren Schülern, die eine gänzlich neue
Methode begründeten [3]. Sie verstanden die Naturerscheinungen als durch natürliche
Ursachen und natürliche Ursprünge bedingt, statt sie mit Geistern, Göttern oder anderen
übernatürlichen Urhebern in Verbindung zu bringen. Bei ihrer Suche nach einem einigenden
Konzept, das als Erklärung für die vielen verschiedenen Phänomene herangezogen werden
könne, postulierten sie häufig eine letzte Ursache oder ein letztes Element, aus dem alles
andere entspringe, wie etwa Wasser, Luft, Erde oder ungeformte Materie.
Allem Anschein nach besaßen diese ionischen Philosophen eine beträchtliche Kenntnis der
Errungenschaften der babylonischen und anderer nahöstlicher Kulturen und übernahmen einige
ihrer Erklärungen, in erster Linie solche, die mit der unbelebten Natur zu tun hatten. Die
Spekulationen der Ionier über den Ursprung der Lebewesen hatten keinen bleibenden Einfluß.
Von etwas größerer Bedeutung waren ihre Überlegungen über die menschliche Physiologie.
Die wirkliche Bedeutung der ionischen Schule liegt darin, daß sie den Beginn der Wissenschaft
markiert; das heißt, die Ionier suchten nach natürlichen Ursachen für die Erscheinungen der
Natur.
Später, im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr., verlagerte sich das Zentrum des philosophischen
Denkens in die griechischen Kolonien in Sizilien und Süditalien. Die Schlüsselfiguren dort
waren Pythagoras, Xenophanes, Parmenides und Empedokles. Pythagoras mit seiner Betonung
von Zahlen und Mengen begründete eine einflußreiche Tradition, die nicht nur die exakten
Wissenschaften, sondern auch die Biologie beeinflußte. Empedokles scheint mehr als
irgendeiner seiner Vorgänger über biologische Fragen nachgedacht zu haben, aber wenig von
seinen Lehren ist erhalten geblieben. Er ist heute vor allem als derjenige bekannt, der die
Existenz von vier Grundstoffen postulierte: Feuer, Luft, Wasser und Erde. Die gesamte
materielle Welt war seiner Ansicht nach aus unterschiedlichen Kombinationen dieser vier
Elemente zusammengesetzt, was entweder zu größerer Homogenität oder andernfalls zu
größerer Mischung führte. Die Überzeugung von der Existenz dieser vier Elemente hat sich
mehr als 2000 Jahre gehalten. Die Frage Heterogenität oder Homogenität lebt in den Schriften
des im 19. Jahrhundert lehrenden Zoologen K.E. von Baer und in denen des Philosophen
Herbert Spencer wieder auf.
Die darauf folgenden Jahrzehnte sahen die Festigung zweier großer philosophischer
Traditionen, der Lehre Heraklits, die den Wandel betonte („Man kann nicht zweimal in
denselben Fluß steigen"), und der Demokrits, des Begründers der Atomlehre, der im Gegensatz
zu Heraklit die unveränderliche Konstanz der Atome, der kleinsten Bausteine aller Dinge,
hervorhob. Obgleich wenig überliefert ist, scheint Demokrit eine Menge über biologische
Probleme geschrieben zu haben, und man nimmt an, daß Aristoteles einige seiner Ideen von
Demokrit übernommen hat. Allem Anschein nach war er der erste, der ein Problem aufwarf,
das seitdem die Philosophie gespalten hat: Ist die Organisation von Phänomenen, insbesondere
in der Welt des Lebendigen, das Resultat bloßen Zufalls oder ist sie aufgrund der Struktur der
elementaren Bestandteile, der Atome, notwendig? Die Frage, ob Zufall oder Notwendigkeit, ist
seither unter Philosophen Gegenstand von häufigen Kontroversen gewesen [4]. Sie lieferte
Monod (1970) den Titel für sein viel gelesenes Buch. Mehr als 2200 Jahre nach Demokrit
zeigte Darwin, daß Zufall und Notwendigkeit nicht die einzigen zwei Möglichkeiten sind, daß
vielmehr der Zwei-Schritte-Prozeß der natürlichen Auslese Demokrits Dilemma aufhebt.
Diese frühen griechischen Philosophen erkannten, daß so vertraute physiologische
Erscheinungen wie Fortbewegung (Lokomotion), Ernährung, Wahrnehmung und
Fortpflanzung Erklärung erfordern. Den modernen Wissenschaftler berührt es seltsam, dass sie
meinten, sie könnten eine solche Erklärung lediglich durch konzentriertes Nachdenken über
das jeweilige Problem finden/Zugegeben, zu der Zeit, in der sie lebten, war dies vielleicht der
einzige vorstellbare Weg, diese Probleme anzugehen. Die Situation änderte sich langsam, vor
allem, als sich die experimentelle Wissenschaft während des ausgehenden Mittelalters und in
der Renaissance von der Bevormundung der Philosophie zu befreien begann.
Die noch fortlebende Tradition, durch bloßes Philosophieren wissenschaftliche Erklärungen
zu erlangen, hatte im 18. und 19. Jahrhundert einen zunehmend schädlichen Einfluß auf die
wissenschaftliche Forschung und veranlaßte Helmholtz zu bitterer Klage über die Arroganz der
Philosophen, die die Ergebnisse seiner Experimente ablehnten, weil sie sich im Widerspruch zu
ihren Deduktionen befanden. Die Einwände der essentialistischen Philosophen gegen den
Darwinismus sind ein weiteres Beispiel für diese Haltung. Im Griechenland der Antike jedoch
trug der deduktive philosophische Ansatz dazu bei, daß Fragen gestellt wurden, die niemand
jemals zuvor gestellt hatte. Er führte zu einer immer präziseren Formulierung dieser Fragen
und bereitete damit einer rein wissenschaftlichen Methode den Weg, die schließlich an die
Stelle der philosophischen Behandlung trat.
Als dritte große Tradition bestand in der Antike, neben der Naturgeschichte und der
philosophischen Tradition, die biomedizinische Tradition der Schule von Hippokrates (etwa
450-377 v. Chr.), die eine erhebliche Menge an Wissen und Theorie auf dem Gebiet der
Anatomie und Physiologie hervorbrachte. Dieser gesamte Wissenskomplex, der von der
alexandrinischen Schule (Herophilos und Erasistratos) und von Galen und seiner Schule
weiterentwickelt wurde, bildete die Grundlage für das Wiederaufleben der Anatomie und
Physiologie in der Renaissance, insbesondere in den italienischen Universitäten. Von der
nacharistotelischen Zeit bis hin zum 18. Jahrhundert war das Studium der menschlichen
Anatomie und Physiologie das Hauptanliegen der Biologie. Für die Wissenschaft als Ganzes, ja
für das gesamte abendländische Denken, waren jedoch die Entwicklungen in der Philosophie
weitaus wichtiger als irgendwelche konkrete Entdeckungen in Anatomie und Physiologie.
Zwei griechische Philosophen, Platon und Aristoteles, hatten einen größeren Einfluß auf die
spätere Entwicklung der Wissenschaft als alle anderen. Platon (etwa 427-347 v. Chr.) hatte ein
besonderes Interesse an der Geometrie, das sein Denken stark beeinflußte. Seine Beobachtung,
daß ein Dreieck, unabhängig von der Kombination seiner Winkel, immer ein Dreieck und als
solches in diskontinuierlicher Weise verschieden von einem Viereck oder jedem anderen
Vieleck ist, wurde zur Grundlage seines Essentialismus [5], einer Philosophie, die für die
Biologie gänzlich ungeeignet ist. Mehr als zweitausend Jahre waren nötig, bis es der Biologie
unter dem Einfluß Darwins gelang, sich von dem lähmenden Zugriff des Essentialismus zu
befreien. Platons Denken wurzelte in der Geometrie. Daher überrascht es nicht, daß er nur
wenig Verwendung für naturgeschichtliche Beobachtungen hatte. In der Tat stellt er in seinem
Werk Timaeus ausdrücklich fest, die Beobachtung mit den Sinnen schaffe wohl Vergnügen für
die Augen, doch ließe sich damit kein echtes Wissen erwerben. Da er der Seele wie auch dem
Architekten (Demiurg) des Kosmos besonderes Gewicht beimaß, konnten die Neo-Platoniker
die Brücke zum christlichen Dogma schlagen und eine Philosophie entstehen lassen, die bis
zum 17. Jahrhundert das Denken des abendländischen Menschen bestimmte. Ohne die
Bedeutung Platons für die Geschichte der Philosophie in Frage zu stellen, muß ich doch in aller
Deutlichkeit festhalten, daß er für die Biologie eine Katastrophe bedeutete. Seine ungeeigneten
Begriffe wirkten sich jahrhunderte lang nachteilig auf die Biologie aus. Das Entstehen des
modernen biologischen Denkens besteht zum Teil in der Emanzipation von der Platonischen
Philosophie.
Anders liegen die Dinge, wenn wir uns dem zweiten der einflußreichsten griechischen
Philosophen, Aristoteles, zuwenden.
Aristoteles
Niemand vor Darwin hat einen so großen Beitrag zu unserem Verständnis der lebenden Welt
geleistet wie Aristoteles (384-322 v. Chr.)[6]. Sein biologisches Wissen war umfassend und
nährte sich aus verschiedenen Quellen. In seiner Jugend wurde er von asklepiadischen Ärzten
erzogen. Später verbrachte er drei Jahre auf der Insel Lesbos, wo er offenbar viel Zeit auf das
Studium von Meeresorganismen verwandte. Fast jedes Teilgebiet der Geschichte der Biologie
muß mit Aristoteles anfangen. Er unterschied als erster mehrere der Fachgebiete der Biologie
und handelte sie in monographischer Form ab (Departibus animalium, De generatione
animalium usw.). Er erkannte als erster den großen heuristischen Wert des Vergleichs und wird
zu Recht als der Begründer der vergleichenden Methode gefeiert. Er war der Erste, der für eine
Vielzahl von Tierarten detaillierte Lebensgeschichten schrieb. Er widmete ein ganzes Buch der
Fortpflanzungsbiologie und den Lebensgeschichten (Egerton, 1975). Er zeigte ein starkes
Interesse an dem Phänomen der organischen Vielfalt, wie ihn auch die Bedeutung der
Unterschiede zwischen Tieren und Pflanzen fesselte. Zwar schlug er keine formale
Klassifikation vor, doch teilte er die Tiere nach gewissen Kriterien ein; seine Anordnung der
Invertebraten war der zweitausend Jahre später von Linnaeus aufgestellten Gruppierung
überlegen. Vielleicht der am wenigsten bemerkenswerte Teil seines biologischen Werkes ist
seine Physiologie; dort übernahm er weitgehend tradierte Ideen. Sehr viel mehr als seine
Vorgänger war er ein Empiriker. Seine Überlegungen gehen immer auf eigene Beobachtungen
zurück. An einer Stelle {De generatione animalium, 760 b 28) stellt er ziemlich deutlich fest,
die Information, die man von seinen Sinnen erhält, habe Vorrang gegenüber dem, was die
Vernunft einem eingibt. In dieser Hinsicht besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen ihm
und den sogenannten Aristotelikern unter den Scholastikern, die alle Probleme nur durch
Denken lösten.
Hervorragend und kennzeichnend für Aristoteles war, daß er nach Ursachen suchte. Er
begnügte sich nicht damit, lediglich Wie-Fragen zu stellen, sondern war, da er auch WarumFragen stellte, in erstaunlicher Weise modern. Warum entwickelt sich ein Organismus von
einem befruchteten Ei zur vollkommenen erwachsenen Form? Warum ist die Welt der
lebenden Organismen so reich an endgerichteten Tätigkeiten und Verhaltensweisen? Er
erkannte deutlich, daß der rohen Materie die Fähigkeit abging, die komplexe Form eines
Organismus hervorzubringen. Noch etwas anderes mußte vorhanden sein, etwas, das er mit
dem Wort eidos bezeichnete. Jedoch definierte er diesen Ausdruck völlig anders als Platon.
Aristoteles' eidos ist ein teleonomes Prinzip, das in seinem Denken genau dasselbe leistete wie
das genetische Programm des modernen Biologen. Im Gegensatz zu Platon, der eine äußere
Kraft postulierte, um die Ordnung der Natur und insbesondere ihre Tendenz zu Komplexität
und ihr Zielgerichtetsein zu erklären, lehrte Aristoteles, daß die natürlichen Substanzen sich
entsprechend ihrer eigenen Eigenschaften verhalten und daß alle Naturerscheinungen entweder
Prozesse oder die Manifestationen von Prozessen sind. Und da alle Prozesse ein Ziel haben,
war die Erforschung der Ziele seiner Ansicht nach eine wesentliche Komponente des Studiums
der Natur. Demzufolge haben für Aristoteles alle Strukturen und biologischen Tätigkeiten
einen biologischen Sinn oder, wie wir heute sagen würden, eine adaptive Bedeutung. Eins
seiner Hauptziele bestand gerade darin, derartige Bedeutungen aufzuklären. Aristotelische
Warum-Fragen haben in der Geschichte der Biologie eine wichtige heuristische Rolle gespielt.
„Warum?" ist die wichtigste Frage, die der Evolutionsbiologe bei allen seinen Studien stellt.
Man kann sich Ursprung und Wesen der Welt auf vielerlei verschiedene Weisen vorstellen:
(l)eine statische Welt von kurzer Dauer (die jüdischchristliche, geschaffene Welt), (2) eine
statische Welt von unbegrenzter Dauer (aristotelische Weltsicht), (3) eine zyklische
Veränderung im Zustand der Welt, bei der Perioden goldener Zeitalter mit Perioden des
Verfalls und der Wiedergeburt abwechseln, und (4) eine sich allmählich entwickelnde Welt
(Lamarck, Darwin). Aristoteles' Überzeugung von einer im wesentlichen perfekten Welt
schließt jeden Glauben an Evolution aus.
Die Pionierleistung des Aristoteles ist erst in den letzten Jahrzehnten in ihrem ganzem
Ausmaß gewürdigt worden. Für den schlechten Ruf, den Aristoteles in vergangenen
Jahrhunderten genoß, gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, daß die Thomisten ihn zu ihrer
Autorität erkoren, und als die Scholastik in Mißkredit geriet, teilte Aristoteles automatisch ihr
Schicksal. Noch wichtiger ist die Tatsache, daß während der naturwissenschaftlichen
Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts nahezu das gesamte Schwergewicht auf der Physik
und den exakten Naturwissenschaften lag. Aristoteles hatte eine bemerkenswerte Philosophie
der Biologie entwickelt, doch war er zum Unglück zugleich davon überzeugt, man könne
Makro- und Mikrokosmos in gleicher Weise behandeln, und wandte somit seine biologische
Denkweise auf die Physik und die Kosmologie an. Die Ergebnisse waren ziemlich
verhängnisvoll, wie Francis Bacon, Descartes und viele andere Autoren des 16., 17. und 18.
Jahrhunderts niemals müde wurden aufzuzeigen. Der Hohn, mit dem diese Autoren Aristoteles
überhäuften, ist angesichts der Vorzüglichkeit und Originalität des Gros seines Werkes schwer
zu verstehen.
Heute gewinnt Aristoteles erneut an Wertschätzung und Anerkennung. Diese Einstellung
wuchs, je mehr sich die Biologie von der Bevormundung durch die exakten Wissenschaften
befreite. Erst nachdem in unserer Zeit die dualistische Natur der lebenden Organismen restlos
verstanden worden war, erkannte man, daß das von Aristoteles postulierte gestaltende Prinzip
dem genetischen Programm, dem detaillierten Plan für Entwicklung und Handeln, entspricht.
Das hat zur Folge, daß wir Aristoteles toleranter gegenüberzustehen beginnen. Jahrhunderte
lang war die Welt der Philosophen und Physiker völlig taub gewesen gegenüber der
Versicherung von Naturbeobachtern wie z. B. Aristoteles, daß etwas mehr erforderlich sei als
die Gesetze der Physik, um aus einem Froschei einen Frosch und aus einem Hühnerei ein Huhn
werden zu lassen (Mayr, 1976). Dies erfordert jedoch weder einen elan vital, nisus formativus,
eine Entelechie oder lebendigen Geist, sondern lediglich die Einsicht, daß die komplexen
biologischen Systeme das Produkt genetischer Programme sind, deren Geschichte mehr als 3
Milliarden Jahre alt ist. Keine andere These hat derart zeitraubende und
adrenalinproduzierende Kontroversen heraufbeschworen wie das Märchen, Mikro- und
Makrokosmos gehorchten genau den gleichen Gesetzen. Noch gibt es nur wenige Anzeichen
dafür, daß diese Einsicht bereits bis zu der Mehrheit der Philosophen vorgedrungen ist, aber sie
beginnt sich unter den Biologen auszubreiten.
Nach Aristoteles bestanden die drei biologischen Traditionen der Griechen weiter fort. Die
Naturgeschichte, insbesondere die Beschreibung und Klassifikation von Pflanzen, erreichte in
den Schriften von Theophrastos und Dioskurides einen Höhepunkt, wohingegen Plinius, dessen
Interesse der Zoologie galt, ein enzyklopädischer Sammler war. Die biomedizinische Tradition
erreichte ihren Gipfel in Galen (131-200), dessen Einfluß bis zum 19. Jahrhundert anhielt.
In der Philosophie nach Aristoteles bildete sich eine Polarität zwischen den Epikureern und
den Stoikern heraus. Epikuros (342-271 v. Chr.) baute auf der von Demokrit gelegten
Grundlage auf. Er war davon überzeugt, alles bestehe aus unveränderlichen Atomen, die
herumwirbeln und wahllos zusammenstoßen. Er stellte eine gut durchdachte materialistische
Erklärung der unbelebten und der lebendigen Welt auf, derzufolge alle Dinge aus natürlichen
Ursachen erfolgen. Für ihn war Leben durch die Bewegungen lebloser Materie bedingt. Seine
Erklärung, wie Lebenserscheinungen aus der Ansammlung geeigneter Atomkonstellationen
entstehen, war bemerkenswert modern. Sein Schüler Lucrez (Titus Lucretius Carus) (99-55 v.
Chr.) vertrat eine ebenso kompromißlose materialistische Atomlehre. Beide lehnten Aristoteles'
teleologische Ideen ab. Lucrez argumentierte in wohldurchdachter Weise gegen die
Vorstellung der Zweckmäßigkeit. Er bediente sich bereits vieler Argumente, die im 18. und 19.
Jahrhundert wieder vorgebracht wurden. Doch die Kritik des Aristoteles an jenen Anhängern
der Atomlehre, die durch eine rein zufällige Wechselwirkung zwischen Wasser und Feuer
Löwen und Eichbäume produzierten, war ganz und gar berechtigt. Galen schloß sich seiner
Kritik an.
Die Beweisführung der Epikureer richtete sich in der Hauptsache gegen die Stoiker, die
pantheistische Ideen vertraten und an eine zum Nutzen des Menschen geschaffene,
zweckmäßige Welt glaubten. Ihrer Ansicht nach war es Aufgabe der Philosophie, die Ordnung
der Welt zu verstehen; später entwickelte sich die Naturtheologie aus dem Gedankengut der
Stoiker. Die Stoiker lehnten den Zufall als einen Faktor in der Welt ab; alles sei teleologisch
und deterministisch. Ihre Einstellung war absolut anthropozentrisch, sie betonten die
Unterschiede zwischen dem intelligenten Menschen und den instinktgeleiteten Tieren
(Pohlenz, 1948).
Nach Lucrez und Galen geschah bis zur Renaissance nichts mehr in der Biologie, was
wirkliche Konsequenzen gehabt hätte. Die Araber trugen, soweit ich das beurteilen kann,
nichts Wichtiges zur Biologie bei. Das gilt sogar für zwei arabische Gelehrte, Avicenna (9801037) und Aberrhos (Ibn Rosh, 1120-1198), die ein besonderes Interesse an biologischen
Fragen hatten. Allerdings war die Wiederentdeckung des Aristoteles in der westlichen Welt
den arabischen Übersetzungen seiner Werke zu verdanken, und dies war vielleicht der größte
Beitrag, den die Araber zur Geschichte der Biologie geleistet haben. Ein weiterer Beitrag von
ihnen war eher indirekter Art. Die Griechen waren große Denker, doch sie experimentierten
nur in begrenztem Umfang (Regenbogen, 1934). Demgegenüber waren die Araber groß im
Experimentieren, und man kann sogar behaupten, daß sie das Fundament legten, auf dem
später die experimentelle Naturwissenschaft entstehen sollte. Jedoch war es ein langer und
gewundener Pfad, der schließlich zu diesem Ziel führte; die wichtigste Zwischenstation war die
Alchimie.
Das christliche Weltbild
Als das Christentum die abendländische Welt eroberte, trat ein völlig neues Weltbild an die Stelle der
griechischen Vorstellung von einer ewigen, im wesentlichen statischen Welt. Die christliche Theologie ist
von der Idee der Schöpfung beherrscht. Nach der Bibel ist die Welt in relativ junger Zeit geschaffen
worden und alles Wissen über sie ist im offenbarten Wort enthalten. Diese Lehre schloß jede
Notwendigkeit, ja jede Möglichkeit aus, Warum-Fragen zu stellen oder Vorstellungen von einer Evolution
zu hegen. Die Welt, von Gott geschaffen, war „die beste aller möglichen Welten", wie Leibniz es später
ausdrückte. Die Einstellung des Menschen zur Natur war beherrscht durch Gottes Gebot: „Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch Untertan, und herrschet über die Fische im Meer
und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen" (Genesis 1, 28). Die
Natur war dem Menschen Untertan; im hebräischen oder christlichen Dogma gab es kein Einssein mit der
Natur, wie es die Animisten empfinden und wie es sich in vielen buddhistischen Religionen widerspiegelt.
Die in jüngerer Zeit proklamierte Achtung vor der Umwelt war den großen monotheistischen Religionen
des nahen Ostens fremd (White, 1967).
Keine andere Entwicklung im Christentum war für die Biologie so wichtig wie die Weltsicht, die als
Naturtheologie bezeichnet wird. In den Schriften der Kirchenväter wird die Natur gelegentlich mit einem
Buch verglichen – ein natürliches Analogon zu dem offenbarten Buch der christlichen Religion, der Bibel.
Die Gleichwertigkeit der beiden „Bücher" legt den Gedanken nahe, ein Studium des Buches der Natur, der
Schöpfung Gottes, könne als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Naturtheologie als Ergänzung zur
offenbarten Theologie der Bibel dienen.
Die christliche Naturtheologie war keine neue Philosophie. Die Harmonie der Welt und die ersichtliche
Vollkommenheit der Anpassungen im Reich des Lebendigen hatte schon lange vor dem Christentum
immer wieder die Beobachter beeindruckt. Schon im Alten Reich der Ägypter (Memphis), zweitausend
Jahre vor den Griechen und Hebräern also, hatte man eine schöpferische Intelligenz postuliert, die den
Naturerscheinungen ihre Form gegeben habe. Genauere teleologische Aussagen finden sich bei Herodot
und Xenophon. Platon sah die Welt als Schöpfung eines intelligenten, guten, logisch denkenden und
göttlichen Künstlers. Der Gedanke von der Erde als einer gestalteten und geeigneten Umwelt für das Leben
wurde von den Stoikern weiter gepflegt und bereichert. Galen trat voller Überzeugung für die Idee einer
geplanten Welt ein, das Werk eines weisen und mächtigen Schöpfers. Niemand jedoch war für die
Entwicklung der Naturtheologie von größerer Bedeutung als der heilige Thomas von Aquin. Durch seine
Schriften wurde eine teleologische Weltsicht im abendländischen Denken zur vorherrschenden
Geisteshaltung. In seiner Summa theologica beruht der fünfte Beweis der Existenz Gottes auf der Ordnung
und Harmonie der Welt, denn diese setzen voraus, daß es ein intelligentes Wesen geben muß, das alle
natürlichen Dinge ihrem Ziel zuführt.
Trotz der Lehren der Naturtheologie war das Zeitalter der Scholastik der Entwicklung der
Naturwissenschaften keineswegs förderlich. Die Scholastiker waren Rationalisten; sie bemühten sich
darum, die Wahrheit nicht durch Beobachtung oder Experiment, sondern durch Logik zu finden. Daher ihre
endlosen Disputationen. Lehre und Suche nach der Wahrheit, so wie sie sie betrieben, war das Privileg des
Klerus. Das Studium natürlicher Dinge, ja überhaupt jeder empirische Ansatz, wurde im allgemeinen
verachtet. Die vorherrschende Philosophie der Scholastik war die thomistische Philosophie, die nach
Thomas von Aquins eigener Überzeugung hauptsächlich von Aristoteles abgeleitet war. Diese Philosophie
ist unter dem sonderbar irreführenden Namen Realismus bekannt. Für einen modernen Biologen ist sie vor
allem durch ihre uneingeschränkte Unterstützung des Essentialismus gekennzeichnet. Dagegen betonte der
Nominalismus als einzige andere einflußreiche Schule der Scholastik, es existierten lediglich Individuen,
die durch Namen zu Klassen zusammengefaßt würden. Während des Mittelalters übte der Nominalismus
keinen Einfluß auf die Biologie aus, und es ist immer noch keinesfalls klar, ob und in welchem Maße er zu
dem schließlichen Entstehen von Empirizismus und Populationsdenken beitrug.
Die Vorstellung der christlichen Kirche von der überragenden Autorität des „offenbarten Wortes" wurde
im Mittelalter kurioserweise auf andere Schriften ausgedehnt, insbesondere auf das Werk des Aristoteles
und sogar auf die Schriften arabischer Gelehrter wie Avicenna. Entflammte eine Debatte darüber, wie viele
Zähne ein Pferd habe, so schlug man, um die Antwort zu finden, eher bei Aristoteles nach, als daß man
einem Pferd ins Maul sah. Die nach innen gerichtete Welt der mittelalterlichen Christenheit schenkte der
Natur wenig Aufmerksamkeit. Das begann sich im 12. und 13. Jahrhundert ein wenig zu ändern. Hildegard
von Bingen (1098-1179) und Albertus Magnus (1193-1280) schrieben über Naturgeschichte, doch ist ihr
Schaffen qualitätsmäßig nicht mit dem des glänzenden Beobachters Friedrich II (1194-1250) zu
vergleichen; sein großartiges Buch Kunst der Falkenjagd (De arte venandi cum avibus) war durch das
Interesse an Morphologie und Biologie der Vögel seiner Zeit um viele Jahrhunderte voraus. Friedrichs
echte Kenntnis des lebendigen Tieres, die so offenkundig auf persönlicher Erfahrung beruhte, stand hoch
über dem Niveau anderer zeitgenössischer naturgeschichtlicher Schriften, für die die unkritischen
Kompilationen von Cantimpr6 oder Beauvais als Beispiele angeführt sein mögen (Stresemann, 1975).
Friedrichs Einfluß war vielfältig. Er ließ einige von Aristoteles' Schriften ins Lateinische übersetzen und
war Schirmherr der medizinischen Fakultät von Salerno (gegründet 1150), wo zum ersten Mal seit mehr als
tausend Jahren menschliche Körper seziert wurden.
Nach Salerno wurden in verschiedenen Teilen Europas Universitäten gegründet, vor allem in Italien
(Bologna, Padua), Frankreich (Paris, Montpellier) und England (Oxford und Cambridge). Jede von ihnen
hat ihre ureigenste Geschichte, einige begannen als medizinische Fakultäten oder Rechtsschulen, andere,
wie die (etwa 1200 gegründete) Sorbonne, als theologische Fakultäten. Die meisten von ihnen wurden
rasch zu Zentren der Scholastik, und es herrscht keineswegs Einigkeit darüber, ob sich ihre Existenz
günstig oder nachteilig auf die abendländische Gelehrsamkeit ausgewirkt habe. Auf einigen Gebieten (zum
Beispiel dem der Anatomie) entwickelten sie sich schließlich zu Zentren fortschrittlicher Forschung. Zu
Mittelpunkten der biologischen Forschung wurden die Universitäten erst im späten 18. und frühen 19.
Jahrhundert.
Logik, Kosmologie und Physik (Crombie, 1952) erlebten im späten Mittelalter eine bemerkenswerte
Wiedergeburt, deren hohes intellektuelles Niveau erst in der jüngsten Generation richtig gewürdigt worden
ist. Im Vergleich zu ihnen lag die Biologie immer noch im tiefen Schlummer. Von allen Aspekten der
lebenden Natur widmete man sich lediglich medizinischen Problemen oder Fragen der menschlichen
Biologie. Vergeblich sucht man nach irgendeinem Bemühen, sich mit den großen unergründlichen Fragen
des Lebens auseinanderzusetzen, die für spätere Jahrhunderte und für den modernen Geist von solch großer
Faszination sein sollten. Man hat das Empfinden, dieser Mangel an Interesse habe auf irgendeine Weise
mit der extremen Frömmigkeit des Zeitalters zutun gehabt, die keine Fragen über Gottes Schöpfung zuließ,
doch dann wundert man sich, warum sich dieses Tabu nicht auch auf die Physik und Kosmologie
erstreckte. Lag es daran, daß das Ansehen der Mathematik und ihre theologische Neutralität automatisch zu
Physik und Kosmologie führten, während es keinen solchen „Schlüssel" gab, der die Tür zur Biologie
geöffnet hätte? Die Naturtheologie schlug schließlich eine solche Bresche, aber erfolgreich war sie damit
erst im 17. Jahrhundert. War es die Entdeckung exotischer Länder, in denen dieselben Himmelskörper zu
sehen waren und dieselben physikalischen Gesetze galten wie in Europa, wo aber gänzlich andere Faunen
oder Floren gefunden wurden? Lag es daran, daß es zur Erklärung der Erscheinungen des Lebens
erforderlich ist, sehr viel differenziertere Fragen zu stellen als sie das Studium fallender Körper aufwirft?
Wer soll das wissen? Es fehlt uns immer noch an einer brauchbaren Analyse der zeitlichen Verzögerung
zwischen dem Erwachen der mechanischen Wissenschaften und dem erst nach dem Ende des Mittelalters
erfolgenden Wiederaufleben der Biologie.
Die Renaissance
Während der Renaissance erwachte ein neues Interesse an der Naturgeschichte und Anatomie. Beide
gehörten zur Medizin, und die eifrigsten Forscher auf diesen Gebieten waren Lehrer der Medizin oder
praktizierende Ärzte. Wie sich aus der Zahl von Kräuterbüchern ersehen läßt, war das Studium von
Heilkräutern während des ganzen ausgehenden Mittelalters weit verbreitet, insbesondere nachdem die
Werke von Theophrastos und Dioskurides wieder verfügbar geworden waren. Doch bedurfte es der
Pflanzenbücher von Brunfels, Bock und Fuchs, um eine neue „Zurückzur-Natur"-Bewegung in der
Pflanzenforschung einzuleiten (siehe Kapitel 4). Allmählich begann sich auch der befreiende Einfluß des
Kennenlernens fremder Länder und Kontinente bemerkbar zu machen. Es begann mit den Kreuzzügen,
dann kamen die Reisen der venezianischen Kaufleute (wie Marco Polos Reise nach China) und die
Entdeckungsfahrten der portugiesischen Seefahrer, und den Höhepunkt bildete die Entdeckung der Neuen
Welt durch Christoph Colombus (1492). Eine entscheidende Folge dieser Reisen war die plötzliche
Erkenntnis der ungeheuren Vielfalt des Tier- und Pflanzenlebens überall auf der Erde. Diese Einsicht
wiederum führte zu der Veröffentlichung mehrerer enzyklopädischer Naturgeschichten, etwa denen von
Wotton, Gesner und Aldrovandi, wie auch zu mehr speziellen Naturgeschichten, z. B. der von Belon über
Vögel und der von Rondelet über Meeresorganismen.
Anatomie wurde in den mittelalterlichen medizinischen Fakultäten gelehrt, insbesondere in Italien und
Frankreich, allerdings auf eine sonderbar literarische Art. Der Medizinprofessor las nämlich Textstellen
von Galen vor, während ein Assistent („Chirurg") die entsprechenden Teile des Körpers sezierte. Letzteres
erfolgte mehr schlecht als recht, galten doch die Rhetorik und die Disputationen der Professoren, die alle
nichts anderes taten, als Galen zu interpretieren, als weitaus wichtiger als das Sezieren. Keiner trug so viel
dazu bei, diesen Zustand zu ändern, wie Andreas Vesalius (1514-1564). Er beteiligte sich selbst aktiv am
Sezieren, erfand neue Seziergeräte und veröffentlichte schließlich ein anatomisches Werk mit großartigen
Illustrationen: De Humani Corporis Fabrica (1543). In diesem Werk korrigierte er eine Reihe von
Irrtümern Galens, machte jedoch selbst nur eine begrenzte Zahl von Entdeckungen und behielt den
aristotelischen Rahmen der physiologischen Erklärung bei Trotzdem begann mitVesalius eine neue Ära in
der Anatomie, in der das scholastische Vertrauen auf die tradierten Texte durch eigene Beobachtungen
ersetzt wurde. Die Nachfolger des Vesalius, unter ihnen Falloppio, Fabricius ab Aquapendente, Eustachi,
Cesalpino und Severino,machten nicht nur wichtige Entdeckungen in der menschlichen Anatomie, mehrere
von ihnen leisteten darüber hinaus auch bedeutende Beiträge zur vergleichenden Anatomie und zur
Embryologie. Die besondere Bedeutung dieser Entwicklung liegt darin, dass sie die Grundlage für einen
Neubeginn in der Physiologie legte.
Die angewandten Wissenschaften, d.h. Technik und Ingenieurwesen, bereiteten während der
Renaissance den Boden für eine völlig neue Betrachtungsweise der Dinge vor. Die Mechanisierung des
Weltbildes, die sich aus dieser Bewegung ergab, erreichte einen ersten Gipfelpunkt in den Ideen von
Galileo Galilei (1564-1642) und seiner Schüler und Mitarbeiter. Für sie war die Natur ein
gesetzgebundenes System bewegter Materie. Bewegung war der Kern von allem, und für alles mußte es
eine mechanische Ursache geben. Galileis Betonung der Quantifizierung kommt in seiner Ermahnung zum
Ausdruck: „Miß alles, was meßbar ist, und mache das Nichtmeßbare meßbar!". Dies alles führte zur
Entwicklung und Verwendung von Instrumenten zur Bestimmung von Mengen und zur Berechnung von
Regelmäßigkeiten, die die Aufstellung allgemeiner Gesetze erlaubten; es führte dazu, daß man mehr auf
Beobachtung und Experiment vertraute als auf das Wort von Autoritäten. Das bedeutete insbesondere eine
Ablehnung bestimmter Aspekte der aristotelischen Lehre, die durch den Einfluß der Thomisten autoritative
Züge angenommen hatten.
Die Angriffe gegen Aristoteles kamen nicht nur von den Physikern, sondern auch aus der Philosophie.
Francis Bacon, besonders ätzend in seiner Kritik an Aristoteles, wurde zum Propheten der induktiven
Methode, obgleich seine eigenen biologischen Theorien ganz und gar deduktive Konstruktionen waren.
Bacons großes Verdienst jedoch war seine Betonung der Unvollständigkeit unseres Wissens, im Gegensatz
zu dem mittelalterlichen Glauben, daß Wissen vollkommen sei.
Der bei weitem bedeutendste Beitrag der wissenschaftlichen Revolution zur Biologie war eine neue
Einstellung zur Forschung: die uneingeschränkte Ablehnung der sterilen Scholastik, des Bemühens, die
Wahrheit bloß durch Logik zu finden. Man legte nun größeres Gewicht auf Experiment und Beobachtung,
auf das Sammeln von Tatsachen. Dies begünstigte die Erklärung der Regelmäßigkeiten in den
Erscheinungen der Welt durch Naturgesetze. Es wurde zur Aufgabe des Wissenschaftlers, diese Gesetze zu
entdecken. Die tatsächliche Anzahl konkreter Beiträge einer derartigen mechanistischen Methode zur
Biologie ist jedoch sehr klein. Zu ihnen gehören Harveys Messungen der Blutmenge, ein wichtiges Glied
in seiner Beweiskette zum Nachweis des Blutkreislaufs, ferner die Studien einiger Anatomen, insbesondere
Giovanni Alfonso Borellis (1608-1679) Arbeiten über Lokomotion. In der Tat ist kein anderer Zweig der
Physiologie für eine mechanische Analyse besser geeignet als die Bewegung von Extremitäten, Gelenken
und Muskeln.
Die Veröffentlichungen von Newtons Principia im Jahre 1687, in denen eine Mechanisierung der
gesamten unbelebten Welt auf mathematischer Basis vorgeschlagen wurde, ermutigte die Physiologen, an
ihre Probleme mit mechanistischen Methoden heranzugehen. Mehr als je zuvor wurde es nun modern, alles
auf physikalische Weise (durch Kräfte und Bewegungen) zu erklären, so ungeeignet eine derartige
Erklärung auch für die Mehrzahl biologischer Erscheinungen sein mochte. Zum Beispiel akzeptierte man
mehr als 150 Jahre lang die Erklärung der Warmblütigkeit von Säugetieren und Vögeln mit der Reibung
des Blutes in den Blutgefäßen, obgleich sie mit einigen einfachen Experimenten oder durch die
Beobachtung des Blutkreislaufs in kaltblütigen Amphibien oder Fischen von gleicher Körpergröße wie
Mäuse und Vögel hätte widerlegt werden können. Oberflächliche physikalistische Erklärungen waren im
17. und 18. Jahrhundert und gelegentlich noch später ein großes Hindernis für die biologische Forschung.
Wie Radi (1913) vor langem gezeigt hat, bedeutete der Triumph der exakten Wissenschaften während
der wissenschaftlichen Revolution in vielerlei Hinsicht eine Niederlage für die Biologie und für alle jene
spezifisch biologischen Denkweisen, die erst im 19. und 20. Jahrhundert wieder zu Ansehen gelangt sind,
wie Teleonomie (verleumdet als die Suche nach den letzten Ursachen), Systemdenken, das Studium
qualitativer und durch Emergenz entstehender Merkmale, auch historischer Entwicklungen. All dies wurde
vernachlässigt, wenn nicht sogar bekämpft und lächerlich gemacht. Die Antwort der Lebenswissenschaften
auf die Attacken der Physiker war entweder ein vergeblicher Versuch, biologische Vorgänge mit Hilfe der
völlig ungeeigneten Fachausdrücke der Physik („Bewegungen und Kräfte") auszudrücken, oder ein ebenso
vergeblicher Rückzug auf den Vitalismus oder übernatürliche Erklärungen. Erst vor erstaunlich kurzer Zeit
haben Biologen die intellektuelle Kraft aufgebracht, ein erklärendes Paradigma zu entwickeln, das die
einzigartigen Merkmale des Reiches des Lebendigen in vollem Maße berücksichtigt (s. Kap. 2) und
dennoch restlos mit den Gesetzen der Chemie und Physik vereinbar ist.
Descartes
Niemand hat vermutlich mehr zur Verbreitung des mechanistischen Weltbildes beigetragen als der
Philosoph
Rene
Descartes
(1596-1650).
Wie
Platon,
war
auch
er
in
seinem
Denken stark von der Mathematik beeinflußt, seine brillanteste Leistung auf diesem Gebiet war
wahrscheinlich
die
Erfindung
der
analytischen
Geometrie.
Seine
Angriffe
auf
die aristotelische Kosmologie waren gerechtfertigt und konstruktiv, obwohl sich seine
eigenen Vorschläge letzten Endes ebenso wenig durchsetzten. Seine These jedoch, die
Lebewesen seien bloße Maschinen, mußte jeden Biologen beleidigen, der auch nur das
mindeste von Organismen verstand. Descartes' krasser Mechanismus stieß daher auf
heftigen Widerstand in Form eines ebenso absurden teleologischen Vitalismus. Es ist
vermutlich kein Zufall, daß Frankreich, das Land mit den extremsten Mechanisten von
Descartes bis zu La Mettrie und Holbach, vielleicht auch die Hochburg des Vitalismus
war. Descartes' Behauptungen, Lebewesen seien nichts als Maschinen, die menschliche
Spezies unterscheide sich von ihnen durch den Besitz einer Seele, alle Wissenschaft müsse auf Mathematik
aufbauen, wie auch viele andere seiner allzu stark verallgemeinern den dogmatischen Aussagen, die sich
inzwischen als völlig falsch erwiesen haben, waren ein Mühlstein um den Hals der Biologie, dessen
Auswirkungen (in der Kontroverse Mechanismus-Vitalismus, zum Beispiel) noch bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts spürbar waren. Einer der schwächsten Bausteine in Descartes' Gedankengebäude war seine
Erklärung der Entstehung der Lebewesen. Sie entstanden seiner Ansicht nach durch das zufällige
Zusammentreffen von Partikeln. Letzten Endes betrachtete er also die Natur als ein Resultat des blinden
Zufalls. Diese These stand jedoch deutlich im Widerspruch zu der Ordnung der Natur und den
bemerkenswerten Anpassungen aller Kreaturen, die aufzuzeigen die Naturforscher nicht müde wurden.
Am verblüffendsten an Descartes ist, daß sein Gedankensystem großteils thomistisch ist, mochte er
selbst auch das Gegenteil beteuern. Eine gute Illustration seiner Denkweise sind die Schlüsse über seine
eigene Existenz: „Aus dem allen erkannte ich, daß ich eine Substanz war, deren ganze Wesenheit oder
Natur im Denken besteht und die, um zu sein, keines Ortes bedarf, noch auch von irgend einem materiellen
Dinge abhängt. Es ist demnach dieses Ich, d.h. die Seele, durch die ich bin, was ich bin, von meinem
Körper gänzlich verschieden (distinct) und selbst leichter zu erkennen, als er; und wenn es keinen Körper
gäbe, so würde sie trotzdem genau das bleiben, was sie ist" (Abhandlung über die Methode, Vierter Teil).
Die meisten seiner Resultate auf dem Gebiet der Physiologie erhielt er durch Deduktion, nicht durch
Beobachtung oder Experiment. Wie schon Platon vor ihm, so bewies auch Descartes durch das Versagen
seiner Methode, daß man biologische Probleme nicht durch mathematisches Argumentieren lösen kann. Es
ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten, bevor sich genau sagen läßt, welchen Einfluß Descartes auf die
spätere Entwicklung der Biologie hatte, insbesondere in Frankreich. Dazu gehört auch die Frage, wie weit
der Kartesianismus für die geringe Resonanz verantwortlich ist, die der Evolutionsgedanke (z. B. die
Lamarckschen Vorstellungen) in späteren Jahrhunderten in Frankreich fand. Rückblickend ist besonders
bemerkenswert, mit welcher Naivität Descartes und einige seiner Nachfolger rein physikalische
Erklärungen oberflächlichster Art akzeptierten. Buffon, zum Beispiel, kam zu dem Ergebnis, daß „eine
einzige Kraft", nämlich die Schwerkraft, „die Ursache aller Erscheinungen der rohen Materie ist, und daß
diese Kraft, zusammen mit der Wärmekraft, die lebenden Moleküle produziert, von denen alle Wirkungen
organisierter Körper abhängen" (Oeuvr. Phil., S.41).
Vielleicht mußte die Biologie in der Tat eine Phase durchmachen, in der sich der sterile kartesianische
Physikalismus durchsetzte. Die Scholastiker hatten unglücklicherweise Aristoteles' durchaus richtigen
Nachweis popularisiert, daß die biologische Form nicht in Begriffen bloß unbelebter Materie verstanden
werden könne, an die Stelle der aristotelischen Psyche jedoch die Seele des christlichen Dogmas gesetzt.
Die Physiologie eines Aristoteles und Galen wurde, im christlichen Sinn einer Seele interpretiert,
wissenschaftlich unhaltbar. Unter diesen Umständen gab es für Descartes zwei Möglichkeiten. Er konnte
entweder zu der aristotelischen „Form" zurückkehren und sie neu definieren, wie die moderne Biologie mit
dem genetischen Programm, oder er konnte für die Tiere auf die christliche Seele verzichten, ohne etwas
anderes an ihre Stelle zu setzen; dann war der Organismus ein Stück unbelebter Materie gleich allen
anderen unbelebten Dingen. Er optierte für die letztere Möglichkeit; eine inakzeptable Entscheidung für
jeden Biologen, der weiß, daß ein Lebewesen mehr als bloß unbelebte Materie ist. baß Descartes sie
annahm, beweist, wie wenig er Biologe war. Nur bei seinem Nachdenken über den Menschen erkannte er,
daß an seiner These etwas falsch sein mußte. So übernahm er den Dualismus von Körper und Seele, der
(bei Descartes nicht neu) uns seither Schwierigkeiten bereitet.
Die Herrschaft der mechanischen Weltsicht war allerdings nicht vollständig. In der Tat waren die
Behauptungen der Galileischen Mechanisten und der Kartesianer derart extrem, daß sie fast unverzüglich
Gegenströmungen auslösten. Zwei dieser Strömungen sind für die Geschichte der Biologie von besonderer
Bedeutung: das Entstehen der qualitativchemischen Tradition und das Studium der Vielförmigkeit. Beide
wurzelten zum Teil in der wissenschaftlichen Revolution.
Im 16. Jahrhundert entstand in der Physiologie eine neue Richtung, die sich, statt auf Bewegungen und
Kräfte, auf Beschaffenheit (Qualität) und chemische Bestandteile konzentrierte. Dieser Ansatz war im
Prinzip keineswegs antiphysikalistisch, denn er erklärte Lebensvorgänge mit Begriffen, Gesetzen und
Mechanismen, die zunächst entwickelt worden waren, um Prozesse in der unbelebten Welt zu erklären. Ich
erwähne Paracelsus (1493-1541) und seine Schüler, ferner die Alchimisten und die Schule, die man
gewöhnlich als Iatrochemie bezeichnet. So wenig aussichtsreich diese neue Strömung zu Beginn war, und
so falsch in Einzelheiten, um so nachhaltiger war ihr Einfluß auf lange Sicht für die kausale Analyse
biologischer Erscheinungen, im Gegensatz zu strikt mechanistischen Richtungen. Paracelsus, Genie und
Scharlatan, der an Magie und okkulte Kräfte glaubte, lehnte die Bedeutung der traditionellen vier Elemente
der Griechen ab und ersetzte sie durch Chemikalien, insbesondere Schwefel, Quecksilber und Salz. Seine
Auffassung der Lebensprozesse als chemische Vorgänge begründete eine neue Tradition, die durch J.H.
van Helmont (1577-1644) zum Beginn einer neuen Phase in der Geschichte der Physiologie wurde. Van
Helmonts Schriften enthalten eine merkwürdige Mischung aus Aberglauben, Vitalismus und
außerordentlich scharfsinnigen Beobachtungen. Er prägte den Ausdruck „Gas" und betrieb wichtige
Studien an CO2. Er erkannte die Azidität des Magens und die Alkalinität des Dünndarms und leitete damit
ein ganz neues Forschungsgebiet in der Ernährungsbiologie ein. Das Eindringen chemischer Erklärungen
in die Physiologie hielt unter seinen Schülern (z. B. Stahl) an.
Die Entdeckung der Vielfalt
Die Bemühungen um eine mechanistische Erklärung aller Erscheinungen dienten unter anderem dem
Ziel, die Einheit der Naturwissenschaft zu fördern. Die Physiker hatten den Ehrgeiz, die Phänomene des
Universums auf ein Minimum an Gesetzen zu reduzieren. Die Entdeckung der nahezu unbegrenzten
Mannigfaltigkeit von Tieren und Pflanzen provozierte auf dem Gebiet der Erforschung der lebenden
Organismen eine fast diametral entgegengesetzte Tendenz. Die Pflanzenkenner und Enzyklopädisten hatten
die Tradition von Theophrastos und Aristoteles neu belebt, indem sie die verschiedenartigsten Organismen
entdeckten und in liebevoller Kleinarbeit beschrieben. Immer mehr Naturforscher widmeten sich nun der
Erforschung der Vielfalt der Natur und erkannten, daß die Welt der Schöpfung weitaus reicher war, als
man sich hatte träumen lassen. Und die Herrlichkeit Gottes konnte man in jeder seiner Kreaturen
erforschen, von den niedrigsten bis hinauf zu Nashörnern und Elefanten, bewundert von Dürer und Gesner.
Gleichzeitig trug die wissenschaftliche Revolution dazu bei, das Interesse an der Vielfalt der Natur noch
weiter zu beleben. In der geistigen Atmosphäre der Mechanisierung wurden zahlreiche neue Instrumente
entwickelt, deren wichtigstes für die Biologen das Mikroskop war. Die Mikroskopie eröffnete dem
Biologen eine neue Welt. Zwar gestatteten die ersten Mikroskope lediglich eine zehnfache Vergrößerung,
doch reichte dies aus, um die Existenz eines gänzlich unerwarteten lebenden Mikrokosmos zu enthüllen,
vor allem der für das bloße Auge unsichtbaren im Wasser lebenden Organismen.
Die beiden hervorragendsten Wissenschaftler aus den Anfängen der Mikroskopie waren Anton van
Leeuwenhoek (1632-1723) und Marcello Malpighi (1628-1694). Sie beschrieben Tier- und
Pflanzengewebe (Geburtsstunde der Histologie) und entdeckten Süßwasserplankton, Blutzellen und sogar
das Spermatozoon. Charakteristisch für diese frühe Mikroskopie war die Freude am Entdecken. Ohne
bestimmtes Ziel untersuchten diese Forscher nahezu jedes vergrößerbare Objekt und beschrieben, was sie
sahen; biologische Theorie findet man in ihren Schriften sehr wenig. Nebenbei gesagt, war dreihundert
Jahre später eine ähnliche Einstellung auch für die ersten Anwendungen des Elektronenmikroskops
bezeichnend.
In dieser Zeit wurden auch die Insekten als Objekt für wissenschaftliche Studien entdeckt. Francesco
Redi wies im Jahre 1668 nach, daß Insekten nicht durch Urzeugung entstehen, sondern sich aus Eiern
entwickeln, die von befruchteten Weibchen gelegt werden. Jan Swammerdam (1637-1680) leistete
hervorragende anatomische Arbeit an der Honigbiene und anderen Insekten. Pierre Lyonnet, Ferchault de
Reaumur, de Serres, Leonhard Frisch und Roesel von Rosenhof waren weitere Naturforscher des 17. und
18. Jahrhunderts, die Wichtiges zur Kenntnis der Insekten beitrugen. Die meisten von ihnen wurden von
der reinen Freude getrieben, zu beschreiben, was sie entdeckt hatten, selbst wenn es sich lediglich um die
4041 Muskeln einer Raupe handelte (Lyonnet, 1762; s. Kapitel 4).
Der Enthusiasmus über die außerordentliche Vielfalt der Welt des Lebendigen wurde noch weiter
angefeuert von dem Erfolg der Seereisen und von der Fülle an exotischen Pflanzen und Tieren, die
Entdeckungsreisende aus aller Herren Länder in die Heimat brachten. Kapitän Cook nahm die Forsters,
Vater und Sohn, auf einer seiner Reisen als Naturkundler mit. Der jüngere Forster inspirierte Alexander
von Humboldt, der wiederum den jungen Charles Darwin. Die Ära der Überseereisen und
Forschungsexpeditionen in fremden Ländern brachte einen wahren Begeisterungstaumel für exotische
Organismen mit sich. Riesige Sammlungen wurden angelegt, als Beispiel seien nur die Sammlungen der
Schirmherren von Linnaeus in den Niederlanden, von Banks und seinen Konkurrenten in London und des
von Buffon geleiteten Jardin du Roi in Paris genannt.
Das exponentielle Wachstum der Sammlungen erweckte als vordringlichstes Bedürfnis der Zeit die
Klassifizierung. Nach seinen Anfängen bei Cesalpino (1583), Tournefort und John Ray (zu deren Werk, s.
Kap. 4), erreichte das Zeitalter der Klassifizierung seinen Höhepunkt in Carl Linnaeus (1707-1778). Zu
seiner Zeit wurde seine Bedeutung mehr als die jedes anderen Naturforschers seit Aristoteles gepriesen;
doch schon hundert Jahre später wurde sein Werk als pedantischer Rückfall in die Zeit der Scholastik
verunglimpft. Heute sehen wir ihn als ein Kind seiner Zeit, hervorragend in Vielem und blind in Anderem.
In der Fauna und Flora seiner Heimat beobachtete er (wie John Ray vor ihm) die deutliche Diskontinuität
der Arten und ging davon aus, daß die Umwandlung einer Art in eine andere unmöglich sei. Sein Beharren
auf der Konstanz und scharfen Abgrenzung der Arten, zumindest in seinen frühen Schriften, bereitete den
Weg für die spätere Entwicklung einer Evolutionstheorie. Erst in den letzten Jahren hat man sich wieder
der Beiträge erinnert, die Linnaeus zur Pflanzengeographie und Ökologie geleistet hat. Den meisten seiner
Nachfolger fehlte es leider an seiner natürlichen Begabung, und sie fanden volle Befriedigung in der
Beschreibung neuer Arten.
Aber nicht alle Naturforscher der Epoche verfielen der Modekrankheit der Artenbeschreibung. J.G.
Kölreuter (1733-1806) zum Beispiel, begann zwar mit dem tradierten Interesse an der Natur der Arten,
doch leistete er Pionierarbeit in der Genetik, Befruchtung und Blütenbiologie der Pflanzen. C. K.Sprengel
(1750-1816) führte mit umfassenden Versuchen über die Befruchtung von Pflanzen diese Studien fort.
Obwohl die Arbeit dieser beiden Forscher zu ihrer Zeit fast unbekannt blieb, war sie ein Teil des
Fundaments, auf dem Darwin später seine experimentelle Forschung über Befruchtung (und Fruchtbarkeit)
bei Pflanzen aufbaute.
Eine gänzlich andere Tradition der Naturgeschichte als die von Linnaeus wurde von Buffon begründet,
dessen Histoire naturelle (1749 ff.) fast von jedem gebildeten Europäer gelesen wurde. Das Schwergewicht
dieses Werkes lag auf der Darstellung des lebenden Tieres und seiner Lebensgeschichte, und es hatte einen
gewaltigen Einfluß auf die naturgeschichtlichen Studien – einen Einfluß, der erst in unserer modernen Zeit
der Ethologie und Ökologie voll zum Tragen kam. Im 18. und 19. Jahrhundert befand sich das Studium der
Naturgeschichte fast völlig in den Händen von Amateuren, vor allem Landpfarrern wie Zorn, White (Vikar
in Seiborne) und C. L. Brehm. So brilliant Buffon auch das naturgeschichtliche Wissen populär machte,
seinen größten Einfluß übte er vermutlich durch seine stimulierenden, oft wagemutig neuartigen Ideen aus.
Er hatte einen wahrhaft befreienden Einfluß auf das zeitgenössische Denken, und zwar auf so
verschiedenen Gebieten wie Kosmologie, Embryonalentwicklung, Artproblem, natürliches System und
Erdgeschichte. Er selbst rang sich nie ganz zu einer Theorie der Evolution durch, doch bereitete er ohne
jede Frage den Boden für Lamarck vor (s. Kap. 7). Ich stimme völlig mit dem überein, was Nordenskiöld
über Buffon sagt (1926, S.231): „Die Gerechtigkeit verlangt aber, daß wir seine Verdienste anerkennen,
denn er war zweifellos auf dem rein theoretischen Gebiet der hervorragendste unter den Biologen des 18.
Jahrhunderts, der an Gedanken der reichste war, und dessen fruchtbare Ideen noch in weiterer Zukunft von
Einfluß waren".
Die Mannigfaltigkeit ist natürlich ein Phänomen, das ganz und gar nicht in das Newtonsche Schema
physikalischer Gesetze hineinzupassen scheint. Doch da Gesetze der Beweis für die Existenz eines
gesetzgebenden Schöpfers waren, waren die Erforscher der Vielfalt – von Kielmayer über die Quinaristen
bis zu Louis Agassiz -, herausgefordert, Gesetze zu entdecken, die die Vielfalt ordneten. Diese
Bemühungen förderten, weitgehend entgegen der Absicht ihrer Autoren, eine Menge Beweismaterial
zugunsten der Evolution zutage.
Linnaeus begründete in jeder Hinsicht die Wissenschaft der Systematik und Buffon machte das Studium
der Natur zu jedermanns Zeitvertreib. Die Physiologie erklomm neue Höhen mit Haller, und die
Embryologie mit Bonnet und Wolff. Das Resultat war, daß die Biologie, die im 17. Jahrhundert
weitgehend im Schatten der Physik und der exakten Wissenschaften gestanden hatte, in der Mitte des 18.
Jahrhunderts den ihr zustehenden Platz einzunehmen begann.
Das Hauptanliegen des Jahrhunderts war ohne Zweifel das Beschreiben, Vergleichen und Klassifizieren
von Organismen. Die Anatomie, seit ihren Anfängen in erster Linie eine Methode der physiologischen
Forschung, wurde nun zunehmend zu einer vergleichenden Wissenschaft. Sie entwickelte sich zu einer
weiteren Methode des Studiums der Vielfalt. Der eigentliche Beginn der vergleichenden Methode, der
zweiten bedeutenden Methode der Naturwissenschaft (neben dem Experiment), fällt in die zweite Hälfte
des 18. Jahrhunderts. Zwar waren bereits seit dem 16. Jahrhundert vergleichende Untersuchungen
durchgeführt worden, beispielsweise von Belon, Fabrizio und Serverino, doch zu einer systematischen
Forschungsmethode wurde der Vergleich erst bei Camper, Hunter, Pallas, Daubenton und vor allem Vicq
d'Azyr. Die so begründete neue Tradition erreichte einen ersten Höhepunkt in dem Werk Cuviers, der in
einer Reihe methodischer Studien mit besonderem Gewicht auf den Invertebraten das Fehlen jeglicher
Zwischenglieder zwischen den Hauptstämmen des Tierreichs nachwies, und daher die Existenz einer scala
naturae ablehnte. Nach 1859 lieferten vergleichende anatomische Studien einige der überzeugendsten
Beweise zugunsten Darwins Theorie von der gemeinsamen Abstammung.
Naturtheologie
Ein moderner Mensch kann sich nur schwer die Einheit von Wissenschaft und christlicher Religion
vergegenwärtigen, die zur Zeit der Renaissance und bis weit ins 18. Jahrhundert hinein bestanden hat. Der
Grund für das Fehlen eines Konflikts zwischen Naturwissenschaft und Theologie lag darin, daß beide in
der Naturtheologie (Physiko-Theologie) – der Wissenschaft der Epoche – miteinander verschmolzen
worden waren. Der Naturtheologe erforschte die Werke des Schöpfers um der Theologie willen. Die Natur
war für ihn ein überzeugender Beweis für die Existenz eines höchsten Wesens, denn wie anders konnte
man sonst die Harmonie und Zweckmäßigkeit der Schöpfung erklären? Dies rechtfertigte das Studium der
Natur als eine angemessene Betätigung für einen Gläubigen des 17. Jahrhunderts. Der Geist der
Naturtheologie hatte selbst noch auf so späte Autoren wie Leibniz, Linnaeus und Herder sowie auf die
englische Naturwissenschaft bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein einen dominierenden Einfluß. Die
völlige Beherrschung aller wissenschaftlichen Tätigkeit und allen wissenschaftlichen Denkens durch die
Vorstellungen der Naturtheologie ist von den Wissenschaftshistorikern seit langem verstanden worden; es
liegt eine beträchtliche Reihe kluger Abhandlungen darüber vor.
Die Mechanisierung des Weltbildes stürzte den gottesfürchtigen Christen in ein schweres Dilemma.
Bekannte er sich zu den Behauptungen der Physiker, so mußte er annehmen, die Welt sei zu einem
einzigen Zeitpunkt geschaffen und zur gleichen Zeit seien auch Naturgesetze („sekundäre Ursachen")
aufgestellt worden, die später lediglich ein Minimum an göttlichen Eingriffen erforderlich machten. Die
Aufgabe des „Naturphilosophen" lag darin, die unmittelbaren Ursachen zu erforschen, in denen diese
göttlichen Gesetze sich manifestierten. Diese Auslegung paßte zwar recht gut zu den Erscheinungen der
physikalischen Welt, aber die Erscheinungen der Welt des Lebendigen standen völlig im Widerspruch
dazu, beobachtete man hier doch eine derartige Vielfalt individueller Handlungen und Wechselwirkungen,
daß es absolut unvorstellbar war, sie mit einer begrenzten Zahl grundlegender Gesetze erklären zu wollen.
Alles in der lebendigen Welt schien so unvorhersagbar, so besonders, so einzigartig, daß der beobachtende
Naturforscher sich genötigt sah, zur Erklärung jeder Einzelheit im Leben jedes Individuums aller
Lebewesen zurückzugreifen auf den Schöpfer, sein Denken und sein Handeln. Dies schien jedoch ebenso
undenkbar, da, wie einer der Kommentatoren bemerkte, ein Herrscher zwar seine Arbeiter überwacht, aber
nicht selbst alle Aufgaben eines Arbeiters erfüllt. Somit schien keine der Alternativen akzeptabel zu sein.
Die folgenden zweihundert Jahre waren von Versuchen und Bemühungen erfüllt, diesem Dilemma zu
entgehen; doch im Rahmen des Schöpfungsdogmas gab es keine Lösung. Die zwei philosophischen
Schulen bestanden daher weiter: Die Vertreter der exakten Wissenschaften sahen in Gott die Macht, die
zum Zeitpunkt der Schöpfung die alle Vorgänge dieser Welt regelnden Gesetze aufgestellt hatte. Anders
jene gottesfürchtigen Naturforscher, deren Studium die lebendige Natur war: in ihren Augen waren die
Gesetze von Newton und Galilei für die Erscheinungen der Vielfalt und der Anpassungen bedeutungslos.
Sie sahen vielmehr die Hand Gottes sogar in dem kleinsten Aspekt der Anpassung oder Vielfalt. John Rays
The Wisdom of God Manifested in the Works of Creation (1691) ist nicht nur ein eindringlicher
Gottesbeweis aus der Zweckmäßigkeit der Natur, sondern auch eine sehr zuverlässige Naturgeschichte, ja
man könnte sagen, eins der ersten ökologischen Werke überhaupt. Die Schriften der Naturtheologen waren
wegen der ausgezeichneten Qualität der ihnen zugrunde liegenden Beobachtungen weit verbreitet und
trugen viel zur Verbreitung des Studiums der Naturgeschichte bei. Die Naturtheologie war eine notwendige
Entwicklung, da in einer statischen, „erschaffenen" Welt Zweckmäßigkeit die einzige mögliche Erklärung
für die Anpassung war. Jede neue Entdeckung in diesen Anfängen der Naturgeschichte war Wasser auf die
Mühle der Naturtheologie. Insbesondere das scheinbar idyllische Leben der Eingeborenen in den Tropen
wurde als Beweis für die Existenz eines göttlichen Planes angesehen. Die Entdeckung der Wimpertierchen
und Hohltiere (Zoophyten) schien zu bestätigen, daß alle Lebewesen Glieder einer großen Kette waren und
der Mensch die Krone der Schöpfung. Aber die Stunde des Triumphs der Naturtheologie war kurz. Wurde
sie in einem großen Teil von Buffons Werken nur implizite in Frage gestellt, so war die Kritik in Humes
Dialogues (1779) über die Naturreligion und in Kants Kritik der Urteilskraft (1790) klar und
unmißverständlich.
Die Evolutionsbiologie profitierte beträchtlich von der Naturtheologie. Das klingt paradox, wenn man
bedenkt, daß die Evolution vor 1859 kaum Beachtung fand, und doch ist es wahr, wenn auch nur indirekt.
Die Naturtheologie stellte Fragen nach der Weisheit des Schöpfers und die sinnvolle Weise, in der er alle
Lebewesen zueinander und an ihre jeweilige Umwelt angepaßt hatte. Sie führte zu den fruchtbaren Studien
von Reimarus und Kirby über tierische Instinkte und zu C. K. Sprengels Entdeckung der wechselseitigen
Anpassungen der Blüten an die Bestäubung durch Insekten. Von Ray und Derham, über Paley bis zu den
Autoren der Bridgewater-Abhandlungen und vielen ihrer Zeitgenossen, beschrieben alle Naturtheologen
das, was wir heute Anpassungen nennen würden. Würde man in den erklärenden Systemen überall „Hand
des Schöpfers" durch „natürliche Auslese" ersetzen, so könnte man den Großteil der naturtheologischen
Literatur über lebende Organismen fast unverändert in die Evolutionsbiologie übernehmen. Niemand kann
bestreiten, daß die Naturtheologie ein beachtenswert reiches und solides Fundament für die
Evolutionsbiologie legte und daß erst zu Darwins Zeit wieder mit ebenso viel Eifer Studien über
Anpassungen betrieben wurden, wie es die Naturtheologen getan hatten.
Die Naturtheologie vermittelt eine äußerst optimistische Weltsicht. Doch viele Geschehnisse in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zerstörten diesen grenzenlosen Optimismus, angefangen mit dem
Erdbeben von Lissabon, den Schrecken der französischen Revolution und der Einsicht in die
Unerbittlichkeit des Kampfes ums Dasein. Die Herrschaft der Naturtheologie über das Denken des
abendländischen Menschen endete in Frankreich und Deutschland vor dem Ende des 18. Jahrhunderts.
Bemerkenswert anders war die Entwicklung in England: Hier erreichte die Naturtheologie in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine neue Blüte. Paleys Natural Theology (1802) und die Bridgewater
Abhandlungen (1832-1840) trugen den teleologischen Gottesbeweis noch einmal mit allem Nachdruck vor.
Die führenden englischen Paläontologen und Biologen der Epoche waren Naturtheologen, unter ihnen
Charles Lyell und andere Freunde Darwins. Diese Tatsache erklärt zum großen Teil das geistige Gerüst
von Darwins Origin of Species (s. Kap. 9).
Leben und Fortpflanzung
Das Studium der Lebewesen, mit Ausnahme der Naturgeschichte, wurde von der Renaissance bis zum 19.
Jahrhundert weitgehend von Medizinern betrieben. Sogar die großen Botaniker (außer Ray) hatten eine
medizinische Ausbildung. Ihr Anliegen war natürlich in erster Linie das Funktionieren des gesunden oder
kranken Körpers, und zweitens das Problem der „Fortpflanzung", d.h. das Entstehen neuer Lebewesen.
Etwa zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde es Aufgabe der Physiologie, einen Kompromiß zwischen den
zunehmend radikalen mechanistischen und den entgegen gesetzten vitalistischen Extremen zu finden.
Albrecht von Haller (1707-1777) gab der Physiologie eine neue Richtung. Er kehrte zur empirischen
Tradition von Harvey und den Anhängern der Vivisektion zurück und versuchte in zahllosen Tierversuchen
die Funktion verschiedener Organe zu bestimmen. Zwar fand er keinen Beweis für eine die
physiologischen Funktionen lenkende „Seele", doch überzeugten ihn seine Experimente, daß die Strukturen
des lebendigen Körpers bestimmte Eigenschaften (wie Reizbarkeit) besitzen, die in der unbelebten Natur
nicht zu finden sind.
Trotz Hallers ausgewogener Schlußfolgerungen schwang das Pendel bis ins erste Viertel des 20.
Jahrhunderts weiter zwischen Vitalismus und Mechanismus hin und her; beide Extreme bekämpften sich
weiter gegenseitig. Der Vitalismus wurde z. B. von der Montpellierschen Schule (Bordeu, Barthez)
verfochten, von den deutschen Naturphilosophen, von Bichat und Claude Bernard, wie auch von Driesch;
Ludwig, Du Bois-Reymond, Julius Sachs und Jacques Loeb vertraten dagegen einen kompromißlosen
Mechanismus. Man kann vermutlich zu recht sagen, daß diese Kontroverse erst beigelegt wurde, als man
erkannt hatte, daß alle Entwicklungs- und Lebensvorgänge von genetischen Programmen gesteuert werden.
Kehren wir zum 17. und 18. Jahrhundert zurück: Die zweite große Kontroverse betraf das Wesen der
Entwicklung. Es galt, die Frage zu beantworten, wie sich das „amorphe" Froschei in einen ausgewachsenen
Frosch und ein Fischei in einen Fisch entwickeln könne. Die Vertreter der Präformationstheorie glaubten,
es gäbe etwas Vorgeformtes in dem Ei, das dafür verantwortlich sei, daß aus dem Ei eines Grasfrosches ein
Grasfrosch und aus dem einer Forelle eine Forelle werde. Die extremen Vertreter der präformistischen
Schule postulierten eine Präexistenz; sie meinten, auf irgendeine Weise sei ein Miniaturerwachsener
(Homunkulus) in dem Ei (oder in dem Spermatozoon) eingeschlossen, eine unglückliche Annahme, deren
Absurdität sich leicht nachweisen ließ. Ihre Gegner vertraten die These der Epigenese, also der
allmählichen Differenzierung eines völlig amorphen Eis in die Organe des erwachsenen Lebewesens; das
war kaum überzeugender, denn es erklärte die Artspezifizität der Entwicklung nicht, es sei denn, man zog
Vitalkräfte zur Erklärung heran. Die Epigenetiker waren die führenden Vertreter des Vitalismus. Wie so
häufig in der Geschichte der Biologie, gewann am Ende keine der sich widersprechenden Theorien die
Oberhand, vielmehr setzte sich eine Mischung ausgewählter Elemente aus beiden durch. Die Epigenetiker
hatten recht mit ihrer Aussage, das Ei sei zu Beginn im wesentlichen undifferenziert, und die Präformisten
hatten recht damit, daß seine Entwicklung von etwas Vorgeformtem gesteuert wird, was heute als das
genetische Programm erkannt ist. Beteiligt ah dieser Kontroverse waren außer Haller Bonnet, Spallanzani
und C. F. Wolff (Roe, 1981).
Die Biologie in der Zeit der Aufklärung
Wie schon das Wort „Aufklärung" besagt, war das 18. Jahrhundert, von Buffon, Voltaire und Rousseau bis
zu Diderot, Condillac, Helvetius und Condorcet, eine geistig befreiende Periode. Die vorherrschende Form
der Religion war der Deismus. Der aufgeklärte Deist gestand zwar die Existenz Gottes zu, doch konnte er
keinen Beweis dafür finden, daß Gott die Welt zum Nutzen des Menschen geschaffen hatte. Sein Gott war
die höchste Intelligenz, der Schöpfer der Welt und ihrer universalen Ordnung, der Verkünder allgemeiner
und unwandelbarer Gesetze. Es war ein ferner Gott, fern vom Menschen, um den er sich wenig kümmerte.
Vom Deismus über den Agnostizismus bis zum völligen Atheismus war es nur noch ein kleiner Schritt,
und viele Denker taten diesen Schritt.
Die Aufklärung war eine Zeit, in der jedes bis dahin gültige Dogma, ob theologischer, philosophischer
oder wissenschaftlicher Art, in Frage gestellt wurde. Allerdings sollte uns die Verfolgung der Philosophen
durch die französische Regierung („den König") die Augen dafür öffnen, daß viele der Lehren der
Philosophen nicht nur philosophische, sondern auch politische Konsequenzen hatten.
Condorcets Lehre von der Gleichheit aller, zum Beispiel, war eine Rebellion gegen die
Klassenprivilegien (Feudalismus) und ließ biologische Aspekte völlig außer acht. Sie erkannte lediglich
drei Arten von Ungleichheit an, Reichtum, sozialen Status und Bildung, leugnete jedoch Unterschiede in
der natürlichen Begabung. Nach Condorcets Überzeugung ließ sich völlige Gleichheit erreichen, sobald die
Gleichheit von Reichtum, Status und Erziehung erreicht worden sei. Eine Vorstellung wie natürliche
Auslese oder sogar Evolution konnte für jemanden, der sich einem derart kompromißlosen
Gleichheitsgedanken verschrieben hatte, keinen Sinn haben.
Man darf allerdings nicht vergessen, daß die Aufklärung keine homogene Bewegung war. Es gab fast
ebenso viel verschiedene Ansichten, wie es Philosophen gab.
Paris von Buffon bis zu Cuvier
Die Geschichte der Biologie ist reich an Episoden, in denen ein Zentrum der Forschung wie ein Meteor
aufstieg. Die norditalienischen Universitäten im 16. und 17. Jahrhundert sind ein Beispiel, die deutschen
Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert ein anderes, und Paris von Buffon (1749) bis
Cuvier (1832) ein drittes. Über die Beiträge der Hauptfiguren dieser Galaxis Pariser Sterne wird in späteren
Kapiteln zu sprechen sein, an dieser Stelle aber müssen wir einen Namen herausgreifen, den von Lamarck
(1744-1829), denn sein Vorschlag einer Evolutionslehre (zum ersten Mal in seinen Discours, 1800
formuliert) bedeutete ein drastisches Abwenden von der Tradition.
Man sagt oft, nur junge Leute hätten revolutionäre neue Ideen, Lamarck war jedoch über fünfzig Jahre
alt, als er seine heterodoxen Vorstellungen entwickelte. Seine geologischen Studien hatten ihn davon
überzeugt, daß die Erde sehr alt war und daß sich die Bedingungen auf ihr beständig veränderten. Er war
sich vollauf dessen bewußt, daß die Organismen an ihre Umwelt angepaßt sind; daher mußte er folgern,
daß sie sich verändern müssen, um ihre Anpassung an die in ständigem Wechsel begriffene Welt
beizubehalten. Sein Vergleich fossiler Mollusken in den verschiedenen Schichten des Tertiärs und bis zur
Gegenwart bestätigte seine Überlegungen. Das führte (1809) Lamarck zu seiner Theorie der Umbildung;
sie postulierte einen den Organismen innewohnenden Trieb zur Vervollkommnung und eine Fähigkeit zur
Anpassung an die Anforderungen der Umwelt. Nahezu alle seine Bemühungen blieben jedoch erfolglos,
vor allem, weil er in herkömmlichen Vorstellungen (wie der einer Vererbung erworbener Eigenschaften)
befangen war. Lamarck, von Cuvier auf das heftigste angegriffen, beeindruckte dennoch viele seiner Leser,
unter ihnen Chambers, den Autor der Vestiges (1844). Trotz aller entgegengesetzter Beteuerungen war
Lamarck zweifellos ein Wegbereiter Darwins. Seine Beiträge zur Botanik und zum biologischen Wissen
sowie zur Klassifikation der Wirbellosen hätte Lamarck auch ohne seine Evolutionstheorie einen
ehrenhaften Rang in der Geschichte der Biologie gesichert.
Man schreibt Lamarck gelegentlich das Verdienst zu, mit seiner Theorie der Evolution (1800; 1809) und
dadurch, daß er im Jahre 1802 das Wort „Biologie" prägte (das unabhängig davon im Jahr 1800 von
Burdach und 1802 von Treviranus vorgeschlagen worden war), eine neue Ära der Biologie eingeleitet zu
haben. Ein umfassender Blick auf die Biologie bestätigt dies nicht. Lamarcks Evolutionstheorie hatte
außerordentlich wenig Einfluß, und das Prägen des Wortes „Biologie" allein schuf noch keine Wissenschaft
der Biologie. Trotz Lamarcks großartiger Schemata (Grasse, 1940) und des Werks einiger
Naturphilosophen in Deutschland, gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts tatsächlich noch keine Biologie.
Die noch zu schaffende Biologie warf lediglich ihre Schatten voraus. Was es tatsächlich gab, war die
Naturgeschichte und die medizinische Physiologie. Zu einer Einheit wurde die Biologie erst, als die
Evolutionsbiologie entstanden und Disziplinen wie die Zytologie entwickelt waren.
Lamarcks großer Gegenspieler war Cuvier (1769-1832), dessen Beiträge zur Wissenschaft fast zu
zahlreich sind, um aufgezählt zu werden. Er begründete zweifellos die Paläontologie, und seine Analyse
der Wirbeltierfaunen des Pariser Beckens war ein ebenso wichtiger Beitrag zur Stratigraphie wie die Arbeit
William Smiths in England. Cuviers bedeutende Studien in der vergleichenden Anatomie und seine Absage
an die scala naturae sind bereits erwähnt worden. Als E. Geoffroy Saint-Hilaire die Idee eines
einheitlichen Plans im gesamten Tierreich erneut aufleben lassen wollte, widerlegte Cuvier diese
Behauptungen in vernichtender Weise. Der sogenannte Akademie-Disput (1831) mit Geoffroy SaintHilaire war nicht eine Debatte über Evolution, wie gelegentlich behauptet wird, sondern drehte sich um die
Frage, ob sich die Baupläne aller Tiere auf einen einzigen Archetypus reduzieren lassen oder nicht.
Cuvier hatte einen gewaltigen Einfluß auf seine Zeit, einen guten und einen schlechten. Er förderte die
Forschung in der vergleichenden Anatomie (vielleicht mehr in Deutschland als in Frankreich) und in der
Paläontologie, doch drückte er auch Generationen von französischen Biologen seine konservative
Gesinnungsart auf. Das hatte unter anderem zur Folge, daß die Evolution trotz Lamarcks in Frankreich
langsamer akzeptiert wurde als in jedem anderen wissenschaftlich aktiven europäischen Land. Cuvier
spielte in der Geschichte der Evolutionslehre eine bemerkenswert paradoxe Rolle. Er bekämpfte sie in
ihrem Exponenten, Lamarck, mit all der Kraft seines Wissens und seiner Logik, andererseits gehörten
jedoch seine eigenen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der vergleichenden Anatomie, der Systematik
und der Paläontologie mit zu dem besten Beweismaterial für die späteren Verfechter der Evolutionstheorie.
Der Aufstieg der Wissenschaft vom 17. bis zum 19. Jahrhundert
Vieles geschah in diesen drei Jahrhunderten, aber häufig ist es unmöglich zu unterscheiden, was Ursache
und was Effekt war. Die Reisen der lateinisch sprechenden Gelehrten von Land zu Land, die für das späte
Mittelalter und die Renaissance charakteristisch gewesen waren, nahmen in auffallender Weise ab und
damit die Verbreitung der lateinischen Sprache. Infolgedessen wuchs der Nationalismus in der
Wissenschaft, unterstützt von der Verwendung nationaler Sprachen in der gelehrten Literatur. Immer
seltener nahm man auf Werke ausländischer Literatur Bezug. Dieser Provinzialismus erreichte seinen
Höhepunkt im 19. Jahrhundert, mit dem Resultat, daß jedes Land sein eigenes intellektuelles und geistiges
Milieu besaß.
Vermutlich gab es keine andere Ära in der abendländischen Geschichte, in der der Zeitgeist in den
einzelnen Nationen so unterschiedlich war wie in der Zeitspanne von 1790 bis 1860. In England dominierte
der Empirizismus. Er baute auf einer (nominalistischen) Tradition auf, die auf William von Ockham
zurückging, wurde in erster Linie von John Locke entwickelt und von den Chemikern des 18. Jahrhunderts,
Hale, Black, Cavendish und Priestley, übernommen. Frankreich erlebte die Schrecken der Revolution und
dann nach der Wiedererrichtung der Monarchie eine reaktionäre Restauration. Zwar spielten weder die
Naturtheologie noch die Kirche eine Rolle, doch war die Grundhaltung, in der Biologie durch Cuvier
bestimmt, konservativ. In Deutschland war die Stimmung dagegen völlig anders. Hier war ein Land, das
nach den schlimmen Heimsuchungen und Entbehrungen des 17. und 18. Jahrhunderts auf dem Wege zu
sich selbst war, und der neue Geist drückte sich in großem Enthusiasmus aus, zuerst für die klassische
Antike, dann für romantische Bewegungen, und kulminierte schließlich in der Naturphilosophie eines
Schelling, Oken und Carus. Wie in Frankreich, so spielte auch in Deutschland die Naturtheologie nach
etwa 1780 keine Rolle mehr. In England geschah jedoch das Gegenteil: hier war die Naturtheologie die
absolut beherrschende Geistesrichtung. Die Naturwissenschaft, insbesondere die Biologie, wurde
vernachlässigt und befand sich fast völlig in der Hand von Amateuren, wenn nicht Dilettanten. Dies ist der
Hintergrund, vor dem das Entstehen des Darwinismus zu sehen ist.
Die Professionalisierung der Wissenschaft bildete sich in Frankreich nach der Revolution von 1789
heraus und etwa zur gleichen Zeit auch in Deutschland (allerdings ist mir keine ausführliche Analyse dieser
Frage bekannt, siehe Mendelsohn, 1964), in England aber verzögerte sie sich bis etwa in die Mitte des 19.
Jahrhunderts. Die heute allgemein gültige Vorstellung von der Wissenschaft und ihrer Ausübung entstand
weitgehend an den deutschen Universitäten. Hier wurden in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts die
ersten Laboratorien für Unterrichtszwecke errichtet (die von Purkinje, Liebig und Leuckart). Die deutschen
Universitäten des 19. Jahrhunderts widmeten sich mehr als die irgendeines anderen Landes der Forschung
und Lehre. Niemand sah einen Widerspruch zwischen reiner Wissenschaft und nützlichem Wissen. Das
Universitätssystem in Deutschland hatte eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Lehrlingssystem in den
handwerklichen Berufen. Es spornte zu vortrefflicher Arbeit und Leistung an.
Als die Wissenschaft in den Vereinigten Staaten zu blühen begann und „graduate schools" an den
Universitäten errichtet wurden, wurde überwiegend das System der deutschen Universität übernommen. In
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts begannen die Gelehrten erneut zu reisen, sich zwischen den
Ländern zu bewegen; die meeresbiologische Station in Neapel wurde ein wichtiger Anziehungspunkt. Die
Wissenschaft wurde wieder einmal international. Diese Tatsache hatte (nebenbei bemerkt) einen starken
Einfluß auf die Entwicklung der experimentellen Biologie in den Vereinigten Staaten (Allen, 1960).
Noch ein Wort zur geographischen Situation. Nahezu alle wichtigen Beiträge, die vom 15. Jahrhundert
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zum Fortschritt der Biologie geleistet wurden, kamen aus nur sechs
oder sieben Ländern. Der Mittelpunkt war zunächst Italien, danach verlagerte er sich in die Schweiz, dann
nach Frankreich und in die Niederlande, später nach Schweden und schließlich nach Deutschland und
England. Die Gelehrten bewegten sich ungehindert von einem Land ins andere, und die Gründe für die
vorübergehende Vorherrschaft des einen oder anderen Landes waren in erster Linie wirtschaftlicher und
soziologischer Art. Einer der Gründe für den Primat Deutschlands in der Biologie im 19. Jahrhundert war
die frühe Errichtung von Lehrstühlen für Zoologie, Botanik und Physiologie an den deutschen
Universitäten. Zu einer Zeit, als Richard Owen wohl der einzige berufsmäßige Biologe in England war (die
gesamte Lehre war in der Hand entweder von Geistlichen oder von Ärzten), waren Zoologie und Botanik
in Deutschland bereits zu Berufen geworden.
Das Wesen der wissenschaftlichen Veröffentlichung
Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein entwickelte sich die Wissenschaft in recht gemächlichem Tempo. In
vielen Disziplinen und Unterdisziplinen gab es zu jeder Zeit jeweils nur einen einzigen Fachmann. So
wenige arbeiteten in den verschiedenen Zweigen der Biologie, daß Darwin meinte, er könne es sich leisten,
20 Jahre zu warten, bevor er seine Theorie der natürlichen Auslese veröffentlichte. Er war wie vom Donner
gerührt, als jemand anders (A. R. Wallace) dieselbe Idee hatte wie er. Als mit der Einrichtung von
Lehrstühlen für verschiedene Zweige der Biologie an zahlreichen Universitäten die Professionalisierung
der Biologie begann und jeder Professor zahlreiche junge Spezialisten heranbildete, setzte eine
exponentielle Beschleunigung in der Rate der wissenschaftlichen Produktion ein.
Die zahlenmäßige Zunahme an Fachleuten hatte zur Folge, daß sich das Wesen der biologischen
Veröffentlichung änderte. Wie Julius Sachs in seiner Geschichte der Botanik zeigte, fand dieser Wandel in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Die großen Werke, die für das 18. Jahrhundert charakteristisch
gewesen waren, wie Buffons Histoire naturelle oder Linnaeus' Systema Naturae, wurden nunmehr nicht
nur durch kürzere Monographien ergänzt, sondern auch – und das ist wichtiger – durch kurze
Zeitschriftenartikel. Damit entstand ein Bedürfnis nach vielen neuen Zeitschriften. Bis 1830 hatte es neben
allgemeinen Veröffentlichungen wie die Göttinger Wissenschaftliche Nachrichten nur die
Veröffentlichungen der Royal Society, der französischen Akademie und anderen Akademien gegeben. Nun
begannen spezielle Gesellschaften wie die Zoological Society, die Linnean Society und die Geological
Society of London mit Publikationen. Unabhängige Zeitschriften entstanden, etwa die Annals and
Magazine, American Journal of Science, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie und Jahrbücher für
wissenschaftliche Botanik. Es fehlt immer noch eine Geschichte der biologischen Zeitschriften; daß diese
jedoch eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Biologie spielten, steht außer Frage.
In dem Maße, wie sich die Biologie in der jüngeren Zeit immer stärker spezialisierte, wurden
Chromosoma, Evolution, Ecology und die Zeitschrift für Tierpsychologie (um wie der nur ein paar zufällig
herausgegriffene Beispiele zu nennen) zu Sammelpunkten neu entstehender Untergebiete. Wir sind heute
so weit, daß in wenigen Jahrzehnten mehr Artikel (und Seiten) veröffentlicht werden als in der gesamten
vorangehenden Geschichte der Biologie. Dies hat eine enorme Erweiterung und Vertiefung der Biologie
zur Folge, doch wenn wir versuchen wollten, eine Liste der zehn fundamentalsten Probleme der Biologie
aufzustellen, so würden wir wahrscheinlich feststellen, daß die meisten von ihnen schon vor mindestens 50
oder 100 Jahren zum ersten Mal aufgeworfen wurden. Selbst wenn der Historiker nicht jede Frage oder
jede Kontroverse bis in unser Jahrzehnt (1980) hinein verfolgen kann, so kann er gewiß eine Grundlage
schaffen, von der aus es leichter ist zu verstehen, was gegenwärtig getan wird.
Trennende Entwicklungen im 19. Jahrhundert
Die Entwicklung der vergleichenden Methode gegen Ende des 18. Jahrhunderts bot zum ersten Mal eine
ausgezeichnete Gelegenheit zum Zusammenschluß der Biologie, zum Brückenschlag zwischen
Naturbeobachtern und Anatomen/Physiologen. Cuviers Betonung der Funktion verstärkte diese Bindung
noch. Aber nur wenige Biologen ergriffen die Gelegenheit, niemand so sehr wie Johannes Müller (18001858), der in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts von der reinen Physiologie auf vergleichende
Embryologie und Morphologie der Wirbellosen umstieg. Müllers eigene Schüler vertieften die Spaltung in
der Biologie durch ihr aggressives Eintreten für eine physikajistischreduktionistische Methode bei der
Erforschung des Lebens, die ungeeignet war für die Untersuchung der Phänomene, an denen die
Naturbeobachter interessiert waren. Von den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts an fehlte es, mehr denn
je, an Kommunikation zwischen Naturbeobachtern und Physiologen, oder wie man es nach 1859 nennen
konnte, zwischen den Erforschern der evolutionären (letzten) und denen der physiologischen
(urlmittelbaren) Ursachen. In mehrfacher Hinsicht war diese Polarität nur eine Fortsetzung des alten
Konflikts zwischen den Kräuterkundlern/Naturbeobachtern und den Ärzten/Physiologen des 16.
Jahrhunderts, nur daß die Konfliktpunkte und Interessenunterschiede nunmehr weitaus präziser definiert
waren, vor allem nach 1859. Nun standen zwei gut umrissene Biologien, die Evolutionsbiologie und die
funktionale Biologie, nebeneinander. Sie wetteiferten miteinander um Talente und Mittel, und sie stürzten
sich in eine Kontroverse nach der anderen, die aus der Schwierigkeit entstanden, den Blickwinkel des
Gegners zu verstehen.
Einige Wissenschaftshistoriker unterscheiden gern zwischen verschiedenen Perioden mit jeweils einem
einzigen beherrschenden Paradigma (Kuhn), episteme (Foucault) oder einer einzigen dominierenden
Forschungstradition. Diese Auffassung paßt jedoch nicht auf die Situation in der Biologie. Seit der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts findet man immer häufiger selbst innerhalb einer biologischen Disziplin oder
Fachrichtung zwei nebeneinander existierende scheinbar unvereinbare Paradigmen, wie Präformation und
Epigenese, Mechanismus und Vitalismus, Iatrophysik und Iatrochemie, Deismus und Naturtheologie, oder
Katastrophentheorie und Uniformitarismus, um nur einige der zahlreichen Polaritäten zu erwähnen. Das
erschwert die Interpretation erheblich. Wie läßt sich vor dem Hintergrund des gesamten intellektuellen,
kulturellen und geistigen Kontextes, vor dem Hintergrund des Zeitgeists der Epoche, erklären, daß sich
zwei diametral entgegengesetzte Weltbilder herausgebildet und erhalten haben?
Der Geschichtsschreiber sieht sich jedoch mit noch zwei weiteren Problemen konfrontiert. Die
verschiedenen Kontroversen, von denen ich gerade einige aufgezählt habe, fallen nicht zeitlich zusammen
und sie enden jeweils (was auch immer zu ihrem Abschluß geführt haben mag) in verschiedenen Perioden.
Noch schlimmer: Wie ich bereits gezeigt habe, ist die Abfolge der Ereignisse in den einzelnen Ländern oft
sehr unterschiedlich. Die Naturphilosophie war (mit Ausnahme von E.Geoffroy Saint-Hilaire, dem
Quinarianismus, Richard Owen) weitgehend auf Deutschland beschränkt; die Naturtheologie beherrschte
die britische Wissenschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hatte aber bereits im 18. Jahrhundert in
Frankreich und Deutschland ausgespielt. Foucaults Ideal, den Fortschritt der Wissenschaft (und ihres
Milieus) als eine Reihe aufeinanderfolgender epistemes darzustellen, findet man in der realen Welt mit
Sicherheit nicht.
Was wir stattdessen vorfinden, sind zwei Gruppen von Erscheinungen. Erstens allmähliche Veränderung
der Struktur, Institutionalisierung und normative Aspekte dessen, was wir jetzt Wissenschaft nennen, und
zweitens, einige genau umrissene Perioden in einzelnen Zweigen der Wissenschaft. Das Beste, was ich tun
kann, ist also, eine bedauernswert unzusammenhängende Auswahl von in groben Zügen gezeichneten
Skizzen der Fortschritte in verschiedenen biologischen Disziplinen zu geben. Aufgrund weiterer Forschung
werden zweifellos Aussagen darüber möglich sein, ob und in welchem Ausmaß Verbindungen bestanden
haben zwischen den Ereignissen in den verschiedenen Zweigen der Biologie und welche Zusammenhänge
(wenn überhaupt) zwischen den wissenschaftlichen Fortschritten und dem allgemeinen geistigen und
gesellschaftlichen Milieu bestehen. Diese Zusammenhänge sind in meiner Darstellung bedauerlich zu kurz
gekommen. Die beiden Zweige der Biologie, die Mitte des 19. Jahrhunderts am besten definiert waren,
waren die physiologische Biologie und die Evolutionsbiologie. Ich werde mich zuerst mit ihnen befassen,
bevor ich mich späteren Entwicklungen zuwende.
Die Physiologie reift heran
In keinem anderen Bereich der Biologie hat das Pendel zwischen den gegensätzlichen Ansichten derart
häufig und heftig hin- und hergeschwungen wie in der Physiologie. Extreme mechanistische Auslegungen,
die die Organismen für nichts anderes als Maschinen hielten, die man aufgrund von Bewegungen und
Kräften erklären konnte, und extremer Vitalismus, demzufolge die Organismen von einer empfindenden,
wenn nicht sogar denkenden Seele beherrscht waren, lagen seit Descartes und Galilei bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts im Kampf miteinander.
Die physikalistische Bewegung wurde durch die populären philosophischen Schriften der drei
Naturwissenschaftler Karl Vogt, Jakob Moleschott und Ludwig Büchner, die deutschen wissenschaftlichen
Materialisten, erheblich gestärkt (Gregory, 1977). Ihrem Namen zum Trotz waren sie echte Idealisten, aber
ebenso echte Atheisten. Mit ihrem unerschütterlichen Widerstand gegen Vitalismus, Offenbarungsglauben
und jede Art nichtmaterialistischer Erklärung, dienten sie als Wächter der Physiologie, die erbarmungslos
jede nicht physikalischchemische Auslegung attackierten.
Für das Entstehen eines rabiaten reduktionistischen Physikalismus in der Physiologie Mitte des 19.
Jahrhunderts gab es zwei Gründe: Zum einen rief die immer noch weitverbreitete Macht des Vitalismus
eine berechtigte Opposition auf den Plan. Der zweite Grund war das enorme Ansehen der Physik zu jener
Zeit, das die Physiologen auf sich ausdehnen konnten, indem sie einen kompromißlosen Physikalismus und
„mechanische" Erklärungen übernahmen. Helmholtz war einer der Exponenten dieser Bemühungen und er
schlug 1869 auf dem Innsbrucker Treffen der deutschen Naturforscher das Motto vor: „Endziel der
Naturwissenschaften ist, die allen anderen Veränderungen zugrundeliegenden Bewegungen und deren
Triebkräfte zu finden, also sie in Mechanik aufzulösen."
In der Tat ist eine derartige Reduktion häufig in jenen Bereichen der Biologie möglich, die sich mit
unmittelbaren Ursachen befassen, und der Versuch einer solchen Analyse ist in der Regel sogar dann
heuristisch, wenn er keinen Erfolg hat. Das hohe Ansehen dieser Reduktion hatte jedoch zur Folge, daß sie
auf viele biologische Probleme angewandt wurde, insbesondere in der Evolutionsbiologie, wo diese
Methodik ganz und gar ungeeignet ist. Helmholtz pendelte zwischen Physik und Biologie hin und her, was
er konnte, weil alle physiologischen Prozesse letzten Endes chemische oder physikalische Vorgänge sind.
Doch sein elegantes Konzept wurde nur allzu leicht auch auf solche Zweige der Biologie angewandt, für
die es nicht geeignet war. Haeckel (1866) setzt sich im Vorwort zu seinem Werk Generelle Morphologie
die Aufgabe, die Wissenschaft von den Organismen „durch mechanischkausale Begründung" auf das
Niveau der anorganischen Wissenschaften zu heben. Nägeli nennt seine große Abhandlung über die
Evolution die Mechanisch-Physiologische Theorie der Abstammungslehre (1884), und ungefähr zur
gleichen Zeit benennt Roux die Embryologie um in „Entwicklungsmechanik".
All diese Bemühungen hatten zwei große Schwächen. Erstens wurden die Ausdrücke „mechanistisch"
oder „mechanisch" selten deutlich definiert, und bedeuteten zuweilen, z.B. bei Untersuchungen der
funktionalen Morphologie, „mechanisch" in wörtlicher Bedeutung, manchmal dagegen einfach das
Gegenteil von übernatürlich. Die zweite Schwäche war die, daß die Verfechter der mechanistischen
Philosophie niemals zwischen unmittelbaren und letzten Ursachen unterschieden und daher nicht
erkannten, daß die mechanistische Methode zwar beim Studium unmittelbarer Ursachen unerläßlich, bei
der Analyse evolutionärer Ursachen jedoch in der Regel bedeutungslos ist.
Die Methodik der Physiologie machte im 19. Jahrhundert drastische Veränderungen durch. Dazu
gehörte auch eine Anwendung sehr viel feinerer physikalischer Methoden, insbesondere durch Helmholtz
und Ludwig, und, in noch stärkerem Maße, eine zunehmende Anwendung chemischer Methoden. Jeder
Körpervorgang und die Funktion jedes Organs und jeder Drüse wurden von einem ganzen Heer zoologisch
und chemisch ausgerichteter Physiologen getrennt erforscht. Im großen und ganzen wurde die menschliche
Physiologie in eigenen Laboratorien erforscht, also nicht in Labortorien, in denen man sich mit Tier- oder
Pflanzenphysiologie befaßte, obgleich sich die Erforscher der menschlichen Physiologie ausgiebig der
Tierexperimente (einschließlich der Vivisektion) bedienten. Die Veröffentlichung von Darwins Origin of
Species im Jahre 1859 rief hier kaum ein Echo hervor, war doch die Erklärung in der Physiologie eine
Erklärung beschränkt auf unmittelbare Ursachen.
Der Darwinismus
Die Evolutionsidee starb nicht mit dem Tode Lamarcks im Jahre 1829. In Deutschland blieb sie eine
beliebte Vorstellung der Naturphilosophen und einiger Zoologen und Botaniker wie Schaaffhausen und
Unger. In England war es Chambers, der sie in seinen Vestiges (1844) wieder zum Leben erweckte, einem
Plädoyer für den Evolutionismus, das ungeachtet der heftigen Kritik seitens der Fachwissenschaftler sehr
populär war. Doch die Naturtheologie und der teleologische Gottesbeweis blieben weiterhin die
herrschende Philosophie, die fast von allen führenden Wissenschaftlern der Ära, einschließlich Charles
Lyells, unterstützt wurde. Das ist der Hintergrund, vor dem Darwin im Jahre 1859 seine neue Theorie
vorschlug.
Die Evolution besteht aus Veränderungen in der Anpassung und in der Diversität. Lamarck hatte bei
seiner Theorie die Diversität faktisch ignoriert in der Annahme, daß durch Urzeugung unaufhörlich neue
Arten von Organismen entstünden. Darwin dagegen wandte, angeregt durch die Lektüre von Lyells
Prindples und seine Studien über die Fauna der Galapagos-Inseln und Südamerikas, seine Aufmerksamkeit
vor allem der Entstehung der Vielfalt zu, d.h. der Entstehung neuer Arten. Seine Evolutionstheorie war
eine Theorie der „gemeinsamen Abstammung", bei der letztlich alle Organismen von einigen wenigen
ursprünglichen Vorfahren oder sogar von einer einzigen ersten Urform abstammen. Damit wurde der
Mensch unerbittlich zu einem Bestandteil des gesamten evolutionären Stroms gemacht und der erhabenen
Stellung enthoben, die ihm die Stoiker, das christliche Dogma und die kartesianische Philosophie verliehen
hatten. Man kann diese Umwertung der Stellung des Menschen durch die Theorie der gemeinsamen
Abstammung die erste Darwinsche Revolution nennen.
Ebenso revolutionär war Darwin in seiner Theorie über die Ursache der Evolution. Erstens lehnte er die
saltationistischen Theorien der Essentialisten ab und bestand darauf, die Evolution gehe nur allmählich vor
sich. Zweitens verwarf er die Lamarcksche Vorstellung, die Evolution sei durch einen automatischen
inneren Trieb zur Vervollkommnung verursacht; stattdessen schlug er eine präzise und getrennte Ursache
für jede einzelne evolutive Veränderung vor. Diese Kausalität war für Darwin ein Zwei-Schritte Phänomen, wobei der erste Schritt in der kontinuierlichen Erzeugung eines unerschöpflichen Vorrats an
genetischer Variation bestand. Es brachte Darwin nicht in Verlegenheit, daß er zugeben mußte, er
verstünde nicht, wie eine derartige Variation zustande käme. Er behandelte sie einfach als „unbekannte
Größe". Der zweite Schritt war das unterschiedliche Überleben und die unterschiedliche Fortpflanzung
(„Selektion") einzelner Individuen aus dem Überangebot der in jeder Generation erzeugten Lebewesen
einer Art. Diese natürliche Auslese war keineswegs ein „zufälliges Phänomen", wie man Darwin häufig
vorwarf, sondern ausschließlich (wenn auch in probabilistischem Sinne) durch die Wechselwirkung
zwischen genetischer Ausstattung und Umweltbedingungen verursacht. Diese Theorie der evolutiven
Kausalität war Darwins zweite Revolution. Er erklärte die Zweckmäßigkeit (die Harmonie der lebenden
Welt) nicht teleologisch, sondern auf rein materialistische Weise und hatte damit, wie seine Gegner
meinten, „Gott entthront".
Die erste Darwinsche Revolution, die Theorie der gemeinsamen Abstammung, wurde bald von nahezu
allen wohl informierten Biologen übernommen (allerdings sträubten sich einige seiner frühesten Gegner,
wie Sedgwick und Agassiz, bis zu ihrem Tod dagegen). Die zweite Darwinsche Revolution, die
Anerkennung seitens der Biologen der natürlichen Auslese als dem einzigen richtunggebenden Faktor in
der Evolution, kam erst mit der „Synthese der Evolutionstheorie" (etwa 1936-1947) zum Abschluß.
Darwins Theorie der gemeinsamen Abstammung gehört zu den Theorien mit dem größten heuristischen
Wert, die je vorgeschlagen worden sind. Sie veranlaßte ein ganzes Heer von Zoologen, Anatomen und
Embryologen dazu, Verwandtschaften und wahrscheinliche Merkmale des angenommenen gemeinsamen
Vorfahren zu bestimmen. Das war eine nahezu endlose Aufgabe, die selbst heute noch keineswegs
bewältigt ist, denn es herrscht immer noch beträchtliche Unsicherheit über die nächsten Verwandten und
die mutmaßlichen gemeinsamen Vorfahren vieler Hauptgruppen von Pflanzen und Tieren. Seltsamerweise
beschränkte sich die vergleichende Anatomie fast ausschließlich auf die Anwendung der Darwinschen
Theorie der gemeinsamen Abstammung und setzte unbewußt, wie sich nicht leugnen läßt – die Tradition
der idealistischen Morphologie fort. Kaum jemand fragte direkt nach den Ursachen der strukturellen
Veränderungen in der Phylogenie. Erst in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts wurde die
vergleichende Morphologie bewußt zu einer evolutionären Morphologie, indem sie die Verbindung zur
Ökologie und Verhaltensbiologie herstellte und durchweg Warum-Fragen zu stellen begann.
Haeckels Theorie der Rekapitulation („Biogenetisches Grundgesetz", 1874), d.h. die Theorie, daß ein
Organismus während seiner Ontogenese die morphologischen Stadien seiner Vorfahren durchläuft, hatte
einen enormen Aufschwung der vergleichenden Embryologie zur Folge. Ein typisches Ergebnis dieser Art
Forschung war Kovalevskys Entdeckung, daß die Seewalzen nahe Verwandte der Wirbeltiere sind, die
beide zum Stamm der Chordata gehören.
Die vergleichende Embryologie stellte fast ausschließlich Fragen der Evolutionsbiologie und war daher
für die Vertreter der funktionalen Biologie recht unbefriedigend. Goette, His und Roux rebellierten
schließlich gegen diese Einseitigkeit und versuchten eine Embryologie zu begründen, die sich dem
Studium der unmittelbaren Ursachen widmete, eine rein mechanistische, von Spekulation und Geschichte
unbehinderte
Embryologie.
Diese
neue
Embryologie,
von
Roux
bezeichnenderweise
„Entwicklungsmechanik" genannt, beherrschte diesen Zweig der Biologie von den achtziger Jahren des
vorigen bis in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts hinein. Sie geriet jedoch bald in Schwierigkeiten,
als sich herausstellte, daß sich aus einem nach der ersten Furchung in der Mitte durchgeteilten Ei in
manchen Tiergruppen zwei vollständig ausgebildete Embryonen entwickeln konnten. Welche Maschine
konnte wohl normal funktionieren, wenn man sie in der Mitte durchschnitt? Dieses unerwartete Maß an
Selbstregulierung veranlaßte Driesch, der dieses Experiment durchgeführt hatte, sich eine recht extreme
Form des Vitalismus zu eigen zu machen und eine nichtmechanische „Entelechie" zu postulieren. Selbst
Embryologen, die sich nicht Driesch anschlossen, neigten zu vitalistisch gefärbten Interpretationen, etwa
Spemann mit seinem „Organisator". Interessanterweise waren die Embryologen, obgleich keine Gegner des
Evolutionismus, fast einstimmig gegen den Darwinismus. Aber das waren schließlich die meisten Biologen
der Zeit.
Eine geringfügige Neuorientierung der europäischen Biologie erfolgte etwa um 1870. Zu dieser Zeit
kamen die Schüler von J. Müllers Nachfolgern ans Ruder, gewann Darwins Origin an Stoßkraft, wurde die
Mikroskopie zu einem eigenen Fachgebiet, begann sich die schrittweise Professionalisierung der
englischen Wissenschaft bemerkbar zu machen (Thistleton-Dyer, Michael Forster) und befreite sich
Frankreich allmählich von dem Einfluß Cuviers. Die Entwicklung war allerdings in den verschiedenen
Bereichen der Biologie sehr verschieden. Infolge der raschen technologischen Fortschritte im Bau von
Mikroskopen und bei den Fixier- und Färbemethoden war kein Gebiet in den letzten drei Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts erfolgreicher als das Studium von Zellen und Zellkernen. In dieser Zeitspanne wurde der
Vorgang der Befruchtung endlich verstanden. Weismann, Hertwig, Strasburger und Kölliker kamen 1884
zu dem Schluß, daß das genetische Material im Zellkern enthalten sein müsse. Darwin hatte seine Theorie
der Pangenesis vorgeschlagen, bevor diese Kenntnis über die Zellen verfügbar war. In den nun folgenden
Jahren führte die Zellforschung zur Aufstellung recht wohldurchdachter genetischer Theorien, die in der
detaillierten Analyse und Synthese von Weismann (1892) gipfelten. Mit Ausnahme von Nägeli (1884) und
O. Hertwig postulierten alle diese Autoren eine partikuläre, d.h. an Teilchen oder Elemente, wie Mendel
sagte, gebundene Vererbung; mit Ausnahme von de Vries (1889) konzentrierten sich alle auf die
Entwicklungsaspekte der Vererbung. Von unserer heutigen rückblickenden Warte aus können wir
feststellen, daß sie von zwei wichtigen Annahmen ausgingen, die sich seither als unrichtig erwiesen halben.
Erstens setzten sie, um Differenzierung und quantitative Vererbung zu erklären, voraus, die Determinanten
für ein Merkmal seien in einem Zellkern durch viele identische Partikel vertreten, die während der
Zellteilung ungleich verteilt werden konnten; und zweitens glaubten sie, diese Determinanten würden sich
unmittelbar in die Strukturen des sich entwickelnden Organismus verwandeln. Die erste dieser Annahmen
wurde von Mendel widerlegt, die zweite von Avery und der Molekularbiologie.
Im Jahre 1900 wurden die Mendelschen Gesetze durch de Vries und Correns wiederentdeckt. Sie wiesen
nach, daß jeder Elternteil lediglich eine genetische Einheit zu jedem sich aufspaltenden Merkmal beiträgt.
Diese wurde später als „Gen" bezeichnet (siehe Kapitel 16 und 17). Innerhalb von zwei Jahrzehnten hatte
ein ganzes Heer von Genetikern unter der Führung von Bateson, Punnett, Cuenot, Correns, Johannsen,
Castle, East, Baur und T. H. Morgan die meisten Prinzipien der Transmissionsgenetik erarbeitet. Alle
Belege, die sie zusammentrugen, wiesen darauf hin, daß das genetische Material unveränderlich war, das
heißt, daß die Vererbung „hart" ist. Veränderungen im genetischen Material sind diskontinuierlich und
wurden als „Mutationen" bezeichnet. Leider benutzten de Vries und Bateson die Entdeckung der
Mendelschen Vererbung als Ausgangspunkt für eine neue saltationistische Evolutionstheorie, verwarfen
Darwins Vorstellung von der allmählichen Evolution und ignorierten mehr oder weniger seine Theorie der
natürlichen Auslese.
Diese Interpretation der Evolution war für die Naturbeobachter unannehmbar, um so mehr, als ihr
Verständnis der Natur der Arten und der geographischen Variation während der vorangegangenen fünfzig
Jahre gewaltige Fortschritte gemacht hatte. Das wichtigste war, daß sie begonnen hatten, das Wesen von
Populationen zu verstehen, und ein „Populationsdenken" entwickelt hatten, demzufolge jedes Individuum
in seinen Merkmalen einzigartig ist. Ihr Beweismaterial bestätigte völlig Darwins Schluß, daß die
Evolution (außer in Fällen der Polyploidie) allmählich erfolgt und daß die Speziation gewöhnlich
geographische Speziation ist. Leider wurde die Literatur der Taxonomen, die schließlich in der „Neuen
Systematik" ihren Höhepunkt erreichte, von den Vertretern der experimentellen Biologie ebenso ignoriert
wie ein Großteil der genetischen Literatur nach 1910 von den Naturbeobachtern. Die Folge war eine
beklagenswerte Kluft in der Kommunikation zwischen diesen beiden biologischen Lagern.
In den Jahren zwischen 1936 und 1947 wurden die Schwierigkeiten und Mißverständnisse schließlich
überwunden: eine einheitliche Evolutionstheorie entstand, die häufig als „synthetische Theorie der
Evolution" bezeichnet wird (Mayr und Provine, 1980). Wie z.B. Dobzhansky, Timofeeff-Ressovsky,
Rensch, Mayr, Huxley, Simpson und Stebbins zeigten, lassen sich die wichtigsten evolutionären
Erscheinungen wie Speziation, evolutive Trends, das Entstehen evolutiver Neuheiten, und die gesamte
systematische Hierarchie durch eine Synthese der in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses
Jahrhunderts herangereiften genetischen Theorie und dem Populationsdenken der Systematiker erklären.
Abgesehen von einigen Akzentverschiebungen und der Tatsache, daß all die verschiedenen Mechanismen
inzwischen weitaus präziser analysiert werden, ist die synthetische Evolutionstheorie das Paradigma von
heute.
Die Biologie im 20. Jahrhundert
Während des gleichen Zeitraums, in dem die Evolutionstheorie verfeinert wurde, entstanden ganze neue
Bereiche der Biologie. Von besonderer Bedeutung sind die Gebiete der Ethologie (vergleichende tierische
Verhaltensforschung), der Ökologie und der Molekularbiologie.
Ethologie und Ökologie
Nach der (weitgehend unbeachtet gebliebenen) Pionierarbeit von Darwin (1872), Whitman (1898) und O.
Heinroth (1910), verdankt das Gebiet der Ethologie seine wirkliche Entfaltung der Arbeit von Konrad
Lorenz (1927 ff.) und später von Niko Tinbergen. Während die früheren Schulen der Tierpsychologie ihre
Aufmerksamkeit überwiegend dem Studium der unmittelbaren Ursachen zugewandt hatten und im
allgemeinen mit einer einzigen Art arbeiteten, bei der sie sich auf Lernprozesse konzentrierten, befaßten
sich die Ethologen in vergleichenden Studien hauptsächlich mit der Wechselwirkung zwischen
genetischem Programm und nachträglichen Erfahrungen. Ihre Untersuchungen über artspezifische
Verhaltensweisen, insbesondere über die Werbung – ein weitgehend von geschlossenen Programmen
gesteuertes Verhalten -, waren überaus erfolgreich. Der wissenschaftliche Streit zwischen Lorenz und von
Holst einerseits und Autoren wie Schneirla und Lehrman andererseits über die Größe des genetischen
Beitrags zum Verhalten war in mancherlei Hinsicht eine Wiederholung ähnlicher Meinungsdifferenzen, die
bis ins 18.Jahrhundert (Reimarus kontra Condillac) und ins 19. Jahrhundert (Altum kontra A. Brehm)
zurückreichten. Die Kontroversen der vierziger und fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts auf diesem Gebiet
gehören heute der Vergangenheit an. Es gibt unter den Erforschern des tierischen Verhaltens heute kaum
prinzipielle Differenzen; was an Differenzen verbleibt, ist weitgehend eine Frage der Betonung.
Die Verhaltensforschung breitet sich heute hauptsächlich in zwei Richtungen aus. Auf der einen Seite
verschmilzt sie mit der Neurophysiologie und Sinnesphysiologie, auf der anderen mit der Ökologie: Das
artspezifische Verhalten wird unter dem Blickwinkel seiner selektiven Bedeutung in der ökologischen
Nische der Art untersucht. Schließlich besteht ein großer Teil des Verhaltens in dem Austausch von
Signalen, am häufigsten zwischen Individuen der gleichen Art. Die Wissenschaft der Signale und
Botschaften (Semiotik) und die Rolle der Kommunikation für die Sozialstruktur der Arten sind heute
besonders aktive Forschungsgebiete.
Man schreibt dem 20. Jahrhundert gewöhnlich auch das Verdienst zu, die Ökologie hervorgebracht zu
haben. Zwar ist es richtig, daß die Bedeutung der Erforschung der Umwelt niemals zuvor derart anerkannt
worden ist, wie seit den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts, doch reicht ökologisches Denken bis in das
Altertum zurück (Glacken, 1967). Es spielte in den Schriften von Buffon und Linnaeus und in den
Reiseberichten der großen Entdecker des 18. und 19. Jahrhunderts (der Forsters und Humboldts zum
Beispiel) eine wichtige Rolle. Für diese Reisenden war das letzte Ziel nicht mehr das Sammeln und
Beschreiben von Arten, sondern das Verstehen der Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer
Umwelt. Alexander von Humboldt wurde zum Begründer der ökologischen Pflanzengeographie, später
wandte sich sein Interesse jedoch fast ausschließlich der Geophysik zu. Viele von Darwins Erörterungen
und Überlegungen wären in einem Ökologielehrbuch durchaus am Platz. Der Ausdruck „Ökologie" für die
Wissenschaft, die sich mit dem „Naturhaushalt" befaßt, wurde im Jahre 1866 von Haeckel vorgeschlagen.
Semper (1880) lieferte einen ersten allgemeinen Text über den Gegenstand. In den folgenden Jahren gab es
wenig Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen, die „die Lebensbedingungen" oder „Assoziationen"
verschiedener Arten von Organismen studierten. Möbius (1877) veröffentlichte seine klassische Studie
über eine Austernbank, Hensen und andere konzentrierten sich auf die Meeresökologie, Warming auf die
Pflanzenökologie, und wieder andere begründeten die Limnologie, die (hauptsächlich ökologische)
Wissenschaft von den Binnengewässern.
Die Ökologie blieb lange Zeit recht statisch und beschreibend. Buchstäblich Tausende von Schriften
befaßten sich mit der Zahl von Arten und Individuen innerhalb einer speziellen, genau vermessenen Fläche.
Verschiedene Autoren wetteiferten im Vorschlagen phantastischer Nomenklaturen für alle nur möglichen
Ausdrücke, die auf dem Gebiet benutzt wurden: sogar der Spaten, mit dem man die Pflanzen ausgrub,
wurde in „Geotom" umbenannt.
Drei Entwicklungen waren für eine Neuorientierung der Ökologie verantwortlich. Das eine waren die
Berechnungen von Lotka-Volterra, die sich mit den durch Räuber-Beute-Beziehungen bedingten
zyklischen Veränderungen von Populationen und in einem weiteren Rahmen mit verschiedenen anderen
Aspekten des Wachstums, Verfalls und Kreislaufs von Populationen befaßten. Zweitens begann man mehr
Gewicht auf die Konkurrenz zu legen. Das Exklusionsprinzip wurde aufgestellt und von Gause
experimentell überprüft. Allmählich wurde das Studium der zwischenartlichen Konkurrenzbeziehungen
unter der Führung von David Lack und Robert MacArthur zu einem der wichtigsten Zweige der Ökologie.
Diese Thematik liegt auf der Grenze zwischen Ökologie und Evolutionsbiologie, denn die
Konkurrenzbeziehungen sind nicht nur für Existenz und Fehlen von Arten, für ihre relative Häufigkeit und
die gesamte Artenvielfalt bestimmend, sondern auch für die adaptiven Veränderungen dieser Arten im
Verlauf der Evolution. Drittens brachte die Hinwendung zu Problemen des Energieumsatzes, insbesondere
in Binnengewässern und in den Ozeanen, eine Erneuerung der Ökologie mit sich. Die Frage, in welchem
Maße Computermodelle zum Verständnis der Wechselbeziehungen in Ökosystemen beitragen, ist noch
immer umstritten.
Viele ökologische Faktoren, etwa das Täuschen des Räubers, Fütterungsstrategien, Nischenauswahl,
Nischenerkennen, alle Qualitätsbeurteilungen und viele andere mehr, sind letztlich Verhaltensmerkmale,
so daß man vielleicht sogar so weit gehen kann zu behaupten, der größere Teil der ökologischen
Forschung, zumindest an Tieren, beschäftige sich heute mit Verhaltensproblemen. Außerdem befassen sich
alle Arbeiten in der Pflanzen- wie auch Tierökologie letztlich mit der natürlichen Auslese.
Das Entstehen der Molekularbiologie
Je detaillierter und komplizierter die Analyse der physiologischen Vorgänge und Entwicklungsprozesse
wurde, umso deutlicher wurde, daß sich letztlich viele dieser Prozesse auf das Wirken biologischer
Moleküle reduzieren lassen. Pas Studium derartiger Moleküle war zunächst ausschließlich die Domäne der
Chemie und Biochemie. Die ältesten Wurzeln der Biochemie reichen bis weit in das 19. Jahrhundert
zurück, doch gab es ursprünglich keine klare Abgrenzung von der organischen Chemie, und biochemische
Forschung wurde gewöhnlich in chemischen Instituten betrieben. In der Tat hatte ein großer Teil der frühen
Biochemie wenig mit Biologie zu tun, war sie doch lediglich die Chemie von aus Organismen extrahierten
Verbindungen oder bestenfalls von Verbindungen, die in biologischen Vorgängen von Bedeutung sind. Bis
zum heutigen Tag gibt es noch Bereiche der Biochemie, die dieser Art sind. Ein zweiter Weg führte von
der Physiologie zur Molekularbiologie (Florkin, 1972ff.; Fruton, 1972; Leicester, 1974).
Einige Errungenschaften der Biochemie sind für den Biologen von besonderer Bedeutung. Dazu gehört
zum Beispiel die schrittweise Aufklärung gewisser Stoffwechselbahnen, etwa des Zitronensäurezyklus, wie
auch der schließliche Nachweis, daß jeder Schritt in der Regel von einem spezifischen Gen gesteuert wird.
Diese Forschung ist keine bloße Biochemie mehr, und es hat sich völlig zu recht eingebürgert, sie als
Molekularbiologie zu bezeichnen. In der Tat hat man es hier mit der Biologie der Moleküle zu tun, ihren
Veränderungen, Wechselbeziehungen und sogar ihrer Geschichte im Laufe der Evolution.
Eine weitere wichtige Entwicklung war die Einsicht, daß die Annahmen der Kolloidchemie unrealistisch
waren und daß viele biologisch wichtige Materialien aus Polymeren mit hohem Molekulargewicht
bestehen. Diese Entwicklung, in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts vor allem mit dem Namen
Staudinger verbunden, trug erheblich dazu bei, daß man schließlich zu einem Verständnis von Kollagen,
Muskeleiweiß und, am wichtigsten, DNA und RNA gelangte. Polymerisierte organische Moleküle besitzen
einige Eigenschaften von kristallen, und man entdeckte, daß sich ihre komplizierte dreidimensionale
Struktur mit Hilfe der Röntgenstrahlen-Kristallographie aufklären läßt (Bragg, Perutz, Wilkins und andere).
Diese Studien ergaben, daß die dreidimensionale Struktur der Makromoleküle, d.h. ihre Morphologie, die
Grundlage ihrer Funktionsweise darstellt. Obgleich die meisten biologischen Makromoleküle letzten Endes
Aggregate der gleichen begrenzten Zahl von Atomen sind (hauptsächlich Kohlenstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff, Schwefel, Phosphor und Stickstoff), besitzen sie alle außerordentlich spezifische und häufig
völlig einzigartige Eigenschaften. Das Studium der dreidimensionalen Gestalt dieser Makromoleküle trug
viel zu unserem Verständnis dieser Eigenschaften bei.
Die Molekularbiologen haben die Struktur buchstäblich Tausender von biologischen Verbindungen
bestimmt und herausgefunden, an welchen Pfaden sie beteiligt sind, doch wenige ihrer Forschungsarbeiten
haben so viel Aufsehen erregt wie die Aufklärung der chemischen Natur des genetischen Materials. Schon
1869 hatte Miescher entdeckt, daß ein großer Prozentsatz des Kernmaterials aus Nukleinsäuren bestand.
Eine Zeitlang (in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts) postulierte man, daß Nuklein
(Nukleinsäure) das genetische Material sei, aber diese Hypothese verlor schließlich wieder an Popularität
(Kapitel 19). Erst als Avery und seine Mitarbeiter 1944 die transformierende Substanz des Pneumokokkus
als DNA nachwiesen, kam es zu einer Neuorientierung. Zwar waren sich mehrere Biologen sofort der
Bedeutung von Averys Entdeckung bewußt, doch besaßen sie nicht das technische knowhow, um dies
faszinierende Molekül gründlich erforschen zu können. Das Problem lag klar auf der Hand: Wie konnte
dieses scheinbar einfache Molekül (wenigstens hielt man es zu jener Zeit für einfach, verglichen mit der
Mehrheit der Proteine) im Kern des befruchteten Eies die gesamte Information zur Steuerung der
artspezifischen Entwicklung des daraus entstehenden Organismus enthalten? Man mußte die exakte
Struktur der DNA kennen, bevor man beginnen konnte, darüber zu spekulieren, wie sie ihre einzigartige
Funktion erfüllen konnte. Ein stürmischer Wettlauf setzte ein zwischen einer Reihe von Laboratorien, die
sich die Klärung dieser Frage zum Ziel gesetzt hatten, aus dem Watson und Crick vom Cavendish
Laboratory in Cambridge, England, im Jahre 1953 als Sieger hervorgingen. Wären sie es nicht gewesen, so
wäre es ein paar Monate oder Jahre später jemand anderem gelungen.
Jeder hat schon einmal von der Geschichte der Doppelhelix gehört. Aber nicht jeder begreift die
Bedeutung dieser Entdeckung in ihrem ganzen Umfang. Es stellte sich heraus, daß die DNA nicht direkt an
der Entwicklung oder an den physiologischen Funktionen des Körpers beteiligt ist, sondern lediglich einen
Satz von Instruktionen (ein genetisches Programm) liefert, das in die richtigen Proteine übersetzt wird. Die
DNA ist ein in jeder Zelle des Körpers in identischer Form vorhandener detaillierter Plan, der von einer
Generation zur anderen weitergegeben wird. Der entscheidende Bestandteil der DNA-Moleküle sind vier
Basenpaare (stets ein Purin und ein Pyrimidin). Eine Sequenz von drei Basenpaaren (Triplett) ist wie ein
Buchstabe in einem Code und steuert die Übersetzung in eine spezifische Aminosäure. Die Reihenfolge
solcher Tripletts bestimmt, welches spezielle Peptid gebildet wird. 1961 entdeckte Nirenberg, daß durch
die Tripletts der DNA eine Translation in Aminosäuren möglich ist. Die Basenfolge in dem Triplett ist der
Code.
Die Entdeckung der Doppelhelix der DNA und ihres Codes war ein Durchbruch ersten Ranges. Sie
brachte ein für allemal Klarheit in einige der verworrensten Bereiche der Biologie und führte dazu, daß
neue, klar umrissene Fragen gestellt wurden, von denen einige in die heutigen Grenzbereiche der Biologie
gehören. Sie machen deutlich, warum ein grundlegender Unterschied zwischen Organismen und jeder Art
nichtlebendiger Substanz besteht. Es gibt in der unbelebten Welt nichts, was über ein genetisches
Programm verfügte, das Informationen mit einer 3 Milliarden Jahre alten Geschichte speichert! Zur
gleichen Zeit erhellt diese rein mechanistische Erklärung viele der Phänomene, von denen die Vitalisten
behauptet hatten, sie seien auf chemische oder physikalische Weise nicht zu erklären. Gewiß ist die
Erklärung immer noch physikalistisch, aber doch unendlich komplexer als die grob mechanistischen
Erklärungen früherer Jahrhunderte.
Parallel zu den rein chemischen Entwicklungen der Molekularbiologie gingen solche anderer Art. Die
Erfindung des Elektronenmikroskops in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts z. B. machte ein neues
Verständnis der Zellstruktur möglich. Was die
Forscher des 19. Jahrhunderts als Protoplasma bezeichnet und für den Grundstoff des Lebens gehalten
hatten, erwies sich nun als ein hochgradig komplexes System intrazellulärer Organellen mit spezifischen
Funktionen. In der Mehrzahl handelt es sich um Membransysteme, die spezifischen Makromolekülen als
„Habitat" dienen. Die Molekularbiologie stößt an einer Vielzahl von Fronten vor, an einer weitaus
größeren Zahl von ihnen als wir hier erwähnen können – und viele sind für die Medizin von
ausschlaggebender Bedeutung.
Hauptperioden in der Geschichte der Biologie
Traditionsgemäß unterscheidet man in der Geschichtsschreibung zwischen verschiedenen Perioden. Die
westliche Weltgeschichte zum Beispiel ist in drei Perioden unterteilt worden: Altertum, Mittelalter,
Neuzeit. Die Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit wird gewöhnlich bei etwa 1500 angesetzt, um
genauer zu sein, zwischen 1447 und 1517. Innerhalb dieser Zeitspanne, so sagt man, fanden alle jene
entscheidenden Ereignisse statt und setzten alle jene Bewegungen ein, die dem neuen Abendland sein
charakteristisches Gepräge geben sollten: die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern (1447),
die Renaissance (als deren Beginn man den Fall von Konstantinopel im Jahre 1453 annimmt), die
Entdeckung der Neuen Welt (1492), und die Reformation (1517). Diese Ereignisse bedeuten recht
drastische Veränderungen, wenn man auch seine Zweifel daran haben kann, ob es legitim ist, eine scharfe
Trennungslinie zwischen Mittelalter und Neuzeit zu postulieren. Schließlich gab es in den zweihundert
Jahren vor 1447 ebenfalls zahlreiche bemerkenswerte Entwicklungen.
Auf ähnliche Weise hat man auch in der Wissenschaftsgeschichte gut definierte Zeitalter der
Wissenschaft zu unterscheiden versucht. Viel Aufhebens hat man zum Beispiel darum gemacht, daß
sowohl das Hauptwerk von Kopernikus als auch das von Vesalius im Jahre 1543 veröffentlicht wurden.
Wichtiger ist, daß man die Ereignisse der Zeit von Galilei (1564-1642) bis Newton (1642-1727) als die
„wissenschaftliche Revolution" bezeichnet hat (Hall, 1954). So bedeutend die Fortschritte auch waren, die
während dieses Zeitraums in den exakten Wissenschaften und auch in der Philosophie (mit Bacon und
Descartes) gemacht wurden, sie waren in der Biologie von keinerlei welterschütternden Veränderungen
begleitet. Darüber hinaus ist für einen kritischen Betrachter die Fabrica von Vesalius, von der überlegenen
künstlerischen Qualität der Illustrationen abgesehen, kaum eine revolutionäre Abhandlung. Sie ist in ihrer
Bedeutung keinesfalls mit De Revolutionibus von Kopernikus vergleichbar (siehe auch Radl, 1913, S. 99107).
Das 16. Jahrhundert war eine schwierige Periode voller Widersprüche, eine Epoche mit raschen
Veränderungen des Zeitgeistes. Es sah den Höhepunkt des Humanismus (in dem Werk von Erasmus von
Rotterdam), es erlebte Luthers Reformation (1517), aber auch das kräftige Einsetzen der Gegenreformation
(mit der Gründung des Jesuitenordens) und den Beginn der wissenschaftlichen Revolution. Die
Wiederentdeckung des wahren Aristoteles (im Gegensatz zu dem der Scholastik) hatte einen deutlichen
Einfluß auf die Biologie, insbesondere auf die Arbeit von Cesalpino und Harvey. Zwar nicht mit der Blüte
der mechanischen Wissenschaften vergleichbar, zeigten sowohl die Physiologie als auch die
Naturgeschichte gegen Ende des 16. und im frühen 17. Jahrhundert eindeutige Zeichen zunehmender
Aktivität.
Alles weist darauf hin, daß zwischen den Geschehnissen in den exakten Wissenschaften und der
Entwicklung der Wissenschaften vom Leben kaum eine zeitliche Kongruenz besteht. Ebenso wenig kann
man in der Biologie gut umrissene ideologische Zeitalter abgrenzen, wie John Greene (1967) in seiner
geistreichen Abhandlung über Foucaults Les mots et les choses sehr richtig betont hat. Jacobs Logic of Life
(1970) ist in der Foucaultschen Tradition geschrieben, aber auch Jacob akzeptiert Foucaults Zeitalter nicht.
Holmes (1977) stellt darüber hinaus die Frage, ob Jacobs Abgrenzung von Zeitaltern tatsächlich besser ist.
Keiner dieser Autoren hat jemals wirklich darüber nachgedacht, aus welchem Grunde das Aufteilen der
Geschichte der Biologie in Perioden bei verschiedenen Verfassern derart unterschiedliche Ergebnisse
zeitigt. Könnte es vielleicht sein, daß solche Perioden nur in der Vorstellung bestehen und daher nur durch
willkürliche Abgrenzung definiert werden können, die jeder Verfasser anders vornimmt? Es ist ziemlich
unwahrscheinlich, daß diese Annahme richtig ist. Viele der von bestimmten Historikern anerkannten
Perioden sind bei weitem zu real. Ich möchte meinen, daß die Antwort anders lauten muß. Nämlich: diese
Perioden sind nicht universal. Sie variieren in gewissem Maße in verschiedenen Ländern, und sie
differieren recht deutlich in den verschiedenen Wissenschaften und in den verschiedenen Bereichen der
Biologie, insbesondere zwischen der funktionalen Biologie und der Evolutionsbiologie. Denn die
Veränderungen in diesen beiden Zweigen der Biologie sind keineswegs eng korreliert.
Der Biologie fehlt die Einheit der exakten Wissenschaften, und jede ihrer verschiedenen Disziplinen
hatte, wie ich schon erwähnt habe, ihre eigene Chronologie von Geburt und Blütezeit. Bis zum 17.
Jahrhundert etwa bestand das, was wir heute Biologie nennen würden, aus zwei Gebieten, zwischen denen
nur ein recht schwacher Zusammenhang bestand: Naturgeschichte und Medizin. Im Verlauf des 17. und 18.
Jahrhunderts teilte sich die Naturgeschichte recht deutlich in Zoologie und Botanik auf, obgleich viele der
Zoologen und Botaniker vom Fach, bis zu Linnaeus und Lamarck, sich beliebig zwischen beiden Gebieten
hin- und herbewegten. In der Medizin sonderten sich zur gleichen Zeit Anatomie, Physiologie, Chirurgie
und klinische Medizin zunehmend voneinander ab. Gebiete, die im 20. Jahrhundert vorherrschende
Bedeutung gewinnen sollten, wie die Genetik, Biochemie, Ökologie und Evolutionsbiologie, existierten
vor 1800 schlechthin nicht. Der Aufstieg – und die gelegentlichen Rückschläge jedes dieser Gebiete ist
eine faszinierende Geschichte und bildet eins der Hauptthemen der folgenden Kapitel dieses Buches.
Vermutlich wird ein Taxonom, ein Genetiker oder ein Physiologe jeweils unterschiedliche Perioden
unterscheiden, und das gleiche gilt für einen Deutschen, einen Franzosen oder einen Engländer. Man mag
es bedauern, daß die Geschichte nicht ein wenig ordentlicher ist, aber das läßt sich nun einmal nicht
ändern. Die Aufgabe des Historikers erschwert dies erheblich, muß er doch unter Umständen gleichzeitig
fünf oder sechs verschiedene zeitgenössische „Forschungstraditionen" („research traditions", wie Larry
Laudan sie nennt) untersuchen. So interessant das Problem der Unterscheidung geistiger Epochen auch ist,
es ist noch so neu, daß bisher weder für die Biologie als Gesamtheit, noch für die Entwicklung in den
einzelnen Ländern der ganzen Welt eine gute Analyse vorliegt.
Jede der zahlreichen biologischen Disziplinen, wie Embryologie, Zytologie, Physiologie oder
Neurologie, hatte sowohl Perioden der Stagnation als auch solche raschen Fortschritts zu verzeichnen.
Zuweilen hört man die Frage, ob es jemals eine Periode gegeben habe, in der die Biologie eine ebenso
drastische Neuorientierung erfuhr wie die Physik während der wissenschaftlichen Revolution. Die Antwort
ist negativ. Zwar hat es bestimmte Jahre gegeben, in denen im einen oder anderen Zweig der Biologie ein
neuer Anfang gemacht wurde: 1828 für die Embryologie, 1839 für die Zytologie, 1859 für die
Evolutionsbiologie und 1900 für die Genetik. Doch hatte jeder Zweig der Biologie seinen eigenen Zyklus
und es gab keine breit angelegte allgemeine Umwälzung. Sogar die Veröffentlichung von Darwins Origin
of Species im Jahre 1859 hatte faktisch keinen Einfluß auf die experimentellen Zweige der Biologie. Das in
der Evolutionsbiologie so grundlegend wichtige Ersetzen essentialistischen Denkens durch
Populationsdenken berührte die funktionale Biologie fast ein ganzes Jahrhundert lang kaum. Die Klärung
der DNA-Struktur (1953) war ein fruchtbarer Anstoß für die Zell- und Molekularbiologie, für einen großen
Teil der organismischen Biologie aber ohne jede Relevanz.
Am ehesten entspricht einer Revolution in der Biologie die Zeit von etwa 1830 bis 1860, eine der
aufregendsten Perioden in der Geschichte der Biologie überhaupt (siehe Jacob, 1973, S. 178). Zu dieser
Zeit erhielt die Embryologie einen erheblichen Anstoß durch die Arbeit von K. E. von Baer, entstand die
Zytologie mit der Entdeckung des Zellkerns durch Brown und der Arbeit von Schwann, Schieiden und
Virchow, nahm die neue Physiologie Gestalt an unter Helmholtz, Du Bois-Reymond, Ludwig und Bernard,
legten Wöhler, Liebig und andere die Fundamente für die organische Chemie, stellten Johannes Müller,
Siebold und Sars die Wirbellosenzoologie auf eine neue Grundlage und – schließlich und am wichtigsten –
konzipierten Darwin und Wallace die neue Evolutionstheorie. Diese vielfältigen Leistungen entsprangen
keineswegs einer einheitlichen Bewegung, ja sie waren weitgehend voneinander unabhängig. Zum großen
Teil waren sie der wachsenden Professionalisierung der Wissenschaft zu verdanken, wie auch der
Verbesserung des Mikroskops und der raschen Entwicklung der Chemie. Einiges davon war jedoch das
unmittelbare Resultat des unerklärlichen Auftretens eines einzigartigen Genies.
Biologie und Philosophie
Bei den Griechen gab es keine Trennung von Wissenschaft und Philosophie. Die Philosophie war die
Wissenschaft der Zeit, was insbesondere für die ionischen Philosophen seit Thales zutraf. Einige
Mathematiker/Ingenieure, wie Archimedes, und einige Ärzte/ Physiologen, wie Hippokrates und später
Galen, kamen einem echten Wissenschaftler am nächsten, aber die hervorragenden Philosophen des
Zeitalters, wie Aristoteles, waren ebenso sehr Wissenschaftler wie Philosophen.
Nach dem Ende der Scholastik begannen sich die beiden Disziplinen zu trennen. Anatomen wie
Vesalius, Physiker/Astronomen wie Galilei, Botaniker/Anatomen wie Cesalpino und Physiologen wie
Harvey waren in erster Linie Wissenschaftler, obgleich einige von ihnen sehr starke philosophische,
aristotelische oder antiaristotelische, Bindungen besaßen. Die Philosophen ihrerseits wurden zunehmend zu
„reinen" Philosophen. Descartes war einer der wenigen, der sowohl Wissenschaftler als auch Philosoph
war, während wir Berkeley, Hobbes, Locke und Hume bereits als reine Philosophen bezeichnen. Kant war
vielleicht der letzte Philosoph, dem wir hervorragende theoretische Beiträge zur Wissenschaft (genauer zur
Anthropologie und zur Kosmologie) verdanken, und zwar derart ausgezeichnete Beiträge, daß sie in der
rein naturwissenschaftlichen Geschichtsschreibung zitiert werden. Nach ihm war es umgekehrt so, daß die
Naturwissenschaftler und Mathematiker zur Philosophie beitrugen (Herschel, Darwin, Helmholtz, Mach,
Russell, Einstein, Heisenberg, K. Lorenz).
Die Philosophie erlebte im 18. und 19. Jahrhundert eine Blütezeit. Descartes hatte den beengenden
Einfluß von Aristoteles gebrochen, und die Herrschaft von Descartes wurde wiederum von Locke, Hume
und Kant beendet. Merkwürdig ist: Alle Philosophen dieser Epoche, so sehr sie sich sonst auch in ihren
Ansichten unterschieden, stellten die Mehrzahl ihrer Fragen im Rahmen des Essentialismus. Das 19.
Jahrhundert war Zeuge mehrerer Neuanfänge, von denen Comtes Positivismus, eine Philosophie der
Wissenschaft, der wichtigste war. Recht einflußreich war auch ein betont reduktionistischer Materialismus,
der in Deutschland von Vogt, Büchner und Moleschott vertreten wurde (Gregory, 1977), und sei es auch
nur, weil seine Übertreibungen holistische, emergentistische oder sogar vitalistische Strömungen
provozierten. Wegen seiner konsequenten und niemals falsifizierten Absagen an jeglichen Dualismus und
alles Übernatürliche hatte er jedoch einen bleibenden Effekt.
Innerhalb der Biologie hatten diese philosophischen Strömungen ihren größten Einfluß auf die
Physiologie und Psychobiologie, d. h. auf biologische Disziplinen, die sich mit unmittelbaren Ursachen
befassen. Welcher Natur genau die Beziehungen zwischen diesen Philosophen und der physiologischen
Forschung waren, ist bis heute noch nicht gehörig analysiert worden. Trotz einiger gegenteiliger
Behauptungen scheint die Philosophie nur eine relativ geringe, wenn nicht sogar unerhebliche Rolle bei
dem Entdeckungsprozeß gespielt zu haben, wohingegen umgekehrt philosophischen Dogmen oder
Prinzipien eine wichtige rahmengebende Funktion in bezug auf die erklärenden Hypothesen zukam.
Unter den Philosophen hatte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1717), im Gegensatz zu den
physikalistischen Philosophen seiner Zeit, das echte Bedürfnis, die Natur als ein Ganzes zu verstehen. Er
zeigte, wie unbefriedigend es war, das Funktionieren der Welt des Lebendigen ausschließlich mittels
sekundärer, physikalischer Ursachen zu erklären. Wenn auch die Antworten, die er selbst gab
(prästabilierte Harmonie und Prinzip des zureichenden Grundes) nicht die gesuchten Lösungen waren, so
warf er doch Probleme auf, die nachfolgende Philosophengenerationen, einschließlich Kants, in tiefe
Verwirrung stürzten. Trotz seines brillanten mathematischen Denkens erkannte Leibniz klar, daß mehr an
der Natur war als bloße Quantität, und er war einer der ersten, die die Bedeutung der Qualität erkannten. In
einem von dem Diskontinuitätsbegriff des Essentialismus beherrschten Zeitalter betonte er die Kontinuität.
Sein Interesse an der scala naturae, so statisch er diese auch verstehen mochte, trug dazu bei, den Boden
für das Evolutionsdenken vorzubereiten. Er beeinflußte tiefgreifend das Denken von Buffon, Maupertuis,
Diderot und anderen Philosophen der Aufklärung, und über diese auch Lamarck. Er bildete vielleicht das
bedeutendste Gegengewicht gegen den Einfluß des essentialistischen, mechanistischen Denkens der
Galilei-Newtonschen Tradition.
Die philosophischen Grundlagen der Evolutionsbiologie sind weitaus weniger eindeutig als die der
funktionalen Biologie. Der Begriff eines Gerichtetseins im Leben („höher und niedriger") geht auf
Aristoteles und die scala naturae zurück (Lovejoy, 1936), doch das Populationsdenken hatte anscheinend
nur sehr spärliche Wurzeln in der Philosophie (später Nominalismus). Für die entscheidende Erkenntnis der
Bedeutung der Geschichte (im Gegensatz zu der Zeitlosigkeit physikalischer Gesetze) kamen erhebliche
Anstöße aus der Philosophie (Vico, Leibniz, Herder). Die Einsicht in die Bedeutung der Geschichte führte
fast unvermeidlich zu einem Anerkennen des Prozesses der Entwicklung. Die Entwicklung wiederum war
wichtig für Schelling (und die Naturphilosophen), Hegel, Comte, Marx und Spencer. Die Bedeutung dieser
Denker ist in Mandelbaums (1971, S.42) Definition des Historizismus recht gut dargestellt: „Der
Historizismus ist der Glaube, daß ein angemessenes Verständnis der Natur eines beliebigen Phänomens
und eine angemessene Beurteilung seines Wertes dadurch gewonnen werden, daß man es unter dem Aspekt
betrachtet, welche Stelle es in einem Entwicklungsprozeß einnahm und welche Rolle es in diesem Prozeß
spielte."
Es ist verlockend, mit dem Gedanken zu spielen, die Evolutionstheorie habe ihren Ursprung in dieser
Art zu denken gehabt, aber es gibt kaum Anzeichen dafür, daß dies der Fall gewesen sein könnte – außer
Spencers Evolutionismus, der allerdings auf Darwin, Wallace, Huxley oder Haeckel keinen befruchtenden
Einfluß hatte. In der Tat scheint entgegen allen Erwartungen niemals ein enger Zusammenhang zwischen
Historizismus und Evolutionsbiologie bestanden zu haben, außer vielleicht in der Anthropologie.
Historizismus und logischer Positivismus waren jedoch zwei ganz und gar inkompatible Strömungen. Erst
vor relativ kurzer Zeit haben einige Wissenschaftsphilosophen die Vorstellung der „historischen
Darstellungen" („historical narratives") akzeptiert. Und doch hätte man bereits kurz nach 1859 eingesehen
haben können, daß der Begriff Gesetz in der Evolutionsbiologie (und daher auch in jeder Wissenschaft, die
sich mit zeitabhängigen Vorgängen befaßt, wie die Kosmologie, Meteorologie, Paläontologie,
Paläoklimatologie oder Ozeanographie) weit weniger brauchbar ist als der Begriff der „historical
narratives".
Die Gegner des Kartesianismus stellten Fragen, die den Mechanisten niemals in den Sinn kamen. Diese
Fragen machten in peinlicher Weise deutlich, wie unvollständig die Erklärungen der Mechanisten waren.
Nicht nur, daß diese anders Denkenden Fragen über Zeit und Geschichte stellten, es wurden auch immer
häufiger Warum-Fragen gestellt, das heißt, man suchte nach „letzten Ursachen". Der entschiedendste
Widerstand gegen die mechanistische Theorie der Anhänger Newtons, die sich damit zufrieden gaben,
einfache Fragen nach unmittelbaren Ursachen zu stellen, entwickelte sich in Deutschland gegen Ende des
18. und zu Beginn des 19.Jahrhunderts. Selbst Denker, die keine Biologen waren, wie Herder, hatten einen
kräftigen Einfluß auf diesen Widerstand. Doch leider brachten alle diese Bemühungen (in die auch Goethe
und Kant verwickelt wären) kein konstruktives neues Paradigma hervor; stattdessen geriet diese Strömung
unter den Einfluß von Oken, Schelling und Carus – Autoren, deren Phantastereien die Experten nur mit
Spott begegnen konnten und deren törichte Konstruktionen der moderne Leser nur mit peinlicher
Verlegenheit lesen kann. Dennoch waren einige ihrer grundlegenden Interessen durchaus denen Darwins
ähnlich. Von den Exzessen der Naturphilosophen abgestoßen, zogen sich die antimechanistischen
Naturforscher in die unproblematische Beschreibung zurück, ein Gebiet, das zwar unerschöpflich, aber,
wie die besten Geister bald darlegten, intellektuell nicht lohnend war.
Es herrscht immer noch keine Übereinstimmung darüber, ob die Philosophie nach 1800 einen Beitrag
zur Naturwissenschaft geleistet hat oder nicht. Es ist keineswegs überraschend, daß die Philosophen
allgemein dazu neigen, diese Frage positiv zu beantworten, die Antwort der Naturwissenschaftler dagegen
negativ ist. Doch besteht kein Zweifel daran, daß die Formulierung von Darwins Forschungsprogramm von
der Philosophie beeinflußt war (Ruse, 1979 a; Hodge, 1982). Während der letzten Generationen hat sich
die Philosophie recht deutlich in die Metawissenschaft zurückgezogen, d.h. in die Analyse der
wissenschaftlichen Methodologie, die Semantik, Linguistik, Semiotik und andere Gebiete an der Peripherie
der Wissenschaft.
Biologie heute
Was würde man sagen, wollte man die moderne Biologie mit einigen wenigen Worten charakterisieren?
Der vielleicht beeindruckendste Aspekt der heutigen Biologie ist ihre Geschlossenheit. Faktisch alle großen
Kontroversen früherer Jahrhunderte sind beigelegt. Der Vitalismus in all seinen Formen ist restlos
verworfen worden und hat seit mehreren Generationen keine ernstzunehmenden Anhänger mehr. Die
zahlreichen miteinander konkurrierenden Evolutionstheorien sind nach und nach aufgegeben worden und
wurden durch eine einzige „synthetische" Evolutionstheorie ersetzt, die den Essentialismus, die Vererbung
erworbener Eigenschaften, orthogenetische Trends und den Saltationismus ablehnt.
Mehr und mehr Biologen haben eingesehen, daß es bei der funktionalen Biologie und der
Evolutionsbiologie nicht um ein „entweder – oder" geht, sondern daß kein biologisches Problem gelöst ist,
solange nicht sowohl die unmittelbaren als auch die letzten (= evolutionären) Ursachen bestimmt sind. Die
Folge davon ist, daß sich viele Molekularbiologen heute mit Evolutionsfragen befassen, und umgekehrt
viele Evolutionsbiologen molekulare Probleme behandeln. Das gegenseitige Verständnis ist heutzutage
weitaus größer a|s dies noch vor 25 Jahren der Fall war.
Die letzten 25 Jahre waren auch Zeuge der endgültigen Befreiung der Biologie von der Bevormundung
durch die exakten Wissenschaften. Heutzutage gesteht man nicht nur allgemein zu, daß die Komplexität
biologischer Systeme von einer anderen Größenordnung ist; man ist sich auch darin einig, daß die Existenz
von geschichtlich entstandenen Programmen in der unbelebten Welt unbekannt ist. Teleonomische
Prozesse und angepaßte Systeme, wie sie durch diese Programme möglich werden, sind in physikalischen
Systemen unbekannt.
Der Vorgang der Emergenz, d. h. das Auftreten von zuvor unerwarteten neuen Eigenschaften oder
Merkmalen auf höheren Integrationsebenen in komplexen hierarchischen Systemen, ist in lebendigen
Systemen von weitaus größerer Bedeutung als in unbelebten Systemen. Dies trägt ebenfalls zu den
Unterschieden zwischen den exakten Wissenschaften und der Biologie bei und damit zur
Unterschiedlichkeit der in diesen Bereichen benutzten Strategien und Erklärungsmodelle.
Die Frage, welches heute die wichtigsten Probleme der Biologie sind, läßt sich nicht beantworten, denn
ich kenne kein einziges biologisches Fachgebiet, das sich nicht mit wichtigen ungelösten Problemen
auseinandersetzt. Das gilt sogar für solch klassische Gebiete wie die Systematik, Biogeographie und
vergleichende Anatomie. Und dennoch sind es die Fragen, die mit komplexen Systemen zu tun haben, die
am brennendsten und bisher am schwersten zu handhaben sind. Die einfachste von ihnen, die gegenwärtig
in der Molekularbiologie im Mittelpunkt des Interesses steht, ist die Frage nach Struktur und Funktion des
Eukaryonten-Chromosoms. Um diese verstehen zu können, müssen wir auch die spezifische Funktion und
gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen DNA-Arten kennen (Codieren für lösliche oder nichtlösliche
Proteine, stille DNA, relativ repetitive, hochrepetitive DNA, und so weiter); obwohl alle diese DNAs
chemisch im Prinzip gleich sind, produzieren einige von ihnen „Baumaterial", erfüllen andere eine
regulierende Funktion und haben wieder andere nach Ansicht einiger Molekularbiologen überhaupt keine
Aufgabe (sind „parasitär"). Das mag richtig sein, doch ist es für einen eingefleischten Darwinisten, wie ich
einer bin, nicht sehr überzeugend. Ich zweifle jedoch nicht daran, daß es uns in wenigen Jahren gelungen
sein wird, das ganze komplexe DNA-System zu verstehen.
Weniger zuversichtlich bin ich hinsichtlich der Geschwindigkeit des Fortschritts bei unserem
Verständnis der komplexeren physiologischen Systeme, etwa jener, die die Differenzierung und
Arbeitsweise des Zentralnervensystems steuern. Man kann diese Probleme nicht lösen, ohne die Systeme in
ihre Bestandteile zu zerlegen, doch wenn man während der Analyse die Systeme zerstört, so wird es sehr
schwierig, das Wesen all der im Innern der Systeme vorhandenen Wechselwirkungen und
Steuermechanismen zu verstehen. Wir werden ein gehöriges Maß an Zeit und Geduld benötigen, bevor wir
komplexe biologische Systeme restlos verstehen. Und es wird nur mit einer Mischung aus
reduktionistischen und emergentistischen Methoden gelingen.
Die Biologie ist heute zu einem so weiten und derart differenzierten Gebiet geworden, daß sie nicht
mehr völlig von einer speziellen „Mode" beherrscht werden kann, wie dies zum Beispiel durch die
Artenbeschreibung zur Zeit von Linnaeus, die Aufstellung von Phylogenien im post-Darwinschen Zeitalter
oder die Entwicklungsmechanik in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts geschah. Zwar ist
momentan die Molekularbiologie ganz besonders aktiv, doch auch die Neurobiologie ist eine starke und
blühende Fachrichtung, und das gleiche läßt sich über die Ökologie und über die Verhaltensbiologie sagen.
Und selbst die weniger aktiven Zweige der Biologie verfügen über ihre eigenen Zeitschriften
(einschließlich vieler, die neu gegründet wurden), veranstalten Symposien und werfen beständig neue
Fragen auf. Am wichtigsten jedoch ist, daß ungeachtet der scheinbaren Aufspaltung in viele Fachbereiche
heute ein stärkeres Gefühl der Einheit herrscht als dies während mehrerer Jahrhunderte in der
Vergangenheit der Fall war.
Teil l: Vielfalt des Lebens
Kaum ein anderer Aspekt ist für das Leben so bezeichnend wie seine nahezu unbegrenzte Vielfalt. In
Populationen mit geschlechtlicher Fortpflanzung gibt es keine zwei Individuen, die einander gleich sind; es
gibt weder zwei gleiche Populationen einer Species, noch zwei Species, zwei höhere Taxa, irgendwelche
Sozietäten und so weiter ad infinitum, die einander gleich wären. Wohin wir auch in der Natur blicken,
entdecken wir Einzigartigkeit, und Einzigartigkeit ist gleichbedeutend mit Vielfalt.
Vielfalt findet sich in der lebendigen Welt auf jeder Hierarchiestufe. In einem höheren Organismus gibt
es wenigstens 10000 verschiedene Arten von Makromolekülen (einige Schätzungen liegen sogar sehr viel
höher). Zieht man all die verschiedenen Zustände von Repression und Derepression aller Gene in einem
Zellkern in Betracht, so besitzt ein höherer Organismus Millionen, wenn nicht Milliarden verschiedener
Zellen. Die Zahl der verschiedenen Organe, Drüsen, Muskeln, Nervenzentren, Gewebe und so weiter geht
in die Tausende. Jedes Individuum einer sich geschlechtlich fortpflanzenden Art ist einzigartig nicht nur,
weil es genetisch einzigartig ist, sondern auch, weil es sich im Alter von jedem anderen unterscheiden und
in seinen Immunsystemen und offenen Erinnerungsprogrammen verschiedene Informationen angesammelt
haben kann. Diese Vielfalt ist die Grundlage der Ökosysteme und die Ursache von Konkurrenz und
Symbiose; sie macht auch die natürliche Auslese möglich. Jeder Organismus muß, um zu überleben, die
Vielfalt seiner Umwelt kennen oder zumindest fähig sein, es mit ihr aufzunehmen. Tatsächlich gibt es wohl
kaum einen biologischen Vorgang oder ein biologisches Phänomen, bei dem organismische Vielfalt nicht
eine Rolle spielt.
Besonders bedeutsam ist, daß man auf jeder Hierarchieebene sehr ähnliche Fragen hinsichtlich der
Vielfalt stellen kann, zum Beispiel über Ausmaß oder Veränderlichkeit der Vielfalt, ihren Mittelwert, ihren
Ursprung, ihre funktionale Rolle und ihre selektive Bedeutung. Wie es für Vieles in der Biologie
bezeichnend ist, sind auch die Antworten auf die meisten dieser Fragen eher qualitativer als quantitativer
Art. Auf jeder Ebene der Vielfalt ist der erste Schritt zu ihrer Erforschung die Bestandsaufnahme, d.h. das
Entdecken und Beschreiben der verschiedenen „Sorten", aus denen eine spezielle Klasse besteht, ob es sich
dabei nun um Gewebe und Organe in der Anatomie handelt, um verschiedene normale und anomale Zellen
und Zellorganellen in der Zytologie, verschiedene Typen von Assoziationen von Floren und Faunen in der
Ökologie und Biogeographie, oder verschiedene Sorten von Arten und höheren Taxa in der Taxonomie.
Durch Beschreibung und Bestandsaufnahme wird das Fundament gelegt, von dem aller weiterer Fortschritt
in den jeweiligen Wissenschaften abhängt. In den folgenden Kapiteln werde ich mich darauf beschränken,
eine einzige Komponente der Vielfalt des Lebens zu behandeln, die Vielfalt der „Sorten" von Organismen
[1].
Die Entdeckung des Ausmaßes der Vielfalt
Seit es Menschen gibt, hat ihren Geist die Vielfalt der Natur beschäftigt. Wie unwissend ein
Eingeborenenstamm auch in anderen biologischen Fragen sein mag, stets besitzt er ein beträchtliches
Vokabular an Namen für verschiedene Tiere und Pflanzen, die in seiner Gegend vorkommen. Als erste
werden natürlich jene Lebewesen benannt, die für den Menschen unmittelbar von Interesse oder Bedeutung
sind, ob nun als Raubtiere (Bären, Wölfe), Nahrungsquelle (Hase, Rotwild, Fische, Muscheln, Gemüse,
Obst und so weiter), für Bekleidung (Häute, Pelze, Federn) oder wegen magischer Eigenschaften. Dies sind
auch heute noch die in der Folklore vorherrschenden „Arten".
Daß diese Beschäftigung mit der Vielfalt der Natur eine weltweite Erscheinung ist, wurde deutlich, als
europäische Naturforscher von ihren Expeditionen und Sammelreisen zurückkehrten. Sie pflegten
ausnahmslos von der erstaunlichen Kenntnis über Vögel, Pflanzen, Fische oder Strandtiere zu berichten,
die sie bei jedem besuchten Eingeborenenstamm vorgefunden hatten. Jeder Stamm konzentriert sich, nicht
weiter verwunderlich, auf die Naturgeschichte, die für sein tägliches Leben von besonderem Interesse ist.
So wird ein an der Küste lebender Stamm vielleicht alles über die in der Gezeitenzone lebenden
Schalentiere wissen, aber kaum etwas über das Vogelleben des angrenzenden Waldes. Da die Zahl an
Vogelarten in einem Gebiet gewöhnlich klein ist, besitzt ein Stamm häufig einen eigenen Namen für jede
Art (Diamond, 1966). Im Falle reicher lokaler Floren kann die Betonung eher auf generischen Namen
liegen – eine Tradition, die von dem Botaniker Linnaeus fortgesetzt wurde. Gewöhnlich gibt es ein
umfangreiches Vokabular für Kulturpflanzen und Haustiere; Angehörige von Stämmen mit Jagdtradition
besitzen jedoch oft auch ein hervorragendes Wissen über wildlebende Tiere und natürlich vorkommende
einheimische Pflanzen. Es ist außerordentlich bedauerlich, daß dieses Wissen von der Anthropologie so
lange Zeit vernachlässigt worden ist. Unter dem Einfluß der Zivilisation gehen solche Traditionen rasch
verloren, so daß es für ein Studium der Volkstaxonomie in vielen Gebieten zu spät ist. Zum Glück sind in
den letzten Jahren einige hervorragende Studien auf diesem Gebiet veröffentlicht worden [2]. Von
speziellem Interesse ist, wie häufig nicht nur Arten und Varianten, sondern auch höhere Taxa erkannt
wurden.
Die frühen Naturbeobachter kannten nur die Fauna und Flora in den Grenzen ihrer Heimat. Selbst
Aristoteles erwähnt nur etwa 550 Tierarten, und die ersten Renaissance-Kräuterbücher enthielten zwischen
250 und 600 Pflanzenarten. Daß es nicht überall auf der Welt die gleiche Flora und Fauna gibt, war jedoch
bereits in der Antike bekannt aus den Reiseberichten, wie sie von Herodot, Plinius und anderen überliefert
sind. Sie berichteten von Elefanten, Giraffen, Tigern und vielen anderen Tieren, die an den europäischen
Mittelmeerküsten nicht vorkamen.
Die Existenz solch seltsamer Kreaturen regte die Phantasie der Europäer an, übt doch das Unbekannte
überall eine Faszination auf den zivilisierten Menschen aus, ob es sich nun um exotische Länder, fremde
Völker oder bizarre Tiere und Pflanzen handelt. All die unglaublichen Geschöpfe in dieser unserer
wunderbaren Welt zu entdecken und zu beschreiben, war die große Leidenschaft von Reisenden und
Sammlern von Plinius bis zu Gesner und den Schülern von Linnaeus. Im Altertum hatte man natürlich
nicht die geringste Vorstellung von dem Ausmaß der geographischen Verbreitung von Faunen und Floren
wie heute. Dies änderte sich erst, als Reisende wie etwa Marco Polo (1254-1323) bis tief ins Innere Asiens
(oder Afrikas) vordrangen. Als die Portugiesen im 15. Jahrhundert die Ozeane zu durchqueren begannen
und Kolumbus die Neue Welt entdeckte (1492), wurde das Wissen um die biotische Vielfalt der Welt um
eine ganz neue Dimension erweitert. Cooks Seereisen, die die Erforschung Australiens und der Inseln des
pazifischen Ozeans einleiteten, bildeten den Schlußstein in diesem Gebäude. Doch all das war erst der
Anfang, denn die ersten Reisenden und Sammler brachten nur einen Bruchteil der fernen Faunen und
Floren mit. Sogar in Europa beschrieb man noch in den vierziger und fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts
neue Arten von Säugetieren und Schmetterlingen. Die Schatztruhe noch unbeschriebener Arten weniger
auffälliger Gruppen und weniger zugänglicher Gegenden scheint schier unerschöpflich zu sein. In den
Tropen kennen wir wahrscheinlich selbst heute noch nicht mehr als ein Fünftel oder Zehntel der
vorhandenen Arten.
Mit wachsenden Kenntnissen gewannen neue Betrachtungsweisen die Oberhand. Das Interesse der
ersten Reisenden hatte dem Spektakulären gegolten; für sie gab es nichts Schöneres als mit Geschichten
von Monstern und Fabelgeschöpfen nach Hause zu kommen. Bald jedoch wich dies einem echten Interesse
am rein Exotischen. Private Sammler in England, Frankreich, Holland und Deutschland richteten
Naturalien-Kabinetts ein, kaum anders jedoch als Briefmarken- oder Münzensammler. Echte Naturforscher
wie Linnaeus und Artedi profitierten von dem Enthusiasmus derartiger Sammler und Gönner. Zu den
Forschern, die Kolonien bereisten und wichtiges zur Naturgeschichte von zuvor nahezu unbekannten
Gegenden beitrugen, gehörten Marcgrave in Brasilien und Rumphius in Ostindien (s. Stresemann, 1975).
Das 18. Jahrhundert war der Beginn der Ära der großen Seereisen. Bougainville und Cook sowie andere
französische und britische Expeditionen brachten großartige Schätze mit [3]. Diese Aktivitäten nahmen im
19. Jahrhundert weiter zu, als sich Rußland (Kotzebue) und die Vereinigten Staaten hinzugesellten.
Reisende besuchten die entlegendsten Gegenden der Welt, sammelten alle Sorten naturgeschichtlicher
Gegenstände, füllten die privaten Museen, bis sie platzten, und erzwangen so den Bau großer nationaler
und staatlicher Museen und Herbarien. Niemals waren es der Proben und Exemplare zu viele, denn jede
Reise, jede Sammeltätigkeit erbrachte weitere Neuheiten. Noch in den zwanziger und dreißiger Jahren
unseres Jahrhunderts entdeckte eine einzige Expedition (die Whitney South Sea Expedition), die fast alle
Inseln der Südsee besuchte, in einer so gut bekannten Gruppe wie der der Vögel mehr als dreißig neue
Arten.
Die Arbeiten von Humboldt und Bonpland in Südamerika, von Darwin auf der Beagle (1831-1836), von
A.R.Wallace in Ostindien (1854-1862) und von Bates und Spruce in Amazonien sind wohlbekannt, doch
man vergißt gewöhnlich, daß es buchstäblich Tausende von anderen Sammlern gegeben hat. Linnaeus
sandte seine Schüler auf die Suche nach exotischen Pflanzen, aber einige der besten unter ihnen erlagen
tropischen Krankheiten: Bartsch (gest. 1738), Ternström (gest. 1746), Hasselquist (gest. 1752), Loefling
(gest. 1756) und Forskal (gest. 1763). Noch größer war die Tragödie in Ostindien, wo in einem Zeitraum
von dreißig Jahren die Blüte der europäischen Zoologen tropischen Krankheiten oder Mörderhand zum
Opfer fiel: Kühl (gest. 1821), van Hasselt (gest. 1823), Boie (gest. 1827), Macklot (gest. 1832), van Oort
(gest. 1834), Homer (gest. 1838), Forsten (gest. 1843) und Schwaner (gest. 1851). Unter ihnen waren die
enthusiastischsten und begabtesten Naturforscher der Zeit, deren Traum es war, zur Kenntnis des
Tierlebens der Tropen beizutragen. Kuhl und Boie waren Deutschlands brillianteste junge Naturkundler.
Die Lücke, die ihr Tod riß, trug mit dazu bei, daß die Qualität der deutschen naturgeschichtlichen
Forschung in den darauf folgenden Jahren abzusinken begann, denn jede Zeit hat immer nur eine begrenzte
Zahl erstklassiger Geister.
Unerforschte und kaum bekannte Länder bildeten jedoch nur ein Gebiet, in dem die Erforscher der
Vielfalt die Grenzen aufrollten. Man erforschte auch andere Lebensformen und exotische Umwelten. Die
Parasiten zum Beispiel wurden Gegenstand ernsthafter Forschung. Im menschlichen Darm lebende
Parasiten sind bereits in dem Ebers-Papyrus (1500 v.Chr.) erwähnt und wurden von den Ärzten des antiken
Griechenland erörtert; als ihre universale Verbreitung im Menschen und im Tier nachgewiesen wurde,
führte dies zu dem Glauben, sie entstünden durch Urzeugung. Erst im 19. Jahrhundert erkannte man, daß
viele, wenn nicht die Mehrheit der Parasiten auf einen einzigen Wirt begrenzt sind und daß eine Wirtsart
gleichzeitig von mehreren verschiedenen Parasiten geplagt werden kann: von Bandwürmern (Cestodes),
Saugwürmern (Trematodes), Fadenwürmern (Nematodes), von Blut- und Zellparasiten. Angefangen mit
den Studien von Zoologen wie Rudolphi, von Siebold, Küchenmeister und Leuckart spezialisierte sich eine
immer größere Zahl von Parasitologen auf diesen Zweig der Vielfalt [4]. Wegen der komplexen
Lebenszyklen der meisten Parasiten erfordert dieses Forschungsgebiet besondere Beharrlichkeit und
Findigkeit. Da Parasiten zu den gefährlichsten Erregern menschlicher Krankheiten gehören (Malaria,
Schlafkrankheit, Bilharziose, Rickettsien, usw.), wurden sie zu Recht intensiv erforscht. Auch Pflanzen
werden weithin von Parasiten heimgesucht, Von Gallinsekten, Milben und einer langen Reihe von Pilzen
und Viren. Es wäre wahrscheinlich nicht übertrieben, würde man behaupten, daß es mehr Arten
Pflanzenparasiten gibt als höhere Pflanzen. Ihre Entdeckung brachte eine enorme Ausdehnung des Reiches
der organischen Vielfalt mit sich.
Ein weiteres Neuland der Vielfalt entdeckte man in den Binnengewässern und Ozeanen. Schon
Aristoteles war während seines Aufenthaltes auf Lesbos von den Lebensformen im Meer fasziniert
gewesen. Dennoch nannte Linnaeus noch 1758 in seinem Systema Naturae mit Ausnahme einiger Fische,
Mollusken und Korallen nur lächerlich wenig Meeresorganismen. Dank des Forscherdranges von Pallas,
St. Müller und einer Reihe skandinavischer Forscher folgte bald Entdeckung auf Entdeckung. Aber auch
hier ist das Ende der erfolgreichen Suche noch nicht in Sicht. Sars war der erste Wegbereiter der
Erforschung der Tiefseefauna. Ihr galt die besondere Aufmerksamkeit der britischen ChallengerExpedition (1872-1876). Die Skandinavier, Holländer, Franzosen und Deutschen folgten mit
ozeanographischen Expeditionen, und die Fachleute sind immer noch dabei, neue Funde zu beschreiben.
Die Untersuchung des Lebens im Meer führte zur Entdeckung der marinen Parasiten. Meeresorganismen
werden zum Teil von denselben höheren Taxa von Parasiten (Cestoden und Trematoden), heimgesucht wie
die auf dem Land lebenden Organismen, andere Parasiten (Mesozoen, parasitische Ruderfüßer,
Rhizocephala) sind auf die Meere beschränkt und haben sich dort reich entfaltet.
Das Mikroskop eröffnete die Welt der Organismen, die mit bloßem Auge nicht oder zumindest nicht gut
sichtbar sind (Nordenskiöld, 1928). Die Verwendung einfacher Linsen zur Vergrößerung kleiner Objekte
reicht vermutlich bis in die Antike zurück. Eine Kombination von Linsen, d. h. ein Mikroskop, wurde
anscheinend zum ersten Mal von holländischen Linsenmachern im frühen 17. Jahrhundert konstruiert. Eine
1625 in Rom veröffentlichte Studie des Italieners Francisco Stelluti über die Biene (auf der Grundlage
einer fünffachen Vergrößerung) war das erste Werk der biologischen Mikroskopie. Alle Arbeit am
Mikroskop während der darauffolgenden zwei Jahrhunderte erfolgte an außerordentlich einfachen
Instrumenten. Ein Großteil galt dem Studium von pflanzlichem Gewebe (Hooke, Grew, Malpighi) oder der
Feinstruktur von Tieren, insbesondere In sekten (Malpighi, Swammerdam). Swammerdam entdeckte 1669
Daphnia, aber er beschrieb weder Einzelheiten, noch verfolgte er den Weg weiter, etwa durch die
Erforschung anderer Planktonorganismen (Schierbeck, 1967; Nordenskiöld, 1928).
So wichtig die Rolle dieser Forscher für die Geschichte der Zytologie und der Tier- und
Pflanzenmorphologie war, der Ruhm, mit Hilfe des Mikroskops die Grenzen der Vielfalt vorgeschoben zu
haben, gebührt van Leeuwenhoek (Dobell, 1960). Mit einem wahrhaft erstaunlichen Instrument, einem
Mikroskop mit nur einer einzigen Linse, erzielte er anscheinend bis 270fache Vergrößerungen. In den
Jahren 1674,1675,1676 und danach entdeckte von Leeuwenhoek die Fülle der Welt der Protisten
(Protozoen und einzellige Algen) und ariderer planktonischer Organismen (Rädertierchen, kleine
Crustaceen usw.) im Wasser und legte damit das Fundament für mehrere der später erfolgreichsten Zweige
der Biologie. Ja, er entdeckte und beschrieb sogar Bakterien. Seine Entdeckung der Infusorien (einzellige
Tiere und Pflanzen) hatte einen gewaltigen Einfluß auf das Denken seiner Zeit und die Diskussion über die
Urzeugung. Am wichtigsten aber bleibt: van Leeuwenhoek war der erste, der den Biologen das
unermeßlich weite Reich des mikroskopischen Lebens zum Bewußtsein brachte und damit die Gelehrten,
die sich mit Fragen der Klassifikation befaßten, vor gänzlich neue Probleme stellte.
Erst 1838 legte Ehrenberg die erste umfassende Abhandlung über die Protozoen vor, doch da es zu jener
Zeit noch keine Zelltheorie gab, betrachtete er sie als „vollkommene Organismen", d. h. er nahm an, sie
seien mit den gleichen Organen (Nerven, Muskeln, Eingeweide, Gonaden und so fort) ausgestattet wie
höhere Organismen. C. T. von Siebold stellte im Jahre 1848 den Stamm der Protozoen auf und wies ihre
einzellige Natur nach [5]. Rasche Fortschritte machte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die
Erforschung aller Arten von planktonischen Tieren und Algen. Jede Verbesserung des Mikroskops brachte
eine Erweiterung des Wissens mit sich, die Erfindung des Elektronenmikroskops in den dreißiger Jahren
dieses Jahrhunderts machte schließlich die Erforschung der Morphologie von Viren möglich.
Bisher habe ich mich in meiner Darstellung darauf konzentriert zu beschreiben, wie die Forschung einen
immer breiteren Zugang zur Vielfalt im Tierreich fand. Zugleich war jedoch auch in der Pflanzenforschung
eine ähnliche Entwicklung im Gange. Bevor noch die Blütenpflanzen (Angiospermen) halbwegs gut
beschrieben waren, hatten einige Botaniker sich bereits auf Kryptogamen (Farne, Moose, Flechten, Algen)
und die reiche Welt der Pilze zu spezialisieren begonnen (Mägdefrau, 1973).
Fossilien
Aber das ist noch immer nicht alles! Der Vielfalt der heutigen lebendigen Welt steht in mindestens
gleicher, wenn nicht größerer Fülle das Leben der vergangenen Zeitalter gegenüber, das nur in fossilem
Zustand erhalten ist. Die höchsten Schätzwerte für die Zahl der rezenten Tiere und Pflanzen belaufen sich
auf etwa 10 Millionen Arten. Das Leben auf der Erde begann vor etwa 3,5 Milliarden Jahren und seit
mindestens 500 Millionen Jahren existiert eine reiche Tier- und Pflanzenwelt; wenn wir einen vernünftigen
Umsatz in der Artenzusammensetzung der Tier- und Pflanzenwelt annehmen, so liegt die geschätzte Zahl
von 1 Milliarde ausgestorbenen Arten vermutlich eher zu niedrig als zu hoch. In der Paläontologie geht die
Zeit der großen Entdeckungen, etwa des Archaeo pteryx (eine Zwischenstufe zwischen Reptilien und
Vögeln) und des Ichthyostega (Glied zwischen Fischen und Amphibien), vielleicht ihrem Ende entgegen,
aber selbst heute wird immer noch gelegentlich ein neuer Stamm fossiler Wirbelloser beschrieben, und für
neue Ordnungen, Familien und Gattungen scheint kein Ende abzusehen zu sein.
Die Geschichte der Entdeckung fossiler Faunen und Floren ist alt, sie reicht bis in die Antike zurück
(siehe auch Teil II) [6]. Herodot, Strabo, Plutarch und insbesondere Xenophanes erwähnen Fossilien von
Meeresmollusken und hatten erkannt, daß sie durch das Zurückweichen des Meeres entstanden waren. Den
versteinerten Säugetieren, Reptilien und Amphibien wandte sich die Aufmerksamkeit jedoch erst im 17.
Jahrhundert zu; eine ständig wachsende Zahl von Funden wurde im 18. und 19. Jahrhundert gemacht. Wer
hat nicht von den Freilegungen von Mastodonten, Dinosauriern, Ichthyosauriern, Pterodaktylen, Moas und
anderen, häufig gigantischen, fossilen Wirbeltieren gehört?
Gleichzeitig wuchs auch der Wissensbestand in der Paläobotanik (Mägdefrau, 1973, S. 231-251). Die
Schwierigkeiten auf diesem Gebiet sind groß, müssen doch Stämme, Blätter, Blüten, Pollen und Früchte
(Samen) zusammenpassen. Dennoch ist die Zahl der bekannten Fossilien stetig angewachsen, und mit ihr
unser Verständnis ihrer Verbreitung in Raum und Zeit. Die Erforschung fossiler Pollen war besonders
bedeutungsvoll. Doch bleiben immer noch viele große Rätsel zu lösen, unter anderem das der Entstehung
der Angiospermen (Doyle, 1978).
Bis zur Mitte unseres Jahrhunderts hatten die ältesten bekannten Fossilien (spätes Präkambrium) ein
Alter von rund 625 Millionen Jahren. Seitdem haben Barghoorn, Cloud und Schopf mit der Entdeckung
fossiler Prokaryonten in bis zu 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen diese Grenze um etwa das 5fache
hinausgeschoben (Schopf, 1978).
Die Prokaryonten, ob rezent oder versteinert, stellen heute das faszinierendste Neuland der
beschreibenden Systematik dar. Wie aus einem sorgfältigen Studium der Biochemie und Physiologie der
Bakterien hervorgeht, sind sie weitaus stärker diversifiziert, als man zuvor angenommen hatte. Ja, Woese
und seine Mitarbeiter haben vorgeschlagen, die Methanobakterien und ihre Verwandten in ein getrenntes
Reich (Archaebacteria) zu stellen und in ein weiteres jene Prokaryonten, die als Vorfahren der
symbiotischen Organellen der Eukaryontenzellen gelten (Mitochondrien, Plastiden usw.). Die Erforschung
der ribosomalen RNA und anderer Moleküle hat endlich Licht in die zuvor umstrittene Klassifizierung der
Bakterien gebracht (Fox et al., 1980). So erstaunlich es auch ist, ständig wird in der Taxonomie, dem
ältesten Zweig der Biologie, etwas Neues, häufig alarmierend Neues entdeckt: ein Beispiel ist die
Wiederentdeckung von Trichoplax, des anscheinend primitivsten aller Metazoen (Grell, 1972).
Die Systematik, die Wissenschaft der Vielfalt
Bei einem Blick zurück auf die Geschichte der Erforschung der Mannigfaltigkeit, wird man unwillkürlich
von Ehrfurcht erfüllt angesichts der überwältigenden Vielfalt der Natur in Raum (alle Kontinente), Zeit
(seit 3,5 Milliarden Jahren bis heute), in der Größe (von Viren bis zu Walen), in Habitat (Luft, Land,
Binnengewässer, Ozeane) und Lebensform (freilebend oder parasitär). Es ist nicht verwunderlich, daß der
Mensch erst nach und nach den unglaublichen Reichtum des ihn umgebenden organischen Lebens kennen
lernte. In der Tat hatte er viele Gründe dafür, diese Fülle zu erforschen. Da war zunächst sein stets wacher
Wissensdurst in bezug auf seine Umgebung und sein Wunsch, diese zu kennen und zu verstehen. Da war
auch die praktische Notwendigkeit zu wissen, welche Tiere und Pflanzen ihm von Nutzen sein konnten,
hauptsächlich als Nahrung und, im Falle der Pflanzen, auch als Heilmittel. Als man Linnaeus fragte, wofür
das Studium der Vielfalt denn gut sei, antwortete er als frommer Anhänger der Lehre von der
Weltschöpfung in seiner Abhandlung „Cui bono?" mit den Worten: Alle geschaffenen Dinge müssen
einem Zweck dienen. Einige Pflanzen dienen als Medizin, einige Lebewesen dienen dem Menschen zur
Nahrung usw. Der Schöpfer in seiner Allwissenheit tat nichts Unnützes, sondern schuf jedes Ding zu einem
besonderen Zweck oder zum Nutzen von jemand oder etwas. Unsere Aufgabe ist es, diese seine Absichten
zu entdecken, und das ist der Zweck der Naturgeschichte.
Im 17. und 18. Jahrhundert hatte jedoch die Leidenschaft für das Studium der Natur noch einen anderen
Grund. Bereits die Griechen hatten die Harmonie der Natur gepriesen: Die ganze Welt bildet einen
Kosmos, ein Wort, dessen Bedeutung für die Griechen Schönheit und Ordnung einschloß. Ob man nun die
Natur als das vollkommene Werk des Schöpfers ansieht oder sie, in der Interpretation von Seneca und den
Pantheisten, mit Gott gleichsetzt, – viele gottesfürchtige Wissenschaftler wie John Ray, Isaac Newton und
Carl Linnaeus waren davon überzeugt, daß fest verwurzelt in der Natur eine verborgene Ordnung und
Harmonie existiere, die zu enträtseln und zu erklären ihre Aufgabe sei.
Die Gesetze der Physik betonen Universalität und Uniformität. Wären nur der Zufall und das blinde
Wirken physikalischer Gesetze im Universum tätig, so argumentierten die Naturwissenschaftler des 17.
und frühen 18. Jahrhunderts, so müßte man entweder eine homogene oder eine völlig chaotische Welt der
Dinge vorfinden. Folglich kann die gutgefügte Vielfalt der Lebewesen, die man tatsächlich vorfindet, nur
der Existenz eines Schöpfers zu verdanken sein. Newton drückte dies mit folgenden Worten aus: „Wir
kennen ihn nur aus seiner höchst weisen und hervorragenden Planung von Dingen und Zweckursachen; wir
bewundern ihn wegen seiner Vollkommenheit; aber wir verehren ihn und beten ihn an um seiner
Herrschaft willen, denn wir beten ihn an als seine Diener, und ein Gott ohne Herrschaft, ohne weise
Voraussicht und Zweckursachen ist nichts anderes als Schicksal und Natur. Die blinde metaphysische
Notwendigkeit, die gewiß immer und überall die gleiche ist, könnte keine Vielfalt von Dingen erzeugen.
All die den verschiedenen Zeiten und Orten angepaßte Vielgestaltigkeit der natürlichen Dinge, die wir
vorfinden, konnte aus nichts anderem entstehen als aus den Gedanken und dem Willen eines Wesens, das
notwendigerweise existiert." Die Erforschung der vollkommenen Harmonie der Natur und ihrer
Mannigfaltigkeit war somit die beste Art der Gotteserfahrung. Sie wurde zu einem Bestandteil der
Naturtheologie, der großen Mode des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Das Thema der Naturtheologie war
nicht nur die Anpassung als Beweis für den Schöpfungsplan, sondern auch die Mannigfaltigkeit als solche.
Niemand war sich dessen deutlicher bewußt als Louis Agassiz, der das natürliche System (wie er es in
seinem Essay on Classification beschrieb) als den entscheidendsten Beweis für die Existenz Gottes ansah
[7].
Die so gut wie unvorstellbare Fülle der Arten von Lebewesen bedeutete jedoch eine ernsthafte
Herausforderung an den menschlichen Geist. Seit der wissenschaftlichen Revolution in der Mechanik und
in der Physik war die abendländische Welt in der Suche nach Gesetzen befangen. Gerade dafür jedoch war
kein Aspekt der Natur so unergiebig wie die organische Vielfalt. Nur mit einer Methode konnte man
hoffen, solche Gesetze zu entdecken: Man klassifizierte die Vielfalt und ordnete sie. Das erklärt, warum die
Naturbeobachter im 17., 18. und 19. Jahrhundert davon besessen waren, zu klassifizieren. Das ermöglichte
es, wenigstens einige Ordnung in die verwirrende Vielfalt zu bringen. Wie es nun einmal so geht, führte die
Klassifikation schließlich tatsächlich zu dem gesuchten Gesetz: der Abstammung (durch Modifikation) von
einem gemeinsamen Ahnen. So wichtig erschien im 18. Jahrhundert Zoologen und Botanikern dieser
Ordnungsprozeß, daß sie Klassifikation nahezu mit Naturwissenschaft gleichsetzten.
Wie in allen anderen Zweigen der Wissenschaft waren auch unter den Praktikern der Taxonomie
begabte wie auch weniger gute Leute. Einige dieser Spezialisten taten in ihrem ganzen Berufsleben nichts
anderes als neue Arten zu beschreiben. In der Ära von Linnaeus, als die Taxonomie hoch angesehen war,
erschien dies annehmbar. Zu jener Zeit war die Folge der Vorherrschaft der Systematik eine
Vernachlässigung aller anderen zeitgenössischen biologischen Forschung, z.B. der Arbeit von Kölreuter.
Aber schließlich erhob sich doch – und sehr zu recht – die Frage, ob sich eine derart rein deskriptive
Tätigkeit tatsächlich als Wissenschaft qualifiziert, wenn sie weder eine Suche nach Gesetzen, noch den
Versuch einschließt, zu Verallgemeinerungen zu gelangen? Die glänzenden Erfolge von Baer, Magendie,
Claude Bernard, Schleiden, von Helmholtz und Virchow in anderen Zweigen der Biologie während der
dreißiger bis fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts führten dazu, daß die Systematik rasch an Ansehen
verlor. Allerdings erwachte sie nach 1859 zu neuem Leben, als Darwins Theorie von der Abstammung der
Taxa von gemeinsamen Ahnen die erste nicht übernatürliche Erklärung für die Existenz höherer Taxa
lieferte. Dieser neue intellektuelle Impuls war jedoch bald erschöpft, und die erregenden Fortschritte in der
funktionalen Biologie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ließen die Systematik erneut in den
Hintergrund treten. Die Physiologen und Experimentalembryologen hielten sie für eine rein beschreibende
Tätigkeit und der Aufmerksamkeit eines „wahren Naturwissenschaftlers" unwürdig. Die Vertreter der
exakten Wissenschaften wie auch die Experimentalbiologen waren sich darin einig, daß die
Naturgeschichte eine Art Briefmarkensammeln sei. Ein führender Zoologe bemerkte anläßlich eines
Besuches in der Universität Cambridge im späten 19. Jahrhundert: „Die Naturgeschichte wird so weit nur
möglich entmutigt und von den zahllosen Mathematikern der verehrten Universität als müßige
Zeitverschwendung betrachtet." Noch 1960 stellte ein wohlbekannter Physikhistoriker fest: „Die
Taxonomie reizt jemanden, der sich mit der wissenschaftlichen Ideengeschichte befaßt, herzlich wenig."
Diese Kritiker erkannten nicht, wie sehr das Studium der Vielfalt die Grundlage für die Forschung in
weitesten Gebieten der Biologie bildet (Mayr, 1974b). Sie übersahen auch, was Naturgeschichte in den
Händen von Aristoteles, Cuvier, Weismann oder Lorenz geworden war: einer der fruchtbarsten und
schöpferischsten Zweige der Biologie. Baute nicht Darwins Origin of Species im wesentlichen auf
naturgeschichtlichen Untersuchungen auf, und entwickelten sich nicht die Disziplinen der Ethologie und
Ökologie aus der Naturgeschichte? Die Biologie wäre eine außerordentlich enge Wissenschaft, wollte man
sie auf die experimentelle Forschung in Laboratorien beschränken und des Kontakts mit den ständig neuen,
belebenden Erkenntnissen aus der Naturgeschichte berauben.
Bedauerlicherweise hat bisher noch niemand eine Geschichte des Einflusses der Naturgeschichte auf die
Entwicklung der Biologie geschrieben. In D. E. Aliens The Naturalist in Britain (1976) liegt allerdings
eine ausgezeichnete Arbeit für das England des 19. Jahrhunderts vor. Stresemanns Ornithologie (1949)
befaßt sich mit dem gleichen Thema, soweit es Vögel betrifft. In jeder Gruppe von Naturbeobachtern gibt
es immer einige rührige und wißbegierige Geister, die tieferreichende Fragen stellen. Sie trugen die
wertvollsten Schriften zu den Werken der Naturtheologie bei (beispielsweise Ray, Zorn und Kirby), sie
gründeten naturgeschichtliche Zeitschriften und Gesellschaften und umrissen die grundlegenden Probleme,
die schließlich zum Gegenstand einzelner Zweige der Biologie, der Evolutionsbiologie, Biogeographie,
Ökologie und Verhaltensforschung werden sollten. Interessanterweise waren alle großen Pioniere auf
diesem Gebiet Amateure – engagierte und enthusiastische Amateure. Die Naturgeschichte war der letzte
Zweig der Biologie, der zu einem Beruf wurde. Erst heute weiß man zu würdigen, welch großen Beitrag sie
zur Begriffsbildung in der Biologie geleistet hat.
Es fehlt nicht an sogenannten Geschichten der Taxonomie, aber fast ohne Ausnahme sind sie lediglich
Geschichten von Klassifikationen Sie verzeichnen die schrittweisen Verbesserungen (ebenso wie die
gelegentlichen Rückschläge) der konkreten Klassifikationen von Tier- und Pflanzengruppen, wie sie von
Aristoteles, Theophrastos und Dioskurides über Adanson, Linnaeus, Pallas, Cuvier, Lamarck, de Jussieu,
Lindley, Hooker, Engler, Ehrenberg, Leuckart, Haeckel, bis zu Huxley und vielen anderen vorgeschlagen
worden sind. Historiker dieser Art zeigen, daß aufgrund des unermüdlichen Bemühens, Gattungen,
Familien und Ordnungen umzugruppieren, die Aufstellung mehr und mehr homogener Gruppierungen
gelungen ist, die die Abstammung von gemeinsamen Vorfahren und den Grad der evolutiven Abweichung
erkennen lassen. Es ist eine faszinierende Geschichte von Versuch und Irrtum [8].
Da in dieser Art von Literatur der Schwerpunkt auf der Klassifikation liegt, setzt sie sich nicht mit der
Geschichte der wechselnden Ideen und Begriffe des Fachgebietes auseinander. Die zwei wichtigsten
Aspekte der Geschichte der Systematik wie auch der Geschichte der Evolutionsbiologie, sind: 1. Sie ist
eher eine Geschichte der Begriffe als der Fakten; 2. vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis heute, also in
etwa 250 Jahren, gab es konkurrierende, wenn nicht sogar sich widersprechende Begriffe und
Interpretationen nebeneinander. Die auseinanderklaffende Uneinheitlichkeit der Biegriffsbildung in der
Taxonomie ist zum Teil dadurch bedingt, daß in der Taxonomie jede Gruppe von Organismen eine andere
Tradition hat. Das gilt nicht nur für Bakterien, Pflanzen und Tiere, sondern sogar für verschiedene Gruppen
von Pflanzen, Insekten oder Wirbellosen. Neue Begriffe (wie Klassifikation nach multiplen Merkmalen,
polytypische Arten, Zwillingsarten – sibling species – im Gegensatz zu biologischen Rassen) wurden in der
Taxonomie der verschiedenen höheren Taxa zu sehr unterschiedlichen Zeiten akzeptiert.
Der erste Eindruck von der Geschichte der Systematik ist der eines unaufhörlichen Ringens mit
denselben alten Problemen, mit Fragen wie etwa: Was ist eine Art? Was ist Verwandtschaft? Wie grenzt
man höhere Taxa am besten ab? Wie gruppiert man Arten zu höheren Taxa? Welches sind die
zuverlässigsten Merkmale? Welche Prinzipien sind bei der Einordnung von Taxa in höhere Kategorien
zugrundezulegen? Welche Funktion hat die Klassifikation? Und so weiter.
Die Geschichte der Systematik entspricht offensichtlich nicht im geringsten der Vorstellung vom
Fortschritt der Wissenschaft, wie ihn Thomas Kuhn in seiner Theorie der wissenschaftlichen Revolutionen
beschrieben hat. Nicht einmal die Darwinsche Revolution 1859 hatte einen entscheidenden Wandel in der
Systematik zur Folge, wie man es hätte erwarten können. Die Gründe für diesen Sachverhalt sollen im
folgenden dargestellt werden. Zugleich wird diese Darstellung zeigen, daß die Systematik, ihre Begriffe
und Vorstellungen, in den letzten dreihundert Jahren keineswegs völlig stagniert haben. Begriffe haben
gewechselt und sind geklärt worden, was sich am besten anhand der Veränderungen in der Verwendung
und Bedeutung einiger häufig verwendeter Termini in den verschiedenen Epochen und in den Schriften der
verschiedenen Autoren erläutern läßt [9].
Wie sollte sich eine wirklich einheitliche Theorie der Systematik entwickeln können, solange der
Ausdruck „Verwandtschaft" sowohl für bloße Ähnlichkeit als auch für genetische Verwandtschaft benutzt
wurde, solange man mit dem Ausdruck „Varietät" ebenso geographisch abgegrenzte Populationen wie
innerhalb der Population auftretende Varianten (Individuen) meinte, solange der Terminus „Spezies, Art"
sowohl für morphologisch verschiedene Individuen als auch für fortpflanzungsmäßig isolierte
Populationen benutzt wurde und der Ausdruck „Klassifikation" ebenso Identifikationssysteme (z.B.
Bestimmungstabellen) wie echte Klassifizierungen bezeichnete? Das Wort „natürliches System" hatte in
verschiedenen Epochen unterschiedliche Bedeutungen, und Ausdrücke, wie „Kategorie", wurden häufig
von ein und demselben Autor zur Bezeichnung verschiedener Begriffe gebraucht. Die meisten Verfasset,
die denselben Ausdruck (z. B. „Kategorie" oder „Varietät") in sehr verschiedener Bedeutung benutzten,
waren sich dieser Tatsache nicht bewußt. Man kann wohl mit Recht sagen, daß die letzten vierzig Jahre
größere Fortschritte in der Klärung taxonomischer Begriffe gebracht haben, als die zweihundert Jahre
zuvor.
Die Struktur der Systematik
Betrachtet man den Elefanten, die: Giraffe, den Kaiserpinguin, den Schwalbenschwanz-Schmetterling, die
Eiche und einen Pilz, so ist der erste überwältigende Einidruck vermutlich, jedes sei von ihnen ganz
einzigartig. Wäre diese Vielfalt wirklich völlig chaotisch, so ließe sie sich nicht studieren. Es gibt jedoch
Regelmäßigkeiten und – mehr als das – sie lassen sich erklären; das haben Darwin und viele andere
gezeigt. Außer Zufallsfaktoren gibt es bestimmbare Ursachen für das Entstehen der Vielfalt. Somit ist es
legitim, eine Wissenschaft namens Systematik gelten zu lassen, deren Gegenstand die Vielfalt ist. Simpson
(1961) gibt folgende Definition: „Die Systematik ist die wissenschaftliche Untersuchung der Arten und
Mannigfaltigkeit von Organismen sowie aller Beziehungen und Verwandtschaften zwischen ihnen." Wie
Simpson weiter ausführt, „ist [die Systematik] der elementarste und zugleich umfassendste Teil [der
Biologie]; der elementarste, da man über [Organismen] nicht diskutieren oder sie wissenschaftlich
abhandeln kann, solange sie nicht taxonomisch eingeordnet sind; und der umfassendste, da [die
Systematik] in ihren verschiedenen Zweigen alles sammelt, benutzt, zusammenfaßt und anwendet, was
über [Organismen] bekannt ist, sei es über ihre Morphologie, Physiologie, Psychologie oder Ökologie."
Da die Systematik ein solch immens großes Gebiet umfaßt, muß man versuchen, sie zu unterteilen. Die
Geschichte dieses Gebiets wird am leichtesten verständlich, wenn man zwei taxonomische Untergebiete
unterscheidet: (1) die Mikrotaxonomie, die sich mit den Methoden und Prinzipien befaßt, anhand derer
Arten („Spezies") von Organismen erkannt und abgegrenzt werden, und (2) die Makrotaxonomie, die sich
mit den Methoden und Prinzipien beschäftigt, mit deren Hilfe Typen von Organismen klassifiziert, d. h. in
Form von Klassen eingestuft werden. Die Taxonomie als Ganzes wird dann (etwas enger als die
Systematik) als „die Theorie und Praxis der Abgrenzung von Organismen und ihrer Klassifikation"
definiert (Simpson, 1961 a; Mayr, 1969).
4 Makrotaxonomie, die Wissenschaft der Klassifikation
Klassifikationen sind überall dort notwendig, wo man es mit Vielfalt zu tun hat. So gibt es
Klassifikationen von Sprachen, von Gütern in Produktions- oder Marktsystemen, von Büchern in einer
Bücherei oder von Tieren und Pflanzen in der Natur. Das Verfahren des Klassifizierens besteht in all
diesen Fällen darin, daß man einzelne Objekte in Kategorien oder Klassen gruppiert. Über dieses
grundlegende Vorgehen besteht keine Uneinigkeit, jedoch war jahrhundertelang umstritten, wie dies am
besten zu tun sei, welche Kriterien bei diesem Einordnen anzulegen seien und welches letzthin der Zweck
einer Klassifikation sei. Es ist die Aufgabe der Geschichte der Makrotaxonomie, die unterschiedlichen und
häufig wechselnden Antworten auf diese Fragen darzustellen und zu erörtern.
Zuvor sind jedoch einige Begriffe kritisch unter die Lupe zu nehmen, die in der Geschichte der
Taxonomie häufig verwechselt worden sind.
Identifikation kontra Klassifikation
Identifikationssysteme sind keine Klassifikationen. Zur Bestimmung bedient man sich deduktiver
Verfahren. Ihr Zweck ist die Einordnung eines untersuchten Individuums in eine der Klassen einer bereits
bestehenden Klassifikation. Gelingt dies, so hat man das Exemplar „identifiziert". Zur Identifikation
genügen wenige Merkmale, aufgrund derer das Exemplar in die eine oder andere Alternative eines
Bestimmungsschlüssels verwiesen wird (Mayr, 1969. S.4, 66, 112-115). Im Gegensatz dazu werden bei der
Klassifikation, wie man sie heute versteht, Populationen und Taxa in Gruppen gesammelt, und diese
wiederum in immer größeren Gruppen; bei diesem Verfahren bedient man sich einer großen Zahl von
Merkmalen.
Für die Beurteilung von Klassifikationen, die einem bestimmten Zweck dienen sollen, zum Beispiel
„Klassifikationen'4 von Heilkräutern nach ihren heilenden Eigenschaften, ist entscheidend, daß man den
Unterschied zwischen Klassifikations- und Identifikationssystemen verstanden hat. In der Tat sind solche
„Klassifikationen" nichts anderes als Bestimmungsschlüssel, jedenfalls scheint es dem modernen
Taxonomen so. Als der griechische Arzt Dioskurides Pflanzen nach ihren heilenden Eigenschaften ordnete,
wollte er sicherstellen, daß jeweils die richtige Art zu ihrem spezifischen medizinischen Zweck verwendet
würde. Da fast bis zu unserer Zeit die meisten Arzneien aus Pflanzen gewonnen wurden, dienten die
Arzneibücher gleichzeitig als Handbücher zur Pflanzenbestimmung.
Einige dieser Klassifikationen für bestimmte Zwecke sind allerdings keine Bestimmungsschlüssel,
sondern dienen dem Zweck, der in ihrem Namen angegeben ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in der
ökologischen Literatur Pflanzen nach Wachstumsform oder Standort klassifiziert werden. Die
Brauchbarkeit derartiger Klassifikationen ist sehr begrenzt. Bis zum 16. Jahrhundert wurden nahezu alle
Bemühungen um „Klassifikation" unter diesem Gesichtspunkt der Nützlichkeit vorgenommen. Wenn man
sich mit Klassifikationen befaßt, muß man sich daher über das Ziel einer Klassifikation im klaren sein.
Die Funktionen von Klassifikationen
Philosophen wie Taxonomen haben fast von Anfang an erkannt, daß die Klassifikationen einem
zweifachen Zweck dienen, einem praktischen und einem generellen (das heißt, einem wissenschaftlichen
oder einem metaphysischen). Über das Wesen dieser beiden Zielsetzungen hat es jedoch erhebliche
Meinungsverschiedenheiten gegeben. Die frühen Autoren sahen den praktischen Zweck der Klassifikation
vor allem in ihrer Funktion als Bestimmungsschlüssel. In jüngerer Zeit wird als praktischer Zweck am
häufigsten hervorgehoben, daß eine Klassifikation als Index für ein Informations- und Wiederabrufsystem
dienen solle. Um diesen Zweck am besten zu erfüllen, sollte eine Klassifikation aus Klassen von Objekten
bestehen, die die größte Zahl gemeinsamer Eigenschaften aufweisen. Eine solche Klassifikation ist
automatisch der Schlüssel für die in ihr gespeicherte Information. Ein leichter Informationsabruf ist in der
Regel der wichtigste oder sogar der einzige Zweck der Klassifikation von Posten wie Büchern in einer
Bücherei oder den meisten anderen unbelebten Gegenständen; sie werden nach mehr oder weniger
willkürliche Kriterien geordnet. Im Gegensatz dazu unterliegen die Klassifikationen von Objekten, die
durch Kausalität (wie etwa Krankheiten) oder durch Ursprung (wie bei der biologischen Klassifikation)
miteinander verbunden sind, erheblichen Einschränkungen, haben aber die wertvolle Eigenschaft, als
Grundlage für weitreichende Verallgemeinerungen dienen zu können.
Was die generelle Bedeutung der biologischen Klassifikation betrifft, so hat sich im Lauf der Zeit vieles
verändert. Für Aristoteles spiegelte die biologische Klassifikation die Harmonie der Natur wider,
insbesondere soweit sie sich in der scala naturae manifestierte. Für die Naturtheologen zeigte die
Klassifikation den Schöpfungsplan des Baumeisters dieser Welt; das hat Louis Agassiz (1857) deutlich
gemacht. Das natürliche System ist Ausdruck dieses Plans. Nachdem Darwin die Theorie der gemeinsamen
Abstammung aufgestellt hatte, wurde die metaphysische Interpretation der Klassifikation durch eine
wissenschaftliche ersetzt. Da die Beobachtungen in allen vergleichenden Zweigen der Biologie mit Hilfe
des (jetzt unter dem Blickwinkel der Evolution definierten) „natürlichen Systems" organisiert waren, wurde
das Abgrenzen von Taxa und Aufstellen einer Hierarchie höherer Taxa, die die größtmögliche Zahl
gültiger Verallgemeinerungen erlaubte, zur primären Funktion der Klassifikation. Dabei ging man von der
Annahme aus, daß die Vertreter eines Taxon, da sie als Nachkommen eines gemeinsamen Vorfahren ein
gemeinsames Erbe besitzen, mehr Eigenschaften miteinander gemeinsam haben als mit anderen nicht auf
diese Weise verwandten Arten. Evolutionäre Klassifikationen besitzen daher bei allen vergleichenden
Studien einen erheblichen heuristischen Wert. Sie sind entweder an zusätzlichen Merkmalen oder im
Vergleich zu anderen Taxa überprüfbar (Warburton, 1967).
Die Existenz dieser zwei verschiedenartigen Ziele (praktisch und generell) der biologischen
Klassifikation hat zu Kontroversen geführt. Zum Beispiel wurde die Frage aufgeworfen, ob das Ziel der
Informationswiedergewinnung mit dem der Verallgemeinerung vereinbar ist. Welches ist die Natur der
konkretisierten Verallgemeinerungen? Kann man sie als Theorie betrachten?
Diese kurze Auflistung der Probleme im Zusammenhang mit den verschiedenen Funktionen der
Klassifikation möge die Aufmerksamkeit des Lesers schärfen, wenn er den historischen Wandlungen in der
Einstellung zu diesen Problemen nachspürt.
Aristoteles
Die Geschichte der Taxonomie beginnt mit Aristoteles (384-322 v.Chr.). Obwohl anscheinend bereits
vor ihm viel über Tiere und Pflanzen bekannt war, enthalten die wenigen frühen Schriften, die uns
überliefert sind, keine Klassifikationen. Soweit es um faktisches Wissen geht, hat Aristoteles offensichtlich
in sein Werk alles aufgenommen, was er von seinen Vorgängern erfahren konnte, das meiste vermutlich
von der Schule des Hippokrates. Doch die liebevolle Sorgfalt, mit der Aristoteles Meerestiere in allen
Einzelheiten beschreibt, läßt darauf schließen, daß es sich bei einem großen Teil seiner Aussagen um
Originalinformation handelt, oder zumindest, daß diese von ihm persönlich von Fischern und ähnlichen
„volkstümlichen" Quellen übernommen wurde. Man nimmt an, daß er sich während seiner Jahre auf
Lesbos intensiv mit naturgeschichtlichen Studien befaßte. Sein Hauptwerk der beschreibenden Zoologie ist
die Historia Animalium, aber zahlreiche Aussagen, die für die Systematik von Bedeutung sind, finden sich
auch in De Partibus, De Generatione und in anderen Schriften.
Seit alters her wird Aristoteles als der Vater der Wissenschaft von der Klassifikation gefeiert, und doch
hat seit der Renaissance bis heute große Unsicherheit und viel Uneinigkeit darüber bestanden, welche
Klassifikationsprinzipien er wirklich benutzt habe [1]. Zum Teil scheint dies daran zu liegen, daß
Aristoteles in seinen früheren Schriften (in denen er die Prinzipien seiner Logik entwickelte) andere
Methoden vorschlug als in seinen späteren biologischen Schriften, zum anderen an seiner Überzeugung,
daß die Methode der Definition durch logische Zweiteilung keine leidlich vollständige Beschreibung; und
Kennzeichnung von Tiergruppen ergeben könne.
Die Methode der aristotelischen Logik läßt sich am besten am Beispiel eines bekannten
Gesellschaftsspiels erläutern, bei dem jemand aufgefordert wird, einen Gegenstand zu raten, den die
anderen in seiner Abwesenheit ausgewählt haben. Seine erste Frage lautet vielleicht: „Ist es lebendig?"
Damit unterteilt er alle vorstellbaren Objekte in zwei Klassen: Lebewesen und unbelebte Gegenstände. Ist
die Antwort ja, so fragt er etwa: „Ist es ein Tier?" und unterteilt damit die Klasse der Lebewesen wieder in
zwei Klassen, Tiere und Nicht-Tiere. Eine Fortsetzung dieses Verfahrens, bei dem die verbleibende Klasse
von Objekten immer wieder in zwei Teile unterteilt wird (dichotome Unterteilung), führt früher oder später
zur richtigen Antwort.
In der aristotelischen Logik wird die größte beobachtete Klasse, das summum genus (z. B. Pflanzen)
durch einen deduktiven Prozeß in zwei (oder mehr) untergeordnete Unterklassen aufgeteilt, die als
„species" bezeichnet werden. Jede „species" wird auf der nächst niedrigeren Teilungsstufe ihrerseits wieder
zu einem „genus", das wiederum in „species" unterteilt wird. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis
die niedrigste Gruppe von „species" nicht mehr unterteilbar ist. Die „species" des Logikers braucht
natürlich nichts mit der biologischen Art zu tun zu haben, wenngleich das Resultat des letzten Schritts bei
der Unterteilung einer Klasse von Organismen in der Tat eine biologische Spezies, eine Art, sein kann. Die
Klassifikation durch logische Unterteilung ist eine Abwärtsklassifikation. Sie ist ebenso auf unbelebte
Gegenstände wie auf Organismen anwendbar (Möbel lassen sich in Stühle, Tische, Betten usw.
unterteilen).
Spätere Autoren haben sich dadurch verwirren lassen, daß Aristoteles bei der Beschreibung seiner
logischen Methode als Beispiel Unterteilungskriterien heranzog, die sich auf Tiere bezogen, wie „behaart
oder nicht behaart", „mit Blut oder ohne Blut", „Vierfüßer oder nicht". Aber er klassifizierte die Tiere nicht
mit der Methode der logischen Aufteilung; dies geht aus der Tatsache hervor, daß Aristoteles' System der
Tiere keine komplizierte Hierarchie ist [2], und noch deutlicher daraus, daß er sich sehr konkret über die
dichotome Aufteilung als Klassifizierungsprinzip lustig macht (De partibus animalium 642b5-644a11) und
beträchtliche Anstrengungen unternimmt zu zeigen, warum sie nicht funktionieren würde. Ungeachtet der
Ablehnung durch Aristoteles war die logische Zweiteilung von der Renaissance (Cesalpino) bis hin zu
Linnaeus (siehe unten) die bevorzugte Methode der biologischen Klassifikation. Entgegen den
Darstellungen in einem Großteil der historischen Literatur ist es jedoch nicht gerechtfertigt, diese
Klassifikationsmethode als aristotelisch zu bezeichnen.
Wie ging Aristoteles dann aber bei der Klassifikation der Formenvielfalt der Tiere tatsächlich vor? Er tat
dies auf sehr moderne Weise, indem er aufgrund genauer Prüfung Gruppen bildete: „Man soll aber
versuchen, die Tiere nach Gattungen einzuteilen, worin die gebräuchlichen Namen den Weg weisen… Jede
dieser Gattungen zerfällt weiter nach vielen Merkmalen, nicht in Zweiteilung" (643b9-14). „In der Regel
sind die Gattungen abgegrenzt nach der Form der Glieder oder des ganzen Körpers" (644b7-9). Erst nach
Aufstellen der Gruppen griff Aristoteles einige geeignete unterscheidende Merkmale heraus. Diesem dem
gesunden Menschenverstand folgenden phänetischen Ansatz stülpte er ein System der Merkmalsbewertung
über, d. h. er gewichtete die Eigenschaften, anhand derer er die Gruppen kennzeichnete und in einer Art
Reihenfolge anordnete. Diese Anordnung ist der Aspekt der aristotelischen Taxonomie, der für den
modernen Wissenschaftler am schwersten zu verstehen ist. Wie man weiß, war Aristoteles von der
Bedeutung der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft stark beeindruckt, und so waren die Attribute
heiß (im Gegensatz zu kalt) oder feucht (gegenüber trocken) für ihn von entscheidender Wichtigkeit. Heiß
stand über kalt und feucht über trocken. Das Blut, das sowohl warm als auch feucht ist, wurde somit ein
besonders wichtiges Merkmal. Aristoteles besaß demnach eine Wertskala für physiologische Funktionen,
wie sie für verschiedene Arten von Tieren charakteristisch zu sein schienen. Wärmere, feuchtere Kreaturen
waren seiner Ansicht nach vernunftbegabt, wohingegen kältere, trockenere Lebewesen weniger
lebensnotwendige Wärme besaßen und ihnen der höhere Typ von „Seele" fehlte. Überlegungen dieser Art
sagten besonders den Aristotelikern der Renaissance zu und veranlaßten sie, taxonomischen Merkmalen
aufgrund ihrer vermuteten physiologischen Bedeutung konkrete Rangordnungen zuzuteilen.
Dies muß man im Auge behalten, wenn man verstehen will, warum die Klassifikationen des Aristoteles
weder als Bestimmungssysteme, noch als rein phänetische Schemata gemeint waren. Aristoteles erkannte
bestimmte Gruppen in erster Linie zu dem Zweck an, seine physiologischen Theorien zu erläutern und die
Information über Fortpflanzung, Lebenszyklus (Perfektionsgrade der Nachkommen) und Lebensraum
(Luft, Land, Wasser) in ein System eingliedern zu können. Für ihn war es daher völlig legitim, die im
Wasser lebenden Wale von den auf dem Lande lebenden Säugetieren und die weichen, freischwimmenden
Tintenfische von den im Wasser und auf dem Land lebenden hartschaligen Mollusken zu trennen. Im
Ganzen waren die höheren Tiertaxa des Aristoteles, abgesehen von einigen nicht zueinanderpassenden
Kombinationen und nicht klassifizierten Resten, eindeutig denen des hauptsächlich an Pflanzen
interessierten Linnaeus überlegen.
In den zoologischen Schriften des Aristoteles fallen drei Dinge besonders auf! Erstens war Aristoteles'
Interesse an der organismischen Vielfalt der Welt ungeheuer groß. Zweitens gibt es keinerlei Hinweis
darauf, daß er ein besonderes Interesse daran gehabt hätte, die Tierwelt zu klassifizieren; nirgends ordnete
er die von ihm erkannten neun höheren Taxa in tabellarischer Form an. Und schließlich, um es noch einmal
zu sagen: welche Klassifikation auch immer er gehabt haben mag, sie war nicht das Ergebnis logischer
Zweiteilung. Es ist bemerkenswert, wie wenig von Aristoteles' Prinzipien der Logik in der Historia
animalium zum Ausdruck kommt. Man hat bei diesem Werk weit eher den Eindruck eines empirischen,
nahezu pragmatischen Ansatzes als den deduktiver Logik.
Aristoteles wollte lediglich auf wirksame Weise mitteilen, was er über Tiere wußte, damit „man sich
zunächst mit den Merkmalen und den allgemeinen Eigenschaften befreundet" (491a8). Der rascheste Weg
zu seinem Ziel war der Vergleich. In der Tat stützt sich das ganze Buch auf Vergleiche: Vergleiche der
Strukturen (vergleichende Anatomie), der Fortpflanzungsbiologie und des Verhaltens (Tierpsychologie).
Zur Erleichterung dieses Verfahrens unterteilte er die von ihm genannten 580 Tiersorten in
Kollektivgruppen wie Vögel und Fische, wobei er oft Tiergruppen benutzte, die ebenso alt sind wie die
griechische Sprache.
Seine Einteilung aller Tiere in solche „mit Blut" und „ohne Blut" blieb erhalten, bis Lamarck diesen
Gruppen die neuen Namen „Wirbeltiere" und „Wirbellose" gab). Bei den Bluttieren erkannte Aristoteles
Vögel und Fische als getrennte Gattungen, doch bereiteten ihm die verbleibenden Tiere Schwierigkeiten.
Indem er Lebendgebären gegenüber Legen und Ausbrüten von Eiern als wichtiges Schlüsselmerkmal
annahm, unterschied er zwischen den Tieren mit Haarkleid (die wir heute als Säugetiere bezeichnen) und
den kaltblütigen, eierlegenden Tieren (Reptilien und Amphibien). Deutlich trennte er die Wale sowohl von
den Fischen als auch von den Landsäugetieren. Die verschiedenen Sorten fliegender Tiere trennte er recht
weit voneinander: Vögel als Tiere mit gefiederten Flügeln, Fledermäuse mit lederartigen Flügeln, und
Insekten mit membranartigen Flügeln. Doch bei den Wirbellosen umfassen seine Schaltiere solch
heterogene Elemente wie Rankenfußkrebse, Seeigel, Schnecken und Muscheln.
Aristoteles vermittelte eine Fülle von Beobachtungen über strukturelle Unterschiede zwischen
verschiedenen Tiergruppen, wobei er besonders Unterschiede in den Verdauungs- und
Fortpflanzungssystemen hervorhob. Doch scheint er mindestens ebenso stark an der Ökologie der Tiere
(ihrem Habitat und ihrer Lebensweise), ihrer Fortpflanzungsbiologie und ihrem Temperament interessiert
gewesen zu sein: „Die Unterschiede der Tiere liegen ebenso in ihrer Lebensweise und ihren Betätigungen
und Gewohnheiten, wie in ihren Körperteilen" (487all-12), insbesondere im Zusammenhang mit den
Grundelementen Wasser, Luft und Erde. Es besteht heute kein Zweifel daran, daß es Aristoteles nicht
darum ging, eine Klassifikation der Tiere zu erstellen, die zu deren Identifikation benutzt werden könnte.
Welche Bedeutung hatte Aristoteles dann aber in der Geschichte der Systematik? Vielleicht sein
wichtigster Beitrag lag darin, daß er, ein hervorragender Philosoph, derart starken Anteil an Tieren und
ihren Eigenschaften nahm. Dies erleichterte in hohem Maße das Wiederaufleben der Zoologie im späten
Mittelalter und in der Renaissance. Ob in bezug auf Struktur, Ernährungsgewohnheiten, Verhalten oder
Fortpflanzung, überall stellte Aristoteles signifikante Fragen, die das Studium der Tiere zu einer
Wissenschaft machten. Darüber hinaus legte er das Fundament für die spätere Unterteilung der Biologie in
Morphologie, Systematik, Physiologie, Embryologie und Ethologie, und gab in seinen Schriften
Anweisungen, wie ein Forscher vorzugehen habe. Seine Unterscheidung von individuellen Arten (Spezies)
und Kollektivgruppen (Genera) war der Ausgangspunkt für die scharfsinnigeren und komplizierteren
Klassifikationen späterer Zeiten.
Heutzutage gilt Aristoteles nicht mehr lediglich als einer der Väter der Scholastik, sondern auch als
philosophierender Biologe; viele Aspekte seines Werks erscheinen daher in gänzlich neuem Licht. Eine
moderne Analyse von Aristoteles' taxonomischer Begriffsstruktur steht jedoch immer noch aus [3].
Stark verallgemeinernd kann man wahrscheinlich sagen, daß das Niveau der Naturgeschichte nach
Aristoteles' Tod stetig sank. Plinius und Aelian waren eifrige Kompilatoren, die recht unkritisch gute
Naturgeschichte und mythologische Fabelwesen nebeneinanderstellten [4]. In der Folgezeit schrieb man
über Tiere nicht mehr, weil man mitteilen wollte, was man über sie wußte, sondern um zu moralisieren; sie
wurden zu Symbolen. Wollte man über den Fleiß moralisieren, so berichtete man von der Ameise; ging es
um Mut, so nannte man den Löwen. Mit der Ausbreitung des Christentums fanden Tiergeschichten häufig
Eingang in religiöse Traktate. Tiere wurden zu Symbolen für bestimmte Ideen im christlichen Dogma, und
in Gemälden und Kunstwerken entsprechend dargestellt. Man könnte beinahe sagen, daß das Studium der
Tiere zu einem rein geistigen oder ästhetischen Geschäft wurde, das mit Naturgeschichte nahezu nichts
mehr zu tun hatte. In großen Zügen traf dies zumindest für die mehr als tausendjährige Zeitspanne von
Plinius (gest. 79 v.Chr.) bis zum 15.Jahrhundert zu (Stannard, 1979). Das Werk Friedrichs des Zweiten, De
arte venandi cum avibus (1250), und die Schriften von Albertus Magnus (etwa 1200-1280) waren für ihre
Zeit Ausnahmen.
In den darauffolgenden Jahrhunderten trat mit neuen Entwicklungen ein rascher Wandel ein. Eine dieser
Entwicklungen war die Wiederentdeckung der biologischen Schriften des Aristoteles, die nunmehr in
neuen Übersetzungen zugänglich gemacht wurden. Eine andere die allgemeine Verbesserung des
Lebensstandards, die auch eine stärkere Betonung der ärztlichen Kurist und damit ein größeres Interesse an
Heilkräutern zur Folge hatte. Schließlich bildete sich gegen Ende des Mittelalters eine Art ZurückzurNatur-Bewegung heraus, ein Wegstreben von der ausschließlichen Betonung des geistigen Lebens. Seit
Hildegard von Bingen (1098-1179) und Albertus Magnus widmeten sich offenkundig mehr und mehr
Menschen der Betrachtung lebender Pflanzen und Tiere in der freien Natur – mehr noch, sie schrieben über
sie und – was am wichtigsten war – als schließlich die Buchdruckerkunst aufkam, druckten sie Bücher über
sie. Doch es war ein langsamer und allmählicher Prozeß. Die enzyklopädische Tradition des Plinius, jenes
großen und unkritischen Kompilators, bestand bis zur Zeit von Gesner und Aldrovandi fort. Inzwischen
jedoch, d.h. während des 16. Jahrhunderts, waren es die Ärzte, die Naturbücher verfaßten.
Die Klassifikation der Pflanzen in der Antike und zur Zeit der Verfasser der Kräuterbücher
Aristoteles schrieb auch über Pflanzen, aber seine Schriften sind verloren gegangen. Daher beginnt die
Geschichte der Botanik mit den Werken seines Schülers Theophrastos (371-287 v.Chr.). So wichtig der
Beitrag des Theophrastos zur Pflanzenmorphologie und Pflanzenbiologie auch ist, er besaß kein formales
Klassifikationssystem. Das Hauptkriterium der Unterteilung war für ihn die Wachstumsform (Bäume,
Sträucher, kleine Sträucher und Kräuter), aber er benutzte auch andere Kriterien wie Vorhandensein von
Dornen oder nicht, Anbau durch den Menschen, und so weiter. Offenbar übernahm er viele seiner
Gruppierungen aus dem Volkstum, mit dem Ergebnis, daß einige von ihnen völlig natürlich sind (Eichen,
Weiden), wohingegen andere taxonomisch gesehen recht künstlich erscheinen, wie „Daphne", ein
Konglomerat von Pflanzen mit immergrünen Blättern.
Für die unmittelbare Geschichte der Botanik weitaus wichtiger war Dioskurides (etwa 60 n.Chr.). Als
griechischer Arzt im Dienste des römischen Heeres war er weit gereist und hatte sich ein enormes Wissen
über für den Menschen nützliche Pflanzen angeeignet. Seine Materia medica enthält die Beschreibung von
zwischen 500 und 600 Pflanzen, die entweder in der Medizin Verwendung finden oder Gewürze, Öle,
Harze oder Früchte liefern. Die Anordnung der Pflanzen in seinen fünf Büchern richtet sich hauptsächlich
nach ihrer praktischen Anwendung (Arzneiwurzeln, Gewürzkräuter, Parfüms, etc.). Trotzdem stehen in
seinen Listen häufig verwandte Pflanzen beieinander; beispielsweise nennt er die meisten der von ihm
erkannten 22 Arten von Labiatae oder 36 Arten von Umbelliferae nacheinander. In der Tat kritisierte er die
von einigen früheren Autoren angewandte alphabetische Ordnung mit der Begründung, dadurch würden
verwandte Pflanzen, die ähnliche Eigenschaften besitzen, voneinander getrennt. Die große Bedeutung von
Dioskurides liegt darin, daß sein Werk Materia medica während anderthalb Jahrtausenden der führende
botanische Text überhaupt war (Mägdefrau, 1973, S. 19-21). Dioskurides galt als die oberste Autorität in
allen Dingen, die mit Pflanzen zu tun hatten, insbesondere mit ihren medizinischen Eigenschaften. Doch
wurde auch diese Tradition, wie schon im Fall von Galens Anatomie, zunehmend zu reinem Buchwissen,
d. h. sie entfernte sich immer mehr von der Natur und den tatsächlichen Organismen.
Vom 13. Jahrhundert an erschien jedoch eine Reihe von Kräuterbüchern, in denen eine Rückkehr zur
eigentlichen Naturbeobachtung spürbar ist, und dieser Trend beschleunigte sich noch erheblich, nachdem
die Buchdruckerkunst erfunden worden war. Eine lateinische Übersetzung von Dioskurides erschien 1478,
eine von Theophrastos 1483, und viele handgeschriebene Kräuterbücher aus früheren Jahrhunderten
wurden zu jener Zeit zum ersten Mal gedruckt [5]. Das Wachsende Interesse an der Identifikation von
Pflanzen, die Entdeckung reicher Lokalfloren – Arten, die Dioskurides unbekannt gewesen waren – wie
auch die Suche nach neuen medizinischen Eigenschaften bei neu entdeckten Pflanzen führte zur Gründung
von Lehrstühlen der Botanik an den europäischen medizinischen Fakultäten, deren erster 1533 in Padua
eingerichtet wurde.
Mit der Arbeit der „Deutschen Väter der Pflanzenkunde", Brunfels (1488-1534), Bock (1489-1554) und
Fuchs (1501-1566), setzte eine neue Ära ein. Diese Naturforscher kennzeichnen eine Rückkehr zur Natur
und zur eigenen Beobachtung. Ihre Berichte sind keineswegs eine Reihe von Kompilationen und endlosen
Rekapitulationen von Legenden und Allegorien, sondern beschreiben wirkliche, lebende Pflanzen, wie sie
in der Natur beobachtet wurden. Sie stellen auch einen Versuch dar, lokale Floren zu beschreiben und im
Bild festzuhalten; zu diesem Zweck beschäftigten diese Botaniker ausgezeichnete Zeichner und
Holzschnitzer, so daß die Illustrationen einen Grad an Exaktheit und künstlerischer Qualität erreichten, der
generationenlang unübertroffen war. Sie spielten in der Botanik die gleiche Rolle, wie die Illustrationen des
Vesalius in der Anatomie. Bei Brünfels' Werk Herbarum Vivae Eicones (1530) wird im Titel darauf
aufmerksam gemacht, daß die Pflanzen (von Hans Weiditz) nach der Natur gezeichnet seien. In allen drei
Kräuterbüchern werden viele mitteleuropäische Arten beschrieben und im Bild dargestellt, die den
Botanikern der Antike unbekannt gewesen waren. Brunfels illustrierte 260 Pflanzen und Fuchs in seiner
Historia Stirpium (1542) nicht weniger als 500 Pflanzen.
Der originellste der Drei war Hieronymus Bock. Allen seinen Beschreibungen, die in präzisem und
anschaulichem umgangssprachlichen Deutsch geschrieben waren, lagen ohne jeden Zweifel eigene
Beobachtungen zugrunde. Außerdem lehnte er die alphabetische Anordnung in anderen Kräuterbüchern
ausdrücklich ab und gab als seine Methode an, „alle verwandten und miteinander verbundenen oder sich in
anderer Weise ähnelnden Pflanzen seien zusammenzustellen, aber dennoch getrennt zu betrachten". Er
lieferte nicht nur ausgezeichnete Beschreibungen, sondern vermerkte darüber hinaus auch die Fundorte und
Standorte (einschließlich Bodenbeschaffenheit) der Pflanzen, die er beschrieb, sowie ihre Blütezeit und
andere Aspekte ihrer Lebensgeschichte. Auf diese Weise war Bocks Werk der Prototyp aller zukünftigen
Werke über Lokalfloren. Zusammen mit anderen gedruckten Kräuterbüchern aus Frankreich und England
gehörte es zu den beliebtesten Büchern der Epoche [6].
Die Klassifikation bei den Verfassern der Kräuterbücher
Vielleicht der auffallendste Aspekt der „Klassifikationen" der Verfasser der Kräuterbücher ist: es mangelt
ihnen an jeglichem widerspruchsfreien System; ihre Autoren waren überhaupt nicht an Klassifikation
interessiert, sondern an den Eigenschaften einzelner Arten. Bei Brunfels (1530) scheint die Reihenfolge,
zumindest der Gattungen, recht willkürlich zu sein. Nahe verwandte Arten, beispielsweise Plantago major,
P. minor und P. rubea, werden jedoch nacheinander genannt. Fuchs (1542) ordnet seine Pflanzen
weitgehend alphabetisch an, die ersten vier Kapitel befassen sich dementsprechend mit Absinthium,
Abrotonum, Asarum und Acorum. Diese Reihenfolge wird in der deutschsprachigen Ausgabe (1543)
beibehalten, obwohl die deutschen Bezeichnungen für diese vier Gattungen, Wermut, Taubwurtz,
Haselwurtz und Drachenwurtz, nunmehr in umgekehrter alphabetischer Ordnung stehen. Amüsant ist, daß
Fuchs anmerkt, er habe aus der stark verkürzten deutschen Ausgabe diejenigen Pflanzen ausgelassen, die
der „gemeine Mann" nicht zu kennen brauche.
Drei klassifikatorische Aspekte der Kräuterbücher verdienen besondere Erwähnung. Erstens wird in
ihnen auf etwas vage Weise zwischen Arten (species) und Gruppen (genera) unterschieden. Zweitens
handelt es sich bei vielen Gruppen (wie Gräsern) um völlig natürliche Gruppen, die aber häufig durch
Einbeziehung von Formen mit oberflächlichen Ähnlichkeiten vergrößert werden. Etwa würden unter den
Nesseln sowohl die echten Nesseln (Urtica) als auch die Lippenblüter mit ähnlichen Blättern, d. h. die
falschen Nesseln, eingereiht werden. Neben dem Weizen (einem Gras) findet man den Buchweizen (eine
zweikeimblättrige Pflanze), und zwar einzig und allein, weil sein volkstümlicher Name das Wort „Weizen"
enthält. Ein solches Nebeneinanderstellen war für die Identifikation von erheblichem Wert, aber natürlich
keine Grundlage für eine solide Klassifikation. Drittens schließlich werden in den Kräuterbüchern nur
schwache Anstrengungen gemacht, höhere Taxa aufzustellen. Gerard etwa widmet das erste Kapitel seines
Werkes Herball (1597), das auf Dodoens und Lobel aufbaut, den „Gräsern, Binsen, Getreide, Pflanzen mit
langen, schwertförmigen Blättern und Knollen- oder Zwiebelgewächsen", d.h. vorwiegend
einkeimblättrigen Pflanzen. Sein zweites Kapitel jedoch enthält „alle Sorten von Kräutern, die als
Nahrungsmittel, Medizin oder Duftstoff dienen", botanisch also ein völliges Mischmasch.
Ihren Höhepunkt erreichte die Tradition der Kräuterbücher mit der Veröffentlichung von Caspar
Bauhins Pinax (1623). Hier wird der beträchtliche Fortschritt in den neunzig Jahren seit der
Veröffentlichung Von Brunfels' Eicones deutlich. In zwölf Bänden, die in 72 Abteilungen unterteilt sind,
beschreibt Bauhin etwa 6000 Pflanzensorten. Alle diese Sorten werden einer Gattung und einer Art
zugeordnet, allerdings werden keine generischen Diagnosen vorgenommen. Verwandte Pflanzen werden
häufig aufgrund ihrer allgemeinen Ähnlichkeit oder gemeinsamer Eigenschaften zusammengruppiert. Die
auf diese Weise gebildeten Gruppen erhalten keine Taxon-Bezeichnung, und es wird keine Diagnose
höherer Taxa gegeben. Nichtsdestoweniger erkennt der Verfasser, wenn er dies auch nicht explizite
ausspricht, die Monocotyledonen und stellt die Arten und Gattungen von etwa neun oder zehn Familien
und Unterfamilien der Dicotyledonen zusammen. Zwar erklärt Bauhin seine Methode nirgendwo, doch
besteht kein Zweifel daran, daß er eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale gleichzeitig berücksichtigte
und Gattungen mit einer Reihe gemeinsamer Merkmale jeweils zu einer Gruppe zusammenfaßte. Wenn
man bedenkt, daß der Hauptzweck von Bauhins Pinax in der Erstellung eines geeigneten Katalogs von
Pflanzennamen bestand, so ist seine Fähigkeit, verwandte Gattungen zu finden und in Gruppen
zusammenzufassen, höchst erstaunlich.
Die Anfänge fast aller späteren Entwicklungen der systematischen Botanik lassen sich bereits in den
Schriften der Kräuterkundler finden: der Versuch, Pflanzen auf der Grundlage von Ähnlichkeiten oder
gemeinsamen Merkmalen zu gruppieren; die Anfänge einer binominalen Nomenklatur und sogar
dichotomer Bestimmungsschlüssel; die Suche nach neuen Merkmalen und das Bemühen um exaktere und
sorgfältigere Beschreibungen Vielleicht der wertvollste Beitrag der Kräuterbuchautoren war ihre
empirische Einstellung. Sie gaben sich nicht mehr damit zufrieden, lediglich die Schriften von Dioskurides
und Theophrastos zu kopieren, vielmehr untersuchten sie die Pflanzen wirklich in der Natur und
beschrieben, „wie eyn yedes seiner Art und Geschlecht nach auffwachs/wie es blüe/und besame/zu welcher
zeit im jar/und in welcherley erdtrich eyn yedes am besten zu finden seie" (Bock, 1539). Doch jeder von
ihnen hatte seine eigene Methode, und welcher Methoden auch immer sie sich bedienten, sie waren alle
äußerst unbeständig darin.
Da zu jener Zeit relativ wenige Pflanzen bekannt waren, konnte man eine Art einfach dadurch finden,
daß man so lange in einem Kräuterbuch blätterte, bis man eine halbwegs ähnliche Pflanze fand, und nur
dann las man die Beschreibung sorgfältig durch und sah sich die Abbildung genau an, um die Pflanze
sicher zu identifizieren. Als jedoch die Zahl der bekannten Pflanzen während des 16. und 17. Jahrhunderts
fast exponentiell anwuchs, reichte diese einfache Methode bald nicht mehr aus. Fuchs (1542) kannte etwa
500 Arten und Bauhin (1623) 6000, John Ray dagegen zählte im Jahre 1682 bereits 18000 Arten auf.
Eine alphabetische oder andere willkürliche Anordnung war nicht mehr genug. Um dieser Lawine neuer
Pflanzen„sorten" gewachsen zu sein, wurde eine weit sorgfältigere Unterscheidung der Arten innerhalb der
umfangreicheren „Sorten" (Gattungen) erforderlich und man bemühte sich ernsthafter um das Erkennen
von Gruppierungen verwandter Gattungen, d. h. höherer Taxa. Man brauchte außerdem ein System oder
Verfahren, mit dem man ein bestimmtes Exemplar relativ schnell identifizieren konnte.
Abwärtsklassifikation mittels logischer Zweiteilung
Die Theorie der Klassifikation scheint täuschend einfach zu sein: Man ordnet die zu klassifizierenden
Objekte aufgrund ihrer Ähnlichkeit ein. Hat man es mit Organismen zu tun, so erhebt sich unmittelbar die
Frage: Wie bestimmt man, ja noch besser, wie mißt man Ähnlichkeit? Die Antwort lautet: durch eine
sorgfältige Analyse von Merkmalen. Auswahl und Bewertung von Merkmalen haben daher bei den
Diskussionen in der letzten Zeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden. Wenn wir jedoch mit einer
Betrachtung von Merkmalen beginnen, werden wir niemals den Unterschied zwischen den früheren
Klassifikationstheorien, die von Cesalpino bis Linnaeus vorherrschten, und denen, die seit Darwin
überwogen haben, verstehen können. Wir müssen also zuerst die Frage stellen, welche Arten von
Klassifikationen überhaupt möglich sind.
Tatsächlich errichtete man in der Renaissance Klassifikationen nicht dadurch, daß man Objekte nach
ihrer Ähnlichkeit einordnete. Das vordringlichste Bedürfnis war das der Identifikation von Pflanzen und
Tieren, und die erste umfassende Methodenlehre der Pflanzentaxonomie wurde entwickelt, um dieser
Forderung zu genügen. Allgemein, und zu Recht, wird dem italienischen Anatom und Physiologen Andrea
Cesalpino (1519-1602) das Verdienst zugeschrieben, dies in seinem großen Werk De Plantis (1583) als
erster konsequent durchgeführt zu haben. Er betrachtete sich selbst als Anhänger von Theophrastos und
teilte wie dieser die Pflanzen in Bäume, Sträucher, kleine Sträucher (perennierend) und Kräuter ein. Um
aber ein einfaches Bestimmungsschema zu entwickeln, griff er zu der Logik des Aristoteles und entlieh
sich von ihr die Methode der dichotomen Unterteilung, mit der vom Mittelalter bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts jeder vertraut war, der eine Schulbildung genossen hatte (s. Erörterung von Aristoteles, oben).
Die Prinzipien der Abwärtsklassifikation durch logische Teilung sind im Grunde genommen sehr
einfach. Doch wurden sie in den Schriften der Klassifikatoren von Cesalpino bis Linnaeus in ein derart
kompliziertes Gewebe scholastischer Lehren und Ausdrucksweise eingebettet (wie die Ausdrücke
„Essenz", „Universalien", „Akzidenz", „differentiae", „Merkmale" und so weiter erkennen lassen), daß ein
besonderes Fachstudium zu ihrem Verständnis nötig ist [7].
Die Methode der logischen Dichotomie stammt nicht von Aristoteles. Bereits Platon war daran
interessiert, allgemeine Gruppen von untergeordneten Objekten zu unterscheiden (Messon, 72;
Parmenides, 1290; Politicus 261 B), seine volle Bedeutung erreichte das Verfahren jedoch erst unter den
Schülern des Aristoteles, siehe den Baum des Porphyrios, der auch unter dem Namen Baum des Rameus
bekannt ist (Jevons, 1877, S. 702). Charakteristisch für diesen Ansatz ist die Unterteilung einer „Gattung"
in zwei „Arten" („tertium non datur"). Man bezeichnet dies auch als dichotome Teilung. Dieses Verfahren
ist ideal für die Konstruktion von Bestimmungsschlüsseln geeignet, führt aber häufig zu äußerst
künstlichen und unausgewogenen Klassifikationen. Aristoteles selbst machte sich, wie oben gezeigt, über
die Idee lustig, eine Klassifikation auf die Dichoto mie gründen zu wollen; da er aber bei seinen logischen
Übungen Beispiele aus der Zoologie heranzog, brachte er seine Nachfolger in Verwirrung.
Es gab mehrere Gründe dafür, weshalb sich die Abwärtsklassifikation in dem langen Zeitraum zwischen
Cesalpino und dem 19. Jahrhundert so großer Beliebtheit erfreute. Ihr wichtigster praktischer Vorteil lag
darin, daß sie mit einer Reihe leicht erkennbarer Klassen begann – etwa Bäumen, Sträuchern, Kräutern,
oder im Tierreich mit Vögeln, Schmetterlingen oder Käfern – und diese mittels geeigneter
differenzierender Merkmale („differentiae") wieder in untergeordnete Gruppen von Unterklassen aufteilte.
Man benötigte vorab keine Kenntnisse der Spezies, mußte lediglich in der Lage sein, das Verfahren der
logischen Unterteilung anzuwenden. Jeder Laie konnte das. Dennoch wäre die Annahme falsch, der einzige
Grund für die Popularität der logischen Teilung sei ihre leichte praktische Anwendbarkeit gewesen. Ihre
Beliebtheit war in den Jahrhunderten am größten, in denen jederman in der geschaffenen Welt Ordnung
und Logik zu erkennen suchte. Das heißt: wenn die Welt ein geordnetes System ist, welche Methode kann
da zu ihrem Studium und ihrer Analyse besser sein als eine, die sich der Werkzeuge und Verfahren der
Logik bediente? Eine Klassifikation konnte die Ordnung der Natur nur dann angemessen widerspiegeln,
wenn sie auf den wahren „Essenzen" der Organismen beruhte. Und die logische Zweiteilung war die
geeignete Methode, um zur Entdeckung und Definition dieser Essenzen beizutragen. Sie war somit ein
vollkommenes Abbild der vorherrschenden essentialistischen Philosophie der Zeit.
Bei dieser Methode logischer Aufteilung ist nichts wichtiger als die Wahl der differenzierenden
Merkmale. Die Abhängigkeit von Einzelmerkmalen erfordert eine sorgfältige Bewertung dieser Charaktere
[8]. Cesalpino war sich dessen vollauf bewußt und widmete sich mit viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit
dem Studium der Pflanzenmorphologie. Er entdeckte zahlreiche nützliche Merkmale und war einer der
ersten (nach Gesner), der den taxonomischen Wert des Fruchtstandes erkannte.
Dennoch war Cesalpino mit seiner Theorie von der Gewichtung von Merkmalen ganz und gar auf der
falschen Spur. Als echter Aristoteliker wählte er die Merkmale nach ihrer physiologischen Bedeutung aus.
Die beiden Arten von Attributen, die seiner Ansicht nach für eine Pflanze am wichtigsten waren, hatten mit
Ernährung und Fortpflanzung zu tun. Der wichtigste Aspekt für ihn war die Ernährung (Wachstum), daher
seine Aufteilung in Bäume, Kräuter usw. Die Bedeutung der Fortpflanzung zeigte sich in der Betonung von
Fruchtstand, Samen und Sämlingen (in Analogie zu Aristoteles' Betonung des Tierembryos). Bei diesem
Verfahren war der Vergleich ein wichtiges Element; allerdings verstieg sich Cesalpino zu absurden
Extremen, als er eine Entsprechung zwischen den funktional wichtigsten Strukturen bei Tieren und
Pflanzen herzustellen suchte. So setzte er die Wurzeln der Pflanzen gleich dem Magen und
Verdauungstrakt der Tiere, und er zählte Stamm und Stiel von Pflanzen zu ihrem Fortpflanzungssystem, da
sie die Samen und Früchte tragen.
Bedenkt man, mit welcher Häufigkeit Konvergenz, Parallelismus, Merkmalsverlust und andere
Unregelmäßigkeiten in der Merkmalsentwicklung vorkommen, so würde man erwarten, daß die Methode
der logischen Zweiteilung nach einzelnen Merkmalen ein absolutes Chaos zur Folge hätte haben müssen.
Prüft man jedoch Cesalpinos Pflanzenklassifikation genau, so zeigt sich, daß die 32 von ihm erkannten
Pflanzengruppen im großen und ganzen bemerkenswert "natürlich" sind [9]. Offensichtlich konnte
Cesalpino nicht nur durch Anwendung des logischen Systems zu seinen Gruppierungen gelangt sein.
Stafleu (1969, S.23) bemerkt sehr richtig, daß Cesalpino „mit bestimmten natürlichen Gruppen anfing, die
ihm intuitiv oder durch Überlieferung bekannt waren, und den irrelevanten und in jedem Fall unwichtigen
„Überbau" der logischen Zweiteilung später hinzufügte". Cesalpino ging also nach einem Zwei-SchritteVerfahren vor. Er sortierte seine Pflanzen zunächst aufgrund genauer Prüfung in mehr oder weniger
natürliche Gruppen und suchte dann nach geeigneten Schlüsselmerkmalen, die ihm eine Anordnung dieser
Gruppen nach den Prinzipien der logischen Zweiteilung erlauben würden. Nur auf diese Weise konnte er
gleichzeitig zwei Ziele erreichen, nämlich einmal einen geeigneten Bestimmungsschlüssel und zum andern
eine Anordnung seiner Pflanzen in Gruppen nach ihrer „Ähnlichkeit4' (Verwandtschaft). Nicht immer
gelang es ihm völlig, einen Kompromiß zwischen den gegensätzlichen Erfordernissen der beiden
Methoden zu finden; zum Beispiel mußte er den Prinzipien der logischen Teilung folgend, die
kräuterartigen und baumartigen Leguminosen (Schmetterlingsblütler) zwei verschiedenen Familien
zuzuteilen.
Ungeachtet der offenkundigen Unzulänglichkeiten seines Systems übte Cesalpino während der
folgenden zweihundert Jahre starken Einfluß auf die Botanik aus. Bis zu Linnaeus waren alle Systeme der
Pflanzenklassifikation Modifikationen und Verbesserungen des Ansatzes, dessen sich Cesalpino als erster
bedient hatte – und das gilt auch noch für Linnaeus selbst. Bei allen beruhte die Klassifikation auf der
Methode der logischen Zweiteilung und einem gewissen Maß an vorheriger Merkmalsgewichtung. Der
Grund für diesen starken Einfluß Cesalpinos lag nicht darin, daß seine Klassifikation besonders brauchbar
gewesen wäre; er war ganz einfach der erste Autor, der eine mehr oder weniger konsequente
Klassifikationsmethode erarbeitet hatte. Sie mußte solange genügen, bis jemand eine bessere vorschlug.
Je nachdem, welche Merkmale man bei den ersten Schritten der Unterteilung auswählt, erhält man
zwangsläufig gänzlich verschiedene Klassifikationen. Das ist der Grund, weshalb sich die Systeme der
großen Botaniker des 17. und 18. Jahrhunderts, die in Cesalpinos Fußstapfen traten, derart drastisch
voneinander unterschieden. Nur der Fachwissenschaftler interessiert sich für die Einzelheiten, in denen die
Klassifikationen von Magnol, Tournefort, Rivinus, Bauhin, Ray und den weniger prominenten Verfassern
voneinander abweichen. Alle diese Botaniker differierten in ihrer Pflanzenkenntnis, und dies wiederum
beeinflußte ihre Wahl des Merkmals für die erste Zweiteilung. Ebenso erhielt man bei der Einordnung von
Tieren völlig verschiedene Resultate je nachdem, ob man als erstes unterscheidendes Merkmal (differentia)
„mit Blut" öder „ohne Blut", „behaart" oder „unbehaart", „zweifüßig" oder „vierfüßig" wählte.
Eine weitere Konsequenz dieses Verfahrens der Abwärtsklassifikation ist, daß es nicht allmählich und
stückweise verbessert werden kann. Ersetzt man ein Merkmal durch ein anderes, so erhält man eine völlig
neue Klassifikation. Im Rahmen dieses Systems ist die mögliche Zahl verschiedener Klassifikationen
wahrhaft unbegrenzt. Dennoch gelang es diesen Botanikern irgendwie, Auswahl und Reihenfolge ihrer
Merkmale so anzupassen, daß bestimmte wohlbekannte natürliche Pflanzengruppen nicht
auseinandergerissen wurden. Wie deutlich die „Natürlichkeit" bestimmter Gruppen erkannt wurde, geht aus
der Tatsache hervor, daß, wie Larson (1971, S.41) feststellt: „Viele Pflanzenfamilien – Coniferae,
Cruciferae, Graminaceae und Umbelliferae z.B. – im 16.Jahrhundert aufgestellt wurden und während all
der Wechselfälle des Kampfes um Systeme intakt blieben." Mehr und mehr solcher Gruppierungen wurden
erkannt, insbesondere als sich herausstellte, daß bestimmte, scheinbar isolierte europäische Gattungen
großen tropischen Familien angehörten.
Die Botaniker des 17. Jahrhunderts differierten jedoch nicht nur darin, welches Gewicht sie
verschiedenen Merkmalen beimaßen, sondern auch darin, ob ihr Hauptinteresse der Gattung oder der Art
galt, sowie auch, wie unantastbar das Prinzip der logischen Zweiteilung und das angeblich aristotelische
System der Merkmalsbewertung für sie war. Genau in diesen zwei Punkten wichen die beiden größten
Botaniker des späten 17. Jahrhunderts am stärksten voneinander ab.
Ray und Tournefort
John Ray (1627-1705) war natürlich weit mehr als ein Botaniker [10]. Er war Mitverfasser der wichtigsten
zoologischen Abhandlungen der Epoche und schrieb eins der großen Werke der Naturtheologie. Zugleich
war er aber auch ein praktischer Engländer dessen Hauptziel darin bestand, ein Pflanzenbuch zu verfassen,
das die unzweideutig“
Identifikation von Pflanzen gestatten würde. Sein besonderes Interesse galt daher dem Wesen der Arten.
In seiner Historia Plantarum behandelt er nicht weniger als 18655 Pflanzen„arten" und gibt eine Definition
der Kategorie Art (siehe Glossarium) die in den darauffolgenden einhundertundfünfzig Jahren allgemein
übernommen wurde. Fast als einziger unter den frühen Botanikern hatte er keine medizinische Ausbildung
und war daher weniger als seine Zeitgenossen von scholastischer Tradition beeinflußt, weniger sogar als
Tournefort, der in einem Jesuitenseminar erzogen worden war Daher überrascht es nicht, daß John Ray von
seinen ersten botanischen Veröffentlichungen an bei der Anwendung der Zweiteilung weit weniger
konsequent war als Cesalpino oder Tournefort. Nicht nur, daß er in verschiedenen Klassen verschiedene
Komplexe untergeordneter Merkmale benutzte, er zögerte nicht einmal, von dem Fruchtstand zu
vegetativen Merkmalen überzugehen (Vorhandensein eines Stammes oder von Knollen wurzeln), wenn
dies angebracht schien. Tournefort und Rivinus griffen ihn wegen diese Abweichungen heftig an, Ray aber
beantwortete die Kritik mit dem pragmatischen Rat: „Eine akzeptable Klassifikation ist eine solche…, bei
der Pflanzen zusammengesellt werden, die ähnlich sind und in wichtigen Teilen oder in ihrem gesamten
äußeren Erscheinungsbild übereinstimmen, und bei der solche voneinander getrennt werden, die sich in
diesen Aspekten unterscheiden" (Synopsis, 1690, S. 33). Er wiederholt dieses Leitprinzip in seinen
sämtlichen folgenden Veröffentlichungen. Etwa: „Die erste Voraussetzung einer natürlichen Methode muß
sein, daß sie weder Pflanzengruppen aufspaltet zwischen denen augenscheinliche natürliche Ähnlichkeiten
bestehen, noch solche mit natürlichen Unterscheidungen zusammenwirft" (Sylloge, 1694, S. 17). Cesalpino
und andere Verfechter der logischen Teilung hatten natürlich behauptet, daß ihre Methode gerade dies
leiste. So ist Ray gezwungen, weiter zu gehen. In seiner Schrift De Variis (1696) weist er darauf hin, daß es
tatsächlich keine objektive Methode gibt, zu bestimmen, welche Merkmale Ausdruck der Essenz sind und
welche nebensächlich. Mit anderen Worten, er lehnt implizite die Methode einer a priori-Bewertung ab.
(Es ist wichtig, daß er nicht das Konzept einer Essenz oder den Unterschied zwischen essentiellen und
akzidentiellen Merkmalen verwirft.) Davon ausgehend kommt er zu dem Schluß, daß nicht nur Blüte und
Frucht, sondern auch andere Teile der Pflanze sehr wohl Ausdruck der Essenz sein können. Er geht sogar
so weit zu behaupten, Arten könnten sich durch Gruppen akzidentieller Merkmale voneinander
unterscheiden (Ornithology, 1678).
Sloan (1972) hat die These vertreten, Ray sei durch sein Studium von Lockes Schriften zu diesen
ketzerischen Ansichten gelangt. Vieles läßt jedoch darauf schließen, daß Ray durch rein pragmatisches
Herangehen zu der unorthodoxen Beurteilung von Merkmalen gekommen ist und dann „philosophische
Studien" betrieben hat, um Munition für seine Replik an Tournefort zu sammeln (29. April 1696, Brief an
Robinson). Da es sehr zweifelhaft ist, ob ein einzelnes Merkmal die Essenz einer Gattung wiedergeben
kann, empfiehlt Ray in seiner Schrift Methodus Plantarum (1703, S.6-7): „Die beste Anordnung von
Pflanzen ist die, bei der alle Gattungen, von der höchsten bis hinunter zu den untergeordneten und
niedrigsten, mehrere gemeinsame Eigenschaften besitzen oder in mehreren Teilen oder Akzidenzien
übereinstimmen." Er geht so weit, bei seiner Gruppierung sogar ökologische Kriterien anzuwenden, eine
Gruppe von Merkmalen also, die seit Cesalpino streng verpönt war. Tatsächlich hatte schon Magnol
(Prodromus, 1689) die Verwendung von Merkmalskombinationen empfohlen.
Rays Beitrag zur eigentlichen Pflanzenclassifikation war recht unwesentlich. Wie Albertus Magnus,
Pena, Lobel und Bauhin unterschied er zwischen Monocotyledonen und Dicotyledonen, ohne den
grundlegenden Charakter der Unterschiede zu erkennen. Er behält immer noch die Einteilung des
Theophrastos in Bäume, Sträucher, Kräuter usw. bei, und seine Klassifikationen der Nelken- und
Nachtschattengewächse zum Beispiel sind denen Bauhins und anderer Vorläufer beträchtlich unterlegen.
Die Geschichte der botanischen Klassifikationen zeigt, daß Rays Einfluß begrenzt war. Trotzdem läßt sich
kaum daran zweifeln, daß er zur Schwächung des Einflusses der Methode der logischen Zweiteilung
beitrug.
Rays berühmtester Zeitgenosse in Frankreich, Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) war vielleicht
der erste Botaniker, der die Fülle exotischer Floren in vollem Umfang erkannte (Sloan, 1972, S.39-52;
Mägdefrau, 1973, S. 46-48). Rein praktische Überlegungen waren ihm daher wichtiger als die Entwicklung
einer universellen oder natürlichen Methode. Sein Ziel war, einen geeigneten Schlüssel für die
Formenvielfalt der Pflanzen aufzustellen: „Die Pflanzen zu kennen bedeutet, die exakten Namen zu
kennen, die ihnen aufgrund der Struktur einiger ihrer Teile gegeben worden sind" (Tournefort,
Institutiones, 1694, S. 1). Da die Zahl der Gattungen zu seiner Zeit noch überschaubar war, konzentrierte er
sich auf diese Kategorie. Im Gegensatz zu der Mehrzahl seiner Vorgänger benutzte er als Gattungsnamen
ein einziges Wort. Tourneforts größtes Verdienst liegt darin, daß er die erste klare Formulierung des
Gattungsbegriffs gegeben hat, wie auch in der klugen Abgrenzung und deutlichen Beschreibung von 698
Pflanzengattungen, von denen die meisten (wenn auch gelegentlich unter anderen Namen) von Linnaeus
übernommen wurden. Infolgedessen gehen einige der bekanntesten Gattungsnamen von Pflanzen auf
Tournefort zurück. Da Blüten und Früchte die größte Zahl leicht sichtbarer Merkmale aufweisen, baute er
die meisten seiner Beschreibungen auf diesen Pflanzenteilen auf, doch zog er gelegentlich auch andere
Strukturen heran, wenn das eine Hilfe zu sein schien. Tournefort war weitaus eher zu Konzessionen an die
praktischen Notwendigkeiten bereit als Linnaeus. Bei Pflanzen ohne Früchte und Blüten oder solchen, bei
denen diese Strukturen zu klein für das bloße Auge sind, empfahl er, daß „zur korrekten Bestimmung
[solcher] Gattungen nicht nur alle übrigen Teile der Pflanzen verwendet werden sollten, sondern auch ihre
weniger wichtigen Merkmale, die Art und Weise ihrer Vermehrung, die Summe der Merkmale und das
äußere Erscheinungsbild" (Institutiones, S.61).
Trotz seiner sorgfältigen Merkmalsanalyse war seine Klassifikation höherer Taxa mehr oder weniger
künstlich. Von den 22 Klassen, die er aufstellte, entsprechen lediglich sechs natürlichen Gruppen. Für den
Zweck der Identifikation war Tourneforts Methode jedoch erfolgreicher als die Systeme seiner
Zeitgenossen Ray, Morison oder Rivinus. Sie wurde allgemein übernommen, und zwar nicht nur in
Frankreich, sondern auch in den Niederlanden und schließlich auch in England und Deutschland. Die
Systeme von Boerhaave (1710), Magnol (1729) und Siegesbeck (1737) waren Varianten des
Tournefortschen Systems. Sie unterschieden sich vor allem in der Wahl des Merkmals, das sie für am
wichtigsten hielten. Das Hauptziel all dieser Systeme war die Bestimmung mit Hilfe der logischen
Zweiteilung. Keins von ihnen erreichte erfolgreich eine konsequente Abgrenzung natürlicher Gruppen, was
mit der logischen Methode in der Tat unmöglich ist.
Zur Zeit Cesalpinos war die Abwärtsklassifikation keine schlechte Strategie, denn alles in bezug auf die
Klassifikation war zu jener Zeit noch ungewiß. Noch hatte man keinen realistischen Artbegriff entwickelt,
und die Zahl der neu entdeckten Arten von Organismen wuchs exponentiell. Zu einer Zeit, als wenige
Leute überhaupt etwas über Naturgeschichte wußten, war korrekte Identifikation die dringlichste
Notwendigkeit, und die dichotome Klassifikation war dafür sehr gut geeignet. Rückblickend wird deutlich,
daß sie ein brauchbarer, wenn nicht sogar unvermeidlicher, erster Schritt zu einer besseren
Klassifikationsmethode war.
Die Botaniker dieser Epoche wurden häufig als „Aristoteliker" beschimpft, womit zugleich deduktive
Methode und blindes Vertrauen auf Tradition und Autorität gemeint waren. Das ist keineswegs
gerechtfertigt. Zwar benutzten sie die Methodik der logischen Zweiteilung, war diese doch für eine
erfolgreiche Bestimmung vorzüglich geeignet; ihre Arbeit aber orientierte sich nicht im geringsten an der
Autorität, sondern beruhte vielmehr auf der Forschung in der Natur, ausgedehnten Reisen und einer
sorgfältigen Analyse von Exemplaren. Sie legten eine solide empirische Grundlage für die verbesserten
Systeme der postlinnaeischen Epoche.
Es muß an dieser Stelle auf den auffallenden Unterschied in der historischen Entwicklung der
Naturgeschichte und der exakten Wissenschaften aufmerksam gemacht werden. Das 16. und 17.
Jahrhundert erlebte die sogenannte „wissenschaftliche Revolution", die jedoch im wesentlichen auf die
exakten Wissenschaften und in geringerem Ausmaß auf einige Gebiete der funktionalen Biologie
beschränkt war. Naturgeschichte und Systematik blieben jedoch von den umfassenden Veränderungen in
den Nachbarwissenschaften nahezu unberührt. Von Cesalpino über Tournefort und Ray (ganz zu
schweigen von Jungius oder Rivinus) bis zu Linnaeus bestand eine ungebrochene Tradition des
Essentialismus und des aristotelischen logischen Systems. Es ist – nicht ganz unberechtigt – behauptet
worden, die Naturgeschichte sei fast bis Darwin immer noch von platonischer und aristotelischer
Metaphysik beherrscht gewesen. Man sollte jedoch hinzufügen, daß sie außerdem noch von einem anderen
Strang im Gewebe des aristotelischen Denkens beherrscht war: dem Geist des Naturkundlers, der Freude
am Beobachten der Natur und der Faszination von der Vielgestaltigkeit der Natur. Jener Teil des
aristotelischen Erbes besteht bis heute fort, die Systematik wurde aber durch Darwin von der
aristotelischen Metaphysik befreit, die zudem während der Übergangszeit zwischen Adanson und 1859
bereits stark geschwächt worden war.
Das rasche Anwachsen der Kenntnisse auf dem Gebiet der Pflanzenklassifikation seit dem frühen 16.
Jahrhundert bis zu Linnaeus wäre ohne einen wichtigen technischen Fortschritt unmöglich gewesen: die
Erfindung des Herbariums (Lanjouw und Stafleu, 1956). Die Idee, Pflanzen zu pressen und zu trocknen,
scheint zuerst Luca Ghini (1490-1556) gekommen zu sein, zu dessen Schülern u.a. Cibo (dessen
Herbarium aus dem Jahre 1532 bis heute erhalten ist), Turner, Aldrovandi und Cesalpino gehörten, die alle
Herbarien anlegten. Herbarien waren für das Sammeln exotischer Pflanzen unerläßlich. Die meisten von
Linnaeus' Beschreibungen nichtschwedischer Pflanzen gehen auf Herbariumsexemplare zurück. Jedes der
großen Herbarien der Welt besitzt heute eine Sammlung von drei bis sechs Millionen Exemplaren, die die
Botaniker zum Zweck der Beschreibung und Bestimmung zu Rate ziehen. Es gibt gute Gründe für die
Annahme, daß die großen Fortschritte in der Pflanzenklassifikation in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts durch die neue Technologie der Herbarien beträchtlich erleichtert wurden, erlaubte sie doch
zu allen Jahreszeiten den Rückgriff auf wirkliche Exemplare. Der zweite wichtige technologische
Fortschritt war die Herstellung von Holzdruckstöcken. Luca Ghini war noch auf andere Weise ein großer
Erneuerer. Er richtete im Jahre 1543 (oder 1544) in Pisa den ersten botanischen Garten einer Universität
ein. Ein zweiter wurde 1545 in Padua gegründet. Zu einer Zeit, als es nur wenige Herbarien gab und
Illustrationen kümmerlich waren, kann der Wert botanischer Gärten für Lehrzwecke nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gab es öffentliche botanische Gärten bereits in
Florenz, Bologna, Paris und Montpellier.
Die vor-linnaeischen Zoologen
Als die Wissenschaft in der Renaissance wiederauflebte, hatte die Tierklassifikation einen erheblichen
Vorsprung vor der Pflanzenklassifikation. Während die Blütenpflanzen in ihrer Struktur ziemlich
einheitlich sind, gibt es auffallende Unterschiede zwischen einem Wirbeltier, einem Insekt oder einer
Qualle, und sogar unter den Wirbeltieren zwischen einem Säugetier, einem Vogel, einem Frosch oder
einem Fisch. Es ist daher nicht verwunderlich, daß schon vor Aristoteles zwischen den wichtigsten
Tiergruppen unterschieden worden war. Keine komplizierte Theorie war nötig, um sie zu erkennen. Die
Existenz solcher auffallender Unterschiede zwischen gut abgegrenzten Tiertaxa hatte zur Folge, daß. die
Zoologen dazu neigten, sich zu spezialisieren und auf eine besondere Gruppe, wie Säugetiere, Vögel
(Turner, Belon) oder Fische (Rondelet) zu konzentrieren.
Aber es gibt einen noch wichtigeren Unterschied zwischen der Behandlung von Pflanzen und Tieren.
Pflanzen sind sehr zahlreich, aber trotz ihrer scheinbaren Ähnlichkeit schrieb man bestimmten Arten sehr
spezifische Heileigenschaften zu. Eine korrekte Identifikation war daher von überragender Dringlichkeit.
Zwar spielte die Identifikation auch in den Tierbüchern eine gewisse Rolle, doch kannte jeder Löwen,
Füchse, Hasen, Raben, und es schien nicht besonders interessant oder wichtig zu sein, wie sie eingeordnet
wurden. Stattdessen gab es die Tradition der moralisierenden Tierbücher, etwa den physiologus oder
Konrad von Megenbergs Puch der Natur, die sich mit den Gewohnheiten der Tiere befaßten. Somit lag von
Anfang an das Gewicht der neuen Zoologiebücher auf dem, was wir heute Verhalten und Ökologie nennen
würden,. Gewiß war es immer noch üblich, die klassischen Autoren getreu zu zitieren und in gelehrten
philologischen Analysen der Bedeutung von Tiernamen zu schwelgen; außerdem begegnete man den
Erzählungen weit gereister Personen und den Geschichten über die Existenz von Monstern immer noch mit
nicht geringer Leichtgläubigkeit. Nichtsdestoweniger bewiesen die Verfasser dieser Bücher echtes
Interesse am lebenden Tier und ließen zweifelsfrei erkennen, daß sie ihren Gegenstand in der Natur
erforscht hatten. Allerdings waren sie wenig an der Klassifikation interessiert, und bald blieb die
zoologische Taxonomie hinter der Pflanzentaxonomie zurück.
Fünf Naturbeobachter, die in einem Zeitraum von 22 Jahren geboren wurden, waren zu Beginn des 16.
Jahrhunderts für das Wiederaufleben der Zoologie nach dem Mittelalter verantwortlich [11]. Obschon
Engländer, verbrachte William Turner (1508-1568) einen großen Teil seines Erwachsenenlebens auf dem
Kontinent, wo er 1544 in Köln sein Werk Avium… historia veröffentlichte; es enthielt die
Lebensgeschichte einzelner Vögel und war zweifellos das Ergebnis eigener Beobachtungen. Turner ist
auch durch botanische Veröffentlichungen bekannt, doch waren dies keine solchen Pionierleistungen wie
seine Ornithologie. Ein weit gewichtigerer Band ist Pierre Belons (1517-1564) L'histoire de la nature des
oyseaux (\555). Belon hatte mit seinen Reisen durch das östliche Mittelmeer und die Länder des Nahen
Ostens beträchtlichen Ruhm erworben. Unter Verwendung ökologischer und morphologischer Merkmale
ordnete er Vögel in die Klassen Raubvögel, Wasservögel mit Schwimmfüßen, Sumpfvögel ohne
Schwimmhäute sowie große und kleine Baumvögel ein. Somit war also Anpassung an das Habitat sein
Hauptkriterium für die Klassifikation. Einige von Belons Gruppierungen überlebten jedoch, vor allem in
der französischen ornithologischen Literatur, bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Belon schrieb auch über
Fische und andere Wassertiere (1551; 1553), aber diese Schriften wurden fast sofort von Guillaume
Rondelets (1507-1566) De Piscisbus Libri 18 (1554) überschattet, das die Beschreibungen von etwa 200
Arten echter Fische sowie Wale, Tintenfische (Cephalopoda), Krebstiere (Crustacea), hartschalige
Mollusken, Ringelwürmer (Annelida), Stachelhäuter, Hohltiere (Coelenterata) und Schwämme enthielt.
Auch eine Reihe von Ungeheuern war mit aufgeführt, als ob dies reguläre Bewohner des Mittelmeeres
wären.
Im Jahre 1551 begann Konrad Gesner (1516-1565) mit der Veröffentlichung seiner Historia Animalium,
einer gewaltigen Enzyklopädie mit einem Umfang von mehr als 4000 Seiten, in denen er alles
zusammengetragen hatte, was er in der Literatur über die verschiedenen Tierarten finden konnte. Sein
Vorbild war offensichtlich eher Plinius als Aristoteles. Gesner war bei weitem zu stark beschäftigt, um
viele eigene Beobachtungen über Tiere beitragen zu können, aber seine zahlreichen Korrespondenten
versorgten ihn mit Originalmaterial. Trotz seines starken Interesses an allem und jedem, was er über Tiere
lernen konnte, lag ihm offensichtlich nichts an der Klassifikation. „Um die Benutzung des Werkes zu
erleichtern", sind die Arten in jedem Band in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. In zwei anderen
Werken, Icones (1553) und Nomenciator (1560), gruppierte Gesner die Arten systematisch, wobei er
jedoch gegenüber den früheren Bemühungen von Aristoteles und Rondelet keinerlei Fortschritt erzielte.
Seine wertvolleren botanischen Arbeiten wurden erst lange nach seinem Tod veröffentlicht (1751-1771)
und hatten wenig Einfluß.
Ein Band von Gesner über Vögel wurde von Ulisse Aldrovandi (1522-1605) zu drei dicken Büchern
erweitert, ohne daß er, mit Ausnahme der anatomischen Befunde einiger Freunde und deren Schüler,
eigene Originalbeobachtungen hinzufügte. Es war nichts als eine ungeheure Kompilation, von der Buffon
sagte: „Wenn man alles Unbrauchbare oder für das Thema Irrelevante wegließe, könnte man sie auf ein
Zehntel des Originals reduzieren." In einer Beziehung unterschied sich Aldrovandis Ornithologia (1599;
1600; 1603) von Gesners Historia: Die Arten waren nicht alphabetisch geordnet, sondern zu gänzlich
künstlichen Kategorien zusammengefaßt, beispielsweise Vögel mit harten Schnäbeln, Vögel, die sich in
Staub oder in Staub und Wasser baden, solche, die gut singen, Wasservögel und so weiter – so recht die
Karikatur einer Klassifikation, die sich nicht einmal an den Prinzipien der logischen Zweiteilung
orientierte.
In dem Jahrhundert nach Gesner, in dem die Pflanzenklassifikation große Fortschritte machte, tat sich in
der zoologischen Klassifikation nichts. Fortschritte wurden erst gemacht, als man anstelle von Funktion
und Habitat die Struktur zum Klassifikationskriterium machte. Dieses Kriterium wurde zum ersten Mal in
Francis Willughbys (1635-1672) posthum veröffentlichtem Werk Ornithologiae, libri tres (1676)
angewendet; in ihm wurden die Vögel nach strukturellen Merkmalen, etwa Form des Schnabels und der
Füße oder Körpergröße, eingeteilt. Zwar benutzte Willughby die Prinzipien des logischen Systems, doch
kannte er die Vogelwelt offenbar sehr gut (Stresemann, 1949), und die meisten der von ihm anerkannten
Gruppen werden auch nach heutigen Maßstäben immer noch als natürliche Gruppen angesehen. Wir
werden niemals erfahren, wie viel von dieser Klassifikation Willughbys Freund John Ray, dem
Herausgeber von Willughbys Manuskripten, zu verdanken ist. Jedenfalls brachte Ray selbst bald darauf
knappe Darstellungen über Säugetiere und Reptilien (1693) und Insekten (1705) heraus; die über Vögel
(1713) und Fische (1713) erschienen erst nach seinem Tode. So künstlich Rays Methode in vielem auch
war, die mit ihr erzielten Klassifikationen waren nicht nur die besten, die es bis dahin gegeben hatte, sie
waren in gewissen Einzelheiten sogar auch den späteren Klassifikationen von Linnaeus überlegen.
Zu einem brennenden Problem wurde die zoologische Klassifikation, als man im 17. Jahrhundert die
Welt der Insekten „entdeckte". Bald erkannte man, daß die Zahl der Insektenarten weitaus größer war als
die der Pflanzenarten, und verschiedene Naturkundler (Swammerdam, Merian, Reaumur, de Geer und
Roesel) wandten ihre Aufmerksamkeit überwiegend oder völlig den Insekten und ihrer Klassifikation zu.
Der Größte unter ihnen war Rene Antoine Ferchault de Reaumur (1683-1757). Seine berühmte
sechsbändige Naturgeschichte der Insekten war in vielerlei Hinsicht eine Pionierleistung, wenngleich sie
zum Teil in Anlehnung an Jan Swammerdams (1637-1680) Werk aufgebaut war. Reaumurs hervorragende
Beobachtungen am lebenden Insekt dienten Buffon als Vorbild für seine Histoire naturelle, während das
Gewicht, das er auf die höheren Taxa legte (statt auf die ermüdende Beschreibung von Arten), Cuvier als
Modell für sein Mémoire (1795) diente. Obgleich Reaumur nicht speziell an der Klassifikation interessiert
war, machte er nichtsdestoweniger zahlreiche scharfsichtige Beobachtungen – etwa die, daß die Weibchen
der Glühwürmchen (Leuchtkäfer) trotz des Fehlens des diagnostischen Merkmals harter Deckflügel
dennoch Käfer seien. Er erkannte, daß die Abgrenzung natürlicher Gruppen nicht von einzelnen für die
Klassifikation wichtigen Merkmalen abhängig sei. Reaumurs Ansichten waren ein deutliches Symptom des
wachsenden Widerstandes gegen die Methode der logischen Zweiteilung; gemeinsam mit Adansons
Schriften machten sie den Weg frei für die Prinzipien der Aufwärtsklassifikation (siehe weiter unten).
Fortgeführt wurde Reaumurs Werk von C. de Geer (1720-1778), der Wichtiges zur Insektenklassifikation
beitrug, die wiederum allem Anschein nach das linnaeische System der Insekten beträchtlich beeinflußten
(Tuxen, 1973; Winsor, 1976 a).
Während des 16., 17. und 18. Jahrhunderts war die Naturgeschichte nicht so klar in Zoologie und
Botanik geteilt wie im 19. Jahrhundert. Autoren wie Turner, Gesner, Ray, Linnaeus, Adanson, Lamarck
und andere schrieben Bücher sowohl über Tiere als auch über Pflanzen. Aber auch in jenen Jahrhunderten
spezialisierten sich die meisten Verfasser entweder auf Tiere (Belon, Rondelet, Swammerdam, Reaumur,
Buffon) oder auf Pflanzen (Cesalpino, Bauhin, Morison, Tournefort). Nach 1800 war kein Taxonom mehr
imstande, sowohl Tier- als auch Pflanzenreich erschöpfend zu behandeln. Angesichts dieser zunehmenden
Trennung überrascht es nicht, daß sich in der Taxonomie der beiden Reiche allmählich recht
unterschiedliche Traditionen herausbildeten; daran änderte auch die Tatsache nicht viel, daß Ray und
Linnaeus zum Teil die botanische Methodik von den Pflanzen auf die Tiere übertrugen.
Während bei den Zoologen die Spezialisierung von Anfang an ausgeprägt gewesen war, konnten die
Botaniker dank der strukturellen Einheitlichkeit der Blütenpflanzen leicht vom Studium einer Familie zur
Erforschung einer anderen übergehen, ohne neue Techniken oder Terminologie lernen zu müssen. Erst
relativ spät im 19. Jahrhundert begannen einige Botaniker sich auf bestimmte Pflanzenfamilien zu
spezialisieren, sei es auf Orchideen, Gräser oder Palmen – ein Trend, der in den letzten fünfzig Jahren
besonders deutlich geworden ist. Die Spezialisierung unter den Zoologen wurde noch stärker, als sie die
Insekten und Wassertiere zu erforschen begannen; allerdings hat es gelegentlich Zoologen gegeben, die
sich gleichzeitig auf sehr verschiedene Taxa spezialisierten, etwa den französischen Spinnenforscher
Eugene Simon (1848-1924), der zugleich Kolibri-Spezialist war. Derartige Spezialisierungen auf einzelne
höhere Taxa hatten zur Folge, daß man sich weniger mit den Methoden und Prinzipien der höheren
Klassifikation beschäftigte. Es läßt sich kaum leugnen, daß die Tiertaxonomie bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts hinter der Pflanzentaxonomie zurückblieb.
Aber das Zurückbleiben der Zoologie hatte noch einen anderen Grund: Pflanzen sind sehr viel leichter
zu konservieren und aufzubewahren als Tiere. Während Herbarien seit Mitte des 16. Jahrhunderts weit
verbreitet waren, wurden Methoden zum Schutz von Tiersammlungen gegen die Zerstörungen durch
Motten und Speckkäfer (Dermestidae) erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfunden. Lange Zeit
konservierte man Tiere in Alkohol, doch wer kann eine Sammlung von Vögeln erforschen, wenn sie in
Alkohol konserviert sind? Dies Verfahren ist für Fische und manche Meeresorganismen geeignet, auch für
Exemplare, die man zum Sezieren benötigt, nicht aber für Vögel, deren Farbe wichtig ist. Eine Zeitlang
benutzte man Salz und Alaun zur Konservierung von Vogel und Säugetierbälgen, aber erst als Becoeur in
den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts die Arsenseife erfunden hatte, wurde eine dauerhafte
Konservierung von Vogelbälgen möglich (Farber, 1977). Diesem einzigen technischen Fortschritt ist es zu
verdanken, daß es heutzutage ansehnliche Vogel- und Säugetiersammlungen gibt.
Auch die Insektensammlungen waren äußerst anfällig gegen die Zerstörung durch Speckkäfer, und
dauernde Insektensammlungen wurden erst möglich, als man Naphthalin zu verwenden begann, als die
Vitrinen dicht schlossen und man von Zeit zu Zeit die Kästen ausräucherte. Auch war eine ständige
Überwachung durch Museumskonservatoren nötig. Obgleich sich die gleichen Probleme im Prinzip auch
bei Pflanzen stellten, war die tatsächliche Gefährdung bei ihnen weitaus geringer, und es war entsprechend
leichter, Sammlungen anzulegen und zu erhalten. Der rasche Aufstieg der Tiersystematik nach 1800 ist
zum Teil das Ergebnis neuer Technologien bei der Konservierung von Tiersammlungen.
Noch zwei weitere bedeutende Unterschiede zwischen Tieren und Pflanzen sind zu erwähnen. Als
Cuvier und Lamarck die außerordentliche Mannigfaltigkeit der inneren Anatomie von wirbellosen Tieren
entdeckten (siehe unten), hatte dies eine große Blüte der vergleichenden Anatomie zur Folge, und dies
wiederum weckte bei den Zoologen ein starkes Interesse an der Einteilung von Klassen und Stämmen. Die
weit größere innere Einheitlichkeit der Pflanzen, oder vielleicht richtiger ausgedrückt, die Tatsache, daß es
schwieriger war, die Pflanzenanatomie zu interpretieren, schloß eine ähnliche Bewegung in der Botanik
aus. Außerdem ist die Art bei Pflanzen ein weitaus komplexeres Phänomen als bei Tieren (zumindest
höheren Tieren), und demzufolge haben Zoologen einen ganz anderen Artbegriff als Botaniker (s. Kap. 6).
Schreibt man eine Geschichte der Systematik, so führt es zu Mißverständnissen, wenn man die
Aussagen von Botanikern und Zoologen unterschiedslos zusammenwirft. Die Ansichten der Vertreter
dieser beiden Zweige der Biologie müssen nicht nur im Zusammenhang mit ihrem Material, sondern auch
mit ihrer begrifflichen Entwicklung dargestellt und interpretiert werden. Allerdings können selbst innerhalb
eines dieser Zweige der Taxonomie verschiedene Vorstellungswelten nebeneinander existieren. Zum
Beispiel war die linnaeische Schule in der Pflanzentaxonomie lange Zeit derart dominierend, daß alle
Nichtkonformisten konsequent übersehen, wenn nicht sogar unterdrückt wurden. Dies ist mit ein Grund für
die Hintansetzung von Botanikern wie Magnol und Adanson gewesen, die in mancher Hinsicht größere
Wissenschaftler waren als Linnaeus. Selbst heute noch gehen Klassifikationstheorie und Artbegriff in der
Regel weit auseinander, wenn man die Ansichten eines Spezialisten für eine wohlbekannte Tiergruppe
(etwa Vögel) mit denen eines Spezialisten für eine nur wenig bekannte Gruppe von Insekten oder anderen
Wirbellosen vergleicht.
Carl Linnaeus
Kein anderer Naturkundler hat schon zu seinen Lebzeiten so großen Ruhm erworben wie Carl Linnaeus
(1707-1778) [12], der gelegentlich „Vater der Taxonomie" genannt wird. Doch hundert Jahre nach seinem
Tod hielt man ihn weithin für nichts anderes als einen engstirnigen Pedanten. Heute können wir, dank der
Forschungstätigkeit von Cain, von Hofsten, Stearn, Larson, Stafleu und anderen Linnaeus-Spezialisten, ein
ausgewogeneres Bild zeichnen [13]. Das ist keine leichte Aufgabe, denn Linnaeus war eine sehr komplexe
Persönlichkeit, mit sehr widersprüchlichen Charaktereigenschaften. In seiner Methodik war er in der Tat
von pedantischer Nüchternheit, daneben besaß er großes literarisches Talent. Er war ein Anhänger der
okkulten Zahlenkunde (mit besonderer Vorliebe für die Zahlen 5,12 und 365) und entwickelte vor allem in
späteren Jahren, einen starken Hang zur Mystik; zugleich aber – kaum glaubhaft – war er das Muster eines
gewissenhaften Taxonomen; das alles in einer Person! Er lebte jahrelang in Holland und besuchte
Deutschland, Frankreich und England, doch sprach er lediglich Schwedisch und Latein und sonst fast keine
fremde Sprache. Als er in Holland eintraf (1735), waren Methode und Begriffsrahmen bereits beträchtlich
ausgereift, aber obwohl sich seine Methode in der Folge nur wenig änderte (seine spätere Erfindung der
binominalen Nomenklatur war für ihn keine wichtige Änderung seines Systems), wandelten sich seine
philosophischen Vorstellungen tiefgreifend. Sein eigentliches Interesse galt lediglich einem einzigen
Aspekt der Biologie einzelner Arten, ihrer Fortpflanzungsbiologie (Ritterbush, 1964, S. 109-122), aber wie
seine Essays (Amoenitates Academicae) zeigen, war er an einer breiten Vielfalt biogeographischer und
ökologischer Themen interessiert (Linne, 1972)[14]. Sein vorrangiges Anliegen war die Klassifikation;
seine Besessenheit, alles zu klassifizieren, was ihm über den Weg lief, ging soweit, daß er eine
komplizierte Einteilung von Botanikern in Phytologen, Pflanzenliebhaber, Collectores, Methodici,
Adonides, Oratores, Eristisi usw. vorschlug (Philosophia Botanica, Thesen 6-52).
Linnaeus kannte 1753 etwa 6000 Pflanzenarten und glaubte, die Gesamtzahl liege bei etwa 10000, und
die Zahl der Tierarten sei ungefähr ebenso groß (1758 führte er 4000 Tierarten an). (Sein Zeitgenosse
Zimmermann (1778) war realistischer: er schätzte, es würden schließlich 150000 Pflanzenarten und 7
Millionen Tierarten entdeckt werden.) Die ganze linnaeische Methode (ein Botaniker muß die Diagnose
aller Gattungen im Gedächtnis behalten!) beruhte auf der Annahme einer begrenzten Zahl von Taxa; wir
kennen heute allein mehr als 200000 Arten Phanerogamen. Linnaeus kannte 236 schwedische Arten Algen,
Flechten und Pilze, verglichen mit etwa 13000 Arten, die wir heute aus Schweden kennen. Er nahm an, die
Tropen besäßen von allen Teilen der Welt das einförmigste Pflanzenleben. Aber solche Unzulänglichkeiten
seines Wissens waren für die Entwicklung seiner Methodologie nicht annähernd so schädlich wie die
Widersprüche in seinen Begriffen. Einerseits benützte Linnaeus, wie wir gleich sehen werden,
scholastische Logik und war strenger Essentialist, andererseits akzeptierte er auch das Prinzip der
Lückenlosigkeit, und betont die Kontinuität. Hauptziel seiner Methode war ein eminent praktischer Zweck:
die korrekte Bestimmung von Pflanzen und Tieren; allerdings suchte er dieses Ziel mit der hochgradig
künstlichen Methode der logischen Aufteilung (Dichotomie) zu erreichen. Es verwundert nicht, daß
Kritiker in seinen Schriften so viele Widersprüche entdecken konnten.
Trotz allem: Linnaeus verdient seinen hohen Ruhm zu recht. Seine technischen Innovationen
(einschließlich der Erfindung der binominalen Nomenklatur), die Einführung eines rigorosen Systems von
Diagnosen im Telegrammstil, die Entwicklung einer sorgfältig durchdachten Terminologie der
Pflanzenmorphologie (Bremekamp, 1953 a), die Standardisierung von Synonymien und jedes anderen
denkbaren Aspekts taxonomischer Forschung brachte in die Taxonomie und Nomenklatur Einheitlichkeit
und Einfachheit, wo ein totales Chaos gedroht hatte. Dies war das Geheimnis seiner Beliebtheit und seines
Erfolges. Durch seine Autorität hatte Linnaeus der Welt der Systematik seine Methoden aufzwingen
können; die Folge war die beispiellose Blüte der taxonomischen Tier- und Pflanzenforschung im 18. und
frühen 19. Jahrhundert.
Allerdings bedauerten nach-linnaeische Verfasser, Botaniker wie Zoologen, daß das Werk von Linnaeus
eine Überbewertung der Klassifikation und Nomenklatur zur Folge hatte und daß daneben fast alle anderen
Aspekte der Naturgeschichte zu kurz kamen. Vor allem die Erforschung des lebenden Tieres geriet völlig
in Vergessenheit; ein weiteres Resultat war, daß nicht nur Varietäten, sondern auch Jugendstadien und
Larven bekannter Arten als getrennte Arten beschrieben wurden. Das Übersehen Kölreuters, das Bedauern
von Nägeli und Sachs über die Anstrengungen, um in Botanik und Zoologie Talente für Physiologie und
Embryologie zu gewinnen, bestätigen diesen Standpunkt.
Moderne Autoren haben große Schwierigkeiten gehabt, Linnaeus zu verstehen, weil viele seiner
Ausdrücke wie „Genus", „Species", „Name", „kennen" und „natürliches System" die ganz spezielle
Bedeutung des Systems der scholastischen Logik haben. Beim Studium hatte sich Linnaeus in Logik
ausgezeichnet, und er war von der Präzision dieser Methode tief beeindruckt. Seit Cesalpino hatte jeder
Botaniker die Logik der Zweiteilung mehr oder weniger konsequent angewandt, und das war immer noch
bei Linnaeus der Fall (Cain, 1958) [15].
In einer Hinsicht unterscheidet sich Linnaeus von seinen Vorgängern. Sie hatten bei ihren
Abwärtsklassifikationen die Dichotomie so oft angewandt wie nötig war, um zum gesuchten „Genus" oder
der „Species" zu gelangen. Im Gegensatz dazu wandte Linnaeus seine Methode mit ganzer Strenge nur auf
der Ebene des Genus an. Höhere Kategorien als das Genus interessierten ihn weniger; intraspezifische
Variation behandelte er vage und inkonsequent.
Linnaeus und die höheren Kategorien
Statt eines Systems mit konsequenter Abwärtsdichotomie stellte er ein System auf, das innerhalb eines
Reiches eine Hierarchie von nicht mehr als vier Kategorien aufweist: Klasse, Ordnung, Gattung und Art.
Das Einordnen der gesamten Vielfalt der Natur in Taxa auf diesen vier Ebenen verlieh seinem System eine
Klarheit und Folgerichtigkeit, die den schwerfälligen Dichotomien der meisten seiner Vorgänger fehlten.
Der moderne Taxonom kennt eine komplizierte Hierarchie höherer Kategorien. Die vollständige Reihe
von der Art bis zum Reich wird häufig als Linnaeische Hierarchie bezeichnet (Simpson, 1961; Mayr,
1969), wenngleich Linnaeus nicht der Erste war, der höhere Kategorien als die Gattung anerkannte. Wie
wir gesehen haben, deutete schon Aristoteles bei seiner Anordnung der Tiere vage eine Hierarchie an. Er
teilte alle Tiere in Blutlose und Bluttiere ein. Die ersteren hatten Unterkategorien wie vierfüßig, vielfüßig
oder fußlos, usw. In der Mehrheit werden diese Gruppierungen nach einzelnen diagnostischen Merkmalen
aufgestellt, und die Nachfolger des Aristoteles verstanden seine Einteilungen in der Regel als diagnostische
Schlüssel. Doch wie schon früher angedeutet, machte sich Aristoteles selbst über die künstliche Methode
der dichotomen Schlüssel lustig. Er erkannte, daß sein Kriterium „lebendgebärend" (im Gegensatz zu
„eierlegend44) zum Beispiel nicht zu einer natürlichen Gruppe führt. Zu keiner Zeit hat Aristoteles
terminologisch zwischen verschiedenen höheren Kategorieebenen unterschieden.
Als die aristotelische Tradition während der Renaissance wieder auflebte, gehörte dazu auch ein
mangelndes Interesse an den höheren Kategorien. Die Verfasser der Kräuterbücher wie auch die
Enzyklopädisten erkannten entweder überhaupt keine höheren Kategorien oberhalb der Gattung an, oder
aber sie bezeichneten die aus ihrer logischen Zweiteilung hervorgehenden Gruppen als „Bücher", „Kapitel"
oder mit einem anderen, nichttaxonomischen Ausdruck. Rays Gruppen oberhalb der Gattung trugen
ebenfalls sachfremde Bezeichnungen. Tournefort war anscheinend der erste Botaniker, der eine formale
Klassifikation von Kategorien über der Gattung entwickelte. Er teilte die Pflanzen in 22 Klassen auf und
diese Klassen wiederum in 122 Sektionen.
Die Benennung dieser höheren Kategorien war zunächst von Autor zu Autor verschieden. Was
Tournefort als „Sektionen44 bezeichnet hatte, nannten Magnol und Adanson „Familien44 und Linnaeus
„Ordnungen44. In dem Maße, wie die Zahl der Pflanzengattungen und arten anwuchs, und damit auch die
Notwendigkeit einer wohldurchdachten Hierarchie, wurden alle diese wahlweise verwandten Ausdrücke zu
einer einzigen Terminologie zusammengefaßt. Um das Jahr 1800 wurde die Kategorie Familie bereits
ziemlich übereinstimmend zur Bezeichnung einer Stufe zwischen Gattung und Ordnung benutzt.
Allerdings ist Cuvier bei der Verwendung dieser Ausdrücke in aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen
noch inkonsequent. Völlig formalisiert wurden sie erst in den Schriften des Entomologen Latreille.
Bei der Definition seiner Kategorien Ordnung, Klasse und Reich war Linnaeus ungemein zurückhaltend.
Man hat das Empfinden, er habe diese höheren Kategorien nicht aus theoretischen, sondern aus rein
praktischen Gründen eingeführt. In der Tat sagt er ganz offen, Klasse und Ordnung seien weniger
„natürlich" als die Gattung. In seiner Philosophia Botanica (These 160) schreibt er: „Eine Klasse ist eine
Übereinstimmung mehrerer Gattungen in ihren Fruchtbildungsorganen entsprechend den Prinzipien von
Natur und Kunst." Mit anderen Worten: Klassen sind bis zu einem gewissen Grade künstlich; allerdings
gibt Linnaeus zu verstehen, daß sie durch natürliche Klassen zu ersetzen sein werden, sobald alle
Pflanzengattungen entdeckt und beschrieben sind. Die Ordnung war für ihn in sogar noch stärkerem Maße
eine Frage der Bequemlichkeit: „Eine Ordnung ist eine Unterteilung von Klassen, die notwendig ist, um zu
verhindern, daß mehr Gattungen zusammengeordnet werden als der Verstand leicht behalten kann" (These
161). Offensichtlich waren die höheren Kategorien von Linnaeus in erster Linie bequeme Kunstgriffe, um
Informationen wiederzugewinnen. Sein mangelndes Interesse an den höheren Kategorien ist durch die
Tatsache dokumentiert, daß die von ihm anerkannten höheren Tiertaxa entschieden denen von Aristoteles
vor mehr als zweitausend Jahren unterlegen (stärker heterogen) waren.
In Linnaeus' Einstellung zu den höheren Kategorien gibt es eine Reihe von Ungereimtheiten. Die
Gattung spiegelt sein essentialistisches Denken par excellence wider, und alle Gattungen sind durch scharfe
Diskontinuitäten voneinander getrennt. Dagegen hat er zu Klassen und Ordnungen eine eher
nominalistische Einstellung. Hier macht er sich Leibniz' Motto zu eigen, daß die Natur keine Sprünge
macht. Je mehr Pflanzen wir kennen, umso mehr Lücken zwischen den höheren Taxa werden gefüllt
werden, bis die Grenzen zwischen Ordnungen und Klassen möglicherweise schließlich ganz verschwinden.
Seine Bejahung des Prinzips der Lückenlosigkeit kommt in seiner Aussage zum Ausdruck, daß alle
Pflanzentaxa auf allen Seiten Verwandtschaften aufweisen geradeso wie benachbarte Länder auf einer
Weltkarte (These 77; für seine Karte, s. Greene, 1959, S.135).
Die Gattung
Die Gattung ist für den modernen Taxonomen die niedrigste kollektive Kategorie, eine Gruppe von Arten,
die gewisse Eigenschaften gemeinsam haben. Diese Definition unterscheidet sich von dem Gattungsbegriff
der Taxonomen, die die aristotelische Logik anwandten. Für sie war die Gattung eine Klasse mit einer
definierbaren Essenz, die sich mittels unterscheidender Merkmale in Arten unterteilen ließ. Eine Gattung
bezeichnete keinen feststehenden Rang in einer Hierarchie von Kategorien, und der Gattungs"name" war
häufig polynominal, insbesondere auf den unteren Ebenen der Unterteilung. Ursprünglich wurde er kaum
konsequent angewandt; Aristoteles gebrauchte den Ausdruck genos gelegentlich sogar in Fällen, in denen
wir heute von Arten sprechen würden (Balme, Grene). In einem langwierigen Prozeß wurde der Ausdruck
„genus" auf die heutige kategoriale Ebene eingeengt. Er setzte unter den Autoren der Kräuterbücher und
den Enzyklopädisten ein, von denen Cordus (1541) und Gesner (1551) den Gattungsnamen bereits in
bemerkenswert moderner Weise benutzten, obgleich die deutschen Kräuterkundler das Wort Geschlecht
(genus) häufiger in der Bedeutung von Art als von Gattung verwendeten. Die vorher recht vage Benutzung
der Worte „genus" und „species" begann in den Schriften der großen Taxonomen des 17. Jahrhunderts,
Ray und Tournefort, an biologischer Bedeutung zu gewinnen.
Die Gattung war für Linnaeus der Eckpfeiler der Klassifikation [16]. Wenn man in seiner Umgebung
Ordnung herstellt, so klassifiziert man nicht Dinge, sondern ihre „Essenzen". Für Linnaeus war es ein
Axiom, daß natürliche Gattungen existieren, daß sie d.h. die ihnen zugrundeliegenden „Essenzen" – als
solche geschaffen worden waren und daß sie anhand ihrer Fruchtbildungsmerkmale erkannt werden
konnten. Er gestand so viele Gattungen zu, wie es verschiedene Gruppen von Arten gibt, die in der Struktur
ihrer Befruchtungsorgane übereinstimmen. Nicht der Taxonom „macht" die Gattung, er entdeckt lediglich
die zu Anfang geschaffenen Gattungen. In Linnaeus' Klassifikationstheorie besteht eine sehr enge
Verbindung zwischen Schöpfungsdogma und essentialistischer Logik.
In seinen ersten Schriften hielt sich Linnaeus noch an die strengen Gesetze der Logik, indem er das
ganze Pflanzenreich als summum genus bezeichnete, dessen „species" die Pflanzenklassen waren. Nach
1735 gab er diese Verwendung auf und begrenzte den Ausdruck „genus" auf die Hierarchieebene
unmittelbar über der Species. 1764 führte er 1239 Pflanzengattungen auf. Linnaeus legt viel Nachdruck auf
seine Methode, die er in seiner Philosophia Botanica (These 186-209) in allen Einzelheiten beschreibt. Die
Definition einer Gattung ist die Aussage ihrer Essenz. „Die Gattung wird durch das Merkmal definiert,
dieses wiederum ist dreifacher Art: das künstliche, das essentielle und das natürliche. Das generische
Merkmal ist gleichbedeutend mit der Definition der Gattung (These 186)…Die essentielle Definition
verleiht der Gattung, auf die sie sich bezieht, ein Merkmal, das sehr speziell auf diese beschränkt und
besonders ist. Die essentielle Definition [Merkmal] unterscheidet aufgrund einer einzigartigen Idee jede
Gattung von ihren Nachbarn in derselben natürlichen Ordnung" (These 187).
Wäre es möglich, die essentiellen Merkmale einer Gattung ausfindig zu machen, so brauchte man
lediglich die essentielle Definition. Doch Linnaeus gesteht Ray gegenüber implizite zu, daß keine derartige
Methode bekannt sei. Daher muß man ebenfalls eine künstliche Definition angeben, mit der sich „eine
Gattung von den anderen Gattungen in einer künstlichen Ordnung unterscheiden läßt" (These 188).
Schließlich „zählt die natürliche Definition alle nur möglichen genetischen Merkmale auf und schließt
somit die essentielle wie auch die künstliche Definition ein" (These 189) [17].
Obwohl Linnaeus seine Vorstellungen über die scharfe Abgrenzung und Beständigkeit der Arten im
Laufe seines wissenschaftlichen Werdegangs erheblich geändert hat (siehe Kap.6), schwankte er niemals in
seiner Einschätzung der Gattung. Man hat das Gefühl, daß er Gattungen intuitiv (durch genaues
Betrachten) erfaßte, was ihn zu dem berühmten Leitsatz veranlaßte: „Es ist die Gattung, aus der sich die
Merkmale ergeben, und nicht die Merkmale, welche die Gattung erfordern." In der Tat ignorierte er häufig
Eigenheiten von etwas aberranten Arten, solange sie „offensichtlich" noch zu einer gegebenen Gattung
gehörten. Die Gattung war für ihn das am besten geeignete Paket zur Wiedergewinnung von Information,
denn bei dem relativ begrenzten Teil des Tier- und Pflanzenreichs, der ihm bekannt war, waren die
Gattungen im großen und ganzen durch deutliche Diskontinuitäten voneinander getrennt. Wichtiger war
jedoch, daß aufgrund seiner essentialistischen Philosophie die Gattung (mit ihrer Essenz) für ihn die
gottgegebene reale Einheit der Vielfalt war.
In mancher Hinsicht war die linnaeische Gattung mit ihrer essentialistischen, monolithischen,
unabhängigen Existenz, zumindest als Begriff, ein Schritt rückwärts weg von Tourneforts Begriff der
Gattung, die eine Gruppe von Arten war, also eine kollektive Kategorie. Die Gattung ist ein Mittel, so
Tournefort, „um wie in einem Bouquet Pflanzen zusammenzubringen, die einander ähneln, und sie von
denen abzugrenzen, denen sie nicht ähnlich sind" (Elements de botanique, 1694, S.13). Der moderne
Gattungsbegriff geht somit eher auf Tournefort zurück als auf Linnaeus. Stafleu (1971, S.74) weist mit
Recht darauf hin, „daß es eigentlich nicht Linnaeus war, der zum ersten Mal folgerichtig aufgestellte
Definitionen (Diagnosen) und somit vergleichbare Beschreibungen von Gattungen vorlegte Die Ehre
hierfür gebührt dem pragmatischen Empiriker Tournefort."
Das linnaeische Sexualsystem
Eine Klassifikation war für Linnaeus ein System, das dem Botaniker erlaubte, Pflanzen zu „erkennen", d.h.
sie rasch und sicher zu benennen. Ein solches System ließ sich nur aufstellen, wenn man gut definierte,
beständige Merkmale benutzte. Die vegetativen Teile der Pflanzen zeigen viele Anpassungen an besondere
Bedingungen und tendieren somit zu Konvergenzen (wie etwa zwischen Kakteen und
Wolfsmilchgewächsen), wodurch sich die frühen Pflanzentaxonomen irreführen ließen. Linnaeus machte
die Blüte zur Hauptquelle seiner Merkmale, hatte dies doch den großen Vorteil, daß die Unterschiede in der
Zahl der Staubgefäße und Stempel (und mehrere andere Merkmale der Blüten) keine ad hoc Anpassungen
sind, sondern, wie wir heute sagen würden, entweder ein zufälliges Nebenprodukt des zugrundeliegenden
Genotypus oder anders Anpassungen zur Erleichterung der Bestäubung unabhängig vom Standort.
Linnaeus bezeichnete seine Methode, irreführend, als „Sexualsystem". Diese Terminologie spiegelte
seine Einschätzung der hervorragenden Bedeutung der Fortpflanzung wider: Die Fortpflanzung verriet den
verborgenen Plan der Schöpfung. Tatsächlich sind Unterschiede in der Zahl der Staubgefäße und Stempel,
so praktisch sie für die Identifikation auch sein mögen, von geringer oder gar keiner funktionalen
Bedeutung. Aber Linnaeus hätte es für geschmacklos gehalten, dies offen zuzugeben, und so bezeichnete er
sein System, um ihm eine philosophische Rechtfertigung zu geben, als Sexualsystem. In seinem Systema
Naturae (l.Aufl.) legte er es 1735 zum ersten Mal in Form eines Schlüssels vor. Vier grundlegende
Kriterien wurden benutzt: Zahl, Gestalt, Proportion und Lage. Die absolute Zahl war also nur einer der
Merkmalskomplexe. Ob die Blüten sichtbar sind (später als Phanerogamen bezeichnet) oder nicht, wie
viele Staubgefäße und Stempel eine Blüte hat, ob sie miteinander verwachsen sind oder nicht, und ob
männliche und weibliche Elemente in der gleichen Blüte vorkommen – solcher Art waren die Merkmale,
anhand derer Linnaeus 24 Klassen (Monandria, Diandria, etc.) unterschied. Die Klassen wiederum wurden
mit Hilfe zusätzlicher Merkmale in Ordnungen unterteilt.
So künstlich dieses System auch war, für die praktischen Zwecke der Identifikation sowie für
Speicherung und Wiedergewinnung von Information war es nützlich. Jeder Botaniker, der das
Sexualsystem anwandte, würde zu dem gleichen Befund gelangen wie Linnaeus. Er brauchte nur eine
relativ begrenzte Zahl von Namen von Blüten- und Fruchtteilen auswendig zu lernen, und konnte dann jede
Pflanze identifizieren. Es überrascht nicht, daß fast alle das linnaeische System übernahmen. 1739 bereits
erklärte der führende französische Botaniker Bernard de Jussieu, das linnaeische Verfahren sei, da exakter,
dem seines Landsmannes Tournefort vorzuziehen; der Sieg war vollständig.
In einer Klassifikation auf der Basis der gemeinsamen Abstammung tritt jede Art (oder jedes höhere
Taxon) nur ein einziges Mal auf. Sie nimmt eine einzig geartete Stellung in der Hierarchie ein. Diese
Einschränkung gilt für einen künstlichen Identifikationsschlüssel nicht. Ein variables Taxon kann
wiederholte Male in verschiedene Paare eingeordnet werden. Man erinnere sich an die linnaeische
Klassifikation hartschaliger Wirbelloser. Er stufte Typen mit Schale (Mollusken, Rankenfüßer, bestimmte
Polychäten) in die Ordnung der Testacea ein, weiche Tiere dagegen, d. h. Mollusken ohne Schale (etwa
Schnecken und Kopffüßer), Hohltiere und die Mehrheit der Polychäten in die Ordnung Mollusca. Aber bei
der Aufzählung der Gattungen der Testacea, gab er in jedem Fall auch einen Mollusken-Gattungsnamen für
das Weichtier an, etwa Chiton (Tier Doris), Cypraea (Tier Limax), Nautilus (Tier Sepia), Lepas (Tier
Triton) und so weiter. Die Gattungen Doris, Limax, Sepia und Triton wurden als gültige Gattungen in der
Ordnung Mollusca noch einmal aufgeführt. Das übergeordnete Anliegen von Linnaeus war die praktische
Frage der Identifikation, und um diese zu erleichtern, schuf er sein System der doppelten Nennung (von
Hofsten, 1963). Es war ein Kompromiß: die Schale diente der Bestimmung, das Tier gab die tatsächliche
Position im System an. Man kann es als Versuch interpretieren, künstliche und natürliche Klassifikation
gleichzeitig vorzunehmen.
Bedenkt man das offensichtlich Gekünstelte der Methode der logischen Zweiteilung, so überrascht, wie
viele der von Linnaeus anerkannten Gattungen aus gut charakterisierten Gruppen von Arten heute noch als
Gattungen oder Familien gelten. Eine genaue Untersuchung dieser Klassifikation bringt des Rätsels
Lösung: Wie Cesalpino erkannte Linnaeus solche Gruppen zuerst durch Betrachten – danach erarbeitete er
die Definition (die Essenz). In seiner Philosophia botanica (These 168) gab Linnaeus das offen zu. Dort
sagt er: „Man muß den Gesamteindruck heimlich zu Rate ziehen, unterm Tisch, um die Bildung falscher
Gattungen zu vermeiden." Als sein Sohn gefragt wurde, welches das Geheimnis seines Vaters sei, bei der
Künstlichkeit seiner Methode so viele natürliche Gattungen geschaffen zu haben, antwortete er: „Es war
nichts anderes als seine Erfahrung im Erkennen der Pflanzen an ihrem Gesamteindruck. Deshalb wich er
oft von seiner eigenen Methode ab, denn er ließ sich nicht von einer Veränderung in der Zahl von Teilen
stören, wenn nur der Charakter der Gattung bewahrt werden konnte." Linnaeus ging manchmal so weit, in
dieselbe Gattung Arten hineinzupacken, die sich in ihrer Staubgefäßzahl unterschieden und in verschiedene
Klassen seines Sexualsystems hätten eingestuft werden müssen! Er übernahm sogar das Merkmal einer
Gattung unangetastet in spätere Auflagen seiner Werke, obgleich später hinzugefügte Arten Merkmale
besaßen, die zu dem früheren generischen Merkmal im Widerspruch standen. Bei seinen
Tierklassifikationen war er genauso inkonsequent. Die Schaflausfliege (Melophagus ovinus), eine
flügellose Fliege wurde von ihm ohne Zögern unter die „zweiflügeligen Insekten" (Diptera) eingeordnet.
Es gibt eine Fülle ähnlicher Fälle in Linnaeus zoologischen Werken, wo pragmatische Erwägungen
gegenüber philosophischen Prinzipien die Oberhand behielten (siehe auch Winsor, 1976 a).
Buffon
Das 18. Jahrhundert war das große Zeitalter der Naturgeschichte. Es war Zeuge der heroischen Seereisen
von Kapitän Cook, von Bougainville und Comerson (Stresemann, 1949). Das neu auflebende Interesse an
der Natur kam nicht nur in den Schriften Rousseaus zum Ausdruck, sondern auch in den Werken der
Mehrheit der „philosophes" der Aufklärung. Es war das Jahrhundert der Naturalienkabinetts, die im Besitz
nicht nur von Königen und Fürsten waren, sondern auch von reichen Bürgern wie George Clifford (16851760) in Holland, Sir Hans Sloane (1660-1753) und Sir Joseph Banks (1743-1820) in England sowie
anderen in Frankreich und anderen europäischen Ländern^ [18]. Eine Ambition solcher Mäzene der
Naturgeschichte war die Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Katalogs ihrer Sammlungen.
Bücher über die Natur wurden zunehmend populär, aber keines hatte einen solch spektakulären Erfolg
wie Buffons Histoire naturelle. Obgleich dieses Werk sich, wie Linnaeus' taxonomische Abhandlungen,
mit der Vielgestaltigkeit der Natur befaßte, war doch Buffons Methodik grundlegend anders. An einer
Identifikation von Exemplaren lag ihm herzlich wenig, er wollte vielmehr lebensvolle Bilder der
verschiedenen Tiersorten zeichnen. Die Pedanterie der Scholastiker und Humanisten lehnte er ab und
wollte mit ihrer Betonung logischer Kategorien, Essenzen und Diskontinuitäten nichts zu tun haben. Er
neigte eher dazu, Ideen zu bevorzugen, wie sie von Leibniz verbreitet wurden, bei denen das
Schwergewicht auf Lückenlosigkeit sowie Kontinuität, ferner auch auf dem aristotelischen Konzept der
Stufenleiter der Vervollkommnung lag. In Buffons Augen war dies eine weit überlegenere Sicht der Natur
als die staubtrockene Kategorieneinteilung der „nomenclateurs", wie er Linnaeus und seine Schüler
verächtlich nannte. Das Studium Newtons führte ihn in die gleiche Richtung. Zeigte nicht das Gesetz der
Schwerkraft und die anderen physikalischen Gesetze, daß es eine von allgemeinen Gesetzen bewirkte
Einheit in der Natur gab? Warum diese Einheit zerschneiden und zerstören, indem man sie in Arten,
Gattungen und Klassen zerteilte? Die Natur kennt keine Arten, Gattungen und anderen Kategorien; sie
kennt nur Individuen, erklärte er 1749 im ersten Band seiner Histoire naturelle, alles ist Kontinuität (aber
bereits 1749 schloß er Arten von dieser summarischen Behauptung aus). Buffons erste Liebe war die
Physik und Mathematik gewesen, und obwohl er vorher schon etwas mit Naturgeschichte vertraut gewesen
war, erwachte erst nach seiner Ernennung zum Direktor des Jardin du Roi (heute Jardin des Plantes) im
Jahr 1739, mit 32 Jahren, sein lebhaftes Interesse an der Mannigfaltigkeit der organischen Welt.
Buffon und Linnaeus wurden 1707 geboren; die beiden Männer hätten nicht gegensätzlicher sein
können. Das galt zunächst auch für ihre Schüler. Die Anhänger von Linnaeus betonten alle jene Aspekte
des taxonomischen Verfahrens, die die Identifikation erleichterten, wohingegen Buffon und die
französische Schule ihre Aufmerksamkeit vordringlich auf das Verstehen der organismischen
Vielgestaltigkeit konzentrierten. Die Linnaeus-Schüler unterstrichen Diskontinuität, Buffon dagegen
Kontinuität. Linnaeus vertrat die platonische Philosophie und thomistische Logik, während Buffon von
Newton, Leibniz und dem Nominalismus beeinflußt war. Linnaeus konzentrierte sich auf „essentielle"
Merkmale, recht oft auf ein einzelnes entscheidendes Merkmal, da, wie er behauptete, die Beschäftigung
mit beschreibenden Details das Erkennen der essentiellen Merkmale verhindern würde. Buffon dagegen
bestand darauf, daß wir „alle Teile des Objekts benutzen müssen, das wir studieren", einschließlich seiner
inneren Anatomie, seines Verhaltens und seiner Verbreitung.
Für die Darstellung der Säugetiere war Buffons Methode hervorragend geeignet, sie war lediglich eine
Fortsetzung der Tradition früherer Klassifikatoren (etwa Gesner). Die Zahl der Säugetierarten war begrenzt
und die Identifikation selten ein Problem. Nur Botaniker, wie Ray und Linnaeus, hatten die Prinzipien der
Logik auf die Klassifikation von Tieren angewandt. Als Buffon Säugetiere in Haustiere und wildlebende
Tiere unterteilte, rechtfertigte er diese Aufteilung damit, daß sie „die natürlichste sei". Für ihn bedeutete
„natürlich" dasselbe wie praktisch, und nicht „die Essenz ausdrückend", wie für Linnaeus [19].
Etwa um 1749 begannen sich Buffons Ansichten zu wandeln und das schließlich um so mehr, je mehr
seine Kenntnis von Organismen zunahm (Roger, 1963, S.566). Während er etwa 1749 noch radikal an der
Möglichkeit irgendeiner Klassifikation lebender Organismen zweifelte, gab er bereits 1755 zu, daß es
verwandte Arten gäbe. 1758 machte er sich noch über die Idee von Gattungen lustig, aber 1761 akzeptierte
er sie als Erleichterung bei der schwierigen Aufzählung der „kleinsten Objekte der Natur", und etwa 1770
schließlich macht er die Gattung zur Grundlage seiner Klassifikation der Vögel, wahrscheinlich noch mit
dem inneren Vorbehalt, sie sei willkürlich. Obgleich er eine gemeinsame Abstammung von
Haustier„gattungen" zugesteht, waren das natürlich nur biologische Arten. Darüber hinaus machte er sich
von 1761 an das Konzept der Familie zu eigen. Allerdings darf man nicht vergessen, daß Buffon niemals
den Versuch machte, das ganze Tier- und Pflanzenreich zu klassifizieren. In der Tat besteht seine Histoire
naturelle zum großen Teil aus Monographien einzelner Säugetierarten. Diese sind sowohl literarisch als
auch wissenschaftlich hervorragend und hatten einen enormen Einfluß auf die Ausbildung junger
Zoologen. Doch war das kein Material, das als Fundament für die Entwicklung einer allgemeinen Theorie
der Systematik dienen konnte – etwas, woran Buffon einfach nicht interessiert war.
Wenn auch von entgegengesetzten Polen ausgehend, näherten sich Linnaeus und Buffon mit dem
Fortschreiten ihrer Arbeit in ihren Vorstellungen zunehmend einander an. Linnaeus liberalisierte seine
Vorstellungen über die Unveränderlichkeit der Arten, und Buffon gestand (entgegen den Ansichten der
Nominalisten) zu, daß es möglich sei, Arten nichtwillkürlich als Fortpflanzungsgemeinschaften zu
definieren (Hist. nat. 1753, IV, S. 384-386). Allerdings übernahm Buffon niemals Linnaeius' Ansichten
über das Wesen der Gattung, d. h. die Vorstellung, daß sie die objektivste aller Kategorien sei. Zudem
waren seine Kriterien für die Anerkennung höherer Taxa völlig anders als die, die Linnaeus zu benutzen
behauptete (Gesamtheit aller charakteristischen äußerlich erkennbaren Merkmale gegenüber einzelnen
unterscheidenden Merkmalen als Ausdruck der Essenz).
Gegen Ende ihres Lebens, etwa in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts, unterschieden sich die
taxonomischen Methoden von Linnaeus und Buffon so wenig, daß bei ihren Schülern die beiden
Traditionen miteinander verschmolzen. Lamarck, ein Schützling Buffons, erklärte noch laut und
entschieden, Kategorien existierten nicht, sondern nur Individuen, sobald er aber sein Glaubensbekenntnis
zu Protokoll gegeben hatte, maß er ihm in seinen taxonomischen Werken keine große Bedeutung mehr bei.
Das gleiche gilt für Lacepede. Bei Cuvier schließlich ist die Buffonsche nominalistische Tradition nicht
mehr erkennbar.
Ein Neubeginn in der Tierklassifikation
Im 17. und 18. Jahrhundert machte die Tierklassifikation geringe Fortschritte. Ja, die linnaeische
Klassifikation der Wirbellosen war ein Rückschritt gegenüber der des Aristoteles. All dies änderte sich
über Nacht, 1795, mit der Veröffentlichung von George Cuviers Makrotaxonomie, die Wissenschaft der
Klassifikation 147
(1769-1832) Memoire sur la structure interne et externe, et sur les affinites des animaux auxquels on a
donné le nom des vers[20]. Das von Linnaeus unter dem Namen Würmer anerkannte Taxon, das alles
mögliche enthielt, wurde von Cuvier in sechs neue Klassen gleichen Ranges unterteilt: Mollusken,
Crustaceen, Insekten, Würmer, Stachelhäuter und Zoophyten. Siebzehn Jahre später beraubte er die
Wirbeltiere ihrer bevorzugten Stellung, indem er einige Wirbellose zum gleichen Rang erhob und alle
Tiere in vier Stämme („embranchements") einordnete: Wirbeltiere, Mollusken, Arthropoden und Radiata
(Cuvier, 1812). Innerhalb dieser höchsten Taxa erkannte er eine Reihe neuer Klassen, Ordnungen und
Familien an, die bis dahin zusammengeworfen oder völlig übersehen worden waren. Die Mollusken und
Testazeen von Linnaeus faßte er zur Klasse der Mollusca zusammen. Qualle (Medusa) und Seeanemone
(Actinia) nahm er aus der Gruppe der Mollusken heraus und ordnete sie unter den Zoophyten ein.
Das Wichtigste an Cuviers Beitrag zur Tierklassifikation war seine Entdeckung des großen
Informationsgehalts der inneren Anatomie der Wirbellosen. Beim Sezieren zahlreicher Wassertiere fand er
eine Fülle neuer Merkmale und neuer Organisationstypen. Dies begründete die große Tradition der
vergleichenden Zoologie der Wirbellosen. Seine Befunde ließen ihn als ersten eine Reihe von Taxa
erkennen, die heute noch als gültig angesehen werden.
Äußerst bemerkenswert an Cuviers gewaltigem Beitrag ist, daß er sich zwar auf ein sorgfältig
ausgearbeitetes System von Begriffen und Gesetzen gründet, begrifflich jedoch kein Fortschritt gegenüber
den Prinzipien der aristotelischen Logik war. Wieder liegt der Nachdruck auf einer Abwärtsklassifikation
durch Teilung, und immer noch sucht er nach der Essenz, der wahren Natur jeder Gruppe, und Merkmale
werden immer noch auf der Grundlage ihrer funktionalen Bedeutung bewertet. Dennoch führte Cuvier eine
Reihe von Neuerungen ein.
Cuvier und die Korrelation von Merkmalen
Cuvier meinte, bestimmte physiologische Systeme seien von solch großer Bedeutung, daß sie die
Ausprägung aller anderen Merkmale steuerten. Dies war ein neues Konzept, ein neuer Ausgangspunkt. Die
Taxonomen vor Cuvier waren im ganzen gesehen so vorgegangen, als sei jedes einzelne Merkmal von
jedem anderen unabhängig und als besäße jeder Organismus mit einem anderen Merkmal eine andere
Essenz. Buffon war als erster mit diesem atomistischen Ansatz nicht einverstanden. Ein Organismus war
kein willkürliches Gemisch von Merkmalen, wie man aus den Schriften der Linnaeus-Anhänger entnehmen
mochte; die Zusammenstellung der Merkmale war vielmehr durch deren „Korrelation" diktiert. Cuvier
verarbeitete Buffons recht allgemeine Vorstellungen zu einem konkreten Prinzip, dem Prinzip der
Korrelation von Teilen (siehe Kap. 8): Die verschiedenen Teile eines Organismus sind in solchem Maße
wechselseitig voneinander abhängig, daß ein Anatom aus dem Zahn eines paarzehigen Huftiers sofort auf
die vermutliche Struktur anderer Teile der Anatomie dieses Tieres schließen kann. Alle Funktionen eines
Organismus sind wechselseitig voneinander abhängig, und zwar so eng.f daß sie nicht unabhängig von
anderen variieren können:
„In dieser gegenseitigen Abhängigkeit der Verrichtungen, und dieser Hülfe, die sie sich abwechselnd
leisten, sind die Gesetze gegründet, welche die Verhältnisse ihrer i Organe bestimmen, und welche mit den
metaphysischen und mathematischen Gesetzen von gleicher Notwendigkeit sind. Denn es ist ausgemacht,
daß die gehörige Harmonie zwischen den Organen, welche aufeinander wirken, eine notwendige
Bedingung des Daseyns des Wesens ist, welchem sie angehören und daß, wenn eine dieser Verrichtungen
auf eine Art eingerichtet wäre, die mit den Einrichtungen der anderen nicht bestehen könnte, das Wesen
würde nicht existieren können." (Lecons d'anatomie comparée, 1800, S.51; zit. nach der dt. Ausg. Erste
Vorlesung: Thierische Oeconomie, 4. Abschn., S.58).
Seit Cuvier das Prinzip der korrelierten Variation proklamierte, haben es erfahrene Taxonomen als einen
der wichtigsten Anhaltspunkte für die Bewertung von Merkmalen benutzt. Es kann ad hocSpezialisierungen im Zusammenhang mit der Besetzung spezieller adaptiver Zonen anzeigen, ebenso aber
fest verwurzelte genetische Integration, wie sie in der Merkmalskonstanz in höheren Taxa zum Ausdruck
kommt. Anscheinend der erste, der die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung einer derartigen Konstanz
lenkte, war Lamarck in seinem Werk Flore Frangoise (1778), gefolgt kurz darauf von Jussieu. Cuvier
jedoch ging weiter; statt lediglich die Aufmerksamkeit auf eine Korrelation von Teilen zu lenken, besaß er
ein differenziertes System der Gewichtung von Merkmalen: sein Prinzip des abgestuften Ranges der
Merkmale (siehe unten).
In seiner Betrachtungsweise unterscheidet sich Cuvier von Linnaeus darin, daß es ihm tatsächlich um die
Klassifikation und ihre Prinzipiell geht, und nicht um ein Identifikationsschema. In seinem Memoire (1795)
macht er sich, wie Reaumur vor ihm, nicht einmal die Mühe, Gattungen oder Arten zu beschreiben. Sein
eigentliches Ziel brachte er mit folgenden Worten zum Ausdruck:
„Kurz gesagt, ich habe dieses Essay über die Aufteilung nicht zu dem Zweck vorgelegt, daß es als
Ausgangspunkt für die Bestimmung des Namens von Arten dient; dafür wäre ein künstliches System
leichter, und das ist auch richtig. Mein Ziel war es, die Natur und die wahren Verwandtschaftsbeziehungen
der animaux a sang blanc [Wirbellose] besser bekannt zu machen, indem ich das, was über ihre Struktur
und allgemeine Eigenschaften bekannt ist, auf allgemeine Prinzipien reduziere."
Lamarck
So groß der Unterschied im Philosophischen zwischen Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) und Cuvier
auch war, ihre Beiträge zur Klassifikation waren bemerkenswert ähnlich (Burkhardt, 1977). Auch Lamarck
führte zahlreiche wertvolle Neuerungen in der Klassifikation der Wirbellosen ein und befaßte sich mit
Problemen wie der Stellung der Rankenfüßer und Manteltiere oder der Anerkennung der Spinnentiere und
Anneliden als eigene Taxa. In der Tat lieferte Lamarck, von den Protozoen bis zu den Mollusken,
zahlreiche Beiträge zur Taxonomie; seine Theorie der Klassifikation war jedoch ebenso konventionell wie
die Cuviers. Lamarck begann in dem Glauben, die Tierwelt sei eine einzige Reihe, beginnend bei den
einfachsten Infusorien und im Menschen gipfelnd. Demzufolge versuchte er jedes höhere Taxon nach
seinem jeweiligen „Vervollkommnungsgrad" einzustufen. Später gab er seine Vorstellung von einer
einzigen scala naturae immer mehr auf, zum Teil unter dem Einfluß Cuviers, der diese Rangfolge durch
vier embranchements (Stämme) ersetzt hatte, zum Teil auch aufgrund eigener vergleichender Studien.
Zunächst gab er lediglich zu, es gäbe Arten und Gattungen, die infolge der „Macht der Umstände" von der
geraden Linie abwichen, schließlich aber räumt er ein, daß sich die „masses" (höheren Taxa) verzweigten,
und seine schließliche Darstellung der Verwandtschaftsbeziehungen unter den Tieren (1815) unterscheidet
sich im Prinzip nicht von einem phylogenetischen baumartigen Diagramm, wie man es Ende des 19.
Jahrhunderts in der Literatur erwarten würde. Wiederholt betonte Lamarck, wie wichtig seiner Ansicht
nach die Tätigkeit der Klassifikation sei, da „das Studium von Ähnlichkeiten (affinities)… heute als
Hauptinstrument für den Fortschritt der Naturwissenschaft angesehen werden sollte".
Taxonomische Merkmale
Klassifikation ist das Ordnen von Taxa auf der Grundlage ihrer Ähnlichkeit und
Verwandtschaftsbeziehungen, die durch ihre taxonomischen Merkmale bestimmt oder aus ihnen abgeleitet
werden. Diese Definition zeigt die entscheidende Bedeutung taxonomischer Merkmale für die Erstellung
von Klassifikationen. Von den Anfängen der Geschichte der Taxonomie bis heute gehen jedoch die
Meinungen darüber auseinander, welche Merkmale für taxonomische Analysen die brauchbarsten, ja,
welche überhaupt gerechtfertigt sind. Die Geschichte der Klassifikation ist zum großen Teil eine
Geschichte der Auseinandersetzungen über diesen Punkt. Die Griechen waren sich völlig dessen bewußt,
daß nützliche, z. B. heilende Eigenschaften oder das Vorhandensein von Stacheln wenig mit anderen,
anscheinend tiefer verwurzelten Eigenschaften einer Pflanze zu tun haben. Auch die Essentialisten, deren
Klassifikation auf logischer Zweiteilung beruhte, waren davon überzeugt, daß einige Merkmale
bedeutsamer waren als andere. Zwar war ihre Terminologie der essentiellen und akzidentiellen Merkmale
durch das scholastische Dogma belastet, doch waren sie einer Wahrheit auf der Spur, die erst Jahrhunderte
später begriffen werden sollte. Seit Cesalpino erkannte man allgemein an, daß nichtmorphologische
Merkmale, wie das Verhältnis zum Menschen (angebaut gegenüber wildwachsend), saisonabhängiges
Erscheinungsbild (laubabwerfend gegenüber immergrün) oder Standort, für die Aufstellung nützlicher
Klassifikationen weniger geeignet waren als Strukturmerkmale. Infolgedessen hat die Verwendung von
Strukturmerkmalen seit dem 16. Jahrhundert im Vordergrund gestanden.
Von Cesalpino bis heute hat es drei große Kontroversen um die taxonomischen Merkmale gegeben: (1)
Sollte man nur ein einziges Schlüsselmerkmal (fundamentum divisionis) oder mehrere („alle nur
möglichen") Merkmale benutzen? (2) Sollten nur morphologische Merkmale oder auch ökologische,
physiologische und Verhaltensmerkmale zugelassen werden? (3) Sollten Merkmale „gewichtet" werden
oder nicht – und wenn, anhand welcher Kriterien?
Schon Aristoteles hatte festgestellt, daß einige Merkmale für die Abgrenzung von Tiergruppen
brauchbarer seien als andere, und in der gesamten Geschichte der Taxonomie stimmten nur sehr wenige
Autoren dieser Feststellung nicht zu. (Zu den wenigen Ausnahmen gehören die numerischen Phänetiker
[siehe unten] in einigen ihrer früheren Schriften [Sokal und Sneath, 1963]. Sie treten für eine gleiche
Bewertung aller Merkmale ein.) Die Frage hieß also nicht: gewichten oder nicht, es ging vielmehr um zwei
andere Probleme: Welche Prinzipien sollte man der Bewertung eines Merkmals zugrundelegen? Und: Wie
sollte man eine Bewertungsskala in eine Klassifikation umsetzen? Zu bedenken ist: Ein Verfasser kann ein
von einem anderen Verfasser benutztes spezielles Bewertungskriterium ablehnen; das muß aber nicht
bedeuten, daß er die Methode der Bewertung als solche ablehnt. Buffon und Adanson traten für die
Benutzung von „so vielen Merkmalen wie möglich" ein, sie schlugen aber keineswegs eine gleichmäßige
Gewichtung aller Merkmale vor.
Solange Klassifikationen im Grunde Identifikationsschlüssel waren, erforderten sie zwangsläufig, daß
man sich auf einzelne Merkmale stützte. Es spielte keine Rolle, ob die mit diesem Verfahren erzielten
Gruppen heterogen waren, solange der Zweck der Identifikation erreicht werden konnte. Erfahrene
Botaniker wußten, daß kein Teil einer Pflanze mehr und bessere diagnostische Züge besaß als der
„Fruchtstand" (Blüten, Früchte und Samen). Ein besonderer Vorteil dieses strukturellen Systems ist seine
große Zahl quantifizierbarer Merkmale, etwa die Zahl der Blütenblätter, Staubgefäße und Stempel. Blüten
hatten den zusätzlichen Vorteil, daß sie innerhalb einer Art wenig variieren (im Vergleich zu den meisten
Aspekten der Belaubung) und dennoch aus einem reichen Sortiment variabler Teile zusammengesetzt sind,
die artspezifische Unterschiede aufweisen. Niemand wies mit mehr Fleiß und Erfolg auf solche
Unterschiede hin als Linnaeus, wenngleich einige seiner Zeitgenossen ihn dafür verwünschten, daß er
Merkmale benutzte, die nur mit Hilfe einer Handlupe zu sehen waren.
Kein Essentialist hätte zugegeben, daß er den Fruchtstand wegen seiner praktischen Vorteile benutzte.
Stattdessen konstruierten sie einen komplizierten Mythos, an den sie anscheinend selbst glaubten;
bestimmte Aspekte einer Pflanze waren irgendwie wichtiger als andere und brachten somit die Essenz
besser zum Ausdruck. Cesalpino stufte Ernährung wie auch das Resultat der Ernährung (Wachstum) am
höchsten ein, während er der Fortpflanzung (verkörpert im Fruchtstand) den zweithöchsten Rang zuwies:
Da das Vorsorgen für den Fortbestand einer Pflanze in der nächsten Generation der zweitwichtigste
Anhaltspunkt für die Essenz ist, sind alle Aspekte der Fruchtbildung (Blüten und Samen) die
zweitwichtigsten Merkmale. Im Unterschied zu Cesalpino schätzte Linnaeus den Fruchtstand höher eiri als
das Wachstum, und er stellte ganz einfach fest (Phil. Bot., These 88), „die Essenz der Pflanze besteht aus
ihrem Fruchtstand". Daß die Blüten wegen ihrer Nützlichkeit und nicht so sehr aus philosophischen
Gründen ausgewählt wurden, läßt sich am besten damit beweisen, daß sie auch heute bei
Identifikationsschlüsseln an hervorragender Stelle benutzt werden, obgleich das Argument ihrer
„funktionalen Bedeutung" schon vor zweihundert Jahren ad acta gelegt wurde.
Gewiß waren sich die Botaniker von Gesner (1567) und Cesalpino (1583) bis zu Linnaeus alle über die
Bedeutung des Fruchtstandes einig, doch ließ dies wegen der Vielzahl der Merkmale, die mit der
Fruchtbildung zu tun haben, immer noch einen großen Entscheidungsspielraum. Verschiedene Botaniker
wählten unterschiedliche Merkmale für ihre erste Unterteilung aus: Tournefort und Rivinus die
Blütenkrone, Magnol den Blütenkelch, Boerhave die Frucht, Siegesbeck die Samen und Linnaeus
Staubgefäße und Stempel. Es wäre schwierig gewesen, diese Komponenten des Fruchtstandes rangmäßig
nach ihrer funktionalen Bedeutung einzuordnen. Infolgedessen spalteten sich die vorlinnaeischen Botaniker
weitgehend nach Nationalitäten. Die Engländer folgten Ray, die Deutschen Rivinus (Bachmann) und die
Franzosen Tournefort. Da Identifikation das Hauptziel war, wurde Tourneforts System, das einfacher,
präziser und leichter zu merken war als die beiden anderen, von immer mehr Botanikern übernommen, bis
es durch das sogar noch praktischere linnaeische Sexualsystem ersetzt wurde.
Als während des 17. und 18. Jahrhunderts die Zahl der bekannten Tiere rapide anwuchs, wurden immer
häufiger morphologische Merkmale benutzt, aber kein Zoologe hatte jenes brennende Interesse an der
Methodik wie die zeitgenössischen Botaniker. Immer noch gab man häufig ökologischen Kriterien den
Vorzug, vor allem bei Gruppen, die keine Wirbeltiere waren. Vallisnieri (1713) zum Beispiel unterteilte die
Insekten in vier Hauptgruppen: solche, die auf Pflanzen wohnen; solche, die im Wasser wohnen
(einschließlich Crustaceen); solche, die auf Felsgestein und im Boden wohnen; und solche, die in oder auf
Tieren leben. Wurden doch einmal morphologische Merkmale verwandt, so waren sie häufig schlecht
gewählt, zum Beispiel als Linnaeus die fischförmigen Wale unter die Fische einordnete oder als er die
Mehrheit der Wirbellosen als Würmer (Vermes) zusammenfaßte.
Cuviers Prinzip des abgestuften Ranges von Merkmalen – verschiedene Teile in einem Organismus
haben unterschiedliche taxonomische Werte -, war ein Gewichtungssystem. In seinen früheren Arbeiten
(vor etwa 1805) nahmen die Ernährungsorgane und insbesondere die Organe des Blutkreislaufs die erste
Stelle unter den Schlüsselmerkmalen seiner höheren Taxa ein. Um 1807 jedoch war dem Nervensystem
schließlich der Rang des Spitzenmerkmals zuerkannt worden, und es spielte nunmehr die wichtigste Rolle
bei Abgrenzung und Einstufung der vier embranchements (Coleman, 1964). Auf der Ebene der niedrigeren
Kategorien maß Cuvier häufig dem gleichen Merkmal bei verschiedenen Tiergruppen unterschiedliches
Gewicht zu. Zum Beispiel definieren Zahnmerkmale bei den Säugetieren Ordnungen, bei den Reptilien
Gattungen, bei den Fischen aber nur Arten. Die Struktur der Füße, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hat
für Säugetiere den Wert eines Ordnungsmerkmals, da Füße ihr Hauptfortbewegungsinstrument sind,
wohingegen sie bei Vögeln, wo die Flügel von hervorragender Bedeutung sind, einen viel geringeren Wert
als taxonomisches Merkmal hat. Nichtsdestoweniger war Cuvier der Ansicht, daß bestimmte Merkmale mit
einem bestimmten Rang in der Hierarchie der Kategorien assoziiert seien. Sein Prinzip des abgestuften
Ranges von Merkmalen ist offenkundig mehr oder weniger nichts anderes als das a prioriBewertungssystem der Botaniker, außer daß bei den Tieren, in traditionell aristotelischer Manier, das
„Empfindungsvermögen" den höchsten Rang einnimmt, weswegen die primären Merkmale vom
Nervensystem abgeleitet sind. Zwar revolutionierte Cuvier die Klassifikation der Wirbellosen, doch tat er
das nicht durch die Einführung neuer Begriffe, sondern vielmehr dadurch, daß er einen ganzen neuen
Komplex von Merkmalen einführte, nämlich der Merkmale der inneren Anatomie.
Eine zweite Revolution in der Verwendung von Tiermerkmalen, die ebenfalls nichts mit neuen
Begriffen zu tun hat, war das Resultat technischen Fortschritts, der Erfindung des Mikroskops. Die
Einführung optischer Instrumente in die Erforschung der Naturgeschichte (etwa 1673) durch van
Leeuwenhoek war eine Innovation, deren volle Auswirkung auch heute noch nicht völlig erschöpft ist (wie
die vor kurzem mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops erzielten Entdeckungen erkennen lassen). Sogar
Staubgefäße und Stempel, die Schlüsselmerkmale im Linnaeischen System, sind am besten in
Vergrößerung zu sehen. Das Studium der Skulptur der Deckflügel von Käfern oder der Fühler, des Geäders
der Flügel und des Genitalapparats aller Insekten erfordert zumindest ein Vergrößerungsglas; für die
Erforschung der im Wasser lebenden Wirbellosen, der Algen, Protozoen und anderen Protisten ist ein
Mikroskop unerläßlich.
Die Forschung mit dem Mikroskop nahm nach den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts rasch zu. Die
sorgfältige histologische Untersuchung von Lebewesen aller Größen führte zur Entdeckung taxonomisch
wichtiger Sinnesorgane, Drüsen, akzessorischer Strukturen des Fortpflanzungs- und Verdauungssystems,
und unbekannter Einzelheiten des Nervensystems. Später kamen gänzlich neuartige Merkmale
(beispielsweise chromosomale und biochemische Unterschiede) hinzu, ebenfalls dank des technologischen
Fortschritts. Zwar schien die Zahl der dem Taxonomen zur Verfügung stehenden Merkmale rasend schnell
zuzunehmen, doch reichten die neuen Informationen nicht aus, um wichtige Kontroversen über
Verwandtschaftsbeziehungen aus der Welt zu schaffen.
Das Dogma, daß ein besonderer Typ von Merkmalen als Grundlage der Klassifikation am besten
geeignet sei, wurde bereits zu Linnaeus' Lebenszeit heftig angegriffen. Doch wurde nicht so sehr das
Prinzip des Gewichtens an sich abgelehnt, es waren vielmehr die Überlegungen, anhand derer die
Gewichtung vorgenommen werden sollte. Zuerst war, wie oben beschrieben, die funktionale Bedeutung als
einziges, die taxonomische Brauchbarkeit bestimmendes Gewichtungskriterium zugelassen. Zu gegebener
Zeit wurden jedoch völlig neue Bewertungskriterien vorgeschlagen. Lamarck, Cuvier und de Jussieu
betonten die Bedeutung „konstanter" Merkmale. De Candolle legte besonderes Gewicht auf Symmetrien,
die bei Pflanzen in der Tat häufig für Gattungen und ganze Familien charakteristisch sind. Solche
Symmetrien finden sich bei den Blüten, den Blattständen und anderen Pflanzenmerkrnalen.
Polythetische Taxa
Die Gattung (auf jeder Ebene) wird für den Essentialisten repräsentiert durch die Gesamtheit aller „Arten"
(d.h. untergeordneten Taxa) mit gemeinsamer Essenz, oder, wie es später von Taxonomen ausgedrückt
wurde, durch die Arten mit bestimmten gemeinsamen „Merkmalen". Seit den ersten Anfangen der
Klassifikation entstanden erhebliche Schwierigkeiten durch Individuen oder Arten, denen das eine oder
andere für das Taxon „typische" (d. h. essentielle) Merkmal fehlte. Pedanten pflegten solche Arten in
verschiedene Gattungen einzuordnen; die erfahreneren Taxonomen, wie etwa Linnaeus, übersahen die
Diskrepanz einfach. Ja, es wurden höhere Taxa gefunden, die nur durch eine Kombination von Merkmalen
zuverlässig definiert werden konnten, von denen jedes auch außerhalb des betreffenden Taxon auftreten
oder gelegentlich bei einem Vertreter des Taxon fehlen konnte. In derartigen Fällen ist eine einzelne
Besonderheit für die Zugehörigkeit zu einem solchen Taxon weder notwendig noch ausreichend.
Obgleich dies in einigen Aussagen von Ray bereits implizite enthalten ist, scheint Adanson der erste
gewesen zu sein, der das deutlich erkannte. Vicq-d'Azyr (1786) stellte fest, daß „eine Gruppe völlig
natürlich sein und doch kein einziges Merkmal haben kann, das allen Arten, aus denen sie sich
zusammensetzt, gemeinsam ist". Heincke (1898) zeigte, daß zwei Fischarten, Hering und Sprotte, sich in
acht strukturellen Merkmalen voneinander unterscheiden, daß aber nur zehn Prozent der Individuen in allen
diesen Merkmalen verschieden sind. Beckner (1959) erkannte dieses Prinzip als erster formal an, indem er
Taxa als „polytypisch" bezeichnete, die auf Merkmalskombinationen beruhen. Da jedoch der Terminus
„polytypisch" in der Taxonomie bereits in anderer Bedeutung benutzt wurde, ersetzte Sneath (1962) ihn
durch den Ausdruck polythetisch.
Die Kennzeichnung höherer Taxa durch polythetische Merkmalskombinationen war das endgültige
Ende einer essentialistischen Definition. Schon lange zuvor jedoch war das gesamte Konzept der
Schlüsselmerkmale, das für die Methode der logischen Zweiteilung notwendig war, heftig angegriffen
worden, und dies hatte, als die Zeit dafür reif war, zu einem völlig neuen Konzept der Klassifikation
geführt.
Aufwärtsklassifikation durch empirische Gruppierung
Als die europäischen Botaniker und Zoologen von der Lawine neuer Gattungen und Familien aus den
Tropen überschwemmt wurden, erwies sich die Abwärtsklassifikation auf der Grundlage aristotelischer
Logik, also die Methode von Cesalpino bis Linnaeus, als mehr und mehr unzureichend. Man hatte erwartet,
daß die dichotomische Zweiteilung zwei Zwecke erfüllte: daß sie die Ordnung der Natur (den Bauplan der
Schöpfung) enthülle, und zugleich einen geeigneten Identifikationsschlüssel abgäbe. Die Praxis zeigte
jedoch, daß diese beiden Ziele miteinander unvereinbar waren und daß eine konsequente Anwendung der
Prinzipien des logischen Systems in der Regel zu absurden Resultaten führte. Eine rückblickende Analyse
dieser Klassifikationstheorie zeigt, daß sie zumindest drei grundlegende Schwächen aufwies:
1. Ist lediglich eine begrenzte Fauna oder Flora zu klassifizieren, so genügt ein Identifikationssystem,
wie es die logische Zweiteilung liefern kann. Doch lassen sich mit dieser Methode keine „natürlichen"
Gruppen von Arten und Gattungen bilden, wie man sie für die Klassifikation sehr großer Faunen und
Floren benötigt.
2. Bei jedem Schritt kann nur ein einziges Merkmal benutzt werden. Die Auswahl dieses Merkmals
wurde von seiner angeblichen Fähigkeit bestimmt, die Essenz der „Gattung" zu offenbaren. Jedoch ist die
These, bestimmte Merkmale (zum Beispiel jene mit größerer funktionaler Bedeutung) seien besser
geeignet, die Essenz eines Taxon zu enthüllen als andere, weder theoretisch noch praktisch gerechtfertigt.
Damit verliert das ganze System der Bewertung von Merkmalen nach ihrer vermutlichen funktionalen
Wichtigkeit seine Gültigkeit.
3. Die ganze Philosophie des Essentialismus, auf dem die Methode der logischen Zweiteilung beruhte,
ist ungültig und daher als Grundlage einer Klassifikationstheorie ungeeignet.
Die drastische Umwälzung im philosophischen Denken des 17. und 18. Jahrhunderts konnte nicht ohne
Einfluß auf das Denken der klassifizierenden Naturforscher bleiben. Eine Reihe von Historikern hat es als
faszinierende Herausforderung empfunden, festzustellen, welch relativen Einfluß die wissenschaftliche
Revolution und die Aufklärung, die philosophischen Vorstellungen Lockes mit ihrer Betonung des
Nominalismus und Empirizismus, die Philosophie Kants und die Ideen Newtons und Leibniz' mit ihrem
Schwergewicht auf der Kontinuität, auf das Denken von Buffon, Linnaeus und ihre Schulen hatten. Daß
Buffon sich über die „nomenclateurs" (womit er die Linnaeus-Anhänger meinte) lustig machte, war eine
der Manifestationen dieser philosophischen Einflüsse.
Nimmt man jedoch die taxonomischen Arbeiten des 18. Jahrhunderts genau unter die Lupe, so wird
deutlich, daß rein praktische Überlegungen eine große, wenn nicht sogar die dominierende Rolle bei der
Gestaltung taxonomischer Konzepte spielten. Die praktischen Schwierigkeiten einer Abwärtsklassifikation
wurden mit jedem Tag deutlicher. Welche Gültigkeit hatte eine Methode, die sogar den großen Linnaeus
zwangen, zu „mogeln" und seine Arten sozusagen „unter dem Tisch" zu sortieren, weil die aristotelische
Logik versagte? Wie sollten seine weniger erfahrenen Anhänger verhindern, daß sie zu völlig absurden
Klassifikationen gelangten? Man versteht die grundlegenden Veränderungen in der taxonomischen Theorie
zwischen 1750 und 1850 nicht, wenn man nicht gleichzeitig fragt, welche neuen Anforderungen an die
taxonomische Praxis gestellt wurden, und sich klar macht, daß die philosophischen Fundamente der
Abwärtsklassifikation allmählich am Einbrechen waren.
Mit der Zeit wurde klar, daß es nutzlos war, die von oben nach unten erfolgende, aufgliedernde
Klassifikation retten zu wollen, indem man sie abänderte, und daß der einzige Ausweg war, sie durch eine
ganz andere Methode zu ersetzen: die aufwärtsgerichtete oder aufbauende Klassifikation. Bei diesem
Verfahren beginnt man unten, sortiert ähnliche Arten in Gruppen und faßt diese Gruppierungen wiederum
in einer Hierarchie höherer Taxa zusammen. Die Methode ist, zumindest im Prinzip, rein empirisch.
Ungeachtet einiger Kontroversen (siehe unten), ist dies im großen und ganzen der Ansatz, der wenigstens
in den Anfangsphasen des Klassifizierungsverfahrens – heute von jedem modernen Taxonomen angewandt
wird.
Als sich die Klassifikation durch genaues Betrachten und Gruppieren (statt durch Teilung) durchsetzte,
bedeutete dies eine totale methodische Revolution. Nicht nur, daß die Klassifizierungsschritte nunmehr in
umgekehrter Richtung erfolgten, man gab es auch auf, sich auf ein einziges Merkmal (fundamentum
divisionis) zu stützen, und ersetzte dieses Vorgehen durch die Verwendung und gleichzeitige Betrachtung
zahlreicher Merkmale oder, wie einige der Verfechter der Aufwärtsklassifikation verlangten, „aller
Merkmale".
Obgleich beide Methoden begrifflich drastisch verschieden waren, wurde die aufgliedernde
Klassifikation im Zeitraum vom Ende des 17. bis zum 19. Jahrhundert derart allmählich durch eine
aufbauende Klassifikation substituiert, daß sich offenbar niemand völlig dessen bewußt war, daß dieser
Vorgang überhaupt stattfand.
Aus mehreren Gründen lief die Veränderung derart übergangslos ab. Erstens war die Methode des
Klassifizierens von Objekten durch „genaues Betrachten" natürlich keineswegs neu. Bereits Aristoteles
hatte seine höheren Taxa durch eine Merkmalskombination abgegrenzt. Wenn wir jemand auffordern
würden, einen Korb mit mehreren Obstsorten auseinanderzusortieren, so würde es ihm nicht schwerfallen,
diese durch „Betrachten" in Äpfel, Birnen und Apfelsinen zu unterteilen. Ein derartiges vorbereitendes
Sortieren wurde anscheinend von allen frühen Botanikern vorgenommen, sogar von jenen, die erklärte
Anhänger des logischen Systems waren. Bock und Bauhin gingen ganz offen in dieser Weise vor,
Cesalpino, Tournefort und Linnaeus im geheimen. Offenbar hatte die teilende Methode von Anfang an
gewisse Elemente zusammenordnender Klassifikation enthalten. (Umgekehrt blieben auch nach der
prinzipiellen Ablehnung der logischen Zweiteilung noch einige ihrer Elemente erhalten, da sie für die
Identifikation nützlich waren.)
Mehrere Voraussetzungen mußten erfüllt sein, bevor der Wechsel stattfinden konnte, aber bisher liegt
keine gründliche Analyse seiner Geschichte vor. Erstens ist eine Aufwärtsklassifikation nur möglich, wenn
man auch versteht, was man gruppiert das heißt Arten. Eine Voraussetzung für die zusammensetzende
Methode war daher eine Kenntnis der Arten, selbst wenn diese essentialistisch definiert waren. Die ersten
Kräuterkundler und andere Autoren vor Linnaeus, die gelegentlich alle Arten einer Gattung
zusammenwarfen oder Varianten wie vollwertige Arten behandelten, hätten mit der zusammensetzenden
Methode beträchtliche Schwierigkeiten gehabt. Die Entwicklung einer naturgeschichtlichen Tradition im
17. und 18. Jahrhundert leistete hier einen entscheidend wichtigen Beitrag (siehe Kap. 6). Die zweite
Voraussetzung war das Nachlassen des Einflusses des Essentialismus, wie schon oben beschrieben.
Drittens bildete sich, zum Teil infolge des Verfalls des Essentialismus, eine empirische Haltung aus; man
war mehr an Resultaten als an zugrundeliegenden Prinzipien interessiert.
In den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts leisteten drei Botaniker auf dem Gebiet des Einordnens von
Arten anhand von Merkmalskomplexen Pionierarbeit: Der britische Botaniker Morison benutzte eine
Vielfalt von Merkmalen; Ray stellte fest, daß es, um die richtigen Schlüsse über die Essenz einer Gattung
zu ziehen, „kein sichereres Zeichen und keinen besseren Beweis als den Besitz mehrerer gemeinsamer
Eigenschaften geben könne" (De Variis, 1696, S.13). 1703 wiederholte er diese Aussage: „Die beste
Anordnung von Pflanzen ist die, bei der alle Gattungen von der höchsten bis hinunter zu den
untergeordnetsten und niedrigsten mehrere gemeinsame Eigenschaften haben oder in mehreren Teilen oder
Akzidenzien übereinstimmen" (Meth. Plant, S.6-7).
Zu etwa der gleichen Zeit lehnte Magnol (1689) in Frankreich es ab, sich zur Abgrenzung höherer Taxa
der Methode der Teilung nach dem logischen System zu bedienen. Um zu Schlüssen über
Verwandtschaftsbeziehungen zu gelangen, benutzte er Merkmale aller Pflanzenteile, nicht nur des
Fruchtstandes. Bedeutsamer war jedoch, daß er ganz spezifisch die Bedeutung eines holistischen Ansatzes
hervorhob, das heißt des Gruppierens von Arten „durch genaues Betrachten": „Es gibt sogar bei
zahlreichen Pflanzen eine gewisse Ähnlichkeit, eine Verwandtschaft, die nicht in den einzelnen Teilen,
getrennt betrachtet, besteht, sondern in der Pflanze als Gesamtheit; eine wichtige Ähnlichkeit, die aber
nicht ausgedrückt werden kann" (Prodromus, 1689). Die besondere Bedeutung Magnols lag in seinem
großen Einfluß auf Adanson, dessen Gedankenwelt er formen half. Seine Weigerung, Merkmale in
essentielle und akzidentielle einzuordnen (wie es die Essentialisten verlangten), wurde zwar von Linnaeus
ignoriert, aber von Adanson und von der gesamten empirischen Schule übernommen.
Buffon (Oeuvr. Phil, 1749, S.13) unterstützte die Klassifikation durch genaues Betrachten recht
nachdrücklich: „Mir scheint, daß der einzige Weg, um zu einer instruktiven und natürlichen Methode zu
gelangen, darin besteht, Dinge, die einander ähnlich sehen, in einer Gruppe zusammenzufassen, und Dinge
voneinander zu trennen, die sich unterscheiden." Er betonte außerdem, man müsse alle Merkmale in
Betracht ziehen, und dieser Rat wurde von Merrem, Blumenbach, Dallas, Illiger, Meckel und anderen
Zoologen befolgt (Stresemann, 1975, S. 107).
Als erster Autor brachte Michael Adanson (1727-1806) den intellektuellen Mut auf, offen die Gültigkeit
der Methode der logischen Zweiteilung in Frage zu stellen. In seinem Werk Les familles naturelles des
plantes (1763) schlug er vor, diese Methode durch einen empirischen, induktiven Ansatz zu ersetzen, „da
die botanischen Methoden, die nur einen Teil oder nur eine kleine Zahl von Pflanzenteilen in Betracht
ziehen, willkürlich, hypothetisch und abstrakt sind. Sie können nicht natürlich sein… die einzige natürliche
Methode in der Botanik ist eine solche, die alle Teile der Pflanzen berücksichtigt… [und es ist dies die
Methode, mit der] wir die Verwandtschaft finden, die Pflanzen zusammenbringt und sie in Klassen und
Familien trennt." Adanson ging noch weiter und entwickelte eine wohldurchdachte Methode zum
Überprüfen taxonomischer Merkmale.
Adanson und die Verwendung multipler Merkmale
Die Ablehnung der Methode der logischen Teilung auf der Grundlage eines einzigen Merkmals warf neue
Probleme auf. Wenn die Abgrenzung von Gruppen anhand mehrerer Merkmale erfolgen soll, wie viele
Merkmale sollten denn dann benutzt werden, und sollte man bestimmten Merkmalen den Vorzug geben?
Adanson war der erste Botaniker, der diese Fragen systematisch erforschte. Um herauszufinden, welchen
Effekt die Auswahl von Merkmalen auf die Klassifikation haben würde, nahm er versuchsweise 65
künstliche Pflanzengruppierungen vor, deren jede durch ein spezielles Merkmal gekennzeichnet war, etwa
die Form der Blütenkrone, Position der Samen, oder das Vorhandensein von Dornen. Diese Reihen
bewiesen ihm, daß es unmöglich ist, mit entweder nur einem einzigen oder mit einer Kombination von nur
zwei Merkmalen zu einem zufriedenstellenden System zu gelangen. Da Adanson den Anteil der aus jeder
dieser Anordnungen resultierenden natürlichen Gruppen berechnete, ist er gelegentlich als numerischer
Taxonom bezeichnet worden, zum ersten Mal von Adrien de Jussieu im Jahre 1848. Doch ist diese
Behauptung irreführend, da Adanson seine arithmetische Methode nicht zur tatsächlichen Abgrenzung von
Gattungen und Familien benutzte. Vielmehr nahm er solche Abgrenzungen, dem Beispiel Magnols
folgend, durch visuelles Erkennen von Gruppen vor. Obgleich er zuerst die Unterschiede zwischen
Gattungen und Arten herausarbeitete, „verstand ich aus der Gesamtheit [ensemble] dieser vergleichenden
Beschreibungen, daß die Pflanzen natürlich in Klassen oder Familien zerfallen" (Fam.1763, S. clviii)
Adanson erkannte klar, daß sich einzelne Merkmale in ihrer taxonomischen Bedeutung unterscheiden.
„Allen Eigenschaften gleiches Gewicht zu verleihen, hätte in logischem Gegensatz zu Adansons induktiver
Methode gestanden. Ein solches willkürliches Vorgehen wäre gleichbedeutend mit einer a prioriBewertung der Merkmale gewesen" (Stafleu, 1963, S. 201; siehe auch Burtt, 1966). Adanson sprach sich
zugunsten der potentiellen Berücksichtigung aller Teile der Pflanze aus, nicht nur des Fruchtstandes. Er
hob vor allem zwei Punkte hervor: (1) Bestimmte Merkmale tragen nichts zur Verbesserung einer
Klassifikation bei und sollten außer acht gelassen werden, und (2) die Merkmale mit großem
Informationsgehalt sind von Familie zu Familie verschieden. Jede Familie besitzt ihr eigenes „génie".
Von einigen seiner Gegner wurde Adanson aus dem sonderbaren Grunde kritisiert, daß seine Methode
eine zu umfangreiche Kenntnis der Pflanzen erfordere. Diese Kritik wäre berechtigt gewesen, wenn der
einzige Zweck der Klassifikation die Identifikation wäre; wie jedoch die Geschichte der Systematik immer
wieder bewiesen hat, können zufriedenstellende Klassifikationen – d. h. solche, die auf einer kritischen
Bewertung sämtlichen Beweismaterials beruhen – nur von gründlichen Kennern der betreffenden Gruppe
konstruiert werden. Adansons Einstellung gegenüber den Merkmalen läßt sich so zusammenfassen: er
befürwortete in der Tat eine Gewichtung von Merkmalen, allerdings nicht aufgrund einer vorgefaßten
Meinung öder a priori festgelegter Prinzipien (etwa physiologische Bedeutung), sondern aufgrund einer a
posteriori-Bewertung durch Vergleich von zuvor durch genaue Betrachtung aufgestellter Gruppen.
Nahezu jedes Prinzip, das von Adanson vorgeschlagen worden war, ist inzwischen zu einem Bestandteil
der taxonomischen Methodik geworden. Zu seiner Zeit jedoch, die immer noch von thomistischer Logik
und der nahezu diktatorischen Autorität von Linnaeus beherrscht war, wurde er fast völlig ignoriert. Es ist
schwer zu sagen, wieviel Einfluß sein Werk Familles desplantes tatsächlich hatte. Lamarck spendete ihm
Lob, andere aber, die eindeutig von dem Werk beeinflußt waren, etwa A.L.de Jussieu, waren kleinlich
genug, die Quelle ihrer Ideen nicht zu nennen. Als zahlreiche praktizierende Taxonomen in nachfolgenden
Jahren und Generationen zu den gleichen Prinzipien gelangten, taten sie dies unabhängig und aufgrund
empirischer Arbeiten und nicht, weil sie Adansons weitgehend vergessene Schriften studiert hatten. Fast
ein ganzes Jahrhundert mußte vergehen, bis Adansons Größe wiederentdeckt wurde (Stafleu, 1963).
Die Übergangsperiode (1758-1859)
Das Jahrhundert nach der Veröffentlichung der 10. Auflage von Linnaeus' Systema Naturae (1758) war
eine Ära beispielloser taxonomischer Aktivität, nicht zuletzt, weil das Studium der organischen Vielfalt seit
Linnaeus in hohem Ansehen stand. Je mehr immer neue Organismen entdeckt wurden, um so mehr junge
Leute wurden Zoologen und Botaniker. Die Suche nach neuen Arten und ihrer Zuordnung drohte alles
andere Interesse an der Biologie zu ersticken. Die erregenden Arbeiten eines Kölreuter oder Sprengel auf
dem Gebiet der Blütenbiologie blieben unbeachtet, brachten sie doch keine neuen Arten hervor. Nägeli
(1865), der kein Taxonom war, bedauerte, daß alle anderen Zweige der Botanik „ im Strom der
Systematik" ertränkt würden.
Die enorme Anhäufung von Tier- und Pflanzenexemplaren in privaten und öffentlichen Sammlungen
hatte tiefgreifende Veränderungen des taxonomischen Berufs zur Folge. Die Taxonomen wurden
sozusagen professioneller und die Spezialisierung stärker. Neue Zeitschriften wurden gegründet, um die
Beschreibungen der zahlreichen Neuheiten aufzunehmen, und Amateure entdeckten, daß sie einen hohen
Grad an Kompetenz erreichen konnten, wenn sie sich auf eine einzige Familie spezialisierten. Die jährliche
Produktion an taxonomischer Forschung nahm stetig zu.
Die Taxonomie stieß in völlig neue Gebiete vor. Hatte bis dahin das Interesse der Zoologie nunmehr den
Wirbeltieren und der Botanik den Blütenpflanzen gegolten, so wandte sich die Zoologie den Wirbellosen
zu, insbesondere den im Wasser lebenden Wirbellosen, und schließlich (seit Sars) sogar den
Tiefseeorganismen. Die Botaniker widmeten ihre Aufmerksamkeit immer mehr den blütenlosen Pflanzen.
In der Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung von Adansons Familles des plantes (1763) und
Darwins Origin of Species (1859) verdrängte die Aufwärtsklassifikation allmählich die
Abwärtsklassifikation. Frankreich, unter den europäischen Ländern vielleicht am wenigsten vom
Essentialismus beherrscht, wurde tonangebend in der Einführung der neuen Methoden in die Taxonomie.
Dies geht klar nicht nur aus den frühen Pionierleistungen Magnols, Buffons und Adansons hervor, sondern
auch aus den Schriften von Lamarck und Cuvier. Lamarck (1809; 1815) hielt zwar immer noch an viel
veralteter Philosophie fest, doch klassifizierte er eher durch Gruppieren als durch logische Zweiteilung;
und Cuviers Prinzip der Korrelation der Teile verstärkte den Trend zu einem Taxonbegriff auf der Basis
vieler Merkmale, wie auch die neue Tendenz nach neuen Merkmalen zunahm. Damit wurde einer neuen
pragmatischen Tradition in der zoologischen Klassifikation Tür und Tor geöffnet, in der Merkmale danach
beurteilt wurden, inwieweit sie einen Beitrag zur Bildung anscheinend „natürlicher" Gruppierungen
leisteten; d.h. sie wurden a posteriori bewertet. Abgesehen davon hatte man erkannt, daß die relative
Bedeutung eines Merkmals (sein Gewicht) bei verschiedenen höheren Taxa verschieden sein konnte, d.h.
daß der taxonomische Wert von Merkmalen nicht absolut ist.
Dies führte ebenfalls zu einem neuen Konzept der taxonomischen Kategorien. Sie galten nun nicht mehr
als Schritte bei der logischen Teilung (vom summum genus bis hinunter zur untersten Art), sondern als
Rangstufen in einer Hierarchie. Die Gattung wurde nun zu einer kollektiven höheren Kategorie, war also
ontologisch und epistemologisch etwas völlig anderes als die essentialistische Gattung der logischen
Teilung. Diese Wende in Bedeutung und Rolle der Gattung ist von Taxonomen und Philosophen häufig
übersehen worden, was Mißverständnisse und Begriffsverwirrungen zur Folge hatte.
Daneben änderte sich kaum merklich die relative Bedeutung verschiedener Kategorien. Für Linnaeus
war die Gattung das Zentrum des Universums. In dem Maße, wie die Gattungen durch die fortgesetzte
Entdeckung neuer Arten größer und größer wurden, mußten die meisten von ihnen immer wieder
aufgespalten werden, und das Schwergewicht verschob sich auf den nächst höheren Rang, die Familie. In
vielen, aber keineswegs allen Gruppen von Organismen wurde die Familie zur stabilsten
Klassifikationseinheit.
Der Übergang von der aufgliedernden zur aufwärtsgerichteten Klassifikation (sowie die entsprechenden
methodischen und begrifflichen Veränderungen) ging langsam, allmählich und unregelmäßig vor sich, wie
es auf fast alle wissenschaftlichen „Revolutionen" zutrifft. Wie schon gesagt, setzte die stärkere Betonung
der Familien mit Magnol (1689) ein; die Verwendung mehrerer, häufig aus verschiedenen Organsystemen
entnommener Merkmale, war bereits mehr oder weniger zögernd von Bauhin, Morison, Ray, Magnol und
Tournefort übernommen worden; Bauhin (1623) war vielleicht der erste, der in seiner Klassifikation
Pflanzen „nach ihren natürlichen Verwandtschaftsbeziehungen" gruppierte. Doch alle diese Autoren waren
nicht konsequent, insbesondere, weil ihre Klassifikationen ja (in stärkerem oder geringerem Maße) auch als
Identifikationssysteme dienen sollten.
Stafleu (1963, S. 126) macht sehr richtig darauf aufmerksam, daß nicht nur praktische Überlegungen,
sondern auch der Einfluß von Descartes und seinen Prinzipien dazu beitrugen, die Autorität des
aristotelischen Teilungssystems zu unterminieren. Adansons Vorgehen zum Beispiel, war sehr stark an den
vier methodischen Grundregeln des Descartes orientiert: Zweifel, Analyse, Synthese und Aufzählung. Der
kartesianische Einfluß wie auch (über Buffon) die Auswirkungen des Gedankenguts von Newton und
Leibniz waren unter anderem Gründe dafür, daß Linnaeus in Frankreich einen geringeren Einfluß hatte als
in anderen taxonomisch interessierten Ländern. Seine zahlreichen praktischen Neuerungen (binominale
Nomenklatur, Nomenklaturregeln und so weiter) wurden natürlich mit der Zeit übernommen, sein
Aristotelismus jedoch wurde nur als ein bequemes Identifikationssystem und nicht als eine solide
philosophische Grundlage für die Klassifikation akzeptiert. Vielleicht die auffälligste Entwicklung in der
postlinnaeischen Taxonomie war, daß Klassifikationen immer deutlicher hierarchische Gestalt annahmen
(siehe unten).
Die Pflanzentaxonomie, die in den zweihundert Jahren zwischen Cesalpino (1583) und Linnaeus eine
großartige Blüte erlebt hatte, verzeichnete in der Zeit nach Linnaeus weiterhin ein zwar stetiges, aber
wenig spektakuläres Wachstum. Drei Entwicklungen waren für diese Ära kennzeichnend. Die wichtigste
war das Bestreben (das selbst heute noch nicht völlig von Erfolg gekrönt ist), ein „natürliches System" der
Pflanzen aufzustellen. De Jussieu, de Candolle, Endlicher, Lindley, Bentham und Hooker, sie alle trugen
mehr oder weniger erfolgreich zu diesem Ziel bei. Die zweite Entwicklung: man verwandte bei den
Kryptogamen zunehmend mehr Aufmerksamkeit nicht nur auf Farne und Moose, sondern auch auf Fungi,
Algen und einzellige Wasserpflanzen (Protisten). Und als letztes: auch in der Botanik begann das Zeitalter
der Spezialisierung; es wurden Monographien veröffentlicht, die sich mit speziellen Pflanzengruppen
befaßten, und zu sehr intensiver Forschung in ausgewählten Teilbereichen des Pflanzenreichs führten;
allerdings spezialisierten sich Botaniker nur selten in dem Maße wie Zoologen.
Entschieden zu wenig gewürdigt wird die Tatsache, daß die Tiertaxonomie während dieses Zeitraumes
zu einem der bedeutendsten Zweige der akademischen Zoologie wurde. Naturforscher wie von Siebold,
Leuckart, Ehrenberg, Sars, Dujardin und viele andere (man könnte sogar Darwin mit in diese Kategorie
einbeziehen) begannen als Taxonomen, lieferten aber, als sie sich für das lebende Tier als Ganzes zu
interessieren begannen, wichtige Beiträge zur allgemeinen Zoologie. Man denke etwa an die Klärung des
Lebenszyklus der Parasiten, den Generationswechsel, die Abfolge der Larvenstadien von im Wasser
lebenden Wirbellosen, die Struktur innerer Organe und ihre Funktion, sowie fast jeden anderen Aspekt des
lebenden Tieres. Recht häufig läßt sich zweifelsfrei nachweisen, daß sich solche Studien unmittelbar aus
taxonomischer Forschungstätigkeit ergeben haben, und doch hat man der Taxonomie selten Dank dafür
gewußt, daß von ihr Anregungen zu neuen Fragestellungen in der Biologie ausgingen. Zum Beispiel wurde
erst 1969 (Ghiselin) in vollem Umfang erkannt, wie wichtig Darwins monographische Arbeit über die
Rankenfüßer für den Reifungsprozeß seiner Evolutionstheorie gewesen ist.
Die Suche nach einem natürlichen System
Den meisten Verfechtern der Abwärtsklassifikation war völlig klar, daß die mit ihren Methoden erzielten
Klassifikationen „künstlich" waren. Linnaeus beklagte in mehreren seiner Werke, daß die Zeit für eine
wirklich „natürliche" Klassifikation (wie er sie interpretierte) noch nicht reif sei. Bei verschiedenen
Gelegenheiten publizierte er Fragmente einer „natürlichen" Pflanzenklassifikation (Stafleu, 1971), und so
künstlich einige seiner Hauptunterteilungen auch waren, er ordnete die Mehrheit der Gattungen in ihnen
weitgehend so an, wie es ein moderner Vertreter der Evolutionstaxonomie tun würde. Doch ein einfaches
Substituieren der aufteilenden durch die aufbauende Klassifikation genügte nicht, um eine natürliche
Klassifikation zu erreichen. Es mußte ein ordnendes Prinzip geben, ein Grundkonzept, das dem
Taxonomen als Leitlinie dienen konnte.
Schon seit der Zeit der Griechen war der Glaube weit verbreitet gewesen, die Vielgestaltigkeit der Natur
sei die Manifestation einer tieferen Ordnung oder Harmonie. Keine andere Gruppe von Philosophen,
soweit wir das nach dem wenigen, was von ihren Schriften überliefert ist, beurteilen können, machte sich
so viele Gedanken über diese Harmonie wie die Pythagoreer. Die Naturtheologie ließ die Vorstellung von
einer harmonischen Ausgewogenheit der Natur wieder aufleben und sah überall in der augenscheinlichen
„Zweckmäßigkeit" aller Anpassungen ein Zeichen dieser Harmonie. Aber die Vielgestaltigkeit schien
zunächst chaotisch zu sein und nicht allzu gut in diese Philosophie zu passen. Besonders
unzufriedenstellend wurde die Lage in der Zeit nach Linnaeus, als bei Tieren und Pflanzen die Zahl der
bekannten Arten und höheren Taxa fast exponentiell anwuchs. Angesichts der fast chaotischen Fülle neuer
Arten kam man nicht umhin zu fragen: Wo ist denn nun jene Harmonie der Natur, von der jeder
Naturforscher träumt? Welche Gesetze regeln diese Mannigfaltigkeit? Welche Pläne hatte der Urheber aller
Dinge, als er kleine und große Geschöpfe schuf?
Es war in einer derart stark von der Naturtheologie beherrschten Epoche einfach unvorstellbar, daß die
organische Vielgestaltigkeit gar keinen Sinn haben, daß sie lediglich das Ergebnis des „Zufalls" sein
könne. Folglich war es die Aufgabe des Taxonomen, die Gesetze zu finden, die die Vielfalt regeln, oder,
wie andere es ausdrückten, den Plan der Schöpfung aufzudecken.
Die Klassifikation, die diesen göttlichen Plan am perfektesten widerspiegelte, wäre „das natürliche
System", und das zu finden, war das Ideal jedes Naturforschers. Untersucht man jedoch genauer, was die
verschiedenen Autoren sich unter dem Ausdruck „natürlich" vorstellten, so stößt man auf eine Vielzahl von
Vorstellungen. Eine Erörterung einiger der Verwendungen des Ausdrucks wird uns helfen, das Denken
dieser Periode leichter zu verstehen. Die verschiedenen Bedeutungen lassen sich am besten verdeutlichen,
wenn wir ihre jeweiligen Antonyme anführen.
1. „Natürlich" ist das, was die wahre „Natur" (d.h. Essenz) widerspiegelt im Gegensatz zu dem, was
durch „Zufall" bedingt ist. Die essentialistischen Klassifikatoren von Cesalpino bis zu Linnaeus versuchten
Klassifikationen aufzustellen, die in diesem Sinne natürlich waren (Cain, 1958). Im Prinzip war dies das
Ideal von Linnaeus, und dies scheint er auch im Auge gehabt zu haben, als er seine Unzufriedenheit mit
seinem künstlichen Sexualsystem zum Ausdruck brachte. „Natürlich" bedeutete für Linnaeus keineswegs
dasselbe, was es für uns bedeutet, denn die „Natur" einer Art, einer Gattung oder eines höheren Taxon war
für ihn deren Essenz. In diesem Punkt sind sich alle Linnaeus-Forscher einig (Stafleu, 1971; Larson, 1971).
Man darf niemals vergessen, daß Linnaeus davon überzeugt war, Gattungen und höhere Taxa stellten als
Gottes Schöpfungen unveränderliche Essenzen dar und man würde sie erst wirklich kennen, wenn man
diese Essenzen ganz erkannt hatte. Wie Cain (1958, S.155) feststellte, „ist es wahrscheinlich, daß ein
natürliches System für Linnaeus ein System ist, daß die Natur der Dinge zeigte, und [diese] Natur
bedeutete in der Praxis Essenz". Diese Einsicht hilft uns, seine Essays über die „natürliche Methode" (im
Sinne von natürlichem System) zu verstehen.
Linnaeus' Theorie über den Ursprung von Klassen und Gattungen (in einem Anhang zu seinem Werk
Genera Plantarum (1764) ist von einem strikten Schöpfungsglauben diktiert. Aus all dem geht deutlich
hervor, was er tatsächlich im Sinn hatte, wenn er von dem „natürlichen System" sprach: ein System, in dem
die intuitive Definition höherer Taxa (aufgrund allgemeiner Ähnlichkeit) durch eine Bestimmung der
wahren Essenz dieser Taxa ersetzt wird. Unter den Nachfolgern von Linnaeus nahm der Ausdruck
„natürliches System" freilich allmählich eine völlig andere Bedeutung an.
2. In dem Maß wie der Einfluß der essentialistischen Philosophie geringer wurde, begann sich die
Bedeutung des Wortes „natürlich" zu ändern, wurde gleichbedeutend mit: was vernünftig ist und nicht
willkürlich. Diese Auslegung drückte die im 18. Jahrhundert weitverbreitete Einstellung aus, daß die
Ordnung der Natur vernünftig sei und durch Nachdenken erkannt und verstanden werden könne. Alles in
der Natur gehorche gottgegebenen Gesetzen, und die Ordnung der Natur sei nach Gottes Plan geschaffen.
Das „natürliche System", wenn man es finden könne, würde auf das genaueste den Bauplan der Schöpfung
widerspiegeln (Agassiz, 1857).
3. Für wieder andere besagte der Ausdruck „natürlich" „empirisch" im Gegensatz zu „künstlich" (d.h.
rein utilitaristisch). Eine natürliche Klassifikation im Rahmen dieser Vorstellung würde John Stuart Mills
Anforderungen erfüllen: „Den Zwecken der wissenschaftlichen Klassifikation wird am besten gedient,
wenn die Objekte in Gruppen geordnet werden, über die eine größere Zahl allgemeiner und wichtiger
Hypothesen aufgestellt werden kann, als in bezug auf alle anderen Gruppen, denen man die gleichen Dinge
zuordnen könnte." Im wesentlichen hatten Überlegungen dieser Art Adansons Vorgehen zugrundegelegen.
Es ist eine Tradition, die von Bauhin begründet, Von Morison (allerdings halbherzig) unterstützt, von
Magnol dagegen sehr entschieden vertreten wurde.
4. Nach 1859 schließlich hatte der Ausdruck „natürlich" die Bedeutung „von einem gemeinsamen
Vorfahren abstammend", wenn er zur Beschreibung eines Klassifikationssystems benutzt wurde. Eine
natürliche Klassifikation nach Darwin ist eine, in der die Mitglieder einer Gruppe die Nachkommen eines
gemeinsamen Vorfahren sind.
Mit einer Auflistung dieser verschiedenen Bedeutungen des Terminus „natürlich" sind jedoch die
begrifflichen Fundamente der während dieser Zeitspanne vorgeschlagenen Klassifikationen keineswegs
erschöpfend beschrieben. Die Suche nach einer Harmonie oder einem Plan in der Natur wurde noch von
einigen anderen Begriffen beeinflußt, die wir zum Teil bereits in anderen Zusammenhängen angesprochen
haben. Insbesondere drei Vorstellungen erfreuten sich in drei aufeinanderfolgenden Epochen jeweils großer
Beliebtheit.
Scala naturae
Jahrhundertelang schien die Stufenleiter der Vollkommenheit das einzige vorstellbare Schema zu sein, das
Ordnung in die organismische Vielfalt bringen konnte [21]. Blumenbach (1782, S.8-9) sah als einer von
vielen Autoren in der scala naturae die solide Grundlage eines natürlichen Systems, das es dem Menschen
erlauben würde, „die natürlichen Körper gemäß ihrer größten und mannigfachsten Verwandtschaft zu
ordnen, die ähnlichen zusammenzufassen, und die nicht ähnlichen voneinander zu trennen". Lamarck
brachte, insbesondere in seinen frühen Schriften, ähnliche Ansichten zum Ausdruck. Unter den Botanikern
war die Idee der scala naturae weniger verbreitet, da man bei Pflanzen, mit Ausnahme vielleicht der
Entwicklung von den Algen und anderen Kryptogamen zu den Phanerogamen, kaum einen Trend zur
Perfektion erkennen konnte. Daher zog Linnaeus es vor, eine Klassifikation mit einer Landkarte zu
vergleichen, auf der jedes Land an mehrere andere grenzt.
Je mehr man die Mannigfaltigkeit der Natur kennenlernte, desto häufiger wurde die These von einer
kontinuierlichen Stufenfolge, die von dem am wenigsten perfekten Atom bis hinauf zum perfektesten
Lebewesen führen sollte, in Frage gestellt. Lamarck sah keinerlei Kontinuität mehr zwischen dem
Inorganischen und dem Organischen, obgleich er häufige Urzeugung postulierte. Die sogenannten
„Zoophyten" (Korallen, Polypen und so weiter) wurden besonders sorgfältig unter die Lupe genommen.
Nahmen sie tatsächlich einen Platz zwischen Pflanzen und Tieren ein? Und wenn nicht: Waren sie
Pflanzen oder Tiere? Große Aufregung und nicht geringe Verblüffung waren die Folge, als Trembley[22]
im Jahre 1740 entdeckte, daß die grüne Hydra (Chlorohydra viridissima) eindeutig ein Tier und dennoch
mit Chlorophyll und erstaunlicher Regenerationsfähigkeit ausgestattet war, hatte man doch bisher
angenommen, dies seien typische Eigenschaften von Pflanzen. Bald darauf wies Trembley nach, daß auch
Korallen und Moostierchen Tiere waren und keinesfalls Zwischenstufen zwischen Pflanzen und Tieren.
Auch die von Lamarck anerkannten, zahlreichen Verzweigungen in den Verwandtschaftslinien des
Tierreichs waren mit einer einzigen scala naturae unvereinbar.
Seinen endgültigen Todesstoß erhielt dieses Konzept, als Cuvier (1812) mit Nachdruck darauf bestand,
es gäbe nicht mehr und nicht weniger als vier große, voneinander völlig unabhängige Tierstämme. Auch
nach Cuvier war es manchmal noch möglich, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Angehörigen
kleinerer Gruppierungen zu erkennen, aber das Ordnungsprinzip der „zunehmenden Perfektion" war nicht
länger anwendbar. Abgesehen davon verlor das Postulat von Verbindungen zwischen nichtähnlichen
Gruppen immer mehr an Überzeugungskraft. Die Einheit der organischen Welt, deren Symbol früher die
scala naturae gewesen war, schien immer mehr zu zerfallen, je besser man die Welt des Lebens
kennenlernte. Sobald man begriffen hatte, daß eine eindimensionale Linie oder ein eindimensionales
Leitprinzip unzulänglich war, setzte die Suche nach multidimensionalen Systemen ein.
„Affinität" und Analogie
Der Platz einer Gruppe von Organismen in der Stufenleiter der Vervollkommnung wurde von ihrer
Ähnlichkeit („Affinität") zu weniger vollkommenen oder vollkommeneren Nachbarn bestimmt. Für einen
modernen Biologen ist es schwierig, sich vorzustellen, was „Affinität" in vorevolutionistischen
Erörterungen bedeutete; vielleicht bedeutete es einfach Ähnlichkeit. Allerdings war man auch überzeugt,
diese Ähnlichkeit drücke eine Art kausaler Beziehung aus, wie sie in der scala naturae oder in Louis
Agassizs Plan der Schöpfung enthalten war.
Einige der Schwierigkeiten mit der scala naturae schienen dadurch bedingt zu sein, daß es zwei Arten
von Ähnlichkeit gab, die echte verwandtschaftliche Ähnlichkeit und eine andere, die Schelling, Oken und
ihre Nachfolger als Analogie bezeichneten. Die Pinguine sind mit den Enten und Alken durch eine echte
Verwandtschaftsbeziehung verbunden, mit den im Wasser lebenden Säugetieren (etwa den Walen) jedoch
durch Analogie. Falken zeigen Verwandtschaft mit Papageien und Tauben, aber Analogie zu den
Raubtieren unter den Säugetieren. So bizarr das Denken der Naturphilosophen teilweise auch war, ihre
Aufteilung der „Verwandtschaftsbeziehung" in „Affinität" und Analogie erwies sich in der nachfolgenden
Geschichte der Biologie als sehr bedeutsam. Auf der Grundlage dieser Unterscheidung entwickelte Richard
Owen seine Begriffe Homologie und Analogie, die seitdem die vergleichende Anatomie beherrschen
sollten, insbesondere, nachdem die Ausdrücke von der Evolutionstheorie neu definiert worden waren.
Wie sollte man jedoch, bevor die Evolutionslehre vorgeschlagen worden war, die Idee
verwandtschaftlicher Ähnlichkeit und Analogie in ein System umsetzen? Hier borgten sich die
Naturphilosophen Gedankengut von den Pythagoreern aus. Kann man Gesetz und Harmonie in der Natur
besser ausdrücken als in Zahlen? Der Entomologe W.S.MacLeay (1819) wählte die Zahl 5, und obgleich
andere später mit den Zahlen 3 und 4 experimentierten, blieb die 5 die beliebteste Zahl; das System wurde
als quirinales System bezeichnet [23]. Nach Ansicht von MacLeay waren alle Taxa auf Kreisen
angeordnet, fünf pro Kreis, und benachbarte Kreise berührten einander („osculating"). Taxa auf demselben
Kreis zeigten verwandtschaftliche Ähnlichkeit, Berührung mit anderen Kreisen bedeutete Analogie. Eine
Aufgabe des Taxonomen war somit die Suche nach derartigen Querverbindungen.
Obgleich diese häufig recht bizarren Systeme von den besonneneren Naturforschern vernichtend
kritisiert wurden, kann man die Anhänger des Quinarianismus verstehen: sie suchten nach Gesetzen, mit
denen die Vielfalt der Natur erklärt werden könne, und vor Aufkommen der Evolutionslehre scheinen
Zahlensysteme das Beste gewesen zu sein, was verfügbar war. Selbst T. H. Huxley war eine Zeitlang vom
Quinarianismus fasziniert und unternahm zahlreiche Versuche, die höheren Taxa der Wirbellosen auf
entsprechenden Kreisen oder in parallelen Reihen anzuordnen (Winsor, 1976 b). Diese Lehre war im
England der vierziger und fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts so verbreitet, daß sogar Darwin sich mit ihr
befaßte. Denn wären die Organismen tatsächlich in Vielfachen von fünf angeordnet, so würde dies
bedeuten, daß sie von einem übernatürlichen Urheber geplant worden sind, und damit wäre die Entstehung
der Formenvielfalt durch natürliche Auslese widerlegt. Allerdings erkannte Darwin schon nach flüchtiger
Untersuchung, daß die Tatsachen der taxonomischen Vielfalt mit allen numerischen Schemata unvereinbar
waren. Vor allem lieferte sein Studium der Rankenfußkrebse keinerlei Beweis für diese These.
Sogar die Mehrheit derer, die den Quinarianismus ablehnten, mußte zugestehen, daß es mehrere Arten
von Ähnlichkeit gab. Ähnlichkeit aufgrund von Verwandtschaft wurde immer anerkannt, ebenso auch
Analogie, gelegentlich fand man aber rein zufälliges „Ähnlichsehen" oder andere Arten von Ähnlichkeit.
Die rätselhafteste all dieser Ähnlichkeiten war die verwandtschaftliche „Affinität", jedoch herrschte
allgemein Einigkeit darüber, daß sie „die unmittelbare Folge jener Gesetze des organischen Lebens sei, die
der Schöpfer zu seiner eigenen Orientierung beim Schöpfungsakt erlassen habe" (Strickland, 1846, S.356).
Aus diesem Grund wurde die verwandtschaftliche Ähnlichkeit für Louis Agassiz zu einem der
überzeugendsten Beweise für die Existenz des Schöpfers.
Pragmatismus und Hierarchien
Das Versagen der scala naturae, der großartigen Systeme der Naturphilosophen und der pythagoreischen
Bemühungen der Numerologen hatte einen ausgesprochen ernüchternden Effekt auf die Taxonomie. In den
fünfzig Jahren vor der Veröffentlichung von Darwins Origin of Species vermieden die meisten Taxonomen
das Theoretisieren überhaupt, und wenn sie die Prinzipien der Aufwärtsklassifikation übernahmen, so
gaben sie sich damit zufrieden, einfach und pragmatisch offensichtlich ähnliche Arten und Gattungen in
Gruppen zusammenzufassen.
Fortschritte in der Begriffswelt waren in dieser Zeit kaum zu verzeichnen. Cuvier wiederholte selbst in
seiner letzten Veröffentlichung lediglich die Grundsätze, die er schon zwanzig Jahre zuvor verkündet hatte.
Die Situation in der Botanik war nicht besser. A.-P. de Candolles Theorie elementaire (1813) hielt,
ungeachtet gegenteiliger Behauptungen, immer noch an den klassischen, essentialistischen a prioriMethoden fest [24]. Und dennoch wurde, von den Praktikern selbst nahezu unbemerkt, die Verwendung
eines einzelnen Schlüsselmerkmals bei der Aufstellung höherer Taxa verdrängt durch die Gruppierung von
Arten (oder anderen niedrigeren Taxa) zu höheren Taxa aufgrund von Merkmalskombinationen. Die
aufbauende Klassifikation wurde zu etwas Selbstverständlichem. Dadurch, daß sie „von unten anfing",
förderte sie in starkem Maße das Heranbilden von Spezialisten (Lindroth, 1973).
Diese neue Methode führte bald zu der Entdeckung, daß viele zuvor erkannte Taxa außerordentlich
heterogen waren. Zum Beispiel konnten Meckel (1821) und Leuckart (1848) zeigen, daß Cuviers Radiata
(von diesem unterschieden anhand des Schlüsselmerkmals „radiale gegenüber bilateraler Symmetrie") eine
unnatürliche Gruppierung zweier grundsätzlich verschiedener Stämme war, der Stachelhäuter und der
Hohltiere. Auf jeder Ebene, vom Stamm bis hinunter zur Gattung, wurden zuvor erkannte höhere Taxa
überprüft und in homogenere Bestandteile aufgeteilt, sobald sich herausstellte, daß sie unnatürliche
Gruppierungen waren. Bis zum Jahre 1859 war ein großer Teil der Tiertaxa neu definiert und auf Gruppen
von Arten beschränkt worden, die in ihren strukturellen und biologischen Merkmalen weitgehend
übereinstimmten.
Die Begeisterung für dieses theoriefreie, rein pragmatische Vorgehen wurde etwas gedämpft, als man
einige Phänomene entdeckte, die ein allzu großes Vertrauen in die phänetische Ähnlichkeit untergruben.
Natürlich hatte man schon seit langem gewußt, daß Raupe und Schmetterling ein und dasselbe Tier
darstellen, aber angesichts des wachsenden Interesses am Klassifizieren konnte man der Frage nicht mehr
ausweichen, ob eine Klassifikation aufgrund der Raupen wohl die gleiche wäre wie eine Klassifikation, die
von den Schmetterlingen ausgeht, in die sich die Raupen verwandeln. In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts entdeckte man, daß derartige Metamorphosen in vielen Wirbellosengruppen erfolgen, daß sie
für die meisten Gruppen sessiler Meeresorganismen sogar die Regel sind. Seit den Anfängen jeglichen
zoologischen Systems waren die Rankenfüßer zu den Mollusken gestellt worden oder zur nächst
niedrigeren Klasse, den Testacea. Es war eine Sensation, als John Vaughan Thompson am 8. Mai 1826
beobachtete, wie eine Krebslarve sich auf dem Boden eines Glasbehälters in einen jungen Rankenfüßer
verwandelte (Winsor, 1969). Weitere Studien ließen keinen Zweifel daran, daß Rankenfüßer sessile Krebse
sind. Thompson und andere Meeresbiologen entdeckten, daß viele Planktonorganismen nichts anderes als
die Larvenstadien wohlbekannter Wirbelloser darstellen, und daß selbst freilebende Krebse in ihrer
Metamorphose mehrere Larvenstadien durchlaufen können (Nauplius, Zoea, Cypris).
Die beruhigende Vorstellung von Typen, die sich entweder nach dem Primat der Funktion (Cuvier) oder
anhand deutlich verschiedener Baupläne (von Baer und die Naturphilosophen) anordnen ließen, machte in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einer sogar noch vollständigeren Verwirrung Platz. Verantwortlich
dafür waren zwei weitere Entdeckungen. Eine betraf den komplizierten Lebenszyklus der Bandwürmer,
Saugwürmer und anderer Endoparasiten. Die Stadien der Generationenfolge, z. B. Cysticercus -Bandwurm,
Cercarie – Saugwurm, sind, obgleich von denselben Genotypen hervorgebracht, so total verschieden, daß
sie Zweifel an der Gültigkeit eines rein phänetischen Ansatzes bei der Klassifikation wecken. Noch
verblüffender war die Entdeckung eines regulären Generationswechsels bei Salpen (Tunicata) durch
Adelbert von Chamisso (1819), und bei Hohltieren durch Michael Sars (1838-1846) und J. Steenstrup
(1842). Die freischwimmende Generation solcher Arten ist von der sessilen Generation derart verschieden,
daß beide Formen bis zu dieser Entdeckung in völlig verschiedene Taxa eingeordnet worden waren
(Winsor, 1976 b; Churchill, 1979). Den Botanikern war das Problem nicht unbekannt, da bei verschiedenen
Gruppen von Kryptogamen Gametophyt und Sporophyt gewöhnlich völlig anders aussehen.
Zum Glück hatten diese beunruhigenden Entdeckungen keinen neuen Ausbruch metaphysischer
Spekulationen zur Folge, sondern spornten die Taxonomen lediglich zu einer Verdoppelung ihrer
Anstrengungen an, „natürliche" Gruppen „verwandter" Organismen zusammenzustellen. Das Resultat
dieser Anstrengungen war fast automatisch eine Klassifikation untergeordneter Kategorien, die man heute
gewöhnlich als die Linnaeische Hierarchie bezeichnet. Was bedeutet der Terminus „Hierarchie" in einer
taxonomischen Theorie?
Hierarchische Klassifikationen
Die meisten Klassifikationen, ob unbelebter Objekte oder Organismen, sind hierarchisch aufgebaut. Sie
bestehen aus „höheren" und „niedrigeren" Kategorien, höheren und niedrigeren Rängen. Man übersieht
jedoch gewöhnlich, daß die Verwendung des Terminus „Hierarchie" doppeldeutig ist, und daß zwei
grundsätzlich verschiedene Arten von Gruppierungen mit dem Ausdruck bezeichnet worden sind. Eine
Hierarchie kann entweder ausschließend oder einschließend sein. Militärische Ränge, etwa einfacher
Soldat-Unteroffizier-Sergeant-Leutnant-Hauptmann bis hin zum General, sind ein typisches Beispiel einer
ausschließenden Hierarchie. Das heißt, ein niedrigerer Rang ist keine Unterteilung eines höheren Ranges;
Leutnants sind keine Unterteilung von Hauptleuten. Die scala naturae, die während des 16., 17. und 18.
Jahrhunderts einen dominierenden Einfluß auf das Denken hatte, ist ein weiteres gutes Beispiel einer
ausschließenden Hierarchie. Jede Vervollkommnungsebene wurde als ein Fortschritt (oder Rückschritt)
gegenüber der nächst niedrigeren (oder höheren) hierarchischen Ebene betrachtet, schloß diese aber nicht
ein. Noch ein weiteres Beispiel einer ausschließenden Hierarchie ist die Hierarchie der Funktionen, wie sie
von Cesalpino bis zu Cuvier verfochten wurde. Daß in dieser Hierarchie das Wachstum den höchsten Rang
einnimmt, und die Fortpflanzung den nächst höchsten, bedeutet nicht, daß die Fortpflanzung eine
Unterteilung des Wachstums ist, so wie Gattungen Unterteilungen von Familien sind.
Die moderne Hierarchie taxonomischer Kategorien ist ein typisches Beispiel einer einschließenden
Hierarchie. Ein konkretes Beispiel: hundeartige Arten, etwa Wolf, Kojote und Schakal, werden der Gattung
Canis (Hunde) zugeordnet; die verschiedenen hundeartigen und fuchsartigen Gattungen sind in der Familie
Canidae zusammengefaßt. Diese wiederum bilden zusammen mit den Katzen, Bären, Wieseln und anderen
verwandten Familien die Ordnung Carnivora. Klasse, Unterstamm, Stamm und Reich sind weitere
aufeinanderfolgende höhere Ränge in dieser Hierarchie. Jedes höhere Taxon enthält die Taxa der
niedrigeren, untergeordneten Ränge.
In der Theorie lassen sich einschließende klassifizierende Hierarchien sowohl mit der aristotelischen
Logik als auch mit Hilfe der aufbauenden Klassifikation aufstellen. Im Laufe der Geschichte hat die
logische Teilung jedoch niemals zu einer gut definierten taxonomischen Hierarchie geführt, da jede Ebene
für sich behandelt wurde, denn jede „Art" (im logischen System definiert) wurde auf der nächst niedrigeren
hierarchischen Stufe zu einer „Gattung". Selbst als Tournefort wie auch Linnaeus die Gattung weitgehend
stabilisierten, erkannten sie lediglich zwei höhere Kategorien an, an denen sie zudem nur wenig interessiert
waren (siehe oben).
Linnaeus wandte als erster die höheren Kategorien rational und im großen und ganzen konsequent an.
Dennoch war sein Denken immer noch zu stark von dem Prinzip der aristotelischen Teilung beherrscht, als
daß es ihm möglich gewesen wäre, eine völlig folgerichtige einschließende Hierarchie aller Organismen
vorzuschlagen. Diese Entwicklung setzte sich erst in den zwei Jahrzehnten zwischen 1795 und 1815 durch
(Winsor, 1976 b, S.2-3). Für diesen begrifflichen Wandel war in starkem Maße die Gruppe prominenter
Taxonomen am Pariser Museum d´Histoire Naturelle verantwortlich. Allerdings machten sich die
verschiedenen Autoren die neue Denkweise in unterschiedlichem Maße zu eigen. Zum Beispiel war
Lamarcks Hierarchie der höheren Taxa (masses) immer noch strikt ausschließend, obgleich auf der Ebene
der niederen Kategorien zusammensetzende, also einschließende Elemente vorhanden waren. Cuviers vier
Stämme (embranchements) besaßen keine hierarchische Verbindung untereinander, bzw. wenn sie
miteinander verbunden waren, so war es eine rein ausschließende Verbindung. Allerdings lassen sich
innerhalb dieser Stämme, bei den niederen Kategorien, einige einschließende hierarchische Tendenzen
beobachten.
Die Methode, mit Hilfe eines aufbauenden Verfahrens einschließende Hierarchien zu konstruieren, ist
aus einer Reihe von Gründen bedeutungsvoll. Erstens wäre niemand auf den Gedanken gekommen, wie
Darwin eine Theorie der gemeinsamen Abstammung vorzuschlagen, wenn es keine einschließende
Hierarchie taxonomischer Kategorien gegeben hätte. Von unmittelbarem Interesse ist, daß die neue
Methode sowohl praktische als auch philosophische Fragen aufwirft: Auf welchen Prinzipien soll die
Konstruktion einer einschließenden Hierarchie aufbauen? Dies war ein besonders brennendes Problem, da
das Denken der meisten Taxonomen immer noch von der scala naturae, einer ausschließenden Hierarchie
beeinflußt, wenn nicht beherrscht war.
Die Realität der höheren Kategorien und Taxa
Schon seit dem 17. Jahrhundert hat es mehr oder weniger heftige Auseinandersetzungen über die „Realität"
der höheren Kategorien gegeben. Essentialisten wie Linnaeus beharrten dogmatisch darauf, zumindest die
Gattung, gekennzeichnet durch ihre Essenz, sei ein „reales" Phänomen. Taxonomen mit nominalistischen
Tendenzen waren unter der Führung von Buffon (1749) mit gleichem Nachdruck der Ansicht, es existierten
lediglich Individuen, und zumindest die höheren Kategorien wie Gattung, Familie und Klassen seien
lediglich willkürliche Konventionen des menschlichen Geistes. Die Tatsache, daß im 17. Jahrhundert keine
zwei Botaniker zu derselben Klassifikation gelangten, schien zweifellos das nominalistische Argument zu
bestätigen. Durch seine Unterscheidung zwischen dem Abstrakt-Idealen und dem Konkret-Realen legte
Buffon die Grundlage für eine Lösung, doch setzte sich die Kontroverse noch weitere zweihundert Jahre
fort.
Für diese lange Dauer der Auseinandersetzung war in erster Linie eine terminologische Verwirrung
verantwortlich: der Ausdruck „Kategorie" wurde in zwei völlig verschiedenen Bedeutungen verwandt. Erst
als für eine der zwei früheren Bedeutungen ein neuer Ausdruck, das Wort „Taxon" eingeführt wurde,
konnte diese Verwechslung beseitigt werden [25].
Ein Taxon ist eine „Gruppe von Organismen beliebigen taxonomischen Ranges, die hinlänglich
verschieden ist, so daß es gerechtfertigt erscheint, sie zu benennen und einer bestimmten Kategorie
zuzuordnen". Unter dem Aspekt der Logik ist ein Taxon ein Individuum, und die einzelnen Tiere oder
Pflanzen, aus denen sich das Taxon zusammensetzt, sind Teile des Taxons (Ghiselin, 1975; Hull, 1976).
Eine Kategorie, in ihrer begrenzten, modernen Bedeutung, bestimmt den Rang oder die Stufe in einer
hierarchischen Klassifikation. Dabei handelt es sich um eine Klasse, zu der alle Taxa gehören, denen der
entsprechende Rang zuerkannt wurde. Der Unterschied zwischen Taxon und Kategorie läßt sich am besten
an einem Beispiel erläutern: Rotkehlchen, Drosseln, Singvögel, Sperlingsvögel, Vögel, Wirbeltiere,
Chordatiere und Tiere sind Gruppen von tatsächlichen Organismen; sie sind Taxa. Welcher Rang den
genannten Taxa in der hierarchischen Klassifikation zugewiesen wird, wird durch die Kategorien
angezeigt, in die sie eingeordnet werden: Art, Familie, Unterordnung, Ordnung, Klasse, Unterstamm,
Stamm und Reich.
Die Frage, „sind die höheren Kategorien real?", muß also in zwei getrennte Fragen aufgelöst werden: (1)
Sind die (meisten) Gruppen (Taxa), die wir in die höheren Kategorien einordnen, gut abgegrenzt? Und (2)
Ist es möglich, eine objektive (nicht willkürliche) Definition von höheren Kategorien wie Gattung, Familie
oder Ordnung zu geben? Die Antwort auf die erste Frage ist ein eindeutiges ja, die Antwort auf die zweite
Frage dagegen ein ebenso klares nein. Taxa wie Kolibris, Menschenaffen oder Pinguine sind
außerordentlich „natürlich" oder „real" (d.h. gut abgegrenzt), und doch ist der Rang, der ihnen in der
Kategorie zugewiesen wird, subjektiv, zumindest gilt dies für Taxa oberhalb der Artebene. Es kommt vor,
daß ein Taxon von einem Systematiker in die Kategorie der Familie eingestuft wird, von einem zweiten
Autor in eine niedrigere Kategorie (Tribus) und von einem dritten in eine höhere (Überfamilie). Mit
anderen Worten: der Rang in der Hierarchie ist weitgehend eine willkürliche Entscheidung. Alle jene, die
so hitzig über die Realität oder Nicht-Realität von Kategorien diskutierten, sprachen ganz einfach über
verschiedene Dinge. Zwar hatten einige frühere Autoren dies bereits deutlich verstanden (beispielsweise
Plate, 1914), doch blieb die Unterscheidung noch so lange unberücksichtigt, bis die terminologische
Differenzierung eingeführt wurde.
5 Gruppieren nach gemeinsamer Abstammung
Die empirisch arbeitenden Taxonomen hatten keine kausale Erklärung dafür, daß man Arten nach ihrer
„Verwandtschaft" oder „Ähnlichkeit" einordnen kann. Strickland (1840) definierte die Ähnlichkeit
(afflnity) als „die Verwandtschaftsbeziehung zwischen zwei oder mehr Angehörigen einer natürlichen
Gruppe, oder, mit anderen Worten, eine Übereinstimmung in essentiellen Merkmalen", doch ließ er dabei
die Schlüsselworte „natürlich" und „essentiell" Undefiniert. Es war Darwin, der die Lücke in der Erklärung
schloß und zeigte, warum es natürliche Gruppen gibt und warum sie „essentielle" Merkmale gemeinsam
haben. Von ihm stammt aber die grundlegende Theorie der biologischen Klassifikation. Niemand vor
Darwin hatte so eindeutig festgestellt, daß die Angehörigen eines Taxon ähnlich sind, weil sie von einem
gemeinsamen Vorfahren abstammen. Gewiß, die Idee war nicht völlig neu; schon Buffon hatte mit der
Möglichkeit gespielt, daß ähnliche Arten, wie Pferd und Esel oder alle Katzen, möglicherweise von einer
gemeinsamen Ahnenart abstammten, und das gleiche hatten auch Erasmus Darwin und einige der
deutschen Evolutionisten getan. Linnaeus hatte in seinen späteren Jahren die Ansicht geäußert, die
Angehörigen eines höheren Taxon seien möglicherweise das Resultat von Hybridation, doch setzten weder
Buffon noch Linnaeus diese Spekulationen in eine Theorie der Klassifikation oder der Evolution um. Auch
als Pallas 1766 und Lamarck 1809 und 1815 baumähnlich verzweigte Verwandtschaftsdiagramme
vorschlugen, hatte dies keinen Einfluß auf die hierarchische Klassifikation (Simpson, 1961, S. 52).
Nur wenigen ist klar, daß Darwin der Begründer des gesamten Gebietes der evolutionären Taxonomie
war. Wie Simpson richtig feststellte, „stammt die evolutionäre Taxonomie deutlich und fast ausnahmslos
von Darwin". Gemeint ist damit nicht nur, daß die Theorie der Abstammung von gemeinsamen Vorfahren
automatisch eine Erklärung für die meisten Ähnlichkeitsgrade unter den Organismen liefert (was sie
tatsächlich tut), sondern auch, daß Darwin eine wohldurchdachte Theorie mit einer detaillierten Darstellung
von Methoden und Schwierigkeiten entwickelte [1], Das ganze dreizehnte Kapitel seines Werkes Origin of
Species* (S.411-458 der ersten Auflage) ist der Darstellung seiner Klassifikationstheorie gewidmet. Sie
beginnt mit den oft zitierten Sätzen: „Seit den frühesten Zeiten der Erdgeschichte gleichen organische
Wesen einander in abnehmendem Grade, so daß sie in Gruppen und Untergruppen geteilt werden können.
Diese
_____________
*Textstellen aus Origin of Species sind zum Teil aus der deutschen Ausgabe Die Entstehung der Arten
(Stuttgart: Philipp Reclam Junior) zitiert. Die Seitenzahlen beziehen sich jedoch immer auf die englische
Ausgabe. Gleiches gilt für L.L.D., deutsch: Leben und Briefe von Charles Darwin (1883), 3 Bände
Einteilung ist keineswegs willkürlich, wie etwa die Gruppierung der Sterne zu Sternbildern" (S.411).
Zwischen den Zeilen lehnt Darwin hier die häufig vorgebrachte Behauptung ab, die Klassifikationen,
welche 1859 bereits einen beträchtlichen Grad an Ausgefeiltheit und Vervollkommnung erreicht hatten,
seien ein willkürliches und künstliches Produkt der Taxonomen. Er fährt fort:
Die Naturforscher suchten die Arten, Gattungen und Familien nach einem sogenannten Natürlichen
System zu ordnen. Aber was ist mit diesem System gemeint? Einige Autoren halten es einfach für einen
Rahmen, in dem die Lebewesen, die sich am meisten gleichen, zusammengeordnet, die sich nicht
gleichenden dagegen getrennt werden;… Viele Naturforscher aber meinen, das Natürliche System
bedeute noch mehr: sie glauben, daß es den Plan des Schöpfers enthülle. Solange jedoch nicht gesagt
wird, ob mit dem Plan des Schöpfers die Ordnung in Zeit oder Raum oder beides gemeint ist, oder was
sonst damit gemeint sein soll, scheint dieser unserer Kenntnis nichts hinzuzufügen…. Ich glaube, daß
unsere Klassifikation etwas mehr als die bloße Ähnlichkeit ausdrücken soll, und daß die gemeinsame
Abstammung – die einzige bekannte Ursache großer Ähnlichkeit zwischen Lebewesen – das Band bildet,
das zwar unter verschiedenen Modifikationsstufen verborgen ist, durch unsere Klassifikationen uns aber
teilweise enthüllt wird (S.413).
In Origin of Species wie auch in seinen Briefen unterstreicht Darwin immer wieder von neuem, daß „jede
echte Klassifikation genealogisch ist" (S. 420), daß aber „die Genealogie an und für sich noch keine
Klassifikation gibt" (L. L. D., II, S. 247). Zwar war Darwin davon überzeugt, „daß die Anordnung der
Gruppen einer Klasse, ihre gegenseitige Nebeneinander- und Unterordnung streng genealogisch sein muß,
um als natürlich zu gelten"; er erkannte aber auch, daß es damit noch nicht genug war, sondern „daß… das
Maß von Verschiedenheit in den Zweigen oder Gruppen, obschon sie in gleichem Grade mit ihren
gemeinsamen Vorfahren blutsverwandt sind, sehr ungleich sein kann, weil sie verschieden großen
Abänderungen unterlagen; und dies wird dadurch ausgedrückt, daß die Formen in verschiedene Gattungen,
Familien, Abteilungen und Ordnungen eingeteilt werden" (S. 420). Dies ist eine sehr wichtige Feststellung,
denn sie spricht, wie weiter unten noch zu erörtern sein wird, den Hauptunterschied zwischen zwei
modernen taxonomischen Schulen an, der Kladistik und der evolutionären Taxonomie.
An dieser Stelle verweist Darwin auf sein berühmtes phylogenetisches Diagramm Origin of Species (S.
116), wo jede von drei Arten (A, F und J), die im Silur der gleichen Gattung angehörten, moderne
Abkommen sehr unterschiedlichen Ranges besitzt. Die von der Art F abstammende Linie änderte sich so
wenig, daß sie immer noch der silurischen Gattung zugeordnet wird, wohingegen ihre Schwestergruppen A
und J heute andere Familien oder sogar Ordnungen darstellen (S. 125). Beim Einordnen der Rankenfüßer
bestimmte Darwin gewöhnlich den Rang aufgrund des Divergenzgrades, und nicht anhand der Nähe zum
Verzweigungspunkt (Ghiselin und Jaffe, 1973; Mayr, 1974 c).
Darwin verwandte etwa acht Jahre auf die Klassifikation der Cirripedien (Rankenfüßer) und gewann
dabei, theoretisch wie auch praktisch, einen großen Einblick in die Klassifikation (Ghiselin, 1969). Auf
diese Erfahrung gestützt, konnte er eine Liste von Empfehlungen aufstellen, die dem Taxonomen behilflich
sein sollten, herauszufinden, welche Ähnlichkeiten für die Bestimmung der „Abstammungsnähe"
(propinquity of descent) am brauchbarsten sind. Vor allem unterstrich er immer wieder die Bedeutung des
Gewichtens des taxonomischen Wertes (Informationsgehalts) aller Merkmale:
Man könnte meinen (und man tat es in alten Zeiten auch wirklich), daß diejenigen Teile der
Organisation, die die Lebensgewohnheiten und die allgemeine Stellung der Geschöpfe im Naturhaushalt
bestimmen, für ihre Einteilung besonders wichtig seien. Aber nichts ist falscher als das… Als
allgemeine Regel kann sogar gelten: Je lockerer die Beziehungen eines Körperteils zu den besonderen
Lebensgewohnheiten eines Geschöpfes sind, desto wichtiger ist er für die Klassifikation. (S.414; siehe
auch S. 425)
Insbesondere lehnt Darwin die unter den Botanikern des 17. und 18. Jahrhunderts und seit Cuvier auch
unter den Zoologen weit verbreitete Idee ab, je wichtiger eine Struktur für das Überleben und den
Fortbestand eines Organismus sei, um so wichtiger sei sie auch für seine Klassifikation. Einen Fall nach
dem anderen führt Darwin an (S. -415-416), um diesen Gedanken zu widerlegen. „Daß die bloße
physiologische Bedeutung eines Organs keineswegs seinen Wert für die Klassifikation bestimmt, erkennen
wir schon daraus, daß in verwandten Gruppen, bei denen… dasselbe Organ auch dieselbe physiologische
Bedeutung hat, dessen Wert für die Klassifikation doch sehr verschieden ist" (S.415). Er erläutert dies an
dem unterschiedlichen Wert, der den Fühlern als taxonomischem Merkmal bei verschiedenen
Insektenfamilien zukommt.
Dieser Ratschlag Darwins bedeutet keineswegs, daß er die Bedeutung der natürlichen Selektion
verneinte. Vielmehr hatte er das Empfinden, daß besondere Anpassungen möglicherweise nur einen
begrenzten Anteil des genetischen Besitzes einer Gruppe betreffen und somit weniger informativ sind als
der allgemeine Habitus. Außerdem können besondere Anpassungen unabhängig voneinander in mehreren
nicht miteinander verwandten Entwicklungslinien erworben werden, mit anderen Worten: sie sind
konvergent. Spezielle Anpassungen können auf Konvergenz beruhen; diese Einsicht schützt den
Taxonomen davor, Konvergenzen als Beweise für gemeinsame Abstammung anzusehen. Andere,
manchmal sogar scheinbar sehr geringfügige Typen von Merkmalen haben einen weitaus größeren
Informationsgehalt: „Die Bedeutung geringfügiger Merkmale für die Klassifikation hängt hauptsächlich
von ihren Beziehungen zu anderen mehr oder minder wichtigen Merkmalen ab. Der Wert von miteinander
verbundenen Merkmalen ist in der Naturgeschichte tatsächlich sehr groß" (S.417). Darwin war sich also
durchaus der simultanen Variation mehrerer Merkmale bewußt. Nach Erörterung der besonderen
Eigenschaften einiger Merkmale, etwa embryologischer, rudimentärer und geographischer Merkmale,
kommt er zu dem Schluß:
Alle die erwähnten Regeln, Behelfe und Schwierigkeiten der Klassifikation lassen sich… dadurch
erklären, daß das natürliche System auf der Abstammung mit Modifikationen begründet ist, daß die
Merkmale, die die Naturforscher für ein Zeichen echter Verwandtschaft zweier oder mehrerer Arten
halten, von einem gemeinsamen Vorfahren ererbt worden sind und also jede echte Klassifikation
genealogisch ist, und daß ferner die Gemeinsamkeit der Abstammung das unsichtbare Band bildet, das
die Naturforscher unbewußt suchten (S. 420).
Für die Merkmalsbewertung schlägt Darwin gewisse Regeln vor, von denen wir einige bereits erwähnt
haben. Wie Ray, Lamarck, de Jussieu, Cuvier, de Candolle und die meisten Klassifikatoren vorangehender
Jahrhunderte, unterstreicht auch Darwin den hohen taxonomischen Wert von Merkmalen, die über große
Gruppen hinweg konstant sind. Außerdem betont er die Bedeutung korrelierter Merkmalskomplexe,
vorausgesetzt, sie sind nicht nur das Resultat einer ähnlichen Lebensweise. Einen recht großen Abschnitt
widmet er den Ähnlichkeiten der Körperform aufgrund konvergenter Entwicklung (S. 427) und warnt den
Taxonomen davor, sich von derartiger „Ähnlichkeit, die nur auf Analogie oder Anpassung beruht" (S.
427), irreführen zu lassen [2].
Die theoretischen Diskussionen der evolutionären Klassifikation in den darauffolgenden hundert Jahren
waren wenig mehr als Fußnoten zu Darwin. Nichts von Darwins Regeln oder Prinzipien ist seither
widerlegt worden, und ebenso wenig hat man seither etwas von spezieller Bedeutung hinzugefügt. Zwei
von Darwins Empfehlungen sind besonders wichtig. Eine besteht in dem Ratschlag, zwischen
Ähnlichkeiten aufgrund von Abstammung einerseits und auf Konvergenz beruhender äußerer Ähnlichkeit
andererseits zu unterscheiden. Ein Merkmal wie die Chorda dorsalis zum Beispiel hat einen hohen
taxonomischen Wert, da es Teil eines komplexen Merkmalssystems ist, das kaum zweimal unabhängig
voneinander entstanden sein konnte. Andererseits ist die Metamerie (Segmentierung) ein auch nicht
annähernd so grundlegendes Merkmal, da feine Fülle von Beweisen dafür vorliegt, daß sie im Tierreich
mindestens zweimal unabhängig voneinander entstanden ist. Denn es ist höchst unwahrscheinlich, daß
zwischen der Metarnerie der Wirbeltiere und der der Arthropoden irgendein phylogenetischer
Zusammenhang besteht.
Darwins andere Empfehlung geht dahin, Merkmale zu „gewichten". Eine derartige Bewertung ist
wichtig, da einige Merkmale einen weit größeren Informationsgehalt besitzen als andere. Die
phylogenetische Gewichtung, wie Darwin sie praktizierte, ist ein nachträglicher Gewichtungsprozeß. Der
Wert eines Merkmals ergibt sich aus seiner Korrelation mit den (durch verschiedene Testmethoden
ermittelten) am sichersten etablierten Teilen von Klassifikationen. Einige Taxonomen hatten
Schwierigkeiten mit der Unterscheidung zwischen dieser Gewichtung und der a priori-Gewichtung (wie
sie von Cesalpino und Cuvier angewandt wurde). Doch läßt sich dies mittels angemessener Analyse
erreichen, und seitdem man sich der phylogenetischen a posteriori-Bewertung mit erneutem Interesse
zugewandt hat (Mayr, 1959 a; Cain, 1959 b), hat sie sich als brauchbare Methode erwiesen (Mayr, 1969).
Heute verschmilzt sie mit Computer-Bewertungsverfahren.
Der Grund für den höchst ungleichen Informationsgehalt sogenannter taxonomischer Merkmale ist
bisher noch nicht eindeutig geklärt worden, man nimmt jedoch an, er sei dadurch bedingt, daß einige
Komponenten des Phänotyps viel fester in den Genotyp eingebaut sind als andere. Je tiefer ein Merkmal
oder Merkmalskomplex genetisch verwurzelt ist, um so wahrscheinlicher wird er geeignet sein,
Verwandtschaftsbeziehungen erkennen zu lassen. Die Arbeiten von Schmalhausen, Waddington und
Lerner haben gezeigt, daß der Genotyp durch seine Architektur in derart stabiler Weise integriert ist, daß
bestimmte Komponenten des Phänotyps während der phyletischen Divergenz unverändert erhalten bleiben.
Die zugrundeliegenden Kanalisierungen und Regulierungsmechanismen scheinen mitunter regelrecht von
der Evolution unberührt zu bleiben, und das ist die Erklärung für die manchmal ganz unerwartete Stabilität
scheinbar belangloser Komponenten des Phänotyps.
Auf die Methodik der Klassifikation hatte die Darwinsche Revolution nur einen geringfügigen Einfluß.
Der Wendepunkt in der Geschichte der Taxonomie war zweifellos durch das Abgehen von Essentialismus
und „Abwärtsklassifikation" gekennzeichnet gewesen, und diese Entwicklung war bereits lange vor 1859
weitgehend abgeschlossen. Der entscheidende Beitrag Darwins zur Taxonomie war zweifacher Art: erstens
lieferte sein Begriff der gemeinsamen Abstammung eine erklärende Theorie für die Existenz der
Linnaeiscihen Hierarchie und für die Homogenität von Taxa in einer „natürlichen" Klassifikation; zweitens
stellte Darwin, zumindest im Prinzip, die Vorstellung von der Kontinuität der Organismengruppen wieder
her, die von Cuvier wie auch von den Naturphilosophen (in ihrer Theorie der Archetypen) abgelehnt
worden war. Sehen wir uns einige Aspekte dieser beiden Beiträge ein wenig genauer an.
Die Bedeutung von Ähnlichkeit
Wie wir gesehen haben, hatten die Quinarianer und mehrere andere Zoologen und Botaniker in den
zwanziger bis vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts erkannt, daß es zwei Arten von Ähnlichkeit bei den
Organismen gab. Die Ähnlichkeit zwischen einem Wal und einem Lahdsäugetier beruht auf
Verwandtschaft, die Ähnlichkeit zwischen einem Wal und einem Fisch auf Analogie. Die tiefer denkenden
unter diesen Forschern (etwa Strickland und Owen) erkannten, daß die Analogien durch Ähnlichkeit der
Funktion entstanden waren, waren aber außerstande, die durch Verwandtschaft bedingte Ähnlichkeit
(afflnity) zu erklären, es sei denn, sie beriefen sich auf den „Schöpfungsplan". Darwin löste das Problem,
indem er einfach feststellte, Ähnlichkeit sei Abstammungsnähe. Daraus ergab sich das Postulat, alle Taxa
sollten aus Nachkommen des jeweils nächsten gemeinsamen Vorfahren bestehen oder, in Haeckels
Ausdrucksweise, sie sollten monophyletisch sein. Zur Abgrenzung solcher Taxa war es notwendig, alle
Ähnlichkeiten und Unterschiede sorgfältig zu erforschen, um unterscheiden zu können zwischen durch
gemeinsame Abstammung bedingten Merkmalen (den einzigen, die für die Klassifikation brauchbar sind)
und analogen (konvergenten) Merkmalen (wie Hakenschnäbel bei Falken und Eulen oder Schwimmfüße
bei Wasservögeln), die unabhängig voneinander aufgrund der Ähnlichkeit der Funktion erworben wurden.
Die Wiederherstellung der Kontinuität
Die Ablehnung der Stufenleiter der Vervollkommnung durch die vergleichenden Anatomen des frühen 19.
Jahrhunderts hatte zur Folge, daß so viele unabhängige Einheiten anerkannt wurden, wie es Archetypen
(Baupläne) gab. Gleichwohl suchte man immer noch herauszufinden, was höher oder was niedriger war,
wie dies in dem Rat zum Ausdruck kommt, den Louis Agassiz seinen Schülern gab: „Jede Tatsache, die
Sie vorbringen können, um zu zeigen, daß eine Ordnung höher ist als eine andere, ist echte
wissenschaftliche Forschung". Darwins Interpretation der Linnaeischen Hierarchie als ein System, das die
gemeinsame Abstammung widerspiegelt, stellte nicht nur das Prinzip der Kontinuität wieder her, sondern
bedeutete auch ein gewaltiges Forschungsprogramm. Niemand begriff dies deutlicher als Haeckel, der
seinen Ehrgeiz daransetzte, alle Tier- und Pflanzentaxa auf der Grundlage ihrer Abstammung miteinander
zu verbinden und dies in Formi von Stammbäumen darzustellen, wie sie seither die Lehrbücher der
Systematik zieren. Haeckel war ein Künstler und stellte seine Phylogenien tatsächlich als malerische
Bäume dar, die aber zunehmend durch baumähnliche Diagramme, sogenannte Dendrogramme, ersetzt
wurden, von denen sich ein frühes Beispiel in Darwins Origin of Species findet (Voss, 1952).
Die Beziehung zwischen postulierter Stammesentwicklung und Klassifikation ist von 1859 bis heute
umstritten geblieben. Schon 1863 lehnte T. H. Huxley alle phylogenetischen Überlegungen ab und
forderte, alle Klassifikationen seien „auf rein strukturelle Überlegungen" zu gründen. „Eine solche
Klassifikation erhält ihre höchste Bedeutung als Aussage über die empirischen Gesetze der Korrelation Ion
Strukturen." Huxleys Ansicht wich hier deutlich von der Darwins ab, dessen Prinzip es war, daß man keine
Beobachtungen machen kann, wenn man keine Theorie besitzt. Heutzutage besteht der Trend, Darwins
Grundsatz anzuwenden, indem man bei jedem Taxon fragt, ob die Merkmale der in ihm enthaltenen Arten
erkennen lassen, daß das Taxon monophyletisch ist, d. h. indem man durchweg phylogenetische Postulate
aufstellt und dann überprüft, ob diese von dem taxonomischen Beweismaterial bestätigt werden.
Für Haeckel gab es keinen Zweifel daran, daß sich eine Klassifikation auf Verwandtschaft gründen
mußte, und daß man die Verwandtschaft erfuhr, sobald man die Stammesentwicklung verstanden hatte. Die
Hauptaufgabe beim Klassifizieren bestand somit darin, Methoden zu entwickeln, mit denen man die
Phylogenese herausfinden würde. Unter diesen Methoden gab es eine, die Haeckel und seine Zeitgenossen
faszinierte, die Theorie der Rekapitulation (Gould, 1977). In ihrer klassischen Form besagte diese Theorie,
die ontogenetischen Stadien rekapitulierten die Erwachsenenstadien der Vorfahren (siehe Kapitel 10). Man
weiß heute, daß diese Theorie falsch ist, doch sie hatte großen heuristischen Wert, ließ sie doch die
vergleichende Embryologie entstehen und führte zu vielen spektakulären Entdeckungen. Ihr größter
Triumph war Kowalewskys Nachweis einer Chorda bei den Larven der Manteltiere (Tunicata); das bewies,
daß sie Chordatiere sind und keine Mollusken, wie man vorher angenommen hatte. Die Tatsache, daß
Säugetierembryonen Kiemenbögen haben wie ihre Fischvorfahren (entdeckt von H.Rathke, 1825), und
viele ähnliche Entdeckungen der vergleichenden Embryologie zeigten, daß eine modifizierte
Rekapitulationstheorie recht wohl annehmbar ist, die besagt, daß Embryonen häufig embryonale Stadien
ihrer Vorfahren wiederholen. Der heuristische Wert der vergleichenden Embryologie war bereits zwischen
1820 und 1859 zur Genüge bewiesen worden durch die Entdeckung der typischen Krebslarven von
Rankenfüßern (Winsor, 1969), durch die Klärung des Lebenszyklus einiger parasitärer Krebse und
schließlich durch den Nachweis, daß der zerbrechliche Haarstern Comatula nichts anderes ist als der Kopf
der Seelilie Pentacrinus. Ja, der Wert der vergleichenden Embryologie als Ergänzung zur vergleichenden
Anatomie war der Leitgedanke von Louis Agassiz' Lowell-Vorlesungen der Jahre 1848-49. Seit 1836 hatte
Agassiz sich mit der Idee getragen, daß es einen dreifachen Parallelismus gäbe zwischen
Fossiliengeschichte, embryologischer Entwicklung und Rang in der Klassifikation (Winsor, 1976 b,
S.108).
Das Endresultat der Forschungen in der vergleichenden Anatomie und Embryologie war, daß man bei
den Tieren eine unnatürliche Klasse oder einen unnatürlichen Stamm nach dem anderen dadurch zu einer
natürlichen Klasse oder einem natürlichen Stamm machte, indem man nichtverwandte Elemente aus ihnen
entfernte, etwa Rankenfüßer und Manteltiere aus den Mollusken, und – was sehr wichtig war -, indem man
Cuviers Stamm der Radiata auseinanderbrach (Winsor, 1976 b). Dieses Verstehenlernen der
Verwandtschaft der Hauptgruppen von Wirbellosen, das seinen ursprünglichen Anstoß Cuvier und
Lamarck verdankte, machte in den fünfzig Jahren vor Erscheinen des Origin wahrscheinlich ebenso große
(oder noch größere) Fortschritte wie in den fünfzig Jahren danach. Die sorgfältige morphologische Analyse
trug mehr zum Erkennen und Abgrenzen natürlicher Taxa bei als die phylogenetische Theorie. Doch in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Erstellung von Stammbäumen eine Lieblingsbeschäftigung
von Zoologen [3].
Die Klassifikation der wichtigsten Pflanzentaxa wurde von der Evolutionstheorie wohl noch weniger
berührt als die Tierklassifikation. Unbewußt blieben die Prinzipien der scala naturae, das Voranschreiten
vom Einfachen (Primitiven) zum Komplexen, über einen langen Zeitraum hinweg das Leitprinzip der
Botaniker. Die Klassifikation der Blütenpflanzen (Angiospermen) war durch zwei Hindernisse erschwert:
Erstens gründete sie sich fast ausschließlich auf die Blütenstruktur; Holzanatomie und chemische
Bestandteile sind erst in den letzten dreißig oder vierzig Jahren ernsthaft in die Liste brauchbarer Merkmale
aufgenommen worden. Das zweite Handikap war eine irrige Auffassung davon, welches die ursprünglichen
Blüten seien. Lange Zeit nahm man nämlich an, die ersten Angiospermen seien durch den Wind bestäubt
worden und besäßen keine Blütenblätter, weshalb man unter den rezenten Familien solche wie Betulaceae,
Fagaceae und verwandte Familien (Amentiferae), die vom Wind bestäubt werden, für die primitivsten
gehalten hat. Heute weiß man, daß Windbestäubung und der damit zusammenhängende Abbau der Blüten
sekundär ist und daß am ältesten eine ganz andere Gruppe von Familien ist, die mit den Magnoliaceae und
den Ranunculaceae (Ranales) verwandt ist. Die Verbindungsglieder zwischen dieser Gruppe und den
Samenfarnen, in denen man die Stammväter der Angiospermen vermutet, sind im Fossilienmaterial bisher
noch nicht gefunden worden. Die Behandlung dieser Fragen in den jetzt führenden Lehrbüchern läßt nicht
nur den Grad der Aktivität auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten erkennen, sondern zeigt auch den
bemerkenswerten Fortschritt, der bei der Abgrenzung ziemlich homogener, natürlicher Taxa erzielt worden
ist.
Die Entwicklung der Botanik im 19. Jahrhundert ist wohl durch nichts so tiefgreifend beeinflußt worden
wie durch Hofmeisters Forschungen über den Lebenszyklus und die Fortpflanzung der Kryptogamen und
die Homologien ihrer Fortpflanzungsstrukturen. Sie ermöglichen den ersten Einblick in die
Verwandtschaftsbeziehungen der Kryptogamen, sie rissen auch den zuvor unüberwindlichen Grenzwall
zwischen Kryptogamen und Blütenpflanzen nieder. Hofmeisters Forschungen bewiesen eindeutig, daß dem
gesamten Pflanzenreich ein mehr oder weniger einheitlicher Organisationsplan zugrundeliegt. Seine
Vergleichenden Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen
(1851) legten ein solides Fundament, auf dem man nach 1859 eine Phylogenie der Kryptogamen aufbauen
konnte. Nachdem die Merkmale der verschiedenen Gruppen erst einmal deutlich herausgearbeitet worden
waren, war es relativ einfach, sie mit Hilfe des Prinzips der gemeinsamen Abstammung zu ordnen.
Bald wandte sich die Aufmerksamkeit dem Studium der Variation in der Fortpflanzung in verschiedenen
Kryptogamengruppen und ihren Verwandtschaftsbeziehungen zu. Bei keiner dieser Gruppen war eine
Klärung so dringend nötig wie bei den außerordentlich heterogenen Fungi. Der große Pionier auf diesem
Gebiet war Anton de Bary (1831-1888), der seine zahlreichen detaillierten Analysen des Lebenszyklus
verschiedener Fungusgruppen in den Jahren 1866 und 1888 zusammenfaßte und damit eine stabile
Grundlage für die eifrige Tätigkeit seiner Nachfolger schuf. Die Bedeutung und Einzigartigkeit der Fungi
kommt darin zum Ausdruck, daß mehrere Forscher sie heute von den Pflanzen abtrennen und in ein
getrenntes Reich stellen.
Der Niedergang der makrotaxonomischen Forschung
Nach 1880 nahm das Interesse an der Makrotaxonomie und an der phylogenetischen Forschung
allmählich, aber spürbar ab. Dafür gab es zahlreiche Gründe, deren einige in dem Gebiet selbst zu suchen
sind, andere aber äußere Gründe waren. Am wichtigsten war vielleicht ein Gefühl der Enttäuschung
angesichts der Schwierigkeit, eindeutige Ergebnisse zu erhalten. Ähnlichkeit ist gewöhnlich ein recht
genauer Indikator der Verwandtschaft, wenn es um die Klassifikation von Taxa unterhalb des Ranges der
Ordnungen geht. Bei der Einordnung der höheren Taxa (Ordnungen, Klassen und Stämme) ist die
Ähnlichkeit keine verläßliche Richtschnur mehr, und daher waren die Fortschritte enttäuschend gering. Die
meisten Nicht-Taxonomen sind erstaunt, wenn sie hören, wie wenig sicher unsere Kenntnis der
Verwandtschaftsgrade der Organismen sogar heute noch ist. Zum Beispiel wissen wir bei der Mehrheit der
Vogelordnungen immer noch nicht, welche andere Ordnung jeweils am nächsten mit ihr verwandt ist. Das
gleiche gilt für viele Säugetierfamilien und gattungen, zum Beispiel für die Lagomorpha, Tubulidentata,
Xenarthra und die Tupajas.
Doch diese Ungewißheiten bei der Klassifikation der höheren Wirbeltiere sind unbedeutend im
Vergleich zu denen, die bei der Einstufung der Wirbellosen, der niedrigen Pflanzen und vor allem der
Prokaryota und Viren bestehen. Liest man heutige Abhandlungen über die Klassifikation der niederen
Wirbellosen, so ist man über die Tatsache verblüfft, daß heute zum Teil dieselben Fragen immer noch
umstritten sind, um die sich die Auseinandersetzungen in den siebziger, achtziger und neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts drehten. In der Regel gibt es zwar Meinungen, denen die Mehrheit zustimmt, doch ist
die bloße Tatsache, daß einige Forscher auf das heftigste unorthodoxe Alternativen verfechten, ein
Gradmesser der immer noch herrschenden Unsicherheit. Um dem Leser eine Vorstellung von den
Problemen zu vermitteln, bei denen die Ansichten auseinandergehen, möchte ich einige Fragen stellen: Aus
welcher Gruppe von Protozoen haben sich die Metazoen entwickelt? Besitzen alle Metazoen einen
einzigen Stammvater unter den Protozoen oder haben sich die Schwämme getrennt entwickelt? Rangieren
die Mesozoen, die Coelenterata oder die Turbellaria als primitivste Metazoen über den Schwämmen? Ist
die Aufteilung der höheren Wirbellosen in Protostomia und Deuterostomia natürlich? In welche dieser
beiden Gruppen (sofern man sie anerkennt) gehören die Tentaculata (Lophophorata)? Wie zuverlässig ist
die Theorie der Archicoelomata?
Viele Probleme der Verwandtschaft bei den Arthropodentaxa sind ebenfalls noch ungelöst, genauso wie
die Herleitung der Arthropoden von den Anneliden. Kerkut (1960) hat richtig auf diese Unsicherheiten
aufmerksam gemacht, deren sich niemand besser bewußt ist als die Spezialisten selber. Da dies hier eine
Ideengeschichte ist, ist es unmöglich, die Geschichte der aufeinanderfolgenden Klassifikationen der
höheren Tier- und Pflanzentaxa in den letzten zweihundert Jahren auch nur zu skizzieren. Es ist eine
faszinierende Geschichte [4]. In jeder Generation erweckten neue Prinzipien (etwa das der Rekapitulation)
oder neu entdeckte Merkmale neue Hoffnungen, doch der Fortschritt war langsam.
Angesichts der erfolglosen Versuche, die Verwandtschaftsbeziehungen der wichtigsten Tierstämme zu
ergründen, lehnte zumindest ein kompetenter Zoologe um die Jahrhundertwende die Abstammung von
gemeinsamen Vorfahren ab. Fleischmann (1901) nannte die Theorie einen schönen Traum, der jedoch
durch keine Fakten gestützt werde.
Kerkut zog fünfzig Jahre später zwar keine so extreme Schlußfolgerung, war aber ebenso pessimistisch
hinsichtlich der Frage, ob man jemals zu einem Verständnis der Verwandtschaft der höheren Tiertaxa
gelangen würde. Wir müssen ehrlich zugeben, daß unsere Unkenntnis dieser Verwandtschaftsbeziehungen
immer noch groß genug, um nicht zu sagen, überwältigend, ist. Es ist dies ein deprimierender Zustand,
wenn wir bedenken, daß seit der großen Zeit des Stammbaum-Aufstellens unmittelbar nach Erscheinen von
Darwins Origin mehr als hundert Jahre vergangen sind. Die morphologischen und embryologischen
Hinweise sind für die Aufgabe einfach nicht ausreichend.
Ein zweiter Grund für die nach-Darwinsche Ernüchterung hinsichtlich der Makrotaxonomie war die
Verwirrung der Begriffe. Als Haeckel und seine Anhänger darauf bestanden, nur solche Klassifikationen
seien natürlich, die auf Phylogenie beruhten, widersprachen, seine Gegner mit dem Argument: und wie
erkennen wir die Phylogenie? Werden nicht Phylogenien von den Befunden abgeleitet, zu denen man im
Laufe der Aufstellung von Klassifikationen gelangt? Wie können wir also Klassifikationen auf
Phylogenien aufbauen, ohne uns hoffnungslos in einem circulus vitiosus zu verstricken? Erst vor relativ
kurzer Zeit hat man einen Ausweg aus diesem Dilemma gefunden: Weder basiert die Phylogenie auf
Klassifikation, noch ist umgekehrt Klassifikation auf Phylogenie gegründet. Beide beruhen auf einer
Erforschung „natürlicher Gruppen", die man in der Natur vorfindet und die Merkmalskombinationen
aufweisen, wie man sie bei Abkömmlingen von einem gemeinsamen Vorfahren erwarten würde. Sowohl
Klassifikation als auch Phylogenie beruhen auf demselben Vergleich von Organismen und ihren
Merkmalen und auf einer sorgfältigen Beurteilung ihrer Ähnlichkeiten und Unterschiede (Mayr, 1969). Die
Vertreter der evolutionären Taxonomie stimmen heute darin überein, daß biologische Klassifikationen mit
der vermuteten Phylogenie übereinstimmen müssen. Diese Begriffsklärung hat einem erneuten Interesse an
der Klassifikation höherer Taxa den Weg bereitet.
Andere Ursachen für das Nachlassen des Interesses an der Makrotaxonomie nach 1900 waren äußerer
Art. Die Behauptung der Mendelianer, Mutationen brächten neue Arten hervor, hatte zur Folge, daß sich
ein Großteil der Tätigkeit in der Taxonomie auf die Mikrotaxonomie (das „Artenproblem") verlagerte und
schließlich in der neuen Systematik seinen Höhepunkt erreichte. Da man in weiten Kreisen die Unterarten
als beginnende Arten ansah, widmeten viele Fachwissenschaftler – insbesondere Vogel-, Säugetier-,
Schmetterlings- und Schneckenforscher – ihre ganze Aufmerksamkeit der Beschreibung neuer Unterarten.
Die gründliche Beschäftigung mit der Artstufe brachte auch endlos viele noch unbeschriebene Arten zum
Vorschein, und das alles trug zur Vernachlässigung der Makrotaxonomie bei.
Vielleicht der wichtigste Faktor, der für den Niedergang der Makrotaxonomie verantwortlich war, war
die wachsende Konkurrenz seitens anderer Zweige der Biologie. Infolge der erregenden Entdeckungen in
der experimentellen Biologie (Entwicklungsmechanik, Zytologie, Mendelsche Genetik, Physiologie,
Biochemie) wandte sich die Mehrheit der begabtesten jungen Biologen diesen Gebieten zu. Die Folge war
eine knappere personelle Besetzung in der Taxonomie und eine Verringerung der institutionellen
Unterstützung dieses Zweiges der Biologie.
Von den 29 Referaten, die auf dem 1957 in Uppsala zum Gedächtnis des 250. Geburtstages von
Linnaeus veranstalteten Symposium „Systematik heute" gehalten wurden, befaßten sich lediglich vier mit
Problemen der Makrotaxonomie. Damit wird in überzeugender Weise das überwiegende Interesse an der
Artebene veranschaulicht, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Mehrheit der Taxonomen
charakteristisch war. Trotzdem war auch während dieser Zeit ein schwaches Interesse an der Klassifikation
höherer Taxa geblieben, was zur Veröffentlichung einer Reihe bedeutender Arbeiten über Probleme und
Begriffe der Klassifikation geführt hat, etwa die von Bather (1927), Simpson (1945), Rensch (1947) und
Huxley (1958). Mit Beginn der sechziger Jahre war die Aufgabe der neuen Systematik in der
Mikrotaxonomie, zumindest die Entwicklung von Begriffen, weitgehend abgeschlossen, und die Zeit war
reif für eine erneute Beschäftigung mit der Makrotaxonomie.
Die Notwendigkeit einer neuen Methodik
Der glänzende Anfang Darwins, die Entwicklung einer Theorie und Methodik der Makrotaxonomie, geriet
nach ihm weitgehend in Vergessenheit. Die Maßstäbe, nach denen Gattungen, Familien und Ordnungen
anerkannt und in noch höheren Taxa zusammengefaßt wurden, waren bei den verschiedenen Gruppen von
Organismen höchst unterschiedlich. Bei den weniger bekannten Gruppen waren „Klassifikationen" nach
einem Einzelmerkmal, oder richtiger gesagt, Identifikationssysteme, immer noch sehr in Mode. Da
verschiedene Autoren sich für verschiedene Schlüsselmerkmale entscheiden konnten, entstanden
Kontroversen der gleichen Art, wie sie im 17. Jahrhundert für die Botanik charakteristisch gewesen waren.
Die Taxonomen schlugen häufig neue Klassifikationen vor, für die sie keine angemessene Rechtfertigung
vorbringen konnten außer dem Anspruch, sie seien „besser". Für Linnaeus hatten die Namen der höheren
Taxa den Zweck gehabt, als Gedächtnisstützen zu dienen, aber jene Zoologen und Botaniker, die
Gattungen und Familien in immer kleinere Stücke aufspalteten, verloren dieses Ziel völlig aus den Augen.
Das ging so weit, daß zum Beispiel bei den Vögeln gewisse Autoren in den zwanziger und dreißiger Jahren
unseres Jahrhunderts für nahezu jede Art eine eigene Gattung anerkannten. Es gab keine Richtschnur für
die Anwendung der höheren Kategorien. Ein berühmter Ornithologe verteilte die Vogelfamilien auf 25
Ordnungen, ein anderer ebenso hervorragender Autor ordnete sie in 48 Ordnungen ein. Wer von außen,
etwa von den angewandten Wissenschaften (wie Medizin, Landwirtschaft oder Ökologie) her einen Blick
auf die Makrotaxonomie warf, dem mußte die Situation in der Taxonomie völlig chaotisch erscheinen, was
sie in der Tat auch war.
Dennoch war die Lage nicht ganz und gar hoffnungslos. Es gab wenigstens einige brauchbare
Lehrbücher über Theorie und Praxis der zoologischen Systematik (Ferris, 1928; Rensch, 1934; Mayr,
Linsley und Usinger, 1953). In der Literatur verstreut fanden sich gelegentlich einschneidende
Erörterungen über bestimmte Aspekte der Klassifikationstheorie, beispielsweise von Mayr (1942, S.280291) über die Bedeutung der Gattung und, wichtiger, von Simpson (1945) über die Theorie der
Makrotaxonomie. Vielleicht die hervorragendste konstruktive Entwicklung der Epoche bestand darin, daß
die höheren Taxa ökologische Bedeutung erhielten. Man erkannte, daß höhere Taxa aus Arten
zusammengesetzt sind, die als Aggregat eine spezifische Nische oder Anpassungszone besetzen. Mit
anderen Worten: Der Schwerpunkt verschob sich von dem morphologischen Merkmal als Kennzeichen
eines höheren Taxon zur biologischen Bedeutung dieses Taxon im Naturhaushalt. Nichtsdestoweniger warf
die Klassifikation für den Durchschnittsbiologen schwerwiegende Probleme auf, um es sehr gelinde
auszudrücken. Die neue Systematik hatte, da sie sich weitgehend auf die Artebene konzentrierte, keine
Lösung für die Bedürfnisse der Makrotaxonomie gebracht. Die Hilfe mußte von anderer Seite kommen.
Unabhängig voneinander wurden zwei diametral entgegengesetzte Lösungen vorgeschlagen: numerische
Phänetik und Kladistik. Beide neue Methoden waren nicht als Reformen gedacht, sondern als revolutionäre
Substitution der bestehenden Verfahren.
Die numerische Phänetik
Bei fast jedem Klassifikationsverfahren werden Objekte aufgrund ihrer Ähnlichkeit in Gruppen
eingeordnet. Doch die Konstruktion biologischer Klassifikationen mit der Methode der nachträglichen
Merkmalsbewertung, wie sie von den empirischen Taxonomen seit Adanson praktiziert und von Darwin
theoretisch gerechtfertigt wurde, setzt beträchtliche Kenntnisse und Erfahrung voraus. Völlig zu recht
wurde daher gelegentlich die Frage laut, ob es nicht möglich sei, eine Methode zu entwickeln, mit der
jemand ohne jede Erfahrung, ja sogar ein Nicht-Biologe, Arten in „natürliche" Gattungen und höhere Taxa
gruppieren könne. In der Tat wäre es sogar für den erfahrenen Taxonomen von Vorteil, wenn er in Fällen,
in denen zwei oder mehr Autoren sich über die optimale Klassifikation nicht einig sind, auf eine
automatische und objektive Methode zurückgreifen könnte. Das wesentliche Element eines derartigen
Herangehens wäre die Entwicklung von Verfahren, mit denen sich Ähnlichkeitsgrade quantifizieren und
eine qualitative oder subjektive Taxonomie in eine objektive, numerische Taxonomie umwandeln lassen.
Die Geschichte der numerischen Taxonomie ist noch nicht geschrieben. Erste bahnbrechende
Bemühungen reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, obwohl die meisten von ihnen sich mit
intraspezifischer Variation, insbesondere mit geographischer Variation befassen. Einzelne Versuche,
numerische Methoden auf die Klassifikation von Arten, Gattungen und noch höhere Taxa anzuwenden,
sind gewöhnlich in der taxonomischen Literatur begraben und nur einigen wenigen Spezialisten bekannt.
Hinweise auf diese Literatur finden sich in Simpson, Roe und Lewontins Quantitative Zoology (1960).
Ein fast vergessener Pionier war der Genetiker A. H. Sturtevant (1939; 1942). Er traf zahlreiche
Vorkehrungen, um möglichst jede Voreingenommenheit zu vermeiden und schloß alle erfahrungsgemäß
adaptiv oder durch Entwicklung korrelierten Merkmale aus seinen Berechnungen aus. Bei einer Analyse
von 39 Merkmalen von Drosophila-Arten konnte er 58 Arten in eine Reihe von Verwandtschaftsgruppen
einordnen und, weit wichtiger, zu mehreren recht weitreichenden Verallgemeinerungen gelangen, die
seither wiederholt bestätigt worden sind. Die erste dieser Verallgemeinerungen besagt, daß streng
phänetische Methoden am zuverlässigsten sind, wenn sie auf nahe Verwandte angewandt werden, bei
Anwendung auf entfernt verwandte Formen aber gewöhnlich zu widersprüchlichen Resultaten führen.
Außerdem gelang ihm eine Definition sogenannter guter Merkmale („good characters"), indem er die
Korrelation zwischen den verschiedenen Merkmalen in Tabellen erfaßte und entdeckte, daß diejenigen
Merkmale die „besten" sind, die als nützliche Indikatoren der wahrscheinlichen Natur anderer Merkmale
dienen konnten, oder, mit anderen Worten, Merkmale, die mit anderen kovariant waren.
Nach Erfindung des Elektronenrechners kamen unabhängig voneinander drei Gruppen von Taxonomen,
C. D. Michener und R. R. Sokal (1957) in Kansas, der Bakteriologe P. H. A. Sneath (1957) in London und
A. J. Cain und G. A. Harrison (1958) in Oxford auf den Gedanken, Computerverfahren für die
Quantifizierung der Ähnlichkeit und das Gruppieren von Arten und höheren Taxa für derartige quantitative
Methoden einzusetzen. Der zentrale Aspekt ihrer Vorschläge war der, die integrierende Fähigkeit des
menschlichen Gehirns, die in der klassischen Taxonomie das Ordnen von Taxa lediglich anhand von
genauer Betrachtung oder durch Auflistung von Ähnlichkeiten erzielt hatte, durch die mechanischen
Operationen des Computers zu ersetzen. Dies, so glaubten sie, würde die in der Vergangenheit übliche
willkürliche und subjektive Bewertung durch eine objektive und beliebig wiederholbare Methode ersetzen.
Zunächst waren siph alle drei Gruppen darin einig, daß allen Merkmalen gleiches Gewicht gegeben werden
sollte, doch erkannten Cain und Harrison (1960) bald, daß die verschiedenen Merkmale unterschiedlichen
Informationsgehalt besaßen, und schlugen daher ein „phyletisches Gewichten" vor. Auch Michener
distanzierte sich bald von seinem ursprünglichen Vorschlag. Die beiden verbleibenden Pioniere, Sokal und
Sneath, jedoch taten sich zusammen und trugen 1963 in einem klassischen Werk, Prindples of Numerical
Taxonomy, ihre Methodologie und Philosophie vor. Die Bezeichnung „numerische Taxonomie" war
irreführend, da, wie Simpson und andere ausführten, numerische Methoden seit Generationen in der
Taxonomie, und zwar bei den unterschiedlichsten taxonomischen Schufen, in Gebrauch waren. Es hat sich
daher eingebürgert, das taxonomische Methodensystem von Sokal und Sneath mit dem Namen numerische
Phänetik zu bezeichnen. Bedauerlicherweise wurden bei der Verbreitung der neuen Methode summarische
Behauptungen aufgestellt, die später nicht bestätigt werden konnten. Zum Beispiel hieß es, zwei beliebige
Wissenschaftler, die völlig unabhängig voneinander, jedoch mit demselben Merkmalskomplex arbeiteten,
kämen mit der neuen phänetischen Methode zu identischen Schätzwerten der Ähnlichkeit zwischen zwei
Organismen. Diese Behauptungen trafen offensichtlich nicht zu, und das rief unter erfahrenen traditionellen
Taxonomen beträchtliche Gegnerschaft hervor [5]. Eine kräftig überarbeitete zweite Auflage (1973) von
Sokal und Sneath enthält viele Verbesserungen. Weitere Arbeiten auf dem Gebiet der numerischen
Taxonomie stammen von Jardine und Sibson (1971) und Clifford und Stephenson (1975). Ein etwas
anderer Ansatz findet sich auch bei Throckmorton (1968). Wie Darwin bereits dargelegt hatte, haben
verschiedene Merkmale einen verschiedenen Informationsgehalt, und wenn man verschiedene Gemische
von Merkmalen auswählt, gelangt man oft zu recht unterschiedlichen Klassifikationen. Verschiedene
Körperteile, verschiedene Stadien im Lebenszyklus, und morphologische im Gegensatz zu biochemischen
Merkmalen – sie alle führen zu anderen Ähnlichkeitsschätzwerten. Um ihre Objektivität zu beweisen,
schlug die numerische Phänetik vor, die Art als Klassiflkationseinheit abzulehnen und durch „operationale
taxonomische Einheiten" (operational taxonomie units- OTUs)zu ersetzen, als ob das eine Verbesserung
wäre. Tatsächlich führte dies zu denselben praktischen Schwierigkeiten, die zur Aufgabe des typologischen
Artbegriffs geführt hatten. Die Phänetiker mußten entweder die verschiedenen Geschlechter, Altersklassen
und Morphen als verschiedene OTUs behandeln und dann Männchen und Weibchen und andere stark
abweichende Phänotypen in verschiedene Taxa einteilen, oder aber sie mußten eine sehr sorgfältige
Analyse biologischer Varianten (Phäna) vornehmen, und solche Varianten zu OTUs zusammenfassen, die
mit den biologischen Arten zusammenfallen. Eine solche Bewertung der Variation, wenn auch weitaus
realistischer, erforderte jedoch genau die gleiche Art subjektiver Beurteilungen, die durch die „objektive"
phänetische Methode angeblich ausgeschlossen worden waren.
Der weitaus wichtigste Unterschied zwischen traditionellen Taxonomen und numerischen Phänetikern
liegt in ihrer Einstellung zur Bewertung taxonomischer Merkmale, wobei es nur drei Möglichkeiten gibt.
Bei der ersten sind alle Merkmale gleichwertig, d.h. haben bei der Klassifikation dieselbe Bedeutung.
Obschon die Anhänger der Phänetik dies als eine „nichtgewichtende" Methode bezeichnet haben, ist es
natürlich ein vorheriges Gewichten, wenn man jedem Merkmal die gleiche Bedeutung zuteilt. Es ist ebenso
irreführend wie das a priori-Bewertungsverfahren von Aristoteles, Cesalpino und Cuvier. Ob ein im
Wasser lebendes wirbelloses Tier eine Chorda besitzt oder nicht, ist von größerem taxonornischem Wert
als hundert andere Merkmale. Daß einige Merkmale eine Fülle an Information über Verwandtschaft
enthalten, während andere lediglich „Geräusch" sind, hat bereits Adanson vor mehr als zweihundert Jahren
betont (Farn. pl. 1763,I,S.clxvii).
Die zweite Möglichkeit des Gewichtens besteht darin, daß man eine Reihe feststehender Kriterien
zugrundelegt, etwa physiologische Bedeutung, anhand derer man die relative taxonomische Bedeutung
verschiedener Merkmale bestimmen kann. Dies war die a priori-Methode von Aristoteles und Cuvier. Die
dritte Option schließlich ist ein a posteriori-Bewerten, bei dem die Organismen zuerst (unter
Berücksichtigung zahlreicher Merkmale und Merkmalskombinationen) in anscheinend natürliche Gruppen
geordnet werden und dann denjenigen Merkmalen das größte Gewicht verliehen wird, deren Verbreitung
im System am engsten mit den natürlichen Gruppen verbunden zu sein scheint. Das war Darwins Ansatz;
er kam zu dem Ergebnis: „Die Bedeutung geringfügiger Merkmale für die Klassifikation hängt
hauptsächlich von ihren Beziehungen zu anderen mehr oder minder wichtigen Merkmalen ab" (S.417).
In der Geschichte der Taxonomie waren sich nahezu alle erfahrenen Taxonomen stets dessen bewußt
und haben häufig darauf aufmerksam gemacht, wie unterschiedlich der taxonomische Wert verschiedener
Merkmale sein kann. Eine Klassifikation von Menschenaffen und Hominiden, die primär auf der Struktur
der Großhirnrinde aufbaut, würde erheblich anders ausfallen als eine Klassifikation auf der Grundlage ihrer
physiologischen Makromoleküle (Hämoglobin, etc.). Die jüngere Generation der numerischen Taxonomen
weiß die auffallenden Unterschiede im Informationsgehalt verschiedener Merkmale zu schätzen und
konzentriert sich jetzt darauf, Intuition und subjektive Bewertung durch objektive a posteriori Bewertungs
verfahren (etwa auf der Grundlage von Korrelationsanalysen, etc.) zu ersetzen.
Die Phänetiker setzen die Gesamtheit der Ähnlichkeitswerte einzelner Merkmale in einen einzigen
„phänetischen Abstand" oder Gesamtähnlichkeitswert um. Wie Simpson (1964 a) jedoch sehr richtig
festgestellt hat, bedeutet „ein einziges Ähnlichkeitsmaß… einen enormen Informationsverlust,
hauptsächlich hinsichtlich der Merkmalsrichtung und des Ursprungs von Unterschieden". Die
Quantifizierung der Ähnlichkeit bei einem Vergleich von so hochgradig heterogenen Einheiten, wie es die
Merkmalskomplexe verschiedener Taxa sind, ist in jedem Fall grundsätzlich anfechtbar. Aus diesem Grund
ist die Phänetik auch als typologische Methode bezeichnet worden, und Simpson kam zu dem Schluß, die
Phänetik habe „zu einem Rückschritt im taxonomischen Prinzip… einem bewußten Wiederauflebenlassen
von präevolutionären, dem 18. Jahrhundert zugehörigen Prinzipien" geführt.
Man könnte über die begrifflichen Schwächen der Methode hinwegsehen, wenn es ihr gelungen wäre,
praktische Resultate zu erzielen. Um jedoch die Nichterfassung der Mosaikevolution und den „Lärm um
nichts" der aussageschwachen Merkmale wenigstens zum Teil zu kompensieren, müssen die Phänetiker
eine sehr große Zahl von Merkmalen (vorzugsweise über hundert) programmieren. Zwar läßt sich in
Gruppen, die morphologisch so komplex sind wie die Arthropoden (Insekten, Arachniden usw.),
gewöhnlich eine solche große Zahl von Merkmalen finden, in den meisten Organismengruppen jedoch
mangelt es ernsthaft an taxonomisch brauchbaren Merkmalen. Dies allein schließt die Anwendung einer
Methode aus, die auf der ungewichteten Merkmalsanalyse beruht. Darüber hinaus ist das Verfahren selbst
bei den Insekten sehr mühsam, und das Programmieren von hundert oder mehr Merkmalen bei einer
großen Zahl von Taxa außerordentlich zeitraubend. Einer der Pioniere der Phänetik, C. D. Michener, kehrte
aus diesem Grunde bei der Klassifikation einer großen Sammlung australischer Bienen (die zahlreiche neue
Arten enthielt) zu den traditionellen Methoden zurück.
Heute, etwa fünfundzwanzig Jahre nachdem die phänetische Philosophie zum ersten Mal verkündet
wurde, kann man es wagen, ein erstes vorläufiges Urteil über die Gültigkeit und Nützlichkeit ihrer
Verfahren abzugeben. Es ist klar, daß jeder Klassifikation ein phänetischer Ansatz zugrundeliegt, nämlich
der Versuch, Gruppen „ähnlicher" Entitäten zusammenzufassen. Der Erfolg dieser Bemühung hängt von
den Methoden und Grundsätzen ab, mit deren Hilfe die Ähnlichkeit bestimmt wird. Die numerische
Phänetik hat in dieser Beziehung eindeutig versagt, da sie auf einem gleichmäßigen Gewichten bestanden
und sich somit dafür entschieden hat, alle phyletische Information außer acht zu lassen.
Die der numerischen Phänetik zugrundeliegende Philosophie hat zwar versagt; doch das ist kein Grund,
nicht die Brauchbarkeit vieler der von den Phänetikern entwickelten und angewandten numerischen und
insbesondere multivariablen Methoden anzuerkennen. Die von den numerischen Taxonomen in
Pionierarbeit begründeten Verfahren sind heute in vielen Wissenschaftsgebieten und in anderen Bereichen,
wo das Sortieren und Klassifizieren von Daten wichtig ist, weitverbreitet. Der größte Beitrag der
numerischen Phänetik dürfte darin bestehen, die Verwendung solcher Methoden befürwortet und in die
Taxonomie eingeführt zu haben. Nicht zu unterschätzen ist weiter, daß sie großen Nachdruck auf das in der
Geschichte der Taxonomie von den besten Taxonomen unterstützte Prinzip legte, möglichst viele
unterschiedliche und neue Informationen liefernde Merkmale und Merkmalssysteme heranzuziehen.
Am brauchbarsten sind die phänetischen Methoden beim Einordnen von Arten in große Gattungen und
beim Einteilen von Gruppen mit noch rückständiger Klassifikation. Andererseits kenne ich keinen
nennenswerten Beitrag der numerischen Phänetik zur Klassifikation einer reifen Gruppe oder zur
Klassifikation auf der Ebene von Ordnungen, Klassen oder Stämmen.
Am meisten verspricht die numerische Phänetik vermutlich für die Weiterentwicklung von
Gewichtungsverfahren. Diese gründen sich entweder auf die korrelierte Variation (Kovariation) von
Merkmalen oder auf empirische Leitlinien. Die vermuteten Abkömmlinge eines gemeinsamen Vorfahren
sind fast immer an der Gemeinsamkeit bestimmter Merkmale erkennbar, und es ist lediglich eine Sache des
gesunden Menschenverstandes, einigen Merkmalen ein größeres Gewicht zuzubilligen als anderen. Jeder
klassifikatorische Ansatz ohne Gewichtung von Merkmalen ist eindeutig ineffizient.
In ihrem Bemühen, „streng objektiv" zu sein, verzichten die phänetischen Schulen auf die
Berücksichtigung jeglicher phyletischer Evidenz. Gerade darauf legt jedoch die Kladistik, eine
entgegengesetzte Schule der Klassifikation, das größte Gewicht.
Die Kladistik
Der Vorschlag der unter dem Namen „Kladistik" bekannten taxonomischen Schule geht auf dieselbe
Überlegung zurück wie die Phänetik: Man wollte Subjektivität und Willkür aus der Klassifikation
ausschalten, indem man eine wirklich automatische Methode entwickelte. Die erste umfassende
Darstellung der Kladistik wurde 1950 von Willi Hennig in seiner Theorie der phylogenetischen Systematik
veröffentlicht. Nach Hennigs Ansicht sollten Klassifikationen ausschließlich auf der Genealogie, d.h. auf
dem Verzweigungsmuster des Stammbaums, aufgebaut werden. Phylogenese, so behauptet er, besteht in
einer Abfolge von Dichotomien, deren jede das Aufspalten einer Elternart in zwei Schwester-(d.h. Tochter)arten verkörpert: die Stammart, so nimmt er an, höre mit der Aufspaltung zu existieren auf. Den
Schwestergruppen ist derselbe kategorische Rang zuzuweisen und die ancestrale Art zusammen mit all
ihren Abkömmlingen in einem einzigen, holophyletischen Taxon zusammenzufassen.
Hennigs Arbeit ist in ziemlich schwierigem Deutsch geschrieben, einige Sätze sind schlechthin
unverständlich. Sie bezieht sich an keiner Stelle auf die Schriften von Huxley, Mayr, Rensch, Simpson und
andere Autoren, die Jahrzehnte früher zum Teil über genau das gleiche Gebiet geschrieben hatten. Neue
Termini und Definitionen werden beiläufig eingeführt, doch gibt es keinen Index, mit dessen Hilfe man die
betreffenden Seiten finden könnte. Kein Wunder: der Band blieb, einige wenige deutsche Autoren
ausgenommen, in der Welt der Wissenschaft zunächst unbekannt. Erst 1965 und 1966, als englische
Versionen von Hennigs Methodensystem veröffentlicht wurden, erlangte es größere Verbreitung und in
den siebziger Jahren hatte sich ein wahrer Hennig-Kult entwickelt, obgleich sich einige seiner sogenannten
Anhänger recht weit von seinen ursprünglichen Prinzipien entfernt haben.
Hennig hatte seine Methode als phylogenetische Systematik bezeichnet; sie beruht aber nur auf einer
einzigen Komponente der Phylogenese, der Verzweigung von Entwicklungslinien, weshalb sie von
anderen Autoren in Kladistik oder Kladismus umbenannt wurde; unter dieser Bezeichnung ist sie heute
bekannt.
Der entscheidende Aspekt der Kladistik ist die sorgfältige Analyse aller Merkmale bei einem Vergleich
verwandter Taxa und das Aufteilen dieser Merkmale in ancestrale (plesiomorphe) und einmalig abgeleitete
(apomorphe) Merkmale. Die Verzweigungspunkte in der Phylogenese werden bestimmt durch das
Rückwärtsverfolgen von einmalig abgeleiteten Merkmalsausprägungen (Synapomorphien), da man davon
ausgeht, daß solche apomorphen Merkmale lediglich unter den Nachkommen des Vorfahren vorkommen,
bei dem das Merkmal zuerst auftrat. Diese Methode soll die Rekonstruktion der Phylogenese ohne fossiles
Beweismaterial gestatten, und diese Behauptung ist in der Tat in gewissem Umfang bestätigt worden.
Seit Darwin ist es stets das Ziel der evolutionären Taxonomie gewesen, ausschließlich monophyletische
Taxa anzuerkennen, d.h. Taxa, die ausnahmslos aus Nachkommen eines gemeinsamen Vorfahren bestehen.
Gruppen, von denen man annimmt, sie seien monophyletisch, werden fortwährend an immer neuen
Merkmalen getestet, um festzustellen, ob das Postulat der Monophylie bestätigt wird oder nicht. Der
Vorwurf, die Methode sei zirkulär, ist jedoch, wie Hull (1967) gezeigt hat, nicht gerechtfertigt. Anhand des
sorgfältigen Vergleichs von Arten und Gattungen, die einem höheren Taxon angehören, und der Analyse
aller Ähnlichkeiten, um zu bestimmen, ob sie wirklich homogen sind, war man 1950 in der Tat zu der
Feststellung gelangt, daß die Mehrheit der anerkannten Tiertaxa (bei Pflanzen traf dies weniger zu)
monophyletisch sei. Willi Hennig war jedoch der erste Autor, der ausdrücklich den Grundsatz formulierte,
Verzweigungspunkte in der Genealogie sollten ausschließlich auf synapomorphen Merkmalen aufbauen.
Seiner Meinung nach beweist der gemeinsame Besitz von einmalig abgeleiteten Merkmalsausprägungen
die Abstammung einer gegebenen Artengruppe von einem gemeinsamen Vorfahren.
Kladistische Analyse
Im Prinzip ist die Methode der kladistischen Analyse zur Abgrenzung monophyletischer Gruppen ein
großartiges Verfahren. Es artikuliert objektive Kriterien für die Feststellung der gemeinsamen
Abstammung. Es zwingt zu einer sorgfältigen Analyse aller Merkmale und führt ein neues Prinzip der
Merkmalsbewertung ein, nämlich das des gemeinsamen Besitzes von synapomorphen Merkmalen.
Gruppen mit denselben synapomorphen Merkmalsausprägungen sind Schwestergruppen. Dennoch ist eine
Reihe von Einwänden gegen die kladistische Analyse erhoben worden.
Der erste Einwand betrifft die Terminologie. Hennig führte eine beträchtliche Zahl neuer Termini ein,
von denen die meisten unnötig waren (obgleich die Ausdrücke „plesiomorph" und „apomorph" immer
noch allgemein in Gebrauch sind). Ebenso verwirrend war Hennigs Versuch, fest etablierte Ausdrücke auf
völlig andere Begriffe zu übertragen, beispielsweise beschränkte er den Ausdruck „Phylogenese" auf die
abzweigende Komponente der Phylogenese, definierte „Verwandtschaft" strikt im Sinne der Nähe zum
nächsten Verzweigungspunkt und – am gravierendsten – nahm dem Ausdruck „monophyletisch" seine
übliche Bedeutung als Bezeichnung eines Taxon, und übertrug es stattdessen auf den Abstammungsprozeß.
Seit Haeckel war die Reihenfolge der einzelnen Schritte immer so gewesen, daß man ein Taxon zuerst auf
der Grundlage phänetischer Betrachtungen abgrenzte, und dann testete, ob es monophyletisch war oder
nicht. Die Kladisten fassen einfach alle vermuteten Nachkommen einer gegebenen Art in einem
„monophyletischen" Taxon zusammen, selbst wenn sie so verschieden sind wie Vögel und Krokodile.
Das zweite Problem ist die Schwierigkeit, die Synapomorphie zu bestimmen. Wenn zwei Taxa ein
abgeleitetes Merkmal gemeinsam haben, so kann dies zwei verschiedene Ursachen haben. Entweder ist das
Merkmal von dem nächsten gemeinsamen Vorfahren abgeleitet (echte oder homologe Synapomorphie)
oder aber durch Konvergenz erworben worden (nicht homologe oder Pseudoapomorphie). Die
Zuverlässigkeit der Feststellung, ob eine Gruppe monophyletisch ist, hängt in hohem Maße davon ab, mit
welcher Sorgfalt man zwischen diesen beiden Klassen von Ähnlichkeiten unterscheidet. Die Häufigkeit,
mit der nicht-homologe „Apomorphien" auftreten, ist von vielen Kladisten unterschätzt worden. Wie
häufig eine gegebene, sogar allem Anschein nach recht unwahrscheinliche, Adaptation unabhängig
erworben werden kann, läßt sich ausgezeichnet an der Evolution des Auges verdeutlichen. Photorezeptoren
sind im Tierreich mindestens vierzig Mal unabhängig voneinander entstanden, und in weiteren zwanzig
Fällen läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die bei verwandten Taxa vorgefundenen Augen
ancestrale oder konvergente Entwicklungen waren (Salvini-Plawen und Mayr, 1977). Dieser Fall und viele
andere (siehe Gingerich, 1979) zeigen, wie schwierig es häufig ist, zwischen homologen und nichthomologen Synapomorphien zu unterscheiden. Der unabhängig erfolgte Verlust eines Merkmals in
getrennten Entwicklungslinien ist eine besonders häufige Form der Konvergenz.
Eine weitere enorme Schwierigkeit bei der Bestimmung der Synapomorphien ist das Feststellen der
Richtung der evolutionären Veränderung, das heißt, die Entscheidung, Welcher Zustand der
Merkmalsausprägung ancestral und welcher abgeleitet ist. Zum Beispiel hängt die Einordnung
blumenblattloser Gattungen und Familien der Angiospermen davon ab, ob man das Fehlen der
Blütenblätter für einen primären (ancestralen) oder einen abgeleiteten Zustand hält; oder ein Fall aus dem
Tierreich: man kann entweder die Manteltiere als die primitivste Form und die Lanzettfischphen
(Amphioxus) und die Wirbeltiere als durch Neotenie (Reproduktion durch Larven) entstanden ansehen,
oder aber man kann Amphioxus für den ancestralen Zustand halten und die Manteltiere (Ascidiaceae) für
eine spezialisierte, sekundär sessile Seitenlinie. Die Tier- und Pflanzensysteme sind durchsetzt mit Fällen,
bei denen die Anordnung höherer Taxa ganz und gar davon abhängt, in welcher Richtung man den
Evolutionsverlauf annimmt. Fälle, in denen die Richtung der Evolution rückläufig geworden ist, sind
besonders lästig, aber weitaus häufiger, als allgemein zugegeben wird.
Es gibt mehrere Methoden (darunter auch das Studium des Fossilienmaterials), entweder die eine oder
die andere Polarität als wahrscheinlicher zu beweisen. Dennoch ist eine absolut eindeutige Bestimmung des
ancestralen Zustandes heute oft nicht möglich.
Die Ergebnisse der kladistischen Analyse werden in einem verzweigten Diagramm festgehalten, dem
Kladogramm. Es besteht aus einer Reihe von Zweiteilungen, die die aufeinanderfolgenden Verzweigungen
der phyletischen Linien wiedergeben. Zwei Annahmen, die der Aufstellung von Kladogrammen
zugrundegelegt werden, sind rein willkürlich; erstens, jede bestehende Art stirbt aus, sobald eine neue Art
ersteht; zweitens, jede Verzweigung ist eine Zweiteilung. Seit man weiß, daß Speziation zum größten Teil
in kleinen, isolierten Gründerpopulationen stattfindet, ist offensichtlich, daß eine Speziation dieser Art
überhaupt keinen Einfluß auf die Genetik und Morphologie der Elternart haben kann; sie kann noch
Millionen Jahre im wesentlichen unverändert weiterleben und in häufigen Abständen können aus ihr neue
Tochterarten hervorgehen. Die Annahme einer strikten Dichotomie ist gleichfalls unrealistisch. Ein großes
Taxon, das eine gleichartige Evolutionsstufe erreicht hat, kann gleichzeitig mehrere spezialisierte
Tochterlinien hervorbringen, die zwar ihrer Entstehung nach Schwestergruppen sind, jedoch getrennte
Wege gehen können und nicht mehr miteinander gemein haben als die Abstammung von demselben
Elterntaxon. In einigen kürzlich aufgestellten Kladogrammen ist dies bereits berücksichtigt, und bestimmte
Dichotomien sind durch Polytomien ersetzt worden (Ashlock, 1981). Aus all diesen Gründen hat Hull
(1979) sehr richtig darauf hingewiesen: Die Behauptung vieler Kladisten, ihre Methode sei völlig objektiv
und keineswegs willkürlich, wird von den Tatsachen nicht bestätigt. In Anbetracht der Kritik der Kladisten
an den Schwächen konkurrierender taxonomischer Methodologien ist es Wichtig, dies im Auge zu
behalten.
Kladistische Klassifikation
Die mannigfachen Schwierigkeiten, mit denen die kladistische Analyse zu kämpfen hat, sind dieselben, die
sich auch den traditionellen Taxonomen entgegenstellen; sie sind nicht der Hauptgrund für deren
Ablehnung der Kladistik. Der Grund liegt vielmehr in der Beziehung zwischen kladistischer Analyse und
kladistischer Klassifikation. Für den Kladisten ist seine Aufgabe mit der kladistischen Analyse
abgeschlossen. Die Klassifikation ergibt sich für ihn unmittelbar aus der Genealogie! wie er sie
rekonstruiert hat und wie sie in dem Dendrogramm (Kladogramm) dargestellt ist. Die kladistische
Klassifikation spiegelt die Verzweigungen akkurat wider und gestattet ein direktes Ablesen der
Phylogenese einer Gruppe. Wenn man als einzige Information von einer Klassifikation die Abfolge der
Verzweigungspunkte der Phylogenese erhalten will, dann ist eine kladistische Klassifikation das Richtige.
Soll jedoch die Klassifikation mehr über die Geschichte einer Gruppe aussagen, so wird man eine Methode
bevorzugen, die evolutive Divergenz und autapomorphe Merkmale nicht völlig außer acht läßt [6]. Der
Kladist stimmt nicht mit Darwins Erkenntnis überein, daß Genealogie an sich noch keine Klassifikation
ergibt. Er grenzt seine Taxa nicht anhand der Ähnlichkeit, sondern aufgrund des Prinzips der Holophylie
ab, das heißt, er faßt alle Nachkommen eines gemeinsamen Stammvaters in einem einzigen Taxon
zusammen. Daraus ergeben sich so inkongruente Kombinationen wie etwa ein gemeinsames Taxon für
Krokodile und Vögel oder für Schimpansen und Mensch. Die Klassifikationen beruhen ausschließlich auf
Synapomorphien, selbst in Fällen (wie der Evolution der Vögel aus den Reptilien), wo die Zahl der
autapomorphen Merkmale bei weitem größer ist als die der Synapomorphien (bei den Vögeln und ihren
nächsten Verwandten unter den Reptilien).
Mit anderen Worten: diese Methode setzt sich über die Tatsache hinweg, daß die Phylogenese zwei
Komponenten besitzt, nämlich einmal das Aufspalten von Entwicklungslinien, und zum anderen die
späteren evolutiven Veränderungen der abgespaltenen Linien. Diese letztere Komponente ist für die
Klassifikation darum so wichtig, weil die Evolutionsgeschichte von Schwestergruppen oftmals auffallend
verschieden ist. Von zwei verwandten Gruppen, die von dem nächsten gemeinsamen Vorfahren
abstammen, unterscheidet sich die eine zuweilen kaum von der Vorfahrengruppe, während die anderen
vielleicht eine neue adaptive Zone bezogen und sich zu einem radikal neuartigen Typ entwickelt hat.
Solche Gruppen sind in der Terminologie der Kladisten „Schwestergruppen", die Taxonomen stufen sie
herkömmlicherweise in verschiedene kategorische Ebenen ein. Nichts macht den Unterschied zwischen
kladistischer und traditioneller Taxonomie klarer als Hennigs Anweisung, Schwestergruppen müßten stets
denselben Rang erhalten, gleichgültig, wie sehr sie sich seit ihrer Trennung voneinander fortentwickelt
haben.
Für Hennig war die Kladistik „phylogenetische Klassifikation" und sein Bemühen war, in seinen
Klassifikationen die phylogenetische Evolution darzustellen (obgleich die Methodik für diesen Zweck
ungeeignet war). Hierin unterschied er sich von einigen seiner Nachfolger, die sich entweder jedes
Hinweises auf Evolution und Phylogenese enthalten, oder bewußt dagegen sind, die Evolution in einer
Klassifikation zum Ausdruck kommen zu lassen. Für eine ausführliche Kritik der kladistischen
Klassifikation muß ich auf die jüngere Literatur verweisen [7].
Ich möchte die Erörterung der kladistischen Methode nicht verlassen, ohne zu versuchen, ihr mit ein
paar abschließenden Worten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Der größte Vorteil der kladistischen
Analyse liegt darin: sie ist eine leistungsfähige Methode zum Testen der „Natürlichkeit" (d.h. der
Monophylie) ursprünglich mittels phänetischer Methoden abgegrenzter Gruppen. Da Ähnlichkeit von
Arten und Gattungen verschiedenartige Gründe haben kann, kann Monophylie nur anhand einer rigorosen
Analyse der Homologie der Merkmale bestätigt werden, auf denen die Ähnlichkeit beruht.
Um beurteilen zu können, wie tiefgreifend der Einfluß von Hennigs Methoden gewesen ist, braucht man
sich nur neuere taxonomische Revisionen anzusehen, insbesondere bei den Fischen und bestimmten
Insektengruppen. Selbst viele Autoren, die – wie etwa Michener – den Anspruch ablehnen, das
Kladogramm könne unmittelbar in eine Klassifikation umgesetzt werden, bemühen sich sorgfältig, das
Prinzip der Synapomorphie bei der Abgrenzung von Taxa zu benutzen. Besonders erfolgreich hat sich die
kladistische Analyse in Fällen erwiesen, wo zahlreiche Merkmale vorhanden sind, die bestehenden
Klassifikationen aber noch ziemlich unausgereift waren. Anhand der neuen, aufgrund dieser Analyse
erstellten Kladogramme erwiesen sich viele vorher anerkannte Taxa als polyphyletisch. Übersetzt man
jedoch die detaillierte Analyse in eine genau entsprechende Klassifikation, wie Rosen (1973) dies zum
Beispiel für die höheren Teleostei getan hat, so folgt daraus in unzähligen Fällen: neue Verwendungen
bereits existierender Taxonnamen, eine Unmenge neuer Namen, sowie – noch verwirrender – die
Einführung vieler neuer kategorischer Ebenen. Den Einwand, ein solches Vorgehen sei mit dem ideal einer
geeigneten Klassifikation unvereinbar, weist Bonde (1974, S. 567) mit der Bemerkung zurück, dies sei
kein „gültiges Argument gegen Hennigs Theorie". In bezug auf die kladistische Analyse ist es dies
tatsächlich nicht, um so mehr aber in bezug auf die kladistische Klassifikation.
Das wichtigste Verdienst von Hennigs Methode besteht wohl darin, daß sie zur Klärung der Beziehung
zwischen Phylogenese und Klassifikation beigetragen hat. Simpson, Mayr und andere Taxonomen waren
bei der Erörterung des Verhältnisses zwischen Phylogenese und Klassifikation dem Problem aus dem Weg
gegangen. Entmutigt durch die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Stammesgeschichte der
Blütenpflanzen, stimmten die Blütenpflanzen-Taxonomen nicht mit den Schlüssen der Zoologen überein,
daß die Taxa mit den Befunden der Phylogenese übereinstimmen und die höheren Taxa monophyletische
Einheiten sein müßten (Mayr, 1942, S. 277-280). Davis und Heywood schreiben in ihrem Lehrbuch: „Die
Klassifikation, so behaupten die Taxonomen, sollten auf der Phylogenese aufbauen oder sie widerspiegeln.
Dieses Ziel ist unseres Erachtens in einer Gruppe mit außerordentlich ungenügenden Fossilienfunden
unrealistisch. Ja, der gesamte Begriff der phylogenetischen Klassifikation ist unserer Überzeugung nach ein
Fehler" (1963). Diese Autoren übersahen, daß das Fossilienmaterial bei den meisten Tiergruppen ebenso
unzureichend ist wie bei den Pflanzen, und daß in allen diesen Gruppen die Phylogenese aus Indizien
gefolgert werden muß. Hennigs großes Verdienst ist es, eine Methode entwickelt zu haben, die sowohl
derartige Folgerungen als auch deren wiederholtes Überprüfen gestattet.
Das Fehlen von Fossilien schließt die Aufstellung von Stammesgeschichten nicht aus. Soweit mir
bekannt, war die gesamte allgemein anerkannte Phylogenese der Säugetierordnungen ursprünglich auf
vergleichend anatomischer Forschung (aufgrund von Homologien) aufgebaut, und in keinem einzigen Fall
wurde die zuvor aufgestellte Phylogenese durch spätere Fossilienfunde widerlegt.
Die scheinbar endlose Diskussion darüber, ob die Klassifikation Ausdruck der Phylogenese sei, ob sie
auf der Phylogenese beruhe, ob sie mit der Phylogenese im Einklang stehe oder ob sie überhaupt nichts mit
der Phylogenese zu tun haben sollte, nähert sich jetzt allmählich ihrem Abschluß. Es liegt auf der Hand,
daß man sowohl bei der Klassifikation als auch bei der Phylogenese nach der hypothetischdeduzierenden
Methode vorgeht. Das bedeutet, daß man eine Reihe von Behauptungen testen muß: (1) daß die
Angehörigen eines Taxons untereinander am nächsten „verwandt" (d. h. einander am ähnlichsten) sind; (2)
daß alle Angehörigen eines Taxon die Nachkommen des nächsten gemeinsamen Vorfahren sind
(Monophylie im engeren Sinne); (3) daß die Linnaeische Hierarchie der Taxa mit der Stammesgeschichte
im Einklang steht.
Jede dieser Thesen läßt sich auf mehrerlei Weise überprüfen, sie gehen alle letzten Endes auf eine
Homologieanalyse zurück. Beim Untersuchen der Homologie ist es am wichtigsten, „daß man
unterscheidet zwischen der Definition einerseits und andererseits dem Beweismaterial, das vorhanden ist
und dazu benutzt wird, um festzustellen, ob die Definition als anwendbar gelten kann" (Simpson, 1975,
S.17; ebenso 1961a, S. 68-70). Seit dem Jahre 1859 gibt es nur eine einzige Definition von homolog, die
biologisch gesehen Sinn ergibt: „Ein Wesenszug [Merkmal, Struktur und so weiter] ist bei zwei oder mehr
Taxa homolog, wenn er sich bis zu demselben [einem entsprechenden] Merkmal des vermuteten
gemeinsamen Vorfahren dieser Taxa zurückverfolgen [und von ihm ableiten] läßt."
Zahlreiche Autoren haben dazu beigetragen, Kriterien zu finden, anhand derer man entscheiden kann, ob
die Definition in einem speziellen Fall zutrifft oder nicht. Für morphologische Merkmale ist die beste
Kriterienliste die von Remane (1952). Einige der von ihm genannten Kriteria (etwa die Lage im Verhältnis
zu anderen Strukturen) sind auf verhaltensmäßige qder biochemische Homologien nicht anwendbar; de
facto mag es erforderlich sein, für jeden Merkmalstyp jeweils eine andere Reihe von Kriterien als Beweis
für Homologie zu entwickeln. Daher war es unangebracht und nicht sehr glücklich, daß Remane die als
Beweis für Homologie dienenden Kriterien zur Definition von Homologie erhob.
Die traditionelle oder evolutionäre Methodik
Sowohl Phänetik als auch Kladistik haben zahlreiche Anhänger gefunden. Nichtsdestoweniger ist die
Mehrheit der Taxonomen, obgleich sie vielleicht den einen oder anderen methodischen Fortschritt von den
zwei neuen Schulen übernimmt, bei der traditionellen Klassifikationsmethode geblieben. Sie besteht in
dem Versuch, in der Klassifikation nicht nur zum Ausdruck zu bringen, wie sich die phyletischen Linien
verzweigt haben, sondern auch, wie sich die einzelnen Linien anschließend voneinander fortentwickelt
haben. Dies kann man erreichen, indem man bei der Einstufung der Taxa angibt, ob sie sich durch
Eindringen in eine neue Nische oder adaptive Zone im Vergleich zu ihren Schwestergruppen radikal
verändert haben. Das Ergebnis ist die Umsetzung des Kladogramms in ein Phylogramm (Mayr, 1969). Man
bezeichnet diese Schule gelegentlich als evolutionäre Taxonomie, denn in ihrer Philosophie folgt sie
Darwin fast wortgetreu. Gelegentlich bezeichnet man sie auch als eklektische Taxonomie, weil sie in ihrer
Methodik neu entwickelte Verfahren mitverwendet, etwa bestimmte numerische Methoden der Phänetik
und die von den Ahnen abgeleitete Merkmalsteilung aus der Kladistik. Methoden und Prinzipien der
evolutionären Taxonomie sind in den Lehrbüchern von Simpson (1961) und Mayr (1969) und in Aufsätzen
von Bock, Ghiselin, Michener und Ashlock gut beschrieben [8].
Der Hauptunterschied zwischen der Kladistik und der traditionellen Methode besteht darin, daß letztere
den autapomorphen Merkmalen beträchtliches Gewicht beimißt. Autapomorphe Merkmale sind abgeleitete
Merkmale, die nur von einer, nicht aber von der anderen Schwestergruppe erworben wurden. Da die Zahl
von Merkmalen, die die Vögel seit ihrer Abspaltung von dem Zweig der Archosaurier erworben haben,
viele Male größer ist als die Zahl der Merkmale, in denen sich die Archosaurier von den anderen Reptilien
unterscheiden, werden Vögel als getrennte Wirbeltierklasse anerkannt und nicht mit den Krokodilen (den
einzigen überlebenden Archosauriern) in derselben Klasse oder Ordnung zusammengefaßt. Gleichermaßen
werden die Flöhe, obgleich sie eindeutig von einer besonderen Unterabteilung der Diptera abstammen, als
eine getrennte Ordnung oder Unterordnung der Insekten anerkannt; und die Läuse (Anoplura) werden als
getrenntes höheres Taxon anerkannt, auch wenn sie deutlich von einer Mallophagen-Gruppe abgeleitet
sind, die ihrerseits wieder von einer Gruppe von Psocoptera abstammt. In diesen und allen anderen Fällen,
wo eine Seitenlinie („Ex-Gruppe") sich durch spezielle Anpassungen drastisch verändert und dadurch
zahlreiche autapomorphe Merkmale erworben hat, führt eine rein kladistische Behandlung zu einem
irreführenden Verwandtschaftsbild im herkömmlichen Sinne dieses Wortes (Kim und Ludwig, 1978). Bei
der evolutionären Methode beruht das Einstufen eines Taxon somit auf dem relativen Gewicht der
Autapomorphien im Vergleich zu den Synapomorphien der Schwestergruppen.
Wie Rensch, Huxley und andere hervorgehoben haben, führt die anagenetische Komponente der
Evolution häufig zur Entwicklung ausgesprochener „ Grade"oder Ebenen evolutiver Veränderung, die in
der Klassifikation zum Ausdruck kommen müssen. Der Einwand der Kladisten, dadurch würde
Subjektivität in die Klassifikation eingeführt, ist von den Vertretern der evolutionären Taxonomie mit zwei
Argumenten zurückgewiesen worden: Erstens, die kladistische Methode enthält in der Entscheidung über
die Richtung des evolutiven Wandels, wegen der Mosaikevolution und in den Entscheidungen über
evolutive Parallelentwicklungen ebenfalls viel Subjektivität (Hull, 1979). Und zweitens, in den meisten
Fällen läßt sich ohne allzu große Schwierigkeiten ausrechnen, wie ungefähr das Verhältnis von
autapomorphen zu synapomorphen Merkmalen bei zwei Schwestergruppen aussehen wird. Immer wenn
eine „clade" (eine phyletische Linie) eine neue adaptive Zone bezogen hat, hat das eine drastische
Reorganisation zur Folge; dann muß man der Veränderung ein größeres taxonomisches Gewicht verleihen
als der Nähe der gemeinsamen Ahnen. Die besondere Bedeutung der Autapomorphien ist, daß sie die
Besetzung neuer Nischen und neuer adaptiver Zonen widerspiegeln, die oft von weitaus größerer
biologischer Bedeutung sind als die kladistischen Synapomorphien.
Begriff und Ausdruck grade haben eine lange Geschichte. Ray Lankester (1909) sprach von Protozoen
und Metazoen als von aufeinanderfolgenden grades und teilte, nachdem er die Schwämme abgetrennt und
mit dem Namen Parazoa bezeichnet hatte, die verbleibenden Metazoa in zwei weitere Entwicklungsstufen
ein, die Enterocoela (Coelenterata) und die Coelomata. Bather (1927) machte ausgedehnten Gebrauch von
dem Begriff grade und versuchte zu zeigen, wie bestimmte phyletische Linien in aufeinanderfolgenden
geologischen Zeitaltern mehrere ,grades' durchliefen. In jüngerer Zeit zeigte Huxley (1958), wie nützlich
der Begriff grade zur Illustration evolutionärer Entwicklungen und als Grundlage für das Einstufen von
Taxa ist. Rensch und Simpson haben ebenfalls auf die Existenz derartiger evolutionärer Plateaus
aufmerksam gemacht, auf denen eine beträchtliche Menge an Speziation (Cladogenesis) stattfinden kann,
ohne daß eine signifikante Anagenesis erfolgt.
Der Kladist ignoriert die Existenz von ,grades´ denn dies würde die Anerkennung „paraphyletischer"
Taxa bedeuten. In der Terminologie der Kladisten ist eine monophyletische Gruppe „paraphyletisch", wenn
sie nicht „holophyletisch" ist, d.h. nicht alle Nachfahren des gemeinsamen Stammvaters enthält. Die
herkömmliche Klasse der Reptilien etwa ist eine paraphyletische Gruppe, da sie weder die Vögel noch die
Säugetiere (Aves und Mammalia) einschließt – zwei Gruppen, die abgetrennt wurden, da sie ein von den
verbleibenden Reptilia verschiedenes Evolutionsniveau (grade level) erreicht hatten. Die Anerkennung
paraphyletischer Gruppen hat einerseits zur Folge, daß man eine Klassifikation nicht mehr automatisch in
ein Verzweigungsmuster übersetzen kann, andererseits lassen sich dadurch aber Abweichungsgrade
ausdrücken, was das Kladogramm nicht kann.
Neue taxonomische Merkmale
Alle drei Klassifikationsmethoden – numerische Phänetik, Kladistik und evolutionäre Taxonomie –
beruhen auf der Analyse und Bewertung taxonomischer Merkmale. Konflikte zwischen konkurrierenden
Klassifikationen können oft nicht gelöst werden: In der Regel liegt das daran, daß zu wenig informative
Merkmale vorhanden sind. Daher ist die häufigste Beschwerde eines Taxonomen nicht überraschend: die
Tier- und Pflanzengruppe, an der er arbeitet, verfüge nicht über genügend Merkmale, die eine
unzweideutige Entscheidung über Verwandtschaft erlaubten. Insbesondere zwei Erscheinungen tragen zu
dieser Schwierigkeit bei: Einmal die wohlbekannte Tatsache, daß der Phänotypus bei gewissen Gruppen
oder Organismen bemerkenswert „standardisiert" ist, etwa bei den Hunderten von Rana-Arten oder den
Tausenden von Drosophila-Arten, und somit nur wenige morphologische Hinweise auf die Verwandtschaft
bietet. Zum anderen betrifft jede Abweichung von diesem Standardtypus gewöhnlich nur einen einzigen
funktionalen Komplex, der mit irgendeiner speziellen ad hoc-Anpassung korreliert ist. Die Umstellung auf
eine neue Nahrungsquelle oder die Übernahme eines neuen Komplexes von Brautwerbesignalen kann zu
einer auffallenden morphologischen Umkonstruktion führen, die sich in eine beträchtliche Zahl einzelner
Merkmale aufteilen läßt. Diese als einzelne, separate Merkmale zu zählen, wäre jedoch irreführend, da sie
phylogenetisch gesehen lediglich Ausdruck einer einzigen Funktionsverschiebung sind. Schon Darwin
warnte davor, sich allzu sehr auf ad hoc-Spezialisierungen zu verlassen (Origin, SAU).
Noch häufiger stößt der Taxonom auf eine andere Schwierigkeit: die Ergebnisse, zu denen er aufgrund
verschiedener Strukturen gelangt, stehen miteinander in Konflikt. Das Studium der Extremitäten etwa
ergibt vielleicht, daß Taxon b am eindeutigsten mit Taxon a verwandt ist, während nach den Merkmalen
des Verdauungstrakts zu schließen, Taxon b der nächste Verwandte von Taxon c ist. In einem solchen Fall
ergibt die Bewertung zusätzlicher Merkmale der Extremitäten oder des Verdauungstraktes selten eine
zufriedenstellende Lösung.
In jedem höheren Taxon findet man zahlreiche Fälle dieser Art; die Taxonomen haben daher in den
letzten Jahrzehnten viel Aufmerksamkeit auf die Suche nach neuen taxonomischen Merkmalen verwandt.
Obgleich eine sorgfältige morphologische Analyse fortwährend neue Merkmale enthüllt, spielen
nichtmorphologische Merkmale eine immer wichtigere Rolle bei der Aufstellung von Klassifikationen.
Dazu gehören Komponenten des Verhaltens, der Lebensgeschichte und des Jahreszyklus (vergleiche die
„lebend gebärenden" und die „Eier legenden" Tiere des Aristoteles), Physiologie, Ökologie (z. B.
Nischenbenutzung), Parasiten und jedes andere vorstellbare Attribut eines Organismus. Viele dieser
Merkmale sind vor allem für die Unterscheidung von Arten brauchbar, einige jedoch weisen auf die
Verwandtschaft von Artengruppen hin.
Schon Darwin wies auf die Bedeutung der geographischen Verbreitung hin. Die Wahrscheinlichkeit, daß
eine abweichende australische Gattung mit einer einheimischen australischen Familie verwandt ist, ist
weitaus größer als die, daß ihre nächsten Verwandten in Afrika oder Südamerika leben. Dieses Prinzip der
Suche nach dem nächsten Verwandten in einer geographisch leicht zugänglichen Gegend verliert seine
Gültigkeit im Fall einiger Relikte und Gruppen mit ungewöhnlich großen Verbreitungsmöglichkeiten,
tatsächlich aber funktioniert es in bemerkenswert vielen Fällen, wie Simpson für Tiere und Thorne für
Pflanzen nachgewiesen hat. Eine Mischung aus kladistischer und biogeographischer Analyse ist manchmal
besonders aufschlußreich, wie Hennig und seine Nachfolger gezeigt haben.
Was noch vor wenigen Jahrzehnten das jüngste Neuland der Taxonomie war, das Studium
biochemischer Merkmale, ist nunmehr zu einem ihrer aktivsten und nützlichsten Zweige geworden [9]. Es
begann kurz nach 1900 mit immunologischen Untersuchungen (Nuttall, 1904). Immunologische Methoden
sind heute immer noch in Gebrauch (Leone, 1964), aber seither ist eine lange Reihe neuer Methoden
entwickelt worden. Man untersucht Verteilung, Variation und Evolution von Molekülen. Relativ kleine
Moleküle, wie Alkaloide und Saponine in Pflanzen, haben häufig eine relativ begrenzte taxonomische
Verteilung und können daher ein Hinweis auf Verwandtschaft sein (Hegnauer, 1962; Hawkes, 1968). Die
Evolution größerer Moleküle kann man mit mehreren Methoden erforschen, insbesondere durch das
Studium von Veränderungen in der Aminosäuresequenz. Solche Unterschiede lassen sich oft quantifizieren
und zur Konstruktion von Dendrogrammen des phänetischen Abstandes benutzen. Das Studium einzelner
Makromoleküle, wie des Hämoglobins, Lysozyms oder des Zytochromc, ist jedoch zeit- und
apparaturaufwendig, so daß die Einführung von Automationsmethoden eine Voraussetzung für seine
Verwendung in größerem Umfang ist. Biochemische Methoden sind da sehr nützlich, wo morphologische
Methoden versagen oder keine eindeutigen Resultate gebracht haben. Dabei hat sich die Analyse von
Allelen von Enzymgenen (Isozymen) mittels Elektrophorese als besonders produktiv erwiesen (Ayala,
1976). Mit dieser Methode sind zahlreiche Zwillingsarten (sibling species) entdeckt worden; es hat sich
zudem erwiesen, daß die Zahl der Unterschiede zwischen zwei Arten locker mit der Zeit korreliert ist, seit
der sich die zu beiden Arten führenden Entwicklungslinien getrennt haben. Die Analyse mittels
Elektrophorese ist daher, solange sie sich auf eine ausreichend große Zahl von Genloci gründet, für die
unvoreingenommene Überprüfung der Befunde der morphologischen Analyse äußerst wertvoll. Das
Verfahren der DNA-Hybridation dringt unmittelbar bis zum Genotyp vor. Bei dieser Methode wird die
Kompatibilität eines großen Teils der Genome zweier Arten gemessen, und der Grad der Übereinstimmung
ist ein recht direkter Hinweis auf die Verwandtschaft in Fällen, bei denen gewisse technische
Schwierigkeiten überwunden worden sind. Einzelne molekulare Merkmale sind natürlich ebenso anfällig
für Konvergenz wie morphologische Merkmale, so daß es ebenso riskant ist, molekulare Klassifikationen
auf der Grundlage eines einzelnen molekularen Merkmals aufzubauen, wie solche, die auf einzelnen
morphologischen Merkmalen beruhen.
Zum Auffinden der Verbindungspunkte der höheren Taxa, etwa der Vogelordnungen oder der
Wirbellosenstämme, untereinander sind molekulare Methoden bitter nötig.
Hier hat die morphologische Analyse bisher versagt, da es sich als unmöglich erwiesen hat, eine
ausreichende Zahl eindeutig homologer Merkmale zu finden und da die Richtung der evolutiven Trends
häufig ungewiß ist.
Die Resultate der morphologischen und der molekularen Analyse sind nicht immer kongruent, wie ein
Vergleich zwischen Mensch und Schimpanse zeigt. Einige Autoren haben daher darauf hingewiesen, daß
möglicherweise zwei Klassifikationen nötig seien, eine auf morphologischen, die andere auf molekularen
Merkmalen aufbauend. Ein solcher Vorschlag dürfte aus einer Reihe von Gründen unklug sein: nicht nur
besteht die Wahrscheinlichkeit, daß verschiedene molekulare Merkmale eventuell auch verschiedene
molekulare Klassifikationen ergeben, der Vorschlag impliziert auch mehrere Stammesgeschichten, was
natürlich eindeutig falsch ist. Klassifikation ist nicht eine Klassifikation einzelner Merkmale, sondern
berücksichtigt den ganzen Organismus. Es wird Aufgabe zukünftiger Synthesen sein, auf der Grundlage
morphologischer, verhaltensmäßiger und verschiedener Typen von molekularen Merkmalen gewonnene
Erkenntnisse zu einer einzigen optimalen Klassifikation zusammenzufassen.
Die Erkenntnistheorie der Klassifikation
Die Philosophen haben seit altersher beträchtliches Interesse an den Prinzipien der Klassifikation. In der
Tat war die Klassifikation (wenn auch nicht die Klassifikation von Organismen als solche) eins der
Hauptanliegen von Aristoteles (siehe Kapitel 4). Das Ersetzen der Abwärtsklassifikation (logische
Zweiteilung) durch das Zusammenfassen zu Gruppen (Aufwärtsklassifikation) in der Zeit nach Linnaeus
bedeutete einen wichtigen Fortschritt in der Philosophie. Auch die Philosophen des 19. Jahrhunderts waren
noch stark an der Klassifikation interessiert, etwa Mill, Jevons und die Thomisten. Doch irgendwie
versäumten sie es, die notwendigen Schlüsse hinsichtlich der biologischen Klassifikation zu ziehen, die
durch die Darwinsche Revolution möglich geworden waren. Nahezu einstimmig unterstützten sie auch
weiterhin den Essentialismus und eine Reihe anderer Vorstellungen, die durch den Evolutionsgedanken
überholt waren. Zum Beispiel neigten sie dazu, Identifikation und Klassifikation zu verwechseln, und
bezeichneten das Klassifizieren als einen Prozeß, der es mit einzelnen Exemplaren zu tun hat, während sich
die Klassifikation doch tatsächlich mit Populationen (Arten) befaßt, und die individuellen Organismen
lediglich den Arten zugeordnet (das heißt, identifiziert) werden. Sogar heute noch scheinen einige
Philosophen (Hempel, 1965) der Ansicht zu sein, „daß Klassifikation darin besteht, große Klassen in
Untergruppen aufzuteilen" (Abwärtsklassifikation), obwohl evolutionäre Klassifikation vielmehr das
Zusammenstellen verwandter Taxa zu höheren Taxa bedeutet.
Ein ernstes Manko im Ansatz der meisten Philosophen ist die Annahme, „die Klassifikation von Tieren
und Pflanzen… ist vom Wesen her grundsätzlich der Klassifikation unbelebter Gegenstände ähnlich"
(Gilmour, 1940, S.465). Die phänetische Methodik baut auf der gleichen unzutreffenden Annahme auf.
Künstliche oder willkürliche Klassifikationen sind gerechtfertigt für Gegenstände, die strikt auf der
Grundlage einer Qualität oder eines Merkmals klassifiziert werden, wie Bücher in einer Bibliothek. Solch
ein Verfahren ist jedoch nicht zulässig bei der Klassifikation von Objekten, über die es erklärende Theorien
gibt (Mayr, 1981b). Das trifft zum Beispiel auf kausale Klassifikationen von Krankheiten ebenso zu wie
auf die Klassifikation von Organismen auf der Grundla ge der Theorie, daß die Verwandtschaft von
Organismen durch gemeinsame Abstammung bedingt ist. In der Tat ist es unmöglich, sinnvolle
Klassifikationen für Gegenstände aufzustellen, die das Ergebnis einer Entwicklungsgeschichte sind, ohne
die historischen Vorgänge, die für ihre Entstehung verantwortlich waren, entsprechend zu berücksichtigen.
Wenn man Sterne, geologische Phänomene, Erscheinungen menschlicher Kultur oder die biologische
Mannigfaltigkeit entsprechend Gilmours Empfehlung klassifiziert, so gelangt man zu Ähnlichkeitsklassen,
die in den meisten Fällen die tatsächliche Verwandtschaft der Gegenstände nur unvollständig zum
Ausdruck bringen. Infolgedessen sind sich die evolutionären Taxonomen bereits seit Darwin darin einig,
daß natürliche Taxa monophyletisch (in der klassischen Bedeutung dieses Wortes) sind, sich also aus den
Nachkommen eines gemeinsamen Vorfahren zusammensetzen müssen. Diese theoretische Grundlage
jeglicher biologischer Klassifikation ist eine mächtige Einschränkung und widerlegt die Behauptung, daß
Klassifikationstheorien in gleicher Weise auf unbelebte Gegenstände und Organismen anwendbar seien.
Einige Vertreter der jüngeren Philosophengeneration (etwa Beckner, Hull) wissen um diese Entwicklungen
und sind dabei, gemeinsam mit denen unter den Biologen, die am meisten über die Beziehung von
Evolutionstheorie und Klassifikation nachgedacht haben (wie Simpson, Mayr und Bock), eine Philosophie
der biologischen Klassifikation zu entwickeln [10].
Erleichterung der Informationswiedergewinnung
Die Schlüsse, zu denen die evolutionäre Taxonomie hinsichtlich der Verwandtschaft gelangt, werden in
einem Phylogramm dargestellt, wobei gleiches Gewicht auf die exakte Lage der Verzweigungspunkte und
auf den Grad der Abweichung (d. h. die Zahl der Autapomorphien) jeder Stammeslinie gelegt wird. Die
Evolutionisten benutzen das Phylogramm als Grundlage für ihre Verallgemeinerungen.
Doch eine Klassifikation hat noch eine zweite Funktion: die eines Schlüssels für die in dem System
gespeicherte Information. Damit die Klassifikation als maximal nützliches Instrument zum Abrufen von
Informationen dient, muß bei der Übersetzung des Phylogramms in eine Klassifikation eine Reihe von
Aspekten der Klassifikation berücksichtigt werden, die man mit den Ausdrücken „Rang", „Größe der
Taxa", „Symmetrie" und „Sequenz" bezeichnet. Bei der Entscheidung über jeden dieser Aspekte kommt
eine gewisse Willkür mit ins Spiel, und vermutlich werden sie daher immer umstritten bleiben.
Rangordnung
Der Rang in der Linnaeischen Hierarchie ist durch die Kategorie gekennzeichnet, in die man ein Taxon
einstuft. Die Festlegung des Ranges ist eine der schwierigsten und willkürlichsten Entscheidungen bei der
Klassifikation. Für den Kladisten ist der Rang automatisch durch den am nächsten gelegenen
Abzweigungspunkt des phylogenetischen Baumes gegeben, da Schwestertaxa den gleichen Rang haben
müssen. Der evolutionäre Taxonom dagegen muß entscheiden, bei welcher Anzahl und welchem Gewicht
der autapomorphen Merkmale ein rangmäßiger Unterschied zwischen zwei Schwestergruppen
gerechtfertigt ist; eine solche Entscheidung wird besonders schwierig, wenn die Befunde aufgrund
verschiedener Arten von Merkmalen widersprüchlich sind. Ein mit Molekularmerkmalen arbeitender
Taxonom zum Beispiel könnte aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Makromoleküle vielleicht Fan (Schimpanse)
und Homo in dieselbe Familie einreihen, wohingegen Julian Huxley vorschlug, den Menschen wegen
seiner einzigartigen Merkmale seines Zentralnervensystems und seiner Fähigkeiten in den Rang eines
eigenen Reiches (Psychozoa) zu erheben. Es gibt keine feststehenden Regeln dafür, wie derartige Konflikte
zu lösen sind, außer, man solle eine allgemeine Ausgewogenheit im System anstreben und einen Maßstab
der Ranganordnung benutzen, der die brauchbarsten Verallgemeinerungen gestattet.
Größe
Noch weniger Übereinstimmung herrscht unter den Taxonomen über die optimale Größe, die ein Taxon
haben sollte. Einige Autoren sind der Ansicht, schon relativ geringfügige Unterschiede rechtfertigten die
Anerkennung neuer Gattungen, Familien und höherer Taxa. Sie werden im taxonomischen Jargon als
„Splitters" bezeichnet. Die Mehrheit der Taxonomen zieht relativ große, umfassende Taxa vor, da sie
besser die Verwandtschaft zum Ausdruck bringen und das Gedächtnis weniger belasten. Diese nennt man
„lumpers". Der Konflikt zwischen „lumpers" und „Splitters" besteht seit den Tagen von Linnaeus, der
selbst ein „lumper" war. Er schaffte es, mit der organischen Vielfalt fertigzuwerden, indem er in seiner
Kategorienhierarchie außer dem Reich lediglich vier Stufen unterschied (Art, Gattung, Ordnung und
Stamm). Heutzutage erkennen selbst relativ konservative Taxonomen 21 Kategorienebenen an (Simpson,
1945). Linnaeus kannte lediglich 312 Gattungen für alle Tiere, der moderne Zoologe kennt mehr als
100000,2045 allein für Vögel. Als Faustregel kann man sagen, daß es in der Geschichte der meisten
taxonomischen Gruppen eine Phase gibt, in der sie bei eifriger Erforschung stark aufgespalten werden, und
daß sich eine Phase mit entgegengesetzter Tendenz anschließt, wenn die Kenntnis der Gruppe eine größere
Reife erreicht. Allgemein ist man sich darüber einig, daß die Funktion einer Klassifikation, als Index für
ein Informationsabrufsystem zu dienen, der Größe der Taxa und der Zahl der Hierarchiestufen Grenzen
setzt.
Die Phänetiker sind in letzter Zeit die einzigen Taxonomen, die ernsthafte Anstrengungen gemacht
haben, etwas Einheitlichkeit in die rangmäßige Anordnung von Taxa zu bringen und Willkür soweit wie
möglich auszuschließen. Sie bedienten sich verschiedener Abstandsmaße, die entweder auf
morphologischen Merkmalen (Sokal und Sneath, 1973) oder auf dem genetischen Abstand (Nei, 1975)
beruhen, und schlugen absolute Unterschiedsgrade vor, aufgrund derer sich eine Artgruppe für eine
generische Abtrennung qualifiziert oder nicht. Wenn das Abstandsmaß auf einer genügend breiten Basis
beruht (etwa Zusammenpassen der DNA oder der Isozyme von mindestens dreißig oder vierzig, besser
noch von weit mehr Genloci), so spiegelt es die evolutive Abweichung der verschiedenen Artengruppen
recht gut wider. Es liegen Anzeichen dafür vor, daß die Maßstäbe für die Anerkennung von Gattungen auf
der Grundlage des Grades an molekularer Unterschiedlichkeit in den verschiedenen höheren Taxa
verschieden sein sollten, wenn die Grade der morphologischen Divergenz in starkem Konflikt mit der
molekularen Divergenz stehen. Morphologisch außerordentlich ähnliche Froschund Krötenarten können
bemerkenswerte molekulare Unterschiede zeigen, wohingegen in Gruppen wie Vögeln und Säugetieren
eine ausgeprägte Divergenz in der Morphologie und im Farbmuster wahrscheinlich kein Anzeichen für
größere molekulare Abweichungen ist. Würde man einen einheitlichen molekularen Maßstab anlegen, so
würden viele seit langem anerkannte Gattungen warmblütiger Wirbeltiere in die Synonymie gestellt
werden müssen, während bei den Anura und Gastropoden neue Gattungen für morphologisch sehr ähnliche
Artgruppen eingeführt werden müßten. Angesichts der Hauptfunktion der Klassifikationen ist es
zweifelhaft, ob dies wünschenswert wäre.
Symmetrie
Für das Problem der Symmetrie muß man eher die Evolution verantwortlich machen als die
Taxonomen. Es gäbe eine ideale Symmetrie, wenn alle Taxa auf jeder kategorischen Ebene von gleicher
Größe wären. Für die Quinarianer war die ideale Zahl fünf. Als die Idee, alle Taxa sollten ungefähr die
gleiche Zahl von Arten umfassen, zum ersten Mal aufkam, waren die Vorstellungen der Naturforscher noch
von der Naturtheologie beherrscht. Das Problem wurde zum ersten Mal von A. von Humboldt abgehandelt,
später von von Buch und im Jahre 1835 von einem anonymen Entomologen (Ent. Mag. 2, S. 44-54, 280286), dessen Aufsatz Darwins Aufmerksamkeit erregte. Daß es Taxa von außerordentlich ungleicher Größe
gab, schien allzu launisch, als daß man annehmen könnte, der Schöpfer habe es so beabsichtigt. Es gibt
Tierordnungen, die nur eine einzige Art enthalten, und zahlreiche Gattungen, insbesondere unter den
Insekten, mit mehr als 1000 Arten. Heute besteht kein Zweifel mehr daran, daß sowohl die
Speziationsraten als auch die Überlebensraten in verschiedenen Bereichen des natürlichen Systems
außerordentlich ungleich sind.
Sequenz
Wohl das störrischste Problem bei der Klassifikation ist die Umsetzung des Stammbaums in eine lineare
Sequenz. Solange man annahm, es gäbe nur eine einzige Stufenleiter der Vervollkommnung, war die
Aufgabe im Prinzip einfach. Wie Lamarck feststellte, beginnt man mit den am wenigsten perfekten
Organismen und hört mit den vollkommensten auf. Als Cuvier die scala naturae widerlegt hatte, fand er in
der abgestuften Rangfolge von Merkmalen ein neues Kriterium für die Reihenfolge. Er verwarf jede
Kontinuität zwischen den vier von ihm anerkannten Tierstämmen, doch schrieb ihre Einstufung
entsprechend der Entwicklung des Zentralnervensystems eindeutig eine Reihenfolge vor. Der
Grundgedanke der Stufenleiter der Vollkommenheit blieb somit immer noch bestehen. Als sich die
Evolutionstheorie durchsetzte, hatte sie ungewöhnlich wenig Einfluß auf die Theorie der taxonomischen
Sequenz. Die Sprache der scala naturae wurde lediglich mit einem evolutionären Anstrich versehen. Aus
den „vollkommeneren" Organismen wurden „höher entwickelte" oder einfach „höhere" Organismen.
Nahezu alle Tier- und Pflanzenklassifikationen beruhen, ausgesprochen oder nicht, auf dem Prinzip, daß
die primitiveren oder niedrigeren Organismen an den Anfang gestellt werden und dann die höheren
kommen. Als die Zeit dafür reif war, begann man sich jedoch zu fragen, was das Wort „höher" bedeutete.
Warum sollten Fische über den Honigbienen eingestuft werden? Warum sollten Säugetiere höher stehen als
Vögel? Ist ein Parasit höher oder niedriger als die freilebende Form, von der er abgeleitet ist?
Mit wachsender Einsicht in die Tier- und Pflanzenverwandtschaften wurde immer deutlicher, daß keine
Stufenleiter der Vollkommenheit, ja nicht einmal ein einfacher Stammbaum, die organische Vielfalt
korrekt beschreibt. Vielmehr ist es bei den meisten Organismengruppen am besten, sie als hochgradig
komplexe „phylogenetische Büsche" zu veranschaulichen, mit zahlreichen gleichwertigen Zweigen, von
denen jeder mit sehr einfachen, primitiven Vorfahren beginnt und mit komplexen und spezialisierten
Abkömmlingen endet. Die Tatsache der adaptiven Radiation macht die Aufstellung einer wirklich
logischen Theorie der taxonomischen Reihenfolge unmöglich. In großen Teilen des natürlichen Systems ist
es unmöglich zu zeigen, daß eine spezielle taxonomische Abfolge anderen Alternativen überlegen ist.
Infolgedessen macht sich zunehmend die Tendenz bemerkbar, rein praktische und für die
Wiedergewinnung der Information brauchbare Kriterien zugrunde zulegen (Mayr, 1969) [11]. Das
wichtigste Prinzip besteht darin, jede von breiten Kreisen akzeptierte Sequenz beizubehalten, solange nicht
eindeutig nachgewiesen worden ist, daß sie nicht verwandte Taxa enthält. Wie die ständigen Kontroversen
in der taxonomischen Literatur hinsichtlich der „besten" Reihenfolge der Blütenpflanzenordnungen oder
der Singvögelfamilien zeigen, reichen sogar diese minimalen Einschränkungen nicht aus, Stabilität zu
gewährleisten; und doch ist eine lineare Reihenfolge eine praktische Notwendigkeit. Das Material in den
Sammlungen ist in linearer Reihenfolge angeordnet, und das gleiche gilt für das gedruckte Wort bei allen
Revisionen, Katalogen und Übersichten.
Gegenwärtige Situation und Zukunft der Systematik
Wenn man bedenkt, daß die Taxonomie der älteste Zweig der Biologie ist, so ist ihre heutige Vitalität
recht bemerkenswert. Sie manifestiert sich in der Gründung neuer, ausdrücklich der Taxonomie
gewidmeter Zeitschriften (Taxon, Systematic Zoology, Systematic Botany und so weiter), in einer ganzen
Reihe bedeutender Texte, in der Veranstaltung zahlreicher internationaler Symposien und in einer von Jahr
zu Jahr umfangreicheren Bibliographie. Man ist an vielen Fronten aktiv, nicht nur auf dem Gebiet der
taxonomischen Methodik. Die bloße Beschreibung neuer Arten ist eine Aufgabe, die kein Ende nimmt.
Noch überraschender ist die Anzahl der wichtigen neuen Typen, die in den letzten Jahrzehnten entdeckt
oder zumindest anerkannt worden sind. Zum Beispiel wurde der neue Stamm der Pogonophora erst im
Jahre 1937 beschrieben, der der Gnathostomulida sogar erst 1956. Der einzige überlebende Quastenflosser
Latimeria wurde 1938 entdeckt, der primitive Mollusk Neopilina 1956 und die reliktäre Krebsgruppe
Cephalocarida 1955. So ziemlich alles, was wir über die reiche Fauna in den Meersand- und
Meeresschlammzwischenräumen wissen, ist in den letzten fünfzig Jahren entdeckt worden. Daß Trichoplax
das primitivste aller Metazoen ist, erkannte man erst in den siebziger Jahren.
Die vielleicht erstaunlichste Entdeckung jedoch sind die von Barghoorn, Cloud und Schopf
beschriebenen Fossilien aus dem Präkambrium. Damit verschob sich der Anfang der Geschichte des
Lebens, den man bei vor etwa 650 Millionen Jahren angenommen hatte, bis in die Zeit von vor 3,5 Mrd.
zurück. Gelegentlich aber ergeben sich Entdeckungen auch einfach aus einem sorgfältigeren Studium
schon vorliegender Fossilien, wie die kürzliche Beschreibung der Agmata, eines ausgestorbenen
Wirbellosenstammes aus dem frühen Kambrium, zeigt.
Ein Zeichen für die Vitalität der jüngeren taxonomischen Forschung sind die Verbesserungen in der
Klassifikation der höheren Taxa bei allen Organismengruppen, von den Bakterien, Fungi und Protozoa bis
hinauf zu den Wirbeltieren, einschließlich der Primaten. Die alte Streitfrage, ob der Polyp oder die Meduse
die ancestrale Form der Coelenteraten ist, ist durch viele neueste Untersuchungen wesentlich geklärt
worden: die Mehrzahl der Forscher ist der Ansicht, der Polyp sei die ältere Form. Die Scyphozoa scheinen
eine größere Zahl ancestraler Merkmale zu haben als jede andere Klasse der Coelenterata, und die kürzlich
anerkannte Klasse der Cubozoa (Werner, 1975) stellt eine hübsche Verbindung zwischen ihnen und den
Hydrozoa her. Bei den Pflanzen haben die Arbeiten von Thorne, Carlquist, Cronquist, Stebbins und
Takhtajan zu einer völlig neuen Klassifikation der Blütenpflanzen geführt. Die Zahl höherer Taxa mit
unbekannter oder zumindest unsicherer Verwandtschaft ist jedoch immer noch sehr groß, und in den
nächsten zwanzig oder dreißig Jahren sind wohl noch größere Fortschritte zu erwarten als in den letzten
Jahrzehnten.
Schon zur Zeit von Linnaeus und sogar noch früher (Aristoteles und Theophrastos) erkannte man zwei
Reiche an, die Pflanzen (Plantae) und die Tiere (Animalia). Fungi und Bakterien galten als Pflanzen. Je
mehr das Studium der einzelligen Organismen und Mikroben in jüngerer Zeit voranschritt, umso deutlicher
wurde, wie künstlich diese Klassifikation war. Zuerst erkannte man, daß die blaugrünen Algen (die man
besser als Cyanobacteria bezeichnet) wie auch die Bakterien sich drastisch von allen anderen Organismen
unterscheiden und trennte sie daher als Prokaryota ab (Stanier und van Niel, 1942). Sie nahen keinen
strukturierten Zellkern und keine Chromosomen und unterscheiden sich in der Mehrheit ihrer
Makromoleküle von den übrigen Organismen (Eukarypten). Die Mannigfaltigkeit (im Stoffwechsel und
anderen Faktoren) unter den Bakterien ist groß, aber selbst die am stärksten abweichende (und
augenscheinlich primitivste) Bakteriengruppe, der Methanobacteria hat mit den anderen Bakterien derart
viele Merkmale gemein, daß man sie am besten mit diesen in dem Reich Monera zusammenfaßt.
Die Fungi werden heute ebenfalls generell als eigenes Reich von den Pflanzen abgetrennt, von denen sie
sich nicht nur im Stoffwechsel (keine Photosynthese), sondern auch in der Zellstruktur (immer haploid)
und auf andere Weise unterscheiden. Ob man, wie dies von einigen Autoren befürwortet wird, noch ein
weiteres Reich (Protisten) für die einzelligen Tiere und Pflanzen anerkennen will oder nicht, ist
Geschmackssache. Da die Literatur über Protozoen und einzellige Algen einerseits und über Metazoen und
Metaphyten andererseits recht deutlich getrennt ist, könnte eine derartige Aufteilung die Wiedergewinnung
von Information erleichtern. Solche Fragen der brauchbarsten Strukturierung der Klassifikation aller
Organismen sind von Margulis erörtert worden (1981).
Unter den zahlreichen Gründen für den steten Fortschritt bei der Klassifikation der Organismen stehen
die Verbesserungen der Methodik an erster Stelle. Man hat jetzt erkannt, daß die Klassifikation kein EinSchritt-Verfahren ist und daß allzu stark vereinfachende Methoden daher selten zu zufriedenstellenden
Resultaten führen. Das Klassifizieren besteht aus einer ganzen Reihe von Schritten (Mayr, 1981 b), und für
jeden dieser Schritte sind jeweils andere Verfahren nötig und am brauchbarsten. Zum Beispiel sind die
phänetischen Methoden bei der ersten versuchsweisen Abgrenzung von Taxa, und dann erneut bei der
Einordnung von Taxa auf der Grundlage von patristischen und kladistischen Unterschiedsgraden am
nützlichsten. Kladistische Methoden sind für das Testen von vermuteten Verzweigungsmustern
(kladistische Analyse) am brauchbarsten.
Die Frage, in welchem Maße numerische Methoden zweckmäßig und dem menschlichen Computer
tatsächlich überlegen sind, ist noch nicht endgültig beantwortet. Die meisten morphologischen Merkmale
sind derart mit Konvergenzen, Polyphylie und Mosaikevolution durchsetzt, daß sie als Rohmaterial für die
numerische Analyse allzu unzuverlässig sind. Konvergenz und Polyphylie treten auch bei der Evolution
von Makromolekülen und vermutlich bei der Evolution der DNA auf; doch gibt es Anzeichen dafür, daß
bestimmte Veränderungen in den Makromolekülen die spätere Evolution dieser Moleküle stark
einschränken; das legt den Gedanken nahe, bei gleichzeitiger Beurteilung einer genügenden Zahl von
Molekülen sei die Analyse molekularer Ähnlichkeiten verläßlicher als eine kritiklose morphophänetische
Analyse, wie die numerische Phänetik dies ursprünglich vorgeschlagen hatte.
Das Studium der organischen Vielfalt
In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts galten die Ausdrücke „Taxonomie" und „Systematik" allgemein
als Synonym. Danach befragt, welches die Aufgaben der Systematik seien, würde ein Taxonom
geantwortet haben: „Die organische Vielgestaltigkeit der Natur beschreiben (was bedeutete, die Arten
beschreiben, aus denen sich die Vielgestaltigkeit zusammensetzt) und sie klassifizieren". Und doch hatte
man bereits in den Tagen von Leeuwenhoek und Swammerdam im 17. Jahrhundert erkannt, daß das
Studium der organischen Vielfalt mehr umfaßte als bloßes Beschreiben und Einordnen von Arten. Bereits
damals (und eigentlich schon zur Zeit von Aristoteles) lag es auf der Hand, daß sich die Erforschung der
organischen Vielfalt nicht in diesen elementaren Beschäftigungen des Taxonomen erschöpfte. Von Anfang
an umfaßte das Studium der Diversität auch die Analyse der Stadien des Lebenszyklus und des sexuellen
Dimorphismus. Als man lebende Tiere in der Natur zu erforschen begann, zeigte sich, daß in verschiedenen
Biotopen verschiedene Arten auftraten, die verschiedene Nahrung bevorzugten und deren
Verhaltensweisen verschieden waren. Aber erst in der Mitte unseres Jahrhunderts, in der Folge der neuen
Systematik und der synthetischen Evolutionslehre, erkannte man die große Bedeutung des Studiums der
Vielfalt in ihrer ganzen Reichweite. Nun wurde deutlich, daß die herkömmliche Definition der Funktion
der Systematik bei weitem zu eng war und der wirklichen Situation nicht gerecht wurde.
Aus diesem Grunde unterschied Simpson (1961) terminologisch ausdrücklich zwischen Taxonomie und
Systematik. Er behielt das Wort „Taxonomie" in seiner traditionellen Bedeutung bei, gab aber der
„Systematik" einen viel umfassenderen Sinn, indem er sie als „die wissenschaftliche Untersuchung der
Arten und der Vielgestaltigkeit der Organismen und sämtlicher Beziehungen zwischen ihnen" definierte.
Die Systematik wurde somit als die Wissenschaft von der organischen Vielfalt verstanden, und dieser neue,
erweiterte Begriff der Systematik ist weithin übernommen worden. Die neue Definition warf sofort die
Frage auf, welche Funktionen diese in weitem Sinne verstandene Wissenschaft der organischen Vielfalt
erfüllen und welche Rolle sie in der zeitgenössischen Biologie spielen solle.
Die Taxonomie im engeren Sinne bleibt Fundament und Stützpfeiler der gesamten Wissenschaft der
Systematik. Eine komplette Bestandsaufnahme der existierenden Tier und Pflanzenarten und ihre
Klassifikation ist eine so gewaltige Aufgabe, daß kein Ende abzusehen ist. Ein Spezialist für die
Taxonomie von Milben (Acarina), Nematoden (Fadenwürmer), Spinnen oder einer vernachlässigten
Gruppe von Insekten oder marinen Wirbellosen, kann sich immer noch sein ganzes Leben lang mit nichts
anderem befassen, als neue Arten zu beschreiben und sie den entsprechenden Gattungen zuzuweisen. Die
Vielfalt der organischen Natur scheint im wahrsten Sinne des Wortes unbegrenzt zu sein. Gegenwärtig
werden jährlich etwa 10000 neue Tierarten beschrieben, und selbst wenn wir die niedrigste Schätzung der
Zahl noch unbeschriebener Arten zugrunde legen, wären noch zweihundert Jahre nötig, um die Aufgabe
der bloßen Beschreibung und Benennung aller bestehenden Arten zu Ende zu führen.
Ein kurioser Aspekt der Taxonomie ist die weitgehende Autonomie ihrer verschiedenen Zweige. Je
nachdem, wie ausgereift das Wissen über eine Gruppe ist, weisen die in dieser Gruppe verwandten
Methoden und Begriffe einen verschiedenen Grad an Ausgefeiltheit auf. In der Tat kann man in den
Spezialgebieten der zeitgenössischen Taxonomie jedes der Stadien vorfinden, wie sie sich im Laufe des
Kampfes um die Philosophie der Taxonomie von Linnaeus und Cuvier bis hin zur neuen Systematik
abgezeichnet haben. Sogar heute gibt es zum Beispiel noch einige Autoren, für die das Wort
„Klassifikation" gleichbedeutend mit Identifikationssystem ist. Polytypische Arttaxa sind in der
Ornithologie allgemein anerkannt, in vielen anderen Bereichen der Tiertaxonomie jedoch noch unbekannt.
Die Unabhängigkeit der verschiedenen Gruppen voneinander wird durch die Tatsache veranschaulicht, daß
Zoologen, Botaniker und Bakteriologen jeweils ihre eigenen Nomenklaturregeln haben.
Einer der beiden Hauptaspekte der organischen Natur ist die Vielfalt, der andere sind die
Lebensvorgänge. Doch nicht immer ist man sich der Bedeutung des Studiums der Vielfalt des organischen
Lebens bewußt gewesen. Infolgedessen hat die Systematik im Verlauf der Geschichte der Biologie Höhen
und Tiefen erlebt. Zur Zeit von Linnaeus hatte sie nahezu das Monopol in diesem Wissenszweig inne, und
in der Ära des Erstellens von Stammbäumen in der Zeit nach Darwin (Haeckel und seine Anhänger) erlebte
sie eine weitere Blütezeit. Dem folgte, zum Teil als Reaktion auf die Exzesse der vorangehenden Epoche,
eine Zeit der Vernachlässigung, wenn nicht Unterdrückung, des Studiums der organischen Vielfalt. Wer
die Schriften von Max Hartmann (Allgemeine Biologie), Hans Driesch, T.H. Morgan, Jacques Loeb und
anderen experimentellen Biologen liest, würde niemals auf den Gedanken kommen, das Studium der
Vielfalt sei ebenfalls ein wichtiger und blühender Bereich der Biologie. Zum Teil war diese
Vernachlässigung berechtigt, denn die Arbeit der Erforscher der Vielfalt zu jener Zeit war gewöhnlich
übermäßig deskriptiv (etwa in der Synökologie und dem größten Teil der Taxonomie) oder einseitig auf
phylogenetische Probleme konzentriert (vergleichende Anatomie, die Ethologie von Heinroth und
Whitman). Wenn die Forscher, die sich dem Studium der Vielfalt widmeten, überhaupt an allgemeineren
Problemen interessiert waren, so an der Rekonstruktion eines gemeinsamen Vorfahren als oberstem Ziel.
Es fehlt heute an einer brauchbaren historischen Analyse, aus der man entnehmen könnte, wann und wie
sich diese Situation änderte. Jedoch bahnten sich offensichtlich in den zwanziger, dreißiger und vierziger
Jahren dieses Jahrhunderts neue Entwicklungen an. Vieles weist darauf hin, daß die Populationssystematik
die Änderung herbeiführte. Sie hatte in Rußland durch das Werk Chetverikovs (1926; s. Adams, 1970;
Mayr und Provine, 1980) die Entstehung der Populationsgenetik zur Folge. Ihren Höhepunkt erlebte die
Populationssystematik in der neuen Systematik (Rensch, Huxley, Mayr), die ihrerseits wieder entscheidend
zur synthetischen Evolutionstheorie beitrug (Mayr, 1963). Die Verbreitung des Evolutionsdenkens im
allgemeinen und des Populationsdenkens im besonderen führte zu neuen Begriffsbildungen in der
Paläontologie (Simpson, 1944; 1953), in der Evolutionsmorphologie (Davis, 1960; Bock, 1959), in der
Ökologie (Lack, MacArthur) und in der Ethologie (Lorenz, Tinbergen). Fragen, die mit der organischen
Vielgestaltigkeit zu tun haben, wie auch ein vergleichender Ansatz auf der Grundlage dieser
Vielgestaltigkeit spielten eine dominierende Rolle bei all diesen Entwicklungen.
Diese neue Betonung der Vielfalt hatte einen drastischen Einfluß auf das begriffliche Klima ganzer
Zweige der Biologie. Jahrzehnte hindurch etwa beschrieb man die Evolution als Veränderung der
Genfrequenzen in Populationen. Diese reduktionistische Definition beschränkte die Evolutionsbiologie auf
die Abänderung bestehender Arten, d. h. auf die adaptive Komponente der Evolution. Der Ursprung der
organischen Mannigfaltigkeit wurde vernachlässigt, als gehöre er nicht einmal zur Evolution dazu. Die
gleiche Haltung kam bis in die fünfziger und sechziger Jahre unseres Jahrhunderts in den Schriften der
meisten Paläontologen zum Ausdruck. Simpson (1944; 1953) und andere zeitgenössische Paläontologen
beschränkten sich fast ausschließlich auf die Behandlung der vertikalen Komponente der Evolution und
ließen die Frage des Ursprungs der Vielfalt sogar bei der Diskussion der adaptiven Radiation außer acht.
Erst 1972 (Eldredge und Gould) wandten Paläontologen der Entstehung der Vielfalt die ihr zukommende
Aufmerksamkeit zu. Auch in der Evolutionsmorphologie führte die Erforschung der Vielfalt zu neuen
Begriffen. An die Stelle des einseitigen Interesses an dem gemeinsamen Vorfahren (mittels des Studiums
homologer Ähnlichkeiten) tritt heutzutage das Interesse am Ursprung der Unterschiede zwischen den
Nachkommen, d. h. an der Vielfalt. Das scheint auch für die Ethologie zu gelten, obgleich die Entwicklung
dort noch sehr in den Anfängen steckt.
Angesichts des Einflusses der modernen Einstellung zur organischen Vielfalt auf die gesamte Biologie
mag sich eine etwas ausführlichere Untersuchung der spezifischen Beiträge der Systematik lohnen. Dies ist
auch aus einem anderen Grunde notwendig: nämlich um den bei Außenseitern weit verbreiteten Eindruck
zu widerlegen, Systematik sei nichts anderes als eine bessere Art von Briefmarkensammeln. Man neigt
dazu, einige der wichtigsten Leistungen der Systematik ihren Nachbargebieten, etwa der
Populationsgenetik, der Ökologie oder der Ethologie als Verdienst anzurechnen, selbst wenn die
Fortschritte tatsächlich praktizierenden Taxonomen zu verdanken und lediglich durch ihre Erfährungen bei
der taxonomischen Arbeit möglich geworden sind. Es ist irreführend, die Bezeichnungen „Taxonomie"
oder „Systematik" auf rein büromäßige, beschreibende Tätigkeiten zu beschränken und den umfassenderen,
über die mehr elementaren, beschreibenden Operationen hinausgehenden Befunden und Begriffen einen
anderen Namen zu geben.
Man erinnere sich daran, daß Systematik und Naturgeschichte anfangs (im 17. und 18. Jahrhundert)
weitgehend ein einziges Gebiet waren. Die meisten der heute anerkannten Zweige der organismischen
Biologie haben sich aus der Systematik entwickelt. Ein großer Teil der Ökologie befaßt sich mit den
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arten, ob es sich dabei nun um Konkurrenz, Symbiose oder
Räuber-Beute-Beziehungen handelt. Diese Wechselwirkungen lassen sich nur durch sorgfältiges Studium
der beteiligten Arten verstehen. Die Arbeit der MacArthur-Schule in der Ökologie gilt fast ausschließlich
der Formenvielfalt, und das gleiche trifft auf die Erforschung von Ökosystemen zu. Da das tierische
Verhalten zu einem großen Teil artspezifisch ist, und da die Evolution des Verhaltens zum größten Teil
durch den Vergleich verschiedener Arten verstanden werden kann, ist wiederum offensichtlich das
Studium der organismischen Mannigfaltigkeit eng mit diesem Zweig der Biologie verbunden. Viele
Fachgebiete der Biologie sind völlig von der Systematik abhängig, unter ihnen die Biogeographie, die
Zytogenetik, die biologische Ozeanographie und die Stratigraphie. Auf die Unentbehrlichkeit der
Systematik für die angewandten Wissenschaften (wie öffentliche Gesundheitspflege, Landwirtschaft und
Naturschutz) möchte ich nicht noch einmal näher eingehen.
So wichtig die Systematik auch als Grundlage der erwähnten Zweige der Biologie ist, so liegt ihre
größte Bedeutung vermutlich doch in ihrem Beitrag zur begrifflichen Erweiterung der modernen Biologie,
war doch die großartigste einigende Theorie in der Biologie, die Evolutionstheorie, weitgehend dem
Beitrag der Systematik zu verdanken. Es ist kein Zufall, daß Darwin Die Entstehung der Arten schrieb,
nachdem er auf seiner Reise mit der Beagle auf taxonomische Probleme aufmerksam geworden war und
nachdem er acht Jahre lang konzentriert an der Taxonomie der Rankenfüßer gearbeitet hatte. Von den
Taxonomen kamen auch die wichtigsten Hinweise zur Lösung vieler einzelner Probleme der
Evolutionstheorie. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Rolle der Isolation, die
Artbildungsmechanismen, die Natur der Isolationsmechanismen, Evolutionsraten, Evolutionstrends und
das Problem der Emergenz evolutiver Neuheiten zu nennen. Die Taxonomen (einschließlich der
Paläotaxonomen) haben mehr als alle anderen Biologen signifikante Beiträge zu allen diesen Themen
geleistet.
Die Taxonomen hatten einen aktiven Anteil an der synthetischen Evolutionstheorie (Mayr und Provine,
1980). Die Mehrzahl der Autoren, wie Chetverikow, Rensch, Dobzhansky, Mayr und Simpson, die mit
sehr viel Erfolg eine Theorie zustandebrachten, in der sie die Genetik mit den Hauptfragen der Evolution in
Einklang brachten, waren ihrer Herkunft nach Taxonomen.
Auch die Umweltphysiologie verdankt der Systematik viel. Systematiker auf dem Gebiet der Zoologie,
wie C. L. Gloger, J. A. Allen und Bernhard Rensch, haben Wichtiges zur Entdeckung der adaptiven
geographischen Variation und zur Aufstellung von Klimaregeln beigetragen. Es waren Zoologen mit
taxonomischen Kenntnissen, die die genetische Grundlage für die adaptiven Unterschiede von
geographischen Rassen nachwiesen.
Vielleicht der bedeutendste Beitrag, der vom Studium der Formenmannigfaltigkeit ausging, war die
Entwicklung neuer Ansätze in der Philosophie. Mehr als alle anderen Bereiche der Biologie war es das
Studium der Vielfalt, das den Essentialismus, die irreführendste aller Philosophien, untergrub. Die
Erforscher der Diversität betonten, jedes Individuum unterscheide sich in einzigartiger Weise von allen
anderen; dadurch konzentrierten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Rolle des Individuums; dies wiederum
brachte das Populationsdenken hervor, eine Denkweise, die für die Wechselwirkung der menschlichen
Untergruppen, menschlichen Gesellschaften und menschlichen Rassen untereinander von allergrößter
Wichtigkeit ist. Der Erforscher der Formenvielfalt zeigte, daß jede Art einzigartig und somit unersetzbar
ist, und lehrte so die Achtung vor jedem einzelnen Produkt der Evolution; dies wiederum ist einer der
wichtigsten Gedanken des Naturschutzes. Durch Hervorheben der Bedeutung des Individuums, durch
Entwickeln und Anwenden des Populationsdenkens und dadurch, daß sie uns die Ehrfurcht vor der Vielfalt
der Natur vermittelt, hat die Systematik der Vorstellungswelt des Menschen eine neue Dimension
hinzugefügt, die von den exakten Wissenschaften weitgehend übersehen, wenn nicht sogar geleugnet
worden war; und doch ist es eine Komponente, die für das Wohlergehen der menschlichen Gesellschaft
und für die Planung der Zukunft der Menschheit von entscheidender Bedeutung ist.
6 Mikrotaxonomie, die Wissenschaft von den Arten
Die Einheiten, die der Taxonom zu Gattungen und noch höheren Taxa zusammenfaßt, sind die Arten.
Sie sind die Grundeinheiten der Lebewesen, die die Formenvielfalt der Natur ausmachen. Sie sind die
niedrigste Ebene echter Diskontinuität oberhalb der Stufe des Individuums. Die Kohlmeise und die
Blaumeise gehören verschiedenen Arten an, und ebenso der Spitzahorn und der Feldahorn. Die mit dem
Ausdruck „Art" bezeichnete Einheit scheint auf den ersten Blick offensichtlich, einfach und leicht zu
definieren. Doch der erste Blick täuscht. Wahrscheinlich gibt es in der Biologie keinen anderen Begriff, der
so hartnäckig umstritten geblieben ist wie der Artbegriff [1]. Man sollte meinen, die lebhafte Debatte der
Zeit nach Darwin hätte Klarheit und Einstimmigkeit hervorbringen sollen oder zumindest, die neue
Systematik der dreißiger und vierziger Jahre unseres Jahrhunderts würde endlich Klarheit geschaffen
haben, doch dem war nicht so. Selbst heute noch werden jedes Jahr mehrere Aufsätze über das Artproblem
veröffentlicht und sie zeigen, daß die Meinungen fast noch genauso auseinandergehen wie vor hundert
Jahren. Ein Fortschritt ist allerdings tatsächlich gemacht worden: heute ist sehr viel klarer formuliert als
früher, worin man nicht übereinstimmt. Von besonderem Interesse für den Erforscher der Ideengeschichte
ist, daß die Geschichte des Artproblems zum großen Teil völlig unabhängig von der Geschichte des
Klassifikationsproblems ist. Man kann den Zweig der Systematik, der sich mit der Artfrage befaßt, als
Mikrotaxonomie bezeichnen. Ihre Geschichte soll in diesem Kapitel behandelt werden.
Wenn man von Arten (Spezies) spricht, so denkt man gewöhnlich an Pflanzen- und Tierarten.
Tatsächlich wird der Ausdruck jedoch häufig auf alle möglichen Arten von Gegenständen angewandt, und
zwar im Sinne von „Sorten von". Der Chemiker spricht vielleicht von Arten von Molekülen und der
Mineraloge von Arten von Mineralien (Niggli, 1949; Hooykaas, 1952). Der Artbegriff in der Chemie und
Mineralogie unterscheidet sich jedoch grundlegend von dem der zeitgenössischen biologischen Systematik:
ein Artname in der Mineralogie ist im großen und ganzen ein Klassenname, definiert im Sinne einer Reihe
von Eigenschaften, die für die Zugehörigkeit zur Klasse essentiell sind. Arten unbelebter Gegenstände
entsprechen also mehr oder weniger den Linnaeischen oder vor-Linnaeischen Arten, aber nicht im
geringsten den modernen biologischen Arten.
Doch selbst wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Spezies von Organismen beschränken, finden wir
eine Vielzahl verschiedener Gesichtspunkte vor, zum Teil, weil die Artkategorie in verschiedenen
Teilgebieten der Biologie unterschiedliche Funktionen erfüllt. Für den praktisch arbeitenden Taxonomen
ist das Arttaxon die Grundeinheit, die identifiziert und klassifiziert werden muß; für den Biologen im
Laboratorium ist es der Organismus, der bestimmte, artspezifische Merkmale hinsichtlich physiologischer,
biochemischer und verhaltensmäßiger Attribute besitzt; für die Evolutionstheoretiker ist die Art die Einheit
der Evolution (Monod, 1974b) und für den Paläontologen ein Abschnitt einer stammesgeschichtlichen
Linie. Die verschiedenen Spezialisten werden im besten Fall verschiedene Aspekte unterstreichen; im
schlimmsten Fall werden sie zu weit auseinanderklaffenden Ergebnissen gelangen. Das Resultat ist ein
Fortbestehen der Kontroverse.
Es scheint eines der elementarsten Bedürfnisse des Menschen zu sein, daß er wissen möchte, aus
welchen verschiedenen Arten von Dingen sich seine Umgebung zusammensetzt. Sogar primitive Völker
haben Namen für die verschiedenen Sorten von Vögeln, Fischen, Blumen oder Bäumen, und sie erkennen
gewöhnlich genau dieselben Arten an, die auch der moderne Systematiker unterscheidet (Gould, 1979). Ein
solches Benennen von Sorten ist deshalb möglich, weil die Formenvielfalt der Natur nicht kontinuierlich
ist, sondern aus deutlich verschiedenen Einheiten besteht, die voneinander durch Diskontinuitäten getrennt
sind. Man findet in der Natur nicht nur Individuen, sondern auch „Arten" (Spezies), das heißt, Gruppen von
Individuen, die bestimmte Merkmale gemeinsam haben.
Der Begriff „Art" („Spezies") ist notwendig, da der Ausdruck „Sorte" nicht präzise genug ist. Das
Problem der Trennung von Arttaxa und Gruppierungen höheren oder niedrigeren kategorischen Ranges ist
eine Frage der Abgrenzung. Die Unterscheidung von echten biologischen Arten innerhalb einer gegebenen
Gattung ist somit das Problem der Grenzziehung gegenüber umfassenderen Gruppierungen. Jede
biologische Art enthält jedoch viele Phäna [2], die häufig derart verschieden voneinander sind, daß sie
zunächst als verschiedene Arten beschrieben wurden. Wenn man den Ausdruck „Spezies" mit
„verschiedene Sorte" gleichsetzt, so gibt es kein unterscheidendes Kriterium, mit dessen Hilfe man
verschiedene „Sorten" eindeutig in die drei Kategorien Phänon, echte Art und Gattung einweisen könnte.
Es ist Aufgabe des Artbegriffs, als Maßstab für die richtige Klassifikation von „Sorten" zu dienen.
Dies wirft sofort ein Problem auf: Welches sind die Merkmale, aufgrund derer man Individuen zu Arten
zusammenfassen kann? Diese Frage läßt sich leicht beantworten, wenn der Unterschied zwischen zwei
Arten so eindeutig ist wie der zwischen Löwe und Tiger. In vielen anderen Fällen jedoch scheint die
Variation unter den Individuen einer Art auf den ersten Blick von der gleichen Größenordnung zu sein wie
die Unterschiede zwischen Arten. Denn es gibt eine gewaltige Menge an Variation innerhalb der Tier- und
Pflanzenarten, die im sexuellen Dimorphismus, in der Existenz verschiedener Stadien des Lebenszyklus
(etwa Raupe und Schmetterling), in alternierenden Generationen und in vielen anderen Formen
individueller Variation zum Ausdruck kommt. Dadurch entstehen große Schwierigkeiten bei der
Abgrenzung von Arten. Will man diese Probleme lösen, so muß man nicht nur über ausreichende
biologische Information verfügen, man muß auch eine klare Vorstellung davon haben, was mit dem
Ausdruck „Art" oder „Spezies" gemeint ist.
Arttaxon und Artkategorie
Die Anwendung des Terminus ,Species' auf zwei grundlegend verschiedene Kategorien hat in der
Vergangenheit Verwirrung verursacht. Die Einführung des neuen Ausdruckes Taxon [3] erlaubt nunmehr
eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen.
Ein Taxon ist ein konkretes zoologisches oder botanisches Objekt. Gruppen von Individuen wie Wölfe,
Nachtigallen oder Stubenfliegen sind Speziestaxa (siehe Kapitel 4).
Wenn ein Taxonom ein Exemplar, ein Individuum, einer Art zuteilen will, so hat er es mit einem rein
zoologischen oder botanischen Problem zu tun. Gehören die Individuen eines umschriebenen Gebietes
derselben Population an? Das ist kein Problem des Ranges, wie etwa die Frage der Artkategorie, sondern
ein Problem der Abgrenzung. Er hat ein vorgegebenes zoologisches Objekt vor sich, etwa Schneegänse
(Anser caerulescens), und versucht zu bestimmen, ob weiße und blaue Vögel Produkte desselben Genpools
sind. Gleichzeitig ist das auch ein ontologisches Problem. Sind die Tiere, die zu einer Art gehören,
Angehörige einer Klasse oder nicht? Ghiselin (1974b) hat nachdrücklich beide Begriffe, Art und Klasse so
interpretiert (siehe auch Dobzhansky, 1951): Alle Produkte des Genpools einer Art sind Teile der Art (nicht
Zugehörige einer Klasse!) und die Art als Ganzes ist ontologisch gesehen als Individuum aufzufassen.
Arttaxa sind keine Klassen, sondern haben einen anderen Status. Arttaxa sind Individuen in dem Sinne, daß
jede Art eine räumlichzeitliche Einheit und historische Kontinuität besitzt (Hull, 1976; 1978). Jede Art hat
begründbare deutliche Grenzen, besitzt zu jeder beliebigen Zeit innere Kohärenz und (nicht unbedingt) eine
Kontinuität in der Zeit. Jede Gruppierung von Populationen ist ein Arttaxon, wenn sie die Definition der
Artkategorie erfüllt.
In der Praxis gibt es zwei Probleme im Zusammenhang mit dem Arttaxon: (1) die Zuteilung
individueller Varianten („Phäna", s. Mayr, 1969) zu dem richtigen Arttaxon und (2) die Abgrenzung der
Taxa voneinander, insbesondere die Entscheidung, welche bei einer Vielzahl von Populationen in Zeit und
Raum – zu einer einzigen Spezies gehören.
Man muß deutlich zwischen Arttaxon und Artkategorie unterscheiden. Die Artkategorie ist die Klasse,
deren Angehörige Arttaxa sind. Die jeweilige Definition der Artkategorie, die ein Autor benützt, bestimmt,
welche Taxa er als Arten einordnet. Das Problem der Artkategorie ist einfach das der Definition. Wie
definieren wir den Begriff „Art"? Der Wechsel der Definitionen ist die Geschichte des Artbegriffs.
Das Bestimmen des Artstatus ist also ein Zwei-Schritte-Prozeß. Der erste Schritt besteht in der
Abgrenzung des vermuteten Arttaxon gegenüber anderen Taxa, der zweite im Einstufen des gegebenen
Taxon in die richtige Kategorie, zum Beispiel „Population", „Unterart" oder „Art". Diese klare Erkenntnis
des grundlegenden Unterschiedes zwischen Arttaxon und Artkategorie ist eine Entwicklung der letzten
Jahrzehnte; sie schaltete eine Hauptquelle der Verwirrung, zumindest im Prinzip, aus. Viele Kontroversen,
die sich angeblich um den Artbegriff drehten, betrafen in Wirklichkeit die Anerkennung von Arttaxa und
die Zuordnung individueller Varianten (oder anderer Phäna) zu Arttaxa. Polytypische Arten, zum Beispiel,
sind keine getrennte Artkategorie, sondern lediglich eine besondere Sorte von Taxa. Die Mehrzahl der
Taxonomen, sah – wie auch ich bis vor ein paar Jahren in dieser Beziehung keineswegs klar.
Frühere Artkonzepte
Im Altertum kannte man die biologische Integrität der Art noch nicht. Aristoteles zum Beispiel glaubte,
daß Hybridisation zwischen verschiedenen Arten häufig sei, etwa zwischen Fuchs und Hund oder zwischen
Tiger und Hund. Sowohl Aristoteles als auch Theophrastos übernahmen den Volksglauben, wonach sich
der Samen einer Pflanzenart zu Pflanzen einer anderen Art entwickeln konnte (Heterogonie). Die Mehrheit
der Kräuterkundler und frühen Botaniker hielten dies für wahr oder machten zumindest keinen Versuch, es
zu widerlegen [4]. Albertus Magnus beschrieb fünf Arten der Umwandlung einer Pflanze in eine andere.
Angesichts derartiger Ungewißheiten hinsichtlich der Natur der Arten ist es nicht überraschend, daß es
keine konsequente Terminologie gab. Nach unseren Wörterbüchern ist das griechische Wort für Art eidos
und für Gattung genos, aber Platon benutzte beide Worte, als seien sie völlig gegeneinander austauschbar.
Er gebrauchte niemals eidos im Sinne von „Art", die einer Kategorie „Gattung" untergeordnet ist.
Aristoteles machte zwar einen Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken, hauptsächlich aber in seinen
Abhandlungen über Logik. In seinen biologischen Schriften verwandte er das Wort genos 413mal, aber in
354 Fällen bezieht es sich auf eine Tierart und lediglich in den restlichen Fällen auf eine
Gattungskategorie. Von den 96 Fällen, in denen er das Wort eidos benutzt, bezeichnet es nur in 24 Fällen
Tiersorten. Somit wird der Ausdruck eidos nur in 6 Prozent der 378 Fälle benutzt, in denen auf eine Tierart
bezug genommen wird, in allen anderen Fällen dagegen das Wort genos. „Die herkömmliche Annahme,
daß Aristoteles tatsächlich Tiere in Gattungen oder Arten einstufte… wird von dem Belegmaterial nicht
bestätigt" (Balme, 1962).
Die Ausdrücke „Genus“ und „Species“ wurden in der griechischen Philosophie hauptsächlich bei
Erörterungen über Logik gebraucht. Bei der logischen Zweiteilung wurde die Gattung, ungeachtet ihres
Ranges, in Arten unterteilt. Canis wäre eine Art in der Gattung der Carnivoren, der Pudel aber eine Art in
der Gattung Hund. Die Ausdrücke „genus44 und „species44 regelten die Einbeziehung von Elementen in
größere Klassen. Diese Verwendung, die also einen relativen Rang betonte, setzte sich von der Antike bis
in die Zeit von Linnaeus fort, der in einer seiner frühen Veröffentlichungen schrieb: „Vegetabilium species
sunt: Lithophyta, Algae, Fungi…" und so weiter ( Fundamental 1737).
Die Übernahme des Christentums und des Schöpfungsdogmas änderte die Situation anfänglich
bemerkenswert wenig. Der Heilige Augustinus erklärte, die Pflanzen seien am dritten Schöpfungstage
causaliter geschaffen worden, d. h. die Erde habe an jenem Tage die Kraft erhalten, sie hervorzubringen.
Dies konnte Urzeugung, Heterogonie und alle möglichen anderen Veränderungen in der nachfolgenden
Erdgeschichte bedeuten. Seine Definition der Art („similia atque ad unam originem pertinentia" gleich
„was ähnlich und gemeinsamen Ursprungs ist44) läßt schon die Definition Rays ahnen.
Nach der Reformation änderte sich die Einstellung zur Art drastisch. Beständigkeit und völlige Konstanz
der Arten wurden nun ein festes Dogma. Eine wörtliche Auslegung der Genesis verlangte den Glauben an
die individuelle Schöpfung jeder Pflanzenund Tierart in den Tagen vor der Erschaffung des Menschen. Die
Art war somit die Einheit der Schöpfung. Der rasche Fortschritt der Naturgeschichte in jener Epoche
förderte diese Entwicklung. Die meisten Kräuterkundler gelangten bei ihrer Erforschung wilder Pflanzen
ebenfalls zu der Überzeugung, Arten seien wohldefinierte Einheiten der Natur und sie seien konstant und
deutlich voneinander getrennt.
Der essentialistische Artbegriff
Die auf dem Schöpfungsglauben beruhende Interpretation des Artbegriffes der christlichen
Fundamentalisten stimmte recht gut mit dem essentialistischen Artkonzept überein, demzufolge jede Art
durch ihre unveränderliche Essenz (eidos) gekennzeichnet und von allen anderen Arten durch eine scharfe
Diskontinuität getrennt sei. Für den Essentialismus ist die Vielfalt der unbelebten wie auch der lebendigen
Natur die Widerspiegelung einer begrenzten Zahl unveränderlicher Universalien (Hull, 1974). Diese
Vorstellung geht letzten Endes auf Platons Begriff des eidos zurück, und dieses Konzept schwebte späteren
Autoren vor, wenn sie von der Essenz oder „Natur" eines Objekts oder Organismus sprachen. Alle Objekte,
die dieselbe Essenz gemeinsam haben, gehören derselben Art an.
Auf dieselbe Essenz wird aufgrund der Ähnlichkeit geschlossen. Arten waren somit einfach als Gruppen
ähnlicher Individuen definiert, die anders sind als Individuen, die anderen Arten angehören. So begriffen,
stellen Arten verschiedene „Typen" von Organismen dar. Nach dieser Auffassung stehen die Individuen
nicht in einem besonderen Verhältnis zueinander; sie sind lediglich Ausdruck desselben eidos. Variation ist
das Resultat unvollkommener Manifestation des eidos.
Beim Sortieren von „Arten" von Mineralien und anderen unbelebten Gegenständen funktionierte das
Kriterium der Ähnlichkeit relativ gut. Wenn man jedoch hochgradig variable Organismen zu klassifizieren
hat, ist die Ähnlichkeit ein höchst unzuverlässiger Maßstab. Wie kann man da wissen, ob zwei Individuen
dieselbe Essenz gemeinsam haben oder nicht? Dies läßt sich bei solchen Individuen annehmen, die
einander sehr ähnlich sind, „die dieselben Merkmale haben". Was soll man aber mit Individuen anfangen,
die sich so stark unterscheiden wie Männchen und Weibchen bei geschlechtlich dimorphen Tieren oder wie
Larven und ausgewachsene Individuen bei Wirbellosen oder wie eine der anderen auffällig verschiedenen
Varianten, die man in einer Art so häufig vorfindet? In allen Fällen ausgeprägter sexueller und
altersbedingter Variation oder bei jeder Art von Polymorphismus brach die Methode, aus der Ähnlichkeit
auf gemeinsame Essenz zu schließen, völlig zusammen, so daß man sich gezwungen sah zu fragen, ob es
nicht ein Kriterium gäbe, die „gemeinsame Essenz" zu bestimmen.
John Ray (Hist. Plant., 1686) gab als erster eine biologische Antwort auf diese Frage: „Um eine
Bestandsaufnahme der Pflanzen in Angriff zu nehmen und eine richtige Klassifikation von ihnen aufstellen
zu können, müssen wir irgendeine Art von Kriterium zu entdecken suchen, um das, was man als ,Spezies'
bezeichnet, zu bestimmen. Nach einer langen und ausgedehnten Erforschung ist mir kein zuverlässigeres
Kriterium für die Bestimmung der Arten eingefallen als die unterscheidenden Merkmale, die bei der
Fortpflanzung aus Samen weitergegeben werden. Somit sind also Variationen, gleichgültig welcher Art,
die bei Individuen oder Arten auftreten, wenn sie aus dem Samen ein und derselben Pflanze entstehen,
zufällige Variationen und nicht solche, die eine Art unterscheiden… Ebenso behalten Tiere, die sich in der
Art unterscheiden, immer ihre getrennten Arten; niemals entspringt eine Art aus dem Samen einer anderen
oder umgekehrt."
Dies war ein prächtiger Kompromiß zwischen der praktischen Erfahrung des Naturforschers, der in der
Natur beobachten kann, was zu einer Art gehört, und der essentialistischen Definition, die eine zugrunde
liegende gemeinsame Essenz fordert. Ganz offensichtlich bleibt die gesamte Bandbreite der Variation, die
jedes Elternpaar, das ein und derselben Art angehört, in seinen Nachkommen erzeugen kann, innerhalb des
Rahmens, der durch das Potential der Essenz einer einzelnen Art gesetzt ist. Die Bedeutung der
Fortpflanzung für den Artbegriff liegt darin, daß sie Rückschlüsse darauf zuläßt, welche Variationsbreite
mit der Existenz einer einzigen Essenz vereinbar ist.
Generationen von Naturforschern übernahmen begeistert Rays Definition. Sie hatte zudem den Vorteil,
so gut mit dem Schöpfungsdogma zusammenzupassen. Darauf bezog sich Cuvier, als er Arten als
„individus descendants des parents communs" definierte [5]. Er erklärte dies in einem Brief an seinen
Freund Pfaff folgendermaßen: „Wir stellen uns vor, daß eine Art die gesamte Nachkommenschaft von dem
ersten von Gott geschaffenen Paar ist, fast so wie alle Menschen als die Kinder von Adam und Eva
dargestellt werden. Was für Mittel haben wir, zu diesem Zeitpunkt den Pfad dieser Genealogie
wiederentdecken? Er liegt gewiß nicht in der strukturellen Ähnlichkeit. Tatsächlich bleibt nur die
Reproduktion übrig, und ich behaupte, daß dies das einzige zuverlässige und sogar unfehlbare Merkmal für
das Erkennen der Art ist" (Coleman, 1964, S. 145). In der Tat war dies nichts anderes als Rays Kriterium,
und später gab Cuvier selbst zu, in der Praxis sei die Ähnlichkeit das primäre Kriterium bei der
Abgrenzung von Arttaxa. Zweifellos hat Cuviers Artdefinition keine evolutionären Obertöne.
Zahlreiche Artdefinitionen von Ray bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestätigten auf der einen Seite
die Unveränderlichkeit, Dauer und nicht zu überbrückende Diskontinuität der Arten und bedienten sich
gleichzeitig biologischer Kriterien, um den scheinbaren Gegensatz zwischen auffälliger Variation und der
Präsenz einer einzigen Essenz aufzulösen. Der von den Autoren jener Periode so häufig benutzte Ausdruck
„gemeinsame Abstammung" hatte die rein operationale Bedeutung von Blutsverwandtschaft, und nichts
mit einer Vorstellung von Evolution zu tun. Wenn ein derart nachdrücklich gegen den Evolutionsgedanken
eingestellter Autor wie von Baer (1828) die Art als „die Summe der Individuen, die durch Abstammung
von gemeinsamen Vorfahren miteinander verbunden sind" definiert, so ist es völlig klar, daß er sich nicht
auf die Evolution bezieht. Das gleiche gilt für Kant, wenn er sagt: „Die Natureinteilung [in Gattungen und
Arten]… [gehet auf] Stämme, welche die Tiere nach Verwandtschaften in Ansehung der Erzeugung
einteilt" (WerkeXl, 1968, S. 11). Für einen Anhänger der Schöpfungslehre bedeutete es einfach
Abstammung von dem Paar, das ursprünglich geschaffen worden war. Eine solche „Abstammung" wurde
von Linnaeus erneut bekräftigt.
Linnaeus
Carl Linnaeus, der große schwedische Botaniker, wird immer als ein Verfechter des essentialistischen
Artbegriffs beschrieben. Das war er auch, und doch reicht diese Bezeichnung keineswegs aus, die
Vielseitigkeit seines Artkonzepts angemessen zu beschreiben, denn Linnaeus war in einer Person lokal und
empirisch arbeitender Naturforscher und zugleich ein frommer Anhänger des Schöpfungsglaubens und ein
Gelehrter auf dem Gebiet der aristotelischen Logik [6]. Zwar lag bei allen drei Komponenten seines
Denkens das Schwergewicht auf der Konstanz und scharfen Abgrenzung der Arten, doch ist es, wenn man
Linnaeus' Denken voll und ganz verstehen will, unerläßlich, alle drei Quellen seiner Vorstellungswelt im
Auge zu behalten. Zum ersten Mal (1736) drückte er seinen Artbegriff mit dem berühmten Aphorismus
aus: „Wir zählen so viele Arten, als verschiedene Formen zu Anbeginn erschaffen wurden". In seinem
Werk Philosophia Botanica (These 157) 1751 erweiterte er diese Definition zu der Feststellung: „Es gibt
so viele Arten, als das Ewige Wesen zu Anbeginn verschiedene Formen hervorbrachte. Diese Formen
bringen weitere hervor, nach den ihnen innewohnenden Gesetzen der Fortpflanzung, die aber ihnen selber
immer ähnlich sind. Deshalb gibt es so viele Arten, als uns heute verschiedene Formen und Strukturen
begegnen."
Wenn Linnaeus sagte, „schuf, so meinte er dies völlig wörtlich. In einem Aufsatz brachte er seine
Überzeugung zum Ausdruck, „daß am Anfang der Welt nur ein einziges geschlechtliches Paar von jeder
Art von Lebewesen geschaffen wurde… mit einem geschlechtlichen Paar meine ich ein Männchen und ein
Weibchen jeder Art, bei der sich die Individuen nach Geschlecht unterscheiden; doch gibt es bestimmte
Klassen von Tieren, natürliche Hermaphroditen, und von diesen wurde pro Art nur ein einziges Individuum
am Anfang geschaffen." Zu diesem Ergebnis gelangte er nicht nur aus religiöser Überzeugung, sondern
auch, weil es den zu jener Zeit „modernen" wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprach. Spallanzani und
Redi hatten das Auftreten von Urzeugung widerlegt, und Ray wie auch Linnaeus hatten sich selbst davon
überzeugt, daß die Umwandlung von Samen einer Art in die einer anderen Art (Heterogonie) ebenfalls
unmöglich war. Die Annahmen des Heiligen Augustinus wurden nicht bestätigt.
Die Art spielte in Linnaeus' Denken niemals eine so wichtige Rolle wie die Gattung. Infolgedessen war
er bei der Behandlung spezieller Arten in seinen taxonomischen Katalogen von Pflanzen (Species
Plantarum) und von Tieren (Systema Naturae) häufig recht nachlässig. Die Zusammenstellungen von
Arten in diesen beiden Arbeiten waren voller Fehler, was häufige Revisionen dieser Schriften erforderlich
machte.
Die Beobachtungen der Naturforscher, die Erfordernisse des christlichen Glaubens und das Dogma des
Essentialismus – sie alle führten zu der gleichen Schlußfolgerung, nämlich der Existenz gut definierter und
völlig konstanter Arten. Diese Vorstellung hatte während der darauffolgenden hundert Jahre einen enormen
Einfluß. Solange man davon überzeugt war, daß die Arten mit Leichtigkeit zu anderen Arten werden
konnten (Heterogonie) oder ebenso leicht durch Urzeugung entstanden, konnte die ganze Frage einer
Evolution gar nicht aufkommen. Poulton (1903), Mayr (1957) und Zirkle (1959) haben darauf aufmerksam
gemacht, daß das Beharren von Linnaeus auf der Realität, scharfen Abgrenzung und Konstanz der Arten
vielleicht mehr dazu beitrug, spätere Studien der Evolution zu ermutigen, als wenn er sich der
traditionellen Überzeugung von der leichten Veränderlichkeit der Arten angeschlossen hätte. Aus seinem
Artbegriff ergab sich ein Widerspruch zwischen den vielen Anzeichen von Evolution in der Natur und der
scheinbaren Konstanz der Arten – ein Widerspruch, der gelöst werden mußte.
Kurioserweise verleugnete Linnaeus in seinem späteren Leben den typologischen Artbegriff konstanter
Arten, der unter seinem Namen so wohlbekannt ist. Er entfernte die Aussage „nullae species novae" (keine
neuen Arten) aus der 12. Auflage seines Systema Naturae (1766) und strich in seiner eigenen Kopie der
Philosophia Botanica die Worte „Natura non facit saltus" durch (Hofsten, 1958). Verantwortlich für diese
Wandlung seiner Vorstellungen war eine Reihe von Entdeckungen in der Botanik (Zimmermann, 1953, S.
201-210). Zuerst entdeckte er eine auffallende Mutation der Blütenstruktur (Peloria) an der Pflanze
Linaria, von der er angenommen hatte, sie sei eine neu entstandene gute Art und Gattung, und später fand
er eine Reihe mutmaßlicher Arthybriden. Das veranlaßte ihn zu der sonderbaren Ansicht, daß zu Beginn
vielleicht nur Gattungen geschaffen worden waren, und daß die Arten das Resultat von Kreuzungen
zwischen diesen Gattungen seien. Diese Hypothese war nicht nur unvereinbar mit allem, was er vor her
gesagt und geglaubt hatte, sondern stand auch in völligem Gegensatz zum Essentialismus. Es überrascht
nicht, daß Linnaeus sofort scharf von allen Seiten angegriffen wurde, denn die Erzeugung neuer Essenzen
durch Bastardierung war für jeden konsequenten Essentialisten einfach undenkbar. Niemand vertrat diesen
Standpunkt energischer als Kölreuter, der in einer Serie von Experimenten (1761-1766) nachwies, daß neu
erzeugte zwischenartliche Hybriden keine konstanten neuen Arten, sondern äußerst veränderlich sind, und
daß sie durch fortwährendes Rückkreuzen wieder zu den Elternarten werden können (Olby, 1966) [7].
Diese späte Ideen von Linnaeus wurden in der darauf folgenden Epoche fast völlig vergessen und hatten
allem Anschein nach keinerlei Einfluß auf das zukünftige Evolutionsdenken.
Sein Zeitgenosse Michel Adanson vertrat, so revolutionär sein Denken zum Teil auch war, einen völlig
orthodoxen Artbegriff. Er führte eine sorgfältige Analyse des Artproblems durch und kam dann zu dem
Schluß, „daß die Transmutation von Arten bei Pflanzen ebenso wenig stattfindet wie bei Tieren, und daß es
dafür nicht einmal bei den Mineralien einen unmittelbaren Beweis gibt, woraus das anerkannte Prinzip
folgt, daß die Konstanz bei der Bestimmung einer Art essentiell ist" (1769, S.418). Dieses Zitat zeigt
besonders gut, welch ein formalistisches und unbiologisches Artkonzept selbst von scharfsinnigen und
ansonsten vorurteilsfreien Biologen vertreten wurde.
In der Zeit nach Linnaeus wurde der essentialistische Artbegriff von den Taxonomen fast einstimmig
übernommen. Er postulierte vier Artmerkmale: (1) Arten bestehen aus ähnlichen Individuen, die dieselbe
Essenz gemeinsam haben; (2) jede Art ist von allen anderen durch eine scharfe Diskontinuität getrennt; (3)
jede Art ist in der Zeit konstant und (4) es gibt strenge Grenzen für die mögliche Variation jeder einzelnen
Art. Dieses war, zum Beispiel, Lyells Artbegriff.
Buffon
In seinen Überlegungen über die Art kam Georges Louis Buffon, obwohl zeitlich vor Linnaeus und
Cuvier, dem heutigen Denken näher als diese. Es ist nicht leicht, Buffons Gedanken über die Artfrage
knapp zusammenzufassen; nicht nur, weil sie über zahlreiche Bände seiner Histoire Naturelle verstreut
sind, sondern auch, weil sich seine Denkweise mit der Zeit – von seiner ersten Aussage im Jahre 1749 bis
zu seiner letzten 1766 geändert hat. Verschiedene Buffon-Forscher haben daher unterschiedliche
Auslegungen vorgelegt [8].
Buffons erste Aussagen über die Art hatten einen stark nominalistischen Beigeschmack und scheinen
mehr Gewicht auf die Existenz von Individuen als von Arten zu legen und darüber hinaus die Kontinuität
unter ihnen zu unterstreichen: „Die Natur schreitet in unbekannten Stufenfolgen voran und unterwirft sich
folglich nicht unseren absoluten Aufteilungen, wenn sie mit unmerklichen Nuancen von einer Art zur
anderen und häufig von einer Gattung zu einer anderen übergeht. Es gibt unvermeidlich eine große Zahl
zweifelhafter Arten und dazwischenliegender Exemplare, bei denen man nicht weiß, wo man sie hintun
soll" (Oeuvr. Phil., S. 10).
Eigentlich war diese Feststellung im ersten Band der Histoire Naturelle Teil einer Attacke auf das
Linnaeische System, und in zwei anderen Bänden desselben Werkes (die alle drei gleichzeitig im Jahre
1749 veröffentlicht wurden) vertrat Buffon die Vorstellung von konstanten, gut abgegrenzten Arten. Wenn
es auch von mehreren Spezialisten ge leugnet wird, so verstand Buffon die Arten dennoch essentialistisch.
Jede Art war durch einen artspezifischen moule intérieur gekennzeichnet, der, wenn auch auf andere Weise
abgeleitet, dennoch viele Eigenschaften mit Piatons eidos gemeinsam hatte. Außerdem war jede Art
deutlich von allen anderen Arten getrennt:
In der Natur besteht in jeder Art ein allgemeiner Prototyp, nach dem alle Individuen geformt werden.
Bei ihrer Verwirklichung werden die Individuen jedoch je nach den Umständen verändert oder
verbessert. In bezug auf bestimmte Merkmale zeigt sich dann eine Unregelmäßigkeit in der äußeren
Erscheinung bei der Aufeinanderfolge von Individuen, doch gleichzeitig besteht (eine auffallende
Konstanz, wenn man die Art als Ganzes betrachtet. Das erste Tier, das erste Pferd beispielsweise, war
das äußere Modell und die innere Gußform, nach der alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen
Pferde geformt worden sind und noch geformt werden (Hist. nat. IV, S. 215-216).
Für Buffon war diese Aufeinanderfolge von Individuen das wichtigste Merkmal von Arten, da jede dieser
Abfolgen streng von allen anderen getrennt ist:
In der charakteristischen Formenvielfalt der Arten sind dann also die Zwischenräume zwischen den
Nuancen der Natur am besten bemerkbar und am stärksten ausgeprägt. Man könnte sogar sagen, daß
diese Zwischenräume zwischen Arten die einheitlichsten und am wenigsten variablen Von allen sind, da
man immer eine Linie zwischen zwei Arten ziehen kann, d. h. zwischen zwei Abfolgen von Individuen,
die sich nicht miteinander reproduzieren können. Diese Unterscheidung ist die stärkste, die wir in der
Naturgeschichte haben…. Jede Art – jede Aufeinanderfolge von Individuen, die sich erfolgreich
miteinander fortpflanzen können – wird als eine Einheit betrachtet und getrennt behandelt werden….
Die Art ist also lediglich eine konstante Aufeinanderfolge ähnlicher Individuen, die sich miteinander
reproduzieren können (Hist. Nat. IV, S. 384-385).
Als Ergänzung zu Rays Kriterium, der gezeigt hatte, daß außerordentlich verschieden aussehende
Organismen derselben Art angehören konnten, wenn sie von einem gemeinsamen Vorfahren abstammten,
entdeckte Buffon ein Kriterium, anhand dessen man entscheiden konnte, ob zwei sehr ähnliche „Sorten"
verschiedene „Arten" waren oder nicht. Ein Beispiel: Sind Esel und Pferd eine Art? Seine Antwort war:
Individuen, die keine fortpflanzungsfähigen Nachkommen erzeugen können, gehören zu verschiedenen
Arten. „Wir sollten zwei Tiere als zu derselben Art gehörig betrachten, wenn sie sich mittels Kopulation
fortpflanzen und die Ähnlichkeit der Art beibehalten können; und wir sollten sie als zu verschiedenen
Arten zugehörend ansehen, wenn sie unfähig sind, auf diese Weise Nachkommenschaft zu erzeugen" (Hist.
Nat. II, S. 10). „Eine Art ist eine konstante Aufeinanderfolge ähnlicher Individuen, die sich miteinander
fortpflanzen können" (S.385). Das auffallend Neue an Buffons Artbegriff ist, daß das Kriterium der
Zugehörigkeit zur gleichen Art nicht mehr, wie bei Ray, in der Bandbreite morphologischer Variation bei
den Nachkommen eines Elternpaares besteht, sondern vielmehr in ihrer Fähigkeit, fruchtbare Nachkommen
zu erzeugen. Durch Einführen dieses völlig neuen Kriteriums hatte Buffon einen großen Schritt vorwärts in
Richtung auf den biologischen Artbegriff getan. Da er jedoch die Arten für konstant und nicht veränderlich
hielt, vertrat er noch immer den essentialistischen Artbegriff.
Noch in einem zweiten Aspekt unterscheidet sich Buffon von Linnaeus und anderen orthodoxen
Taxonomen; er mißt den morphologischen Merkmalen geringeres Gewicht bei und betont dagegen
Verhalten, Temperament und Instinkt, die er für weitaus wichtigere Artmerkmale hielt als rein strukturelle
Züge. Es ist nicht genug, so stellt er fest, eine Art anhand einiger weniger Schlüsselmerkmale zu
identifizieren; wenn man ein Tier kennenlernen will, so muß man alle seine Merkmale kennen. Niemand
nahm diese Empfehlung ernster als die Feldforscher, und die große Blüte der Naturgeschichte lebender
Tiere, insbesondere der Vögel, in den darauffolgenden Generationen verdankt Buffons Begriffen sehr viel.
Man kann eine Art immer anhand von Merkmalen ihrer Lebensgeschichte erkennen. Im Gegensatz zu der
Gattung von Linnaeus, die ein rein willkürliches Constructum ist, ist eine Art daher etwas Natürliches und
Reales.
In späteren Jahren seines Lebens (nach 1765) wandelte Buffon seinen Artbegriff etwas ab, indem er das
Wort „Art" in einem engeren und recht eingeschränkten Sinn definierte (Roger, 1963, S. 576). Als er,
insbesondere durch das Studium der Vögel, erkannte, daß es eng verwandte Gruppen von Arten gab, deren
einige offenbar fruchtbare Bastarde hervorbrachten, schrieb er diesen Art„familien" diejenigen Attribute
zu, die er zuvor lediglich den Arten vorbehalten hatte. Doch er behielt gleichzeitig seine Vorstellung von
wohldefinierten Arten auf einer niedrigeren Ebene bei. Djeses tastende Suchen nach einem neuen
Artkonzept nahm den Gedanken vorweg, Artgruppen könnten aufgrund der Abstammung von
gemeinsamen Vorfahren eine Einheit sein; aber das hatte anscheinend keinen bleibenden Einfluß auf seine
Leser und spielte in der späteren Geschichte (des Artbegriffs keine weitere Rolle.
Andererseits übte Buffons recht „biologische" Auffassung der Art einen wichtigen Einfluß aus.
Zimmermann (1778, I, S. 130/131) folgt seiner eigenen Aussage zufolge Buffon, Blumenbach und
Spallanzani in der Übernahme der wechselseitigen Kreuzbarkeit als Artkriterium, und faßt alle Hunde zu
einer einzigen Art zusammen, „einmal, weil sie sich alle untereinander begatten, und, was das wichtigste
ist, fruchtbare Junge zeugen ; zweitens, weil alle diese Rassen einerlei Triebe, gleiche Menschenliebe
haben und gleicher Zähmung fähig sind." Wie aus den Schriften von Pallas, Gloger, Faber, Altum und den
besten Naturforschern des 19. Jahrhunderts hervorgeht, war ein derartiger biologischer Artbegriff zwischen
1750 und 1860 weitverbreitet. Gleichzeitig gab es jedoch auch einen streng essentialistischen Begriff,
insbesondere unter den Sammlern, die jede Variante als eine neue Art beschrieben. Pfarrer C. L. Brehm
benannte in seinem kleinen, thüringischen Dorf nicht weniger als vierzehn Haussperlings„arten"; ein
französischer Spezialist für Süßwassermuscheln gab den Varianten einer einzigen Art mehr als 250
Artnamen. Für diese Autoren waren Arten Typen, und jede Betrachtung der Art als Population war ihrem
Denken fremd. Diese Auffassung von Arten wird in der systematischen Literatur häufig als typologisches
Artkonzept bezeichnet. Es gibt kaum ein höheres Tier- und Pflanzentaxon, in dem nicht ein oder zwei
„Artmacher" aktiv gewesen wären, die für Hunderte und Tausende von Synonymen verantwortlich sind
(Mayr, 1969, S. 144-162).
In der Botanik wurde die Variation vielleicht sogar noch mehr als in der Zoologie als Entschuldigung für
die Beschreibung unzähliger neuer Arten benutzt, insbesondere bei sogenannten „schwierigen" Gattungen
wie Rubus oder Crataegus. Die Lage verschärfte sich dadurch, daß es die Botaniker fast universell
unterließen, terminologisch zwischen individuellen und geographischen Varietäten zu unterscheiden. Ein
erster Anfang zum Besseren war, als der Internationale Botanikerkongreß 1867 den von Alphonse de Can
dolle vorgebrachten Vorschlag annahm, Unterarten, Varietäten und andere Unterteilungen von Arten
anzuerkennen. In den darauffolgenden Jahren trugen die Veröffentlichungen von Kerner (1866; 1869) und
Wettstein (1898) zur Klärung der Lage bei. Doch selbst nach dem Entstehen der neuen Systematik gab es
immer noch allzu viele Botaniker, die den Ausdruck „Varietät" unterschiedslos für geographische
Populationen und für Varianten innerhalb einer Population benutzten.
Der nominalistische Artbegriff
Der Widerstand gegen den essentialistischen Artbegriff entwickelte sich an zwei Fronten, unter den
Naturforschern und unter den Philosophen. Die einflußreichsten Philosophen Anfang und Mitte des 18.
Jahrhunderts waren Leibniz und Locke; keiner von beiden war glücklich mit dem Begriff gut umrissener,
scharf getrennter Arten. Locke leugnete die Existenz von Arten zwar nicht unbedingt, doch sagte er: „Ich
halte es nichtsdestoweniger für wahr, daß die Grenzen, nach denen die Menschen die Arten sortieren,
menschengemacht sind." Er rief aus, er könne nicht einsehen, warum zwei Hunderassen „nicht ebenso
verschieden sind wie ein Spaniel und ein Elefant… so ungewiß sind die Grenzen der Tierarten für uns."
In der Epoche nach Leibniz begannen die Vorstellungen von vielfältiger Fülle und Kontinuität das
abendländische Denken zu beherrschen (Lovejoy, 1936, S. 229-241); da hinein paßten die Begriffe von
diskontinuierlichen systematischen Kategorien, einschließlich der Artkategorie, nicht mehr, und die
Philosophen zogen sich auf eine nominalistische Definition zurück. Für den Nominalisten gibt es nur
Individuen, während Arten oder jede andere „Klasse" von Menschen gemachte Konstrukte sind.
Der Nominalismus, eine mittelalterliche philosophische Schule, lehnte die Vorstellung des
Essentialismus ab, ähnliche Dinge hätten die gleiche Substanz (Essenz) gemeinsam; stattdessen behauptete
er, Klassen ähnlicher Dinge hätten nichts anderes miteinander gemein als einen Namen. Diese Auslegung
wurde von mehreren Autoren des 18. Jahrhunderts auch auf die Arten angewandt (Crombie, 1950). So
behauptete Robinet: „Es gibt nur Individuen, und keine Reiche oder Klassen oder Gattungen oder Arten"
(De la nature, IV, S. 1-2). Ähnliche Aussagen finden sich in den Schriften mehrerer französischer
Naturforscher, angefangen mit dem ersten Bande Buffons (1749) und weiter in den Werken von Lamarck
(Burckhardt, 1977) und Lacepede (1800).
Buffon gab diesen Begriff rasch wieder auf (wenn er überhaupt jemals richtig davon überzeugt war),
und die anderen Naturforscher wie Lamarck und Lacepede behandelten die Arten in ihren eigentlichen
taxonomischen Abhandlungen durchaus orthodox. In seinen späteren Lebensjahren (1817) war Lamarck
immer mehr von der Bedeutung der Arten überzeugt. Er unterstrich, daß die Art bei unbelebten Objekten
etwas ganz anderes sei als bei Organismen. Arten von Lebewesen sind komplexe Systeme heterogener
Moleküle, und das erklärt ihre Variations- und Veränderungsfähigkeit. Schließlich stellte er Fragen über
ihren evolutiven Wandel und ob „sie sich nicht vervielfältigten und auf diese Weise ihre Mannigfaltigkeit
erhielten". Diese prophetische Artauffassung war von Lamarcks früherer nominalistischer Behauptung, es
existierten lediglich Individuen, weit entfernt [9].
Der nominalistische Artbegriff blieb während des gesamten 19. Jahrhunderts bei den Botanikern beliebt.
Zu ihren Hauptverfechtern gehörten Schleiden und Nägeli. Als Beweis zur Bestätigung dieser Vorstellung
wurden am häufigsten „unklare" Gattungen wie Rubus und Hieracium angeführt. Auch bei den
Paläontologen war der nominalistische Artbegriff verbreitet, insbesondere bei Autoren, die mit
„Artefakten" wie den Conodonten arbeiteten, wo die Abgrenzung in der Tat oft schwierig ist. Innerhalb des
letzten Jahrzehnts veröffentlichten prominente Botaniker (etwa Cronquist) und Paläontologen (etwa
A.B.Shaw) geistreiche Plädoyers zugunsten der Artauffassung als einer rein willkürlichen Konvention. Der
Botaniker Bessey (1908) sprach das besonders gut aus: „Die Natur produziert Individuen und nichts
weiter… Arten haben in der Natur keine tatsächliche Existenz. Sie sind Konzepte des menschlichen
Geistes und nicht mehr… Arten sind erfunden worden, damit wir auf eine große Zahl von Individuen
kollektiv Bezug nehmen können [10]." Es gibt jedoch einige jüngere Gegner des biologischen Artbegriffs
(beispielsweise Sokal und Crovello, 1970), die im Grunde nominalistische Ideen vertreten. Allerdings sind
sie in der Minderheit. Die Beweise für die Existenz spezifischer Diskontinuitäten zwischen sympatrischen
natürlichen Populationen sind so überzeugend, daß die meisten Erforscher von lokalen Faunen und Floren
den biologischen Artbegriff übernommen haben.
Die Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts, die mit dem essentialistischen Artbegriff unzufrieden waren,
übernahmen den nominalistischen Begriff nicht unbedingt, weil sie von seiner Überlegenheit beeindruckt
waren, sondern einfach, weil sie sich keine Alternative vorstellen konnten. Mit Auftreten des biologischen
Artbegriffs verlor der nominalistische Begriff diesen Vorteil, und er ist heute, zumindest unter Biologen,
nicht mehr aktuell.
Darwins Artbegriff
Bei keinem anderen Autor kommt das Ringen um den Artbegriff so deutlich zum Ausdruck wie bei
Darwin. Die Art, die er als Sammler und Naturforscher in Shrewsbury, Edinburgh und Cambridge vorfand,
war die typologische, „nichtdimensionale" Art der Lokalfaunen. Das war auch das Artkonzept seiner
käfersammelnden Freunde sowie Henslows und Lyells Art (Mayr, 1972 b). Es war immer noch sein
Artbegriff, als er am 16. September 1835 auf den Galápagos-Inseln anlegte. Die Beagle besuchte vier
Inseln (Chatham, Charles, Albemarle und James), die alle nicht weiter als hundert Meilen voneinander
entfernt waren. Da Darwin niemals zuvor mit geographischer Variation zu tun gehabt hatte, hielt er es für
selbstverständlich, daß die Faunen aller dieser benachbarten Inseln dieselben sein würden und etikettierte
offenbar alle seine Exemplare einfach als „von den Galápagos-Inseln kommend" (Sulloway, 1982). Die
Tatsache, daß die einheimische spanische Bevölkerung bei den Riesenschildkröten jede Inselrasse
voneinander unterscheiden konnte, machte auf Darwin, dessen wissenschaftliches Interesse zu jener Zeit
sehr stark der Geologie galt, anscheinend zuerst nur wenig Eindruck. Als er anschließend seine
Vogelsammlung sortierte, stand er vor der Frage, wie er die Population auf den verschiedenen Inseln
klassifizieren sollte. Zum Beispiel gibt es auf jeder der Galápagos-Inseln eine Spottdrossel (Mimus), doch
weisen die Vögel auf jeder Insel gewisse Unterschiede gegenüber den Vögeln von den meisten anderen
Inseln auf. Sind die Bewohner der verschiedenen Inseln unterschiedliche Arten oder sind sie Varietäten?
Dies war die Frage, die Darwin stellte. Es bestand kein Zweifel daran, daß sie unterschiedliche Taxa waren,
waren doch die Unterschiede sichtbar und beschreibbar. Das Problem war eine Frage des Einstufens, d.h.
des Einordnens in die richtige Kategorie. Man muß dies im Gedächtnis behalten, wenn man Darwins
Aussagen über Arten analysiert. Sogar noch wichtiger ist, sich darüber klar zu werden, daß sich Darwins
Artbegriff in den vierziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts erheblich änderte (Kottier, 1978;
Sulloway, 1979). In den dreißiger Jahren waren seine Vorstellungen von Art und Speziation durch das
zoologische Beweismaterial bestimmt. Ja, er betrachtete die Art als Fortpflanzungsgemeinschaft. Daß
Darwin zu jener Zeit eine solche Auffassung von der Art hatte, war den Darwinforschern bis zur
Wiederentdeckung seiner Notizbücher unbekannt geblieben. Dort schrieb Darwin zum Beispiel: „Meine
Definition der Art hat nichts mit dem Hybridismus zu tun, ist einfach ein instinktiver Impuls, sich getrennt
zu halten, der zweifellos überwunden werden wird [andernfalls würden keine Hybriden produziert]; bis
dies aber eintritt, sind diese Tiere getrennte Arten" (NBT, C, S. 161) [11]. Hier haben wir eine
unmißverständliche
Beschreibung
der
Fortpflanzungsisolation,
die
durch
ethologische
Isolationsmechanismen aufrechterhalten wird. Es gibt in den Notizbüchern wiederholte Hinweise auf
wechselseitige „Abneigung" der Arten gegenüber interspezifischer Kreuzung. „Die Abneigung von zwei
Arten einander gegenüber ist offensichtlich ein Instinkt; und dies verhindert die Kreuzung" (B, S. 197).
„Definition von Art: eine, die im allgemeinen gemeinsam mit anderen Wesen von sehr ähnlicher Struktur
konstante Merkmale beibehält" (B, S.213). In diesen Notizbüchern betonte Darwin wiederholte Male,
Artstatus habe wenig mit dem Grad an Unterschiedlichkeit zu tun. „So können Arten gute Arten sein und
sich kaum in irgendeinem äußeren Merkmal unterscheiden" (B, S.213). Hier bezieht er sich auf die beiden
Zwillingsarten (sibling species) des Laubsängers Phylloscopus trochilus (collybita und sibilatrix), die von
Gilbert White 1768 in England entdeckt worden waren, und die so ähnlich sind, daß sie von den
Taxonomen erst 1817 formell anerkannt wurden. Es ist keine Übertreibung, zu behaupten, daß die
Vorstellung, die Darwin in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts von der Art hatte, dem modernen
biologischen Artbegriff sehr nahekommt.
Nimmt man dann Darwins Origin of species aus dem Jahre 1859 zur Hand und liest, was dort über die
Art gesagt wird, so kommt es einem so vor, als habe man es mit einem völlig anderen Autor zu tun (Mayr,
1959 b). Da dies der Darwin ist, wie er der Welt von 1859 bis zur Wiederentdeckung der Notizbücher
bekannt war, ist es von historischer Bedeutung zu zitieren, was Darwin im Origin of Species sagte:
Keine einzige Deutung hat alle Naturforscher befriedigen können, indessen weiß jeder im allgemeinen,
was mit dem Ausdruck „Art" gemeint ist. (S.44)
Soll daher entschieden werden, ob eine Form als Art oder als Varietät einzureihen ist, so scheint mir das
gesunde Urteil und die reiche Erfahrung des Naturforschers der einzige Führer zu sein, dem man folgen
kann. (S.47)
Aus dem Gesagten geht nun hervor, daß ich die Bezeichnung „Art" für willkürlich halte, gewissermaßen
aus Bequemlichkeit auf eine Reihe von Individuen angewendet, die einander sehr ähnlich sind, daß sie also
von der Bezeichnung „Varietät" für die minder unterschiedlichen und mehr schwankenden Formen nicht
wesentlich abweicht. (S.52, siehe auch S. 469)
Die Größe des Unterschiedes ist daher ein wichtiges Merkmal für die Bestimmung, ob zwei Formen als
Arten oder als Varietäten zu gelten haben (S. 56-57).
Varietäten haben dieselben allgemeinen Merkmale wie Arten, da „Varietäten von Arten nicht
unterschieden werden können" (engl. Ausgabe, S.58; sowie eine ähnliche Aussage auf S. 175).
Jedenfalls läßt sich feststellen, daß weder Unfruchtbarkeit noch Fruchtbarkeit einen sicheren
Unterschied zwischen Arten und Varietäten bilden (S.248).
Kurzum: wir werden die Arten genauso behandeln, wie jene Naturforscher, nach deren Meinung die
Gattungen nur künstliche, der Bequemlichkeit wegen gebildete Zusammenstellungen sind (S.485).
In einem Brief an Hooker (24. Dezember 1856) schrieb Darwin:
„Ich habe jetzt eben die verschiedenen Definitionen von Species verglichen. Es ist wirklich zum
Lachen, wenn man sieht, was für verschiedene Ideen in den Köpfen verschiedener Naturforscher
vorherrschen, wenn sie von ,Species' sprechen; bei einigen gilt Ähnlichkeit über Alles und Abstammung
ist von geringem Gewicht, – bei einigen wieder scheint Ähnlichkeit gar nichts zu gelten und
Erschaffung ist die beherrschende Idee, – bei einigen ist Abstammung der Schlüssel, – bei einigen ist
Unfruchtbarkeit ein untrügliches Zeugnis, bei anderen ist sie nicht einen Heller werth. Ich glaube, das
Alles kommt daher, daß man versucht das Undefinierbare zu definieren" (LLD, II, S. 88).
Was konnte Darwin wohl zu dieser völligen Kehrtwendung in bezug auf sein Artkonzept veranlaßt haben?
Seine Lektüre wie auch seine Korrespondenz zu jener Zeit lassen darauf schließen, daß er nach 1840 und
insbesondere seit den fünfziger Jahren zunehmend von der botanischen Literatur und der Korrespondenz
mit seinen Botanikerfreunden beeinflußt war. Er sagt selbst, daß „Alle meine Vorstellungen, darüber, wie
Species sich verändern, aus lange fortgesetztem Studium der Werke von (und der Unterhaltung mit)
Landwirten und Gärtnern hergeleitet worden sind" (LLD, II, 79). Vielleicht kein anderer Botaniker
beeinflußte Darwins Denken mehr als William Herbert, der unter anderem sagte: „Es gibt keine wirkliche
oder natürliche Trennungslinie zwischen Arten und permanenten oder erkennbaren Varietäten… noch gibt
es irgendwelche Merkmale, auf die man sich zuverlässig stützen kann, um sagen zu können, ob zwei
Pflanzen als Arten oder Varietäten unterscheidbar sind" (1837, S.341). Fast genau gleichlautende Aussagen
kann man seit jener Zeit bis heute in der botanischen Literatur finden. Nur selten wird der Versuch
unternommen, zwischen sympatrischen und allopatrischen Situationen zu unterscheiden. Herbert gestand
der Kreuzbefruchtung keinen Vorrang gegenüber dem Grad morphologischer Ähnlichkeit zu, da er glaubte,
„daß die Fruchtbarkeit des Bastards oder gemischter Nachkommen mehr von der konstitutionsmäßigen
[was auch immer das bedeuten mag!] als von den näheren botanischen Ähnlichkeiten der Eltern abhängt"
(1837, S.342). Nicht die Fortpflanzungsisolation, sondern der Grad des Unterschieds war jetzt zum
Maßstab des Artstatus geworden. Für Herbert war die Gattung die einzige „natürliche" Kategorie.
Viele von Darwins Aussagen sind völlig berechtigt, wenn man das Wort „Varietät" mit „geographisches
Isolat" übersetzt. Es ist heute ebenso wahr wie zu Darwins Tagen, daß die Einordnung geographischer
Isolate, insbesondere jener, die deutlich ausgeprägt sind, willkürlich ist. Es gibt buchstäblich Hunderte,
wenn nicht Tausende geographischer Isolate unter den Vögeln, die noch 1970 von einigen Ornithologen als
Arten und von anderen als Unterarten eingeordnet wurden.
Wenn Darwin nichts anderes hätte sagen wollen, als daß es schwierig und häufig unmöglich ist, isolierte
Populationen rangmäßig einzuordnen, so hätte niemand etwas daran aussetzen können. Geographisch
isolierte Populationen sind in der Tat beginnende Arten. Leider bediente sich Darwin einer streng
typologischen Sprache und brachte dadurch, daß er Ausdrücke wie „Formen" und „Varietäten" verwandte
statt „Individuen" oder „Populationen", eine verwirrende Doppeldeutigkeit ins Spiel. Abgesehen davon
benutzte er den Ausdruck „Varietät", statt ihn durchgehend für geographische Rassen zu verwenden,
häufig, insbesondere in seinen späteren Schriften, zur Bezeichnung einer Variante oder individuellen
Abweichung. Durch diese Erweiterung der Bedeutung des Wortes „Varietät" warf er zwei völlig
verschiedene Speziationsmodi zusammen, nämlich die geographische und die sympatrische Speziation.
Nach einem kurzen Blick auf die Aussagen, die Darwin im Origin of species über die Arten macht,
könnte man den Eindruck gewinnen, er habe sie für etwas völlig Willkürliches gehalten, das lediglich für
die Bequemlichkeit der Taxonomen erfunden worden sei. Einige seiner Bemerkungen erinnern an
Lamarcks Feststellung, es gäbe keine Arten, sondern lediglich Individuen. Und doch behandelten beide
Männer bei ihrer taxonomischen Arbeit (Lamarck an Mollusken, Darwin an Rankenfüßern) die Arten in
völlig orthodoxer Weise, als ob sie eben so viele unabhängige Schöpfungen wären. Und dies war völlig
legitim, wenn ich das hinzufügen darf, denn in diesen taxonomischen Monographien beschrieben sie
Arttaxa, und war dabei die Definition der Artkategorie, von Grenzfällen abgesehen, eine irrelevante
Überlegung.
Irgendwie war Darwin sehr mit sich selbst zufrieden, daß er das Artproblem „gelöst" hatte: Da Arten
sich fortwährend weiterentwickeln, können sie nicht definiert werden, sie sind rein willkürliche
Bezeichnungen. Der Taxonom hat sich nicht länger den Kopf darüber zu zerbrechen, was eine Art ist:
„Wenn die Ansichten, die ich in diesem Werk entwickelte… allgemein angenommen werden, so… werden
die Systematiker nicht mehr von Zweifeln geplagt werden, ob diese oder jene Formen echte Arten seien,
und das bedeutet für sie, wie ich aus Erfahrung weiß, keine kleine Erleichterung" (S.484). Hier haben wir
die Erklärung dafür, warum sich Darwin nicht länger darum bemühte, zu definieren, was eine Art ist. Er
behandelte sie rein typologisch als etwas, das durch „Unterschiedsgrade" gekennzeichnet war. Wie
Ghiselin (1969, S. 101) völlig richtig bemerkt, „gibt es keinen soliden Beweis dafür, daß Darwin die Arten
als fortpflanzungsmäßig isolierte Populationen begriff. Das trifft mit Sicherheit auf die Zeit zu, in der er
den Origin of species schrieb.
Man muß sich außerdem ins Gedächtnis rufen, daß Darwin in diesem Werk das Artproblem im
Zusammenhang mit der Frage der allmählichen Entstehung von Arten behandelte. Es bestand für ihn eine
starke, wenn auch vielleicht unbewußte Motivation, nachzuweisen, daß die Arten nicht so konstant und
deutlich getrennt waren, wie sie nach den Behauptungen der Verfechter des Schöpfungsglaubens sein
sollten. Denn wie konnten sie das Resultat allmählicher Veränderung durch natürliche Zuchtwahl sein,
wenn es stimmte, was Darwins Gegner noch während der folgenden hundert Jahre weiterbehaupteten, daß
nämlich die Arten scharf abgegrenzte und durch „unüberbrückbare Lücken" getrennte Gebilde seien?
Somit war es eine gute Strategie zu leugnen, Arten seien deutlich getrennt. Vieles ließ sich zur Bestätigung
dieser Behauptung anführen, sobald man die Arten einfach durch Unterschiedsgrade und nicht durch
Fortpflanzungsisolation definierte, vorausgesetzt, man machte keinen Unterschied zwischen
geographischen und populationsinternen „Varietäten". Wenn man die Art so versteht, ist die Entstehung
neuer Arten kein unüberwindliches Problem. Allerdings bildete Darwins Überwechseln von seinem
Artbegriff der dreißiger Jahre zu dem der fünfziger Jahre die Grundlage für Kontroversen, die ein
Jahrhundert lang anhalten sollten.
Das Entstehen des biologischen Artbegriffs
Die Veröffentlichung von Darwins Origin of Species stürzte alle in ein schreckliches Dilemma, die sich
mit dem Studium der Arten befaßten. Es war offensichtlich, daß die Arten von gemeinsamen Vorfahren
abstammten und zwar, wie Darwin behauptete, durch einen langsamen, allmählichen Prozeß. Doch die
Erforscher der lokalen Faunen und Floren wußten aus ihrer Erfahrung, daß die Arten in der Natur durch
unüberbrückbare Lücken getrennt sind und keineswegs aus willkürlichen Ansammlungen von Exemplaren
bestanden, wie es Darwin in seinem Werk zu behaupten schien. Folglich behandelte man die Arten
weiterhin so, als hätte niemand eine Evolutionstheorie aufgestellt. Unter den Museumstaxonomen herrschte
weiterhin die essentialistische Artinterpretation (Stresemann, 1975). Man bezeichnete sie als
morphologischen Artbegriff, da der Grad des morphologischen Unterschieds als das Kriterium benutzt
wurde, zu entscheiden, ob bestimmte Individuen derselben oder anderen Arten angehörten. Noch 1900
vertrat eine Gruppe führender britischer Biologen und Taxopomen, unter ihnen Ray Lankester, W. F. R.
Weldon, William Bateson und A.R.Wallace, einstimmig eine rein morphologische Artdefinition (Cock,
1977). Die Definition von Wallace, „eine Art ist eine Gruppe von Individuen, die innerhalb bestimmter
Variationsgrenzen ihnen gleiche Nachkommen erzeugen und die mit den ihnen am nächsten verwandten
Arten nicht durch kaum merkbare Variationen verbunden sind", würde jede isolierte geographische Rasse
in den Rang getrennter Arten erheben. Wann immer man auf Variation stieß, wandte man Rays Rezept an,
d. h. man betrachtete das als konspezifisch, was auch in der Naphkommenschaft eines einzigen
Elternpaares vorkommen kann. Nicht nur wurde dieser Artbegriff von der Mehrheit der Taxonomen
angenommen, er herrschte auch bei den experimentell arbeitenden Biologen vor. De Vries' Arten der
Oenothera gründeten sich auf eine derartige morphologische Definition, und noch vor relativ kurzer Zeit
(1957) weigerte sich Sonneborn, die „Varietäten" von Paramecium als Arten zu bezeichnen, obwohl es
aufgrund ihrer biologischen Merkmale und ihres Fortpflanzungsverhaltens mehr als deutlich war, daß sie in
Wirklichkeit getrennte Arten waren; Sonneborn gab das schließlich selbst zu [12].
Dem morphologischen Artbegriff weit überlegen war ein anderes Konzept, das sich überall in den
Schriften der mit Feldforschung befaßten Naturforscher fand. Autoren wie F.A.Pernau (1660-1731) und
Johann Heinrich Zorn (1698-1748) studierten jeden einzelnen Aspekt der Biologie der Vögel in ihrer
Umgebung und hegten niemals Zweifel daran, daß sie alle gut abgegrenzten Arten angehören, die von allen
anderen durch biologische Merkmale (Gesang, Nest, Vogelzugmuster etc.) und Fortpflanzungsisolation
getrennt sind. Zorn stand, wie Ray, auf dem Boden der Tradition der Naturtheologie, und in den
darauffolgenden 150 Jahren wurde die glänzendste Arbeit über Arten in der Natur von Naturtheologen
geleistet. Tatsächlich waren die hervorragendsten Vogelforscher während dieser Zeit, Gilbert White, C. L.
Brehm und Bernard Altum Pfarrer oder Prediger (Stresemann, 1975). Auch bei der Erforschung der
Insektenarten in der Natur lagen die Naturtheologen, zum Beispiel William Kirby, vorn. Diese Tradition
der mit Feldbeobachtungen arbeitenden Naturforscher führte später, als sie Selbstbewußtsein und
Wissenschaftlichkeit erlangt hatte, zur Entwicklung des biologischen Artbegriffs.
Das alte Artkonzept, das auf der metaphysischen Vorstellung einer Essenz beruhte, ist derart
grundsätzlich verschieden von dem biologischen Begriff einer fortpflanzungsmäßig isolierten Population,
daß ein allmählicher Übergang vom einen zum anderen unmöglich war. Eine bewußte Ablehnung des
essentialistischen Begriffs war notwendig. Erleichtert wurde dies dadurch, daß man klar eine Reihe von
Schwierigkeiten erkannte, mit denen sich die Erforscher der Arten konfrontiert sahen, wenn sie das
Kriterium des „Unterschiedsgrades" anzuwenden suchten (Mayr, 1969, S. 24-25). Die erste Bestand darin,
daß sich keine Beweise für die Existenz einer für die scharf umrissenen Diskontinuitäten in der Natur
verantwortlichen grundlegenden Essenz oder „Form" finden ließen. Mit anderen Worten: es gibt keine
Möglichkeit, die Essenz einer Art zu bestimmen, und daher ist es auch nicht möglich, die Essenz in
Zweifelsfällen als Maßstab zu benutzen. Die zweite Schwierigkeit ergab sich aus dem auffälligen
Polymorphismus, d. h. dem Auftreten auffallend verschiedener Individuen in der Natur, für die jedoch
aufgrund ihrer Fortpflanzungsgewohnheiten oder Lebensgeschichten nichtsdestoweniger nachgewiesen
werden konnte, daß sie einer einzigen Fortpflanzungsgemeinschaft angehörten. Die dritte Schwierigkeit
war die Umkehrung der zweiten, d. h. das Vorkommen in der Natur von „Formen", die sich in ihrer
Biologie (Verhalten, Ökologie) deutlich unterscheiden und fortpflanzungsmäßig voneinander getrennt sind,
sich jedoch morphologisch nicht unterscheiden ließen (Zwillingsarten, sibling species, siehe unten).
Viele historische Diskussionen über den Artbegriff beeindrucken bei näherer Betrachtung dadurch, daß
einige frühere Autoren einem biologischen Artbegriff geradezu quälend nahe gekommen waren. Einem
modernen Biologen würde es scheinen, als sei es nur ein winziger Schritt von Rays veränderter
essentialistischer Definition, „eine Art ist eine Ansammlung aller Varianten, die möglicherweise die
Nachkommenschaft derselben Eltern sind", bis zu einer Artdefinition, die allein auf der Vorstellung der
Fortpflanzungsgemeinschaft aufbaut. Sogar noch näher kam Buffons Definition, „eine Art ist eine
konstante Abfolge ähnlicher Individuen, die sich miteinander fortpflanzen können" und deren Bastarde
steril sind. Doch für Buffon waren die Arten in ihrer Essenz immer noch konstant. Girtanner (Sloan, 1978)
und Illiger (Mayr, 1968) kamen in einigen ihrer Aussagen gleichfalls einer Darstellung der biologischen
Art sehr nahe, waren aber unfähig, sich von dem essentialistischen Denkkorsett zu befreien. Das gleiche
gilt für viele andere Autoren des 19. Jahrhunderts. Keiner machte den scheinbar kleinen Schritt, die Art im
Sinne einer fortpflanzungsrnäßig isolierten Ansammlung von Populationen zu definieren. Warum dauerte
dies derart lange?
Der biologische Artbegriff hat drei Aspekte, die die Übernahme neuer Vorstellungen notwendig
machten. Als erstes mußten Arten nicht als Typen, sondern als Populationen (oder Populationsgruppen)
gesehen werden; diese Komponente setzte den Umschwung vom Essentialismus zum Populationsdenken
voraus. Als zweites ist die Art nicht im Sinne des Unterschiedsgrades, sondern aufgrund ihrer Getrenntheit
zu definieren, d. h. aufgrund der Reproduktionslücke. Und drittens sind die Arten nicht aufgrund von ihnen
innewohnenden Eigenschaften, sondern im Verhältnis zu anderen neben ihnen bestehenden Arten zu
definieren, wobei dieses Verhältnis sowohl ethologisch (sich nicht miteinander kreuzend) als auch
ökologisch (nicht vernichtend miteinander konkurrierend) ausgedrückt wird. Übernimmt man diese drei
Begriffsänderungen, so wird offensichtlich, daß der Artbegriff nur in der nichtdimensionalen Situation
sinnvoll ist: multidimensionale Überlegungen sind bei der Abgrenzung von Arttaxa, nicht aber beim
Entwickeln des begrifflichen Maßstabes wichtig. Ebenso wird deutlich, daß der Begriff nicht deshalb
biologisch genannt wird, weil er sich mit biologischen Taxa befaßt, sondern weil die Definition biologisch
und auf Arten von unbelebten Gegenständen unanwendbar ist. Schließlich zeigt sich, daß man nicht
Fragen, die mit dem Arttaxon zu tun haben, mit Fragen verwechseln darf, die das Konzept der Artkategorie
betreffen.
Erst in den vierziger und fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts war man so weit, daß diese
Charakteristika der biologischen Art klar ausgesprochen und explizite analysiert werden konnten [13].
Allerdings hatte schon eine Reihe von Pionieren die wesentlichen Punkte verstanden. Als erste Autoren
hatten bereits die beiden Entomologen K.Jordan (1896; 1905) und Poulton (1903; s. Mayr, 1955) die
biologische Art deutlich beschrieben und definiert. Poulton definierte die Art „als eine sich miteinander
fortpflanzende Gemeinschaft, als syngamisch" und Jordan stellte fest: „Blutsverwandte Individuen bilden
eine faunistische Einheit in einem Gebiete… Die Einheiten, aus welchen die Fauna eines Gebiets besteht,
sind durch Lücken voneinander geschieden, die hier durch nichts überbrückt werden" (1905, S. 157).
Die Eigenschaften der biologischen Art
Führende Ornithologen wie Stresemann und Rensch wandten in den zwanziger und dreißiger Jahren
dieses Jahrhunderts durchweg den biologischen Artbegriff an. 1919 (S.64) hob Stresemann hervor, daß
nicht das Maß von Unterschieden für die Art bezeichnend sei, sondern „daß sich die [im Verlauf der
geographischen Isolation] zum Rang von Spezies erhobenen Formen physiologisch so weit voneinander
entfernt haben, daß sie, wie die Natur beweist, wieder zusammenkommen können, ohne eine Vermischung
einzugehen." Dobzhanskys Definition der Arten als Formen, „die sich aus physiologischen Ursachen nicht
untereinander fortpflanzen können" (1937, S.312; zit. nach der dt. Ausgabe 1939, S.221), ist praktisch
dasselbe. Die Geschichte der zahlreichen Versuche, zu einer zufriedenstellenden biologischen Definition
der Art zu kommen, ist wiederholt erzählt worden (z.B. Mayr, 1957; 1963). Mayrs Definition aus dem
Jahre 1942, „Arten sind Gruppen von natürlichen Populationen, die sich tatsächlich oder potentiell
untereinander vermehren und fortpflanzungsmäßig von anderen derartigen Gruppen getrennt sind" (S. 120)
besaß noch einige Schwächen. Die Unterscheidung von „tatsächlich oder potentiell" ist unnötig, da
„fortpflanzungsmäßig isoliert" sich auf den Besitz von Isolationsmechanismen bezieht, und es für den
Artstatus irrelevant ist, ob sie irgendwann erprobt werden oder nicht. Eine ausführlichere Definition lautet:
Eine Art ist eine Fortpflanzungsgemeinschaft von (fortpflanzungsmäßig von anderen isolierten)
Populationen, die eine spezifische Nische in der Natur einnimmt.
Diese Definition lehrt nicht, wie man Arttaxa abzugrenzen habe. Sie ermöglicht aber, Taxa auf ihren
kategorischen Rang hin zu überprüfen. Im Gegensatz dazu ist der Grad morphologischen Andersseins kein
geeignetes Kriterium, wie Zwillingsarten und ins Auge fallende Morphen zur Genüge beweisen. Der
biologische Artbegriff, der ein Verhältnis zwischen Populationen ausdrückt, ist nur in der
nichtdimensionalen Situation sinnvoll und wirklich anwendbar. Man kann ihn nur durch Folgern auf
multidimensionale Situationen ausdehnen.
Die Worte „fortpflanzungsmäßig isoliert" sind die Schlüsselworte der biologischen Artdefinition. Sie
werfen sofort die Frage nach der Ursache dieser Isolation auf, ein Problem, das durch den Begriff der
Isolationsmechanismen gelöst wurde. Die ersten, noch unfertigen Anfänge dieses Begriffs reichen bis zu
Buffons Sterilitätskriterium zurück, das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bei den Botanikern beliebt war.
Zoologen, insbesondere Ornithologen und Schmetterlingsforscher, beobachteten jedoch, daß die
Sterilitätsschranke bei den Tieren in der Natur selten getestet und die Zugehörigkeit zur selben
Art gewöhnlich durch Kompatibilität des Verhaltens bestimmt wird. Im Laufe der Zeit entdeckte man
immer mehr Mechanismen, die die Arten daran hindern, sich untereinander zu vermischen, zum Beispiel
Unterschiede in der Brut- oder Blütezeit wie auch die Besetzung verschiedener Habitats. Der schwedische
Botaniker Du Rietz (1930) war anscheinend der erste, der eine detaillierte Liste und Klassifikation
derartiger Schranken für die Kreuzung von Arten vorlegte. Die Erforschung dieser Schranken war deutlich
dadurch beeinträchtigt, daß ein technischer Ausdruck fehlte. Dobzhansky prägte den Ausdruck
„Isolationsmechanismus" für „jeden Faktor, der die Kreuzung von Individuengruppen verhindert… Die
Isolationsmechanismen zerfallen in zwei große Gruppen: in die geographischen und die physiologischen"
(1937, S.230). Zwar erkannte Dobzhansky, daß „geographische Isolation auf einer ganz anderen Ebene als
jegliche Art physiologischer Isolation liegt" (S. 164), doch erkannte er noch nicht, daß nur die letztere eine
echte Eigenschaft einer Art ist. Erst Mayr beschränkte den Ausdruck „Isolationsmechanismen" auf
biologische Eigenschaften von Arten und schloß geographische Schranken ausdrücklich aus (1942, S. 247).
Dabei blieb jedoch immer noch eine Schwierigkeit bestehen, ist es doch in einer ansonsten guten Art
gelegentlich möglich, daß ein Individuum hybridisiert. Mit anderen Worten: die Isolationsmechanismen
können lediglich die Reinheit von Populationen sichern, nicht aber die jedes einzelnen Individuums. Daher
verbesserte Mayr die Definition: „Isolationsmechanismen sind biologische Eigenschaften von Individuen,
die das erfolgreiche Fortpflanzen von solchen Populationen untereinander verhindern, die tatsächlich oder
potentiell sympatrisch sind" (1963, S.91). In den letzten vierzig Jahren ist das Studium der
Isolationsmechanismen eines der aktivsten Gebiete der Biologie geworden [14].
Die Fortpflanzungsisolation ist jedoch nur eins der zwei Hauptmerkmale der Art. Schon die frühesten
Naturforscher hatten beobachtet, daß die Arten auf bestimmte Lebensräume beschränkt sind, und daß jede
Art in eine bestimmte Nische hineinpaßt. Diese Gedanken fallen in den Schriften Buffons ins Auge und
ebenso bei allen Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts, die von der göttlichen Ordnung der Natur sprachen.
Darwin war davon überzeugt, daß die geographische Verbreitung einer Art weitgehend durch die
Artgrenzen ihrer Konkurrenten bestimmt sei [15]. Doch bei der Entwicklung des modernen Artbegriffs lag
das Schwergewicht zuerst fast ausschließlich auf der Fortpflanzungsisolation. Mehr als jedem anderen
kommt David Lack (1944; 1949) das Verdienst zu, das Interesse an der ökologischen Bedeutung der Arten
wieder geweckt zu haben. Ein Vergleich seiner evolutionären Deutung der Schnabelgröße bei den
verschiedenen Arten von Galápagosfinken ist historisch interessant. In einer früheren Arbeit (1945,
tatsächlich jedoch vor 1940 geschrieben) hatte er die Schnabelgröße als ein Arterkennungssignal
interpretiert, somit also als einen Isolationsmechanismus, während er sie in seinem späteren Buch (1947)
als Anpassung an eine artspezifische Nahrungsnische deutete, eine Interpretation, die seitdem immer
wieder bestätigt worden ist.
Es ist heute völlig deutlich, daß der Artbildungsprozeß nicht mit dem Erwerb von
Isolationsmechanismen abgeschlossen ist, sondern auch den Erwerb von Anpassungen erfordert, die es der
neuen Form gestatten, neben potentiellen Konkurrenten zu existieren. Wie schwierig es für eine Art ist, in
das Verbreitungsgebiet eines potentiellen Konkurrenten einzudringen, ist durch die große Häufigkeit
parapatrischer Verbreitungsmuster eng verwandter Arten belegt. (Populationen oder Arten sind
parapatrisch, wenn sie zwar geographisch miteinander in Berührung kommen, sich aber nicht
überschneiden und selten oder niemals miteinander fortpflanzen). In derartigen Fällen ist die eine Art an
einer Seite der Trennungslinie überlegen, die andere auf der anderen Seite. Parapatrie kann auch durch
Kreuzsterilität verursacht sein, wenn vor der Paarung eingreifende Isolationsmechanismen fehlen.
Van Valen (1976, S. 233) unternahm den Versuch, eine Artdefinition auf der Grundlage der
Nischenbesetzung zu formulieren: „Eine Art ist… eine phyletische Linie… die eine adaptive Zone besetzt,
welche von der jeder anderen phyletischen Linie in ihrem Verbreitungsgebiet minimal verschieden ist".
Hier spiegelt sich das Prinzip der kompetitiven Exklusion wider; als Artdefinition ist das jedoch nicht sehr
praktisch, da es, wie ein großer Teil der ökologischen Forschung zeigt, häufig außerordentlich schwer ist,
den „minimalen" Nischenunterschied zwischen zwei Arten zu entdecken. Außerdem besetzen viele Arten
(beispielsweise Raupe-Schmetterling) in verschiedenen Phasen ihrer Lebenszyklen und in
unterschiedlichen Teilen ihres Verbreitungsgebietes sehr verschiedene Nischen. Ist deren jede deshalb eine
andere Entwicklungslinie und Art? Solche Fälle zeigen in anschaulicher Weise, daß die
Fortpflanzungsgemeinschaft der reale Kern des Artbegriffs ist. Wie Lack (1947), Dobzhansky (1951),
Mayr (1963, S. 66-88) und andere gezeigt haben, sind Nischenbesetzung und Fortpflanzungsisolation in
Wirklichkeit zwei Aspekte der Art, die sich nicht gegenseitig ausschließen (es sei denn, bei parapatrischen
Arten). Ja, die wichtigste biologische Bedeutung der Fortpflanzungsisolation besteht darin, daß sie einen an
eine spezifische Nische angepaßten Genotyp schützt. Fortpflanzungsisolation und Nischenspezialisierung
(kompetitiv, exklusiv) sind somit lediglich zwei Seiten derselben Medaille. Nur wenn das Kriterium der
Fortpflanzungsisolation versagt, wie im Fall asexueller Klone, bedient man sich des Kriteriums der
Nischenbesetzung (Mayr, 1969, S.31).
Die neue Systematik
Der essentialistische Artbegriff wurde außerordentlich langsam durch die Vorstellung der biologischen
Art im Sinne des Populationsdenkens ersetzt. Voraussetzungen dafür waren die Entwicklung der Theorie
polytypischer Arttaxa, eine Verfeinerung der Terminologie der infraspezifischen Kategorien und – am
wichtigsten – eine wachsende Einsicht in die unendliche Variabilität natürlicher Populationen. Taxonomen,
Biometriker, Populationsgenetiker und in jüngster Zeit auch Biochemiker (durch die Enzymanalyse) trugen
dazu bei, daß der typologische Artbegriff immer mehr verblaßte. Experimentalphysiologen und
Embryologen waren vielleicht die letzten, die zum Populationsdenken bekehrt wurden. Die mit der neuen
Technik der Enzym-Elektrophorese gewonnenen Erkenntnisse sind mit dafür verantwortlich, daß auch sie
langsam überzeugt wurden.
Die Anwendung des auf dem Populationsdenken aufbauenden Artkonzepts auf die verschiedenen Tierund Pflanzengruppen verbreitete sich mit höchst ungleicher Geschwindigkeit. Wo die Arten leicht in der
Natur studiert werden können, war die Bekehrung zum biologischen Artbegriff praktisch schon vor mehr
als dreißig Jahren abgeschlossen. Wo lediglich konserviertes Material erforscht wird, wie bei vielen
Insekten und anderen Wirbellosengruppen, ist der vorherrschende Artbegriff selbst heute noch recht
typologisch.
Besonders einsichtige Erforscher von Vögeln, Säugetieren, Fischen, Schlangen und Schmetterlingen
kamen unabhängig voneinander zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Doch diese fortschrittlich denkenden
führenden Systematiker waren bis zu den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts noch in der Minderheit.
Die Mehrheit der Taxonomen befaßte sich nicht sehr viel anders mit Arten und deren Variation als
Linnaeus fast zweihundert Jahre vorher. Um 1940 jedoch zeichnete sich die neue Bewegung bereits
deutlich genug ab, so daß ein Nicht-Taxonom, Julian Huxley, sie in einem Buch gleichen Titels als Die
neue Systematik bezeichnete, obwohl kurioserweise wenig neue Systematik in jenem Band zu finden ist.
Was war aber dann die neue Systematik? Es war nicht eine spezifische Technik; vielleicht beschreibt
man sie am besten als einen Standpunkt, eine Geisteshaltung oder eine allgemeine Philosophie. Sie begann
in erster Linie als Auflehnung gegen die nominalistischtypologische und ganz und gar unbiologische
Einstellung gewisser (leider allzu vieler) Taxonomen der vorausgegangenen Epoche. Der Vertreter der
neuen Systematik weiß zu würdigen, daß alle Lebewesen in der Natur Angehörige von Populationen sind.
Er studiert nicht die statischen Merkmale toter Exemplare, sondern die biologischen Eigenschaften von
Lebewesen. Er benutzt die größtmögliche Zahl von Merkmalen, physiologische, biochemische und
Verhaltsmerkmale, sowie morphologische Eigenschaften. Er verwendet neue Techniken nicht nur zur
Messung von Exemplaren, sondern auch zur Aufzeichnung ihrer Lautäußerungen, zur Durchführung
chemischer Analysen und für statistische und Korrelationsrechnungen. Die ersten, die die Gedanken der
neuen Systematik in der Zoologie systematisch abhandelten, waren Rensch (1929; 1933; 1934) und Mayr
(1942).
In der Botanik war die Situation komplizierter. Hier war eine enorme Kluft entstanden zwischen den
Herbarien-Taxonomen einerseits, die weiterhin die Linnaeische Tradition pflegten, und den Feldforschern
und experimentellen Naturforschern andererseits, die mit der typologischmorphologischen Methode der
Herbariumsforscher zunehmend unzufrieden waren, zumal die Bemühungen einiger schöpferischer
Pioniere keinen dauernden Einfluß gehabt zu haben schienen [16]. Der schwedische Pflanzenökologe
Turesson (1922) rebellierte schließlich gegen diese Tradition; er behauptete, die herkömmliche
Terminologie von Art und Varietät sei gänzlich ungeeignet, die Dynamik der Variation in natürlichen
Populationen zu beschreiben. Um dieser Situation abzuhelfen, führte Turesson die neuen Ausdrücke ein:
Ökospezies für die „Linnaeische Art vom ökologischen Standpunkt aus gesehen" und Ökotypus für „das
Produkt, das als Resultat der genotypischen Reaktion einer Ökospezies auf ein spezielles Habitat entsteht".
Mehr als das – er behauptete, das Studium der genetischen und ökologischen Variation natürlicher
Populationen habe nichts mit Taxonomie zu tun und solle zum Forschungsgegenstand einer separaten
biologischen Wissenschaft, der Genökologie (von anderen auch als Biosystematik bezeichnet) gemacht
werden.
Turesson selbst war in seinem Denken reichlich typologisch. Aus seinen Schriften gewinnt man den
Eindruck, daß er die Pflanzenarten eher als ein Mosaik von Ökotypen, statt als eine Ansammlung variabler
Populationen ansah. In gewissem Maße findet sich dieselbe Tendenz zum typologischen Denken auch in
den Schriften anderer skandinavischer Autoren. Nichtsdestoweniger hatten Turessons revolutionäre
Begriffe und seine experimentelle Analyse von Exemplaren wildwachsender Pflanzenpopulationen eine
Auswirkung auf die Pflanzentaxonomie, wie sie kaum hätte größer sein können. Dies regte zu zahlreichen
Studien über die adaptiven Merkmale lokaler Populationen an, die das Verständnis der Populationsstruktur
von Pflanzenarten und ihrer Reaktionsfähigkeit auf lokale Selektionsdrucke einen großen Schritt
weiterbrachte. Es war eine befreiende Rebellion gegen die Linnaeische Tradition in den Herbarien mit
ihrem Gebunden sein an Identifikation und typologisches Denken. Turessons Ruf nach einer neuen Botanik
– ob man sie nun Genökologie oder Biosystematik nennen wollte – wurde von Anderson, Turrill, Stebbins,
Epling, Camp, Gregor, Fassett und anderen Erforschern von Pflanzenpopulationen aufgenommen [17].
Die Botaniker waren den Zoologen in zweierlei Beziehung deutlich voraus. Sie führten experimentelle
Methoden ein und wandten diese in weit umfassenderem Maße an; dabei kam ihnen die Tatsache zugute,
daß es in den meisten Fällen weitaus leichter ist, Pflanzen umzupflanzen und zu kultivieren oder auch
künstlich zu züchten, als Tiere zu züchten. Die Botaniker wandten auch früher und intensiver
Chromosomenuntersuchungen an; zum Teil sahen sie sich durch die Häufigkeit der Polyploidie bei
Pflanzen dazu gezwungen. Andererseits blieb die Pflanzentaxonomie in bezug auf die Einführung
polytypischer Arten weit zurück, und auch die Resultate der Chromosomenuntersuchungen wurden häufig
streng typologisch interpretiert. Einige Jahrzehnte lang sah es so aus, als bestünde ein vollständiger Bruch
zwischen der Linnaeischen Tradition der Herbarien und dem experimentellen Ansatz der
Populationsbotaniker. Doch mit der Zeit nahm sich das derart in die Botanik eingeführte neue Gedankengut
auch der Herbarien an, und die Kluft, die im Jahre 1922 bestanden hatte, wurde zunehmend schmaler und
verschwand schließlich ganz. Die Mehrheit der Herbarien verfügt heute über Einrichtungen zur
Pflanzenzüchtung, und ergänzt darüber hinaus das Verständnis der Variation natürlicher Arten durch das
Studium genetischer und karyologischer Variation sowie auch gelegentlich der Variation von Enzymen und
anderen Molekülen (Mayr, 1963, S.351-354; Ehrendorfer, 1970; Grant, 1971; Solbrig, 1979; 1980).
Bei einem Überblick über den Artbegriff in der Botanik muß man erkennen, daß die Arten bei vielen
Pflanzengruppen ein weit komplexeres Phänomen sind als bei den meisten Tiergruppen, insbesondere den
Vögeln. Nicht nur die Tatsache, daß sich die Pflanzenindividuen nicht fortbewegen, was das Entstehen von
Ökotypen fördert, kompliziert die Situation, sondern auch das weitverbreitete Auftreten von Polyploidie,
Hybridisierung und mehreren Formen von Asexualität und Selbstbefruchtung. Manche Botaniker haben,
nicht unberechtigt, die Frage aufgeworfen, ob das breite Spektrum von Fortpflanzungssystemen, das man
bei den Pflanzen vorfindet, tatsächlich völlig unter dem einzelnen Begriff (und Terminus) „Art"
zusammengefaßt werden kann. Neben dem Ausdruck „Ökospezies" führte Turesson auch noch den
Ausdruck „Coenospezies" für die Gesamtheit von Populationen (und Arten) ein, die auf dem Wege der
Hybridisierung untereinander Gene austauschen können. Das ehrgeizigste System für die terminologische
Unterscheidung von verschiedenen Fortpflanzungssystemen bei den Pflanzen wurde von Camp und Gilly
(1943) vorgeschlagen, die mit Hilfe spezieller technischer Namen zwischen zwölf verschiedenen Sorten
von Arten unterscheiden. Allerdings überschneiden sich die benutzten Kriterien so sehr, und die
Korrelation zwischen genetischen Mechanismen und sichtbarer morphologischer Variation ist so gering,
daß dies komplizierte System von keinem anderen Autor übernommen wurde. Doch fällt es angesichts der
Vielfalt der Fortpflanzungssysteme bei den Pflanzen vielleicht leichter, zu erklären, warum es unter den
Botanikern so viel Widerstand gegen die Übernahme des biologischen Artkonzepts gegeben hat.
An Versuchen, verschiedene Sorten von Arten anzuerkennen, hat es auch in der Zoologie keineswegs
völlig gefehlt. Bestimmte Autoren (etwa Cain, 1954) haben zwischen Morphospezies, Biospezies,
Paläospezies, Ökospezies, Ethospezies und so weiter zu unterscheiden versucht, aber man hat nicht den
Eindruck, als hätten diese terminologischen Bemühungen zu irgendwelchen neuen Einsichten geführt. Der
Ausdruck, der möglicherweise am meisten gerechtfertigt ist, ist das Wort „Agamospezies" für Arten von
Organismen, die sich ungeschlechtlich reproduzieren (siehe unten).
Die Gültigkeit des biologischen Artbegriffs
Der biologische Artbegriff ist nicht unangefochten geblieben. Die ersten Angriffe, aus den zwanziger bis
vierziger Jahren dieses Jahrhunderts, bezweifelten in erster Linie seine praktische Anwendbarkeit: „Wie
kann ein Paläontologe die Fortpflanzungsisolation von Fossilien testen?" oder: „Die Exemplare, die ich in
meinen Sammlungen einordne, sind getrennte und deutlich verschiedene Typen und werden am besten als
Arten bezeichnet". Diese Gegner stellten keine Fragen nach der biologischen Bedeutung, sondern lediglich
solche, die mit der administrativen, museumstechnischen Bequemlichkeit zu tun hatten. Die Vertreter des
biologischen Artbegriffs hatten relativ geringe Schwierigkeiten, zu beweisen, daß die Gegner Arttaxon und
Artkategorie miteinander verwechselten, daß sie den Unterschied zwischen Beweis und abgeleitetem
Schluß nicht kannten (wie Simpson sehr scharfsinnig gezeigt hat), und daß ein Zurückgehen auf den
morphologischen Artbegriff den Taxonomen wieder den ganzen Weg zurückwirft bis zu dem Punkt, wo er
willkürlich darüber entscheiden muß, wie verschieden eine Population zu sein hat, um den Artstatus zu
verdienen.
Eine weitere Reihe kritischer Einwände, die zu jener Zeit erhoben wurden (ebenfalls weitgehend
aufgrund der Verwechslung von Arttaxon und Artkategorie), ging von dem Wunsch aus, die Art
„quantitativ" oder „experimentell" zu definieren. Da sich der biologische Artbegriff weder auf quantitative
noch auf experimentelle Kriterien gründet, so hieß es, muß er abgelehnt werden. Diese Ablehnung geht von
dem irrigen Anspruch aus, die Methoden und Theorien der exakten Wissenschaften seien ohne Anpassung
auf die Evolutionsbiologie anwendbar. Jeder Naturforscher kann die genetisch programmierten
fortpflanzungsmäßigen und ökologischen Diskontinuitäten beobachten, die in der Natur bestehen, ohne
dazu einer komplizierten Computeranalyse zu bedürfen.
In der Zeit zwischen den fünfziger und siebziger Jahren unseres Jahrhunderts traten neue Argumente
gegen den biologischen Artbegriff in den Vordergrund. Mehrere Autoren behaupteten, sie seien bei den
speziellen, von ihnen studierten Organismen nicht in der Lage, die deutlichen Lücken zwischen
sympatrischen Populationen zu entdecken, wie sie von den Anhängern des biologischen Artbegriffs
beschrieben würden. Mit anderen Worten: man behauptete, es gäbe keine gültige Beobachtungsbasis für
den biologischen Artbegriff, und die biologische Art sei eine spezielle Situation, die bei ein paar Gruppen
vorhanden sei und nicht auf alle Organismen ausgedehnt und verallgemeinert werden könne. Um der
Formenvielfalt der Natur gerecht zu werden, müsse man daher entweder ein anderes, umfassenderes
Artkonzept anwenden oder andernfalls für die verschiedenen Organismentypen mehrere Artkonzepte
übernehmen.
Diese Einwände sind ernstzunehmen und besitzen eine gewisse Gültigkeit. Das wirft die Frage auf, ob es
sich bei den Fällen, die nicht zu passen scheinen, um Ausnahmen handelt oder ob vielleicht umgekehrt der
biologische Artbegriff auf einer Ausnahmesituation beruht? Gelegentlich wird behauptet, der biologische
Artbegriff sei von Ornithologen „erfunden" worden und gelte nur für Vögel. Diese Behauptung wird
jedoch durch die historischen Fakten widerlegt. Gewiß trug eine Reihe von Ornithologen (Hartert,
Stresemann, Rensch, Mayr) sehr aktiv dazu bei, den Begriff zu verbreiten, doch waren Poulton und
K.Jordan, die zwei großen Pioniere des Begriffs, Entomologen, und die Drosophila-Forscher von
Timofeeff-Ressovsky, Dobzhansky und J.T. Patterson bis zu Spieth und Carson waren unerschütterliche
Verfechter der biologischen Artvorstellung. Und so unorthodox einige Ideen von M.J.D. White über die
Speziation auch sein mögen, so bekräftigt er doch nachdrücklich seine Zustimmung zum Begriff der
biologischen Art, und zwar auf der Grundlage seiner gründlichen Kenntnis der Orthopteren und anderer
Insekten (White, 1978). Es kann also kein Zweifel daran bestehen, daß der Begriff keine
Ausnahmesituation bezeichnet.
Wie oft der biologische Artbegriff versagt, läßt sich nur mit Hilfe einer sorgfältigen statistischen
Analyse aller Arten eines höheren Taxon bestimmen. Der erste Autor, der eine derartige Analyse vornahm,
war Verne Grant (1957). Er griff elf kalifornische Pflanzengattungen heraus und bestimmte den
Prozentsatz sogenannter „guter" Arten, d.h. gut abgegrenzter Arten, die weder mit anderen Arten
verwechselt werden, noch sich mit anderen fortpflanzen können. Im Gegensatz zu der Situation bei den
Vögeln waren weniger als die Hälfte der Arten „gut". Lediglich bei der Gattung Asclepias der
Schwalbenwurzgewächse waren alle 108 Arten „gut". Bei einer Analyse aller nordamerikanischen
Vogelarten zeigten Mayr und Short (1970), daß 46 der 607 Arten stark diffenzierte, peripher isolierte
Populationen besaßen, die von einigen Ornithologen als vollwertige Arten, von anderen als Unterarten
betrachtet wurden. Nur in etwa vier anderen Fällen traten Fragen hinsichtlich des Artstatus auf. Der
biologische Artbegriff erwies sich als eine große Hilfe bei der Entscheidung über den Artstatus bei
Geschwisterarten, polymorphen Arten und in Fällen der Hybridisierung. Nur in einem einzigen Fall (zwei
Arten der Gattung Pipilo) versagte der Begriff restlos. Bei Drosophila, wo die Arten im großen und ganzen
sehr orthodox sind, stieß man auf ein paar Situationen (beispielsweise bei dem südamerikanischen
D.willistoni-Komplex), die eine ziemliche Ausnahme darstellen. Erst nach gründlichen quantitativen
Analysen solcher Taxa, wie sie oben beschrieben sind, läßt sich ein Urteil darüber fällen, ob die häufig
vorgebrachte Behauptung Gültigkeit hat, daß der biologische Artbegriff auf gewisse höhere Tier- oder
Pflanzentaxa nicht angewandt werden könne.
Im folgenden werden die biologischen Faktoren genannt, die dem biologischen Artkonzept die größten
Schwierigkeiten bereiten.
Morphologische Ähnlichkeit (oder Identität)
Als der biologische Begriff eingeführt wurde, war der morphologische Artbegriff derart stark im
Gedankengut der Biologen verwurzelt, daß viele sich scheuten, morphologisch identische Populationen als
Zwillingsarten (sibling species) anzuerkennen, wenn sie fortpflanzungsmäßig isoliert waren. Die
Unterscheidung zwischen drei Arten von Laubsängern (Phylloscopus) durch Gilbert White im Jahre 1768
sowie die Differenzierung, die C. L.Brehm in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts zwischen zwei
Arten von Baumläufern (Certhia) und zwischen zwei Arten schwarzköpfiger Meisen (Parus) vornahm,
waren vielleicht die ersten Fälle einer Anerkennung von kryptischen oder Zwillingsarten, wie solch
außerordentlich ähnliche Arten seither genannt werden (Mayr, 1942; 1948; 1963). Bald wurden auch bei
den Insekten Zwillingsarten anerkannt (Walsh, 1864; 1865), obgleich die Mehrheit der Entomologen,
standhaft an einem morphologischen Artbegriff festhaltend, diese allgemein als „biologische Rassen"
bezeichnete (Thorpe, 1930; 1940). Erst in den dreißiger und vierziger Jahren unseres Jahrhunderts erkannte
man die ungeheure Bedeutung von Zwillingsarten in der Landwirtschaft sowie in der öffentlichen
Gesundheitspflege. Insbesondere ermöglichte die Entdeckung seitens mehrerer MalariamückenSpezialisten, daß die sogenannte Anopheles maculipennis tatsächlich ein Komplex von sechs
Zwillingsarten war, einen gewaltigen Fortschritt in der Malariabekämpfung. Doch der Widerstand seitens
sogar hervorragender Biologen gegen das Konzept morphologisch sehr ähnlicher Arten hielt bis in die
vierziger und fünfziger Jahre an. Als Dobzhansky und Epling (1944) die Drosophila persimilis
beschrieben, machte Sturtevant (1944) Einwände und nannte diese Art weiterhin D.pseudoobscura B.
Nachdem bereits mehr als deutlich erwiesen war, daß die sogenannten „Varietäten" von Paramecium
tatsächlich fortpflanzungsmäßig isolierte Arten waren, weigerte sich Sonneborn (1957) immer noch, dieses
Ergebnis zu akzeptieren und nannte sie Syngene. Erst 1975 gestand er ihnen schließlich den Artstatus zu.
Von den Protozoen bis zu den Säugetieren gibt es keine Tiergruppe, in der nicht in den letzten Jahren
zahlreiche Zwillingsarten beschrieben worden sind [18].
In drei Bereichen gibt es völlig legitime Einwände gegen die Anerkennung von Zwillingsarten: (1) bei
weitgehend merkmalslosen Protisten oder Prokaryonten, bei denen es sehr spezieller Techniken (etwa
Kerntransplantationen, biochemischer Analysen) bedarf, um die Artverschiedenheit festzustellen; (2) bei
Fossilien, wenn alles Beweismaterial fehlt, das nötig wäre, um zwischen Zwillingsarten unterscheiden zu
können; (3) bei Autopolyploiden unter Pflanzen, wo Individuen mit anderer Chromosomenzahl
fortpflanzungsmäßig isoliert, morphologisch aber nicht unterscheidbar sein können. Keine dieser
besonderen Situationen widerlegt den biologischen Artbegriff, obgleich der praktizierende Taxonom
gelegentlich dazu gezwungen sein mag, sich zur Abgrenzung von Arttaxa an morphologische Kriterien zu
halten und somit Zwillingsarten mit einem einzigen Binomen zu benennen.
Zwei verschiedene Auslegungen der Zwillingsarten wurden in den fünfziger und sechziger Jahren
diskutiert. Nach Mayr (1948; 1963) liefern Zwillingsarten den Beweis dafür, daß die Korrelation zwischen
der morphologischen Divergenz und dem Erwerb von Isolationsmechanismen nicht sehr stark ist.
Zwillingsarten sind biologische Arten, die zwar Fortpflanzungsisolation, aber noch keinen
morphologischen Unterschied erlangt haben. Wenn eine Gattung sowohl Zwillingsarten als auch
morphologisch abweichende Arten enthält, so sind die letzteren gewöhnlich genetisch stärker verschieden,
doch gilt eine derartige Relation nicht notwendig bei Vergleichen zwischen den Gattungen. Nach Ansicht
einer anderen Gruppe von Wissenschaftlern sind Zwillingsarten beginnende Arten, die ein bestimmtes
Stadium des Speziationsprozesses verkörpern. Inzwischen haben neuere Forschungen sehr überzeugend
gezeigt, daß von der Fortpflanzungsisolation her betrachtet kein Unterschied zwischen Zwillingsarten und
morphologisch abweichenden Arten besteht. Außerdem sind morphologisch verschiedene Arten, etwa
Drosophila silvestris und D. heteroneura auf Hawaii, gelegentlich genetisch weitaus ähnlicher als
Zwillingsarten. Es gibt heute keinen Zweifel mehr daran, daß Zwillingsarten keine beginnenden Arten sind.
Grenzfälle oder beginnende Arten
Da sich die meisten Arten aus geographisch isolierten Populationen entwickeln, sollte man erwarten, daß
ein gewisser Prozentsatz solch isolierter Populationen an der Grenze zwischen Unterart- und Artstatus
steht. Die Entscheidung, ob man solche Populationen Arten nennen soll oder nicht, ist notwendigerweise
etwas willkürlich. Doch muß man geradezu erwarten, daß derartige Grenzfälle auftreten, wenn man von
der Evolution überzeugt ist. Viele dieser Fälle sind für den morphologischen Artbegriff genauso
unbequem, da sie morphologisch gesehen ebenso dazwischenliegen wie in bezug auf die Fortpflanzung.
Zum Beispiel haben 46 der 607 nordamerikanischen Vogelarten Populationen, die zu der Klasse
beginnender Arten gehören.
Uniparentale Fortpflanzung (Asexualität)
Der biologische Artbegriff gründet sich auf die Fortpflanzungsisolation von Populationen. Er kann daher
nicht auf Gruppen von Tieren und Pflanzen angewandt werden, die die bisexuelle Fortpflanzung
aufgegeben haben. Für diese Organismen existiert die Population im herkömmlichen biologischen Sinne
nicht. In einer sich asexuell vermehrenden Axt ist jedes Individuum und jeder Klon fortpflanzungsmäßig
isoliert; es wäre absurd, jeden Klon eine getrennte Art zu nennen. Wie kann man dann aber solche
Individuen und Klone zu Arten zusammenfassen? Dies ist lange eine Quelle der Uneinigkeit unter den
Biologen gewesen. Welche Lösung auch immer man annimmt, sie ist bestenfalls ein Kompromiß. Eine
dieser Lösungen, die besser als jede andere auf die meisten Situationen zu passen scheint, beruht auf der
Einsicht, daß eine Art nicht nur durch fortpflanzungsmäßige Isolation, sondern auch durch eine
artspezifische ökologische Nische gekennzeichnet ist. Dieses zweite Artmerkmal kann gewöhnlich auf
asexuelle Organismen angewandt werden. Es ist also üblich, jeweils solche asexuellen Individuen und
Klone in einer Art zusammenzufassen, die dieselbe ökologische Nische ausfüllen oder dieselbe Rolle im
Ökosystem spielen. Die ökologische Landschaft ist in hohem Maße diversifiziert, und infolgedessen sind
ökologische Nischen diskontinuierlich; das gleiche gilt für die Bewohner solcher ökologischer Nischen.
Man kann diese Diskontinuität häufig zur Unterscheidung von Arttaxa bei sich uniparental fortpflanzenden
Organismen benutzen. In der Mehrheit der Fälle besteht eine Korrelation zwischen verschiedenen
Nischenbesetzungen und gewissen morphologischen, physiologischen oder biochemischen Unterschieden,
und man kann somit diese Sorten von Unterschieden dazu verwenden, auf ökologische Unterschiede zu
schließen. Gewöhnlich hat man es mit ganzen Anhäufungen von mehr oder weniger korrelierten
Unterschieden zu tun, und solche Anhäufungen werden als Arten bezeichnet (Stanier et al. 1970, S.525). Es
ist nicht so, wie man gelegentlich hört, daß Arten bei asexuellen Organismen morphologisch definiert sind,
vielmehr gestatten umgekehrt morphologische Unterschiede einen Schluß auf ihre Nischenbesetzung und
somit ihren Artstatus.
Es liegt auf der Hand, daß hinsichtlich des Artbegriffs bei sich uniparental fortpflanzenden Organismen,
insbesondere bei Prokaryonta, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Bei diesen Organismen stößt man
auf viele verwirrende Erscheinungen, für die bei den höheren Eukaryonten kein Gegenstück bekannt ist.
Dazu gehört auch, zum Beispiel, die extreme Konstanz von Blaualgenarten (Cyanophyceen) sowie das
Beweisma terial dafür, daß in bestimmten Bakteriengattungen Genaustausch häufig ist. Es bedarf einer sehr
viel umfassenderen Kenntnis der Tatsachen, bevor man darüber spekulieren kann, welcher Artbegriff für
diese Organismen am besten ist.
Undichte Isolationsmechanismen (Hybridisierung)
Bei beweglichen Tieren mit gut entwickelten, auf Verhalten beruhenden Isolationsmechanismen ist
Hybridisierung selten, bei den meisten Arten in der Tat eine Ausnahme. In einer Reihe von Fällen ist
jedoch ein völliges Versagen der Fortpflanzungsisolation in bestimmten Populationen sympatrischer
Tierarten beschrieben worden (Mayr, 1963, S. 114-125). Dennoch bedeutet dies weder bei den Vögeln
noch bei Drosophila eine ernsthafte Bedrohung des biologischen Artkonzepts. Die meisten Tiergruppen
sind noch nicht gut genug bekannt, als daß es möglich wäre, die Häufigkeit der Bastardierung festzustellen.
Aus der Literatur gewinnt man den Eindruck, daß sie bei den meisten Tiergruppen ebenso selten ist wie bei
Vögeln und Drosophila. Selbst da, wo Bastardierung häufiger vorkommt (wie bei Binnenwasserfischen),
führt dies nicht zu einem ernstlichen Zusammenbruch der Geschlossenheit der Art, da die Bastarde
gewöhnlich unfruchtbar sind. Natürlich bereitet die Hybridisierung dem morphologischen Artbegriff nicht
weniger große Schwierigkeiten als dem biologischen.
Bei den Pflanzen ist die Situation sicherlich anders. Edgar Anderson (1949) führte den nützlichen
Begriff der „Introgression" ein zur Bezeichnung der Eingliederung von Genen einer Art in den Genpool
einer anderen Art als Folge erfolgreicher Hybridisierung und Rückkreuzung. Die Botaniker sind sich darin
einig, daß ein solches Durchsickern von Genen einer Art in eine andere keineswegs selten ist, obgleich es
noch immer erhebliche Auseinandersetzungen darüber gibt, wie häufig dies nun wirklich ist (Grant, 1971,
S. 163-184). Gelegentlich führt dieses „Durchsickern" zu einem völligen Zusammenbruch der Artgrenze,
ähnlich etwa dem Zusammenbruch der Artgrenze zwischen den Vögeln Passer domesticus und P.
hispaniolensis oder Pipilo erythrophthalmus und P. ocai, weit häufiger aber bestehen die beiden
Elternarten ungeachtet der ständigen Ingression Seite an Seite weiter. Stebbins berichtet von einem Fall
zweier Arten von kalifornischen Eichen (Quercus), deren Bastarde vom Pliozän bis in die Gegenwart
bekannt sind, die aber beide dennoch im wesentlichen ihre Reinheit bewahrt haben. Weitere ähnliche Fälle,
insbesondere von Eichen, sind in der jüngeren botanischen Literatur beschrieben worden. Die Genetik
derartiger Situationen entzieht sich ganz unserer Kenntnis, denn es sieht so aus, als würde ein Teil des
Genotyps der beiden Arten von der Bastardierung nicht berührt. Die beiden Arten scheinen in einem
solchen Fall in dem Sinne „fortpflanzungsmäßig isoliert" zu bleiben, daß sie trotz des Durchsickerns
bestimmter Gene aus ihrem Genpool nicht zu einer einzigen Population verschmelzen. Ob in solchen
Fällen der Introgression der biologische Artbegriff aufgegeben werden muß oder nicht, ist noch immer
umstritten (van Valen, 1976). Ich selbst glaube es nicht. Die Einführung eines neuen Terminus für solche
Vorkommnisse mag dazu beitragen, auf ihre Existenz aufmerksam zu machen, hat jedoch keinen
erklärenden Wert. Möglicherweise gibt es jedoch Pflanzengattungen, die keine deutlich abgegrenzten
Arten besitzen (etwa Rubus, Crataegus oder Taraxacum).
Das sogenannte Artproblem in der Biologie läßt sich auf eine einfache Entscheidung zwischen zwei
Alternativen reduzieren: Sind die Arten nun Realitäten der Natur oder sind sie lediglich theoretische
Konstruktionen des menschlichen Geistes? Die Attacken gegen den Artbegriff veranlaßten Karl Jordan
(1905) zu einem geistreichen Ausbruch: Wohin auch immer er sich auf seinen Feldexkursionen wende, so
rief er aus, überall fände er gut definierte natürliche Diskontinuitäten, die alle nicht nur durch sichtbare
Merkmale gekennzeichnet seien., sondern auch durch ein breites Spektrum biologischer Merkmale
(Stimme, Saison, ökologische Präferenzen und so weiter). Für ihn als Entomologen waren die Arten ein
einfaches Faktum der Natur. Der Ornithologe empfindet genau das gleiche. Ja, es fällt ihm im Gegenteil
schwer zu verstehen, warum man sich überhaupt mit dem Artproblem abmüht.
Woher kommen dann aber die Angriffe auf den biologischen Artbegriff? Sie kommen entweder von
Mathematikern, wie Sokal, deren Bekanntschaft mit Arten in der Natur relativ begrenzt ist, oder von
Botanikern. Ich bin selbst kein Botaniker, doch habe ich seit meiner frühesten Kindheit Pflanzen
gesammelt und identifiziert, und zwar auf drei Kontinenten. Es ist richtig, daß es, wie oben erwähnt,
„unklare" Situationen gibt, aber ich bin weit stärker von der deutlichen Unterscheidbarkeit der meisten
Pflanzen„sorten" beeindruckt, die ich in der Natur vorfinde, als von den gelegentlichen Zweifelsfällen. Die
kurzsichtige und einseitige Beschäftigung mit „unklaren" Situationen hat viele Botaniker (allerdings
keineswegs alle und vielleicht noch nicht einmal die Mehrheit) daran gehindert zu erkennen, daß der
Begriff Art die Situation der natürlichen Vielgestaltigkeit der Pflanzen in den meisten Fällen recht
angemessen beschreibt [19]. Amüsanterweise scheinen einige jener Wissenschaftler, die sich am aktivsten
darum bemühen, den Artbegriff zu schmähen, sich völlig zu verwandeln, wenn sie taxonomische
Revisionen und Monographien schreiben, denn dann sind sie völlig konventionell – sie legen also die
gleiche begriffliche Inkonsequenz an den Tag wie Lamarck bei seiner Verwendung des nominalistischen
Artkonzepts.
Die Anwendung des biologischen Artbegriffs auf multidimensionale Arttaxa
Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts befreite sich die Art immer mehr von der Last, die das
essentialistische Dogma ihr aufgebürdet hatte und wurde allmählich zu der Beobachtungseinheit des
lokalen Naturforschers. Dieser wußte sehr genau, daß das, was er in dem von ihm erforschten Areal
vorfand, weder einfach ein beliebiger Haufen von Individuen war, wie die Nominalisten behaupteten, noch
die Ausdrucksform einer Essenz. Lokale Populationen besaßen eine Einheit, und diese Einheit wurde
dadurch bewahrt, daß sich die Individuen, aus denen diese Populationen bestanden, miteinander
fortpflanzten. Ein Naturforscher ließ sich selten längere Zeit von Unterschieden in Geschlecht und Alter
oder anderen Sorten individueller Variation verwirren. Arten, so wie er sie vorfand, waren „reale",
konstante und voneinander durch scharfe Lücken getrennte Objekte. Sie waren die „nichtdimensionalen"
Arten, wie sie John Ray und Gilbert White in England und Linnaeus in Schweden bekannt waren.
In einer Reihe von Analysen hat Mayr seit 1946 darauf hingewiesen, daß der Artbegriff nur dort seine
volle Bedeutung hat, wo verschiedenen Arten angehörige Populationen miteinander in Berührung kommen.
Dies geschieht in lokalen Situationen ohne die Dimensionen Raum (Geographie) und Zeit. In einer solchen
nichtdimensionalen Situation bezeichnet der Ausdruck „Art" eine Beziehung, wie das Wort „Bruder". Ein
Bruder zu sein ist nicht eine Eigenschaft, die einem Individuum innewohnt, denn es hängt einzig und allein
von der Existenz eines Geschwisters ab. Gleichermaßen ist eine Population nur im Verhältnis zu anderen
sympatrischen Populationen eine Art. Die Funktion des Artbegriffs besteht darin, den Status von
nebeneinander existierenden Individuen und Populationen festzulegen. Für den Ökologen und für den
Verhaltensforscher ist es von grundlegender Bedeutung zu wissen, ob solche Individuen derselben Art
angehören oder nicht. Diese Biologen haben es fast ausschließlich mit nichtdimensionalen Situationen zu
tun. Ob zwei Populationen, die weder im Raum noch in der Zeit miteinander in Berührung kommen, der
gleichen Art angehören oder nicht, ist in den meisten Fällen biologisch uninteressant, wenn nicht überhaupt
irrelevant.
Allerdings gibt es drei Gruppen von Biologen, die sich aufgrund ihres Forschungsgegenstandes
gezwungen sehen, über die nicht dimensionale Situation hinauszugehen: Es sind dies die Taxonomen, die
Paläontologen und die Evolutionisten. Sie kommen nicht umhin, Populationen in Kategorien einzustufen,
die einander in Raum und Zeit vertreten und sogenannte geographische oder zeitliche Variation aufweisen.
Wie werden diese Wissenschaftler mit den Problemen fertig, die die multidimensionalen Arten aufwerfen?
Variation in der Raum-Dimension
Beginnen wir mit dem Problem der geographischen Variation. Als man daran ging, Populationen
verschiedener Länder zu vergleichen und in die geeignete Kategorie einzuordnen, stieß man auf
Schwierigkeiten aller Art [20]. Anscheinend war es Buffon, der bei seinem Studium der Tiere
Nordamerikas als erster Forscher auf dieses Problem stieß. Er fand dort nicht nur Säugetiere vor, die
europäischen Arten sehr ähnlich waren, wie Biber, Elch und Rothirsch, sondern auch viele Vögel, die
anscheinend mit wohlbekannten europäischen Arten verwandt waren. Durch diese Beobachtungen
veranlaßt, bemerkte er:
Ohne die Ordnung der Natur ins Gegenteil zu verkehren, könnte es möglicherweise so sein, daß alle
Tiere der Neuen Welt grundlegend dieselben sind wie diejenigen der Alten Welt, von denen sie
abstammen. Man könnte weiterhin den Gedanken nahelegen, daß diese Tiere kleiner geworden sind,
sich in ihrer Form geändert haben usw., da sie von den restlichen Tieren durch ungeheure Ozeane und
unpassierbares Land getrennt gewesen sind und mit der Zeit all die Eindrücke erhalten und all die
Auswirkungen des Klimas erlitten haben, welches aus eben denselben Gründen, die die Trennung
verursacht haben, selbst anders geworden ist. Das sollte uns jedoch nicht daran hindern, sie heute als
Tiere verschiedener Arten zu betrachten (Oeuvres Phil, S.382).
Aus Gründen der Bequemlichkeit haben die meisten Autoren alle Vikarianten als Arten klassifiziert.
Einige Naturforscher zogen allerdings eine andere Lösung vor. Auf seinen Reisen nach Sibirien
entdeckte Pallas gleichfalls zahlreiche vikariierende Vertreter europäischer Arten. Solche fand er auch in
den Sammlungen anderer russischer Forscher, die Expeditionen ins östliche Asien unternommen hatten.
Obgleich er erkannte, daß es sich hier um neue Taxa handelte, stufte er sie gewöhnlich als „Varietäten" ein.
Diese beiden Lösungen des Problems der Einstufung geographischer Vertreter zuvor bekannter Arten
sollten während der nächsten 150 Jahre miteinander konkurrieren. Die Mehrheit der Taxonomen nannte
jede geographische Variante eine verschiedene Art, der Ornithologe Gloger (1833) empfahl jedoch, alle
derartigen geographischen Varianten als Rassen oder Varietäten zu behandeln; dabei hob er hervor, daß
viele, wenn nicht die meisten Vogelarten geographisch variieren.
Zwei Entwicklungen waren notwendig, um dieser Kontroverse ein Ende zu setzen. Erstens die
Ablehnung des Essentialismus mit seinem Beharren auf der Konstanz der Artessenz. Dadurch wurde es
möglich, die Tatsache anzuerkennen, daß es geographisch variable Arttaxa gibt und daß man eine
infraspezifische Terminologie zur Bezeichnung dieser Variabilität entwickeln mußte. Die zweite
Entwicklung war die Einsicht, daß man es mit zwei völlig getrennten Problemen zu tun hatte: mit der
Abgrenzung dieser Taxa einerseits und mit der Aufstellung unzweideutiger Kriterien für die Einordnung
dieser Taxa entweder in die Artkategorie oder in eine infraspezifische Kategorie andererseits. Um ein
Taxon einstufen zu können, muß man einen Begriff von der Kategorie haben, in die man es einordnen will.
Aus diesem Grunde war es unerläßlich, einen eindeutigen Artbegriff zu entwickeln.
Infraspezifische Kategorien
Die Essentialisten wußten nicht, wie sie mit der Variation umgehen sollten, besaßen doch
definitionsgemäß alle Angehörigen einer Art dieselbe Essenz. Wenn man Individuen fand, die stark von
der Norm der Art abwichen, hielt man sie für eine andere Art; differierten sie nur wenig, so galten sie als
„Varietät". Die Varietät (varietas) war die einzige Unterteilung der Art, die von Linnaeus und den frühen
Taxonomen anerkannt wurde, wobei eine Varietät alles einschloß, was vom idealen Typ der Art abwich. In
seinem Werk Philosophia Botanica (1751, These 158) beschrieb Linnaeus die Varietät folgendermaßen:
„Es gibt so viele Varietäten, als verschiedenartige Pflanzen aus dem Samen derselben Art
hervorgekommen sind. Die Varietät ist eine Pflanze, die aus einer zufälligen Ursache verändert ist: Klima,
Boden, Wärme, Winde usw., die daher auf geändertem Boden wieder zurückschlägt.'4 Hier definierte
Linnaeus die Varietät als eine nichtgenetische Abänderung des Phänotyps. Doch bei seiner Erörterung von
Varietäten im Tierreich (These 259) verstand er darunter auch genetische Varianten, wie Haustierrassen,
und verschiedene Sorten von Varianten innerhalb von Populationen. Als Beispiel führte er an: „weiße und
schwarze, große und kleine, fette und magere Kühe, Kühe mit glattem oder wolligem Fell, ebenso die
Rassen des Haushundes44. Offensichtlich bestand die Kategorie „Varietät" in Linnaeus' Schriften aus einer
höchst zusammengewürfelten Ansammlung von Abweichungen vom Arttypus. Weder unterschied er
zwischen erblichen und nichterblichen Varietäten, noch zwischen solchen, die sich auf Individuen bzw. auf
verschiedene Populationen (etwa Haustier- und geographische Rassen) beziehen. Diese Verwirrung der
Begriffe hielt zweihundert Jahre lang an, und einige Reste davon sind sogar noch in der zeitgenössischen
Literatur zu finden. Die Anwendung desselben Ausdrucks „Varietät" auf derart unterschiedliche
Phänomene wie individuelle Varianten und unterscheidbare Populationen war einer der Gründe, warum
Darwin das fundamentale Problem der Speziation nicht klarer sah (Mayr, 1959 b).
Die geographischen Varietäten gewannen in der Geschichte der Systematik und des Evolutionismus
besondere Bedeutung. Zum Beispiel erkannten Pallas und Esper (Mayr, 1963, S.335) bereits im 18.
Jahrhundert, daß geographische Rassen etwas völlig anderes sind als gewöhnliche Varietäten, und
versuchten dies terminologisch zum Ausdruck zu bringen. Mit der Zeit bezeichnete man solche Varietäten
als „Unterarten", behandelte sie aber immer noch völlig typologisch. Fast bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts galt die Subspezies als eine taxonomische Einheit wie die morphologische Art, jedoch von
niedrigerem kategorischen Rang [21]. Diese typologische Interpretation der Subspezies wurde nur sehr
langsam durch eine Auslegung im Sinne des Populationsdenkens ersetzt. Heute definiert man eine
Subspezies als „die Zusammenfassung phänotypisch ähnlicher Populationen einer Art, die ein
geographisches Teilgebiet des Areals der Art bewohnen und sich taxonomisch von anderen Populationen
der Art unterscheiden" (Mayr, 1969, S.41; zit. nach der dt. Ausg. 1975, S.45). Die Subspezies ist eine für
den Taxonomen praktische Einheit, aber keine Einheit der Evolution.
Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die fortschrittlicheren Zoologen, insbesondere jene, die sich
auf Vögel, Fische, Schmetterlinge und Mollusken spezialisiert hatten, zu erkennen, daß nicht nur nie zwei
Individuen einer Population völlig identisch sind, sondern daß sich auch die meisten Populationen in den
Mittelwerten vieler Merkmale voneinander unterscheiden. Welche Folgen diese neue Einsicht auf die
Evolutionstheorie hatte, wird in einem späteren Kapitel zu erörtern sein, sie wirkte sich jedoch auch auf die
Klassifikation der Arten aus.
Wenn eine Population „taxonomisch" (was gewöhnlich gleichbedeutend war mit morphologisch) von
zuvor benannten Populationen abwich, so wurde sie als neue Unterart beschrieben. Ein weiterer Name
wurde dann dem Artnamen hinzugefügt, und so ergab sich für die Unterart eine trinomiale Bezeichnung.
Die britische Rasse der weißen Bachstelze Motacilla alba, zum Beispiel, wurde zu Motacilla alba var.
lugubris. Mit der Zeit ließ man die Bezeichnung „var." weg und benannte die Subspezies einfach mit
Trinomen, in diesem Fall Motacilla alba lugubris. Schlegel (1844) wandte als erster Autor dreigliedrige
Benennungen systematisch an.
Gleichzeitig wurde eine Tendenz, die schon in den Schriften von Esper vorhanden gewesen war, zur
Tradition: nämlich den Terminus „Varietät" auf individuelle (innerhalb der Population auftretende)
Varianten, und den Ausdruck „Unterart" auf geographische Rassen zu beschränken (Mayr, 1942, S. 108113).
Die Konsequenz, mit der der Ausdruck „Subspezies" auf geographische Rassen angewandt wird, ändert
sich von einer taxonomischen Gruppe zur anderen. Viele Botaniker nennen sogar heute noch
geographische Rassen Varietäten. In bestimmten Bereichen der Zoologie wird der Ausdruck „Varietät"
ausschließlich für individuelle Varianten benutzt, während geographische Rassen entweder ignoriert (wenn
unbedeutend) oder zum Rang vollwertiger Arten erhoben werden. In der Pflanzen- wie auch in der
Tiertaxonomie sind wir von einer konsequenten Benennung immer noch weit entfernt.
Polytypische Taxa der Kategorie Art
Unterarten werden nur bei einigen Arten anerkannt. Einige Autoren waren der Ansicht, derartige Arttaxa
sollten terminologisch unterschieden werden, und schlugen verschiedene Namen für sie vor. Rensch (1929)
befürwortete den Ausdruck Rassenkreise, während Mayr (1942) den international besser geeigneten
Terminus polytypische Arten benutzte, der ursprünglich von Julian Huxley eingeführt worden war. Dieser
Ausdruck ist heute zur Beschreibung von Arten, die aus einer Reihe von Unterarten bestehen, allgemein in
Gebrauch (Mayr, 1969, S.37-52).
Zuerst nahm man an, die Anerkennung polytypischer Arten würde die Entwicklung eines neuen
Artbegriffs erfordern. Doch sobald terminologisch zwischen „Kategorie" und „Taxon" unterschieden
worden war, zeigte sich, daß die polytypische Art lediglich einen Sonderfall des Arttaxon darstellt, aber
keinerlei Veränderung des Konzepts der biologischen Artkategorie notwendig macht.
Die Anerkennung polytypischer Arttaxa durch die neue Systematik hatte eine erhebliche Klärung und
Vereinfachung der Klassifikation auf der Artstufe zur Folge. In der Ornithologie zum Beispiel erlaubte die
konsequente Anwendung des polytypischen Artkonzepts eine Herabsetzung der Zahl anerkannter Arttaxa
von über 20000 im Jahre 1920 auf gegenwärtig rund 9000.
Der Fortschritt zur modernen Arttaxonomie war in den verschiedenen Fachgebieten der Biologie höchst
ungleich. Zum Beispiel waren bis 1930 mehr als 95 Prozent aller Vogelarten beschrieben und seitdem
wurden nur etwa drei bis vier neue Arten pro Jahr entdeckt. Daher waren die Taxonomen vorwiegend
bestrebt, die Gültigkeit von Unterarten zu beurteilen und polytypische Arten abzugrenzen. Bei anderen
Gruppen werden immer noch derart viele neue Arten entdeckt, daß die Anwendung des polytypischen
Artbegriffs kaum begonnen hat.
Bis heute haben die Ornithologen noch keine vollständige Einstimmigkeit über die Behandlung von
Unterarten erzielt. Im 19. Jahrhundert war die Situation jedoch nahezu chaotisch gewesen (Stresemann,
1975, S.243-268): Einige Autoren ließen geographisch isolierte Populationen ganz und gar
unberücksichtigt, solange sie nicht auffallend anders waren; andere beschrieben sie als Unterarten, und
wieder andere nannten jede dieser Populationen eine vollwertige Art. Etwa um 1890 war es gelungen, die
Kluft zwischen den auseinander gehenden Meinungen etwas zu verringern. Man war überein gekommen,
daß unterscheidbare Populationen anerkannt werden sollten, doch herrschten immer noch Gegensätze in
bezug auf die Frage, welche dieser Populationen als Unterarten und welche als Arten zu bezeichnen seien.
Unter dem Einfluß der führenden amerikanischen Ornithologen Baird, Coues und Ridgway übernahm man
das Prinzip, alle Populationen, deren Variation mit derjenigen der Elternpopulation überlappte, als
Unterarten zu bezeichnen. Dieses Prinzip drückte sich in dem Slogan aus: „Der kontinuierliche Übergang
ist Prüfstein des Trinominalismus". Im Einklang mit dem von diesen Autoren vertretenen morphologischen
Artbegriff nannte man jede isolierte Population, die einen deutlichen morphologischen oder farblichen
Unterschied aufwies, eine Art. Dieses Kriterium für die Anerkennung von Arttaxa wurde international in
weiten Kreisen übernommen, etwa in der oben erwähnten Artdefinition von Lankester-Wallace.
Der deutsche Ornithologe Ernst Hartert nahm Anstoß an dieser engen Auffassung der Subspezies und
ersetzte sie durch ein neues Kriterium, das der geographischen Vertretung. Selbst wenn eine geographisch
repräsentative Population verschieden war, und „auch wenn man keine dazwischen liegende Formen
besitzt… zeigt man die Nähe der Verwandtschaft", wenn man sie eine Unterart nennt. Seine Definition der
Unterart war somit eine Folgerung aus dem biologischen Artbegriff. Zwar stieß Harterts Prinzip auf
heftigen Widerstand seitens des ornithologischen Establishment in Amerika wie auch in Europa, (doch
fand es bald Anhänger in Deutschland (Meyer, Erlanger, Schalow) und in Österreich (Tschusi, Hellmayr)
und errang in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts unter der Führung von Erwin Stresemann einen
kompletten Sieg.
Stresemann und einige seiner Anhänger gingen jedoch bei der Anwendung des Prinzips des
geographischen Vikariierens häufig zu weit. Sie neigten dazu, zum Teil unter dem Einfluß der
Formenkreislehre von Otto Kleinschmidt, jede allopatrische Art auf den Rang einer Unterart zu reduzieren
(siehe Stresemann, 1975). Es war Rensch (1929), der diesem übermäßigen „lumping" Einhalt gebot. Er
schlug vor, man solle nicht nur Gruppen von geographisch repräsentativen Unterarten (d. h. polytypische
Arten) anerkennen, sondern auch Gruppen von geographisch repräsentativen Arten, die er Artenkreise
nannte und Mayr in „Superspezies" umbenannte. Superspezies sind Gruppen von geographisch
vikariierenden Populationen (die früher als polytypische Arten betrachtet wurden), deren Angehörige (die
von Amadon „Allospezies" genannt wurden) lange genug isoliert waren, um das Artniveau erreicht zu
haben. In den letzten Jahrzehnten bestand die Taxonomie der Vögel hauptsächlich in der sorgfältigen
Prüfung polytypischer Arten, insbesondere in Inselregionen, um festzustellen, welche isolierten und
ausgeprägten Unterarten in den Rang von Allospezies erhoben werden sollten. Den größten Wert hat die
Anerkennung von Superspezies für die zoogeographische Forschung.
Superspezies kommen auch bei vielen anderen Organismengruppen vor, doch tritt dies nicht zutage,
solange nicht ein Spezialist die Areale der am nächsten verwandten Arten auf der gleichen Karte absteckt.
Sehr häufig berühren sich die Grenzen solcher Arten oder überschneiden sich leicht (parapatrische
Verbreitung); dabei kann geringfügige Bastardierung auftreten oder fehlen. Die Froschgruppe Rana pipiens
in Nordamerika, die in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts als weitverbreitete polytypische Art galt,
ist seitdem als eine Superspezies erkannt worden, die sich aus mindestens sechs-(Allo-)Spezies
zusammensetzt.
Bei keiner anderen Tiergruppe ist die Taxonomie so ausgereift wie bei den Vögeln. Aus diesem Grunde
sind die Vögel nicht nur bei Evolutionsstudien, sondern auch in der Ökologie von besonderem Wert. Bei
den meisten anderen Tiergruppen ist die Anwendung biologisch definierter, polytypischer Arten weit
weniger fortgeschritten. Manches deutet darauf hin, daß die Situation bei den Vögeln besonders einfach ist,
da viele der Schwierigkeiten, denen sich die Erforscher anderer Tier- und Pflanzentaxa gegenübersehen,
bei den Vögeln nicht zu existieren scheinen. Chromosomenvariation zum Beispiel scheint sehr geringfügig
zu sein, und Polyploidie zu fehlen. Zwischenartliche Bastardierung ist so selten, daß sie keine Probleme
aufwirft, und ebensowenig gibt es ökologische Spezialisierungen oder Anpassungen an spezifische Wirte,
die Schwierigkeiten bereiten würden. Beginnende Speziation scheint ausschließlich auf dem Wege über
geographisch isolierte Populationen zu erfolgen. Dies verleiht der Vogelart eine Einfachheit, die bei den
anderen Taxa selten ist (Mayr und Short, 1970). Ein beträchtliches Maß an zusätzlicher Forschung wird
nötig sein, um festzustellen, ob man, um den komplexen Situationen in anderen Tier- und Pflanzengruppen
gerecht zu werden, den vorherrschenden Artbegriff modifizieren muß oder nicht und ob eventuell weitere
Sorten von Arttaxa anerkannt werden müssen.
Variation in der Zeitdimension
Die Paläontologen haben bei der Abgrenzung von Arttaxa mit besonders großen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Beim Vergleich von Fossilien von verschiedenen Fundstellen haben sie es sowohl mit der
Zeitdimension als auch mit der geographischen Dimension zu tun. Der Erforscher rezenter Biota befaßt
sich mit einer Momentaufnahme der evolutiven Kontinuität, während sich die organische Vielgestaltigkeit
dem Paläontologen als ein Kontinuum darstellt. Angesichts dieser Schwierigkeiten sind die Paläontologen
bis vor sehr kurzer Zeit dem Artproblem insgesamt ausgewichen. Simpson erwähnt in seinem Werk Tempo
and Mode in Evolution (1944) die Arten praktisch überhaupt nicht, und wenn, so lediglich in Verbindung
mit der Speziation, wie etwa:
„Die phyletischen Linien… setzen sich aus aufeinanderfolgenden Arten zusammen, und
aufeinanderfolgende Arten sind ganz etwas anderes als gleichzeitige Arten, die bei der Speziation im
üblichen Gebrauch des Wortes betroffen sind." (S.202, zit. nach der dt. Ausgabe 1951, S.282).
Wie der Neontologe muß auch der Paläontologe versuchen, sein Problem zu lösen, indem er sich
zunächst mit der nichtdimensionalen Situation befaßt. Dieses Vorgehen ist möglich, da die an einem
Fundort (in einem begrenzten Horizont) entnommene Stichprobe normalerweise eine nichtdimensionale
Situation darstellt. Hier kann der Paläontologe eine eindeutige Entscheidung treffen. Die Variation, die er
hier vorfindet, ist entweder die einer einzigen Population, oder aber stellt mehrere Arten dar. Subspezies in
der Raum- und Zeitdimension sind durch den Charakter der Situation ausgeschlossen. Die Analyse
derartiger monotopischer Stichproben liefert den Maßstab, der dann beim Vergleich von in Raum und Zeit
verschiedenen Serien anzulegen ist. Das Aufspalten des an einem einzigen Fundort gesammelten Materials
in zahlreiche „Varietäten", wie das einige Wirbellosenpaläontologen getan haben, mag zwar bei
stratigraphischen Untersuchungen eine Hilfe sein, ist jedoch biologisch nicht zu vertreten. Unter
biologischem Gesichtspunkt ist es sogar noch weniger sinnvoll, wenn Paläobotaniker für Blätter, Stämme,
Blüten und Samen, die in denselben Lagerstätten vorgefunden werden, getrennte „Arten" anerkennen. Man
muß zugeben, daß sogar solche nichtdimensionale Aufsammlungen schwierige Probleme aufwerfen. Es ist
nicht immer leicht zu bestimmen, ob gewisse Phäne Vertreter verschiedener Arten sind oder ob es sich bei
ihnen nur um Alters- oder Geschlechtsunterschiede handelt. Bei Gruppen, in denen Zwillingsarten
auftreten, lassen sie sich in dem Fossilienmaterial vermutlich niemals voneinander trennen. Doch handelt
es sich hierbei eher um technische Schwierigkeiten als um begriffliche.
Begriffliche Schwierigkeiten entstehen, wenn der Paläontologe gezwungen ist, die lokalen Arten einer
einzigen Lokalität in den multidimensionalen Raum der Geschichte des Lebens hinein zu stellen. Anhand
welcher Kriterien soll er seine Arttaxa abgrenzen? Jede phyletische Linie ist ein offenes System. Wo soll
man bei einer solchen Kontinuität den Anfang und das Ende einer Art ansetzen? Hennig (1950) aus der
kladistischen Schule versucht sich aus diesem Dilemma zu befreien, indem er die Art einfach als das
Segment einer phyletischen Linie zwischen zwei Abzweigungspunkten definiert. Dabei wird jeder Bezug
zur Fortpflanzungsisolation außer acht gelassen, abgesehen davon, daß diese Definition, die sich
ausschließlich auf eine begrenzte Zahl ancestraler oder abgeleiteter Merkmale stützt, stark typologisch ist.
Zudem ist sie strikt formalistisch, da in diesem Schema Art a automatisch zu Art b wird, wenn eine andere
Art c abzweigt, selbst wenn nichts einen Unterschied zwischen Art a und Art b beweist. Der Kladist E. O.
Wiley (1978) bemerkte kürzlich, daß „keine vermutete getrennte, einzelne, evolutive Stammeslinie in eine
Reihe von Ahnen- und Nachkommenarten aufgeteilt werden darf. Hennig und seine Nachfolger übersehen
eine fundamentale Tatsache: Artbildung in peripheren isolierten Populationen hat keinen Einfluß auf den
Hauptstamm der Art; er fährt in seiner Entwicklung fort, ohne seinen Artstatus zu ändern, da er ja von dem
Abzweigen peripherer Tochterarten nicht berührt wird.
Die formalistische „Lösung" des Problems der Art in der Zeitdimension ist somit keine Lösung. Wie
Simpson (1961 a, S. 165) sehr richtig bemerkt, weisen (außer in Fällen saltationistischer Evolution) alle
Entwicklungslinien eine vollkommene evolutive Kontinuität auf, so daß man, wenn man eine derartige
Linie nicht in Ahnen- und Nachkommen-Arten aufteilen würde, „mit dem Menschen anfangen und, immer
noch in der Spezies Homo sapiens, bis zu einem Protisten zurückgehen könnte". Wie aber unterteilt man
eine solche Linie in eine Abfolge von Arten?
Simpson hat das Problem durch die Einführung eines neuen Artbegriffs zu lösen versucht, den der
evolutionären Art: „Eine evolutionäre Art ist eine Abfolge (eine Sequenz von Ahnen- und NachkommenPopulationen), die sich getrennt von anderen entwickelt und ihre eigene einheitliche evolutive Rolle und
Tendenzen hat" (1961, S. 153). Die Schwäche dieser Definition liegt natürlich darin, daß sie auch auf die
meisten beginnenden Arten (wie geographisch isolierte Subspezies) zutrifft. Diese entwickeln sich
ebenfalls getrennt und spielen eine eigene einheitliche evolutive Rolle, sind aber, solange sie keine
Fortpflanzungsisolation erworben haben, keine Arten. Außerdem: was genau ist mit „einheitliche evolutive
Rolle" gemeint? Simpson definiert eine phyletische Linie, nicht aber eine Art.
Abgesehen davon sagt uns diese Definition nicht im geringsten, wie wir eine Sequenz von Arttaxa in der
Zeit abzugrenzen haben. Sind die von Gingerich (1977) beschriebenen Sequenzen zeitlicher Arttaxa von
Plesiadapis und anderen Säugetieren aus dem Paläozen-Eozän gute Arten oder lediglich Subspezies? Die
Antwort: wenn sie unterschiedliche „einheitliche evolutive Rollen" haben, so sind es Arten, ist keine
Antwort, denn wie sollen wir das jemals feststellen? Simpsons Definition ist im wesentlichen eine
typologische Beschreibung, wobei übersehen wird, daß die vom Gesichtspunkt der Evolution gesehen
interessantesten Arttaxa polytypische Arten sind. Viele Populationen und Rassen derartiger Komplexe
unterscheiden sich erheblich in ihrer Nischenausnutzung; sie haben keine einheitliche evolutive Rolle. Bei
der paläontologischen Artdefinition versucht man, die nichtdimensionale Definition durch eine
eindimensionale (Dimension Zeit) zu ersetzen, doch verwickelt man sich in Widersprüche, da die
„horizontalen" Dimensionen (Länge und Breite) unberücksichtigt bleiben. Die Hauptschwäche der
sogenannten evolutionären Artdefinition liegt darin, daß sie das entscheidende Problem der Art
herunterspielt (wenn nicht sogar unberücksichtigt läßt), nämlich Ursache und Aufrechterhaltung von
Diskontinuitäten zwischen den Arten, und sich stattdessen auf die Frage konzentriert, wie
multidimensionale Arttaxa abzugrenzen seien. Doch erfüllt sie noch nicht einmal den begrenzten Zweck,
darüber zu informieren, wie solche offenen Systeme abzugrenzen sind [22]. Nebenbei gesagt, hat es schon
früher Bemühungen gegeben, das Kriterium „in der Evolution befindlich" in eine Artdefinition
aufzunehmen (etwa seitens Alfred Emerson); sie setzten sich jedoch nicht durch, da man die Irrelevanz und
Unbrauchbarkeit dieses Kriteriums erkannte.
Doch ist die Lage für die Paläontologie nicht völlig hoffnungslos. Viele phyletische Linien sterben aus
und damit wird der Linie bei der letzten Art ein natürliches Ende gesetzt. Ferner: viele Arten entstehen
recht schnell in einer peripher isolierten Gründerpopulation oder an einem vorübergehenden Zufluchtsort.
Damit ist der Beginn der ersten Art einer neuen Stammeslinie gegeben. Lediglich in den Fällen einer
Sequenz von Ahnen-Nachkommen-Arten, die in einer einzigen phyletischen Linie allmählich ineinander
übergehen, ist eine scharfe Abgrenzung zwischen zeitlichen Arttaxa unmöglich. Hier weigert sich die
biologische Evolution, den Wünschen des Taxonomen zu entsprechen. Zum Glück sind die Fossilienfunde
sozusagen zuvorkommender. Ihre Unzulänglichkeit läßt gewöhnlich genügend Lücken in den
Entwicklungslinien, um eine Abgrenzung vertikaler Arttaxa zu gestatten, so künstlich dies auch sein mag.
Es sieht so aus, als müßten wir uns mit dieser Kompromißlösung zufriedengeben, zumal das Belegmaterial
die Behauptung einiger Verfechter der Theorie der „unterbrochenen Gleichgewichte" (punctuated
equilibria) (siehe Kapitel 13) nicht zu bestätigen scheint; sie besagt, daß eine phyletische Artbildung
niemals stattfände, und alle neue Arten in Gründer- (oder in Refugien lebenden) Populationen, oder sogar
durch Saltationen entstünden.
Die Bedeutung der Art in der Biologie
Wer nicht mit Arten, sondern mit Zellen oder Molekülen arbeitet, mag aufgrund der nie aufhörenden
Diskussion um die Definition der Artkategorie zu der Überzeugung kommen, die Art sei ein willkürlicher
und unbedeutender Begriff in der Biologie. Tatsächlich jedoch nimmt die Einsicht in die Bedeutung der
Arten ständig zu (Mayr, 1969). Es gab eine Zeit, da war die Artkategorie weitgehend ein Problem der
Taxonomen. Später begannen die Genetiker die genetische Einheit der Arten hervorzuheben, indem sie
entweder die Art als einen einzigen großen Genpool betrachteten oder die Koadaptation der Gene
untereinander betonten. Dies wiederum beeinflußte die Beurteilung des Artbildungsprozesses, der heute
nicht mehr, wie von Darwin, als zufälliger, stets gegenwärtiger Wandel, sondern als ein ziemlich
drastisches Ereignis angesehen wird. Wir sind uns wieder dessen bewußt geworden, daß ein konkreter
Schritt erforderlich ist, um von einer Art zur nächsten zu gelangen. Man weiß heute, daß die genetischen
Veränderungen zwischen den Populationen einer Spezies häufig anderer Art und mit Sicherheit von
geringerer Größenordnung sind als die genetischen Veränderungen, die von einer Art zu einer anderen
führen.
Einer der wichtigsten Aspekte der Art ist ihre Fortpflanzungsisolation gegenüber anderen Arten. Es liegt
also auf der Hand, daß der Erwerb von Isolationsmechanismen in der Geschichte der Arten von
entscheidender Bedeutung ist. Man mag eine Fülle genetischer Veränderungen in benachbarten und
miteinander verbundenen Populationen einer Art finden, wenn diese jedoch nicht durch
Fortpflanzungsbarrieren getrennt sind, gehören sie alle derselben Art an. Solange diese Schranken fehlen,
kann die Vielgestaltigkeit der Populationen durch Genfluß, drastische Bastardierung oder konvergierende
Selektionsdrucke wieder rückgängig gemacht werden. Der Punkt, an dem keine Umkehr mehr möglich ist,
ist erreicht, wenn eine sich entwickelnde Population Isolationsmechanismen gegenüber ihrer
Elternpopulation erworben hat. Von diesem Punkt an kann die neue Art in neue Nischen und neue adaptive
Zonen eindringen. Der Ursprung neuer höherer Taxa und aller evolutiver Neuheiten geht letzten Endes auf
eine Gründerart zurück. Die Art ist daher die grundlegende Einheit der Evolutionsbiologie (Mayr, 1970, S.
373-374).
Die Rolle, die der Art in der Evolution zukommt, ist häufig unterschätzt worden. Huxley (1942) sah in
der Artbildung großteils „einen biologischen Luxus, ohne Auswirkungen auf die großen und fortlaufenden
Trends des Evolutionsprozesses". Mayr (1963, S.620-621) widersprach dieser Auslegung energisch: „Eine
üppige Vervielfältigung der Arten ist ejne Vorbedingung für den Evolutionsprozeß. Jede Art ist ein
biologisches Experiment…, Soweit es eine beginnende Art betrifft, gibt es keine Möglichkeit
vorherzusagen, ob die Nische, in die sie eindringt, eine Sackgasse oder das Tor zu einer großen neuen
adaptiven Zone ist…. Zwar mag der Evolutionist von umfassenden Phänomenen sprechen, wie Trends,
Anpassungen, Spezialisierungen und Regressionen, doch sind diese von dem Fortschreiten der Einheiten,
an denen diese Trends sichtbar werden (der Spezies) nicht zu trennen. Die Arten sind die eigentlichen
Einheiten der Evolution."
Die Art ist darüber hinaus in hohem Maße die grundlegende Einheit der Ökologie. Da sich die
Ökosysteme aus Arten zusammensetzen, läßt sich kein Ökosystem völlig verstehen, solange man es nicht
in die Arten zerlegt hat, aus denen es sich zusammensetzt, und solange die gegenseitigen
Wechselwirkungen dieser Arten nicht verstanden sind. Eine Art ist eine Einheit, die sich, ungeachtet der
Individuen, aus denen sie besteht, mit anderen Arten in Wechselwirkung befindet, mit denen sie sich in die
Umwelt teilt (vgl. Cody und Diamond, 1975). Diese wechselseitige Beziehung zwischen den Arten ist der
Hauptforschungsgegenstand der Ökologie.
Infolge der Tatsache, daß die Isolationsmechanismen eine Art zu einer Fortpflanzungsgemeinschaft
machen, ist die Art im Tierreich auch eine wichtige Einheit der Verhaltensforschung. Individuen, die
derselben Art angehören, besitzen alle Komponenten des Brautwerbeverhaltens als identisches
Signalsystem. Darüber hinaus haben die Angehörigen einer Art viele andere Verhaltensmuster gemeinsam,
insbesondere alle, die mit sozialem Verhalten zu tun haben.
Da die Art eine – wenn nicht sogar die wichtigste – Einheit der Evolution, der Systematik, der Ökologie
und der Ethologie ist, ist sie eine ebenso wichtige Einheit der Biologie wie, auf einem niedrigeren
Integrationsniveau, die Zelle. Sie ist ein eminent brauchbarer, ordnender Mechanismus für viele wichtige
biologische Phänomene. Wenn es auch keinen speziellen Namen für die „Wissenschaft von den Arten"
gibt, wie etwa den Namen „Zytologie" für die Wissenschaft von den Zellen, so besteht doch kein Zweifel
daran, daß es eine solche Wissenschaft gibt und daß sie sich zu einem der aktivsten Fachgebiete der
Biologie entwickelt hat.
Schließlich ist die Art auch von großer praktischer Bedeutung. Ein großer Teil der Verwirrung und
Mißverständnisse in mehreren Zweigen der Biologie, einschließlich der Physiologie, war auf die ungenaue,
wenn nicht sogar falsche Identifikation der Art zurückzuführen, mit der der Forscher arbeitete.
Wissenschaftler auf dem Gebiet der angewandten Biologie haben ständig mit Arten zu tun, gleichgültig, ob
es um Krankheitsvektoren, Pathogene, Seuchen in der Land- oder Forstwirtschaft oder um Probleme
wildlebender Tiere oder der Fischerei geht. Trotz der durch die genetische Einzigartigkeit jedes
Individuums bedingten Variabilität besitzt das genetische Programm (DNA) fast jeder Art eine
artspezifische Einheitlichkeit. Diese allseitige Präsenz der Arten wirft eine Vielzahl von Problemen
hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer Bedeutung auf -Probleme, denen ein Hauptteil der gegenwärtigen
Forschungstätigkeit in der Biologie gewidmet ist.
Teil II: Evolution
Es gibt wohl keinen Volksstamm, und sei er noch so primitiv, der nicht seine Mythen über den Ursprung
des Menschen oder der Bäume, über die Entstehung der Sonne und vielleicht sogar der Welt als Ganzes
hat. Eine gewaltige Schlange, ein Riesenvogel, ein Fisch oder ein Löwe oder irgendein anderes Geschöpf
mit übernatürlichen Kräften oder schöpferischen Fähigkeiten waren die Kräfte, die bei der
Entstehungsgeschichte eine Rolle spielten. Als sich die Religionen mit Gottheiten herausbildeten, da waren
es diese Götter, die die Dinge und das Leben schufen. Bei den Griechen waren das z. B. Zeus, Athene,
Poseidon und andere Götter. Die Schöpfungsgeschichte in der Bibel ist der Prototyp dieser
Ursprungsvorstellung. Die meisten frühen Entstehungsgeschichten haben miteinander gemein, daß sie die
Schöpfung als ein einmaliges Ereignis darstellen. Ergebnis dieses Schöpfungsaktes war eine statische,
zeitlose Welt, deren einziger Wandel der Wechsel der Jahreszeiten und das Kommen und Gehen von
Menschengenerationen war. Ein Evolutionsprozeß war für diese frühen Vertreter der Schöpfungslehre eine
gänzlich fremde Vorstellung. Entgegengesetzten Behauptungen zum Trotz entstand ein echtes
Evolutionsdenken erst bemerkenswert spät in der Geschichte [1].
7 Entstehungsgeschichten ohne Evolution
Im siebenten, sechsten und fünften Jahrhundert v. Chr. erlebten Handel und Gewerbe im östlichen
Mittelmeerraum und Nahen Osten eine beispiellose Blüte. Viele Griechen, insbesondere die Ionier, die an
der Küste Kleinasiens blühende Kolonialstädte gegründet hatten, bereisten Ägypten und Mesopotamien
und lernten ägyptische Geometrie und babylonische Astronomie kennen. Allmählich wurde deutlich, daß
viele Erscheinungen, die man zuvor dem Wirken von Göttern zugeschrieben hatte, auf „natürliche" Weise
erklärt werden konnten. Warum sollte man dann nicht auch Fragen nach dem Ursprung der Materie, der
Erde und des Lebens stellen?
Und wer sollte derartige Fragen stellen? Nicht Wissenschaftler, denn bis zum späten Mittelalter und zur
Renaissance gab es keine Wissenschaft, wie wir sie heute unter diesem Wort verstehen. Vielmehr waren es
die Philosophen, die den Platz der Wissenschaftler innehatten, die nach der Wahrheit forschten und die
Welt zu verstehen suchten, in der sie lebten. In Kapitel 3 haben wir mehrere philosophische Schulen
beschrieben und werden uns nunmehr mit jenen befassen, die für die Evolution von Bedeutung waren
(Guthrie, 1965). Von den Schriften der Vorsokratiker sind leider lediglich Fragmente erhalten, doch
reichen diese aus, um zu vermuten, daß ein Großteil ihrer Lehren der babylonischen oder ägyptischen
Tradition entstammte.
Der erste Philosoph, den wir kennen, war Thales von Milet. Er lebte etwa 625-547 v. Chr. und war in
erster Linie Astronom, Geometer und Meteorologe. Biologische Phänomene interessierten ihn allem
Anschein nach nicht. Er hielt das Wasser für das Urprinzip, und Aristoteles vermutete später, Thales habe
dies getan, weil das Wasser eine so bedeutende Rolle im Tier- und Pflanzenleben spielt, wo sogar der
Samen feucht ist. Außerdem haben viele Tiere in ihrem Lebenszyklus eine Beziehung zum Wasser.
Sein Schüler Anaximandros (etwa 610-546 v.‹ihr.) war zwar vor allem als Geograph und Astronom
bekannt, doch galt sein Interesse weit mehr der Welt des Lebendigen. Er stellte eine vollständige, wenn
auch reichlich phantastische Theorie der Weltenstehung auf, bei der Feuer, Erde, Wasser und Luft eine
wichtige Rolle spielten. Die erste Generation der Lebewesen stellte er sich als durch Metamorphose
entstanden vor, ähnlich der Metamorphose, durch die ein Insekt aus dem Puppenstadium hervorgeht:
Die ersten Tiere wurden in der Feuchtigkeit erzeugt und in dornige Borke eingeschlossen. Als sie älter
wurden, wanderten sie auf das trockene Land, und nachdem ihre äußere Borke geborsten und
abgeworfen War, überlebten sie eine kurze Weile in der neuen Lebensweise.
Der Mensch wurde am Anfang aus lebenden Dingen anderer Art erzeugt, denn während andere bald
selbst nach ihrer Nahrung jagen können, bedarf der Mensch allein einer langen Pflege. Wäre der
Mensch zu Beginn so gewesen, so hätte er niemals überlebt. Daher wurden die Menschen im Innern
dieser [fischähnlichen Geschöpfe] gebildet und blieben in diesen wie Embryonen, bis sie die Reife
erreicht hatten. Dann endlich barsten die Geschöpfe und aus ihnen heraus traten Männer und Frauen, die
imstande waren, für sich selbst zu sorgen. (Aus Toulmin und Goodfield, 1965, S. 36).
Dies ist keine Vorwegnahme der Evolution, wie gelegentlich behauptet worden ist, sondern bezieht sich
auf die Ontogenie der Urzeugungen. Die nachfolgenden Philosophengenerationen, von Anaximenes (etwa
555 v.Chr.) über Diogenes von Apollomia (etwa 435 v.Chr.) und Xenophanes (etwa 500 v.Chr.) bis zu
Parmenides (etwa 475 v.Chr.) akzeptierten die generatio spontanea aus Schlamm oder feuchter Erde.
Empedokles (etwa 492-432 v. Chr.) schlug eine absurde Theorie über die Entstehung der Lebewesen
vor, derzufolge zuerst nur Teile von Körpern entstanden: Köpfe oder Glieder ohne Körper, Köpfe ohne
Augen und Münder und so weiter. Sie trieben umher und zogen einander an, bis perfekte Verbindungen
erreicht waren; unvollkommene Verbindungen gingen zugrunde. Dies als einen Vorläufer von Darwins
Theorie der natürlichen Zuchtwahl zu bezeichnen, ist lächerlich, ist doch an dem Zusammenfügen
komplementärer Teile keinerlei Selektion beteiligt, und ebensowenig ist die Ausmerzung unvollkommener
Exemplare ein Selektionsvorgang. Vielleicht wurde Empedokles ursprünglich durch die Existenz von
Monstrositäten wie zweiköpfiger Kälber zur Aufstellung seiner Theorie angeregt.
In den Schriften von Anaxagoras (etwa 500-428 v. Chr.) und Demokrit (etwa 500-404 v. Chr.) finden
wir die ersten Hinweise auf Adaptation. Für Anaxagoras war es ein nichtmaterielles Prinzip, Nous, das den
Anstoß zur Entstehung der Welt gab, ohne jedoch den späteren Lauf der Entstehung der Dinge zu lenken.
Es war keine Theorie eines Schöpfungsaktes nach Plan, wie gelegentlich behauptet worden ist. Demokrit,
der offenbar von den organischen Anpassungen fasziniert war, verzichtete bewußt darauf, irgendeine
lenkende Kraft zu postulieren. Seiner Ansicht nach war vielmehr die Organisation – von Systemen – eine
notwendige Folge der Eigenschaft der Atome. Demokrit war somit der erste, der die Frage nach
Zufallsmechanismen oder immanenten zielgerichteten Tendenzen stellte. Er glaubte darüber hinaus an die
harmonische Ordnung der Welt und warf Probleme auf, die Aristoteles später mit Hilfe des
Teleologiebegriffes zu lösen suchte.
Insbesondere zwei Aspekte sind für die Vorstellungen der frühen griechischen Philosophen über die
Weltentstehung bezeichnend (1). Die „Schöpfungs"akte werden sozusagen „entgöttert", das heißt, Welt,
Leben oder spezifische Lebewesen entspringen nicht dem Handeln eines Gottes, wie in der
vorphilosophischen Zeit allgemein angenommen wurde, sondern werden als das Resultat der
schöpferischen Macht der Natur verstanden (2). Die Ursprünge waren nichtteleologisch, d. h. es lag ihnen
keine Absicht oder kein Ziel zugrunde; vielmehr war das, was geschah, das Ergebnis des Zufalls oder einer
irrationalen Notwendigkeit.
Diese Philosophen waren somit die ersten, die eine „natürliche" Erklärung für die Welt der
Erscheinungen anboten, das heißt, eine rationale Erklärung, die sich nur auf bekannte Kräfte und
Materialien, wie Sonnenwärme, Wasser und Erde, berief. So naiv und primitiv diese Spekulationen dem
modernen Geist auch erscheinen mögen, stellen sie doch sozusagen die erste wissenschaftliche Revolution
dar, eine Ablehnung übernatürlicher zugunsten materialistischer Erklärungen.
Noch ein weiterer anscheinend grundlegender Unterschied besteht zwischen der Weltvorstellung der
griechischen Philosophen und den geistlichen Verfassern der Bibel. Die Welt der Bibel ist eine junge Welt,
deren Schöpfung erst um etwa 4000 v.Chr. stattgefunden habe, wie Bischof Usher später errechnete.
Außerdem würde diese Welt bald wieder zu Ende gehen, nämlich am Jüngsten Tag. Daher war die Zeit ein
unbedeutender Aspekt der biblischen Weltsicht. Andererseits erscheint uns die Behandlung der Zeit durch
die griechischen Philosophen inkonsequent. Für uns moderne Menschen bedeutet Zeit Veränderung; die
unter den Vorsokratikern vorherrschende Vorstellung war jedoch die einer ewigen Welt, einer Welt ohne
signifikanten Wandel oder bestenfalls mit zyklischen Veränderungen, die früher oder später eine Rückkehr
zur Ausgangssituation zur Folge haben würden, eine in einem Fließgleichgewicht befindliche Welt. Dies
galt offenbar sogar auch für Heraklit und das ihm zugeschriebene Motto panta rhei („alles fließt"). Die
Zeit, wenn auch unbegrenzt, war also für das griechische Weltbild von geringer Konsequenz; sie machte es
nicht notwendig, die Welt der Ursprünge durch eine sich entwickelnde Welt zu ersetzen. Und die
Ursprünge waren in der Tat von enormem Interesse für sie: die Entstehung des Universums, der Erde, des
Lebens, der Tiere, des Menschen und der Sprache. Über darauffolgende Veränderungen dachte man, wenn
überhaupt, dann nur wenig nach.
Ganz und gar anders argumentierte die Schule des Hippokrates (etwa 460-370 v. Chr.). Diese Ärzte
legten größeres Gewicht auf Beobachtung und Empirie als auf rein gedankliche Ableitungen. Sie waren
zweifellos von der Vererbung erworbener Eigenschaften und der Gültigkeit des Prinzips von Gebrauch und
Nichtgebrauch überzeugt. Für die Unterschiede zwischen den Menschen, die an verschiedenen Orten leben,
waren ihrer Ansicht nach Klima und andere regionale Faktoren verantwortlich.
Platon
Verstreut in den Lehren der ionischen Philosophen finden sich vielversprechende Ansätze für die
Entwicklung eines Evolutionsdenkens, etwa unbegrenzte Zeit, Urzeugung, Umweltveränderungen sowie
eine Betonung der ontogenetischen Veränderung im Individuum. Doch es gab keine Weiterentwicklung. In
der Tat änderte die griechische Philosophie ihre Richtung bald danach ziemlich drastisch. Infolge des
Einflusses des Parmenides und, sogar in noch stärkerem Maße, der Pythagoräer aus dem südlichen Italien,
bewegte sich die Denkweise der griechischen Philosophie mehr und mehr in Richtung auf eine abstrakte
Metaphysik und geriet zunehmend unter den Einfluß der Mathematik, insbesondere der Geometrie. Dies
war die erste von unzähligen Episoden in der Geschichte der Biologie, wo die Mathematik oder die exakten
Wissenschaften die Entwicklung der Biologie nachteilig beeinflußten. Die Beschäftigung mit der
Geometrie brachte ein Suchen nach „unveränderlichen Realitäten", nach Idealgestalten mit sich, die dem
vergänglichen Fluß der Erscheinungen zugrundelagen. Mit anderen Worten, sie führte zur Entstehung des
Essentialismus (siehe Kapitel 2), und diese Philosophie ist unvereinbar mit dem Evolutionsdenken.
Nachdem das Axiom, alle durch die Sinne beobachteten zeitlichen Veränderungen seien lediglich
Permutationen und Kombinationen „ewiger Prinzipien" erst einmal akzeptiert worden war, verlor die
historische Abfolge von Ereignissen (die einen Teil des „Flusses" darstellte) [ein anderer Teil war
individuelle Variation], all seine grundlegende Bedeutung. Sie war nur in dem Maße interessant, als sie
Hinweise auf das Wesen der bleibenden Realitäten gab… Die Philosophen befaßten sich stattdessen mit
Fragen allgemeiner Prinzipien – der geometrischen Anordnung der Himmel, der mit den verschiedenen
materiellen Elementen assoziierten mathematischen Formen… Immer mehr wurden sie von der Idee einer
unveränderlichen universellen Ordnung, eines „Kosmos", besessen: dem ewigen und nichtendenden
Schema der Natur – einschließlich der Gesellschaft -, deren Grundprinzipien zu entdecken ihre besondere
Aufgabe war (Toulmin und Goodfield, 1965, S. 40).
Diese neuen Vorstellungen fanden ihren glänzendsten Sprecher in Platon, dem großen Antihelden der
Evolutionslehre. Platons Denkweise war die eines Geometers, und von biologischen Erscheinungen
verstand er offensichtlich sehr wenig. Vier seiner Lehrsätze wirkten sich während der folgenden
zweitausend Jahre besonders verhängnisvoll auf die Biologie aus. Der eine, wie schon gesagt, war der
Essentialismus, der Glaube an konstante eide, unveränderliche, von den äußeren Erscheinungsformen
getrennte und unabhängige Ideen. Der zweite war die Vorstellung eines belebten Kosmos, eines
lebendigen, harmonischen Ganzen (Hall, 1969, S.93), die es später so schwer machte zu erklären, wie eine
Evolution hätte stattfinden können, da doch jede Veränderung die Harmonie stören würde. Drittens ersetzte
er die Urzeugung durch eine schöpferische Kraft, einen Demiurg. Da Platon Polytheist und Heide war, war
sein Weltbaumeister eine etwas weniger konkrete Figur als der Schöpfergott der großen monotheistischen
Religionen. Doch wurde der Demiurg, der Baumeister, der die Welt schuf, später im Sinne des
Monotheismus interpretiert. Diese Auslegung führte zur christlichen Tradition, derzufolge „es Aufgabe des
Philosophen ist, den Bauplan des Schöpfers zu enthüllen", und deren Einfluß noch bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts wirksam war (Physikotheologie, Louis Agassiz). Das vierte von Platons einflußreichen
Dogmen war seine starke Betonung der „Seele". Hinweise auf nichtkörperliche Prinzipien lassen sich auch
bei den vorsokratischen Philosophen finden, aber nirgends so spezifisch, ausführlich und alles
durchdringend wie bei Platon. Als dieses Prinzip später mit christlichen Vorstellungen verschmolz, machte
der Glaube an die Seele es dem gläubigen Christen schwer, den Evolutionsgedanken aufzunehmen oder
zumindest den Menschen und seine Seele mit in das Evolutionsschema einzubeziehen. Es ist oft darauf
hingewiesen worden, welch eine Katastrophe Platons Schriften für die Biologie gewesen sind, auf keinen
anderen Bereich dieser Wissenschaft trifft dies jedoch so sehr zu wie auf das Evolutionsdenken [1].
Aristoteles
Der erste große Naturforscher, von dem wir wissen, Aristoteles, scheint in idealer Weise dafür
prädestiniert gewesen zu sein, als erster eine Evolutionstheorie zu entwickeln [2]. Er war ein
hervorragender Beobachter und erkannte als erster eine stufenweise Anordnung in der lebendigen Natur.
Ja, er war davon überzeugt, daß „die Natur in einer ungebrochenen Aufeinanderfolge von den unbelebten
Objekten über die Pflanzen bis zu den Tieren reicht". Viele im Meer lebende Tiere, so sagte er, wie
Schwämme, Manteltiere und Seeanemonen, ähneln den Pflanzen mehr als den Tieren. Spätere Verfasser
machten daraus die grandiose Idee der scala naturae oder der Großen Stufenleiter des Lebendigen
(Lovejoy, 1936), die im 18. Jahrhundert unter den Anhängern von Leibniz das Aufkommen des
Evolutionsgedankens erleichterte.
Nicht so bei Aristoteles. Viele seiner sonstigen Ansichten waren mit der Evolution nicht zu vereinbaren.
Die Bewegung in der organischen Welt (von der Konzeption über die Geburt bis zum Tod) führt nicht zu
einem permanenten Wandel, sondern lediglich zu einer einem Fließgleichgewicht vergleichbaren
Kontinuität. Auf diese Weise sind Konstanz und Fortdauer vereinbar mit Bewegung und mit der
Vergänglichkeit von Individuen und individuellen Erscheinungen.
Als Naturbeobachter fand Aristoteles überall genau abgegrenzte Arten, gleichbleibende und sich nicht
ändernde Arten und, trotz des Gewichts, das er auf die Kontinuität der Natur legte, mußte diese
Beständigkeit der Arten und ihrer Formen (eide) ewig sein. Aristoteles war nicht nur kein Evolutionist, es
fiel ihm tatsächlich auch außerordentlich schwer, sich jegliche Art von Anfang vorzustellen. Für ihn war
die natürliche Ordnung ewig und unveränderlich, und er hätte sich vermutlich ohne das geringste Zögern
Huttons Satz angeschlossen: „Keine Spur eines Anfangs – keine Aussicht auf ein Ende!"
Es muß an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, daß die unilineare Stufenleiter,, die
Aristoteles in der Welt sah, ein strikt statisches Konzept war. Wiederholt lehnte er die „Evolutionstheorie
des Empedokles ab. Es sei Ordnung in der Natur, und alles in der Natur habe seinen Zweck. Er erklärte
unmißverständlich {Gen. An. 2.1.731b35), der Mensch wie auch Tier- und Pflanzengattungen seien ewig;
sie könnten weder verschwinden, noch seien sie geschaffen worden. Der Gedanke, das Universum könne
sich aus einem anfänglichen Chaos entwickelt haben, oder höhere Organismen könnten aus niederen
hervorgegangen sein, war Aristoteles völlig fremd. Um es zu wiederholen: Aristoteles war gegen jede Art
von Evolution. Die Biologen, einschließlich Darwins, haben immer eine große Bewunderung für
Aristoteles gehegt, aber sie mußten auch mit Bedauern zugeben, daß sie ihn nicht zu den Evolutionisten
zählen konnten. Diese Einstellung des Aristoteles gegen den Evolutionsgedanken war für die Entwicklung
während der darauffolgenden zweitausend Jahre von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, welch
gewaltigen Einfluß Aristoteles während jenes Zeitraums ausübte.
Von den nacharistotelischen Denkern werden die Epikureer gelegentlich als potentielle Evolutionisten
erwähnt. Diese Interpretation ist falsch. Zugegeben, im Gegensatz zu Aristoteles waren sie tatsächlich an
Ursprüngen interessiert. In dem Lehrgedicht des Lukrez „Über die Natur der Dinge" wird die spontane
Entstehung aller Arten von Geschöpfen, sogar die des Menschen, in einem weit zurückliegenden goldenen
Zeitalter postuliert (Bailey, 1928; de Witt, 1954), doch jede evolutionäre Veränderung lehnt er resolut ab:
Denn jedes Ding hat seinen eigenen Wachstumsprozeß;
Alle müssen ihre wechselseitigen Verschiedenheiten bewahren,
Beherrscht von der Natur unumstößlichem Gesetz.
Er stellte sich die Erde so gewaltig in ihrer Schöpferkraft vor, daß sie nicht nur lebensfähige Kreaturen,
sondern auch Monster und Schwächlinge erzeugte, die nicht überleben konnten und ausgemerzt wurden.
Dieser Beseitigungsprozeß ist gelegentlich als eine frühe Theorie der natürlichen Auslese bezeichnet
worden, was aber, wie wir noch sehen werden, irreführend ist.
So war es also gegen Ende des klassischen Zeitalters den Denkern noch nicht gelungen, sich von der
Vorstellung einer entweder völlig statischen oder in einem Fließgleichgewicht befindlichen Welt zu
befreien. Sie befaßten sich bestenfalls mit den Ursprüngen.
Eine geschichtliche Veränderung in der organischen Welt, organische Evolution, lag völlig außerhalb
der Begriffsstruktur des Zeitalters.
Viele Historiker haben Überlegungen darüber angestellt, warum die Griechen mit der Begründung des
Evolutionismus so erfolglos waren. Wir haben alle diese Gründe bereits berührt: Da war das Fehlen des
Zeitbegriffes; und wenn es eine Zeitvorstellung gab, so die einer unwandelbaren Ewigkeit oder eines
fortwährenden zyklischen Wandels, der immer wieder zu demselben Anfang zurückkehrte. Da war die
Vorstellung von einem vollkommenen Kosmos, und da war der Essentialismus, ganz und gar unvereinbar
mit einer Vorstellung von Variation oder Veränderung. Alle diese Lehren mußten an Kraft verlieren oder
zerbrochen werden, bevor es möglich war, sich Evolution vorzustellen. Und dennoch legten gerade die
Griechen in einer Hinsicht einen Grundstein der Evolutionsbiologie, und mehr als jeder andere war
Aristoteles dafür verantwortlich: Die Evolution kann, wie wir heute wissen, nur mittels indirekter Beweise
abgeleitet werden, wie sie uns die Naturgeschichte liefert; und es war Aristoteles, der die Naturgeschichte
begründete.
Der Einfluß des Christentums
Während des Niedergangs des Römischen Reiches übernahm eine neue Ideologie die Führung des
abendländischen Denkens, das Christentum. Sein Einfluß, wie auch der Einfluß der mächtigen kirchlichen
Hierarchie, können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie führten eine grundsätzlich andere
Geisteshaltung ein und schafften die Freiheit des Denkens ab. Man konnte nicht mehr länger denken und
spekulieren, wie es einem gefiel. Nunmehr war das Wort Gottes der Maßstab aller Dinge, und da dieses
Wort in der Heiligen Schrift offenbart war, wurde sie zum Maßstab aller Dinge. An die Stelle einer
zeitlosen Ewigkeit trat in der christlichen und der jüdischen Religion der Glaube an einen allmächtigen
Urheber aller Dinge, der die Welt aus nichts geschaffen hatte und sie irgendwann, am Tag des Jüngsten
Gerichts, abrupt beenden würde. Die Erschaffung der Erde durch Gott nahm sechs Tage in Anspruch, was
für alle Arten von Ursprüngen ausreichte, nicht aber für irgendwelche Evolution. Und auch nach der
Schöpfung war keine Zeit für Evolution gewesen, hatte man doch auf der Grundlage der in der Bibel
genannten Genealogien ausgerechnet, daß die Welt erst vor relativ kurzer Zeit, nämlich erst 4000 v. Chr.
geschaffen worden war. Und doch finden sich im Alten Testament viele Anspielungen auf lineare
Abfolgen (etwa in den sechs Schöpfungstagen), die als Grundlage für das Evolutionsdenken eigentlich
besser geeignet waren als die konstante wie auch die zyklische Welt der Griechen.
Die frühen Kirchenväter konnten es sich leisten, bei der Auslegung der Bibel relativ liberal zu sein, denn
da jedermann ein überzeugter Christ war, bedeuteten Ketzereien keine Gefahr. Ebensowenig gab es eine
Wissenschaft, die eine strengere Einstellung notwendig gemacht haben könnte. Der Heilige Augustinus
(Gilson, 1960) zum Beispiel erkannte zwar die Heilige Schrift als einzige Autorität an, doch war seine
Interpretation der Schöpfung in gewissem Maße allegorisch. Seiner Ansicht nach wurden zu Anbeginn
nicht nur fertige Dinge geschaffen, sondern ein großer Teil von Gottes Schöpfung bestand darin, daß er der
Natur die Fähigkeit verlieh, Organismen zu produzieren. Deren Wesenheiten, deren „naturae" wurden in
der Tat am Anfang geschaffen, aber sie traten häufig erst viel später auf oder wurden erst viel später ins
Leben gerufen. Alle Bestandteile der Natur, Land oder Wasser, haben die Fähigkeit, etwas Neues
hervorzubringen, sei es nun unbelebt oder lebendig. Damit dürfte die generatio spontanea für die
Gläubigen kein Problem sein; sie kann jederzeit auftreten.
Die tausend Jahre nach der Gründung des Christentums waren eine Periode deprimierenden geistigen
Stillstands. Kennzeichnend für die scholastischen Universitäten waren ihre Versuche, durch legalistische,
deduzierende Argumente zur Wahrheit zu gelangen. Aber die langen, sich endlos hinziehenden
Kontroversen, die die Folge dieser Methode waren, waren zum Scheitern verurteilt. Das Wiedererwachen
aus dieser Starre kam aus einer ganz anderen Richtung, war das Resultat eines neu auflebenden Interesses
an der Natur, einer Wiedergeburt der Naturgeschichte, wie aus den Arbeiten Friedrichs II und des Albertus
Magnus deutlich wird (siehe Kapitel 4). Ob Aristoteles-Anhänger oder nicht, die katholischen Gelehrten
des Mittelalters behielten, trotz häufiger Bezugnahme auf eine Stufenleiter des Lebendigen oder eine große
Hierarchie der Erscheinungsformen der Welt, den Glauben an die absolute Unveränderlichkeit aller Arten
bei.
Vielleicht das wichtigste Ereignis in der Zeit der Scholastik war eine Revolte der scholastischen
Philosophen im eigenen Lager. Es bildete sich eine Richtung heraus, die die Grundlehren des
Essentialismus ablehnte, ihre Vertreter wurden später als Nominalisten bezeichnet [3]. Ihrer Ansicht nach
gab es keine Essenzen; ja tatsächlich verfügen wir über nicht mehr als Namen, mit denen Gruppen von
Objekten belegt werden. Sobald wir den Namen „Stuhl" haben, können wir alle Gegenstände
zusammenfassen, die unter die Definition Stuhl fallen, ob es sich dabei nun um Eßzimmerstühle,
Gartenstühle oder Polsterstühle handelt. Die Angriffe der Nominalisten gegen den Essentialismus (genannt
Realismus) zeigten die erste Erschütterung des Essentialismus an. Die Überlegungen der mit der induktiven
Methoden arbeitenden Philosophen und der englischen Empiriker von Bacon an hatten nominalistische
Obertöne, und es ist möglich, daß hier eine ideologische Kontinuität vorliegt. Tatsächlich war der
Nominalismus vielleicht eine erste Stufe des Populationsdenkens (siehe Kapitel 2).
Die Reformation warf das Evolutionsdenken eindeutig wieder zurück, da das Auftreten des
Protestantismus die Autorität der Bibel stärkte. In der Tat führte es zu einer völlig buchstabengetreuen
Auslegung „des Wortes", das heißt, zum Fundamentalismus. Liberale Interpretationen, wie die des
Heiligen Augustinus, wurden nunmehr kompromißlos abgelehnt.
Sonderbarerweise brachte die sogenannte wissenschaftliche Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts,
eine weitgehend auf die exakten Wissenschaften beschränkte Bewegung, keinerlei Veränderung dieser
Einstellung gegenüber dem Schöpfungsglauben mit sich. Alle führenden Physiker und Mathematiker,
Descartes, Huyghens, Boyle und Newton, glaubten an einen persönlichen Gott und waren strenge
Anhänger des Schöpfungsglaubens. Die Mechanisierung des Weltbildes (Dijksterhuis, 1961), die
beherrschende Umwälzung in der Vorstellungswelt des Zeitalters, konnte auf die Evolution verzichten – ja,
sie konnte sie nicht einmal dulden. Eine stabile, in einem einzigen Schöpfungsakt geschaffene und durch
allgemeine Gesetze erhaltene Welt war für alle, die vom Essentialismus durchdrungen waren und an ein
vollkommenes Universum glaubten, durchaus plausibel.
Die Philosophie war in gleicher Weise reaktionär. Man findet keine Spur echten evolutionären Denkens
in den Schriften von Bacon, Descartes oder Spinoza. Descartes betonte, wenn man Gottes Allmacht
bedenke, so könne er nur Vollkommenheit geschaffen haben, und nichts, das von Anfang an perfekt
gewesen sei, könne sich entwickeln [4]. Seltsam genug war es die Theologie, in Form der Naturtheologie,
die in weit stärkerem Maße als die Philosophie dem Evolutionsdenken den Weg bereitete.
Das Entstehen des Evolutionsdenkens
In gewisser Weise steht die Evolution im Widerspruch zum gesunden Menschenverstand. Die
Nachkommen eines jeden Lebewesens entwickeln sich immer wieder zu dem Elterntypus. Eine Katze kann
immer nur Katzen gebären. Gewiß hat es, bevor sich das Evolutionsdenken durchsetzte, Theorien der
plötzlichen Veränderungen gegeben. Zum Beispiel gab es den Glauben an die Urzeugung oder den Begriff
der Heterogonie, die Annahme, daß die Samen einer Pflanzenart, etwa des Weizens, gelegentlich Pflanzen
einer anderen Art hervorbringen könnten, etwa Roggen [5]. Aber beides waren Entstehungstheorien, und
hatten nichts mit Evolution zu tun. Es bedurfte einer echten geistigen Revolution, bevor man Evolution
auch nur denken konnte.
Das größte Hindernis für eine Evolutionstheorie war: Evolution läßt sich nicht unmittelbar beobachten
wie physikalische Erscheinungen, etwa ein fallender Stein oder kochendes Wasser oder irgendein anderer
Vorgang von kurzer Dauer (Sekunden, Minuten oder Stunden), in der die Veränderungen sorgfältig
aufgezeichnet werden können. Stattdessen läßt sich auf Evolution lediglich anhand von Indizien folgern.
Doch um Schlüsse ziehen zu können, muß man zuerst über ein angemessenes begriffliches Gerüst
verfügen. Fossilien, Fakten im Zusammenhang mit Variation oder Vererbung und auch die Existenz einer
natürlichen Hierarchie der Lebewesen dienen erst dann als Beweise, wenn das Vorkommen von Evolution
postuliert worden ist. Doch die Weltanschauungen, die von den Griechen bis ins 18. Jahrhundert
maßgebend waren, waren mit dem Evolutionsdenken unvereinbar oder ihm zumindest alles andere als
förderlich. Daher war der Abbau der vor Übernahme des Evolutionsdenkens im Abendland
vorherrschenden Weltsicht eine unerläßliche Voraussetzung für das Aufstellen einer Evolutionstheorie.
Diese Weltanschauung bestand vor allem aus zwei Thesen: Erstens glaubte man, das Universum sei in
allen seinen Einzelheiten von einem klugen Schöpfer entworfen worden. Diese Überzeugung war (ebenso
wie die zweite Hauptthese, die Vorstellung einer statischen, unveränderlichen Welt von kurzer Dauer)
gegen Ende des Mittelalters so fest im abendländischen Geist verwurzelt, daß es völlig unvorstellbar
schien, sie könnten jemals daraus vertrieben werden. Und doch trat gerade dies, Schritt für Schritt, während
des 17., 18. und frühen 19. Jahrhunderts ein. Welches waren die Ursachen dieser erstaunlichen geistigen
Revolution? War sie das Resultat der wissenschaftlichen Forschung oder eher durch einen alles
durchdringenden Wandel im kulturellen und geistigen Milieu bedingt? Offenbar waren beide Faktoren
wichtig.
Vom 14. Jahrhundert an scheint im Abendland ein neuer Geist erwacht zu sein. Das Zeitalter der
Seereisen, die Wiederentdeckung der Gedankenwelt der Klassik, die Reformation, die neuen Philosophien
von Bacon und Descartes, das Entstehen einer weltlichen Literatur und schließlich die sogenannte
wissenschaftliche Revolution, d. h. die Begründung der modernen Naturwissenschaft – sie alle hatten eine
Schwächung der bis dahin gültigen Überzeugungen zur Folge. Je mehr die wissenschaftliche Revolution in
den exakten Wissenschaften die Notwendigkeit einer rationalen Behandlung natürlicher Phänomene
betonte, um so weniger akzeptabel wurden übernatürliche Erklärungen.
Die Veränderungen waren jedoch nicht nur auf die Naturwissenschaften beschränkt. Es gärte überall. Im
späten 17. und 18. Jahrhundert begann sich eine Geschichtsvorstellung herauszubilden, angeregt zweifellos
durch das Wiederaufleben der griechischen Tradition, das Studium der griechischen Klassiker und das neue
Interesse an der klassischen griechischen Architektur und Kultur. Die Seereisen machten die Welt des
Abendlandes mit der Existenz des primitiven Menschen bekannt, und plötzlich fragte man sich: Auf
welche Weise hat sich der zivilisierte Mensch aus dem frühen primitiven Zustand entwickelt? Dies führte
dazu, daß zum ersten Mal Fragen gestellt wurden wie die, mit denen sich heute die
Gesellschaftswissenschaften befassen. Der Italiener Gianbattista Vico schrieb die grandiose, wegbereitende
Arbeit Scienzia Nova (1725) über die Philosophie der Geschichte (Croce, 1913; Berlin, 1960). Für ihn
waren die verschiedenen Zeitalter der Geschichte des Menschen nicht verschiedene Aspekte einer im
wesentlichen gleichbleibenden Szenerie, sondern aufeinanderfolgende Phasen eines fortlaufenden
Prozesses, eines zwangsläufig evolutiven Prozesses.
Diese allmähliche Befreiung aus der seelischen und geistigen Zwangsjacke der Kirche war von der
Entwicklung einer weltlichen Literatur begleitet. Verbotene Gedanken wurden in Romane eingeschleust,
und in verschiedenen utopischen Werken, von denen im 16., 17. und 18. Jahrhundert viele veröffentlicht
wurden, experimentierten die Verfasser mit neuen Theorien über die Entstehung der Erde, des Menschen
oder der menschlichen Gesellschaft.
Zwei dieser Romane sind als Illustrationen der neuen Denkweise von besonderer Wichtigkeit. Der eine
ist Bernard de Fontenelles Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), in dem die kartesianische
Wirbeltheorie konsequent und radikal zur Entwicklung einer Theorie über die Entstehung der Welt benutzt
wird. Fontenelle postuliert die Existenz von Lebewesen auf anderen Planeten und auf dem Mond und
schließt aus der vermuteten Temperatur und den ebenfalls vermuteten atmosphärischen Bedingungen
dieser Himmelskörper auf die wahrscheinlichen Charakteristika dieser Wesen. Neben unserem
Sonnensystem wird eine unendliche Zahl anderer Sonnensysteme und die Unendlichkeit des Raumes
postuliert. Und – obgleich dies nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde – wenn der Raum unendlich ist,
warum dann nicht auch die Zeit?
Fontenelles Pluralité des mondes war ein rein literarisches Werk, allerdings mit starkem metaphysischen
Akzent. Anders das zweite Prosawerk, das de Maillet (1748) unter dem Titel Telliamed veröffentlichte und
das sich auf das solide Fundament der langjährigen geologischen Studien seines Verfassers gründete. Wie
im Untertitel erläutert, gibt der Autor dieses Werkes vor, er habe „Unterhaltungen zwischen einem
indischen Philosophen und einem französischen Missionar über das Kleinerwerden des Meeres"
aufgezeichnet. Es ist ein außergewöhnlich phantasievolles Werk, in dem dem indischen Philosophen die
kühnsten, heterodoxesten Ideen in den Mund gelegt werden. Das Werk ist in drei Unterhaltungen
aufgeteilt, von denen sich die beiden ersten fast ausschließlich mit geologischen Fragen befassen; sie sind
in vielerlei Hinsicht bemerkenswert fortschrittlich für die Epoche und wurden in der Geschichte der
Geologie vielleicht viel zu stark vernachlässigt. In der dritten Unterhaltung, der längsten der drei, wird eine
Menge über den Ursprung des Lebens und die Metamorphose von Lebewesen gesagt.
Maillets wichtigste geologische These besagt, die Erde sei ursprünglich völlig von Wasser bedeckt
gewesen, aus dem sie nun allmählich emportauche. Dieser Prozeß habe sich über Millionen von Jahren
erstreckt. Zu Beginn habe es lediglich Wasserpflanzen und Wassertiere gegeben, von denen sich einige, als
sie das Wasser verließen, zu ihren auf dem Land lebenden Gegenstücken entwickelten. Die Erde, wie wir
sie heute sehen, sei nicht das Ergebnis eines in kürzester Zeit erfolgten Schöpfungsaktes, sondern sei
Schritt für Schritt durch natürliche Prozesse gestaltet worden. Die Luft sei beständig von den „Samen" von
Organismen aller Art erfüllt, die zum Leben erweckt werden, wann immer die Umweltbedingungen dafür
günstig sind. Bestehende Arten würden umgebildet, wann immer neu entstehende Bedingungen eine
derartige Umgestaltung erforderlich machten. Zum Beispiel könnten aus fliegenden Fischen Vögel werden,
und menschliche Geschöpfe hätten zuvor in den Meeren in der Gestalt von Meerjungfrauen und
Wassermännern existiert. Ja, alle auf dem Land lebenden Geschöpfe seien nichts anderes als umgestaltete
Wasserbewohner. Da es sich immer nur um die Umgestaltung eines zuvor bestehenden Organismus zu
einer neuen Form handelte, bestand bei de Maillet nicht die Vorstellung einer echten Evolution.
Nichtsdestoweniger ist Telliamed ein wichtiges Werk, zeigt es doch, in welch hohem Grade sich die
Denker des 18. Jahrhunderts von den Beschränkungen früherer Jahrhunderte befreit hatten.
Telliamed wurde erst 1748 veröffentlicht, obgleich es bereits um etwa 1715 geschrieben worden war,
also mehr oder weniger dreißig Jahre nach Fontenelles Werk (1686). In beiden Werken spürt man den
Widerhall des tiefen Eindrucks, den die Schriften von Descartes, Newton und Leibniz wie auch
wissenschaftliche Entdeckungen wie die Leeuwenhoeks und anderer Naturforscher, auf die Intellektuellen
dieser Epoche gemacht hatten. Zweifellos ist der Zeitgeist stark durch die Naturwissenschaften geprägt
worden.
Befassen wir uns nun etwas näher mit den wissenschaftlichen Fortschritten, die für diesen tiefgreifenden
Wandel im abendländischen Geist verantwortlich waren. Es gab im 16., 17. und 18. Jahrhundert drei mehr
oder weniger voneinander unabhängige Strömungen wissenschaftlichen Fortschritts, die, wenn auch auf
sehr unterschiedliche Weise, dazu beitrugen, der Evolutionstheorie den Weg zu bereiten: die exakten
Wissenschaften, die Geologie und die Naturgeschichte (im weiteren Sinne).
Die Rolle der Kosmologie
Die wissenschaftliche Revolution in den exakten Wissenschaften (von Kopernikus und Galilei bis zu
Newton und Laplace) legte besonderes Gewicht auf allgemeine, grundlegende Gesetze, wie das Gesetz der
Schwerkraft, die für alle physikalischen Phänomene gelten und nicht nur die Bewegungen von Körpern,
einschließlich Sonnen und Planeten erklären, sondern auch funktionale Erscheinungen in lebenden
Organismen. Boyle drückte dies folgendermaßen aus:
Diese Philosophie… lehrt, daß Gott in der Tat der Materie Bewegung verliehen hat. Daß er aber am
Anfang die verschiedenen Bewegungen ihrer Bestandteile in der Weise lenkte, daß sie die Welt
zustandebringen, die sie seinen Plänen nach bilden sollten, und daß er die Regeln der Bewegung der
körperlichen Dinge und jene Ordnung unter ihnen aufstellte, die wir die Naturgesetze nennen. Somit ist das
Universum in Urzeiten von Gott gebildet und sind die Gesetze der Bewegung festgelegt worden und wird
alles durch diesen beständigen Zusammenfluß, nämlich die allgemeine Vorsehung, aufrechterhalten. Die
gleiche Philosophie lehrt, daß die Erscheinungen der Welt auf physikalischem Wege durch die
mechanischen Eigenschaften der einzelnen Materieteile erzeugt werden und daß sie entsprechend
mechanischen Gesetzen aufeinander einwirken (Boyle, 1738, S. 187).
An die Stelle der weitverbreiteten griechischen Vorstellung des Universums als eines Organismus (mit
einer Seele) trat die Auffassung des Universums als Maschine, die durch eine Reihe von Gesetzen in Gang
gehalten wird. Diese neue Denkweise, als die Mechanisierung des Weltbildes bezeichnet (Dijksterhuis,
1961), durchdrang nicht nur die Physik und die ihr verwandten Naturwissenschaften, sondern auch die
Physiologie und andere Zweige der Biologie und erforderte eine mechanische Interpretation aller
Naturerscheinungen. Wenn sich zum Beispiel die Planeten auf ihren Umlaufbahnen so bewegten, wie es
die Gesetze der Planetenbewegung vorschrieben, so war kein unaufhörliches Eingreifen des Schöpfers
mehr nötig. Zwar war er immer noch die erste Ursache für alles, was besteht, doch waren alle
Naturvorgänge nach dem Schöpfungsakt durch „sekundäre Ursachen", zum Beispiel die allgemeinen
physikalischen Gesetze, geregelt. Ziel der Wissenschaft wurde es, alle Naturerscheinungen durch derartige
Gesetze zu erklären und bisher unentdeckte Gesetze zu finden.
Von besonderem Erfolg war diese neue Denkweise in der Kosmologie. Das Universum der Bibel und
sogar das der griechischen Astronomen wie Ptolemäus war von sehr begrenzter Größe. Die Entdeckung des
Teleskops setzte dem ein Ende. Je stärker die Teleskope wurden, desto mehr schien sich die Welt
auszudehnen, entdeckte man doch niemals ihre Grenzen. Die Vorstellung von der Unendlichkeit des
Universums setzte sich immer mehr durch, und dieser Prozeß hat sich geradewegs bis zur modernen
Astronomie fortgesetzt. Je mehr sich der Mensch an den Gedanken der Unendlichkeit des Raumes zu
gewöhnen begann, um so häufiger wird sich ihm die Frage aufgedrängt haben, ob es nicht auch eine
Unendlichkeit der Zeit gäbe.
Mit der Zeit nahm nicht nur die Vorstellung Gestalt an, daß das Universum in Raum und Zeit unendlich
sei, es tauchte schließlich auch der Gedanke auf, es sei nicht einmal beständig, sondern in
ununterbrochenem Wandel begriffen. Dennoch durfte nichts, was geschah, zu den Berichten in der Bibel
im Widerspruch stehen. In der Tat mußte jede neue Erkenntnis der Wissenschaft mit der mosaischen
Überlieferung in Einklang gebracht werden. Der erste, der in England eine revolutionäre geologische
Abhandlung veröffentlichte, war der Geistliche Thomas Burnet mit seiner Sacred Theory of the Earth
(1681), in der er die ganze Geschichte der Erde von der Schöpfung bis zur Gegenwart erklärte. Das große
Ereignis war die Sintflut, die seiner Interpretation nach durch ein Aufreißen der äußeren Erdkruste und den
Durchbruch unterirdischer Wasser zur Oberfläche verursacht worden war. Alle diese Geschehnisse,
einschließlich sogar der letzten großen Feuersbrunst am Jüngsten Tag hatten natürliche Ursachen, die Gott
zum Zeitpunkt der Schöpfung in Gang gesetzt hatte. Ein anderer Autor, John Woodward verhielt sich in
seinem Essay towards a Natural History of the Earth (1695) weit traditioneller: Die Sintflut war durch ein
direktes Eingreifen des Herrn ausgelöst worden, seither aber ist die Welt wieder mehr oder weniger
stationär. Alle Fossilien sind Produkte der Sintflut und der Beweis dafür, daß sie tatsächlich stattgefunden
hat. Sie bestätigen somit wiederum den Bericht der Bibel. Es war eine sehr tröstliche und beruhigende
Auslegung. William Whiston, ein dritter Autor, der sich mit der Geschichte der Erde befaßte, versuchte den
Bibelbericht im Sinne der Newtonschen Physik zu interpretieren. Die interessanteste These in seiner New
Theory of the Earth (1696) war die, Noahs Sintflut sei durch die allzu große Annäherung eines Planeten
ausgelöst worden.
Wichtig an allen drei Erklärungen war das starke Bestreben, für die Ereignisse in der Erdgeschichte eine
„natürliche" Erklärung zu finden, ohne sich allzu weit vom Bibeltext zu entfernen (Greene, 1959, S. 15,
39). Dies war die erste Bresche, die geschlagen wurde, und seit jener Zeit grübelten Philosophen und
Kosmologen immer ungehinderter und kühner über die Geschichte der Erde, der Sonne und der Sterne
nach. Der Gedanke, das Universum als Ganzes habe eine Entwicklung durchgemacht, trat jedoch
überraschend spät auf. Er wurde zum ersten Mal logisch und konsequent von dem berühmten deutschen
Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) in einer frühen Veröffentlichung mit dem Titel Allgemeine
Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) entwickelt. Hier stellte Kant systematisch die uns heute
vertraute Idee dar, daß die Welt ihren Anfang in einem chaotischen universellen Nebel genommen habe,
der sich zu drehen begann und schließlich die Galaxien, Sonnen und Planeten entstehen ließ. Besonders
erstaunlich ist an Kants Darstellung die allmähliche Entwicklung des gesamten Prozesses: „Die
Unendlichkeit der künftigen Zeitfolge, womit die Ewigkeit unerschöpflich ist, wird alle Räume der
Gegenwart Gottes ganz und gar beleben, und in die Regelmäßigkeit, die der Trefflichkeit seines Entwurfes
gemäß ist, nach und nach versetzen… Die Schöpfung ist niemals vollendet. Sie hat zwar einmal
angefangen, aber sie wird niemals aufhören." Es werden immer neue Sterne und Galaxien entstehen.
Das war keine statische Welt mehr, sondern eine dynamische, in fortwährender Entwicklung begriffene
Welt, die nur entfernt von sekundären Ursachen geregelt wurde ein wahrhaft ketzerischer Gedanke. Mit
dieser revolutionären neuen Idee „fegte Kant absichtlich Newtons sorgfältige Unterscheidung zwischen der
Schöpfung und der Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Ordnung der Natur beiseite: wir brauchen nur
eine einzige Schöpfung zu fordern, den fortschreitenden Sieg der Ordnung über das Chaos während einer
unendlichen Zeit" (Toulmin und Goodfield, 1965, S. 133).
Kant ging weit über Buffons Schätzung hinaus, derzufolge die Erde 168000 Jahre oder sogar eine halbe
Million Jahre alt sein könne. Er dachte zweifellos in Größenordnungen des Unendlichen, und trug damit zu
einem Wandel im Denken der Epoche bei, der sich später in den Schriften von Hutton und Lamarck
widerspiegelte, obgleich vermutlich keiner der beiden unmittelbar Kants Schrift kannte.
Die Rolle der Geologie
Noch tiefgreifender als in der Kosmologie änderte sich die Denkweise in der Geologie [6]. Im 18.
Jahrhundert wurden sich die Erforscher der Natur zum ersten Mal in ganzem Maße der ständigen
Veränderungen bewußt, die die Oberfläche der Erde durchmacht und in der Vergangenheit durchgemacht
hat. Eine neue Wissenschaft begann sich herauszubilden, die Geologie, deren vorrangigste Aufgabe
historischer Art war: nämlich die Rekonstruktion der Abfolge von Ereignissen, die im Verlauf der Zeit auf
der Erde stattgefunden haben. Das Beweismaterial, aufgrund dessen man zu der Entdeckung gelangte, daß
die Erdoberfläche nicht immer so gewesen war, wie sie heute ist, ja, daß die Erde eine Geschichte hat, kam
aus mehreren Quellen.
Eine dieser Quellen war die Entdeckung erloschener Vulkane im Zentralmassiv Frankreichs (im Distrikt
Puy de Dôme). Diese Entdeckung trug zu der Einsicht bei, daß Basalt, ein häufig vorkommendes Gestein,
nichts anderes ist als alte Lava, ein Relikt alter vulkanischer Extrusionen, daß Schichten solcher Lava
weitverbreitet sind und daß die unteren Schichten sehr alt sein müssen.
Ungefähr zur gleichen Zeit begriff man zum ersten Mal, daß viele, ja tatsächlich die meisten
geologischen Formationen sedimentäre Ablagerungen sind [7]. Als man diese Sedimentschichten sorgfältig
untersuchte, stellte man außerdem fest, daß sie eine ungeheure Dicke haben, oft nicht weniger als 3000 m,
gelegentlich sogar mehr als 30000 m. Der Schock, den diese Entdeckung hervorrief, war gewaltig, ließ sie
doch keinen anderen Schluß zu als den, daß die Erde außerordentlich alt ist, da es enormer Zeiträume
bedurft haben mußte, Sedimentschichten von solcher Dicke abzulagern. Wie man weiter entdeckte, waren
weder die vulkanischen, noch die Sedimentgesteine nach ihrer Ablagerung ungestört geblieben. Sie wurden
anschließend von Wasser ausgewaschen, das Täler in sie hineinschnitt, manchmal tiefe Täler. Mehr noch,
viele Sedimentschichten waren seither noch gefaltet worden, nicht selten höchst gewaltsam; in einigen
Fällen waren die Schichten sogar völlig umgestülpt worden. All dies gilt heute so sehr als
selbstverständlich, daß es schwerfällt, sich vorzustellen, wie revolutionär diese Ansichten im 17. und 18.
Jahrhundert wirken mußten und in wie weiten Kreisen man ihnen zunächst ablehnend gegenüberstand.
Eine Zeitlang gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen geologischen Schulen über
die Frage, ob nun die Kräfte des Wassers (Neptunismus) oder des Feuers (Vulkanismus) mehr zur
gegenwärtigen Gestalt der Erdkruste beigetragen hatten. Mit der Zeit teilte man jeder dieser gestaltenden
Kräfte – Vulkanismus, Erosion (plus Ablagerung) und Aufwerfen von Bergen (Faltung) – die ihr
gebührende, richtige Bedeutung zu. Währenddessen nahm das Verständnis der Kräfte, die auf die Erdkruste
einwirken, weiterhin zu. Höchst wichtige Beiträge (etwa die Theorie der Plattentektonik) wurden noch vor
kurzer Zeit, in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts, geleistet. Welches auch immer die verschiedenen
geologischen Entdeckungen im einzelnen waren, sie alle hatten eins gemeinsam: sie verstärkten
wechselseitig die Erkenntnis, daß die Erde ungeheuer alt sein mußte (Albritton, 1980). Damit war ein
Zusammenstoß mit allen Verfechtern einer wortgetreuen Auslegung der Bibel unvermeidlich.
Die Kirche, die mehr oder weniger offiziell das Jahr 4000 v. Chr. als Schöpfungsdatum akzeptiert hatte,
betrachtete jedes substantielle Abweichen von diesem Datum als Ketzerei. Dennoch brachte Buffon in
seinem Werk Les époques de la nature (1779) den Mut auf, das Alter der Erde mit mindestens 168 000
Jahren zu berechnen (Roger, 1962). (Das Alter, das er der Erde nach unveröffentlichten privaten
Schätzwerten zubilligte, betrug eine halbe Million Jahre, also erheblich mehr.) Buffon machte sich viele
Gedanken über diese Probleme und scheint der Erste gewesen zu sein, der eine rationale und in sich
folgerichtige Vorstellung von der beschichte der Erde hatte. Buffon unterschied in Les époques de la nature
(1779; es war die stark erweiterte Version eines etwa 25 Jahre zuvor erschienenen Essays) sieben
„Epochen": Die erste, in der die Erde und die Planeten gebildet wurden; die zweite, in der die großen
Gebirgszüge entstanden; die dritte, als das Festland von Wasser bedeckt war; die vierte, in der das Wasser
zurückwich und die Vulkantätigkeit einsetzte; die fünfte (eine sehr interessante Epoche), als Elefanten und
tropische Tiere im Norden lebten (Man hatte im Norden die Fossilien dieser tropischen Tiere gefunden,
und Buffon konnte sich nicht vorstellen, daß sie jemals in einer anderen als tropischen Klimazone gelebt
haben konnten); die sechste, in der die Kontinente voneinander getrennt wurden (Buffon postulierte dies,
da er deutlich die Ähnlichkeit der nordamerikanischen Fauna mit der Europas und Asiens erkannte. Da
diese Kontinente heute jedoch durch Wasser voneinander getrennt sind, kam er zu dem Schluß, sie müßten
früher miteinander in Verbindung gestanden haben); und schließlich, die siebente Epoche, in der der
Mensch auftrat. Dies war die letzte Epoche, eine in der Tat so kurze Zeit zurückliegende Periode, daß der
Mensch nicht im Fossilienmaterial erscheint. Biologische Fakten spielten bei Buffons Rekonstruktion der
Geschichte der Erde eine große Rolle. Wir müssen uns nun den biologischen Entdeckungen zuwenden, die
den Weg für das Evolutionsdenken bereiteten.
Die Rolle der Naturgeschichte
Wer seine Aufmerksamkeit hauptsächlich oder ausschließlich den Entdeckungen in den exakten
Wissenschaften zuwendet, neigt dazu, die veränderte Geisteshaltung des 17. und 18. Jahrhunderts
ausschließlich der Mechanisierung des Weltbildes zuzuschreiben. Dabei wird die wichtige Rolle der
Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen der Naturgeschichte übersehen. Diese förderten eine Fülle
neuer Fakten zutage, die sich schließlich als unvereinbar mit der These eines einzigen Schöpfungsaktes
erwiesen. Daher ist alles? was zum Aufblühen der Naturgeschichte beitrug, Teil der Geschichte der
Evolutionsbiologie.
Am wichtigsten ist vermutlich einfach die Tatsache, daß man nach Ende des Mittelalters die Natur neu
entdeckte. Es gab immer mehr Autoren, die ihrem Entzücken über Blumen und Vögel Ausdruck verliehen.
Etwa ab 1520 begann eine Reihe glänzend illustrierter Werke über die in Süddeutschland und anderen
Teilen Europas heimischen Pflanzen zu erscheinen (siehe Kapitel 4). Damit wurde der Wunsch wach, ins
Freie hinauszugehen, nach diesen Pflanzen zu suchen und sogar neue, vorher noch nicht beschriebene oder
gezeichnete Exemplare zu entdecken. Ein ähnliches Interesse entwickelte sich für Vögel, Fische und
andere Geschöpfe der Natur. Dabei entdeckte man, daß die meisten westeuropäischen Arten weder in der
Bibel noch in den Schriften von Theophrast, Aristoteles oder Plinius erwähnt worden waren. Man begann
sich zu fragen: Was wissen wir eigentlich wirklich über die Welt, in der wir leben?
Die Bibel kannte lediglich die Fauna und Flora des Nahen Ostens, und die Rettung dieser begrenzten
Fauna in der Arche Noahs war vorstellbar. Doch im 14. und 15. Jahrhundert begannen die großen
Seereisen, die dann im 16., 17. und 18. Jahrhundert zu immer erstaunlicheren Entdeckungen führen sollten,
und die Glaubwürdigkeit der biblischen Darstellung wurde durch die Beschreibung völlig neuer Faunen in
Afrika, Ostindien, in beiden Teilen Amerikas und in Australien auf fatale Weise untergraben. Wie konnten
alle diese reichen Faunen in der Arche Platz gefunden haben? Wenn sich alle Tiere vom Berge Ararat (in
Armenien), aus dem angeblichen Landeplatz der Arche, über die Erde verbreitet hatten, warum war die
Fauna der ganzen Welt dann nicht einheitlich? Wie wurden die isolierten Kontinente Amerika und
Australien kolonisiert [8]? Die Fakten der Biogeographie stellten die Anhänger des Schöpfungsglaubens
vor einige unlösbare Dilemmata, und wurden schließlich für Darwin die überzeugendsten Belege für eine
Evolution (siehe Kapitel 10).
Neue Zweifel an der Glaubwürdigkeit der biblischen Darstellung wurden durch das ständig
anwachsende Wissen über Fossilien geweckt. Gewiß hatte man bereits im Altertum Fossilien gekannt.
Xenophanes von Kolophon (etwa um 500 v. Chr.) fand in Syrakus auf Sizilien in Gesteinsschichten aus
dem Tertiär versteinerte Fische und auf der Insel Malta Fossilien von im Meer lebenden Mollusken.
Bemerkenswert ist: er deutete sie nicht als Zeugen von Katastrophen in der Vergangenheit; er sah in ihnen
vielmehr das Resultat der allmählichen Verschiebung der Meeresspiegel, etwa wie Anaximander.
Aristoteles vertrat in seinem Werk Meteorologie ähnliche Ansichten. Als heftiger Gegner aller
Katastrophentheorien erklärte er die Fossilien ebenfalls als das Produkt langsamer Veränderungen in der
Höhe des Meeresspiegels. Trotzdem blieben zwei falsche Deutungen der Fossilien, die zum Teil auf
Aristoteles zurückgingen, bis zum 18. Jahrhundert lebendig.
Erstens war man weithin der Ansicht, Fossilien „wüchsen aus dem Felsen heraus", wie Kristalle etwa
oder Metallerze, und seien nichts anderes als ein Zufall der Natur, ein „lusus naturae". Entweder schrieb
man der Natur eine vis plastica zu, mit der sie fähig war, alle Arten von Gestalten in Fels zu formen. Oder
aber man erklärte die Fossilien damit, daß überall in der Natur „Keime" vorhanden seien, die sich entweder
in Urzeugungen oder als Fossilien in Felsen manifestierten. Derartige Ansichten wurden von zahlreichen
hervorragenden Autoren, wie Albertus Magnus, Mattioli, Falloppio, Agricola, Kircher, Gesner, Camerarius
und Tournefort, vertreten, ganz zu schweigen von unzähligen weniger gewichtigen Verfassern.
Als sich schließlich die Idee allgemein durchsetzte, daß Fossilien Relikte von Lebewesen aus früheren
Zeiten seien, blieb die vorherrschende Praxis dennoch eine wortgetreue Interpretation der Bibel; die
Fossilien wurden als Reste der von Noahs Sintflut ausgelöschten Geschöpfe interpretiert, insbesondere
durch Steno, Woodward und Scheuchzer. Zwar brachten Leonardo da Vinci, Fracastoro und andere
Pioniere zahlreiche Beweise dafür vor, daß nicht alle Fossilien aus derselben Zeit stammten; doch das
Dogma von der jungen Erde war lange Zeit hindurch zu mächtig, als daß sich die Theorie einer
Aufeinanderfolge distinkter Faunen hätte durchsetzen können.
Zwei Entwicklungen erschütterten schließlich die etwas einfältige Erklärung der Fossilien als
Überbleibsel der Sintflut. Die eine war die Entdeckung unbekannter und somit vermutlich ausgestorbener
Tiere und Pflanzen unter den Fossilien; die andere das Entstehen der Stratigraphie. Die Entdeckung
ausgestorbener Tiere stand nicht so sehr in Widerspruch zu der Bibel selbst als vielmehr zu der etwas
sonderbaren Vorstellung, die man im 17. und 18. Jahrhundert von Gott hatte. In Übereinstimmung mit dem
Prinzip der unbegrenzten Vielfalt, das von den meisten führenden Denkern der Epoche, insbesondere
jedoch von Leibniz verfochten wurde, hatte Gott in der Unbegrenztheit seines Geistes mit Sicherheit jedes
nur mögliche Geschöpf geschaffen. Gott in seiner Güte aber konnte unmöglich gestatten, daß eines seiner
Geschöpfe ausstarb. Die fossilen Überreste anscheinend ausgestorbener Lebewesen bildeten daher ein
echtes Dilemma, für das mehrere Lösungen vorgeschlagen wurden (siehe Kapitel 8 unter Lamarck).
Die zweite Schwierigkeit ergab sich aus der Entdeckung, daß die Fundstätten der Fossilien stratifiziert
sind und jede dieser Schichten ihre eigene deutlich verschiedene Fauna und Flora hat. Wenn man bedenkt,
daß Fossilien seit mehr als zweitausend Jahren bekannt waren, so verging bemerkenswert viel Zeit, bis man
in vollem Maße zu würdigen wußte, was dies bedeutete. Bereits Xenophanes hatte darauf hingewiesen,
man könne in verschiedenen Steinbrüchen möglicherweise verschiedene Fossilien finden, das heißt, in
verschiedenen Gesteinen könnten unterschiedliche Fossilien enthalten sein. Andere Autoren machten
ähnliche Bemerkungen. Doch solange man Versteinerungen als Artefakte der Natur oder Überbleibsel der
Sintflut ansah, wurden diese Beweise nicht zur Kenntnis genommen. Der rasche Fortschritt der
geologischen Forschung im 18. Jahrhundert machte schließlich ein weiteres derartiges Ignorieren
unmöglich. Zum Teil unabhängig voneinander, zum Teil sich gegenseitig anregend, gelangten zahlreiche
Autoren zu der Erkenntnis, daß die Gesteine in einer bestimmten Reihenfolge auftreten, daß die Mehrheit
von ihnen stratifiziert sind und daß bestimmte Schichten weitverbreitet vorkommen. Anfangs bestimmte
man die Schichten in erster Linie anhand petrographischer Merkmale (geschichtete Gesteine, Schiefer,
Kalkstein, Kreide usw.), doch bald entdeckten ein paar findige Pioniere, daß bestimmte Fossilien mit
bestimmten Schichten assoziiert waren. In mehreren Werken über die Geschichte der Geologie hat man
inzwischen der Arbeit von Autoren wie Steno, Lister, Woodward, Hooke, Holloway, Strachey, Arduino,
Lehmann, Füchsel, Werner, Michell, Bergmann, Soulavie, Walch und anderen die ihr gebührende
Anerkennung zukommen zu lassen versucht [9]. Leider gibt es keine gute vergleichende Geschichte dieser
frühen Phase der Stratigraphie. Die von den genannten Autoren veröffentlichten Beobachtungen sind
vereinzelt und unsystematisch. Daß aus der verstreuten Information über Fossilien und
Fossilienvorkommen eine Wissenschaft der Stratigraphie wurde, ist, darin besteht heute Übereinstimmung,
zwei Männern zu verdanken: dem englischen Geometer William Smith und dem französischen Zoologen
Georges Cuvier.
Smith, von Beruf Geometer und Ingenieur, arbeitete am Bau von Kanälen mit und suchte in Bergwerken
den Verlauf kohle- und erzhaltiger Flöze zu verfolgen. Dabei entdeckte er, daß man geologische Schichten
anhand der in ihnen vorkommenden Versteinerungen bestimmen kann. Manchmal ließen sich solche
Schichten Hunderte von Kilometern weit verfolgen, sogar dann, wenn die Lithologie sich änderte. Smith
entwickelte diese Prinzipien in den Jahren 1791 bis 1799, doch veröffentlichte er seine berühmte Karte der
Gesteinsschichten von England und Wales erst 1815 (Eyles, 1969). In der Zwischenzeit hatten französische
Naturforscher in den Kalksteinbrüchen des Pariser Beckens eifrig nach Versteinerungen gesucht, und
Cuvier und seine Mitarbeiter hatten die genaue Stratigraphie dieser Fossilien (in erster Linie
Säugetierfossilien) ausgearbeitet und jede der Faunen mit bewundernswerter Ausführlichkeit beschrieben
[10]. In Deutschland war Schlotheim (1804; 1813) zu ähnlichen Ergebnissen gelangt.
Die Resultate dieser Arbeiten sowohl in Frankreich als auch in England ließen keinen Zweifel daran –
so. sehr diese Schlußfolgerung vielen Geologen auch zuwider sein mochte -, daß man es mit einer
Zeitenabfolge zu tun hatte und daß die untersten Schichten die ältesten waren. Schließlich entdeckte man
darüber hinaus, daß es häufig möglich war, eine Entsprechung der Schichten nicht nur in England und
Kontinentaleuropa, sondern auch in großen Teilen der Welt herzustellen, wenn auch unter Vorbehalt
regionaler Unterschiede der gleichen Art, wie man sie selbst heute zwischen den Faunen etwa Europas und
Australiens oder zwischen den marinen Faunen des Atlantik und des Pazifik findet. Dennoch sind die
Unterschiede zwischen den heute in den verschiedenen Teilen der Welt lebenden Faunen nicht annähernd
so groß wie die zwischen den Faunen verschiedener geologischer Zeitalter, zum Beispiel zwischen
rezenten Organismen und denen des mittleren Tertiär, ganz zu schweigen von denen des Mesozoikum oder
Paläozoikum.
Weder Cuvier noch die großen englischen Geologen (einschließlich Lyells) der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zogen aus diesen Befunden den Schluß, der für uns heute so unausweichlich scheint, daß es
nämlich einen kontinuierlichen evolutiven Wandel dieser Faunen gegeben hat. Stattdessen vertraten sie
weitere fünfzig Jahre lang entweder die Ansicht, jede fossile Fauna sei von einer Katastrophe vernichtet
und durch eine speziell geschaffene völlig neue Fauna ersetzt worden, oder aber waren der Meinung, das
Aussterben sei eher Schritt für Schritt erfolgt, die Ersatzfauna jedoch nichtsdestoweniger durch einzelne
spezielle Schöpfungsakte entstanden (siehe Kapitel 8). Das erklärende Prinzip war und blieb Entstehung,
und nicht Evolution.
Weitere Entwicklungen in der Biologie
Die Fundamente früherer Überzeugungen wurden durch eine Entdeckung in der Naturgeschichte nach
der anderen erschüttert. Mit der Erfindung des Mikroskops wurde eine zuvor unbekannte Welt von
Organismen durch van Leeuwenhoek entdeckt [11]. Sie vergrößerte die Vielfalt der Welt des Lebendigen
um eine neue Dimension und schien die langgesuchte Brücke zwischen den sichtbaren Organismen und der
unbelebten Natur zu schlagen und – am wichtigsten -, sie schien die These von der Urzeugung in
überzeugender Weise zu unterstützen (Farley, 1977). Redi und Spallanzani hatten nachgewiesen, daß sich
keine Maden in Fleisch entwickeln, wenn Fliegen keine Eier dorthin legen können. Dennoch breitete sich
immer mehr die Überzeugung aus, daß mikroskopische Organismen, vor allem Infusorien, aus unbelebter
Materie entstehen können. Bald kannte jeder das Rezept für die Erzeugung derartiger Organismen: Man
lege etwas trockenes Heu in Wasser, und nach ein paar Tagen ist dieses Wasser voll von mikroskopischen
Organismen. Diese Demonstration von „Urzeugung" stand ganz und gar im Gegensatz zum Dogma eines
einzigen Schöpfungsaktes am Anbeginn der Welt. Die Urzeugung nahm später eine Schlüsselstellung in
Lamarcks Evolutionstheorie ein.
Schließlich beeinflußte eine weitere Entwicklung in der Biologie das Evolutionsdenken in
entscheidender Weise: aas Aufkommen der Systematik. Seit Cesalpino und Gesner hatte die
Bestandsaufnahme von Tieren und Pflanzen beständig Fortschritte gemacht (siehe Kapitel 4). Lange Zeit
hatte es so ausgesehen, als ob sich diese Organismen, vom einfachsten bis zum vollkommensten, in einer
einzigen scala naturae anordnen ließen, und eine solche Stufenleiter der Vervollkommnung schien mit
dem Schöpferbegriff des 18. Jahrhunderts gut in Einklang zu stehen. Je mehr jedoch die Kenntnis über
Pflanzen und Tiere zunahm, um so schwieriger wurde es, sie in einer einzigen Rangfolge anzuordnen.
Vielmehr zerfielen sie auf natürliche Weise in wohldefinierte und häufig relativ getrennte Gruppen (wie
Säugetiere, Vögel und Reptilien) und deren Unterteilungen, und diese ließen sich sehr viel bequemer in
einer Hierarchie von Kategorien anordnen. Cuvier stufte alle Tiere in nicht mehr und nicht weniger als vier
Gruppen, „embranchements", ein: Vertebrata, Mollusca, Articulata und Radiata. Er betonte, daß diese vier
Stämme untereinander nicht verwandt seien, doch ließ er innerhalb jeder dieser vier Gruppen ein ziemlich
kompliziertes Verwandtschaftssystem zu. In der Ablehnung jeder Verbindung zwischen unbelebter Materie
und Lebewesen wie auch zwischen Pflanzen und Tieren war Cuvier mit Lamarck einer Meinung, aber er
ging viel weiter und bestritt die Existenz einer einzigen Entwicklungslinie der Tiere. Seine entschiedene
Absage an die scala naturae hatte zur Folge, daß gänzlich neue Fragen gestellt wurden, und machte den
Weg frei für Klassifikationen im Sinne der Evolutionstheorie (siehe Kapitel 4), obgleich Cuvier selbst
diesen Schiritt nicht tat.
Die französische Aufklärung
Die allmähliche Emanzipation von den traditionellen Rollen in Religion, Philosophie und Politik wurde
während der Aufklärung zu einer wahrhaft revolutionären Bewegung [12]. Zwar hatte diese Bewegung
gegen Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Großbritannien begonnen, doch übernahm
Frankreich bei der Entwicklung neuer Vorstellungen über die Welt des Lebens die Führung. Daher ist es
kein Zufall, daß schließlich ein Franzose als erster eine echte Evolutionstheorie aufstellte.
Das 18. Jahrhundert war eine Zeit besonders starker und ungelöster geistiger Spannungen. In der
Philosophie war es durch den Versuch gekennzeichnet, die gegensätzlichen Denkweisen von Descartes,
Newton und Leibniz miteinander in Einklang zu bringen. Der Offenbarungsglaube wurde, je mehr
Widersprüche man in der Bibel fand und je weniger Raum die Mechanisierung des Weltbildes für
übernatürliche Erscheinungen ließ, zunehmend unmoderner. Der Theismus, der Glaube an einen
persönlichen, offenbarten Gott, der immerfort in natürliche Vorgänge eingreift und Wunder vollbringt,
wurde für die Mehrheit der Philosophen und Wissenschaftler unannehmbar. Sogar der Deismus, der Glaube
an einen Gott, der am Anfang die Welt geschaffen hat und mit ihr die Gesetze („sekundäre Ursachen"), die
seither die Welt regieren, geriet in schreckliche Schwierigkeiten. Konnte sein „Plan" so detailliert gewesen
sein, daß er jede einzelne Struktur und Funktion der unzähligen Tier- und Pflanzenarten und ihrer ebenso
zahllosen gegenseitigen Wechselwirkungen enthalten haben konnte? Und wie ließ sich ein solcher Urplan
mit den Veränderungen in Einklang bringen, die überall auf der Erde so sehr ins Auge fielen? Oder genauer
(wie wir gleich sehen werden), wie konnten Plan oder allgemeine Gesetze solche biologischen
Erscheinungen wie Aussterben oder verkümmerte Organe erklären? Während des gesamten 18.
Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts versuchte ein Naturforscher oder Philosoph nach
dem anderen, einen Kompromiß zwischen kreationistischen und deistischen Interpretationen der Welt des
Lebendigen zu finden. Wieder andere Autoren verneinten nicht nur die Existenz eines Bauplans der Welt,
sondern sogar die Existenz eines Schöpfers und wurden somit offen zu Atheisten. Für sie war die Welt
lediglich eine große Maschine. Doch wie konnte man damit die Eigenschaften des Menschen und die
harmonischen Anpassungen aller Organismen an die Umgebung, in der sie leben, erklären? Ob man nun
Theist, Deist oder Atheist war, man sah sich anscheinend unbeantwortbaren Fragen gegenüber. Der
geistige Aufruhr, der sich aus dem Zusammenstoß dieser Ideologien ergab, wie auch das fortwährende
Anwachsen unseres Wissens von der lebendigen Welt, erreichten ihren Höhepunkt im Denken von Charles
Darwin.
Die hundert Jahre von 1740 bis 1840 sind für die Geschichte der Evolution von entscheidender
Bedeutung, denn dies war die Zeitspanne, in der die Idee der Evolution im Geist der fortgeschrittensten
Denker zum Durchbruch gelangte. Es war eine Zeit des Wandels, nicht nur in der Geologie und
Naturgeschichte, sondern auch im politischen und gesellschaftlichen Denken. Der Auflösung des Glaubens
an eine im Fließgleichgewicht befindliche Welt in den Naturwissenschaften entsprach in den politischen
Wissenschaften, ja, auch in der praktischen Welt von Regierung und Gesellschaft, das Zweifeln an der
Gottgegebenheit von Dynastien und feudalen Hierarchien mit ihrer Betonung des Status quo. Dieser Status
quo wurde durch den Begriff des „Fortschritts" in Frage gestellt, dem wohl dominierenden Thema in den
Schriften der Philosophen der Aufklärung. Daß ein Zusammenhang bestand zwischen den beiden Motiven
– der Evolution in der Welt der Natur und dem Fortschritt in der sozialen Welt – liegt auf der Hand. Weit
weniger offenkundig ist, woher die Ideen in beiden Bereichen kamen und in welchem Verhältnis Naturund Gesellschaftswissenschaften zu dieser geistigen Strömung beigetragen haben.
Eine Antwort auf diese Frage ist wichtig in Verbindung mit der Kontroverse zwischen Externalismus
und Internalismus in der Naturwissenschaft. Entstand der Begriff des Fortschritts im politischen Bereich
und tauchte dann, wie die Externalisten behaupten würden, in den Naturwissenschaften als Begriff der
Evolution wieder auf? Eine Analyse des Begriffs Evolution ist für die Beantwortung dieser Frage
unerläßlich.
Die Ideen Fortschritt und Evolution
Fortschritt bedeutet immer Wachstum und Entwicklung, selbst wenn es nur um immanente
Möglichkeiten geht. Soweit es den Menschen betrifft, sagte Fontenelle (1688) voraus : „Wachstum und
Entwicklung der menschlichen Weisheit werden kein Ende nehmen." In gewisser Weise war dies eine
neue, andererseits jedoch auch wieder eine sehr alte Idee, da alle Komponenten des Begriffs Fortschritt –
wie etwa Wachstum und Entwicklung (von Aristoteles), Kontinuität, Notwendigkeit, sich entfaltende
Absicht, Endziel und so weiter – nicht nur in der klassischen Philosophie weitverbreitet sind, sondern auch
in der Weltsicht des Heiligen Augustinus auftreten. Kurze Zeit vor Fontenelle hatte Pascal (1647) in
gleicher Weise die Entwicklung der Menschheit mit dem Wachstum des Individuums verglichen.
Von ebenso großer Bedeutung war die Idee der Entwicklung in der Gedankenwelt von Leibniz mit
ihrem Gewicht auf Kontinuität und unendlicher Vielfalt. In vielerlei Hinsicht stand dies im Gegensatz zu
den Lehren von Descartes, der Uniformität und mathematische Konstanz betonte. Niemand hob derart
nachdrücklich die Bedeutung der Potentialität hervor wie Leibniz: Obgleich viele Substanzen bereits eine
große Perfektion erreicht haben, sind doch aufgrund der infiniten Teilbarkeit des Kontinuierlichen in der
unendlichen Tiefe der Dinge noch schlummernde Teile vorhanden, die noch erweckt werden müssen, an
Größe und Wert wachsen müssen und, mit einem Wort, zu einem vollkommeneren Zustand voranschreiten
müssen… es besteht ein fortwährender und höchst freier Fortschritt des gesamten Universums in Erfüllung
der universellen Schönheit und Vollkommenheit der Werke Gottes, so daß es immer zu größerer
Entwicklung fortschreitet (Nisbet, 1969, S. 115) [13].
Das 18. Jahrhundert in seinem Optimismus betonte unablässig den Fortschritt in der fortwährenden
Vervollkommnung des Menschen. Herder, Kant und andere führende Denker des Zeitalters brachten diesen
Glauben zum Ausdruck und beteiligten sich an dem, was man als die Suche nach einem Gesetz des
Fortschritts bezeichnen könnte (Nisbet, 1969, S. 104-136). Ein solcher Fortschritt war nicht für die Natur,
sondern auch für alle menschlichen Institutionen bezeichnend, und natürlich war gerade diese Betonung bei
der Gestaltung der amerikanischen Verfassung und der französischen Revolution von großer Bedeutung.
Ihren Höhepunkt erreichte diese Denkströmung in Condorcets Esquisse d'un tableau historique des
progrés de l'esprit humain (1795), wo es heißt, „daß die Natur der Vervollkommnung der menschlichen
Fähigkeiten keine Grenzen gesetzt hat; daß… die Fortschritte dieser Fähigkeit zur Vervollkommnung, die
inskünftig von keiner Macht, die sie aufhalten wollte, mehr abhängig ist, ihre Grenze allein im zeitlichen
Bestand des Planeten haben, auf den die Natur uns hat angewiesen sein lassen" (Zit. nach der deutschen
Ausgabe Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes, S.29).
Wenn von der Vorstellung des ununterbrochenen und unbegrenzten Fortschritts zwangsläufig ein Weg
zu einer Evolutionstheorie führen mußte, so hätten die großen Naturforscher des 18. Jahrhunderts diesen
Weg ohne Verzögerung gehen sollen. Doch so war es nicht. Weder Buffon noch Needham, Robinet,
Diderot, Bonnet oder Haller setzten den philosophischpolitischen Begriff des Fortschritts in eine
wissenschaftliche Theorie der Evolution um. Ja, erst als mit Napoleons Usurpation der Macht in Frankreich
die Reaktion auf die Aufklärung einsetzte, begann Lamarck seine Theorie der Evolution zu entwickeln.
Es gibt viele Gründe dafür, die These, die politische Theorie des Fortschritts müsse unvermeidlich in
eine biologische Theorie der Evolution umgesetzt werden, in Frage zu stellen. Zum Beispiel war die
Fortschrittsidee in den Augen der Naturforscher völlig unvereinbar mit den zahllosen Fakten, die auf eine
regressive Evolution hinweisen (einschließlich Parasitismus und verkümmerte Organe). Der vielleicht am
stärksten hindernde Faktor war die Macht des Essentialismus. War nicht aller Fortschritt lediglich ein
Entfalten bereits existierender Potentialitäten ohne jegliche Veränderung in der zugrundeliegenden Essenz,
das heißt, ohne irgendeine tatsächliche Evolution? Fontenelle zum Beispiel lehnte jeden Gedanken an eine
Veränderung ab, die mehr als Wachstum sei, denn, so sagte er, haben nicht Descartes und andere gezeigt,
daß die Natur in ihren Werken einheitlich ist; daß sie ihre Vorschriften nicht von Generation zu Generation
ändert? Das einzige, was er akzeptieren konnte, war das Sich-Entfalten eines bereits bestehenden
Potentials. Es ist ein erheblicher Unterschied zwischen Wachstum und Geschichte: Wachstum ist lediglich
das Entfalten eines immanenten Potentials, Geschichte dagegen ist echter Wandel.
Leibniz jedoch geht über ein derartiges essentialistisches Sich-Entfalten hinaus. Für ihn war die
Potentialität der Natur unbegrenzt, „und somit wird niemals ein Ende des Fortschritts erreicht werden".
Dieser Optimismus war eine logische Konsequenz der Prinzipien der unendlichen Vielfalt, der Immanenz
und Kontinuität, was Voltaire nicht daran hinderte, sich darüber lustig zu machen. Trotz dieser Kritik
wurden Leibnizens Ideen jedoch von der Mehrzahl der Gesellschaftsphilosophen des 19. Jahrhunderts wie
Marx, Comte und Spencer übernommen, deren Ansicht nach Fortschritt „nicht ein Zufall, sondern eine
wohltuende Notwendigkeit" war.
Das Denkgebäude von Leibniz enthielt zwei Elemente, die die zukünftige Geschichte der
Evolutionsbiologie beeinflussen sollten. Die Vorstellung von Kontinuität und allmählichem Fortschreiten
(„Alles in der Natur geht schrittweise vor sich, nichts springt, und diese die Veränderungen steuernde
Regel ist Teil meines Gesetzes der Kontinuität"; 1712, S.376) mit ihrer ausdrücklichen Ablehnung des
Platonismus war ein wichtiger positiver Beitrag und eine unerläßliche Voraussetzung für das moderne
Evolutionsdenken. Sie war einer der Grundpfeiler für Darwins Erklärung der Evolution. Die andere Idee,
die eines inneren Fortschritts-, wenn nicht Vollkommenheitstriebes, war nichts als ein Handikap. Sie
zwang Denker, die wie Spencer über einen Fortschrittsglauben zur Evolution gelangten, in völlig irrige
Theorien über den Evolutionsmechanismus hinein (siehe Kapitel 11). Wer, wie die Schule der schottischen
Philosophen, die Vorstellung eines unvermeidlichen Fortschritts ablehnte, stand in der Tat Darwins
Denken näher als die französischen Apostel des Fortschritts. Heutzutage ist man weithin der Ansicht, der
Glaube an einen unvermeidlichen und kontinuierlichen Fortschritt sei für jede Ideologie katastrophal
(Monod, 1970).
Die Fortschrittsidee hängt eng mit der Vorstellung der scala naturae oder der großen Stufenfolge des
Lebendigen zusammen und entstand zum Teil aus ihr (Lovejoy, 1936). Dieser Begriff reicht bis zu Platon
zurück, nahm aber unter den Scholastikern des Mittelalters und dann erneut im 17. und 18. Jahrhundert
neue Gestalt an. Er stützt sich auf die Überzeugung, daß eine lineare Kontinuität (aber auch Rangordnung)
besteht, die von der Welt der unbelebten Objekte über Pflanzen und niedere Tiere zu höheren Tieren und
zum Menschen (und idealerweise über die Engel bis zu Gott) führt. Gewöhnlich mit dem Begriff der scala
naturae verbunden war darüber hinaus die Idee der Vollkommenheit, die postulierte, alles, was existieren
könne, sei auch tatsächlich existent. Es konnte also keine leeren Räume geben, und die Zwischenräume
zwischen benachbarten Stufen der Stufenreihe waren so unendlich klein, daß diese praktisch
ununterbrochen war. Bei Leibniz, der diese Kontinuität besonders hervorhob, tritt der Einfluß seiner
mathematischen Interessen sehr deutlich zutage. Ja, er drückt seine Gedanken über diesen Gegenstand
häufig in mathematischer Form aus. Vor Leibniz war die große Stufenleiter des Lebendigen ein rein
statischer Begriff, war sie doch bei ihrer Schaffung vollkommen, und da somit eine Bewegung in Richtung
auf eine größere Vollkommenheit unmöglich war, konnte jede Veränderung nur eine Verschlechterung, ein
Absinken, bedeuten.
Die zunehmende Vervollkommnung, wie sie die scala naturae postulierte, konnte auf verschiedene
Weise zum Ausdruck kommen, durch den Besitz von „mehr Seele" (im Sinne von Aristoteles), mehr
Bewußtsein, mehr Vernunft, durch ein Gott-ähnlicher-Werden oder was nicht sonst noch alles. Im Grunde
war es weitgehend ein postuliertes Ideal, denn die Beobachtung bestätigte keineswegs die Existenz einer
solchen perfekten, kontinuierlichen, streng linearen Rangfolge. Im Gegenteil, überall stieß man auf
auffällige Lücken, etwa zwischen Säugetieren und Vögeln, Fischen und Wirbellosen, Farnen und Moosen.
Daher das Entzücken, als die Korallen und andere Organismen (beispielsweise Zoophyten) entdeckt
wurden, die auf höchst glückliche Weise die Verbindung zwischen Pflanzen und Tieren herzustellen
schienen. Man stellte kühn die Behauptung auf, die anderen Lücken würden durch zukünftige
Entdeckungen auch noch gefüllt werden. Keiner der zahlreichen Anhänger von Leibniz war so konsequent
wie Charles Bonnet (1720-1793), der eine ausgeklügelte „échelle des êtres naturels" aufstellte, in der
Flughörnchen, Fledermaus und Strauß die Kontinuität zwischen Säugetieren und Vögeln herstellen [14].
Für ihn war das Kriterium, das den Platz in der Rangfolge bestimmte, die „Organisation". Wo seine
Aussagen auf Evolution hinzuweisen scheinen, handelt es sich zweifellos lediglich um ein Entfalten eines
bereits existierenden Potentials.
Die Existenz von Fossilien und anderem Material, das anscheinend als Beweis für das Aussterben
herangezogen werden konnte, stand offenkundig im Gegensatz zu dem Prinzip der Kraft zum Aufsteigen
und verlangte nach Erklärung. In seinem Werk Protogaea (1693) gesteht Leibniz zu, viele Sorten von
Organismen, die in früheren geologischen Zeitaltern existierten, seien inzwischen von der Erdoberfläche
verschwunden, und viele von denen, die heute leben, zu jener Zeit offensichtlich noch nicht vorhanden
gewesen. Seine These ist: im Verlauf der umfassenden Veränderungen, die im Zustand der Erdkruste
stattgefunden haben „sind sogar die Tierarten viele Male umgestaltet worden". Doch die Zahl der Monaden
blieb unverändert; bei all den Umgestaltungen ging es nicht um Abstammung, wie wir sie heute verstehen,
sondern lediglich um das Sich-Manifestieren von seit Anbeginn existenten Potentialitäten. Das äußere
Erscheinungsbild der Stufenreihe des Lebendigen wandelte sich also mit der Zeit, ohne daß die
zugrundeliegenden Wesenheiten sich nur im geringsten änderten. Diese neue Version des Stufenreichs des
Lebendigen wurde von Lovejoy als das „temporalizing", d.h. als die „Verzeitlichung", dieser Rangfolge
bezeichnet. Trotz gegenteiliger Behauptungen handelte es sich nicht um den Vorschlag einer Theorie der
Evolution.
Da das Prinzip der Lückenlosigkeit kein Aussterben gestatten konnte, mußten ausgestorbene Tiere als
frühere Stadien noch bestehender Organismen interpretiert werden. Dies beispielsweise war eindeutig die
Auslegung von Bonnet (Palingenése); Robinets Vorstellung war phantasievoller: neue Typen entstanden
durch eine Kombination früherer Prototypen. Doch nichts Neues wurde geschaffen, bestand doch für alles
ein präexistentes Potential. Für Robinet lautet „das erste Axiom der Naturphilosophie", daß „die
Stufenfolge des Lebendigen ein unendlich abgestuftes Ganzes ohne wirkliche Trennungslinien darstellt;
daß es nur Individuen gibt, und keine Reiche oder Klassen oder Genera oder Spezies" (Guyénot, 1941,
S.386). Die Stufenleiter war für ihn durch eine Reihe aufeinanderfolgender Schöpfungsakte der Natur
bedingt, er kannte keine Evolution und keine genetische Kontinuität. Kurioserweise findet man ganz
ähnliche, wenn auch etwas mehr im Sinne der Schöpfungslehre formulierte Ideen noch in relativ später
Zeit, nämlich 1857 in den Schriften von Louis Agassiz.
Während der ganzen zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts „lag" der Begriff Evolution sozusagen „in der
Luft"; einige Wissenschaftshistoriker haben drei Franzosen, Maupertuis, Buffon und Diderot, als
Evolutionisten bezeichnet, während deutsche Historiker die gleiche Ehre Rodig, Herder, Goethe und Kant
zuteil werden ließen. Die spätere Forschung konnte jedoch diese Behauptungen nicht untermauern. Alle
diese „Vorläufer" waren Essentialisten und postulierten entweder neue Ursprünge (statt der Evolution
bestehender Typen) oder verfochten lediglich ein Entfalten („Entwickeln" im engeren Sinne) immanenter
Potentialitäten. Dessen ungeachtet sind die Schriften dieser Autoren außerordentlich interessant. Nicht nur,
weil sie das stetige Annähern an den Evolutionsgedanken erkennen lassen, sondern auch, weil sie das
geistige Klima veranschaulichen, in dem sich das Evolutionsdenken durchsetzen mußte. In gewissem Sinne
waren alle diese Autoren in der Tat Vorläufer Lamarcks; in einem anderen Sinne jedoch war es keiner von
ihnen, denn Lamarck war der erste, der die essentialistischen Schranken gegen den Evolutionismus
eindeutig und völlig durchbrach.
Maupertuis
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) war einer der fortschrittlichsten Denker seiner Zeit
[15]. Er brachte als erster das Newtonsche Gedankengut nach Frankreich, wo es von Voltaire und anderen
begierig aufgegriffen wurde. Doch Maupertuis war auch der erste in Frankreich, der das einfache
Newtonsche Paradigma von „Kräften und Bewegung" als für die Biologie, ja sogar für die Chemie,
unzureichend erkannte. Aus diesem Grund nahm er die Leibnizschen Ideen in seinen Begriffsrahmen auf.
Über ihn und Madame Chatelet wurde wiederum Buffon mit dem Leibnizschen System bekannt, was zur
Folge hatte, daß das Gedankengut von Leibniz in den Schriften der meisten französischen philosophes und
Naturwissenschaftler des 18. Jahrhunderts, einschließlich denen Lamarcks, stark vertreten war.
Das Hauptinteresse von Maupertuis galt der Mathematik und Astronomie, aber daneben auch
biologischen Erscheinungen; er war einer der Bahnbrecher der Genetik (siehe Kapitel 14). Ungeachtet
gegenteiliger Behauptungen war er jedoch weder Evolutionist, noch einer der Gründer der Theorie der
natürlichen Auslese, und seine Erklärungen waren eher die eines Kosmologen als die eines Biologen. Seine
wirkliche Bedeutung lag darin, daß er die stark deterministische und auf dem Schöpfungsglauben fußende
Komponente des Newtonschen Systems zurückwies und insofern auf Lukrez und die Epikureer
zurückging, als er die Ursprünge weitgehend dem Zufall zuschrieb. Es gab bei weitem zu viel
Mannigfaltigkeit und Heterogenität in der Natur, als daß die Welt nach einem Plan geschaffen worden sein
konnte. Maupertuis übte heftige Kritik an den Naturtheologen mit Argumenten wie etwa, die Existenz
giftiger Pflanzen und Tiere sei mit der Vorstellung von „Weisheit und Güte des Schöpfers" unvereinbar.
Auch die einen Schöpfer leugnenden Materialisten (Atheisten) mußten auf irgendeine Weise die
Existenz von Organismen erklären. Sie griffen auf die Ideen von Lukrez zurück, wonach Organismen
durch Urzeugung entstehen können. Allerdings gab es von diesem deus ex machina-Vorgang mehrere
Versionen. Man konnte von der Existenz allgegenwärtiger lebender Keime oder Moleküle überzeugt sein,
die durch zufälliges Zusammentreffen sogar die höchsten Organismen produzieren konnten. Anschauungen
dieser Art wurden noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts vertreten, und zwar nicht nur von Maupertuis,
sondern auch von La Mettrie, Diderot und anderen. Eine weitere Möglichkeit war es, die Idee der
Urzeugung mit der der scala naturae zu verbinden. Es gibt keine überall in der Natur Vorhandenen
lebenden Keime, also muß die Urzeugung in der Lage sein, aus unbelebter Materie Leben entstehen zu
lassen. Dieser Vorgang kann jedoch nur die einfachsten Lebewesen hervorbringen, die dann allmählich zu
immer komplexeren Organismen umgestaltet werden, also in einer „verzeitlichten" Stufenfolge des
Lebendigen aufsteigen. Dies war, wie wir noch sehen werden, im wesentlichen Lamarcks Theorie der
Evolution.
Maupertuis' Erklärung der Entstehung der Welt der Organismen setzte die massenhafte Urzeugung neuer
Tier- und Pflanzensorten und eine ebenso massenhafte Ausmerzung fehlerhafter Exemplare voraus. Dies
ist allemal eine Ursprungstheorie, wie sie unter den Griechen weitverbreitet war, nicht aber eine
Evolutionstheorie. Es muß hervorgehoben werden, wie Roger (1963) richtig bemerkt hat, daß diese Theorie
der Beseitigung fehlerhafter neuer Varianten nicht das Geringste mit natürlicher Auslese zu tun hat.
Da Maupertuis keinerlei naturgeschichtliche Bildung besaß, fand er nichts Lächerliches an dem
Gedanken, daß jede beliebige Art von Organismus, selbst ein Elefant, das Produkt einer zufälligen
Kombination von Material sein könne. „Der Zufall, so könnte man sagen, brachte eine gewaltige Zahl von
Individuen hervor; ein kleiner Teil davon war so organisiert, daß seine Organe imstande waren, seinen
Bedürfnissen zu genügen. Ein viel größerer Teil zeigte weder Anpassung noch Ordnung; diese letzteren
kamen alle um. Also sind die Arten, die wir heute sehen, nur ein kleiner Teil all derer, die ein blindes
Schicksal hervorgebracht hat" (Essaie de cosmologie, 1750).
Allerdings verließ sich Maupertuis für die Entstehung neuer Arten nicht völlig auf die Urzeugung.
Aufgrund seiner genetischen Studien kam er zu einer Theorie, die wir heute als Artbildung durch Mutation
bezeichnen würden. Eine neue Art war für ihn nichts anderes als ein imitiertes Individuum; und in diesen
Gedanken war er ein Vorläufer von de Vries. Die Rassen begannen seiner Ansicht nach mit zufälligen
Individuen. Maupertuis war ohne jeden Zweifel Essentialist, und obgleich er sich die Erzeugung neuer
Essenzen vorstellen konnte, war er nicht in der Lage, sich eine allmähliche und kontinuierliche
Vervollkommnung einer Population durch Auslese (d. h. durch Reproduktion) der bestangepaßten
Individuen vorzustellen. Dennoch war seine Welt nicht statisch, sondern eine Welt, in der die Zeit eine
wichtige Rolle spielte.
Buffon
Die zwei größten Naturforscher des 18. Jahrhunderts, Buffon und Linnaeus, wurden im selben Jahr
geboren, 1707. Doch davon abgesehen und mit Ausnahme ihres großen Interesses an der Naturgeschichte,
waren die beiden Männer so verschieden, wie zwei Menschen überhaupt nur sein können. Buffon (17071788) war wohlhabend, kam aus einer aristokratischen Familie und konnte es sich leisten, das Studium der
Naturwissenschaft als Steckenpferd zu betreiben [16]. Linnaeus war arm und mußte hart kämpfen, um eine
Stellung zu bekommen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Auch in den meisten ihrer
wissenschaftlichen Erklärungen vertraten die beiden gegensätzliche Ansichten (siehe Kapitel 4).
Als junger Mann verbrachte Buffon ein Jahr in England, wo er Mathematik, Physik und
Pflanzenphysiologie studierte. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich veröffentlichte er eine Übersetzung
von Newtons Fluxions und Stephen Haies' Vegetable Statics. Durch besondere Protektion des Ministers
Maurepas wurde Buffon 1739 zum Intendanten (Direktor) des Jardin du Roi ernannt, obwohl er für diese
Position nicht besonders gut qualifiziert war. Doch stürzte er sich mit großem Enthusiasmus in die neue
Aufgabe und faßte den Plan, eine universelle Naturgeschichte, von den Mineralien bis hin zum Menschen,
zu verfassen. Fünfunddreißig große Bände dieses Werkes in Quartformat wurden zwischen 1749 und
Buffons Tod im Jahre 1788 veröffentlicht und neun weitere Bände erschienen noch später. In dieser
monumentalen und faszinierenden Histoire Naturelle setzte sich Buffon in anregender Weise mit nahezu
allen Problemen auseinander, die später von den Evolutionisten aufgeworfen werden sollten. Das Werk
war in brillantem Stil geschrieben und wurde in französischer Sprache oder in einer der zahlreichen
Übersetzungen von allen Gebildeten in Europa gelesen. Es ist keine Übertreibung, wenn man behauptet,
daß praktisch alle wohlbekannten Autoren der Aufklärung und sogar späterer Generationen in Frankreich
wie auch in anderen europäischen Ländern entweder direkt oder indirekt Buffon-Anhänger waren. Buffon
war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wahrhaftig der Vater alles Denkens im Bereich der
Naturgeschichte [17]. Obgleich er, wie wir gleich sehen werden, selbst kein Anhänger des
Evolutionsgedankens war, ist es nichtsdestoweniger richtig, ihn als den Vater des Evolutionismus zu
bezeichnen. Und er war mit Sicherheit für das gewaltige Interesse verantwortlich, das man in Frankreich
der Naturgeschichte entgegenbrachte (Burkhardt, 1977, S. 14-17).
Es gibt wenige Denker, bei denen es so schwierig ist wie bei Buffon, sie korrekt zu interpretieren.
Gründe dafür gibt es viele. Zum Beispiel ist Buffons großes Werk eine literarische Enzyklopädie der
Naturgeschichte und die Angaben zu allgemeinen Themen etwa Evolution, Art oder Variation – sind über
viele verschiedene Bände verstreut. Außerdem haben ohne Zweifel Buffons Vorstellungen im Laufe seines
langen und aktiven Lebens eine Entwicklung durchgemacht, wenn auch alle Versuche, seine
Anschauungen in klar definierte Perioden einzustufen, sich als ziemlich unzufriedenstellend erwiesen
haben. Mit seinem wandlungsfähigen, ja fast quecksilbrigen Geist betrachtete Buffon viele Fragen von so
vielen verschiedenen Seiten, daß er sich nicht selten widersprach. Man muß sich ausführlich mit der
Gesamtheit seines Werkes auseinandergesetzt haben, bevor man mit Überzeugung sagen kann, welche
seiner Ansichten als die typischsten anzusehen sind. Und schließlich ist es wahrscheinlich, daß Buffon in
seinen frühen Veröffentlichungen nicht mit völliger Offenheit schreiben konnte. In den vierziger Jahren des
18. Jahrhunderts hatten die Theologen an der Sorbonne immer noch einen großen Einfluß, und einmal
(1751) mußte Buffon in der Tat einige Aussagen formell widerrufen, die er über Geschichte und Alter der
Erde gemacht hatte. Wahrscheinlich war zumindest ein Teil seiner Bemerkungen so formuliert, daß sie bei
den Theologen keinen Anstoß erregten.
Als Buffon 1749 die ersten drei Bände seiner Naturgeschichte veröffentlichte, war er ein relativ
rigoroser Anhänger Newtons. Infolgedessen war er beeindruckt von Bewegungs- und
Kontinuitätsvorstellungen, und die Beschäftigung mit einer großen Zahl statischer, diskontinuierlicher
Entitäten wie Arten, Gattungen und Familien schien ihm ziemlich sinnlos zu sein. Als er zum Direktor des
Jardin du Roi (heute Jardin des Plantes) ernannt wurde, war seine Kenntnis der Systematik ziemlich
begrenzt, doch machte er aus diesem Mangel eine Tugend, indem er die „Nomenclateurs" (LinnaeusAnhänger) als staubtrockene Pedanten attackierte und stattdessen das Studium der lebenden Tiere und der
charakteristischen Merkmale ihrer Lebensweise predigte. In der Vorrede bemerkt er, es sei völlig
unmöglich, die verschiedenen Sorten von Organismen in getrennte Kategorien einzustufen, da es immer
Zwischenstücke zwischen einer Gattung und einer anderen gäbe. Wenn man aber wirklich eine
Klassifikation vornehmen wolle, so müsse diese auf der Grundlage der Gesamtheit aller Merkmale erfolgen
und nicht, wie es die Linnaeische Schule tue, eine willkürliche Auswahl einiger weniger Merkmale
zugrunde legen. Trotz Betonung der Kontinuität enthalten die ersten drei Bände keinen Hinweis auf
Evolution. Weder schlug Buffon die „Verzeitlichung" der Stufenleiter des Lebendigen vor, noch deutete er
an, daß eine Art aus einer anderen entstanden sei oder sich aus einer anderen entwickelt habe. Vielmehr
wird im ersten Band in der Tat die Idee vertreten, die einzigen wirklichen Entitäten in der Natur seien die
Individuen.
Die Reihenfolge der Arten, die Buffon seiner Naturgeschichte zugrundelegt, ist durch reine
Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt. Er beginnt mit denen, die für den Menschen am Wichtigsten oder
nützlichsten bzw. ihm am besten bekannt sind. Daher werden Haustierarten wie Pferd, Hund und Kuh vor
den wildlebenden Tieren behandelt, und die Tiere der gemäßigten Zonen wiederum vor den exotischen.
Diese willkürliche Klassifikation war als Grundlage für Evolutionsüberlegungen so ungeeignet wie nur
möglich. Was den Menschen betrifft, so ist er das höchste Lebewesen: „Alles, sogar seine äußere
Erscheinung, zeigt die Überlegenheit des Menschen über alle anderen Lebewesen". Sehr im Geiste von
Descartes hält Buffon die Denkfähigkeit für das hervorragendste Merkmal des Menschen: „Sein und
Denken ist für uns dasselbe." Da er davon überzeugt ist, daß Tiere nicht denken können, besteht für ihn
eine gewaltige Kluft zwischen Tieren und Menschen, wodurch es ihm unmöglich wurde, sich den
Menschen als ein vom Tier abstammendes Wesen vorzustellen.
Die Formulierung der ersten drei Bände der Histoire Naturelle (1749) läßt darauf schließen, daß Buffon
zu jener Zeit möglicherweise Atheist gewesen ist. Im Jahre 1764 dagegen benutzt er entschieden die
Sprache eines Deisten. Wenn er 1774 schreibt, „je tiefer ich in die Tiefen der Natur eindringe, um so mehr
bewundere ich ihren Urheber und fühle tiefe Ehrfurcht vor ihm44, so scheint er auszudrücken, was er
wirklich fühlt. Als Buffon schließlich an eine ewige Ordnung und an Naturgesetze glaubt, da braucht er
einen Gesetzgeber, der für die beobachteten sekundären Ursachen verantwortlich ist. Die Wissenschaft
wäre sinnlos, würde die Welt nicht durch eine unwandelbare und universelle Ordnung regiert. Hier kommt
Buffon Aristoteles bemerkenswert nahe, der auf der Grundlage desselben Begriffs der ewigen Ordnung des
Universums den Gedanken an Evolution ebenfalls ablehnte.
Buffon war sich der Möglichkeit der „Abstammung von gemeinsamen Vorfahren" durchaus bewußt, ja
er war vermutlich der erste Denker, der sie jemals deutlich zum Ausdruck gebracht hat:
Nicht nur Esel und Pferd, sondern auch den Menschen, die Affen, die vierfüßigen Säugetiere und alle
Tiere kann man so betrachten, als bildeten sie eine einzige Familie… Wenn man zugäbe, daß der Esel
der Familie des Pferdes angehört und sich von dem Pferd nur deshalb unterscheidet, weil er von der
ursprünglichen Form abgewichen ist, so könnte man genau so gut sagen, daß der Affe der Familie des
Menschen angehört, daß er ein entarteter Mensch ist, daß Mensch und Affe gemeinsame Ursprünge
haben; daß in der Tat alle Familien, wie bei den Pflanzen und bei den Tieren, aus einem einzigen
Stamm entstanden sind, und daß alle Tiere von einem einzigen Tier abstammen, aus dem sich im Laufe
der Zeit, als Resultat von Fortschritt oder Degeneration, alle anderen Tierrassen herausgebildet haben.
Denn wenn ein einziges Mal gezeigt werden würde, daß es gerechtfertigt ist, diese Familien
aufzustellen, wenn man die Gewähr hätte, daß es unter den Tieren und Pflanzen nur eine einzige Art
(ich sage gar nicht einmal mehrere Arten) gegeben hat, die durch direkte Abstammung von einer
anderen Art erzeugt worden ist; wenn es beispielsweise tatsächlich so wäre, daß der Esel nur ein
entarteter Abkömmling des Pferdes ist, dann wäre der Macht der Natur keinerlei Grenze mehr gesetzt,
und wir gingen nicht fehl, wenn wir annähmen, daß sie mit genügend Zeit imstande gewesen ist, aus
einem einzigen Lebewesen alle anderen organisierten Wesen entstehen zu lassen. Aber dies ist
keineswegs eine korrekte Darstellung der Natur, versichert uns doch die Autorität der Offenbarung, daß
alle Tiere in gleicher Weise an der Gnade der unmittelbaren Schöpfung teilhatten und daß das erste Paar
jeder Art vollausgebildet aus den Händen des Schöpfers hervorging (Buffon, 1766).
Diese Passage läßt sich so interpretieren, als habe Buffon lediglich pro forma, als Zugeständnis an die
Theologen, seine wahre evolutionistische Überzeugung verhehlt, und sie ist in der Tat gelegentlich so
ausgelegt worden. Alle jüngeren Buffon-Forscher (Lovejoy, Wilkie, Roger) sind sich jedoch darin einig,
daß diese Aussage im Zusammenhang der Schrift, in der sie vorkommt, in der Tat eine ernstgemeinte
Ablehnung der Möglichkeit der Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren darstellt. Unmittelbar
nach der zitierten Passage folgt eine Reihe verschiedener Argumente gegen die Möglichkeit der
Abstammung einer echten Art von einer anderen. Buffon führt insbesondere drei Argumente an. Erstens,
daß in der geschriebenen Geschichte das Erscheinen neuer Arten nicht bekannt ist. Zweitens, daß die
Unfruchtbarkeit der Bastarde eine unüberwindliche Barriere zwischen den Arten aufrichtet. Und drittens:
wenn eine Art von einer anderen abstammte, wenn „beispielsweise die Art der Esel von dem Pferd
abstammte", dann hätte das Resultat nur langsam und schrittweise erzeugt werden können. In diesem Fall
würde es zwischen Pferd und Esel eine lange Reihe von Zwischenstufen geben. Warum sehen wir dann
aber heute nicht die Vertreter, die Abkömmlinge, dieser Zwischenarten? Warum bleiben nur die beiden
Extreme übrig? Diese Argumente führen Buffon zu der Folgerung: „Zwar läßt sich nicht beweisen, daß die
Erzeugung einer Art aus einer anderen durch Entartung für die Natur unmöglich ist, doch ist die Zahl der
Wahrscheinlichkeiten, die dagegen sprechen, derart enorm, daß man sogar aus philosophischen Gründen
kaum einen Zweifel in diesem Punkt haben kann."
Auf welche Weise entstehen dann also Arten? Aus spontanen chemischen Verbindungen geht
ununterbrochen lebende Materie (organische Moleküle) hervor. Organische Moleküle wiederum verbinden
sich spontan miteinander und bilden das erste Individuum jeder wesentlichen Art. Dieses so entstandene
erste Wesen wird der Prototyp einer Art. Er wird zum moule intérieur (zur epigenetischen inneren Form)
für seine Nachkommen und sichert somit die Permanenz der Art. Diese Unveränderlichkeit wird
unaufhörlich von den „Umständen" in Frage gestellt, die Varietäten erzeugen. Doch die Beständigkeit des
moule intérieur verhindert, daß die Variationen bestimmte Grenzen überschreiten. In dieser Beziehung
spielt der moule intérieur eine ähnliche Rolle wie Aristoteles' eidos (Form). Viele niedrigere Organismen
werden fortwährend durch generatio spontanea aus organischen Molekülen erzeugt. Es gibt ebenso viele
Tier- und Pflanzenarten wie es lebensfähige Kombinationen organischer Moleküle gibt. Nicht lebensfähige
Kombinationen sterben aus.
Die ersten drei Bände der Histoire Naturelle (veröffentlicht im Jahre 1749) unterscheiden sich ziemlich
stark von dem vierten (1753) und den nachfolgenden Bänden. Einer der Gründe dafür ist, daß Buffon
Anfang der fünfziger Jahre mit dem Werk von Leibniz Bekanntschaft gemacht hatte, mit dem Gewicht, das
darin auf das Stufenreich des Lebendigen, die Lückenlosigkeit und Vollkommenheit gelegt wird, sowie mit
den darin enthaltenen Hinweisen auf Evolution. Von diesem Zeitpunkt an enthielten Buffons Schriften eine
Mischung aus den Anschauungen Newtons und Leibnizens. Auf der einen Seite vertrat er weiterhin die
Idee der Lückenlosigkeit und sagte: „Es scheint, daß alles, was existieren kann, auch wirklich existiert."
Auf der anderen Seite lehnte er finale Ursachen ab, und seine Einstellung ist durchweg antiteleologisch.
Die Welt wurde zu Anbeginn als etwas Vollkommenes geschaffen, und es gab für sie keine Notwendigkeit,
noch vollkommener zu werden. Gelegentlich lehnte er deutlich Platons Essentialismus ab, etwa wenn er
bemerkt, daß wir von der Vielfalt der Erscheinungen abstrahieren müssen, daß aber diese Abstraktionen
das Produkt unserer eigenen Intelligenz seien und nicht real. Doch die meisten seiner Interpretationen sind
typologischer Art, wie aus seiner Behandlung der Art deutlich wird.
Im ersten Band seiner Histoire naturelle verneinte Buffon die Existen von Arten, indem er behauptete,
es existierten lediglich Individuen. Diesen Gesichtspunkt gibt er im zweiten Band völlig auf. Dort definiert
er die Art folgendermaßen:
Wir sollten zwei Tiere als derselben Art angehörig ansehen, wenn sie sich durch Paarung fortsetzen und
die Ähnlichkeit der Art bewahren können, und wir sollten sie als Angehörige verschiedener Arten
betrachten, wenn sie nicht imstande sind, auf diese Weise Nachkommen zu erzeugen. So weiß man, daß
der Fuchs eine andere Art ist als der Hund, wenn sich als Tatsache erweist, daß aus der Paarung eines
Männchens und eines Weibchens dieser zwei Tiersorten keine Nachkommenschaft hervorgeht. Und
selbst, wenn ein Bastard daraus entstehen sollte, eine Art Maultier, so würde dies als Beweis ausreichen,
daß Fuchs und Hund nicht derselben Art angehören, denn dieses Maultier würde unfruchtbar sein.
Die Entstehung eines sterilen Bastardes beweist, daß wir es mit verschiedenen Arten zu tun haben, denn
für die Erhaltung einer Art „ist eine ununterbrochene, stetige und unveränderliche Reproduktion
notwendig". Wie Lovejoy sehr richtig sagt, setzt diese Ausdrucksweise nicht nur stillschweigend voraus,
daß Arten real sind, sondern auch, daß sie konstante und unveränderliche Entitäten sind. Arten sind für
Buffon Typen und nicht Populationen. Ein solch starrer Artbegriff im Verein mit dem Phänomen der
Sterilität der Hybriden machte den Gedanken einer evolutiven Abstammung einer Art von einer anderen
ganz und gar undenkbar. Buffons Definition der Art hat außerdem den Nachteil, daß sie nicht wirklich
einen Begriff definiert, sondern nur eine Methode liefert zur Überprüfung, ob zwei Individuen derselben
Art oder verschiedenen Arten angehören. Sie hat eine Unterscheidungsfunktion.
Buffons wichtigste Erörterung der Art von Fragen, die heute unter die Überschrift „Evolutionsbiologie"
fallen würden, finden sich in seinem Essay über die Degeneration von Tieren (1766). Hier vertritt er mit
allem Nachdruck die Ansicht, daß die Mehrheit der Variationen nichtgenetischer Natur und von der
Umgebung verursacht sei. Dies ließe sich aus der Tatsache ersehen, daß die Haustierrassen die variabelsten
aller Tiere sind, da der Mensch sie in alle Klimata verpflanzt und an eine große Futtervielfalt gewöhnt hat –
eine Meinung, der sich Darwin später anschloß.
Daß Buffon seine Ausbildung in den exakten Wissenschaften erfahren hat, tritt bei seiner Erörterung der
Variation besonders deutlich zutage. Seiner Überzeugung gemäß behauptet er, daß dieselben Ursachen
auch dieselben Wirkungen haben dürften. Tiere, die an gleichen Orten leben, müßten einander ähnlich sein,
da gleiches Klima gleiche Tiere und gleiche Pflanzen hervorbringe. Da er an den Primat der physikalischen
Ursachen glaubte, war er davon überzeugt, daß es auch auf anderen Planeten Leben gäbe, und errechnete
anhand von Schätzwerten der Abkühlungsgeschwindigkeit dieser Planeten, zu welcher Zeit das Leben dort
entstanden sein dürfte. Buffons Vorstellung von den Organismen als „Produkt" des Ortes, an dem sie
leben, spielte während der nächsten hundert Jahre eine wichtige Rolle im Denken der Biogeographen [18].
Aus all dem, was hier gesagt worden ist, dürfte deutlich geworden sein, warum kein Widerspruch
besteht zwischen der Aussage, daß Buffon kein Evolutionist war, und der Behauptung, er sei dennoch der
Vater des Evolutionsdenkens gewesen. Er war der erste, der eine lange Reihe von Evolutionsproblemen
erörterte – Probleme, die niemand vor ihm aufgeworfen hatte. Zwar gelangte er häufig zu falschen
Schlüssen, doch war er es, der diese Themen in das Repertoire wissenschaftlicher Fragestellungen
aufnahm. Obgleich er selbst evolutionäre Erklärungen ablehnte, lenkte er doch als erster die
Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt auf solche Erklärungen. Wir verdanken ihm umfangreiche
Abhandlungen über den Ursprung der Erde im allgemeinen und über Sedimentgesteine im besonderen; er
begründete die Bedeutung der Frage des Aussterbens von Tierarten; er warf die Frage auf, ob nah
verwandte Arten, wie Pferd und Esel, von demselben Vorfahren abstammen könnten; und schließlich war
er der erste, der dem Problem der Probleme, der Errichtung der Fortpflanzungsisolation (wie wir heute
sagen würden) zwischen zwei beginnenden Arten seine volle Aufmerksamkeit zuwandte.
Welches war, alles in allem genommen, der Nettoeffekt von Buffons Denken auf die zukünftige
Entwicklung des Evolutionsdenkens? Er befindet sich zweifellos in der zweideutigen Position, das
Evolutionsdenken sowohl gehindert als auch gefördert zu haben. Er hinderte es dadurch, daß er häufig die
Doktrin von der Unveränderlichkeit der Arten vertrat. Er hinderte es außerdem dadurch, daß er ein
Artkriterium einführte (Fruchtbarkeit unter den Angehörigen einer Art), das in den Augen seiner
Zeitgenossen evolutive Veränderungen unmöglich machte. In der Tat hat die Frage, wie eine Art eine
andere Art hervorbringen könne, von der sie durch die Unfruchtbarkeitsschranke getrennt ist, einigen
Genetikern noch in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts zu schaffen gemacht (Bateson, 1922;
Goldschmidt, 1940). Diese Vorbehalte Buffons, denen sich alle besser unterrichteten Geister seiner Zeit
anschlossen, waren der Grund, warum ein bloßes Demonstrieren des evolutiven Wandels nicht ausreichte,
um die Evolutionslehre zu begründen. Nötig war vielmehr eine Demonstration, auf welche Weise die Kluft
zwischen den Arten überbrückt werden konnte, und diese wurde später von den Vertretern der
geographischen Artbildung geliefert.
Weitaus wichtiger jedoch sind Buffons positive Beiträge zum Evolutionismus.
1. Mit seiner ausführlichen Analyse führte er den Gedanken der Evolution in den Bereich der
Wissenschaft ein, wo er seither als angemessener Forschungsgegenstand zu behandeln war.
2. Er verallgemeinerte die Ergebnisse seiner anatomischen Untersuchungen (zusammen mit seinem
Mitarbeiter Daubenton) durch Einführen des Begriffs der „Einheit des Typus". Daraus entstand erst die
Schule der idealistischen Morphologie und anschließend die der vergleichenden Anatomie, die so viel
Beweismaterial zugunsten der Evolution beitrug.
3. Mehr als jeder andere war er für eine neue Chronologie der Erde verantwortlich, das heißt dafür, daß
man einen ungeheuren Zeitmaßstab für die Erde akzeptierte.
4. Er war der Begründer der Biogeographie. Als er aus Opposition zu Linnaeus die Arten nach ihren
Herkunftsländern anordnete, gruppierte er sie in Faunen. Die Anhäufung von Listen von Faunen durch
Buffon und seine Nachfolger diente als Grundlage für weitreichende Verallgemeinerungen. In der Tat
leitete Darwin mehr Beweise für die Evolution aus den Fakten der Verbreitung als aus jedem anderen
biologischen Phänomen ab (siehe Kapitel 10).
Vor Buffon besaß die Naturgeschichte alle Kennzeichen einer Nebenbeschäftigung, eines Hobbys. Er
war es, der sie auf das Niveau einer Wissenschaft emporhob. Ein großer Teil der Histoire Naturelle enthält,
was wir heute „Ökologie" nennen würden; andere Teile sind dem Studium des Verhaltens gewidmet. Hier
bestätigte sich in großartiger Weise erneut der Wert des Studiums ganzer Tiere als Gegengewicht zu den
atomisierenden Einflüssen der zeitgenössischen Physiologie, insbesondere da Buffon selbst ebenfalls an
Physiologie, Entwicklung und organischen Molekülen interessiert war. Welche Autoren aus der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts man auch immer liest, ihre Abhandlungen sind letzten Endes lediglich
Kommentare zu Buffons Werk. Mit Ausnahme von Aristoteles und Darwin hat kein anderer Erforscher von
Lebewesen jemals einen derart weitreichenden Einfluß gehabt.
Diderot
Von den führenden Geistern der Aufklärung war keiner stärker an lebenden Organismen interessiert als
Denis Diderot (1713-1784). In mehreren Aufsätzen in der Encyclopédie und vor allem in einer Reihe
ideenreicher Essays setzte er sich immer wieder mit Ursprung und Natur des Lebens, Zufall oder
Determinismus, Wechselwirkung von Molekülen, Urzeugung, der Rolle der Umgebung und ähnlichen
Fragestellungen auseinander [19]. Diderot war offenbar ein eifriger Leser, und bei seinen Überlegungen
entlehnte er großzügig Ideen von Buffon, Leibniz, Maupertuis, Condillac, Bordeu, Haller und anderen
Zeitgenossen. Er trug nur wenige eigene schöpferische Gedanken bei, doch hatte er durch die brillante Art
und Weise, in der er gängige Spekulationen zu einem erklärenden Schema zusammenfügte, großen Einfluß
auf die französischen Intellektuellen. Sein vielleicht kühnstes Essay war Le rêve d'Alembert, das 1769
geschrieben, aber erst 1830 offiziell veröffentlicht wurde. Doch zirkulierte kurz nach seiner Fertigstellung
eine Version unterderhand in Paris, so daß sein Inhalt in den Pariser Salons zweifellos bestens bekannt war;
es ist als fast sicher anzunehmen, daß Lamarck mit ihm vertraut war. Die Atmosphäre des Werkes kommt
in den Fieberphantasien des D' Alembert ausgezeichnet zum Ausdruck:
Alle Geschöpfe sind mit dem Leben aller anderen Geschöpfe verknüpft… Die ganze Natur befindet sich
in einem fortwährenden Zustand des Fließens. Jedes Tier ist mehr oder weniger ein menschliches Wesen,
jedes Mineral mehr oder weniger eine Pflanze, jede Pflanze mehr oder weniger ein Tier… Nichts in der
Natur ist klar abgegrenzt… Ist irgendein Atom in der Natur einem anderen genau gleich? Nein Stimmst du
mir nicht darin zu, daß in der Natur alles mit allem anderen verbunden ist und daß kein Bruch in der Kette
sein kann?… Es gibt nur ein einziges großes Individuum, und das ist das Ganze… Ihr armen Philosophen,
ihr redet über Essenzen! Vergeßt die Idee der Essenzen… und was ist mit den Arten? Arten sind bloße
Tendenzen in Richtung auf ein ihnen gemeinsames Ziel hin… Und das Leben? Eine Reihe von Aktionen
und Reaktionen… Das lebendige Molekül ist der Ursprung von allem, es gibt keinen einzigen Fleck in der
ganzen Natur, der nicht Schmerz oder Freude empfände.
Dieser kurze Monolog enthält eine Liste praktisch aller von der Klassik bis zu den damals modernen
Philosophen wie Leibniz und Buffon vertretenen Ideen über Leben und Materie. Obgleich einige der
Elemente von Diderots späteren Auffassungen eine Rolle in Evolutionstheorien spielten, war Diderot selbst
keineswegs ein Anhänger des Evolutionsgedankens. In seinen Schriften ist in keiner Weise stillschweigend
die Ansicht enthalten, daß sich das Leben auf der Erde mit der Zeit verändert. Zu der Zeit, als er Le rêve
schrieb, war er kompromißloser Atheist geworden. Seine Welt war nicht „geschaffen"; sie besaß keine der
„geplanten" Merkmale der Welt der Naturtheologen. Es war eine durchweg materialistische Welt der
Moleküle. Vielleicht der bemerkenswerteste Satz in Le rêve ist: „Die Organe erzeugen die Bedürfnisse, und
umgekehrt produzieren die Bedürfnisse die Organe." Dieser Gedanke, der allem Anschein nach von
Condillac stammte, sollte schließlich zu einem der Eckpfeiler von Lamarcks Evolutionstheorie werden.
Entwicklungen in anderen Teilen Europas
Die meisten bisher erwähnten Denker waren Franzosen, und Frankreich hatte in der Tat im 18.
Jahrhundert die geistige Führung Europas inne. Aber auch in Großbritannien (insbesondere in Schottland),
Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien gärte es beträchtlich. Tatsächlich übernahmen
Großbritannien und Deutschland nach dem Tod Lamarcks und Cuviers die Führung auf dem Gebiet. In
Deutschland war es nach Leibniz und dessen außergewöhnlicher Originalität ziemlich ruhig geworden.
Doch gab es vielerlei Anzeichen dafür, daß der Theismus schwächer wurde. An seine Stelle trat ein
liberaler Deismus, das heißt, eine Ablehnung aller Offenbarung, einschließlich der Bibel, der seine höchste
Blüte in den Schriften von Reimarus erlebte [20]. In der Biologie beeinflußte Reimarus hauptsächlich die
Interpretation des tierischen Verhaltens. Der einflußreichste Denker der Epoche war jedoch der Historiker
Johann Gottfried Herder [21], dessen wichtigster Beitrag seine Betonung des historischen Denkens und der
Vielfalt war. In seinem vierbändigen Werk Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (17841791) befaßt er sich nicht nur mit der „Entstehung des Menschen", sondern auch ausführlich mit dem
Universum und der Welt der Tiere und Pflanzen.
Herder übte dadurch, daß er alle Fragen konsequent unter dem historischen Blickwinkel anging, großen
Einfluß auf das Denken Goethes, Kants und der Naturphilosophen aus. Doch er war, wie alle anderen
Deutschen auch, Essentialist, und die Umgestaltung einer Art in eine andere war für ihn undenkbar.
Herders Grundvorstellung von der lebendigen Welt war die einer verzeitlichten scala naturae, doch kam er
niemals ins Reine mit dem Problem, wie man von Pflanzen zu Tieren oder von einfachen Tieren zu
höheren Tieren gelangen könnte. Nichtsdestoweniger bestand er darauf: „… von den Pflanzen zum Tier,
von diesen zum Menschen sahen wir die Form der Organisation steigen, mit ihr auch die Kräfte und Triebe
des Geschöpfs vielartiger werden und sich endlich alle, in der Gestalt des Menschen, sofern diese sie fassen
konnte, vereinen." Viele von Herders Gedanken stammen von Buffon, obgleich er sie häufig erheblich
erweitert, wie bei seiner Behandlung des Kampfes ums Dasein.
Kant ist häufig als Vorläufer Darwins bezeichnet worden, allerdings ohne Rechtfertigung, wie mehrere
Autoren eindeutig bewiesen haben, unter ihnen besonders überzeugend Lovejoy (1959 d). Zwar sah Kant
deutlich die Problematik, wie aus der Erörterung der Anpassung in seiner Kritik der Urteilskraft (1790)
hervorgeht, da er jedoch durch und durch Essentialist war, konnte er sich eine Evolution einfach nicht
vorstellen. Er war tief beeindruckt von Buffons Argument, wonach die Unfruchtbarkeitsbarriere die scharfe
Abgrenzung der Arten gegeneinander aufrechterhielt, und nahm dies als eindeutigen Beweis für die
Unmöglichkeit, durch irgendetwas wie Evolution von einer Art zu einer anderen zu gelangen. Es ist ihm
niemals gelungen, den Widerspruch zwischen der Diskontinuität der Arten und der Kontinuität im
Universum zu lösen, die er in seiner Kosmologie wie auch durch sein Festhalten an der großen Rangfolge
der Vervollkommnung zum Ausdruck brachte. Der scheinbare Widerspruch zwischen den rein
mechanischen Gesetzen der Physik und Chemie und der vollkommenen Anpassung aller Organismen, die
einen ad hoc-Schöpfungsakt zu erfordern schien, stellte Kant vor ein Problem, das zu lösen er nicht in der
Lage war (Mayr, 1974d, S. 383-404; Lovejoy, 1959 d, S. 173-206).
Niemand spiegelt das Denken des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Deutschland besser wider als J. B.
Blumenbach, der in seiner einflußreichen Naturgeschichte des langen und breiten über Mutabilität,
Aussterben, Urzeugung, Degeneration, Endursachen, Schöpfung, Katastrophen und Bildungstrieb schrieb.
Blumenbach besaß ein beträchtliches Wissen, war aber unfähig, sich von den herrschenden Ideen seiner
Zeit zu befreien.
England, das im 17. und frühen 18. Jahrhundert in der Philosophie (Locke, Berkeley, Hume), Physik und
Physiologie eine führende Rolle gespielt hatte, leistete im 18. Jahrhundert praktisch keinerlei Beitrag zum
Evolutionsdenken. Die einzige Ausnahme ist Erasmus Darwin [22], Charles Darwins Großvater, der sich in
seinem Werk Zoonomia (1796) in einige gelegentliche evolutionäre Spekulationen einließ. Er bildete sie
niemals weiter durch, und somit hatten sie erstaunlich wenig Einfluß auf spätere Entwicklungen. Eine
ausführliche Darstellung der Anschauungen von Erasmus Darwin ist nicht gerechtfertigt. Es sei lediglich
darauf hingewiesen, daß drei Annahmen in bezug auf seine Vorstellungen falsch sind:
1. Daß er Lamarck vorweggenommen oder gar, daß Lamarck seine Ideen von Erasmus Darwin bezogen
habe. Der Glaube an eine Vererbung erworbener Merkmale und andere Vorstellungen, die sich bei beiden
Autoren finden, waren zu jener Zeit weit verbreitet. Es ist kein Zweifel, daß Erasmus Darwins Werk
Lamarck nicht bekannt war.
2. Daß er seinen Enkel stark beeinflußte. In Charles Darwins Entstehung der Arten findet sich kaum eine
Spur von Erasmus Darwins Gedanken, und jener verneinte ausdrücklich einen derartigen Einfluß,
wenngleich die Lektüre von Zoonomia in seinen Notizbüchern einen Niederschlag findet (Hodge, 1981).
3. Daß er ein außerordentlich origineller Denker war. Erasmus Darwin war in erster Linie jemand, der
Ideen miteinander verflocht und populär machte; praktisch jede einzelne seiner Ideen läßt sich bis zu
früheren Autoren zurückverfolgen, mit denen er durch seine umfassende Lesetätigkeit vertraut war. Seine
sogenannten evolutionären Ideen waren in den Kreisen von Naturtheologen und britischen Tierzüchtern
weitverbreitet.
Für das mangelnde Interesse an dem Evolutionsgedanken im England des 18. Jahrhunderts gab es
mehrere Gründe. Die große Blüte des Empirizismus zu jener Zeit brachte eine Überbewertung der exakten
und experimentellen Wissenschaften mit sich. Die Beschäftigung mit der Naturgeschichte war gänzlich in
der Hand geweihter Pfarrer, was unvermeidlich zu dem Glauben an den perfekten Bauplan einer
geschaffenen Welt führte, einer Ansicht, die mit der Vorstellung von Evolution unvereinbar war.
Linnaeus
Auf den ersten Blick scheint es fehl am Platze zu sein, in einer Erörterung der Geschichte des
Evolutionsdenkens auch Carl Linnaeus (1707-1778) zu erwähnen, der oft als Erzfeind der Evolutionsidee
betrachtet wird. Dennoch spielte er eine wichtige Rolle (siehe Kapitel 4). Obschon von einer auf der
scholastischen Theorie der logischen Unterteilung aufbauenden Klassifikationstheorie ausgehend, legte er
die Fundamente für die Entwicklung einer natürlichen, hierarchischen Klassifikation, die mit der Zeit
tatsächlich die Annahme des Begriffes der gemeinsamen Abstammung notwendig machte. Er ahnte dunkel
die Verwandtschaft von Ordnungen und Klassen, wie seine wohlbekannte Aussage erkennen läßt: „Alle
Pflanzengruppen zeigen Verwandtschaft auf allen Seiten, wie Länder auf einer Weltkarte" (Philosophia
Botanica, 1750, S.77). Und doch zerstörte Linnaeus dadurch, daß er Gattungen, Ordnungen und Klassen
anerkannte, die „Kontinuität des Lebens", und ersetzte sie durch eine Hierarchie von Diskontinuitäten. Dies
war völlig mit dem essentialistischen Denken vereinbar, schuf aber einen Konflikt mit dem
Kontinuitätsglauben des Evolutionsdenkens. Kontinuität und Diskontinuität miteinander in Einklang zu
bringen, wurde damit zu einer der großen Herausforderungen an die Evolutionsbiologie.
Durch sein Beharren auf der Konstanz und Unveränderlichkeit der Arten im Gegensatz zu der
Verschwommenheit der eher nominalistischen französischen Schule machte Linnaeus die Entstehung von
Arten zu einem wissenschaftlichen Problem (Poulton, 1903; Mayr, 1957). Noch komplizierter wurde dieses
Problem durch seine Theorie von der Entstehung der Arten durch Hybridisierung, die er gegen Ende seines
Lebens vorschlug. Wie Ray, so lehnte auch Linnaeus die Heterogonie entschieden ab. In der Tat verneinte
er zumindest in seinen Hauptschriften alle und jede Transmutation einer Art in eine andere.
Sein waches Interesse am Gleichgewicht der Natur und am Kampf ums Dasein war wichtig für die
Entwicklung der Vorstellungen späterer Naturtheologen sowie der Anschauungen von de Candolle und
anderen vor-Darwinschen Denkern (Hofsten, 1958; Limoges, 1970). Es bildete einen wichtigen Teil des
begriffsmäßigen Hintergrundes, vor dem die Theorie der natürlichen Auslese entstand. Tatsächlich lassen
sich nicht wenige von Darwins Argumenten bis zu Linnaeus zurückverfolgen, selbst dort, wo sie die Ideen
von Linnaeus ablehnen. Kurz gesagt, Linnaeus leistete einen wichtigen Beitrag zu der Vorstellungswelt,
die später zur Entstehung der Evolutionstheorien führte [23].
Das Erbe der Vor-Lamarckschen Epoche
Im 17. und 18. Jahrhundert vollzog sich, wie wir gesehen haben, eine fast totale Umwälzung in der
Vorstellung des Menschen von der Natur. In einem „Zeitalter der Vernunft" war die Offenbarung nicht
mehr länger als letzte Autorität für die Erklärung von Naturerscheinungen annehmbar. Der Theismus
machte weitgehend dem Deismus oder sogar Atheismus Platz. Entdeckungen auf allen Gebieten
diskreditierten die Bibel als Quelle wissenschaftlicher Erklärung. Der Gott, der in den Lauf der Dinge
eingriff und Wunder tat, wurde durch das Bild eines Gottes ersetzt, der allgemeine Gesetze gibt, welche als
sekundäre Ursachen bei der Erzeugung aller konkreten Phänomene wirksam sind. Diese Auslegung stand
in Einklang mit der Entdeckung großer physikalischer Gesetze, nach denen Sonne und Planeten sich
automatisch und ohne göttlichen Eingriff bewegen. Die Begriffe Unendlichkeit der Zeit, Unbegrenztheit
des Raumes und kosmologische Evolution (Kant, Laplace) setzten sich durch. Entdeckungen in den
biologischen Wissenschaften stellten die kreationistisch-interventionistische Auslegung auf besonders
ernstzunehmende Weise in Frage. Zu diesen Entdeckungen gehörte die Heterogenität von Faunen und
Floren, immer größere Unterschiedlichkeit der Fossilien in den unteren Schichten, das Anwachsen des
Beweismaterials für die Häufigkeit des Aussterbens, die Linnaeische Hierarchie, die Entdeckung
morphologischer Typen, die Entdeckung mikroskopischer Organismen, die Anerkennung der
unglaublichen Angepaßtheit von Organismen, die Anfänge eines Denkens in Populationen anstelle des
typologischen Denkens.
Gegen Ende des Jahrhunderts war mittlerweile deutlich geworden, daß es zwei Hauptprobleme gab, für
die man eine Erklärung finden mußte: zum einen den Ursprung der Vielfalt und ihre anscheinend
ordentliche Anordnung in einem natürlichen System, und zum anderen die großartige Anpassung aller
Organismen aneinander und an ihre Umgebung. Der Essentialist sah sich darüber hinaus noch vor das
Problem gestellt, wie die Diskontinuität der Arten und höheren Kategorien mit der allgemeinen Kontinuität
aller Lebensphänomene in Einklang zu bringen sei. Schließlich gab es noch eine Reihe spezieller Rätsel,
die mit der Idee von der Weisheit und Güte des Schöpfers in Widerspruch zu stehen schienen, etwa die
Frage des Aussterbens oder der Existenz verkümmerter Organe. Der Schöpfungsglaube war eine Lösung,
die immer weniger befriedigte. Somit war der Weg frei für einen revolutionären neuen Start, und es war
lediglich eine Frage der Zeit, bis ein Naturforscher den Mut und die Originalität besitzen würde, eine dem
geltenden Dogma deutlich widersprechende Lösung vorzuschlagen. Es war der französische Biologe
Lamarck.
8 Evolution vor Darwin
Einem modernen Biologen erscheint die Zeitspanne, die zwischen den ersten provozierenden
Andeutungen des Evolutionismus in Leibniz' Protogaea (1694) und dem endgültigen Vorschlag der
Evolutionstheorie durch Lamarck (1800) verstrich, außerordentlich lang. Sein ganzes Leben lang hatte sich
Buffon an der Grenze der Evolutionslehre bewegt, zahlreiche andere Denker hatten sich eine verzeitlichte
Version der scala naturae zu eigen gemacht, keiner von ihnen aber hatte den entscheidenden Schritt getan,
die ununterbrochene Kette einer erschaffenen Stufenfolge von zunehmend vollkommeneren Lebewesen in
eine Abstammungslinie umzusetzen.
Lamarck
Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829) wurde in eine verarmte
nordfranzösische Adligenfamilie hineingeboren [1]. Mit siebzehn Jahren ließ er sich in die Armee
anwerben, focht im Siebenjährigen Krieg mit großer Tapferkeit in einer Reihe von Schlachten, ließ sich mit
neunzehn Jahren pensionieren und lebte seitdem in Paris von einer sehr kleinen Rente und dem, was er sich
mit literarischer Tagelohnarbeit an Wörterbüchern und dergleichen dazuverdienen konnte. Mit der Zeit
begann er ein sehr großes Interesse an Naturgeschichte, insbesondere Botanik, zu entwickeln und schrieb
schließlich ein vierbändiges Werk über die Flora Frankreichs, das für die Exzellenz seiner Beschreibungen
zu Recht gelobt wurde. Kurz darauf bestellte Buffon ihn zum Hauslehrer und Reisebegleiter seines Sohnes.
Dadurch erhielt Lamarck Gelegenheit, Italien und andere europäische Länder zu sehen; in der Tat waren es
die einzigen Reisen, die er in seinem Leben jemals unternommen hat. Im Jahre 1788 beschaffte Buffon ihm
eine Stelle als Assistent in der botanischen Abteilung des naturhistorischen Museums, die er während der
nächsten fünf Jahre innehatte. Während der annähernd dreißig Jahre, in denen er sich mit Pflanzen befaßte,
veröffentlichte er eine ungeheure Menge, und es kann kein Zweifel daran bestehen, daß er zu jener Zeit
von der Existenz gut abgegrenzter Arten überzeugt war, die „im Anfang geschaffen worden seien" und sich
danach nicht geändert hätten. Aus mehreren seiner Aussagen geht eindeutig hervor, daß er zu jener Zeit
essentialistisch dachte.
Im Jahre 1793 wurde Lamarck im Zuge der Neuorganisation der wissenschaftlichen Institutionen in
Frankreich zum Professor für die „niederen Tiere" ernannt – oder für die Wirbellosen, wie wir sie heute mit
dem Namen bezeichnen, den Lamarck ihnen gegeben hat. Diese neue Ernennung war das entscheidende
Ereignis seines Lebens. Mit enormer Energie wandte er sich dem Studium der zusammengewürfelten
Tiergruppe zu, die Linnaeus unter dem Namen „Würmer" zusammengefaßt hatte. Lamarck war bereits
neunundvierzig Jahre alt, als er sich mit diesen neuen Studien zu befassen begann, doch hatten sie ganz
offensichtlich einen revolutionierenden Einfluß auf seine Vorstellungen. Bis zu jener Zeit hatte er eine für
das 18. Jahrhundert typische Mischung aus Deismus und einer Synthese von Newtonschem und
Leibnizschem Gedankengut vertreten. Von Newton hatte er den Glauben an die Gesetzmäßigkeit des
Universums übernommen und die Überzeugung, daß alle Erscheinungen, nicht nur der unbelebten Natur,
sondern auch der „organisierten Körper", mit der Einwirkung von Bewegungen und Kräften erklärt werden
könnten. Von Leibniz hatte er eine optimistische Überzeugung von der perfekten Harmonie des
Universums, von vollkommener Vielfalt und Kontinuität übernommen. Diese Synthese führte zu
zahlreichen Widersprüchen, und es scheint auf der Hand zu liegen, daß Lamarck sich den Evolutionismus
zu eigen machte in dem Bemühen, wenigstens einige dieser Widersprüche zu lösen.
Lamarck hatte grandiose Pläne für eine universelle „Physik der Erde" (einschließlich der Biologie), und
zu diesem Ziel befaßte er sich ein wenig mit allen Zweigen der Naturwissenschaft. Er machte sich
lächerlich durch seine Einwände gegen Lavoisiers glänzende neue Entdeckungen auf dem Gebiet der
Sauerstoffchemie und durch seine meteorologischen Voraussagen. Er schrieb auch eine Geologie
(Lamarck, 1802 a), die von seinen Zeitgenossen praktisch ignoriert und erst neuerdings ins Englische
übersetzt wurde.
Es war eine der Pflichten seines neuen Professorenamtes, einen jährlichen Kurs über die Wirbellösen zu
halten. Mehrere Jahre lang widmete Lamarck die erste Vorlesung einem Discours d'ouverture. Die
Manuskripte dieser Vorlesungen (oder zumindest einige von ihnen) sind erhalten geblieben und zum Teil
vor kurzem veröffentlicht worden (Lamarck, 1907). Im Discours des Jahres 1799 spiegelt sich Lamarcks
Denkweise noch genauso wider, wie er sie von dem Botaniker A.-L. de Jussieu und der linnaeischen
Schule übernommen hatte: die Arten waren unveränderlich, und es gab keinen einzigen Hinweis auf die
Möglichkeit einer Evolution. Im Discours des darauffolgenden Jahres, den Lamarck am 11. Mai 1800 hielt,
treten seine neuen evolutionistischen Theorien zutage, die bereits die wesentlichen Punkte seiner
Philosophie zoologique (1809) enthalten. Offensichtlich hatte Lamarck zwischen 1799 und 1800 eine
„Bekehrung" erlebt, wie man das in der religiösen Literatur nennen würde. Was kann einen Mann, der
bereits 55 Jahre alt war, veranlaßt haben, seine bisherige Weltsicht aufzugeben und durch eine andere zu
ersetzen, die derart revolutionär war, daß niemand zuvor sie vertreten hatte?
Die Bemühungen um eine Erklärung von Lamarcks Evolutionismus sind in der Vergangenheit fast
ausnahmslos unbefriedigend gewesen, da man es versäumte, Lamarcks Gedanken über die evolutionären
Veränderungen an sich und seine Bemühungen um die Erklärung der dafür verantwortlichen
physiologischen und genetischen Mechanismen voneinander zu trennen. In der nun folgenden Darstellung
soll der Versuch gemacht werden, diese zwei Aspekte der Lamarckschen Evolutionstheorie sorgfältig
auseinanderzuhalten.
Darüber hinaus soll auch in entschiedener Weise versucht werden, Lamarck im Zusammenhang des
intellektuellen Milieus seiner Zeit zu interpretieren. Kaum ein anderer Autor hat in der Vergangenheit so
viel unter whiggischer Geschichtsschreibung gelitten wie Lamarck (siehe Kap. 1). Gewiß gehört er zu den
Figuren in der Geschichte der Biologie, die am schwierigsten zu erörtern sind. Daher gibt es
wahrscheinlich mehr verschiedene Interpretationen, ja de facto sogar Beschreibungen von Lamarcks
Denkweise, als dies für jede andere Figur zutrifft. Selbst wenn man von den veralteten Berichten absieht,
braucht man nur die kürzlich publizierten Darstellungen von Mayr, Hodge und Burkhardt zu vergleichen,
um diesen Punkt ermessen zu können. Intellektuell war Lamarck aufs Tiefste Descartes, Newton, Leibniz
und Buffon verpflichtet. Doch war er in seinem Denken auch ebenso eindeutig von seinem zoologischen
Material beeinflußt, insbesondere von der Variation und Fossiliengeschichte der Mollusken. Hodge (1971
a, b) weist sehr richtig darauf hin, daß man Lamarck nicht im Sinne von Darwins Evolutionstheorie
interpretieren kann und darf. Lamarck hatte keine Theorie über den Ursprung der Arten; ebensowenig zog
er die Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren in Betracht. Höchst bemerkenswert für einen
Naturforscher des frühen 19. Jahrhunderts, ließ er die geographische Verbreitung völlig außer acht und
verzichtete damit auf Tatsachenmaterial, das später zu einer der überzeugendsten Quellen von Darwins
Theorie der gemeinsamen Abstammung wurde.
Lamarcks neues Paradigma
Lamarck erklärt, seine neue Theorie sei nötig, um zwei wohlbekannte Erscheinungen in der Welt der
Organismen zu erklären. Erstens die Tatsache, daß bei den Tieren eine Abstufung in der Organisation, vom
unvollkommensten bis hin zum vollkommensten, festzustellen ist. Unter „zunehmender Perfektion"
verstand Lamarck die allmähliche Zunahme in „Tiersein" von den einfachsten Tieren bis hin zu jenen mit
der komplexesten Organisation, wobei der Mensch den Höhepunkt bildet. Er beurteilte Perfektion nicht im
Sinne der Angepaßtheit an die Umwelt oder der Rolle, die ein Organismus im Haushalt der Natur spielt,
sondern einfach als Komplexität. Die andere Erscheinung, die eine Erklärung verlangt, ist die erstaunliche
Vielgestaltigkeit der Organismen, angesichts derer man das Empfinden hat, „daß alles, was sich die
Vorstellungskraft nur ausdenken kann, tatsächlich entstanden ist". Wie es scheint, bezieht er sich auf das
Prinzip der Lückenlosigkeit von Leibniz.
Noch eine weitere Zutat fügte Lamarck hinzu: die tatsächliche Transformation der Arten in einer
phyletischen Linie. „Nach vielen aufeinander folgenden Generationen sind diese Individuen, die
ursprünglich einer anderen Art angehörten, in eine neue, von der ersten verschiedenen Art umgewandelt"
(1809, S.38-39)*. Überall in seinen Abhandlungen wiederholt Lamarck, daß der evolutive Wandel langsam
und allmählich vor sich gehe: „Die Natur hat bei den belebten Körpern alles nach und nach und eins nach
dem andern hervorgebracht; daran zu zweifeln ist nicht mehr möglich" (S.ll). In einer Erörterung von
ursprünglich im Wasser lebenden Tieren bemerkt er: „Nachdem nun die Natur die Wassertiere aller Stufen
hervorgebracht… hatte, brachte sie einen Teil derselben dazu, in der Luft, und zwar zuerst am Rande der
Gewässer… zu leben" (S.70).
„Da diese Veränderungen nur mit ungeheurer Langsamkeit, für uns mithin unbemerkbar vor sich gehen,
so scheinen die Verhältnisse und Anordnungen der Teile für den Beobachter… immer gleichzubleiben"
(S.30). „So muß man einsehen, daß jeder Organismus unmerklich ein wenig abändern muß, besonders in
seiner Gestalt und in
_____________
*Zitiert nach Zoologische Philosophie. Leipzig: Alfred Kröner Verlag 1909. Die Seitenangaben
beziehen sich allerdings auf die Originalausgabe
seinen äußeren Charakteren, obschon diese Abänderung erst nach beträchtlich langer Zeit bemerkbar
wird" (S.45). Es bedurfte „ohne Zweifel einer enorm langen Zeit und einer beträchtlichen Veränderung in
den aufeinanderfolgenden Verhältnissen, bis die Natur die Organisation der Tiere zu der Stufe der
Verwickelung und Entwickelung bringen konnte, die wir bei den vollkommensten beobachten" (S.50).
Dies ist jedoch keine Schwierigkeit, da „man weiß, daß die Zeit für sie [die Natur] keine Grenzen hat, und
daß sie ihr folglich immer zur Verfügung steht" (S. 114).
Zahlreiche Lamarck-Forscher haben sich gefragt, welche neuen Beobachtungen oder neuen Einsichten
Lamarck dazu veranlaßt haben konnten, sich im Jahre 1800 diesen neuen Blickpunkt zu eigen zu machen.
Was geschehen ist (Burkhardt, 1977), war anscheinend folgendes: Gegen Ende der neunziger Jahre des 18.
Jahrhunderts übernahm Lamarck nach dem Tode seines Freundes Bruguiére die Molluskensammlung des
Pariser Museums. Als er sich an die Erforschung dieser Sammlungen machte, die sowohl fossile als auch
rezente Mollusken enthielten, entdeckte er, daß es für viele der lebenden Arten von Miesmuscheln und
anderen Meeresmollusken analoge Stücke unter den versteinerten Arten gab. Ja, in vielen Fällen war es
sogar möglich, die Fossilien der älteren und jüngeren Tertiärschichten in einer chronologischen Reihe
anzuordnen, an deren Ende eine rezente Art stand. In einigen Fällen, in denen das Fundmaterial vollständig
genug war, gelang es sogar, praktisch ununterbrochene phyletische Linien aufzustellen. In anderen Fällen
zeigte sich, daß die rezente Art bis weit in die Tertiärschichten zurückreichte. Die Schlußfolgerung war
unausweichlich: Viele phyletische Linien hatten im Verlauf der Zeit einen langsamen und allmählichen
Wandel durchgemacht. Wahrscheinlich war keine andere Tiergruppe so geeignet wie die
Meeresmollusken, den Forscher zu einer solchen Schlußfolgerung zu führen. Cuvier, der zur gleichen Zeit
fossile Säugetiere studierte, die im Durchschnitt eine sehr viel raschere Evolution aufweisen als
Meeresmollusken, kam zu dem Ergebnis, daß keiner der fossilen Elefanten oder anderen fossilen Typen ein
lebendes Analogon besaß, und schloß daraus, daß die älteren Arten ausgestorben und durch völlig neue
Arten ersetzt worden seien. Für Lamarck war die Tatsache, daß er Abstammunglinien erkannte, von
besonderer Bedeutung, brachte sie ihm doch die Lösung für ein Problem, das ihn offensichtlich lange Zeit
hindurch beunruhigt hatte: das Problem des Aussterbens.
Ausgestorbene Arten
Seit man sich intensiver mit dem Studium der Fossilien befaßte, war deutlich geworden, daß viele fossile
Arten den lebenden Arten ganz unähnlich sind. Ein auffallendes Beispiel sind die in vielen Ablagerungen
aus dem Mesozoikum so reichlich vorkommenden Ammoniten. Die Frage wurde brennender, als man im
18. Jahrhundert fossile Säugetiere entdeckte, etwa die Mastodonten in Nordamerika und Mammuts in
Sibirien. Schließlich beschrieb Cuvier ganze Faunen fossiler Säugetiere aus mehreren Horizonten des
Pariser Beckens. Die nüchtern denkenden Naturforscher und Fossilienforscher akzeptierten schließlich die
Tatsache, daß die Erde in früheren Zeiten von Geschöpfen bewohnt gewesen war, die inzwischen
ausgestorben waren, wenn auch nicht alle zur gleichen Zeit. Blumenbach zum Beispiel erkannte eine ältere
Periode, in der Tiere, hauptsächlich marine Organismen wie Muscheln, Ammoniten und Terebratulae
ausgestorben waren, und eine neuere Periode, in der Lebewesen ausgelöscht wurden, die überlebende
Verwandte besitzen, wie Höhlenbär und Mammut. Herder hatte bereits von zahlreichen Erdumwälzungen
gesprochen, und andere Autoren von Katastrophen, die alle dazu führten, daß Organismen vernichtet
wurden. Für andere Naturforscher war die Vorstellung des Aussterbens aus verschiedenen ideologischen
Gründen unannehmbar. Für die Naturtheologen war sie ebenso undenkbar wie für die Anhänger Newtons,
für die alles im Universum durch Gesetze geregelt war. Außerdem verstieß sie gegen das Prinzip der
Lückenlosigkeit, da die Ausmerzung einer Art eine Lücke in der Fülle der Natur hinterlassen würde.
Schließlich stand sie noch im Widerspruch zu den Vorstellungen von einem Gleichgewicht der Natur,
denen zufolge es keine Ursachen für das Auftreten von Aussterben geben würde (Lovejoy, 1936, bes.
S.243, 256).
Während des ganzen 18. Jahrhunderts war die Ansicht weit verbreitet, das Aussterben sei mit der
Allmacht und Güte Gottes unvereinbar. In einer Erörterung über Fossilien bemerkte John Ray 1703: „Es
würde daraus folgen, daß viele Arten von Schalentieren aus der Welt verloren gegangen sind, was die
Philosophen bisher nicht zuzugeben bereit waren, da sie meinen, die Zerstörung einer beliebigen Art
bedeute ein Zerstückeln des Universums und mache es unvollkommen; dagegen meinen sie, die Göttliche
Vorsehung sei besonders darum besorgt, die Werke der Schöpfung zu sichern und zu bewahren" (PhysicoTheological Discourses, 3. Aufl., 1713, S. 149).
Die Philosophen zur Zeit der Aufklärung und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren in ihrer
Mehrheit Deisten. Ihrem Gott war es nicht gestattet, in den Lauf der Welt einzugreifen, nachdem er sie
einmal geschaffen hatte. Jedes derartige Eingreifen wäre ein Wunder, und welcher Philosoph konnte es
sich leisten, für Wunder einzutreten, nach dem, was Hume und Voltaire über sie gesagt hatten? Damit
gerieten die Philosophen in ein peinliches Dilemma. Entweder mußten sie leugnen, daß es überhaupt
Aussterben gab (und das war es, im großen und ganzen, was Lamarck tat) oder ansonsten mußten sie
postulieren, daß zum Zeitpunkt der ursprünglichen Schöpfung ein Gesetz verfügt worden sei, das für das
ständige Verschwinden alter und Auftreten neuer Arten im Ablauf der geologischen Zeit verantwortlich
war. Wie aber konnte ein solches Gesetz („für die Einführung neuer Arten") Anwendung finden, ohne daß
ein „besonderer Schöpfungsakt" eintrat? Dies war der (niemals ganz deutlich ausgesprochene) Einwand
Darwins gegen Lyell, der ein solches Gesetz postulierte. Doch kehren wir zu den Bemühungen zurück, das
Aussterben „hinwegzuerklären".
Im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts wurden vier Erklärungen für dieses Verschwinden fossiler
Arten vorgeschlagen; bei keiner von ihnen ging es um „natürliches Aussterben".
Eine Erklärung bestand darin, die ausgestorbenen Tiere seien von Noahs Sintflut oder sonst irgendeiner
anderen großen Katastrophe getötet worden. Diese Erklärung, die sich in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreute, war mit Lamarcks These der allmählichen Veränderung
unvereinbar. Da es sich außerdem bei so vielen „verlorengegangenen Arten" um Wassertiere handelte,
schien eine Vernichtung durch die Sintflut ganz und gar unvernünftig.
Eine zweite Erklärung ging dahin, daß angeblich ausgestorbene Arten sehr wohl in noch unerforschten
Teilen des Erdballs überlebt haben könnten: „Es gibt noch so viele Teile der Erdoberfläche, wohin wir
noch nicht gelangt sind, so viele, welche beobachtungsfähige Menschen nur flüchtig besucht haben, und
noch andere, bei welchen es, wie bei den verschiedenen Teilen des Meeresgrundes, uns wenig möglich ist,
die sich dort aufhaltenden Tiere wahrzunehmen; diese Orte könnten wohl die Arten, die wir nicht kennen,
verbergen" (Lamarck, 1809, S.44).
Schließlich wurde das Aussterben von einigen mit der Tätigkeit des Menschen erklärt. Diese Erklärung
wurde insbesondere für die großen Säugetiere wie Mammut und Mastodon vorgebracht.
Diese drei Erklärungen ließen immer noch viele, wenn nicht die meisten Fragen um das Aussterben
unbeantwortet. Die Entdeckung fossiler Arten, die noch lebenden Arten glichen, lieferte Lamarck daher die
seit langem gesuchte Lösung eines großen Rätsels. „Wäre es nicht möglich, daß die versteinerten
Individuen, um die es sich handelt, noch lebenden Arten angehören, die sich indessen seither verändert und
die Entstehung der gegenwärtig noch lebenden Arten veranlaßt haben?" (1809, S.45). Mit anderen Worten:
Aussterben ist lediglich ein Scheinproblem. Die Ganzheit der Natur ist nirgends unterbrochen, die
seltsamen Arten, die wir nur als Fossilien vorfinden, existieren immer noch, haben sich aber derart stark
verändert, daß sie nicht mehr erkennbar sind, es sei denn, wir verfügen über kontinuierliche
Fossilienhorizonte und, wie wir heute sagen würden, die Evolutionsrate war außerordentlich langsam.
Evolutiver Wandel war also die Lösung für das Problem des Aussterbens. Darüber hinaus bot das Studium
der Evolution eine weitere Möglichkeit, die Harmonie der Natur und die Weisheit des Schöpfers zu
demonstrieren.
Als Lamarck diese Schlußfolgerungen zog, merkte er sofort, daß diese Erklärung noch aus einem
anderen Grund eminent logisch war. Die Erde hat sich während der ungeheuer langen Zeit, in der sie
existiert, fortwährend verändert. Da sich eine Art in vollkommener Harmonie mit ihrer Umgebung
befinden muß und da sich diese Umgebung unaufhörlich ändert, muß eine Art, wenn sie in harmonischer
Ausgewogenheit mit ihrer Umgebung bleiben will, ebenfalls einen ständigen Wandel durchmachen. Täte
sie das nicht, liefe sie Gefahr, auszusterben. Mit der Einführung des Zeitfaktors hatte Lamarck die
Achillesferse der Naturtheologie entdeckt. Es wäre möglich, daß ein Schöpfer in einer statischen Welt von
kurzer Dauer einen perfekten Organismus entwürfe. Wie aber hätten die Arten in vollkommener Weise an
ihre Umgebung angepaßt bleiben können, wenn sich diese in beständigem und manchmal recht drastischem
Wandel befand? Wie hätte der Bauplan alle Klimaänderungen, alle Umgestaltungen der physischen
Struktur der Erdoberfläche und alle wechselnden Zusammensetzungen von Ökosystemen (Räuber und
Konkurrenten) voraussehen können, wenn die Erde Hunderte von Millionen Jahre alt war? Unter diesen
Umständen können Anpassungen nur erhalten bleiben, wenn sich die Organismen ständig an die neuen
Bedingungen anpassen, d. h. wenn sie evoluieren. Gewiß, als gute Naturbeobachter hatten die
Naturtheologen die Bedeutung der Umwelt und der Adaptationen der Lebewesen an diese klar erkannt,
doch hatten sie es versäumt, den Zeitfaktor in Betracht zu ziehen. Lamarck war der erste, der die
entscheidende Bedeutung dieses Faktors erkannte.
Eine starke Unterstützung seiner neuen Evolutionslehre fand Lamarck in seinen geologischen Studien
(Lamarck, 1802 a). Wie alle Leibnizianer war er Uniformitarianer, was in der Tat auf die meisten
Naturforscher im 18. Jahrhundert zutraf. Er postulierte ein hohes Erdalter und stellte sich, ebenso wie
Buffon, vor, daß im Verlauf dieser ungeheuren Zeiträume Veränderungen stattgefunden hatten. Die Dinge
waren in einem ständigen Wandel begriffen, aber dieser Wandel war ungeheuer langsam. Dieses Bild einer
sich ganz allmählich verändernden Welt paßte außerordentlich gut zu einer evolutionistischen
Interpretation. Doch stand es diametral im Gegensatz zu der in einem Fließgleichgewicht befindlichen Welt
Huttons, die keinerlei gerichteten Wandel enthielt und daher evolutionistischen Erklärungen ablehnend
gegenüberstand.
Noch weniger vereinbar war der Evolutionismus natürlich mit dem essentialistischen Denken, das heißt
mit dem Glauben an unveränderliche, diskontinuierliche Typen. Für einen Essentialisten waren
Veränderungen in der Erdfauna nur mit katastrophenartigem Aussterben und Neuschöpfungen erklärbar.
Diese Sicht kommt in den Schriften Cuviers und seiner Anhänger zum Ausdruck. Lamarck war
bedingungslos gegen jede Form von Katastrophentheorie; dies geht aus seinen zoologischen Schriften wie
auch aus seiner Hydrogeologie (1802 a, S. 103) unzweifelhaft hervor.
Zwar hatte diese neue Transmutationstheorie mehrere Probleme gelöst, doch stand sie immer noch vor
fürchterlichen Rätseln. Wäre Lamarck ein unkritischer Anhänger von Bonnets Stufenleiter der
Vervollkommnung mit ihrem allmählichen, ununterbrochenen Übergang von unbelebter Materie bis hin
zum vollkommensten Lebewesen gewesen, so hätte er nichts anderes zu tun brauchen, als sein Prinzip vom
Übergang der Arten auf die scala naturae anzuwenden. Doch Lamarck war keineswegs ein rigoroser
Anhänger Bonnets, so sehr er auch von einer abgestuften Reihe der Perfektion überzeugt war [2]. Sogar in
seinen relativ frühen Schriften betonte er, es gäbe keinen Übergang von der unbelebten Natur zu den
Lebewesen. Und obgleich er, der Vater des Begriffes Biologie, ein überzeugter Verfechter der
grundlegenden Einheit von Tieren und Pflanzen war, lehnte er dennoch nachdrücklich jeden allmählichen
Übergang zwischen den beiden Reichen ab.
Doch der Unterschied zwischen Lamarck und Bonnet ging sogar noch tiefer. Die vergleichende
anatomische Forschung am Pariser Museum, insbesondere in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts,
hatte immer mehr Diskontinuitäten zwischen den verschiedenen morphologischen Typen, den
Wirbeltieren, Mollusken, Spinnen, Insekten, Würmern, Quallen, Infusorien und so weiter, ergeben. Im
Gegensatz zu der von Bonnet vertretenen Ansicht bilden sie keine abgestufte Reihenfolge von Arten. „Eine
solche Anordnung gibt es nicht, vielmehr spreche ich von einer nahezu abgestuften Reihenfolge der
Hauptgruppen [masses], etwa der großen Familien; man kann mit Recht behaupten, daß diese Reihe im
Pflanzen- wie auch im Tierreich besteht, daß sie aber, wenn man die Gattungen und insbesondere die Arten
betrachtet, an vielen Stellen seitliche Verzweigungen bildet, deren Enden wirklich isolierte Punkte
darstellen" {Discours XIII, S.29). Das Bild einer geradlinigen Kette wird in Lamarcks Schriften
fortschreitend durch das eines sich verzweigenden Baumes ersetzt. 1809 erkannte er zwei gänzlich
getrennte Entwicklungslinien im Tierreich an, deren eine von den Infusorien zu Polypen und Strahlentieren
verlief, während die andere, die die Mehrheit der Tiere enthielt, von den durch Urzeugung entstandenen
Würmern ausgehend anstieg. Um das Jahr 1815 erkannte Lamarck eine sogar noch größere Zahl
unabhängiger Stammeslinien an.
Der Verzweigungsprozeß war in Lamarcks Augen ein Anpassungsprozeß und nicht, wie es Darwin und
spätere Evolutionisten verfochten, in erster Linie ein Vorgang zur Hervorbringung der Vielgestaltigkeit der
Arten. Denn die Formenvielfalt des organischen Lebens war für alle, die nicht mehr an eine geplante und
geschaffene Welt glaubten, zu einem quälenden wissenschaftlichen Problem geworden. Als Erklärung für
den Ursprung neuer phyletischer Linien schien es nur zwei vorstellbare Möglichkeiten zu geben, spezielle
Schöpfungsakte oder Urzeugung (Farley, 1977). Damit „Lebewesen wirklich Erzeugnisse der Natur sein
können, muß die Natur die Fähigkeit gehabt haben und noch haben, einige von ihnen direkt zu erzeugen",
sagte Lamarck (1802 b, S. 103). Doch Lamarck kannte die Forschungsarbeiten von Redi und Spallanzani
und verneinte (im Gegensatz zu Maupertuis, La Mettrie und Diderot) die Möglichkeit, daß sich organische
Moleküle, selbst unter Bedingungen größerer Wärme in vergangenen Erdzeitaltern, zu komplexen Tieren
wie Elefanten zusammenfinden könnten. „Einzig und allein unter den Infusorien scheinen Urzeugungen
stattzufinden, die sich unaufhörlich, jedesmal wenn die Verhältnisse günstig sind, erneuern. Wir werden zu
zeigen versuchen, daß die Natur durch sie die Mittel erworben hat, auf vielen Umwegen, nach Ablauf
ungeheurer Zeiten, alle anderen Tierrassen hervorzubringen" (1809, S.66). Sobald erst einmal diese
niederen Organismen entstanden sind, sorgen die bekannten Verfahren der Evolution für ihre weitere
Entwicklung auf eine größere Vollkommenheit hin: „Die Natur [hat] in ihrem Gange – wie sie es noch
heute tut – mit der Schöpfung der einfachsten Organismen begonnen… und… unmittelbar nur diese d. h.
nur die ersten Anfänge der Organisation erzeugt, was man mit dem Namen Urzeugung bezeichnet" (1809,
S.40). Allerdings akzeptierte Lamarck auch ohne zu zögern die Urzeugung von Eingeweidewürmern und
nahm an, sie wären die Ausgangsbasis für die Evolution vieler höherer Organismen. Der Übergang von
einem Typ von Organismen zu einem komplexeren wurde, so meinte er, durch den Erwerb einer neuen
Fähigkeit erreicht, der wiederum durch den Erwerb einer neuen Struktur oder eines neuen Organs bedingt
war (siehe unten).
War Lamarck der erste konsequente Evolutionist?
In einer Reihe von Büchern über die Geschichte der Biologie findet man lange Listen von „frühen
Evolutionisten" aufgeführt. Ja, H. F. Osborn füllt ein ganzes Buch, Front the Greeks to Darwin (1894), mit
Berichten über derartige Vorläufer Darwins. Wie wir in Kapitel 7 gesehen haben, gelingt es bei genauerer
Analyse nicht, die Behauptung zahlreicher Vorläufer zu bestätigen, vertraten diese doch entweder
„Ursprungs"theorien oder Theorien über die Entfaltung immanenter Möglichkeiten des Typus. Eine echte
Evolutionstheorie muß eine allmähliche Umgestaltung einer Art in eine andere und zwar ad infinitum
postulieren. Keinerlei Gedanken dieser Art finden sich in den Schriften von de Maillet, Robinet, Diderot
und anderen, die angeblich Lamarck beeinflußt hatten. Mehrere von Lamarcks Vorgängern, zum Beispiel
Maupertuis, hatten einen plötzlichen Ursprung neuer Arten postuliert. Linnaeus zeigte sich in seinen
späteren Schriften stark beeindruckt von der Möglichkeit einer unbegrenzten Erzeugung neuer Arten durch
Hybridisierung. Buffon hatte die mögliche Umgestaltung einer Art in eine nahe verwandte Art erwogen,
sich aber nachdrücklich geweigert, dieselbe Schlußfolgerung auf eine mögliche Transformation ganzer
Familien anzuwenden. Für alle diese sogenannten Vorläufer war die Natur im wesentlichen statisch.
Lamarck ersetzte dieses statische Weltbild durch ein dynamisches, in dem nicht nur die Arten, sondern die
gesamte Stufenleiter von Lebewesen und das gesamte Gleichgewicht der Natur beständig in Fluß waren.
Noch Buffon hatte die enorme Kluft zwischen den Tieren und dem Menschen betont. Lamarck schlägt
entschlossen eine Brücke über diese Kluft, indem er den Menschen als Endprodukt der Evolution ansieht.
In der Tat ist seine Beschreibung des Pfades, auf dem unser anthropoider Ahnherr zum Menschen wurde,
verblüffend modern: „Wenn irgend eine Affenrasse, hauptsächlich die vollkommenste derselben, durch die
Verhältnisse oder durch irgend eine andere Ursache gezwungen wurde, die Gewohnheit, auf den Bäumen
zu klettern und die Zweige sowohl mit den Füßen als mit den Händen zu erfassen, um sich daran
aufzuhängen, aufzugeben, und wenn die Individuen dieser Rasse während einer langen Reihe von
Generationen gezwungen waren, ihre Füße nur zum Gehen zu gebrauchen und aufhörten, die Füße ebenso
zu brauchen wie die Hände, so ist es nach den im vorigen Kapitel angeführten Bemerkungen nicht
zweifelhaft, daß die Vierhänder schließlich zu Zweihändern umgebildet wurden, und daß die Daumen ihrer
Füße, da diese Füße nur noch zum Gehen dienten, den Fingern nicht mehr opponiert werden konnten…".
Und sie würden sich anstrengen, aufrecht zu stehen, „bewogen durch das Bedürfnis,… weit und breit um
sich zu sehen" (1809, S. 88). Lamarck trug hier seine Ansicht über den Ursprung des Menschen mit
weitaus mehr Mut vor, als Darwin dies fünfzig Jahre später in seinem Origin tun sollte. Der Mensch stellt
„hinsichtlich seiner Organisation doch nur den Typus der höchsten Vollkommenheit dar, welche die Natur
erreichen konnte. Je näher also eine tierische Organisation der seinigen steht, desto vollkommener ist sie"
(1809, S.45). Da die Evolution ein fortwährender Prozeß ist, wird sich auch der Mensch weiter entwickeln,
so daß „endlich zwischen dieser hervorragenden Rasse und den vollkommensten Tieren ein Unterschied
und gewissermaßen ein beträchtlicher Abstand entstanden sein muß, weil dieselbe eine absolute
Oberherrschaft über alle anderen erlangt hat" (1809, S.89). Obgleich der Mensch inzwischen gewisse
Merkmale erworben hat, die bei keinem Tier zu finden sind, oder zumindest nicht in ähnlicher Perfektion,
hat er nichtsdestoweniger die meisten seiner physiologischen Merkmale mit den Tieren gemein. Diese
Merkmale lassen sich sehr oft leichter an Tieren als am Menschen erforschen, man sollte sich daher
„bemühen…, die Organisation der anderen Tiere kennen zu lernen" (1809, S.7), um den Menschen voll
und ganz verstehen zu können. Aristoteles hatte seine Studien der Naturgeschichte der Tiere mit demselben
Argument gerechtfertigt.
Lamarcks Mechanismen des evolutiven Wandels
Lamarck erkannte zwei verschiedene Ursachen als für den evolutiven Wandel verantwortlich an. Als
erstes eine Fähigkeit zum Erwerb immer größerer Komplexität (Perfektion). „Die Natur hat alle Tierarten
nacheinander hervorgebracht. Sie hat mit den unvollkommensten oder einfachsten begonnen und mit den
vollkommensten aufgehört. Sie hat ihre Organisation graduell entwickelt" (1809, S.83). Die Ursache dieses
Trends zu immer größerer Komplexität liegt in „Mächten, die von dem ,erhabenen Urheber aller Dinge*
verliehen worden sind" (1809, S.60, 130). „Konnte seine unendliche Macht nicht eine Ordnung der Dinge
schaffen, die nacheinander alles, was wir sehen können, sowie alles andere, das existiert, das wir aber nicht
sehen können, ins Dasein riefe?". Oder, wie er es 1815 ausdrückte, die Natur „gibt dem Leben der Tiere die
Macht fortschreitend komplizierterer Organisation". Es gibt keinen Zweifel, daß Lamarck die Fähigkeit,
fortschreitend komplexere Organisationsformen anzunehmen, für ein dem Tierleben innewohnendes
Potential hielt. Es war ein Naturgesetz, das keiner besonderen Erklärung bedurfte.
Die zweite Ursache für den evolutiven Wandel war eine Fähigkeit, auf spezielle Bedingungen in der
Umwelt zu reagieren. Wenn der innere Trieb zur Perfektion die einzige Ursache der Evolution wäre, sagt
Lamarck, so fände man eine einzige, schnurgerade, lineare Stufenfolge in Richtung auf die
Vollkommenheit vor. Stattdessen entdecken wir in der Natur jedoch besondere Anpassungen aller Art bei
Arten und Gattungen. Dies, so Lamarck, ist der Tatsache zu verdanken, daß sich die Tiere stets in völliger
Harmonie mit ihrer Umwelt befinden müssen, und es ist das Verhalten der Tiere, wodurch diese Harmonie,
wenn sie gestört worden ist, wiederhergestellt wird. Die Notwendigkeit, auf besondere Umstände in der
Umwelt zu reagieren, löst demnach die folgende Kette von Ereignissen aus:
1. jede erhebliche und fortgesetzte Veränderung in den Umständen einer Tierrasse hat eine wirkliche
Veränderung ihrer Bedürfnisse („besoins") zur Folge;
2. jede Veränderung in den Bedürfnissen der Tiere macht eine Anpassung ihres Verhaltens (andere
Handlungen) erforderlich, damit die neuen Bedürfnisse befriedigt werden, und somit andere
Gewohnheiten;
3. jedes neue Bedürfnis, das zu seiner Befriedigung neue Handlungen erfordert, führt dazu, daß das Tier
entweder einige Körperteile häufiger gebraucht als zuvor, wodurch diese erheblich entwickelt und
vergrößert werden, oder aber daß es neue Körperteile gebraucht, die diese Bedürfnisse „durch ihre
Triebhaftigkeit unbemerkt in ihnen erzeugen" („par des efforts de sentiments intérieures").
Lamarck war weder Vitalist noch Teleologe. Selbst der Trend zu „fortschreitend komplexerer oder
perfekterer Organisation" war nicht durch irgendein mysteriöses orthogenetisches Prinzip bedingt, sondern
das zufällige Nebenprodukt des Verhaltens und der Verrichtungen, die zur Befriedigung neu entstandener
Bedürfnisse nötig waren. Somit waren zunehmende Vollkommenheit und die Reaktion auf neue
Anforderungen der Umgebung lediglich zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Der entscheidende Unterschied zwischen den Evolutionsmechanismen Darwins und Lamarcks liegt
darin, daß für Lamarck die Umwelt und ihre Veränderungen an erster Stelle standen. Sie waren es, die in
den Organismen Bedürfnisse und Verrichtungen hervorriefen, und diese waren ihrerseits die Ursache der
adaptiven Variation. Für Darwin dagegen war zuerst die zufällige Variation da, und die ordnende Tätigkeit
der Umwelt („natürliche Auslese") kam später. Somit wurde die Variation nicht, weder direkt noch
indirekt, von der Umwelt verursacht.
Um eine rein mechanistische Erklärung der evolutiven Veränderung zu liefern, entwickelte Lamarck
eine ausgeklügelte physiologische Theorie, die sich auf die Ideen von Cabanis und anderer Physiologen des
18. Jahrhunderts stützte und die Einwirkung äußerer Reize sowie die Bewegung „feiner Flüssigkeiten"
(subtile fluids) im Körper heranzog, wie sie durch die Anstrengung, den neuen Bedürfnissen zu genügen,
hervorgerufen wurden. Letzten Endes waren diese physiologischen Erklärungen kartesianische
Mechanismen und natürlich gänzlich ungeeignet.
Relativ wenige von Lamarcks Vorstellungen waren völlig neu, doch ordnete er diese Ideen in neue
kausale Abfolgen und wandte sie auf die Evolution an. Allerdings hat sich bisher niemand bemüht, diesen
Vorstellungen bis zu ihren ursprünglichen Quellen nachzuspüren. Eins der Schlüsselelemente in Lamarcks
Theorie, die Behauptung, die Anstrengungen zur Befriedigung von Bedürfnissen spielten bei der
Abänderung eines Individuums eine wichtige Rolle, läßt sich bis zu Condillac und Diderot
zurückverfolgen. Verhalten, das durch Bedürfnisse verursacht ist, stellt einen Schlüsselfaktor in Condillacs
Erklärung des tierischen Verhaltens dar (1755); und Diderot sagte in seinem (1769 geschriebenen) Le rêve
de D'Alembert ganz einfach: „Die Organe produzieren die Bedürfnisse, und umgekehrt bringen die
Bedürfnisse die Organe hervor" (S. 180). Mehr als das brauchte Lamarck nicht, um den Aufstieg von
einem Typ von Organismen zu einem vollkommeneren zu erklären. Er hielt diesen Mechanismus für so
einflußreich, daß er meinte, er könne sogar neue Organe schaffen: „Neu aufgetretene Bedürfnisse, die eine
Notwendigkeit für ein Organ hervorrufen, führen als Resultat der gemachten Anstrengungen tatsächlich zur
Existenz jenes Körperteils".
Zwar mag es so aussehen, als seien die höheren Taxa durch große Lücken voneinander getrennt, das ist
aber nur scheinbar so, da „die Natur… ohne einen Sprung zu machen, von einem System zu einem anderen
übergeht". Bei der Erörterung der zehn von ihm anerkannten Klassen von Wirbellosen (1809, S.66) bestand
Lamarck dogmatisch darauf, daß „in der Nähe der Grenzen, auf halbem Wege zwischen zwei Klassen,
Rassen existieren können, ja müssen". Wenn wir diese postulierten Zwischenglieder nicht finden können,
so kommt das daher, daß sie noch nicht entdeckt worden sind, entweder weil sie in einem entfernten Teil
der Welt leben oder als „Folge der Lückenhaftigkeit unserer Kenntnis der lebenden oder ausgestorbenen
Tiere" (1809, S.13). Mit seinem Hinweis auf „ausgestorbene Tiere" und der Aussage, „daß die lebenden
Tiere eine… verzweigte, unregelmäßig abgestufte Reihe bilden" (1809, S.22), scheint Lamarck der
Vorstellung der gemeinsamen Abstammung sehr nahe gekommen zu sein, doch entwickelte er sie nie. Er
war es zufrieden, daß er einen Mechanismus gefunden zu haben glaubte, mit dem er das Überbrücken der
Lücke zwischen den höheren Taxa erklären konnte.
Der Gedanke, daß ein Organ durch Gebrauch gestärkt und durch Nichtgebrauch geschwächt wird, war
natürlich alt; Lamarck gab ihm lediglich eine seiner Ansicht nach strengere physiologische Auslegung.
Dennoch sah er in dieser Vorstellung einen der Ecksteine seiner Theorie und definierte sie als sein „Erstes
Gesetz": „Bei jedem Tier, welches den Höhepunkt seiner Entwicklung noch nicht überschritten hat, stärkt
der häufigere und dauernde Gebrauch eines Organs dasselbe allmählich, entwickelt, vergrößert und kräftigt
es proportional der Dauer dieses Gebrauchs; der konstante Nichtgebrauch eines Organs macht dasselbe
unmerkbar schwächer, verschlechtert es, vermindert fortschreitend seine Fähigkeiten und läßt es endlich
verschwinden" (1809, S.73). Dieses Prinzip des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs ist im Volksmund
natürlich immer noch weitverbreitet und spielte, wie wir später sehen werden, sogar eine gewisse Rolle in
Darwins Denken.
Das zweite Hilfsprinzip der evolutiven Anpassung ist die Überzeugung, daß erworbene Merkmale
vererbt werden. Lamarck formuliert dies in seinem „Zweiten Gesetz" folgendermaßen: „Alles, was die
Individuen durch den Einfluß der Verhältnisse, denen ihre Rasse lange Zeit hindurch ausgesetzt ist, und
folglich durch den Einfluß des vorherrschenden Gebrauchs oder konstanten Nichtgebrauchs eines Organs
erwerben oder verlieren, wird durch die Fortpflanzung auf die Nachkommen vererbt, vorausgesetzt, daß die
erworbenen Veränderungen beiden Geschlechtern oder den Erzeugern dieser Indivduen gemein sind"
(1909, S. 73).
Lamarck gibt nirgendwo an, durch welchen Mechanismus (Pangenesis?) die Vererbung der neu
erworbenen Merkmale vor sich geht. Wie Zirkle (1946) gezeigt hat, war diese Vorstellung vom Altertum
bis ins 19. Jahrhundert hinein derart weit verbreitet, daß für Lamarck keine Notwendigkeit bestanden hat,
sich darüber auszulassen. Er stellte diesen Grundsatz lediglich in den Dienst der Evolution. Als der
Lamarckismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts wiederauflebte, nahmen die meisten, die Lamarck niemals
im Original gelesen hatten, kurioserweise an, Lamarckismus bedeute lediglich den Glauben an die
Vererbung erworbener Merkmale. Somit erhielt Lamarck sowohl Anerkennung als auch Tadel für ein
Konzept, das er angeblich begründet hatte, das jedoch zu seiner Zeit allgemein vertreten wurde.
Bevor wir diese Erörterung von Lamarcks Paradigma wieder verlassen, möchte ich darauf aufmerksam
machen, daß zwei Vorstellungen, die man Lamarck häufig zuschreibt, in ihm nicht enthalten waren. Die
erste ist eine direkte Erzeugung neuer Merkmale durch die Umwelt. Lamarck selbst lehnte diese Auslegung
mit den Worten ab: „Es wird hier nötig, mich über den Sinn zu erklären, den ich mit den Ausdrücken
verbinde: Die Umwelt wirkt auf die Gestalt und auf die Organisation der Tiere ein, d.h. sie verändern mit
der Zeit, wenn sie sehr verschieden werden, durch entsprechende Modifikationen sowohl diese Gestalt als
auch sogar die Organisation.
Wenn man diese Feststellung buchstäblich nehmen wollte, so würde man mich sicherlich eines Irrtums
zeihen; denn welcher Art auch die Umwelt sein mag, direkt bewirkt sie in der Organisation der Tiere
durchaus keine Abänderung" (1809, S.69). Selbst „bei den Pflanzen, wo keine Tätigkeiten und folglich
keine eigentlichen Gewohnheiten vorhanden sind, führen nichtsdestoweniger große Veränderungen der
Verhältnisse große Unterschiede in der Entwicklung ihrer Teile herbei, so daß einige derselben entstehen
und sich entwickeln, während andere schwächer werden und verschwinden. Aber hier geschieht alles durch
die Veränderungen in der Ernährung der Pflanze, in ihrer Absorption und Transpiration, in der Menge der
Wärme, des Lichtes, der Luft und der Feuchtigkeit, die sie dann für gewöhnlich erhält, und endlich in der
Überlegenheit, welche gewisse Lebensbewegungen über die anderen erlangen können" (1809, S.70). Mit
anderen Worten, die Veränderungen in der Struktur werden von den inneren Tätigkeiten der Pflanzen in
Verbindung mit ihrer Reaktion auf die Umwelt hervorgebracht, wie bei einer Pflanze, die zum Licht hin
wächst.
Die zweite Überzeugung, die man irrtümlicherweise Lamarck zuschreibt, hat mit dem Effekt des
Willens zu tun. Lamarcks Leser haben ihm fast immer eine Theorie der Willenskraft zugeschrieben. So
spricht beispielsweise Darwin von „Lamarck'schem Unsinn… der Anpassungen in Folge des langsam
wirkenden Willens der Tiere" (Brief vom 11. Januar 1844 an J.D. Hooker). Zum Teil ist das
Mißverständnis durch die schlechte Übersetzung des Wortes besoin mit „Wille" statt „Bedürfnis"
hervorgerufen worden wie auch dadurch, daß man Lamarcks sorgfältig entwickelter Kette der Kausalitäten
– von Bedürfnissen über Anstrengungen, physiologische Reize, Anregung des Wachstums bis hin zur
Produktion von Strukturen – keine Aufmerksamkeit schenkte. Lamarck war nicht so naiv, daß er dachte,
Wunschdenken könne neue Strukturen hervorbringen. Für ein volles Verständnis seines Denkens muß man
wissen, daß er kein Vitalist war, sondern ausschließlich mechanistische Erklärungen akzeptierte. Er war
auch kein Dualist, in seinen Arbeiten gibt es nirgendwo einen Hinweis auf eine Dualität von Materie und
Geist. Und schließlich war er auch kein Teleologe, denn er erkannte keinerlei von einem höheren Wesen
vorherbestimmte Ausrichtung der Evolution auf ein Ziel hin an.
Eine ausführliche Analyse von Lamarcks erklärendem Modell zeigt, daß dieses bemerkenswert komplex
war. Es bediente sich solch allgemein akzeptierter Vorstellungen wie der Wirkung von Gebrauch und
Nichtgebrauch von Organen und der Vererbung erworbener Eigenschaften, es nahm für die einfachsten
Organismen Urzeugung an, wie jeder jederzeit für die Erzeugung von Infusorien aus in Wasser
eingeweichtem Heu zu zeigen imstande war (wobei er jedoch vollauf der Demonstration von Spallanzani
und Redi zustimmte, daß Urzeugung für höhere Organismen unmöglich sei); außerdem griff Lamarck auf
die physiologischen Ideen von Cabanis und anderen über die Wechselwirkung zwischen der Reizung feiner
Flüssigkeiten aufgrund von Anstrengungen und den sich daraus ergebenden Effekten auf die Strukturen
zurück. Für den Laien, der die Mehrheit der Glaubenssätze, aus denen es sich zusammensetzte, vertrat, war
Lamarcks Paradigma in höchstem Maße überzeugend. Dies ist der Grund dafür, daß ein Teil der
Lamarckschen Ideen fast hundert Jahre nach der Veröffentlichung von Darwins The Origin of Species
immer noch in so weiten Kreisen vertreten wurde.
Der Unterschied zwischen den Theorien Lamarcks und Darwins
Lange Zeit hat es einen nutzlosen Streit darüber gegeben, ob nun Lamarck ein „Vorläufer" Darwins
gewesen sei oder nicht (Barthelemy-Madaule, 1979) [3]. Darwin selbst verneinte ausdrücklich, irgendeinen
Nutzen von Lamarcks Buch gehabt zu haben, „das wahrer Blödsinn ist… ich habe keine einzige Tatsache
oder Idee daraus entnommen". In einem etwas wohlwollenderen Moment stellte er jedoch fest: „Aber die
Schlußfolgerungen, zu denen ich gelange, sind von seinen nicht weit entfernt; obgleich die Mittel und
Wege des Wandels ganz und gar verschieden sind" (Rousseau, 1969). Zur Erleichterung des
Verständnisses von Darwins Theorie werden an dieser Stelle einige der Komponenten einer
Evolutionstheorie angeführt:
Die Tatsache der Evolution als solche. Die einfache Frage hier lautet, ob die Welt statisch ist oder ob sie
sich entwickelt. Sogar die Vertreter der These vom Entfalten immanenter Potentialitäten waren letzten
Endes vom unveränderlichen Charakter der Essenzen überzeugt. Lamarcks Theorie stand in krassem
Gegensatz zu diesen Theorien einer statischen oder in einem Fließgleichgewicht befindlichen Welt. Es
besteht kein Zweifel, daß er Anerkennung dafür verdient, der erste gewesen zu sein, der eine konsequente
Theorie eines echten evolutiven Wandels vertrat. Darüber hinaus postulierte er die allmähliche Evolution
und gründete diese Theorie auf die Annahme des progressiven Uniformitarianismus. In all diesen Aspekten
war er eindeutig Darwins Vorläufer.
Die Evolutionsmechanismen. Hier hätten Lamarck und Darwin nicht stärker voneinander abweichen
können. Die einzige (nicht ursprünglich von Lamarck stammende) gemeinsame Komponente war, daß sie
beide (wenn auch Darwin in viel geringerem Maße) an den Effekt von Gebrauch und Nichtgebrauch
(indirekte Vererbung) glaubten.
Ein vorrangiges Interesse entweder an der organischen Vielfalt oder an der Anpassung. Es besteht ein
fundamentaler und selten genügend beachteter Unterschied unter den Evolutionisten, je nachdem, ob in
ihren Interessen die organische Vielfalt (Artbildung) oder die Anpassung (phyletische Evolution) an
oberster Stelle steht. Darwin kam durch das Problem der Vervielfältigung der Arten (wie er sie auf den
Galápagosinseln vorfand!) zum Studium der Evolution. Somit galt, zumindest anfänglich, sein
Hauptinteresse dem Ursprung der organismischen Vielgestaltigkeit Evolution war Abstammung von
gemeinsamen Vorfahren. Dies hat zur Folge, daß der Erforscher der Vielfalt die Evolution anders
betrachtet als der Erforscher der phyletischen Evolution (Mayr, 1977 b).
Veränderungen in der Zeit (vertikale Dimension) sind in den Augen eines Darwinisten gewöhnlich
adaptiv. Lamarck hat niemals ausdrücklich ein Konzept der Anpassung formuliert, doch mußte die
gesamte, von ihm postulierte Kausalkette der Evolution unausweichlich zu Adaptation führen. Da die von
ihm beschriebene evolutive Kraft nicht teleologischer Art, sondern materialistisch war, produzierte sie die
Anpassung auf natürlichem Wege. Für den Darwinisten ist Anpassung das Resultat der natürlichen
Auslese. Für Lamarck war die Anpassung das unvermeidliche Endprodukt der physiologischen Prozesse,
die durch das Bedürfnis der Organismen, mit den Veränderungen in ihrer Umwelt fertigzuwerden, nötig
wurden (kombiniert mit einer Vererbung erworbener Merkmale). Mir scheint kein anderer Name zur
Bezeichnung seiner Evolutionstheorie möglich als adaptive Evolution. Der Erwerb neuer Organe und neuer
Fähigkeiten war eindeutig ein Anpassungsvorgang. Übernahm man Lamarcks Prämissen, so war seine
Theorie als Anpassungstheorie ebenso gerechtfertigt wie die Darwins. Leider erwiesen sich diese
Prämissen jedoch als ungültig.
Lamarck im Rückblick
Als man Lamarck, nachdem er lange Zeit vernachlässigt worden war, nach 1859 wiederentdeckte,
wandte man den Ausdruck „Lamarckismus" gewöhnlich auf die Vorstellung der indirekten Vererbung an.
Und je entschiedener diese Art der Vererbung widerlegt wurde, um so mehr wurde der Ausdruck
„Lamarckismus" zu einem Schmähwort. Die Folge davon war, daß man die Beiträge, die Lamarck als
hervorragender Wirbellosenzoologe und Pionier der Systematik geleistet hatte, völlig übersah. Ebenso
übersehen wurde seine wichtige Betonung von Verhalten, Umwelt und Adaptation – von Aspekten der
Biologie also, die die Mehrheit der zeitgenössischen Zoologen und Botaniker, deren Taxonomie rein
deskriptiv war, völlig vernachlässigte. Kein Autor vor Lamarck hatte so deutlich wie er die adaptive Natur
eines Großteils der Struktur der Tiere erkannt, insbesondere bei den Merkmalen von Familien und Klassen.
Mehr als alle anderen vor ihm machte Lamarck die Zeit zu einer der Dimensionen der Welt des Lebens.
Während der whiggischsten Periode der biologischen Geschichtsschreibung wurde Lamarck lediglich
wegen seiner unrichtigen Vorstellungen erwähnt, wegen seines Glaubens an indirekte Vererbung, an
angeborene Vervollkommnungsfähigkeit, und an Artbildung durch Urzeugung. Es ist an der Zeit, daß ihm
für seine beachtlichen intellektuellen Leistungen Anerkennung gezollt wird: für seinen echten
Evolutionismus, mit dem er selbst die komplexesten Organismen von Wimpertierchen oder wurmähnlichen
Vorfahren ableitete; für seinen unermüdlichen Uniformitarianismus, seine Betonung des hohen Erdalters,
seine Hervorhebung der Allmählichkeit der Evolution, seine Einsicht in die Bedeutung von Verhalten und
Umwelt, sowie für seinen Mut, den Menschen in den evolutiven Strom mit einzubeziehen.
Welchen Einfluß Lamarck tatsächlich auf die anschließende Entwicklung des Evolutionsgedankens
hatte, ist außerordentlich schwierig zu ermitteln (Kohlbrugge, 1914). In Frankreich wurde er fast völlig
ignoriert, Grant in Edinburgh bewunderte ihn, und durch Lyells Kritik (die Chambers zum Evolutionisten
machte!) wurde er in England weithin bekannt; weitaus am meisten wurde er aber allem Anschein nach in
Deutschland gelesen. Meckel zitierte ihn und benutzte ihn ausgiebig, und ebenso Haeckel, obgleich dieser
gleichzeitig die natürliche Auslese anerkannte. All dies trug dazu bei, daß sich die Evolutionslehre
durchsetzte. Schließlich jedoch wurde diese Popularität der Lamarckschen Gedanken zu einem Hindernis.
Sie ist mit dafür verantwortlich, daß sich die allgemeine Annahme des Darwinschen erklärenden Modells
und der Konstanz des Erbguts nach 1859 noch um etwa ein dreiviertel Jahrhundert hinzog.
Von Lamarck zu Darwin
Lamarcks Philosophie zoologique (1809) bedeutet den ersten Durchbruch des Evolutionismus. Doch
bedurfte es noch weiterer fünfzig Jahre, bis sich die Theorie der Evolution allgemein durchsetzte. Man
kann daraus nur schließen, daß das auf Schöpfungsglaube und Essentialismus beruhende Weltbild des 17.
und 18. Jahrhunderts zu mächtig war, um Lamarcks phantasiereichen, aber wenig begründeten Ideen zu
weichen. Dennoch ist eine Grunddünung evolutiver Vorstellungen nicht zu übersehen. Die allmähliche
Vermehrung des fossilen Materials, die Resultate der vergleichenden Anatomie, das Entstehen der
wissenschaftlichen Biogeographie und viele andere Entwicklungen in der Biologie 'trugen dazu bei, daß
man dem Evolutionsdenken immer aufgeschlossener gegenüberstand. Doch bedeutete dies nicht, daß
Lamarcks im 18. Jahrhundert wurzelnden, erklärenden Theorien dadurch akzeptabler wurden.
Man muß also einen deutlichen Unterschied machen zwischen dem Akzeptieren des
Evolutionsgedankens als solchem und der Annahme einer spezifischen Theorie zur Erklärung des
Evolutionsmechanismus. Dies ist vor allem deshalb nötig, weil wir, je weiter wir in das 19. Jahrhundert
vordringen, auf immer mehr Erklärungen der Evolution stoßen. Nicht immer ist es leicht, die Unterschiede
zwischen diesen verschiedenen Theorien zu verstehen, da einige Autoren mehrere Theorien oder zumindest
mehrere ihrer Komponenten miteinander verbanden. Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn ich an dieser Stelle
die wichtigsten Evolutionstheorien zusammenstelle und genau angebe, wie sie sich voneinander
unterscheiden. Jede von ihnen wurde, in der Zeitspanne von Darwin (oder Lamarck) bis zur synthetischen
Theorie der Evolution, von zahlreichen Anhängern verfochten.
Es lassen sich sechs Haupttheorien (jede wieder mehrfach unterteilt) erkennen:
1. Eine eingebaute Fähigkeit oder ein innerer Trieb zu wachsender Perfektion (autogenetische Theorien).
Dies war ein Teil von Lamarcks Theorie und wurde in weiten Kreisen vertreten, beispielsweise von
Chambers, Nägeli, Eimer (Orthogenese), Osborn (Aristogenese) und Teilhard de Chardin (Omegaprinzip).
2. Der Effekt von Gebrauch und Nichtgebrauch von Körperteilen, kombiniert mit einer Vererbung
erworbener Merkmale.
3. Ein direkter Einfluß der Umwelt (Induktion; von Lamarck verworfen, aber von Geoffrey Saint-Hilaire
übernommen).
4. Saltationismus (Mutationismus). Die plötzliche Entstehung neuer Arten oder noch stärker
verschiedener Typen (Maupertuis, Kölliker, Galton, Bateson, de Vries, Willis, Goldschmidt, Schindewolf).
5. Zufällige (stochastische) Differenzierung, bei der weder die Umwelt (direkt oder über die Auslese),
noch interne Faktoren die Richtung von Variation und Evolution beeinflussen (Gulick, Hagedoorn, „nichtDarwinsche Evolution").
6. Richtung (Ordnung), die der zufälligen Variation durch die natürliche Auslese aufgezwungen wird
(zum Teil Darwinismus, Neo-Darwinismus).
Die Theorien (1), (2) und (3) wurden gut mehr als hundert Jahre lang nach Lamarck von zahlreichen
Autoren vertreten. Der Saltationismus (4) ist heute als normaler Modus der Artbildung oder des Ursprungs
eines anderen neuen Typus widerlegt, doch wurde er für Sonderfälle (Polyploidie und gewisse
Chromosomen-Neuanordnungen) nachgewiesen. Wieweit zufällige Differenzierung (5) vorkommt, ist
gegenwärtig höchst umstritten.
Nichtsdestoweniger ist man sich fast allgemein darüber einig, daß die meisten mit Evolution und
Variation zusammenhängenden Erscheinungen mit Theorie (6) im Verband mit (5) erklärt werden können.
Die Auseinandersetzungen unter den Vertretern dieser sechs Theorien sind von Nichtbiologen häufig
fälschlicherweise als Kontroversen über die Gültigkeit der Theorie der Evolution an sich interpretiert
worden. Dies ist der Grund dafür, warum ich bereits an dieser Stelle auf die Existenz dieser verschiedenen
erklärenden Theorien aufmerksam gemacht habe, während doch in der Zeit unmittelbar nach Lamarck der
Hauptstreit lediglich um die Evolution als solche ging. Tatsächlich wurde die Mehrheit des neuen
Beweismaterials zugunsten der Evolution, das sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anzuhäufen
begann, zunächst einfach ignoriert. Allerdings war die Reaktion auf dieses neue Tatsachenmaterial in
Frankreich, Deutschland und England, den drei wichtigsten europäischen Ländern, in denen die
biologische Forschung kultiviert wurde, recht verschieden.
Ein Studium der Entwicklungen in diesen Ländern ist besonders wichtig, um den Gedanken zu
widerlegen, der Evolutionismus sei eine direkte Fortsetzung des befreiten, materialistischen und häufig
atheistischen Denkens der Aufklärung. Eine solche Interpretation wird durch die Fakten nicht bestätigt. Die
Aufklärung endete sozusagen mit der Französischen Revolution (1789), und in den darauffolgenden
siebzig Jahren war nicht nur, insbesondere in England und Frankreich, eine beträchtliche Reaktion zu
verzeichnen, es traten auch neue Entwicklungen auf, die für das Entstehen des Evolutionsgedankens
ebenso wichtig waren wie das Philosophieren der Aufklärung.
Frankreich
In Frankreich wurde die Szene während des Vierteljahrhunderts nach Lamarck eindeutig von Cuvier
beherrscht, obwohl dieser Lamarck nur um drei Jahre überlebte. Der einzige Versuch, weniger orthodoxe
Ideen zu vertreten, wurde von dem großen vergleichenden Anatomen Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
(1772-1844) unternommen. Alle seine frühen anatomischen Schriften sind durch völliges Fehlen jeglicher
evolutiver Interpretation gekennzeichnet [4]. Als er jedoch Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts
in Caen in Nordfrankreich bestimmte fossile Reptilien aus Juraschichten untersuchte, stellte er überrascht
fest, daß sie nicht, wie er erwartet hatte, Angehörige derart charakteristischer mesozoischer Typen wie
Plesiosaurus, sondern enge Verwandte der rezenten Gaviale (Krokodilartigen) waren. Dies brachte ihn auf
den Gedanken, daß möglicherweise tatsächlich eine Transformation der Jurakrokodile stattgefunden haben
könne, da „die Umwelt durchaus die Kraft habe, organisierte Körper umzuformen". In einem 1833
veröffentlichten Essay entwickelte er diesen Gedanken weiter, wobei er anscheinend zu erklären suchte,
warum verschiedene Tiere verschieden sind, obwohl sie in ihrem Bauplan im wesentlichen
übereinstimmen. In diesem Essay bemühte er sich um eine physiologische Erklärung, indem er einen
Effekt der Umwelt auf die Atmung heranzog, die ihrerseits eine drastische Veränderung in der Urngebung
der „Atmungsflüssigkeiten" notwendig macht, was wiederum eine tiefgreifende Auswirkung auf die
Struktur des Organismus hat. Im Gegensatz zu Lamarck braucht Geoffroy keine Veränderungen der
Gewohnheiten als Zwischenstufe zu Veränderungen der Physiologie. Seiner Ansicht nach löst die Umwelt
unmittelbar eine organismische Veränderung aus, eine Möglichkeit, die von Lamarck ausdrücklich
verworfen worden war. Obgleich die Neo-Lamarckisten gegen Ende des Jahrhunderts sehr viel von einer
solchen unmittelbaren Auslösung hielten, wäre es richtiger, diese Hypothese als „Geoffroyismus" zu
bezeichnen, wie einige Autoren dies tatsächlich getan haben. Der Umwelteinfluß wurde nach Geoffroy
während des embryonalen Stadiums ausgeübt, und um diese These zu beweisen, führte er ausgedehnte
Experimente mit Kükenembryonen durch.
Die These, Geoffroy sei in seinen späteren Jahren Evolutionist geworden, ist immer noch umstritten. Sie
wurde von Bourdier (1969) gewandt verfochten. Geoffroy glaubte nicht an eine gemeinsame Abstammung;
allerdings war er davon überzeugt, daß rezente Arten, die durch ununterbrochene Fortpflanzung von
vorsintflutlichen Arten abstammten, im Laufe dieser Zeit aufgrund äußerer Einflüsse erheblich verändert
worden waren.
Eine Reihe anderer Gedanken Geoffroys sind für den Evolutionsbiologen von Interesse. Zum Beispiel
gab er zu, einige der durch die Umwelt ausgelösten Veränderungen seien nützlicher als andere. Tiere, die
schädliche Veränderungen erworben haben, „werden aufhören zu existieren und durch andere ersetzt
werden, deren Gestalt sich geändert hatte, um den neuen Gegebenheiten zu entsprechen." Er brachte hier
eine typisch prä-Darwinsche Ausmerzungstheorie vor (siehe unten).
Es gibt mehrere Gründe, warum Geoffroys evolutionäre Überlegungen wenig bleibenden Einfluß hatten.
Er war Deist, in religiösen Fragen konservativ, und seine Theorie war keine Theorie der gemeinsamen
Abstammung, sondern bedeutete eher die Aktivierung des in einem gegebenen Typus bestehenden
Potentials. Einige seiner Aussagen waren recht widersprüchlich, und die von ihm vorgeschlagene
plötzliche Transmutation durch Saltation, von niedrigen eierlegenden Wirbeltieren zu Vögeln, war eine
erhebliche Belastung für die Theorie der Emergenz evolutiven Potentials. Sein Bestreben, dies dadurch
glaubhaft zu machen, daß er feststellte, eine solche drastische Veränderung könne nur durch eine ebenso
drastische und plötzliche Veränderung der Umwelt hervorgerufen werden, war keineswegs überzeugend.
Noch nachteiliger wirkte sich wahrscheinlich die niederschmetternde Niederlage aus, die Geoffroys
wichtigste anatomische These erlitt, nämlich die Ausdehnung der Einheit des Bauplans auf das gesamte
Tierreich (Kapitel 10).
Cuvier
Keiner brachte in der prä-Darwinschen Epoche eine solche Fülle neuer Kenntnisse hervor, die letztlich
die Evolutionstheorie stützten, wie Georges Cuvier (1769-1832) [5]. Er war es, der dem Studium der
Wirbellosen eine neue Grundlage gab, indem er die innere Anatomie dieser Gruppe entdeckte. Er
begründete die Paläontologie und wies für die Tertiärschichten des Pariser Beckens nach, daß jeder
Horizont seine eigene Säugetierfauna besaß. Und wichtiger: er zeigte, daß, je tiefer eine Schicht lag, um so
stärker die in ihr gefundene Fauna von der der Gegenwart abwich. Er bewies schlüssig, daß es tatsächlich
Aussterben gab, da die von ihm beschriebenen ausgestorbenen Mammuts und Mastodonten unmöglich in
irgendeinem entfernten Winkel der Welt hätten unbemerkt bleiben können, wie man dies für im Meer
lebende Organismen postulierte. Mehr als jeder andere hat Cuvier ein Recht darauf, als Begründer der
vergleichenden Anatomie angesehen zu werden, wurde doch bis nach der Veröffentlichung von Darwins
Origin of Species wenig zu den von ihm entwickelten Methoden und Prinzipien hinzugefügt. Bei Cuviers
Wissen und Erfahrung hätte man erwarten können, daß er der erste sein würde, der eine durch und durch
solide Evolutionstheorie vorschlagen würde. Tatsächlich aber stand Cuvier in seinem ganzen Leben dem
Gedanken der Evolution ablehnend gegenüber, und seine Argumente waren für seine Zeitgenossen derart
überzeugend, daß der Evolutionsgedanke sich selbst nach seinem frühen Tode während des nächsten
halben Jahrhunderts in Frankreich nicht durchsetzen konnte.
Welche Fakten oder Ideen waren für Cuviers hartnäckigen Widerstand verantwortlich? Es heißt häufig,
daß sein unerschütterliches Festhalten am Christentum den Glauben an die Evolution ausgeschlossen habe,
doch erbringt eine sorgfältige Analyse seiner Arbeiten keinen Beweis für diese Auslegung (Coleman,
1964). An keiner Stelle bezieht er sich bei seiner wissenschaftlichen Argumentation auf die Bibel, und
seine eigene Interpretation der Vorgeschichte befindet sich häufig in Konflikt zur Heiligen Schrift. So
akzeptierte er zum Beispiel, daß es vor der im Buch Mose