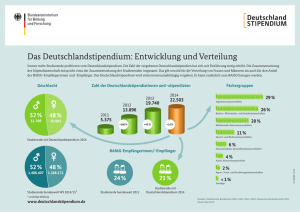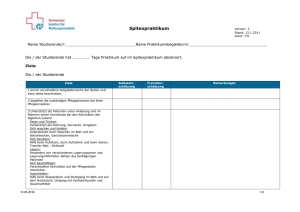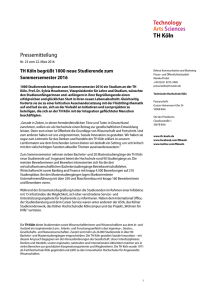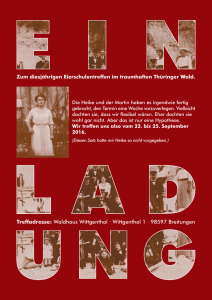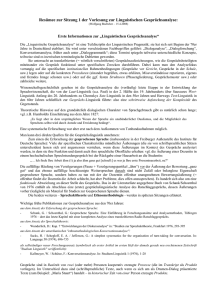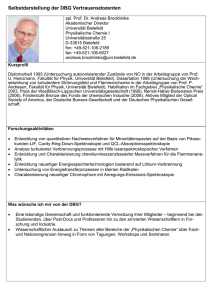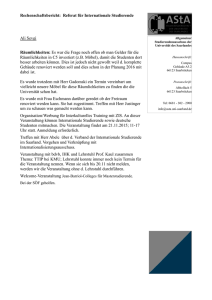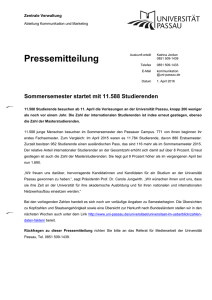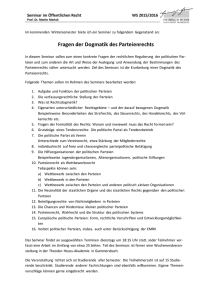Wilhelm Naber - Universität Bielefeld
Werbung
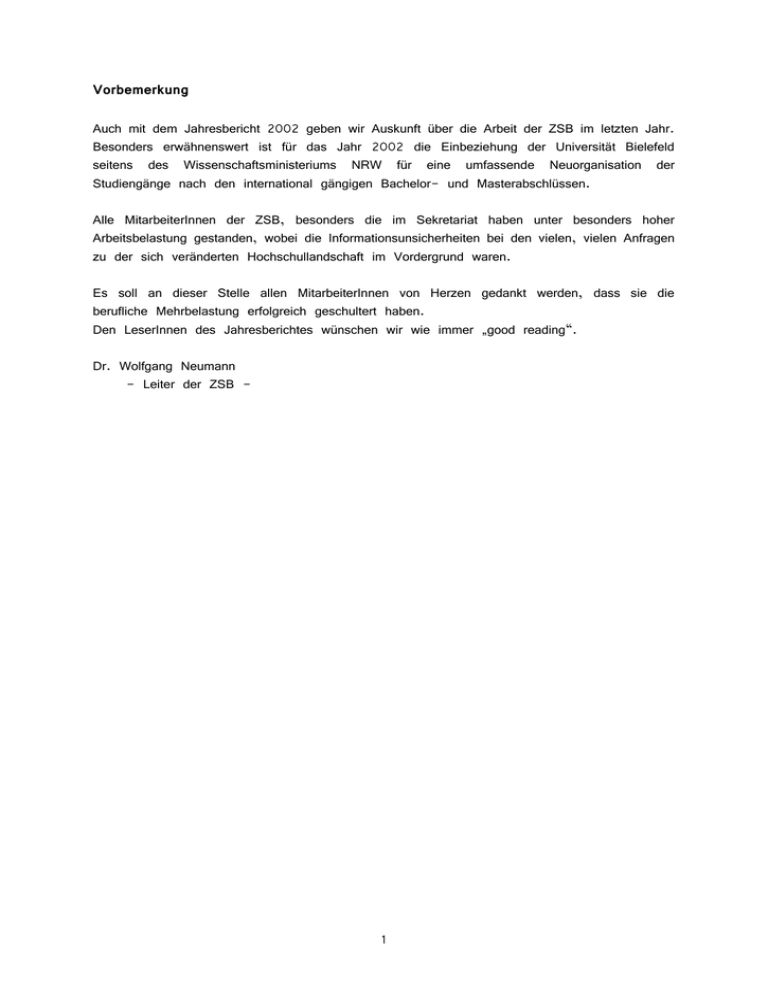
Vorbemerkung Auch mit dem Jahresbericht 2002 geben wir Auskunft über die Arbeit der ZSB im letzten Jahr. Besonders erwähnenswert ist für das Jahr 2002 die Einbeziehung der Universität Bielefeld seitens des Wissenschaftsministeriums NRW für eine umfassende Neuorganisation der Studiengänge nach den international gängigen Bachelor- und Masterabschlüssen. Alle MitarbeiterInnen der ZSB, besonders die im Sekretariat haben unter besonders hoher Arbeitsbelastung gestanden, wobei die Informationsunsicherheiten bei den vielen, vielen Anfragen zu der sich veränderten Hochschullandschaft im Vordergrund waren. Es soll an dieser Stelle allen MitarbeiterInnen von Herzen gedankt werden, dass sie die berufliche Mehrbelastung erfolgreich geschultert haben. Den LeserInnen des Jahresberichtes wünschen wir wie immer „good reading“. Dr. Wolfgang Neumann - Leiter der ZSB - 1 Roswitha Hofmann Jahresstatistik der ZSB - Zentrale Studienberatung für das Jahr 2002 - in Klammern Zahlen und Daten von 2001 - 1. Allgemeine Studienberatung (Insgesamt 21201 gezählte Beratungs- und Informationsanlässe) persönlich 46,71% 9903 Briefe 0,81% 171 1675 E-Mails 7,90% 9452 telefonisch 44,58% Persönliche Beratung: 9903(8001) Die persönlichen Beratungskontakte wurden auf drei Ebenen erfasst: 1. Studienberatungen während der offenen Sprechstunden (3759) (Montag - Freitag vormittags, ohne vorherige Terminabsprache): 2. Kurzinformationen durch die Mitarbeiterinnen des Sekretariats (ganztägig ohne vorherige Terminabsprache): 5268 4219 (3885) 3. Studienberatungen, die außerhalb der offenen Sprechstunden 416 (357) nach Vorabsprache durchgeführt wurden: Beratungsgespräche in der allgemeinen Studienberatung dauern wenige Minuten bis eine Stunde. Im Vergleich zum Vorjahr - das Geschlechterverhältnis war da in etwa ausgeglichen - ist der Frauenanteil sowohl innerhalb als auch außerhalb der offenen Sprechstunden 2 deutlich gestiegen. Telefonische Beratung: 9452(8630) Die telefonische Beratung wird ganztägig in Anspruch genommen; ein Drittel der telefonischen Anfragen wird zusätzlich schriftlich beantwortet (Versendung kommentierten Informationsmaterials). Die Anzahl ergibt sich aus hochgerechneten Stichprobenzählungen. Schriftliche Anfragen: insgesamt: 1846 E-Mails: 1675 (859) Briefe: 171 (361) Insgesamt wurden im Berichtsjahr 1846 Briefe und E-Mails an die ZSB gerichtet und Geisteswiss. beantwortet. Die Fragen richteten sich vor allem nach: 12,78% Lehrämter 1. Allgemeinen Anfragen zum Studium 633 19,54% (864) 155 Sozialwiss. (z.B. zum BA-Modell, Informationen zu Wohnmöglichkeiten, zum 14,76%Studium an der 237 Fachhochschule, zu Studiengängen, die nicht in Bielfeld angeboten werden 179 etc.) 35 2. Anfragen zu einzelnen Studienfächern der Universität Bielefeld 63 1213 (1084) 326 151 Zusatzstud. 2,89% Sport 5,19% 67 Naturwiss. 26,88% Wirtschaft 12,45% Jura 5,52% Geisteswissenschaften Sozialwissenschaften Sonstiges (11) Gesch./Phil. (19) Soziologie (42) Psychologie (92) Ling./Litw. (98) Pädagogik (45) 0 20 40 60 80 100 BHC (27) 0 20 40 60 80 100 3 Beratung zu Arbeitstechniken: Im Berichtsjahr wurde wöchentlich eine spezielle Sprechstunde durchgeführt, in der Studierende Unterstützung bei arbeitstechnischen Problemen anfordern konnten. Naturwissenschaften Sonstiges (6) Bioinf/Genomf. (13) Mediengest. (60) Umweltwiss. (32) Mol.Biotech. (79) Physik (1) Mathematik (12) Chemie (5) Wirt.math. (12) Informatik (20) Biochemie (48) Biologie (38) 0 4 20 40 60 80 Anzahl der Beratungsstunden: 41 (37) Sprechstunden: à 1,5 Stunden Beratungskontakte: 63 (91) Das Geschlechterverhältnis war ausgeglichen. Beratung für Aufschieber: Im Berichtszeitraum wurde wöchentlich eine spezielle Sprechstunde für Studierende mit Aufschiebe-Problematiken angeboten: Anzahl der Beratungsstunden: 35 (38) Beratungskontakte: 74 (60) Das Geschlechterverhältnis verschob sich im Vergleich zum Vorjahr zugunsten der Frauen. Insgesamt nahmen 20 Frauen und 15 Männer das Beratungsangebot wahr. 2. Psychologische Beratung bei Studienproblemen/Psychosoziale Beratung: Einzelberatung: Erfasst wurden Einzelgespräche der hauptamtlichen BeraterInnen, die in den offenen Sprechstunden oder telefonisch sowie nach Kriseninterventionen vereinbart worden waren. Anzahl der Gespräche: 2560 (2233) Anzahl der Personen: 415 (380) Die durchschnittliche Anzahl der Gespräche pro Person lag bei 6,17 (5,88) Geschlechterverteilung: 288 Frauen (entspricht 69 %) 127 Männer (entspricht 31 %) Paarberatungen/Familiengespräche: Teilnehmende Personen: Anzahl der Gespräche: 67 (36 Frauen, 31 Männer) (83) 44 (118) Die Paargespräche waren z. T. Beratungen, die über mehrere Sitzungen ausschließlich als Arbeit mit einem Paar erfolgten, z. T. handelte es sich jedoch auch - wie bei den Familiengesprächen - um einmalige Gespräche. Familiengespräche waren in der Regel Gespräche mit der Herkunftsfamilie, die sich aus der Beratung einer Studentin bzw. eines Studenten ergaben. Gruppenangebote: Im Berichtsjahr wurden 5 Therapiegruppen durchgeführt: - 2 Gruppen für Studierende mit Studien- oder allgemeinen Ängsten: An diesen Gruppen nahmen 19 Personen (14 Frauen und 5 Männer) teil. Die Gruppen umfassten insgesamt 34 Sitzungen à 2 Stunden. - 1 Frauentherapiegruppe mit 7 Teilnehmerinnen. Die Gruppe umfasste 30 Sitzungen à 2 Stunden. - 2 Männertherapiegruppen mit 12 Teilnehmern. Die Gruppen umfassten 22 Sitzungen à 2 Stunden. 5 Im Berichtsjahr wurden 16 themenzentrierte Gruppen und Seminare durchgeführt: - 2 Prüfungstrainings-Seminare (24 TeilnehmerInnen; 5 Männer, 19 Frauen; 25,5 Stunden). - 1 Seminar „Kreative Werkstatt“ (9 TeilnehmerInnen; 2 Männer, 7 Frauen; 27,5 Stunden). - 4 Seminare zum Thema: Abitur - Was nun? Was tun? (42 TeilnehmerInnen; 10 Männer, 32 Frauen; 16 Stunden). - 1 Coaching-Gruppe (Doktorandinnen) (7 Teilnehmerinnen; 44 Stunden). - 2 Gruppen für Psychiatrie Erfahrene Studierende (17 TeilnehmerInnen; 8 Männer, 9 Frauen; 40 Stunden). - 1 Begleitgruppe Abschlussarbeit (21 TeilnehmerInnen, 10 Männer, 11 Frauen; 42 Stunden). - 1 Gesprächsgruppe für Frauen mit Migrationshintergrund (4 Teilnehmerinnen; 12 Stunden) - 4 Seminare Auf dem Weg ins Studium... (84 TeilnehmerInnen, 20 Männer, 64 Frauen; 12 Stunden). Insgesamt: 21 Gruppen Teilnehmende Personen: Stundenzahl insgesamt: 246 (174 Frauen, 72 Männer) 391 Psychologische/Psychosoziale Beratungen und Gruppen insgesamt: Anzahl der Beratungsstunden: 2995 Stunden (2877) (Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr 2001) Anzahl der Personen: 728 (765) 498 Frauen (68,40 %) 230 Männer (31,60 %) 6 Häufigkeit der Themenschwerpunkte aus der psychosozialen Beratungsarbeit aufgrund der Einschätzung der BeraterInnen. (Es konnten pro Thema max. 50 Punkte vergeben werden). Punkte/Gewichtung: Thema: 37 Lücken bei Studientechniken 37 Unsicherheit in Bezug auf das gewählte Studienfach 36 Prüfungsängste 35 Konzentrationsprobleme 33 Unsicherheit in Bezug auf das Berufsfeld 33 Beziehungsprobleme 32 Schwierigkeiten mit den Eltern 32 Versagensangst 30 Depressive Verstimmungen 28 Redeängste 27 überlange Studiendauer (mehr als 15 Semester) 24 Finanzzierungsprobleme 22 Gehemmtsein/Schüchternheit 22 Panikattacken 21 Psychosomatische Probleme 21 Diskriminierungserfahrungen 20 Einsamkeit/Isolation 18 Essstörungen 17 Schlafstörungen 15 Geschlechtsrollenkonflikte 15 Konflikte mit Hochschullehrern 14 Gewalterfahrungen 14 Autoaggressives Verhalten 14 Phobische Ängste 13 Psychoseerfahrung 12 Suchtprobleme 12 Belastung durch alkoholkranke Eltern 7 Auseinandersetzung mit bedrohlichen Krankheiten (Krebs, MS, HIV-positiv) 4 Sexualstörungen 7 8 3. Organisation und Information von Schüler-/Besuchergruppen: Anzahl der Gruppen: Teilnehmende Personen: 10 270 zusätzlich: 2 Infotage mit insgesamt ca. 1.600 TeilnehmerInnen (Schülerinnen und Schüler) 4. Supervision/Institutionsberatung innerhalb der Universität: Gesamtstundenzahl: 83 5. Mitarbeit in Lehrveranstaltungen: Semesterwochenstunden insgesamt, SS + WS: 18 (nicht zu Lasten der Arbeitskapazität der Beratungsstelle) 6. Kooperation mit Einrichtungen außerhalb der Universität: Kooperationspartner: Drogenberatung ZSBn NRW und bundesweit AK Frauen und Psychiatrie Arbeitsamt Bielefeld Arbeitsamt Lippstadt Arbeitsamt Nürnberg Arbeitsamt Detmold Grille ESG FH Bielefeld Gilead III und IV, Bethel Psychosoziale Beratungsstellen Bielefeld Suizidberatung, sozialpsychiatrischer Dienst Evangelisches Johanneskrankenhaus Niedergelassene PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft VHS Minden Westfälische Landesklinik Gütersloh Psychiatrische Ambulanz Gütersloh Bernhard Salzmann Klinik Wildwasser Bielefeld e.V. Frauennotruf Bielefeld Justizbehörden Bielefeld 7. Mitarbeit in Gremien, Ausschüssen, Einrichtungen und Projekten innerhalb der Universität Bielefeld: - Projekt: Probieren geht über Studieren, Abt. Psychologie der Universität Bielefeld - AK AK AK AG Steuerkreis Gesundheit „Studierendenservice“ „Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt“ zur Optimierung der Studieneingangsphase 9 - AG „Gesundheitszentrum für Beschäftigte und Studierende“ an der Universität Bielefeld Gesprächskreis Fachstudienberatung Schwerpunkt Pädagogische Beratung des Weiterbildenden Studiums Frauenstudien, Fakultät Pädagogik Frauenstudienberatungsprojekt /Runder Tisch Lehrkommission AG Konsekutivmodell 10 8. Außerhalb der Universität durchgeführte Maßnahmen/Veranstaltungen: - Informationsveranstaltung Marienschule/Lippstadt; (Roswitha Hofmann) Informationsveranstaltung Gesamtschule Porta-Westfalica; (Roswitha Hofmann) Informationsveranstaltung an der VHS in Minden; (Roswitha Hofmann) Abi-Messe in Lippstadt. (Roswitha Hofmann) Teilnahme an den Info-Bus-Veranstaltungen zu den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen, die in verschiedenen Städten stattfanden; (Roswitha Hofmann, Carmen Burian) 9 a. Teilnahme an Fortbildungen, Tagungen, Kongressen etc. (eigene Fortbildung): - Teilnahme an der 12. Konferenz für Humanistische Therapie und Medizin vom 03.10.- 3.11.2002 in Garmisch; (Wilhelm Naber). - Frühjahrstagung der ARGE vom 06.-09.03.2002 in Köln; (Wilhelm Naber) - Teilnahme an der Fachtagung des Studentenwerkes „Behinderte und chronisch kranke Studierende“ in Frankfurt; (Roswitha Hofmann) - Teilnahme am Arbeitskreis: “Psychiatrie Erfahrene“ in Hamburg; (Roswitha Hofmann) - Teilnahme an der Fachtagung: „Lernort“ Praktikum in Bielefeld; (Roswitha Hofmann) - Teilnahme an dem Fortbildungsseminar: „Mein Platz in der Familie“; (Roswitha Hofmann) - Tagung “Call Center“, am 08.02.02 in Berlin; (Carmen Burian) - Podiumsdiskussion zum Girlsday; (Carmen Burian) - Problembasiertes Lernen/IZHD. (Carmen Burian) - Teilnahme an der Herbsttagung der ARGE/CEBIT in Berlin vom 13.09. – 14.09.2002; (Carmen Burian, Ruth Großmaß) 9 b. Eigene Supervisionen: Die MitarbeiterInnen der ZSB haben im Berichtszeitraum regelmäßig an kollegialen Supervisionen teilgenommen (durchschnittlich 2 Stunden pro Woche). Zusätzlich nahmen die MitarbeiterInnen der ZSB an einer 2 tägigen Teamsupervision teil. 10. Vorträge, Seminare und Veröffentlichungen: 1. Vorträge, Seminare: 1) Ruth Großmaß: „Orientierungsprobleme im Studium“ - 11.02.02 Dt. Akademikerinnen Bund e.V. Regionalgruppe Bielefeld. 2) Ruth Großmaß: „Psychische Krisen und geschlechtsspezifische Ansätze in der psychosozialen Beratung“ - 05.12.02 Fachhochschule Köln. 3) Carmen Burian: „Virtuelle Therapie und Beratung“, Arbeitskreis: Frauen und Psychiatrie. 4) Wolfgang Neumann: „Humor in der Psychotherapie“, Vortrag auf dem 14. Kongress für Klinische Psychotherapie und Beratung in Berlin vom 23.02. – 27.02.02. 5) Wolfgang Neumann: „Humor als Wirkfaktor in der Psychotherapie“, Vortrag im Rahmen des ersten Psychotherapieforums des app (Arbeitskreis niedergelassener psychologischer Psychotherapeuten Bielefeld), am 09.03.02. 6) Wolfgang Neumann: „Spurensuche“ – Dialog zwischen den Generationen zur Familiengeschichte, Vortrag im Rah men des Begleitprogramms zur Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ – Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941/1944, am 11 13.03.02. 2. Publikationen: Ruth Großmaß: „Gestaltung von Beratungsräumen als professionelle Kompetenz“. Ruth Großmaß: Migration als Stressfaktor im Studium, Beitrag im Sammelband „Die Zukunft der Beratung“, Hrsg. Frank Nestmann & Frank Engel, DGVT-Verlag Tübingen, 2002. Wolfgang Neumann: „Dem Therapeur ist nichts zu schweur“, Therapiegeschichten, DGVTVerlag Tübingen, 2002. Wolfgang Neumann: „The presence of the past: using memory work to search for psychological traces of the Nazi past in contemporary Germans, British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 30, No. 1, 2002. Wolfgang Neumann: „Die Gegenwärtigkeit der Vergangenheit“, Beitrag im Sammelband „Die Zukunft der Beratung“, Hrsg. Frank Nestmann & Frank Engel, DGVT-Verlag Tübingen, 2002. 11. Rahmenbedingungen BerufsStudien- Arbeitsauftrag, Personalausstattung (4,5 Stellen für Beratung, 1,5 Sekretariatsstellen, 2 praktikantInnenstellen Sozialarbeit/Sozialpädagogik) und Arbeitsstruktur der Zentralen beratung sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 12 Roswitha Hofmann Kurzkommentar zur Jahresstatistik 2002 Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Nachfrage nach allgemeiner Studienberatung als auch nach psychologischer Einzelberatung deutlich an. Die Veränderungen in diesen beiden Arbeitsbereichen sollen im Folgenden kurz kommentiert werden: Im Bereich der Allgemeinen Studienberatung ist ein geradezu sprunghafter Anstieg in Höhe von 19,2 % in der persönlichen Beratung zu verzeichnen. Während der offenen Sprechstunde (Montag bis Freitag vormittags) war die Nachfragesteigerung nach Studienberatung mit 28,64 % noch eklatanter. Erklärbar ist dieser Anstieg mit der Einführung der neuen gestuften (konsekutiven) Bachelorund Masterstudiengänge und dem damit verbundenen Modellversuch der neuen Lehramtsausbildung zum Wintersemester 2002/03 an der Universität Bielefeld. Die ersten Anfragen zu diesem Modell gab es im April; von da an stieg die Nachfrage nach Information und Beratung sowohl bei der persönlichen, telefonischen Beratung (plus 8,7 %) als auch bei den Anfragen per E-Mail (plus 48,7 %) bis zu Beginn des Wintersemesters stetig. Bei dem %-Wert der telefonischen Beratung muss berücksichtigt werden, dass sie nicht die tatsächliche Zahl der telefonischen Anfragen widerspiegelt. Denn das Sekretariat der ZSB war durch mehr Publikum und die Notwendigkeit der Aufarbeitung schriftlicher Informationen häufig nur über eine Telefonleitung erreichbar, so dass zu vermuten ist, dass nicht alle Anrufe durchgekommen sind. Einen großen Anteil der Studienberatung machte dabei der Bereich von Informationen über das neue Bachelor–Lehramts-Modell aus (plus 36 %), das an die Stelle der herkömmlichen Lehrerausbildung getreten ist. Studieninteressenten sowie Schülerinnen und Schüler aber auch Magisterstudierende, die einen Wechsel in das neue Modell erwogen, nahmen die Beratung verstärkt in Anspruch. Führte in den vergangenen Jahren die Einführung der InfoTage für AbiturientInnen zum Teil zu einer Entlastung der allgemeinen Sprechstunden, so geht dieser „Entlastungstrend“ nicht weiter; vielmehr ist festzustellen, dass mit der Intensivierung der organisierten Schülerinformationen (z.B. Info-Tag, Besuchertage von Schülergruppen, etc.) der Beratungsbedarf wächst. Das machte sich besonders an den Tagen bemerkbar, an denen Schülergruppen die Universität Bielefeld besuchten. Abschließend lässt sich sagen, dass in Zeiten großer Nachfrage eine angemessene Beratung nicht garantiert werden konnte; „Beratung“ musste sich dann auf die Vergabe von gezielter Einzelinformation beschränken. Im Bereich der psychologischen/psychosozialen Beratung ist die Einzelberatung um 12,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mit dieser quantitativen Zunahme von Beratungskontakten ist der Rückgang vom Vorjahr wieder ausgeglichen. Mit 2560 durchgeführten Einzelgesprächen liegt die ZSB im Berichtsjahr quantitativ bei einer ähnlichen Auslastung wie in den Jahren 1999 und 2000. 13 Die Geschlechterverteilung mit 69 % Frauen und 31 % Männer in der psychologischen Einzelberatung zeigt ein ähnliches Bild wie in den Jahren zuvor: Beratung wird nach wie vor von Frauen doppelt so viel in Anspruch genommen als von Männern. Im Gegenzug lag in der Familien- und Paarberatung die Anzahl der Gespräche (ein Minus von 23%) und die Personenzahl deutlich niedriger als im Vorjahr. Diese quantitative Abnahme der Familien- und Paargespräche lässt sich aber eher als eine Normalisierung gegenüber dem Vorjahr interpretieren, als dass sie als genereller Trend zu werten wäre. (In den Jahren 1999 und 2000 war die Zahl der Beratungsgespräche ähnlich hoch wie im Berichtsjahr) Das Gruppenangebot umfasste wie im Vorjahr wieder 5 therapeutische und 16 themenspezifische Gruppen. Das Spektrum der themenspezifischen Gruppenangebote reicht von InformationsWorkshops über Trainings bis zu Begleitgruppen mit unterstützenden Charakter und richtet sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen wie z.B. SchülerInnen, Studierende in Prüfungsphasen und Doktorandinnen etc.. Die Gruppenangebote spiegeln die aktuellen Problematiken des Lebensraums Hochschule wieder und sind gleichzeitig ein Versuch der ZSB mit den vorhandenen Ressourcen ein adäquates Hilfsangebot bereitzustellen. 14 Ruth Großmaß „Studieren mit Kind?“ – Vereinbarkeitsprobleme aus der Sicht der Studienberatung* „Mit Kind an der FH – ein Leitfaden für Studierende“ „Bücher, Windeln, Paragraphen. Studieren mit Kind“ „Beratungsstunden für Studierende und Beschäftigte mit Kind(ern)“ „Zwischen Babybrei und Bibliothek! Organisationstalent ist gefragt, um Studium und Kind unter einen Hut zu bringen. Studentinnen und Studenten erfahren bei uns dazu (fast) alles Wichtige“ – Sucht man in der Universität oder an der Fachhochschule heute nach Spuren eines Studienalltags mit Kind, so trifft man auf Plakate, Handblätter und Broschüren, die Titel wie die oben zitierten tragen. Oft sind es die Gleichstellungsbeauftragten, die sich in diesem Bereich mit Tipps und Unterstützungsangeboten engagieren, oft bieten die Sozialberatungen der Studentenwerke Beratung und Hilfe für studierende Eltern an. Auf leibhaftige Kinder dagegen – auf dem Arm oder an der Hand studierender Eltern – trifft man im Hochschulalltag eher selten. In der Mensa sind sie vereinzelt zu Gast; die Situationen, die man dann beobachten kann, sind meist unspektakulär und entspannt, der Umgang mit den Kindern wirkt selbstverständlich – hier stören Kinder nicht. Und am Nachmittag kann man in den Cafeterien gelegentlich Elternpaare mit Kindern antreffen, meist mit der Organisierung des Alltags und der Übergabe der Betreuung beschäftigt. Kinder zu haben, so scheint es, ist inzwischen für Studierende wie für die Mitarbeiter/innen der Universität vor allem etwas, das organisiert werden muss – eine eher pragmatische Herausforderung, deren Bewältigung individuell zu leisten ist und wozu dann die Universität Leitfäden, Broschüren und Beratung beisteuert. In diesem Oberflächenbild zeichnet sich eine soziale Veränderung ab, die in den letzten 30 Jahren im Verhältnis von Hochschule und Öffentlichkeit zum Thema „Studieren mit Kind“ stattgefunden hat: Wenn eine Studentin schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt, so ist dies nicht mehr, wie es bis in die 50er und 60er Jahre des 20. Jhs. hinein der Fall war, ein Fauxpas, der möglichst nicht sichtbar zu werden hat und mit dem manche weibliche Studienkarriere auch endete. Nicht nur die Position der Studentin in der Hochschule hat sich seither so weit gefestigt, dass die Zulassung zu Wissenschaft und Studium nicht mehr als unmittelbar mit dem Verzicht auf Weiblichkeit und Reproduktion gekoppelt erscheint. Auch im Verständnis von „Studieren“ hat sich etwas verändert: ein Studium wird inzwischen nicht mehr ausschließlich als eine Zeit der Ausbildung angesehen, die man absolviert, bevor Berufsfindung und Familiengründung stattfinden können. Ein Studium gilt heute eher als eine Lebensphase, in der auch andere existenzielle Dinge Raum beanspruchen: so lebt etwa die Hälfte der Studierenden heute in fester Partnerschaft (Deutsches Studentenwerk 2001, S. 3); etwa zwei Drittel ist in irgendeiner Weise neben dem Studium erwerbstätig (Deutsches Studentenwerk 2001, S. 21) und immerhin 6,7 % der Studierenden haben Kinder, ein Anteil der sich „seit etwa 18 Jahren relativ konstant auf annähernd gleichem Niveau“ bewegt (Deutsches Studentenwerk 2001, S. 22). Was es für den Lebensablauf, für die Studienorganisation und den Umgang mit dem eigenen 15 Nachwuchs bedeutet, wenn Eltern studieren, ist damit allerdings noch nicht geklärt, unterliegt doch auch die Gestaltung von Kinderversorgung und -erziehung kulturellen Schwankungen. So wurde etwa in den 80er Jahren der Versuch gemacht, Kinder als eine Facette studentischen Lebens zu sehen, die im universitären Leben ihren Platz haben bzw. finden muss: Säuglinge wurden in Lehrveranstaltungen mitgebracht, Wickelräume wurden gefordert und selbstorganisierte Krabbelgruppen gegründet.1 Dass dieser Versuch nicht von anhaltendem Erfolg gekrönt war, ist schon am äußeren Bild des heutigen universitären Lebens zu erkennen: Selten begegnet man Müttern mit ihren Kindern in Seminaren oder in der Bibliothek; und die Auseinandersetzung über Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Hochschule hat längst den Charakter eines universitären Politikums verloren. Das Modell, an dem sich studierende Eltern heute orientieren, ist das der Berufstätigen. Und aus diesem Modell ergeben sich wichtige – von dem soeben Skizzierten abweichende – Eckpunkte sowohl für die Organisation des Studiums als auch für die Art und Weise, in der das Studium mit dem Familienprojekt verbunden wird. 1. Studieren mit Kind – der vorweggenommene Berufsalltag Dass sich Studierende mit Kindern heute in ihrem Selbstverständnis wie in ihrer Lebensorganisation wesentlich am Modell der Berufstätigen orientieren, ist deutlich an den sozialen Bewältigungsformen abzulesen, mit denen sie sich der Herausforderung „Kind“ stellen und die denen berufstätiger Eltern weitgehend gleichen: Auch Studentinnen, die während ihres Studiums ein Kind bekommen, nehmen Mutterschutz und Erziehungsurlaub in Anspruch. Kinder werden meist zwischen dem dritten und fünften bzw. zwischen dem sechsten und zehnten Studienjahr“ (Deutsches Studentenwerk 2001, S. 333) geboren, also in den „ruhigeren“ Studienphasen, in denen man sich im Studium etabliert hat und sich meist in überschaubaren Lebensstrukturen befindet. Auch dies entspricht den Entscheidungsmustern von Berufstätigen hinsichtlich der Familiengründung. Die Kinderversorgung wird dann – auch dies eine Entsprechung zum Berufsleben – in einer Kombination aus privater/familialer Unterstützung (nicht-studierende Partner/innen, manchmal die eigenen Eltern, manchmal etablierte Freundeskreise, in denen es mehrere Kinder gibt) und institutioneller Versorgung (in Kindertagesstätten) organisiert; studiert wird in der „kinderfreien“ Zeit. Und: Unterstützung von Seiten der Hochschule gibt es insofern, als Stipendiengeber Kinderbetreuungszeiten berücksichtigen, Urlaubssemester bei Schwangerschaft und Geburt zugestanden werden und auch einige Prüfungsordnungen entsprechende Paragraphen enthalten. Zudem existiert an manchen Hochschulen eine günstigere Relation zwischen zur Verfügung stehenden Kinderbetreuungsplätzen und geltend gemachtem Bedarf, als die kommunale Versorgung ansonsten bereithält. Nimmt man diese Bewältigungsmuster zum Maßstab, dann lässt sich konstatieren: In der Kinderfrage hat in den letzten Jahren fast unmerklich eine Angleichung des studentischen Lebens an die gesellschaftlich üblichen Standards stattgefunden: eine Familie zu gründen, ist auch für den akademischen Nachwuchs eine (durch flankierende Maßnahmen der Sozialgesetzgebung möglich gewordene, aber gerade dadurch zugleich als solche bestätigte) Privatangelegenheit. Wer sein Studium mit Kindern verbindet, betrachtet das Studium in der Regel nicht wie ca. 40 % der Kommilitonen (Deutsches Studentenwerk 2001, S. 330) als Lebensmittelpunkt, sondern sieht *erscheint 2003 in: Günther Vedder (Hrsg.); Familiengerechte Hochschule (Publikation zum Audit Familiengerechte Hochschule) 1 Zum politisch-kulturellen Hintergrund vgl. Notz, Notz & Troscheit 1988 16 es als eine Art Berufstätigkeit oder Berufsausbildung.2 Die im Studiengang vorgegebenen Pflichtveranstaltungen werden mit Priorität „kinderfrei“ gehalten; und die übrige Zeit wird in Absprache mit Partner/in, Eltern, Freunden und Babysittern um die Kinderversorgung herum organisiert. Man hat den Eindruck, dass Studierende mit Kindern bewusst eine pragmatische Einstellung zum Studium wählen, die dann auch mit einer entsprechend pragmatischen Karriereabsicht verbunden ist. Kommt man mit studierenden Eltern ins Gespräch oder begleitet man sie in einem Beratungsprozess bei der Bewältigung der Anforderungen, denen sie sich stellen müssen, dann erscheint dieser Pragmatismus weniger bewusst gewählt, als vielmehr Effekt der auf sie einstürmenden Anforderungen zu sein. Es ist die Lebenssituation mit Kindern, die eine pragmatische Sicht auf das Studium erzwingt – häufig von Krisen begleitet und mit Verzicht bezahlt. Zur Verdeutlichung ein Fallbeispiel3 aus der Beratungspraxis: Jan studiert im fünften Semester Biologie, er lebt mit seiner Freundin Sabine zusammen in einer größeren WG, seit einem Jahr haben die beiden eine gemeinsame Tochter – Leonie. Sabine hat ihr Studium an der Fachhochschule für ein Jahr unterbrochen, nun hat sie mit Beginn des Wintersemesters wieder angefangen, mit etwas reduziertem Programm, aber eine Fachprüfung möchte sie im Januar ablegen. Jan kommt in die Beratungsstelle, weil es „Beziehungsstress gibt“ und er sich unter Druck fühlt, nicht richtig arbeitsfähig ist. Er hat das Gefühl, viel zu tun, sich sehr viel Mühe mit der kleinen Tochter zu geben – und dennoch ist es nie genug. Wir sprechen im Erstgespräch ausführlich über seine Lebenssituation, über sein Studium, seine Schwerpunkte, seine Zielvorstellungen. Jan ist begeisterter Biologe, hat wissenschaftliche Ambitionen und bisher sehr breit und gründlich studiert, er will „in Richtung Genetik weitermachen“ und muss im laufenden Semester ein Blockpraktikum absolvieren. In diesem Praktikum präsent zu sein und gute Ergebnisse zu erzielen, ist für sein Weiterkommen in diesem sehr aussichtsreichen Schwerpunkt der Biologie von großer Bedeutung. Seine Freundin Sabine studiert Pflegepädagogik und befindet sich in der Endphase ihrer Ausbildung. „Sie sollte jetzt eigentlich konsequent auf den Abschluss hin studieren“, sagt Jan, „damit wir allmählich eine Perspektive in unser Leben kriegen.“ Beziehungsstress haben Jan und Sabine, weil sie beide Platz und Zeit für ihr Studium wollen, sich nicht einigen können, was jeweils wichtiger ist, und immer wieder vom anderen verlangen, mehr Aufgaben im Haushalt zu übernehmen und die Belastungen des/der anderen im Blick zu behalten. Ich vereinbare mit Jan, dass wir versuchen wollen, zu dritt eine Lösung auszuhandeln. Damit durch die Beratung nicht noch zusätzliche Organisationsprobleme entstehen, verständigen wir uns auf einen Gesprächstermin, der in die gemeinsame Freizeit fällt, was auch bedeutet, dass sie ihre kleine Tochter mitbringen werden. Aus diesem Erstgespräch ergibt sich eine Sequenz von 10 Beratungsgesprächen, in denen Schritt für Schritt ein gemeinsamer Alltagsablauf erarbeitet wird. Dabei ist meine wichtigste Aufgabe zunächst, immer wieder sicherzustellen, dass Jan Sabines „Ehrgeiz“ respektiert und ihre Studienpläne nicht bewertet, sie nicht zu einem schnellen Abschluss drängt, der die von 2 Dass gut die Hälfte aller Studierenden angibt, sie betrachte ihr Studium wie einen Beruf oder eine Berufsausbildung (vgl. Deutsches Studentenwerk 2001, S. 330), zeigt zwar, dass eher eine berufsorientierte als eine akademische Identifikation mit dem Studium vorliegt, bedeutet aber nicht, dass diese Studierenden ihren Alltag auch wie Berufstätige organisieren. Bei studierenden Eltern jedoch heißt es genau das. 3 Für dieses wie für die folgenden Fallbeispiele gilt, dass sie so verfremdet wurden, dass eine Zuordnung zu realen Personen ausgeschlossen ist. 17 ihr gewünschte Spezialisierung ausschließt. Umgekehrt neigt Sabine dazu, Jans Präsenzzeiten an der Uni wie gesellige Unternehmungen zu behandeln, die mehr Freizeitwert haben, als dass sie als Arbeit gelten können. Kompromisse zwischen individuellem Zeitbedarf, Wünschen nach Gemeinsamkeit – auch mit ihrem Kind – und notwendigen Versorgungsleistungen werden in den Beratungsstunden zwischen Jan und Sabine ausgehandelt, was viel leichter geht, nachdem sich die beiden darauf geeinigt haben, dass nicht Forderungen an den anderen, sondern Angebote zur Lösung von Problemen im Vordergrund stehen sollen. Mühsam ist nun nicht mehr dieser Einigungsprozess; mühsam ist es, die gefundenen Kompromisse auch mit in den Lebensalltag zu nehmen, Vereinbarungen nicht wieder zu „vergessen“ und alles, was nicht klappt, nicht gleich wieder aufzugeben, sondern erneut zu besprechen, um Verbesserungen auszuhandeln. In dieser Phase des Beratungsprozesses haben unsere Gespräche vor allem die Funktion, „Gedächtnis“ für das bereits Erreichte zu sein. Denn in der Beratung, einem neutralen Terrain, gelingt es meist doch wieder, an die bereits getroffenen konstruktiven Vereinbarungen anzuschließen und das Wohlwollen und die Kompromissbereitschaft des/der anderen zu sehen. Nach einem halben Jahr hat sich Sabines und Jans Leben ziemlich verändert: Beide sind als Elternpaar mehr zusammengerückt4, die Wohngemeinschaft, in der sie leben, ist nach wie vor wichtig, aber sie hat an Bedeutung verloren. Erst klären Jan und Sabine ihre Bedürfnisse miteinander, überlegen sich, wie etwas gestaltet werden kann, erst dann sprechen sie mit den anderen. Beide bedauern diese Veränderung, akzeptieren sie jedoch als notwendig. Beide haben Abstriche gemacht, was ihr Studium betrifft. Sie werden mehr Zeit brauchen, um fertig zu werden; obwohl beide an ihrem „Ehrgeiz“ festhalten, werden sie einige Spezialisierungen und Vertiefungsseminare streichen, ihre Lehrveranstaltungen stärker auf die Prüfungen hin auswählen. Und auch im Umgang mit ihrer Tochter sind sie pragmatischer geworden: die unmittelbaren Versorgungsaufgaben – insbesondere das Ins-Bett-Bringen – sind konsequent aufgeteilt. Die Zeit, die Sabine und Jan als Eltern gemeinsam mit Leonie verbringen, ist begrenzt und sehr festgelegt und muss dennoch immer wieder gegen Anforderungen von außen verteidigt werden. Bestimmte Aktivitäten macht jetzt nur noch eine/r von beiden mit dem Kind. Obwohl erst 16 Monate alt, wird die Kleine bereits für vier Stunden am Tag in eine Kita gebracht. – Sabines und Jans Leben hat sich in den hochstrukturierten Alltag berufstätiger Eltern verwandelt. Schwierig war es sowohl für Sabine als auch für Jan, noch einmal mit den eigenen Eltern über Geld verhandeln zu müssen. Doch nachdem sie das Zeitvolumen einer ihrer hochstrukturierten Wochen durch eine Kurzprotokoll dokumentiert hatten, war deutlich geworden: Wenn auch noch ein Job hinzukommt, würden sie nicht beide weiterstudieren können, jedenfalls nicht in einer Weise, die Jan oder Sabine noch als Studium bezeichnet hätten. Die Gespräche mit den Eltern waren erfolgreich – für die nächsten zwei Jahre ist die Grundfinanzierung gesichert. Nach gut 10 Monaten beenden wir unsere Beratungsgespräche – vorläufig. Wir alle haben den Eindruck, dass die erarbeitete Balance fragil ist und dass es gut sein kann, dass weitere Unterstützung nötig wird. Wenn man – wie ich in der Beratung von Jan und Sabine – die vielen kleinen Schritte 4 Auch dies ein Effekt von Elternschaft im Studium: Die Paarkonstellation nimmt tendenziell konventionelle Formen an. Dies gilt nicht nur, wie in diesem Beispiel für das Verhältnis der Zweierbeziehung zum studentischen Umfeld, sondern auch für das Verhältnis zur Herkunftsfamilie (s.u.) und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bei Kinderbetreuung versus Jobben (vgl. Deutsches Studentenwerk 2001, S. 334). 18 mitbekommt, die erforderlich sind, um Studium und Kind zu vereinbaren, dann spürt man deutlich, wie anstrengend es ist, während eines Studiums ein Lebensmodell zu entwickeln, in dem sich Kinder, Alltagsanforderungen, Studienanforderungen und Zukunftsvisionen unterbringen lassen. Die soziale und kulturelle Umgebung der Studierenden unterliegt völlig anderen Rhythmen, die Kommunikationsstrukturen verlaufen offener, weniger ergebnisorientiert, als dies bei einem Alltag mit Kindern erforderlich ist. Die Verwandlung des Studiums in „Arbeit“ im Sinne von Berufsarbeit, in eine Arbeit also, die die Person zwar voll beansprucht, die aber zugleich begrenzt ist, erfordert psychische Energien und ist für jedes der beteiligten Individuen von emotionalen Konflikten begleitet. Sabine und Jan hatten vergleichsweise gute Chancen diese Prozesse zu bewältigen: die Beziehung war intakt, beide waren erfolgreiche Studierende, die mit Engagement ihre Themen bearbeiten; beide wollten das Kind und hatten Freude daran, sich mit Leonie zu beschäftigen; ihre Eltern waren verständnisvoll und hilfsbereit (und verfügten über die nötigen Ressourcen). Und trotzdem hatte es im Beratungsverlauf mehrfach Krisenpunkte gegeben, an denen die Beziehung auch hätte zerbrechen können. Elternschaft und Studium zu verbinden, ist, so lässt sich resümieren, schwierig – u.a. weil das Modell „berufstätiges Paar mit Kind“ in einer Umgebung installiert werden muss, die anders als die Erwerbswelt nicht auf die zeitliche Passung unterschiedlicher Anforderungen hin angelegt ist. Schwierig ist Elternschaft für Studierende aber auch deshalb, weil sie sich persönlich an einem anderen Entwicklungspunkt ihrer Biografie befinden, als die meisten Erwerbstätigen zum Zeitpunkt der Familiengründung. Denn für Studierende geht es (noch) nicht darum sich zu etablieren und feste Lebensformen zu entwickeln. Vielmehr stehen Veränderung und Neufindung auch in sehr persönlichem Sinne an: Sich öffnen für neue Ideen, Lebensformen erproben, intellektuelle Grenz-erfahrungen zulassen, individuelle Selbständigkeit erwerben und, damit verbunden, Ablösung von der Herkunftsfamilie … − Optionen wie diese werden auch heute noch mit einem Studium verbunden, „Spätadoleszenz“ heißt diese Phase krisenhafter Reifungsprozesse in der psychologischen Studentenforschung (vgl. Holm-Hadulla 2001). Eine weitere grundlegende Schwierigkeit der Elternschaft von Studierenden ist jedoch unmittelbares Produkt der Orientierung am Modell der Berufstätigen. Denn wie in der Arbeitswelt hat dieses Modell auch in der Universität den Effekt, Elternschaft im akademischen Alltag zum Verschwinden zu bringen. Wie Berufstätige ihre Kinderversorgung organisiert haben, wenn sie zur Arbeit erscheinen, so haben auch Student/inn/en ihre Kinder versorgt, wenn sie in der Universität ankommen. So ist es nicht erstaunlich, dass studierende Eltern häufig – wie die wegen fehlender „Sockelfinanzierung“ Erwerbstätigen (vgl. Deutsches Studentenwerk 2001, S. 173) „faktisch ein Teilzeitstudium“ praktizieren (vgl. Deutsches Studentenwerk 2001, S. 271) – allerdings ohne dass dies als solches sichtbar würde. Im universitären Alltag werden studierende Eltern gar nicht als solche wahrgenommen, sondern unter dem generellen Schema „Student“: als jung, alleinstehend und frei von Verpflichtungen jenseits des Studiums. Und diese Sicht betrifft nicht nur das äußere Erscheinungsbild im universitären Alltag, sondern wirkt auch insofern in die Lern- und Arbeitskultur hinein, als alle Maßnahmen zur Unterstützung der Integration und des Studienerfolges der Studierenden auf dieses Schema hin entworfen werden.5 5 So kommt in dem weiter unten noch einmal zitierten Ratgeber „Handbuch Studieren“ (Kruse 1998) das Stichwort „Kind“ nur ein einziges Mal vor, und zwar im Kontext der zu berücksichtigenden Sonderbedingungen bei BAföG (vgl. Kruse 1998, S. 66). Entsprechende Zurückhaltung bei diesem Thema übt auch die psychologische Studentenforschung: Eine der renommiertesten Studien zu den gesundheitlichen Belastungen eines Studiums (vgl. Bachmann, Berta, Eggli & Hornung 1999) führt bei der Erfassung der Zeitaufteilung zwar „Familie“, nicht aber „Kinderbetreuung“ auf; auch bei der Erfassung der Ressourcen und bei den Variablen, die den Selbstwert beeinflussen, sind eigene Kinder nicht im Blick. 19 Abweichungen davon – wie z.B. das Leben mit Kindern – sind individuell zu bewältigen. Was dies für den Studien- und Arbeitssituation der einzelnen bedeuten kann, soll im Folgenden verdeutlicht werden. 2. Studieren mit Kind – Lernen in der Isolation Um zu verstehen, dass Eltern-Sein nicht nur ein Problem für die Lebensorganisation darstellt, sondern auch die Arbeitsformen des Studiums selbst verändert, ist es hilfreich sich die akademische Seite des Studierens einmal genauer anzusehen. Studieren wird heute nicht mehr als eine Tätigkeit verstanden, für die von Seiten der Universität ausreichend gesorgt ist, wenn Lehr- und Prüfungskapazitäten bereitgestellt sind. Unter den Lern- und Arbeitsbedingungen der inzwischen entstandenen universitären Großbetriebe, die Studierende mit sehr unterschiedlicher Bildungsherkunft und verschiedenen Ausbildungsoptionen zu versorgen haben, ist Studieren zu etwas geworden, das flankierender Maßnahmen bedarf, wenn es gelingen soll. Erstsemesterinformation und Studienberatung begleiten die von den Studierenden zu treffenden Entscheidungen über Fach, Ausbildungsrichtung und Berufsperspektive. Orientierungseinheiten und Tutorien unterstützen die Integration der Anfänger/innen in das akademische Leben und Arbeiten. Paten- und Mentorenmodelle stellen Kommunikationswege zwischen Lehrenden und Studierenden her, Studientechnikenkurse führen in das wissenschaftliche Arbeiten ein, Schreibberatung unterstützt beim Herstellen wissenschaftlicher Texte und hochschulpädagogische Zusatzveranstaltungen vermitteln „Softskills“ wie Präsentation und Rhetorik. Ein erfolgreiches Studium zu absolvieren, erfordert heute, so zumindest das Wissen von Insidern, zahlreiche Kompetenzen, die über die unmittelbaren Fachinhalte hinausgehen – auf 31 Themen bringt es ein von Fachleuten erarbeitetes „Handbuch Studieren“ (Kruse 1998), das in Sachen erfolgreiche Studienbewältigung Begleiter für die ganze Ausbildung sein kann. Studieren bedeutet auf diesem Hintergrund mehr als die Teilnahme an den Pflichtveranstaltungen, die die Studienordnung vorgibt; dies reicht auch dann nicht, wenn alle besuchten Veranstaltungen sorgfältig nachgearbeitet werden. Kontakte mit anderen Studierenden, Arbeitsgruppen und Zusatzkurse, Exkursionen und die Teilnahme an Tagungen, im höheren Semester dann an Kongressen – dies alles bildet den Hintergrund erfolgreicher Studienkarrieren. Dass studierende Eltern mit ihren sehr verbindlichen Verpflichtungen, die sich aus der Kinderversorgung ergeben, hier manchmal das Nachsehen haben, ist leicht vorstellbar. Zur Verdeutlichung auch hierfür eine Fallskizze aus der Beratungsarbeit: Petra ist Mitte 20, Mutter einer dreijährigen Tochter und studiert im dritten Semester Mathematik. Sie kommt in die Studientechnikensprechstunde der Beratungsstelle und möchte ein paar Tipps, wie sie effektiver lernen kann. Sie hat im vergangenen Semester eine Klausur nicht geschafft und glaubt, dass sie „einfach mehr tun“ müsse, effektiver arbeiten eben. Um ihr weiterhelfen zu können, befrage ich sie hinsichtlich ihrer bisherigen Arbeitsgewohnheiten und Methoden. Für mich ergibt sich folgendes Bild: Petra lebt mit ihrer Tochter zusammen in einer Wohngemeinschaft, das Kind ist in einem Ganztagskindergarten untergebracht, sodass Petra im Normalfall (= „wenn alles so läuft, wie es eigentlich gedacht ist“) zwischen 9 und 15.30 h an der Uni sein kann. Sie schafft es alle Pflichtveranstaltungen zu besuchen; und sie bemüht sich auch, in der Zeit dazwischen „in der Bibliothek zu lernen“, Übungsaufgaben zu rechnen und einiges nachzuarbeiten. Um vier holt sie ihre Tochter ab, dann verbringen die beiden ein, zwei Stunden gemeinsam, bis es Zeit ist, das Kind ins Bett zu bringen. Abends kann Petra 20 manchmal auch ausgehen – „meine WG ist sehr hilfsbereit, Sandra ist nie allein in der Wohnung.“ Zwei- bis dreimal in der Woche setzt sie sich abends noch an den Schreibtisch. – „In Mathe läuft dann nichts mehr, aber alles für mein Nebenfach Pädagogik schaff' ich auch noch am Abend“. Petra arbeitet – nach allem was ich im Gespräch in Erfahrung bringe – sehr konzentriert und leidet nicht unter Arbeitsstörungen; sie mag ihr Studienfach auch. „Aber manchmal versteh ich eine Aufgabe einfach nicht, ich müsste mehr nachschlagen, genauer sein; und irgendwie habe ich es dann später vergessen.“ Wir können uns schnell darauf verständigen, dass die Erfahrung „das versteh‘ ich nicht“ zum Mathematikstudium dazugehört, dass man eigentlich Kooperationspartner braucht, mit denen man kontinuierlich zusammen arbeitet, sodass sich die Schwächen der einzelnen ausgleichen, man sich gegenseitig unterstützen kann. „Aber das kannst du vergessen“, sagt Petra, „die treffen sich dann immer ganz unregelmäßig und zu den unmöglichsten Zeiten. Schon im zweiten Semester habe ich gar nicht mehr versucht, Anschluss an eine Lerngruppe zu finden.“ Das Problem, das hier sichtbar wird, konnte auch im Verlauf der weiteren Beratung nicht wirklich gelöst werden. Petra hat Aushänge gemacht und mit der Fachschaft Kontakt aufgenommen, um Kooperationspartner/innen zu finden, die in ihren Lebensrhythmus passen. Das war nicht ganz erfolglos, genauso wie der Versuch e-mail-Kontakt zu einem Dozenten herzustellen, der bereit war, unterstützend auf fachliche Probleme einzugehen. Schwerfällig und mühselig blieb es dennoch Klausurvorbereitungen hinzubekommen und „den Faden nicht zu verlieren“. Auffällig war für mich in der Arbeit mit Petra, dass sie – obwohl sie ihre Situation nüchtern und klar analysieren konnte – nicht ohne Hilfe in der Lage war, die Schwierigkeit, in der sie sich befand, als die zu erkennen, um die es ging. Sie war so eingebunden in ihre eigene sehr strukturierte Lebenssituation, dass sie die Arbeitsgruppen ihrer Kommilitonen gar nicht als Arbeitsgruppen wahrnehmen konnte, in denen etwas für den Studienerfolg Wichtiges geleistet wurde. Da man oft unpünktlich anfing, erst über dies und das sprach, bevor es los ging, Übungsblätter manchmal nur verglichen und Erklärungen erst im Hinausgehen nachgeschoben wurden, konnte Petra nur das Uneffektive sehen, nicht aber das Produktive dieser Treffen: den Zusammenhalt, die oft eher beiläufige Unterstützung und das sich immer wieder Vergewissern, dass die individuellen Schwierigkeit mit der Materie innerhalb der Norm liegen, „kein Problem“ sind. So hatte Petra gar nicht erst versucht, Verabredungen zu treffen, mit denen auch sie leben konnte, sondern sie hatte sich zurückgezogen und den Anschluss verloren. Das hatte zwar den Vorteil, dass Petra ihr individuelles Lernen besser organisieren konnte, es führte aber auch dazu, dass sie allein mit den Aufgaben war und mit den auftretenden Schwierigkeiten. Wenn etwas nicht klappte, glaubte sie, persönlich etwas falsch zu machen, nicht effektiv zu arbeiten, manchmal auch „einfach zu blöd“ zu sein. Neben der Anforderung, den Studienalltag wie einen eingespielten Berufsalltag zu organisieren, sind es folglich die informellen Anforderungen an akademische Kooperation und Kommunikation, an denen studierende Eltern scheitern können – nicht weil sie, wie Petra es formuliert, „blöder“ sind als die anderen, sondern weil ihr strukturierter Lebensalltag es ihnen schwer macht, sich den zahlreichen indirekten akademischen Sozialisationsformen wirklich zu überlassen. Petras Fall hat, so hoffe ich, deutlich gemacht, dass es zum Problem werden kann, wenn man im sozialen Sinne „den Anschluss verliert“ – den Anschluss an die Mitstudierenden, an 21 informelle Arbeitsgruppen, an die Kooperationsformen des jeweiligen Faches, das man studiert. Dass man, ohne dies wahrzunehmen, auch den Kontakt zu wichtigen Haltungen und unausgesprochen geteilten Selbstverständlichkeiten des Studiums verlieren kann, zur akademischen Art zu denken und sich intensiv mit nicht-alltäglichen Gegenständen zu beschäftigen z.B., ist ein weiterer Punkt, der für studierende Eltern von Bedeutung ist. Denn gerade das sehr pragmatische und auf elementare körperlich-sinnliche Erfahrungen zentrierte Leben mit kleinen Kindern kann schnell zu einer Entfremdung von der eher im Inneren stattfindenden Seite des wissenschaftlichen Arbeitens führen. Die damit verbundenen Risiken beschäftigen uns im nun folgenden Abschnitt: 3. Studieren mit Kind – Irritation der Identifikation mit Wissenschaft Wer sich alltäglich in einer Universität bewegt, sich einem Fach zugehörig fühlt, Lehrveranstaltungen besucht, Referate hält, sich für die Ausarbeitung einer These in der Bibliothek vergräbt oder um ein Experiment abzuschließen, im Labor abtaucht – wer Studium und Wissenschaft in dieser Weise „lebt“, für den ist es selbstverständlich, dass Wissenschaft etwas Wichtiges und die gerade verfolgte Fragestellung für das eigene Fach von Bedeutung ist. Die meisten Studierenden schaffen es, mindestens für Abschnitte des Hauptstudiums und die Phase der Abschlussarbeit in diesem Sinne in der Wissenschaft zu Hause zu sein. Ist das Studium dann abgeschlossen und ein anderes berufliches Feld für die professionelle Identität zentral geworden, dann erscheint vielen Ehemaligen die Ernsthaftigkeit, mit der sie als Student/inn/en Detailfragen − jenseits aller praktischen Relevanz − akribisch nachgegangen sind, nicht mehr so recht nachvollziehbar. Für diejenigen allerdings, die Wissenschaft zum Beruf machen wollen, gilt es, genau diese Intensität der Denkarbeit und das sie begleitende selbstverständliche Gefühl von der Bedeutung des eigenen Tuns – Bourdieu nennt die Faszination, die wissenschaftliche Fragen und Debatten auf all diejenigen ausüben, die sich erfolgreich im akademischen Feld bewegen, „illusio“ (vgl. Bourdieu 1997) – beizubehalten und zu professionalisieren. Im Gegensatz zu den Anforderungen an Kommunikation und Kooperation, die zwar nicht in der Studienordnung stehen, aber doch hochschulöffentlich verhandelt werden, ist die Bereitschaft sich mit Intensität und Ausdauer auf Theorien und Forschungsfragen einzulassen, „Beobachtung zweiter Ordnung“ (Luhmann 1992, S. 66 ff.) zu betreiben, kaum Thema, wenn von den Anforderungen einer akademischen Ausbildung die Rede ist. Die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man mit Interesse und Engagement wissenschaftliche Fragen verfolgen kann6 – Verankerung im akademischen Alltag und Zuhause-Sein im den Diskursen des Faches – sind in der Regel weder den Studierenden noch den Wissenschaftler/inne/n bewusst. Gerade die Unsichtbarkeit dieser Voraussetzung wissenschaftlichen Arbeitens macht sie zu einem besonderen Risiko – insbesondere für studierende Eltern. Die folgende Fallskizze soll dies verdeutlichen: Heike ruft mich während der offenen Beratung an und bittet um einen Gesprächstermin bei mir. Sie habe gehört, dass ich auch Doktorandinnen berate. Ich denke zunächst, dass sie an der von mir geleiteten Coaching-Gruppe für Doktorandinnen interessiert ist, und beginne ihr die Modalitäten zu erläutern. Aber Heike unterbricht mich, nein, sie wolle nicht an der Gruppe teilnehmen, sondern nur einmal mit mir über persönliche Schwierigkeiten sprechen. Wir 6 S. hierzu ausführlicher: Großmaß (2000), S. 176 – 228 22 verabreden einen Gesprächstermin und sitzen uns eine Woche später in meinem Beratungsraum gegenüber. „Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist“, berichtet sie“, seit ein paar Wochen habe ich zu nichts mehr Lust, ich sitze zwar meine Stunden am Schreibtisch ab, aber eigentlich weiß ich gar nicht mehr, warum ich das treibe. Die frühen englischen Romanformen – das ist doch wirklich für niemanden mehr interessant. Irgendwie dreh ich mich im Kreis, ich habe das Gefühl allmählich auch zu den einfachsten Dingen keinen Draht mehr zu haben.“ Im weiteren Gespräch wird Heikes Situation konkreter: Sie arbeitet seit 1 ½ Jahren an einer Dissertation in der Anglistik. Gefördert wird sie durch eine Stiftung. Sie lebt mit ihrem Partner und ihrem zweijährigen Sohn zusammen in einer geräumigen uninahen Wohnung; seit Peter vor einem halben Jahr mit dem Referendariat angefangen hat, sind die beiden verheiratet. „Eigentlich“, erzählt sie, „kann ich zufrieden sein; alles hat so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben: Peter hat an einer Schule in der Nähe einen Ausbildungsplatz bekommen. Unser Sohn hat eine nette Tagesmutter und hat sich gut eingewöhnt. Wir kommen finanziell einigermaßen zurecht, und Peter findet es wirklich gut, dass ich weiter wissenschaftlich arbeiten will. Natürlich passt es jetzt auch ganz gut, dass ich meine Arbeitszeiten etwas flexibler handhaben kann. Peter kann ja nicht einfach aus der Schule wegbleiben, wenn Felix mal krank ist.“ Ich frage nach Heikes Arbeitsalltag: Morgens bringt sie ihren Sohn zur Tagesmutter, meist bleiben ihr gut fünf Stunden Zeit, bis sie ihn wieder abholt. Sie kehrt in die Wohnung zurück, räumt „das Gröbste“ auf, damit sie sich in Ruhe an den Schreibtisch setzen kann. Eigentlich genießt sie die Arbeitssituation immer noch, die Ruhe und die konzentrierte Atmosphäre. Allerdings fällt es Heike in letzter Zeit zunehmend schwer, sich wirklich mit ihrem Thema zu beschäftigen. Häufig fallen ihr Kleinigkeiten ein, die noch zu erledigen sind, manchmal liest sie sich in einem „ihrer“ Romane fest, und wenn das Telefon klingelt, nimmt sie das Gespräch an, obwohl sie eigentlich beschlossen hat „morgens nicht ranzugehen“. Schon seit drei Monaten hat sie nichts Neues mehr geschrieben. „Das eigentliche Problem“, sagt sie, „ist aber nicht, dass ich meine Arbeitszeit nicht mehr richtig einhalte, das eigentliche Problem ist, dass ich keine Lust mehr habe, mich mit der Arbeit zu beschäftigen. Das Thema kommt mir ganz unwirklich vor, ganz weit weg.“ Auf die Frage nach ihren Kontakten und ihren Beziehungen wird deutlich, dass Heikes alltägliches Umfeld ganz durch die Versorgung von Felix bestimmt ist. Sie pflegt regen Austausch mit einigen jungen Frauen, die auch Kinder in Felix Alter haben – es gibt gemeinsame Unternehmungen und Spielnachmittage. Auch der Kontakt zu ihrer Mutter und Schwester ist wieder enger geworden. „Wir haben wieder viel mehr Gemeinsamkeiten.“ Die Uni-Kontakte dagegen haben sich ausgedünnt, seit Felix auf der Welt ist. Es war komplizierter geworden Verabredungen zu treffen; und das Baby hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, für den gewohnten Austausch – wissenschaftliche Neuigkeiten, Uni-Klatsch und eigene Arbeitserfahrungen – blieb wenig Raum. Inzwischen sind die Studienkolleginnen auch mit ihren Arbeiten viel weiter. Heike fühlt sich unbeholfen und langsam in deren Gegenwart. Worin Heikes Problem bestand, wurde mir im Verlauf dieses Erstgespräches schnell deutlich: Heike war durch die Veränderung ihrer Lebenssituation aus ihrem akademischen Umfeld herausgefallen. An ihre Dissertation bindet sie nun nichts mehr außer dem monatlichem Kolloquium und dem häuslichen Schreibtisch. Damit sind auch die inneren Bindungen an „ihre“ Wissenschaft brüchig geworden; die Themen, für die sie sich immer begeistert hat, begegnen ihr in ihrem Alltag nicht mehr von selbst. Auch wenn sie einmal „wie früher“ in die Bibliothek geht und in den letzten Heften der Fachzeitschriften blättert, fühlt sie sich von den 23 Diskussionen nicht wirklich angesprochen. Und wenn sie am Schreibtisch sitzt, wird das „Reinkommen“ in die Arbeit immer mühseliger. Unser Gespräch endet damit, dass ich Heike mit der Einschätzung konfrontiere, sie habe durch ihren Kinderalltag den Draht zur Wissenschaft verloren, und ihr anbiete, ihr bei der Suche nach Auswegen zu helfen. Heike hat zunächst Mühe damit zu akzeptieren, dass solche „äußerlichen Dinge“ wie in der Uni sein, andere treffen, über die Arbeit reden für ihre innere Einstellung so wichtig sein sollen, doch sie lässt sich darauf, Veränderungen auszuprobieren und zu sehen, ob es hilft. Es schließt sich eine Sequenz von 12 Beratungsgesprächen an, in denen wir über Heikes Arbeit sprechen – über den Punkt, an dem sie sich inhaltlich befindet; darüber, wessen Position in ihrem Fachgebiet für sie wichtig ist; darüber, mit wem sie sich sachkundig austauschen kann, aber auch darüber, wie es ist, mit Felix in der Mensa zu essen oder mit Felix an der Hand in die Bibliothek zu kommen. Der Wendepunkt ist erreicht, als ich Heike „verordne“, in den Osterferien zu einer wissenschaftlichen Tagung zu fahren, und zwar zu einer Tagung, die zwar in ihr Fachgebiet fällt, in der es aber nicht um etwas geht, das sie für ihre Dissertation dringend benötigt. Heike ist zunächst irritiert, dann stimmt sie zu und setzt bei Peter durch, dass er Felix vier Tage allein versorgt, obwohl er sich auf eine Lehrprobe vorbereiten muss. Eine Woche nach der Tagung sehen wir uns wieder. „Die alte Heike ist wieder da.“ – eröffnet Heike unser Gespräch. Blicke ich auf die Beratungsgespräche mit Heike zurück, dann scheint mir der bedeutendste Punkt ihrer Schwierigkeiten in folgendem Zusammenhang zu liegen: Ihr war nicht klar, dass etwas in ihrer eigenen Wahrnehmung so Individuelles und Persönliches wie ihr Interesse an Literaturgeschichte auch in relativ großem Maße von äußeren Voraussetzungen abhängig ist. Sie hatte sich vorgestellt, sie brauche nichts als gesicherte Arbeitszeiten, um ihre Dissertation fertigstellen zu können. Deshalb hatte sie sich dafür stark gemacht, dass Felix eine Tagesmutter bekommt, obwohl viele in ihrer Umgebung meinten, das sei gar nicht unbedingt erforderlich. Dass der häusliche Schreibtisch als Arbeitsplatz langweiliger war, als ihr Arbeitsumfeld im Institut, war ihr natürlich klar, aber dafür gewann sie schließlich die Nähe zu Felix und einen relativ unproblematischen Tagesablauf in ihrer Familie. Im immer wieder erforderlichen Wechsel von der „Welt“ der wissenschaftlichen Intellektualität zur „Welt“ der kindlichen Bedürfnisse und Interaktionsformen war dann ihre Energie schnell verbraucht worden. Der Weg zurück in die Denkprozesse wissenschaftlicher Textproduktion war für Heike dadurch erschwert, dass ihr Arbeitsplatz im häuslichen Bereich lag – einem Bereich voller Anregungen für den familialen Alltag, aber ohne jegliche Anregung für ihr wissenschaftliches Tun. Heike musste neue, für sie weniger kostenintensive Formen der Verknüpfung ihrer beiden „Welten“ erst lernen; dazu gehörte: Präsenz in ihrer fachlichen Umwelt (z.T. mit Felix an der Hand), Muße für den Übergang in die Schreibtischsituation, Sicherstellen von kollegialem Austausch und Sich-Abgrenzen von der Vorstellung, eine wissenschaftliche Tagung, an der man nicht teilnehmen muss, sei für eine junge Mutter ein Luxus, der zurückzustehen habe. Um diese Veränderungen realisieren zu können, musste Heike auch von einigen Vorstellungen Abschied nehmen, die den Umgang mit Felix betrafen: Auch wenn sie mit ihm Zeit verbrachte, hatte sie nun manchmal ihre eigenen Dinge im Kopf; eine Mappe mit Textentwürfen war immer dabei, auf dem Spielplatz oder bei der Zugfahrt, wenn Heike mit Felix zusammen ihre Mutter besuchte. Ergaben sich ruhige Spielphasen mit anderen Kindern oder schlief Felix im Zug ein, konnte Heike die Zeit nutzen. – Sicher waren mit solchen Maßnahmen nicht alle Probleme 24 gelöst; doch Heike wusste nun: Wenn die Motivation für ihre Arbeit schwindet, muss sie für ein paar Tage raus aus der Familie, Abstand gewinnen, „Kongressluft schnuppern“. Dass das Problem, das in Heikes Geschichte sichtbar wird, kein individuelles ist, sondern eine Produkt der Undurchlässigkeit von Familienstrukturen für intellektuelles Arbeiten einerseits und der akademischen Welt für das Leben mit Kindern andererseits, wird deutlich, wenn man beide Sichtweisen gegenüberstellt. Bei Heike war es die Perspektive der familialen Welt, der Welt der Kinderversorgung und der pragmatischen Alltagsentscheidungen, aus der heraus das Thema der Dissertation völlig entwertet war und seine Bedeutung verloren hatte – „Die frühen englischen Romanformen – das ist doch wirklich für niemanden mehr interessant.“, hatte sie in unserem ersten Gespräch gesagt. Der umgekehrte Blickwinkel, die Sicht, die sich aus dem Erleben der Institution Universität ergibt, ist hinsichtlich der „Kinderfrage“ genauso undurchlässig: Doktorand/inn/en der Naturwissenschaften, die innerhalb der Institution Universität dazu befragt werden7, wie sie ihr Studium erlebt haben, was ihrer wissenschaftlichen Motivation förderlich war und wie sie die Bedingungen für eine wissenschaftliche Laufbahn sehen, äußern sich relativ eindeutig: Mobilität ist eine der wichtigsten Voraussetzung für eine wissenschaftliche Laufbahn, Erziehungsurlaub ist ein Karrierehindernis. Und – dass Kinder und Wissenschaft als Beruf sich (für Frauen) ausschließen, meinen immerhin 16 % der befragten Frauen und 19 % der befragten Männer (vgl. Noller 1999, S. 23). 4. Resümee Die hier vorgestellten Überlegungen und Beratungserfahrungen haben eine Reihe von Schwierigkeiten aufgezeigt, die auftauchen, wenn Studierende Elternschaft und Studium zu vereinbaren suchen. Dabei habe ich mich bewusst auf solche Bereiche konzentriert, in denen – anders als bei Finanzfragen und Wohnungssuche – auf den ersten Blick gar keine besonderen Probleme für Studierende mit Kindern zu erkennen sind. Die Probleme, die Jan, Petra und Heike an sich wahrnahmen – Beziehungsstress, Arbeitsprobleme und Motivationskrisen – sind unter Studierenden verbreitet und wurden auch von den Betreffenden eher am Rande mit ihrer Elternsituation in Verbindung gebracht. Viele der spezifischen Belastungen studierender Eltern werden erst deutlich, wenn man sich die Arbeits- und Lebensprozesse, die ein Studium ausmachen, genauer anschaut und die Frage stellt, welche Veränderungen und Konfliktpunkte sich in diesen Prozessen durch die Versorgung kleiner Kinder ergeben. Nicht für alle Probleme, die in den Fallskizzen aufgetaucht sind, konnten Lösungen gefunden werden; aber häufig gab es doch Auswege – durch das Aushandeln von Kompromissen und das Experimentieren mit individuellen Spielräumen. Hierbei durch Beratung Unterstützung zu finden, war für alle hier beschriebenen Eltern entlastend. Denn ohne diese Unterstützung fühlten sie sich im Umgang mit Alltagsorganisation und Kinderbetreuung viel zu unsicher, um von den sie umgebenden Modellen der Verbindung von Beruf und Familie abzuweichen. Sie waren auch nicht erfahren genug in der Praxis wissenschaftlichen Arbeitens, um die für diese Praxis notwendigen Rahmenbedingungen einschätzen und durchsetzen zu können. Das Kunststück, ein für 7 Unter dem Gesichtspunkt Geschlechtergleichstellung im Zugang zur wissenschaftlichen Laufbahn zu födern, wurden an der Universität Bielefeld 1999 eine Befragung von Doktorand/inn/en der Naturwissenschaften durchgeführt (Noller 1999) und im Anschluss daran eine breiter angelegte Absolventenbefragung (Holzbecher, Küllchen & Löther 2002). Deutlich ist in beiden Befragungen, dass Kinder zu haben eine Belastung ist – mehr als 2/3 der Absolventen, die während ihres Studiums Kinder zu betreuen hatten, fühlten sich in allen studienrelevanten Bereichen, die abgefragt wurden, belastet (Holzbecher, Küllchen & Löther 2002, S. 85). Deutlicher als bei den von mir beschriebenen Einzelfällen wird bei beiden Befragungen die geschlechtsspezifisch immer noch sehr unterschiedlich verteilte Belastung. 25 erfolgreiche Berufstätige gesellschaftlich etabliertes Modell der Kinderversorgung mit den Formen akademischen Arbeitens und der intellektuellen Kultur an der Universität individuell zu verbinden, soll von jungen Leuten vollbracht werden, die in beides erst hineinwachsen und in beiden Bereichen mit vergleichsweise geringen Ressourcen ausgestattet sind. Die in meinen Beispielen skizzierten Schwierigkeiten studierender Eltern hatten ihre Wurzeln vor allem in dieser grandiosen Überforderung. Welche Konsequenzen lassen sich daraus ableiten? Die Universität wird die sich aus dieser Überforderung ergebenden Probleme vielleicht nicht vollständig lösen können. Doch als Bildungseinrichtung, die es mit zukünftigen Führungskräften zu tun hat, wird sie stärker als bisher Verantwortung übernehmen müssen. Und es sind Maßnahmen denkbar, die die Bewältigung der angesprochenen Probleme zumindest erleichtern: So wäre es sicher hilfreich, wenn die kritischen Punkte, die sich für studierende Eltern im Studium ergeben, nicht ausschließlich Gegenstand von Sonderbroschüren und Ratgebern blieben. Das Thema „Studieren mit Kind“ oder „Was tun mit Kinderwünschen?“ könnte genauso gut Platz in allgemeinen Studienführern und – ratgebern finden. Es wäre so auch als hochschulöffentliches Thema präsent, ließe sich leichter auf Orientierungsfragen und –probleme beziehen, die Studierende ohnehin haben und würde nicht mehr ausschließlich auf die Information über sozialrechtlich abgesicherte Unterstützungsmöglichkeiten und Stipendienbedingungen begrenzt. Die Einrichtung von Hotlines und Diskussionsforen begleitend zu Lehrveranstaltungen und Studiengängen ist mit zunehmendem Einsatz von Intra- und Internet sicherlich generell hochschuldidaktisch naheliegend. Für studierende Eltern in Studiengängen wie Mathematik und Informatik, aber auch in vielen Gesellschaftswissenschaften, die von der Lösungserarbeitung in Kleingruppen leben, böte dies die Möglichkeit, zumindest virtuell an den zentralen Arbeits- und Kommunikationsprozessen teilzunehmen. Auch die Wohnangebote der Studentenwerke (und anderer Wohnheimträger) ließen sich sicher mit kalkulierbarem Aufwand um eine begrenzte Anzahl von (beieinanderliegenden) Wohneinheiten erweitern, die kindertauglich sind. In Verbindung mit Kindertageseinrichtungen würde dies nicht nur den Alltag studierender Eltern erleichtern, weil die Kinderbetreuung und -versorgung hochschulnah in Kooperation mit anderen studierenden Eltern organisiert werden kann. Auch die Mobilität der Studierenden mit Kind ließe sich so erhöhen, ein Hochschulwechsel wäre nicht mehr völlig außerhalb des Möglichen. Gleichzeitig stiege die Attraktivität der entsprechenden Hochschule für ausländische postgraduierte Gaststudierende, die je nach Herkunftsland bereits in deutlich größerer Zahl in diesem Ausbildungsabschnitt eigene Kinder haben, als dies bei deutschen Studierenden der Fall ist. Die Teilnahme an Erstsemesterwochenenden, Exkursionen, Fachtagungen und wissenschaftlichen Kongressen, die ein Studium häufig erst lebendig und intensiv gestalten, rückt für Eltern von kleineren Kindern wieder in den Bereich des Möglichen, wenn die Frage der Kinderbetreuung vor Ort selbstverständlicher Bestandteil der Organisation wird. Nicht immer wird sich eine Kinderbetreuung einrichten lassen. Häufig wird dies jedoch möglich sein. Manchmal wird sich eine formelle Betreuungsstruktur 26 auch erübrigen, weil entsprechende Absprachen unter den Teilnehmern die Situation auch ohne dies lebbar machen. Etwas aufwendiger ist es vielleicht, in den zentralen Gebäuden der Hochschulen Räume zu schaffen, die für den Aufenthalt mit kleinen Kindern wirklich geeignet sind – damit Studierende mit Kind sich in der Universität treffen können, Wartezeiten nicht zu Stresssituationen in unwirtlicher Umgebung geraten, und die manchmal vor Ort nötige Übergabe der Betreuung in der erforderlichen Ruhe vonstatten gehen kann. Aufwendig ist dies nicht nur, weil der erforderliche Raum vielleicht nicht einfach so zur Verfügung steht, sondern auch, weil Räume, die für Kinder geeignet sind, einer anderen Ausstattung und zusätzlicher Reinigungsmaßnahmen bedürfen als die eher sparsam ausgestatteten Cafeterien und die zahlreich vorhandenen Flure. Last not least: Der Verzicht auf die Zeit zwischen 17.30 h und 20.00 h (= die Zeit, in der Eltern kleiner Kinder diese versorgen und ins Bett bringen) als Zeit für Lehrveranstaltungen, Ringvorlesungen und Gastvorträge würden nicht nur studierenden Eltern, sondern auch vielen Mitarbeiterinnen der Universität eine vollwertige Teilnahme am akademischen Leben ermöglichen. Die Liste der hier vorgeschlagenen Maßnahmen ist weder vollständig noch in allen Punkten wirklich originell.8 Sie bietet allerdings einige Anregungen, in welche Richtung die Gestaltung einer für die Studierenden „familienfreundlichen Hochschule“ gehen könnte. Nicht jede Maßnahme ist mit aufwendigen Infrastrukturmaßnahmen verknüpft; bei einigen geht es auch „nur“ darum umzudenken: weg von dem Bild der Universität als Organisation mit reibungslosen Abläufen, hin zur Vorstellung von Hochschule als Lebensraum, in dem Studierende mit unterschiedliche Optionen und Lebenssituationen ihr Studium gestalten.9 8 Einige der Punkte wurden bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts formuliert. (vgl. Göhler 1988). 9 Dass damit auch ein Beitrag zur Setting-orientierten Gesundheitsförderung an Universitäten geleistet würde (vgl. Gräser 2000, S. 206 f.) sei am Rande angemerkt. 27 Literatur: Bachmann, Nicole; Berta, Daniela; Eggli, Peter & Hornung, Rainer (1999): Macht Studieren krank? Die Bedeutung von Belastung und Ressourcen für die Gesundheit von Studierenden. Bern. Bourdieu, Pierre (1997): Méditations pascaliennes. Paris. Deutsches Studentenwerk (2001): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2000. 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informationssystem (Klaus Schnitzer, Wolfgang Isserstedt & Elke Middendorf). Bonn. Göhler, Marion (1988): „Wie ich es auch mache – es ist immer verkehrt!“. Untersuchung zur Lebens- und Studiensituation studierender Mütter. In: beiträge zur feministischen theorie und praxis. Köln, H. 21/22 „Mamalogie“. S. 127-132. Gräser, Silke (2000): PsyBe: Ein Modell zur Gesundheitsförderung in der Abschlussphase. In: U. Sonntag, S. Gräser, C. Stock, A. Krämer (Hg.): Gesundheitsfördernde Hochschulen. Konzepte, Strategien, Praxisbeispiele. Weinheim. S. 206 – 217. Großmaß, Ruth (2000): Psychische Krisen und sozialer Raum. Eine Sozialphänomenologie psychosozialer Beratung. Tübingen. Holm-Hadulla, Rainer M. (Hg.) (2001): Psychische Schwierigkeiten von Studierenden. Göttingen. Holzbecher, Monika; Küllchen, Hildegard & Löther, Andrea (2002): Fach- und fakultätsspezifische Ursachen der Unterrepräsentanz von Frauen bei Promotionen. (IFF) Bielefeld. Kruse, Otto (Hg.) (1998): Handbuch Studieren. Von der Einschreibung bis zum Examen. Frankfurt/ New York. Luhmann, Niklas (1992): Beobachtungen der Moderne, Opladen. Noller, Monika (1999): Untersuchung der Situation von Promovendinnen und Promevenden in den Naturwissenschaften an der Universität Bielefeld. (IFF) Bielefeld. Notz, Gisela, Notz, Heike & Troscheit, Maika (1988): Das Leben ist doch kein Kindergeburtstag. Leben mit Kindern – Mütter außerhalb der Kleinfamilie. In: beiträge zur feministischen theorie und praxis. Köln, H. 21/22 „Mamalogie“ S. 73 – 83. 28 Wolfgang Neumann Außerdienstliches Wenn man so als Studienberater und Psychologe unterwegs ist, dann merkt man doch, dass man seinen geliebten Beruf so ganz niemals abschütteln kann, es wäre vielleicht zu stark, dass er uns verfolgt, aber der Leser entscheidet letztlich selbst: Kennen Sie bzw. kennt Ihr einen Ort namens Züssow, mitten in Meckpomm gelegen, einen Eisenbahnknotenpunkt zwischen Berlin und Rostock? Mir war dieser Fleck Erde bis dato nicht bekannt oder irgendwie doch, so wie jeder auf seinen Reisen die persönliche Sichtweise, manchmal wie eine Last, überall mit herumschleppt. Ich, für meinen Teil, betrachte die Welt demnach durch die Psychologenbrille, durch die Lupe für das Menschliche, allzu Menschliche. Züssow ‘first sight’ erinnert mich spontan an die, Freunden blutiger Western gut bekannte, aber wenig einladende Bahnstation im mittleren Westen in deren Ambiente der Filmstreifen „Spiel mir das Lied vom Tod“ - hier müsste eine Mundharmonika–Erkennungsmelodie einsetzen - beginnt. Der Bahnsteig von Züssow ist einsam und leer, ein kalter Wind pustet übers freie Feld direkt in meinen Kragen, keine Uniform in Sicht, kein Wartehäuschen, nur Schotter, rostige Gleise und irgendwo klappert lockeres Blech. Der Bahnhof ist als solcher nicht eindeutig identifizierbar, er ähnelt alles in allem mehr einem weiträumigen Schrottplatz, auf dem ausgediente Gleise gelagert werden. In das Klappern mischt sich, stimmungsvoll arrangiert, vereinzeltes Hundegebell, im trüben Licht ahnt man im Hintergrund eingesunkene Siluetten von Lagerhallen und Schuppen, die vor sich hin gammeln, keine Menschenseele zu sehen, die Trost spenden könnte und nur weiter entfernt versucht der Kirchturm von Züssow einem zu verkünden: Es gibt auch hier noch einen festen Glauben. Charles Bronson, der in dem Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ mit Erfolg unter den Ureinwohnern aufräumte, ist heute hier in Züssow gut besetzt. Er wird dargestellt von einem Mitfahrgast, einem groß gewachsenen, dunklen, wahrscheinlich einzelgängerischen Finstermann, mit langen Stiefeln, der Sprache nach ein verdeckter Sachse aus Leibzig oder Bitterfeld. Er saß gerade noch mit mir im Interregio, ist ebenfalls ausgestiegen und steht nun leicht wippend an der Bahnsteigkante. Unter seinem weiten Mantel hält er zwei dieser sehr lang läufigen Revolver versteckt, die im Italo - Western beliebt waren und die es verstanden, bei jedem Schusswechsel zweifelsfrei zwischen Gut und Böse zu differenzieren. „Züssow, Züssow,“ verrät eine Stimme, die hohl klingt, wie aus einer Grabkammer entkommen, den Reisenden zweimal hintereinander den Namen von dem Kaff, um dann weitere Neuigkeiten zu verkünden: „Reisende haben Anschluss an die Usedomer Bäderbahn in Richtung Zwinemünde um 16 Uhr 04, ab 16 Uhr 37!“ Eine gute halbe Stunde Zeit also, mehr Zeit als nötig, um alles hier kennenzulernen ... und in den düsteren Tag hinein, beginnt es bereits zu dämmern. Wir warten! Ich spüre mein banges Herz, Bronson demonstriert, wie gewohnt, seine sprichwörtliche heldenhafte Gelassenheit, wippt etwas weniger und zieht seinen Schlapphut tief in die Stirn. Gerade noch raubte mir der verbeamtete Zugbegleiter, mit mir unterwegs von Berlin-Ost Richtung Ros- 29 tock, kurz vor nämlichem Züssow, mein Restvertrauen, indem er stark zweifelnd meinte: „Na denn, Ihnen noch gute Weiterfahrt nach Usedom, aber, ob die weiter so gut klappen wird ... man weiß ja nie .... die Bahn, in die Sie jetzt umsteigen werden, diese Bäderbahn, die ist nämlich ab Züssow nur noch privat!“ Mit Hilfe einer Bundesbahnbeamtin und deren Behindertenrampe verließ ich sicheres Gebiet und betrat Feindesland. Die Beamtin stieg verdächtig schnell wieder ein, winkte mir kurz zu und nahm auch die beamtete Rampe wieder mit. Privat, privat, was heißt denn hier privat, im Lexikon der Synonyme von Knaur suche ich Trost, finde aber keinen, denn neben „Privat“ gleich bedeutend mit „Persönlich, ureigen, individuell, daheim, häuslich“ muss ich leider auch „außerdienstlich“ lesen. Das kann ja heiter werden, denke ich einmal positiv, sehe dann zu Bronson hinüber, der steht, wippt wieder stärker und äugt herum. Erwartet er das Böse hier auf den Gleisen noch vor halb fünf? Auf jeden Fall muss es sich beeilen, denn für einen gelungenen Schusswechsel wird das Licht nicht besser. Irgendeine üble Sache wird hier heute noch ablaufen, das spüren wir beide. Bronson hat im übrigen kein Gepäck, macht ja auch mobiler, so hat er beide Hände frei zum Schuss. Ich dagegen sitze in meinem Rolli, fröstele, habe eine Tasche auf dem Schoß, eine zweite hängt hinten am Stuhl und neben mir steht in einer dritten Tasche, gut verpackt, mein Laptop. Dann geht es langsam los. Zunächst ertönt von fern, aus Richtung einer schmalen Landstraße, die die Bahnschwellen, in etwa hundert Meter Entfernung, unbeschrankt überquert, ein Misston, etwas Häßliches ertönt, und kommt langsam näher. Bronson wippt gleichförmig, scheinbar unbeeindruckt, weiter, dann vernimmt man mehrere Misstöne, bald gut zu unterscheiden in Gebell, Gezeter, Gebrüll und Gezänk, ein Unheil kommt näher, baut sich auf, unaufhaltsam, etwas Böses schickt an, sich zu ereignen. Alles ist jetzt nur noch reine Nervensache! Bronson schiebt sich gerade ein Kaugummi zwischen die Lippen. Der ist in seinem Element. Ich neige an sich nicht zu übertrieben bösen Ahnungen, aber zu meinem Frösteln gesellt sich ein Erschauern. Wie, alles in der Welt, konnte ich mich allein so weit in die Ostgebiete hinein wagen? Ich kann den Osten doch nicht retten! Die Stille, eben noch bedrohlich, werde ich noch zurücksehnen, denn nun brechen vier Personen, ein Hund und ein Kleinkind von links in die Gleisanlage ein, alles Ossis, ungestüm, ungezügelt, man merkt sofort, die sind von hier, die sind hier zu Hause. Ein Paar, eine nicht mehr taufrische Frau und ein Bär von Mann, beide sehr beleibt und beide triefnasig, in Sportklamotten steckend, aufgedunsen und laut, rollen heran. Der Kerl zerrt einen kleinen dreckig weißen Hund hinter sich her, Madame schiebt einen Buggy, in dem sich ein kleiner Junge vergeblich schreiend windet, dahinter ein vielleicht fünfzehnjähriger Schlaks mit Zigarette, der noch am wenigsten ungepflegt und ranzig wirkt, wahrscheinlich Produkt eines Fehltritts der Dicken, als sie noch schlank war. Die Nachhut bildet ein dünner, kleiner, windiger Typ, Marke Frettchen, ein Nachbar oder ein entfernter Onkel der netten Familie, zu sagen hat der auf jeden Fall nichts, aber so einer macht die Stimmung auch nicht wirklich besser. So, nun sind alle Rollen vergeben, und ich sehe voller Erwartung zu Bronson hinüber, der aber blinzelt nur kurz und lässt die Kanonen unterm Mantel. Schade! Eine private Bahnangestellte steckt ihre Nase kurz aus einem der lädierten Schuppen und schreit: „Verspätung!“ Alle wissen nun Bescheid, das Kleinkind schreit vergeblich, die Dicke schreit lauter und auch vergeblich, der Hund bellt alle an und keiner will ihn verstehen, die Jugend schmeißt Kippen zwischen die Gleise, der Onkeltyp zerdrückt die vierte Bierdose in Folge und donnert sie den Kippen hinterher, der fette Vater schweigt, trinkt auch Dosenbier und schwitzt, obwohl es kalt ist, Bronson 30 kaut sein Kaugummi fade, und ich, ich hoffe noch und bange arg. Eine Stunde später kommt die Bahn - wahrscheinlich haben Eingeborene das Eisenross angegriffen - und ich bemerke, dass der einzige Waggon erstaunlich komfortabel ist, es gibt sogar ein Rolliklo, und ich freue mich auf Erleichterung. Nun sitzen wir zusammen im Großraumabteil und haben den Zug ganz für uns. Die Adams family macht sich breiter als breit, das Kleinkind wird weiter vergeblich von der Mutter Mama angeherrscht, sie versucht es mit der schwarzen Pädagogik und droht: „Wenn Du nicht sofort aufhörst zu schreien, schmeißen wir Dich aus dem Zug!“ Zumindest eine Nervensäge weniger, denke ich, hoffe aber in Wahrheit auf meinen sächsischen Bronson, nach dem Motto: Ein Mann sieht endlich rot. Der Killer hat sich in die obere Zugetage begeben, um von oben gezielt zuzuschlagen, sobald er es für angemessen hält. Madame lässt plötzlich vom Kind ab und pöbelt den Kindesvater an, er solle auch mal etwas sinnvolles tun, statt nur zu Saufen. Tut er doch, denke ich, er hält wenigstens den Mund. Ich registriere dann erstaunt, dass seine Zuwendung, Marke „Heitata“, den Kleinen zu einer kurzen Schreipause verleitet. Aufs Klo kann ich nicht, dorthin gehen nach dem Reißverschlussprinzip verbunden mit dem Staffelprinzip nacheinander alle Familienmitglieder, auch der Hund. Der Dicke lässt sich so viel Zeit, dass seine Alte an die Tür hämmert und schreit: „He, Du Penner, Du bist hier nicht alleine!“ Wie wahr, denke ich, schüchtern. Viele meiner professionellen Kompetenzen sind jetzt gefragt, sage ich mir, dem Dosenbier Onkel täte ein gezielte Konfrontation gegen sein Suchtverhalten gut, hier würden die guten Kontakte der ZSB zur Bielefelder Selbsthilfeorganisation (BIKIS) zum Tragen kommen, dem Kleinen würde eine Überweisung in ein effektives Angstbewältigungstraining evtl. in freier Praxis zu empfehlen sein, besonders hinsichtlich der Mutter und der Ratschlag, über gut meinende Nachbarn frühzeitig Kontakt zum Jugendamt zu knüpfen, dem Paar wäre als Paar nicht zu helfen – Paartherapie wird von der Kasse sowieso nicht übernommen - aber es wäre ein echtes Vergnügen für einen Studienberater a.D., es ihnen frank und frei unter die Triefnasen zu reiben, beide könnten darüber hinaus verschärftes Weightwatching – wieder BIKIS - vertragen, der Jugendliche bräuchte nur etwas Wärme, eine Lehrstellenberatung vom Arbeitsamt und dort eine Intervention zur Erstellung einer soliden Lebensperspektive außerhalb seines Gurkenvereines, der Hund hätte einen Büffelhautknochen vom Zoogeschäft Riemeier am Jahnplatz verdient ... aber, statt zu intervenieren, was tue ich: Ich hoffe auf Bronson! In Heringsdorf zieht die heilige Familie, ohne weitere als seelische Schäden zu verursachen, ihrer Wege, ich fahre noch eine Station weiter nach Ahlbeck, wohne im Grand Hotel an der Strandpromenade, schreibe dort Lyrik und Prosa und versuche, meine Gefühle zur Invasion der Einheimischen zu verdrängen, nicht ohne ein schales Gefühl gegenüber der handlungsbezogenen Abstinenzregel meines Berufsstandes zurückzubehalten. Kennen Sie bzw. kennt Ihr den? Finden zwei Psychologen an einer Straßenecke einen, der offensichtlich gerade zusammen geschlagen wurde. Sagt der eine zum anderen mit verzweifelndem Unterton in der Stimme: „Und, wie können wir dem helfen, der das getan hat?“ Über diesen Bronson, der sich offensichtlich verduftet hat, denke ich schlicht: „Keine Kamera, kein Drehbuch, keinen Mumm, so sind sie eben diese Helden ... außerdienstlich!“ 31 Zu guter Letzt Immer und immer wieder beschäftigen wir BeraterInnen und TherapeutInnen uns mit Fragen unserer Schlüsselkompetenzen und Basisqualifikationen, gilt es doch die Qualität unserer Arbeit zu sichern. Um der Frage einmal anders nachzugehen, schreibe ich zu guter Letzt eine Geschichte mit der Überschrift: Für meine Mutter, für Doktor Yalom, über mein Nasenöl, zur Polenfrage oder ‘Die Suche nach dem Wesentlichen’. Als ich vor einigen Jahren in den USA war, las ich, gemütlich und ahnungslos auf einem mindestens achtspurigen Highway fahrend, die weithin sichtbare Leuchtreklame „Meet the doctor, no waiting, Hollywood 88877733“. In Amiland ist Eigenwerbung für Heiler normal, wir dagegen dürfen nur zart werbend sein, sonst dräut die KV oder das Standgericht. Ein Schlusswort zu einem Jahresbericht ist eine gute Gelegenheit, Werbung in Sachen Kompetenz zu betreiben und ich habe dementsprechend das Buch „Der Panamahut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht“ verfasst vom amerikanischen Psychiater Irvin Yalom, durchgeackert, um unsere Professionalität zu würdigen. Eijajeijaja, da stehen Tipps und Knaller drin, du meine Güte, unsere Güte betreffend, massenhaft gute Güte ... allein, ich habe das Wesentliche nicht erfasst, um es hier und jetzt kompakt niederschreiben zu können ... und jederzeit das Wesentliche zu erfassen, das sollte einen guten Therapeuten auszeichnen und damit habe ich ein Problem mehr. Jeden Morgen vor der Schulzeit ist die Straße, in der ich wohne, rappelvoller Introjekte. Diese werden geschickt und empfangen, zurückgeschickt und wieder ausgesandt und flattern so lange unaufhörlich aufgeregt hin und her, bis endlich der Schulbus kommt und die Spandauer Allee wieder in ihren Dornröschenschlaf versinken darf. Introjekte sind die Aufträge der Eltern an ihre Kinder, die diese sich anhören müssen, aber nicht anhören wollen, die sie befolgen sollen, aber nicht befolgen werden, wodurch ihnen lebenslang Schuldgefühle entstehen. Erst durch das empathische Verständnis eines guten Psychotherapeuten können dergleichen virulenten Introjekte das Wasser abgegraben werden, wenn überhaupt. Die Introjekte, die den Schülern lauthals seitens ihrer Mütter beim Verlassen der Elternhäuser ins Seelische eingeimpft werden, beleben, wie gesagt die Spandauer kurzfristig sowie den Psychologen vor Ort, wenn dieser an sein Geschäft denkt. „Nun pass im Unterricht gut auf, hübsch aufpassen ... hörst du mir überhaupt zu?“ „Melde dich ... melden, das heißt, Finger hoch... hoch, ja hoch!“ „Nun sei schön brav, stör die anderen nicht ... nicht die anderen stören, nicht ... hörst du ... die wollen lernen!“ „Iss dein Schulbrot allein ... die anderen haben ihr eigenes Schulbrot!“ „Du kommst nach der Schule sofort nach Haus ... hörst du ... und sofort heißt sofort?“ Und ich höre im Chor der Mütter auch meine eigene, stimmlagenmäßig ebenfalls leicht verzweifelt, rufen: „Nun konzentriere dich, konzentriere dich doch nur einmal auf das Wesentliche!“ Natürlich hat auch dies Introjekt nicht gefruchtet, denn es gelang mir, die, mich anregende und meine Mutter aufregende Zerstreutheit in meiner Person, um mein Problem hier einmal positiv zu konotieren, durch alle Erziehungsinstanzen hinweg zu retten, kurz: meine Konzentrationsfähigkeit auf das Unwesentliche ist mir erhalten geblieben? 32 Nehmen wir zum Beispiel nur einmal den gestrigen Donnerstag, da war ich den ganzen lieben Tag konzentriert auf Nasenöl. Kennen Sie Nasenöl, wenn nicht, dann sage ich Ihnen, dass man bei Nasenöl, wie bei der Arbeit als guter Psychologe in der Psychotherapie, sehr konzentriert auf das Wesentliche sein sollte, nämlich auf den Moment der nasalen Zuführung. Bin ich in diesem Augenblick zerstreut, was ich, wie gesagt, als Ressource sehe, dann bin ich den ganzen Tag sehr konzentriert, aber auf das Unwesentliche, auf den Fleck, auf das Monstrum, das auf meiner Hose prangt, so dass ich den gestrigen Tag statt „Donnerstag“ auch hätte „Nasenöl“ nennen können. Mit anderen Worten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Nasenöl, Freitag... Aber auch das ist doch wieder ganz und gar unwesentlich! Kein vernünftiger Mensch würde verstehen, wenn ich mit ihm eine Verabredung zu „Nasenöl um“ ... sagen wir einmal, „siebzehn Uhr dreißig“ machen würde oder? Und stellen Sie sich vor, Sie wären mein erster Klient „Nasenöl morgens Punkt 10 Uhr“, hätten Probleme satt und begegnen einem nur nasal glänzenden Therapeuten. Was würde mein verehrter Doktor Yalom dazu sagen? Was meine Mutter? Obwohl, genau genommen, unkonzentriert war ich nur beim Akt der Nasenöl - Infiltration. Da kann einem aber auch die Wut packen! Ich hatte doch wohl alle Rechte zu dieser momentanen Absenz, ich befand mich noch nicht bei der therapeutischen Arbeit, es war meine Hose, ich hatte es eilig, denn meine Bahn orientiert sich niemals an Nasenöl, egal, wie viele Flecken die Leute mitbringen, die wartet die Sekunde nicht, bis das Zeugs gut abgetupft ist und bitte schön, wie sieht das bei einem guten Therapeuten aus, wenn dessen Nase so unverschämt ölig glänzt. Ich trage übrigens Hochachtung für die Güte der mütterlichen Wahrnehmung, haargenau wusste die, was für ein fauler Strick ihr Jüngster war und bleiben würde, denn anstatt die Hose zu wechseln oder den Fleck wenigstens oberflächlich weg zu rubbeln, würde ihr Schlingel den ganzen Nasentag fleckorientiert konzentriert bleiben, wieder nicht auf das Wesentliche bezogen und so muss ich die Anwesenden und Doktor Yalom, nicht aber meine Mutter, fragen: Kann so ein schlichter Nasenheini im anspruchsvollen Therapiegewerbe überhaupt etwas Wesentliches bewirken? Morgens beim Frühstück werfe ich gern ein paar Blicke in unser Käseblatt, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich beginne hinten bei den Todesanzeigen, dann kommt das Feuilleton dran, erst lokal und dann überregional, dann Sport, montags auch gern umgekehrt, dann Lokales aus dem Städtchen und, wenn die Zeit es erlaubt, stoße ich noch über die Rubrik „Neues aus aller Welt“ zur Politik vor. Meine Angstklienten wissen, dass ich auf der Seite „Vermischtes“ immer nach Badeunfällen mit Haien oder Krokodilen suche, nicht gerade gerne, aber die gruseln so schön. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Freitag, den 15. Februar erinnern, es war für die Jahreszeit, wie es so schön heißt, zu warm, für mich zwar nicht, wohl aber für die Jahreszeit, die hätte es, laut NW, einfach lieber kühler gehabt, komisch, auf jeden Fall sah ich im Vorbeiblättern folgende Überschrift: „Vorfrühling ruft Polen ins Land.“ Ich blätterte weiter, hatte spontan keinen Bezug zu Polen und erst, als ich unterwegs zur Bahn war, dachte ich: „Hoch!!!“ „Was, zum Teufel, machen Polen im Vorfrühling in unserem schönen Westfalen und weshalb schreibt man darüber einen Artikel? Wenn es der Jahreszeit zu warm ist, dann hätte ich eher vermutet, sie würde nach Südländern rufen, die verstehen einfach mehr von Wärme, aber Polen?“ Entsprechend dem Nasenöl wurde der 15. Februar zum Tag der Polenfrage, denn ich blieb den ganzen lieben Tag voll auf die Polen konzentriert. Unterwegs in der Bahn dachte ich darüber nach, wie die Jahreszeit es wohl anstellt, dass sie, wenn es wärmer ist, als sie es mag, nach Polen ruft. Zwischen Hauptbahnhof und Jahnplatz hatte ich das Problem unterirdisch mental gelöst: So eine Jahreszeit hat einfach keine Kommu- 33 nikationsprobleme, die hat ganz andere Medien zur Verfügung als unsereins, Post, Telefon, SMS, Fax, E-mail, darüber lacht die nur, etwas himmelblau, zwei Lerchen unter die Graugänse, Osterglocken heraus, Schneeglöckchen hinein und zackbumm, schon weiß der Pole schwer Bescheid und ist schon unterwegs in den wilden Westen. „Vielleicht,“ so hatte ich bis zur verdienten Mittagspause heraus gearbeitet, „hat die Lösung der Polenfrage mit unserem lecker Spargel zu tun.“ „Polen arbeiten in der Spargelernte,“ dachte ich schon gegen 14 Uhr, „und kommen im Februar ins Land, wenn es wärmer ist, als die Jahreszeit erwartet, weit aus dem Osten zu uns, um irgendwie die Spargelernte vorzubereiten. „Aber was gibt es da groß vorzubereiten,“ dachte ich um Schlag 18 Uhr? Da sieht man einmal wieder, was man wieder einmal alles nicht weiß, das ist wahrscheinlich wieder das Wesentliche, das weiß man eben nicht und es fällt einem dann auch erst auf, wenn man es dringend braucht. Dabei könnte man so viel wissen, wenn man nicht andauernd seine Zeit verplempern würde. Wenn ich, zwar vom vielen Gerede müde, aber doch noch lernfähig, mit der U-Bahn nach Hause fahre, dann sehe ich praktisch nie, dass sich einer der Fahrgäste einmal ernsthaft mit solchen zentralen Agrarfragen auseinandersetzt. „Mensch,“ möchte man den Dahindösenden zurufen, Mensch, „so eine Broschüre der münsterländer Bauernschaft über das Spargelsetzen, zum Beispiel aus dem schönen Schwege bei Glandorf, dem Spargelparadies ist doch schnell verknuspert?“ Überhaupt, es gibt Tage, da lernt man viel und es gibt Tage, da hat man nichts als Schwund am Kopf. So lernte ich Anfang April des Jahres durch eine Sendung im ZDF, dass wir Menschen, zu der Zeit, als unsere Urgene noch in ganz anderen Geschöpfen steckten, aber immerhin schon in Säugern, auch nachts farbig sehen konnten, wie heute noch die Eulen, infrarot, dass uns diese schöne Fähigkeit aber evolutionsmäßig flöten ging, weshalb wir heute auch nachts schlafen und tags Beute machen, anders als die Eulen. Hoch, es ist doch zum Mäusemelken, dass man so wenig Wesentliches weiß. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Säugern verschiedener Nationen beim Farbensehen? Adler, zum Beispiel, können Mäusepisse aus großer Höhe entdecken, auch infrarot, wir dagegen können sie gut riechen, auch nachts. Polen sind stolz, können gut sehen, schlafen auch nachts, aber warum sind sie hier? Das sind doch die wesentlichen Sachen, die du gemeint hast, nicht wahr, Mutti? Nachdem ich einen höchst konzentrierten Tag mit der Polensache verbracht hatte, fischte ich, entgegen meiner Tendenz, faul zu sein und zu bleiben, am Abend die NW aus dem Müll und las auf Seite vier unten eindeutig und unmissverständlich: „Vorfrühling ruft Pollen ins Land!“ Nach einem alten, spanischen Sprichwort braucht der Mensch zwei Jahre, um das Sprechen zu erlernen, jedoch derer sechzig, um endlich zu lernen, die Klappe zu halten. Der Hinweis, dass Nasenöl, übrigens verschrieben von Dr. Brinkkötter, nicht gegen Pollen hilft, ist besonders zu Allergiezeiten nicht ganz unwesentlich. Wegen meines Konzentrationsdefektes spendet mir Doktor Yalom doch Trost, indem er schreibt, er selbst habe oft neiderfüllt seine Klienten seine eigenen bislang ungelösten Probleme lösen gesehen, währenddessen er selbst für deren Lösung keine Zeit gefunden habe. Da auch ich wegen der vielen Arbeit keine Zeit habe, zu einem guten Therapeuten zu gehen, werde ich mir vorläufig durchs therapeutische Schreiben helfen. 34