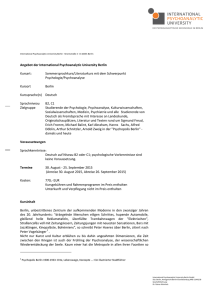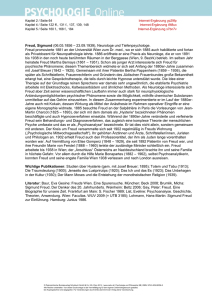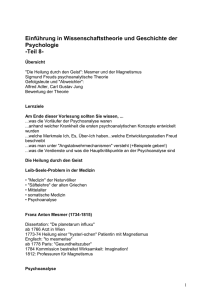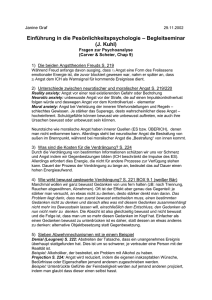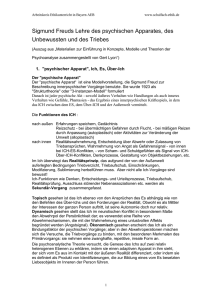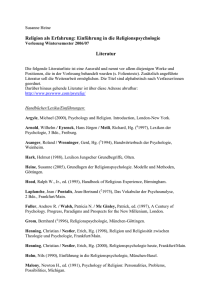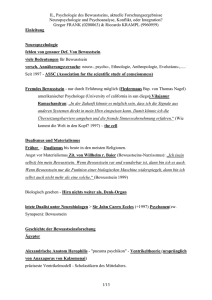2 - Universität Salzburg
Werbung
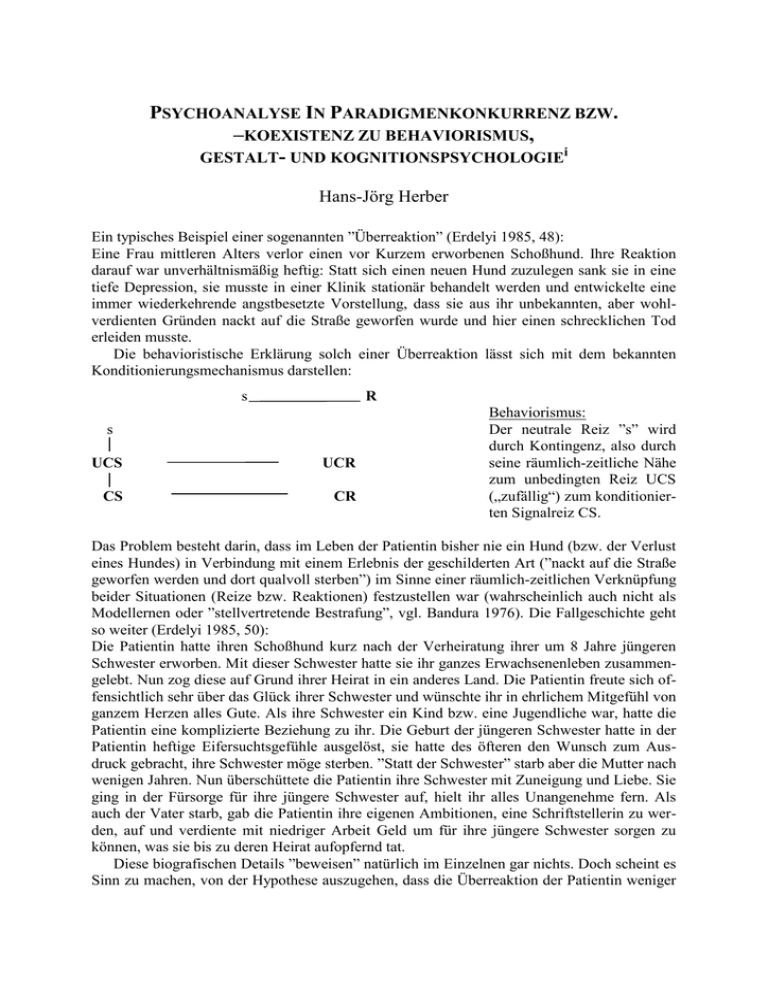
PSYCHOANALYSE IN PARADIGMENKONKURRENZ BZW. –KOEXISTENZ ZU BEHAVIORISMUS, GESTALT- UND KOGNITIONSPSYCHOLOGIEi Hans-Jörg Herber Ein typisches Beispiel einer sogenannten ”Überreaktion” (Erdelyi 1985, 48): Eine Frau mittleren Alters verlor einen vor Kurzem erworbenen Schoßhund. Ihre Reaktion darauf war unverhältnismäßig heftig: Statt sich einen neuen Hund zuzulegen sank sie in eine tiefe Depression, sie musste in einer Klinik stationär behandelt werden und entwickelte eine immer wiederkehrende angstbesetzte Vorstellung, dass sie aus ihr unbekannten, aber wohlverdienten Gründen nackt auf die Straße geworfen wurde und hier einen schrecklichen Tod erleiden musste. Die behavioristische Erklärung solch einer Überreaktion lässt sich mit dem bekannten Konditionierungsmechanismus darstellen: s R s UCS UCR CS CR Behaviorismus: Der neutrale Reiz ”s” wird durch Kontingenz, also durch seine räumlich-zeitliche Nähe zum unbedingten Reiz UCS („zufällig“) zum konditionierten Signalreiz CS. Das Problem besteht darin, dass im Leben der Patientin bisher nie ein Hund (bzw. der Verlust eines Hundes) in Verbindung mit einem Erlebnis der geschilderten Art (”nackt auf die Straße geworfen werden und dort qualvoll sterben”) im Sinne einer räumlich-zeitlichen Verknüpfung beider Situationen (Reize bzw. Reaktionen) festzustellen war (wahrscheinlich auch nicht als Modellernen oder ”stellvertretende Bestrafung”, vgl. Bandura 1976). Die Fallgeschichte geht so weiter (Erdelyi 1985, 50): Die Patientin hatte ihren Schoßhund kurz nach der Verheiratung ihrer um 8 Jahre jüngeren Schwester erworben. Mit dieser Schwester hatte sie ihr ganzes Erwachsenenleben zusammengelebt. Nun zog diese auf Grund ihrer Heirat in ein anderes Land. Die Patientin freute sich offensichtlich sehr über das Glück ihrer Schwester und wünschte ihr in ehrlichem Mitgefühl von ganzem Herzen alles Gute. Als ihre Schwester ein Kind bzw. eine Jugendliche war, hatte die Patientin eine komplizierte Beziehung zu ihr. Die Geburt der jüngeren Schwester hatte in der Patientin heftige Eifersuchtsgefühle ausgelöst, sie hatte des öfteren den Wunsch zum Ausdruck gebracht, ihre Schwester möge sterben. ”Statt der Schwester” starb aber die Mutter nach wenigen Jahren. Nun überschüttete die Patientin ihre Schwester mit Zuneigung und Liebe. Sie ging in der Fürsorge für ihre jüngere Schwester auf, hielt ihr alles Unangenehme fern. Als auch der Vater starb, gab die Patientin ihre eigenen Ambitionen, eine Schriftstellerin zu werden, auf und verdiente mit niedriger Arbeit Geld um für ihre jüngere Schwester sorgen zu können, was sie bis zu deren Heirat aufopfernd tat. Diese biografischen Details ”beweisen” natürlich im Einzelnen gar nichts. Doch scheint es Sinn zu machen, von der Hypothese auszugehen, dass die Überreaktion der Patientin weniger mit dem Verlust des kürzlich erstandenen Hundes als mit dem Verlust ihrer Schwester (und früher der Mutter) zu tun haben könnte: der Verlust eines ”teuren” Lebewesens (in das man viel investiert hat, was nun wertlos geworden ist - vielleicht weil man versagt hat). So gesehen erscheint die Reaktion schon eher verständlich und angemessen zu sein. Unterschied Behaviorismus - Psychoanalyse: Was verhaltenspsychologisch als Überreaktion in Bezug auf einen geringfügigen Verlustreiz figuriert, scheint psychoanalytisch als ”natürliche” Folge eines großen Verlustes (verbunden mit einem massiven eigenen Wertverlust) interpretierbar, der durch den Oberflächenreiz (das Symbol) ”Hund” nur ausgelöst wurde, ohne dass eine Konditionierung von Schwester (bzw. Mutter) und Hund (als räumlich-zeitliche Kontingenz) in realer Weise erfolgte. Die Analogiebeziehung muss ”tiefer” (abstrakter, funktionaler) - semantisch – zustande gekommen sein: bewußt s R unbewußt S Der bewusst wahrgenommene Reiz ”s” ist strukturell und/oder funktional ”ähnlich” dem unbewussten Reiz ” S ”, von dem ”natürlicherweise” eine entsprechend große Wirkung ” R ” ausgeht ( semantische Ähnlichkeit der Tiefenstruktur, funktionelle Analogie von Lebensprozessen, z.B. ”Abszess” als Metapher für ”Verdrängung”, Abspaltung, Isolierung des Krankmachenden um das übrige System gesund zu erhalten, etc., vgl. Herber et al. 1996). 1. Theoriekern und intendierte Anwendungen Herber (1979, 107) konstatiert einen „wissenschaftstheoretischen Notstand“ der Psychoanalyse und ihrer zahlreichen neo-psychoanalytischen und sonstwie tiefen-psychologischen Epigonen, deren Arbeiten „trotz aller kritischen Absetzbewegungen möglicherweise in ‘übermässiger Libidobesetzung’ ... an der vorwissenschaftlichen, wenn auch brillanten, essayistischen Terminologie des Ahnvaters Freud ‘hängen geblieben’ (fixiert) sind, statt ein wissenschaftlich ‘sauberes’ (logisch disjunktes) Begriffsinventar zu schaffen, um Freuds geniale psychologische Einsichten in geeigneten Theorien und Modellen systematisieren, formalisieren und empirisch exakt überprüfen zu können.“ Bunge & Ardila (1987, 22), die den Anfängen eines wissenschaftlichen Forschungs-programms durchaus gewisse Mängel in der exakten Begriffsbildung, der logischen Konsistenz und Mathematisierung zugestehen, äußern sich ähnlich kritisch: „If Freud had been an exact thinker he might not have engendered more than 100 psychoanalytic schools ... exactness favors testability.“ Freud scheint sich der Notwendigkeit zur präzisen Definitionen der verwendeten Begriffe auf empirischer Grundlage bewusst zu sein. Er sieht sich selbst allerdings mehr als heuristischen Anreger (Ideengeber) für die Entwicklung gehaltvoller (alternativer) psychologischer Hypothesen. Als Initiator einer z.T. völlig neuen psychologischen Denkweise fühlt er sich selbst noch nicht in der Lage Bedeutungsumfang und -inhalt der von ihm verwendeten Begriffe präzise genug einschätzen zu können um ein logisch konsistentes System zu „bereiten“ (Freud GW Bd. 10, 210). In dem wenig bekannten „Entwurf einer Psychologie“ (Freud 1962) bemüht er sich noch um eine Art axiomatischer Grundlegung seiner psychologischen Überle- gungen (in „Hauptsätze“ gegliedert) auf Basis des ihm zur Verfügung stehenden neurowissenschaftlichen Forschungsstandes. Dieses Unterfangen bricht letztendlich da ab, wo es für Freud um „den Kern des Rätsels“ geht, nämlich um die gehirnphysiologische Abbildung des Verdrängungsprozesses. Doch hält er auch später (GW Bd. 17, 273) grundsätzlich am ursprünglichen Ziel fest: „Es ist ein unerschütterliches Resultat der Forschung, dass die seelische Tätigkeit an die Funktion des Gehirns gebunden ist wie an kein anderes Organ. Ein Stück weiter ... führt die Entdeckung von der Ungleichwertigkeit der Gehirnteile und deren Sonderbeziehungen zu bestimmten Körperteilen und geistigen Tätigkeiten.“ Oder: „Das Lehrgebäude der Psychoanalyse, das wir geschaffen haben, ist in Wirklichkeit ein Überbau, der irgend einmal auf sein organisches Fundament aufgesetzt werden soll; aber wir kennen dieses noch nicht.“ (GW Bd. 11, 403) Um letztendlich sein - temporäres - Aufgeben in dieser Forschungshinsicht zu rechtfertigen: „... alle Versuche, von da aus eine Lokalisation der seelischen Vorgänge zu erraten, also Bemühungen, die Vorstellungen in Nervenfasern wandern zu lassen, sind gründlich gescheitert“ (GW Bd. 17, 273, siehe dazu die Stellungnahmen namhafter Forscher der Gegenwart zu diesbezüglichen Problemen aus rezenter neurowissenschaftlicher Sicht in Guttmann & Scholz-Strasser 1998). Da Freuds Psychoanalyse mehrere, z.T. konkurrierende theoretische Ansätze enthält (z.B. beim Thema „Aggression“), kann von einem einheitlich axiomatisierten System nicht die Rede sein (diesen Status teilt die Psychoanalyse allerdings mit anderen - z.T. wesentlich elaborierteren - sozialwissenschaftlichen Theorien, vgl. etwa die konkurrierenden Theorien innerhalb der Leistungsmotivationsforschung, z.B. Herber 1979, Herber et al. 1999). Aber erst eine exakt formulierte, logisch widerspruchsfreie und intern möglichst konsistente Theorie ermöglicht eine systematische empirische Forschung. Dieser bis heute andauernde „Notstand“ der Psychoanalyse (und anderer tiefenpsychologischer Systemversuche) ist umso bedauerlicher, als Freud (GW, Bd. 17, 73) verspricht, der wissenschaftliche Ertrag der psychoanalytischen Forschung werde „... in der Einsicht in Zusammenhänge und Abhängigkeiten bestehen, die in der Außenwelt vorhanden sind, in der Innenwelt unseres Denkens irgendwie zuverlässig reproduziert oder gespiegelt werden können, und deren Kenntnis uns befähigt, etwas in der Außenwelt zu ‘verstehen’, es vorauszusehen und möglicherweise abzuändern.“ Dazu gehört, alle theoretischen Terme exakt zu definieren um eine systematische Beobachtung der Realität unter kontrollierten Bedingungen durchführen, die so gemachten Beobachtungsergebnisse strikt theoriebezogen beschreiben und zur objektiven Überprüfung der hypothetischen Erklärungen bzw. Prognosen anwenden zu können. Auch die kritischen wissenschaftstheoretischen Analysen von Perrez (z.B. 1972, 1985) zeigen immerhin auf, dass es in den wissenschaftlichen Systemansätzen der Psychoanalyse um die Formulierung gesetzesartiger Aussagen von hypothetischem Charakter geht: Freud will Erlebens- und Verhaltensphänomene objektiv beschreiben, erklären und vorhersagen. Wenn Perrez (1985, 32) auch zu Recht die „begriffliche Unschärfe, gekoppelt an einen hohen Bedeutungsüberschuss zahlreicher Konzepte, ihre mangelnde logische Verknüpfung ...“, etc. konstatiert - im Unterschied zu vielen seiner Epigonen hält Freud an einem wissenschaftlichen Wahrheitsbegriff fest, wenn er behauptet, „dass es keine andere Quelle der Welterkenntnis gibt als die intellektuelle Bearbeitung sorgfältig überprüfter Beobachtungen, also was man Forschung heißt, daneben keine Kenntnis aus Offenbarung, Intuition oder Divination.“ (Freud GW Bd. 15, 586) Oder - durchaus in Übereinstimmung mit dem Popperschen Wahrheitsbegriff (z.B. Popper 1994, 116) - geht es Freud (GW Bd. 15, 597) darum, „... Übereinstimmung mit der Realität zu erreichen, d.h. mit dem, was außerhalb von uns, unabhängig von uns besteht ... Diese Übereinstimmung mit der realen Außenwelt heißen wir Wahrheit. Sie bleibt das Ziel der wissenschaftlichen Arbeit ...“ Wie andere sozialwissenschaftliche Konzeptionen auch wird die Psychoanalyse nicht um eine wenigstens teilweise Axiomatisierung, Formalisierung, Systematisierung, etc. herumkommen. Ansätze dazu gibt es (z.B. Moser et al. 1968, 1981, Wegman 1985; was die zentralen Abwehrmechanismen „Verschiebung“ und „Ersatzbefriedigung“ betrifft, siehe z.B. Atkinson & Birch 1970, 1986, Blankenship 1986, Kuhl & Blankenship 1986, Astleitner 1992, Astleitner & Herber 1993). Erst dann können in eindeutiger Weise notwendige und hinreichende Bedingungen formuliert werden, denen bestimmte Erlebens- und Verhaltensweisen in transsituationaler bzw. situationsspezifischer Weise - deterministisch oder probabilistisch folgen (zum Problem der Situationsspezifität siehe Patry 1991). Ein interessanter Ansatz zur Rekonstruktion der Freudschen Theorie der Neurose im Sinne des „neuen Strukturalismus“ findet sich in Stegmüller (1986, 413-432), der für die logische „Säuberung“ sowie empirische Überprüfbarkeit psychoanalytischer Konzepte eine formal elaborierte, gangbare Spur zu legen scheint. Die immer wieder erhobene Kritik theoretisch-begrifflicher Unschärfe und mangelnder Systematisierung (Axiomatisierung) trifft - wie erwähnt - nicht nur auf die Psychoanalyse und deren Folgekonzepte zu, sondern auf viele sozialwissenschaftliche Theorien (insbesondere im Bereich der Humanistischen Psychologie), u.a. auch - natürlich mit graduellen Unterschieden - auf die um wissenschaftliche Reputation so sehr bemühte Kognitionspsychologie, der es z.B. bis dato nicht gelungen ist, den Begriff „Bewusstsein“ (oder „Rationalität“) in einer allgemein gültigen und/oder praktisch anwendbaren Weise zu definieren - auch nicht unter zunehmender Einbeziehung biologisch-evolutionstheoretischer Forschung (vgl. z.B. Galperin 1972, Newell & Simon 1972, Riedl 1980, 1984, Wessels 1984, Ruse 1985, Maturana 1985, Churchland 1986, Maturana & Varela 1987, Pöppel 1987, 2000, Bunge 1992/93, Klix 1992, 1993, Perrig et al. 1993, 16ff., Blakeslee 1996, Claxton 1997, Pinker 1998b, Dörner 1999, 785ff., Varela 2000). Keinesfalls besser sieht es konsequenterweise mit dem Begriff des Unbewussten aus (siehe z.B. Hobisch & Schulter 1985, Pöppel 1987, 165ff., 1993, Perrig et al. 1993, Blakeslee 1996, Claxton 1997, Pinker 1998b). Der Theoriekern der Psychoanalyse sei an folgenden - für unseren Paradigmenvergleich grundlegenden - Konzepten dargestellt (fallweise - zur Verdeutlichung - unter Einbeziehung intendierter Anwendungen), was angesichts der bei Freud in den uns bekannten Texten von Problemerörterung zu Problemerörterung etwas „verrutschenden“ Begrifflichkeit in extensionaler wie intensionaler Hinsicht ein nicht ganz leichtes Unterfangen ist und interpretative „Eingriffe“ erfordert: 1.1 Das Unbewusste Am besten erkennt man die Existenz unbewusster Bedürfnisse an Verhaltensweisen wie z.B. „Überreaktionen“, „Zwangshandlungen“, „Fehlleistungen“, „Ersatzhandlungen“, an Erinnerungslücken in Bezug auf persönlich Bedeutsames im Denken und Sprechen (also nicht am z.B. stressbedingten Vergessen von Marginalien, weniger wichtigen Dingen, Ereignissen, etc., vgl. entsprechende Kapitel in Freud GW Bd.1, Bd. 2 u. 3, Bd. 4, Bd. 8, Bd. 10, Bd. 11). Die Annahme unbewusster Prozesse ist für Freud deswegen „notwendig und legitim“, weil „die Daten des Bewusstseins in hohem Grade lückenhaft sind“. Bei allen Menschen „kommen häufig psychische Akte vor, welche zu ihrer Erklärung andere Akte voraussetzen, für die aber das Bewusstsein nicht zeugt. ... “ (Freud GW, Bd. 10, 125f.) Verhalten, Gefühlserlebnisse und Denkprozesse werden vom Unbewussten mitdeterminiert. Das „Es“ symbolisiert in Freuds Persönlichkeitsmodell unbewusste (im fließendenÜbergang zu vorbewussten) Trieb- und Gefühlsregungen, die nach Realisierung drängen.ii Das Streben des Organismus nach Lustmaximierung und Unlustminimierung wird von frühester Kindheit an durch Bezugspersonen, von denen man abhängig ist, mehr oder weniger eingeschränkt. Durch diesen Konditionierungsvorgang kommt es zur Ausprägung des „Überich“ (eine Art Zensor oder Gewissen). Durch die Entwicklung realer Objektbeziehungen, des Denkens, des Erinnerungsvermögens, der Erwartungshaltungen erwirbt der Mensch die Fähigkeit zu zunehmend realitätsangemessenen Strategien der Bedürfnisregulation (z.B. des Bedürfnisaufschubs). Diese Instanz der Persönlichkeit nennt Freud „Ich“. Das Ich vermittelt zwischen den Triebregungen, dem Bedürfnisdruck des Es, den im (un- bis vorbewussten) Überich gespeicherten Geboten und Verboten relevanter Bezugspersonen und den realen Möglichkeiten, die eine konkrete Umweltsituation bereitstellt. Die unbewussten Es-Impulse sind auf lustvolles Erleben und Handeln gerichtet, drängen nach Realisierung und gehen Kompromisse mit Vorstellungen ein, die sowohl den Geboten und Verboten des Überich als auch den wahrgenommenen Möglichkeiten der Realität entsprechen und weitgehend bewusstseinsfähig sind (sofern sie nicht als zu bedrohlich, „traumatisch“ erlebt und daher verdrängt wurden). Eigene Triebimpulse können in unbewusster Konfrontation mit gegengerichteten Überich-Impulsen diffuse Angst erzeugen, deren Ursprung - im Unterschied zur objektbezogenen Furcht - nicht klar erkennbar ist. Abwehrmechanismen sorgen für relative Entlastung und Entspannung, so dass man halbwegs funktionsfähig, „liebes- und arbeitsfähig“ bleibt und mit dem gegebenen Spannungsfeld aus innerer und äußerer Situation einigermaßen umgehen kann, auch wenn der potentielle Erlebens- und Verhaltensspielraum des Individuums dadurch eingeschränkt wird (vgl. Freud GW, Bd. 10, Bd. 15, siehe auch Swanson 1988, 8ff.). 1.2 Abwehr Abwehrmechanismen (vgl. A.Freud 1975) sind nicht willentliche, d.h. in der Sprache der Psychoanalyse unbewusste (bis vorbewusste) Ichtätigkeiten zum Zwecke der - von Es und Überich bedrohten - Aufrechterhaltung der Identität und Selbstachtung des Ich, d.h. sie treten immer dann auf, wenn die Bewusstmachung eines bestimmten Verhaltens, Affektes, Wunsches, etc. die Selbstachtung, das Selbstbild, das wir von uns haben, in Frage stellen bzw. abwerten könnte. Dies wiederum setzt voraus, dass die Person entsprechende ethische Vorstellungen für sich als bindend anerkennt im Sinne eines „so soll ich sein“, oder anders, der Mensch geht von einem Ich-Ideal aus, an dem er sich misstiii. Dadurch entsteht das Bedürfnis sich diesem Ideal anzunähern bzw. sich derjenigen Wünsche, Neigungen, Verhaltenstendenzen im Bewusstsein zu entledigen, die diesen Idealvorstellungen nicht entsprechen. So eine Entledigung gelingt durch Abwehr (vgl. Freud GW Bd. 1, Bd. 10, Bd. 13, Bd. 17). Wie oben beschrieben, besteht nach Freud die Gesamtpersönlichkeit aus den drei Instanzen Es, Ich und Überich, wobei das Ich diejenige Instanz ist, die den Kontakt mit der Außenwelt, der Realität herstellt. Wir werden uns im Folgenden kurz mit der Entwicklung des Überich auseinandersetzen, insoweit dies für das Verständnis der Abwehrmechanismen notwendig ist. Das Überich beinhaltet eine Summe von Wert- und Sollensvorstellungen, welche als zensorische Instanz wirken. Es stellt eine Metapher für das Insgesamt der durch die Eltern, Lehrer und andere Autoritäten, Erziehungsinstitutionen, etc. vermittelten Kulturnormen und Wertvorstellungen dar. Es entwickelt sich in der frühen Kindheit, in einer Zeit also, in der der Mensch einer rationalen Überlegung und Stellungnahme zu sich und der Realität noch nicht fähig ist und den Realitätskontext nur dadurch gewinnt, indem er die Erziehungspersonen imitiert, d.h. deren Normen durch Identifikation (Introjektion, Internalisierung, Subjektion) erwirbt (vgl. die transaktionsanalytische Weiterführung der psychoanalytischen Position durch Rath 1995, 1996, 1998). Dazu ein illustratives Beispiel: Zulliger (1969, 136) berichtet von einem kleinen Mädchen, das unreifes Obst abreißen wollte. Die Mutter befürchtete, ihr Kind könne beim Genuss krank werden. Sie verbot ihm das Abreißen, und weil es dennoch immer wieder an den Baum herantrat, wiederholte die Mutter das Verbot eindringlicher und gab ihrem Kind einen kleinen Klaps auf die Hände. Die Szene wiederholte sich während mehrerer Tage. Später einmal, als die Kleine wieder im Garten spielte und, wie sie glauben konnte, unbeobachtet und nicht beaufsichtigt war, trat sie neuerdings an das Obst heran. Mit der einen Hand langte sie zur Frucht, mit der anderen klapste sie sich auf die begehrliche Rechte und sagte zu sich selbst: „Böses Händchen will nehmen, böses Händchen darf nicht nehmen“ und sie lief weg. – An diesem Beispiel zeigt sich klar das Wechselspiel zwischen Esstrieb und dem zum inneren Anspruch gewordenen Gebot der Mutter. Das Kind hat nach und nach und schließlich ganz das mütterliche Verbot zum eigenen inneren Anspruch gemacht. – Durch Einbeziehung der Eltern in das eigene kindliche Ich rücken sozusagen auch deren Forderungen, Gebote und Verbote in das eigene Ich ein: sie werden zur einheitlichen, inneren Autorität, zum Überich. Dieser Aufbau des Überich findet im Abschluss der Pubertät sein Ende, damit scheidet die erzieherische Außenwelt, die äußere Autorität als bisher dominierende Prägungsinstanz des individuellen Erlebens und Verhaltens aus, das Überich, die innere Autorität, übernimmt die Führung, der Mensch fühlt sich autonom und frei, die erziehlich wirksamen Objekte sind zu „Selbstobjekten“ geworden (vgl. Kohut 1981, Goldberg 1982, Wolf 1982, Lichtenberg et al. 1992, Rath 1998). Ob nun vom Erwachsenen zu diesen einverleibten Bildern der moralischen Aspekte, die in der Kindheit sozusagen „kritiklos“ von Eltern, Lehrern und anderen Erziehungspersonen bzw. Autoritäten übernommen wurden, eine bewusste, reflektierte Stellungnahme erworben werden kann oder ob diese unbewusst, d.h. der Bewusstseinskontrolle entzogen, wirken, hängt weitgehend vom Verhalten der jeweiligen Kindheitserzieher ab. Hier zeigt sich eine hohe Übereinstimmung der psychoanalytischen Erklärungsweise mit dem Konditionieren von Ver-meidungsverhalten durch negative Verstärkung (z.B. Skinner 1973, 168ff.), wenn auch unter Einbezug kognitiver Repräsentationen: So wird ein Erwachsener, der in seiner Kindheit nach jeder Missachtung einer Norm schwer bestraft wurde, es oft gar nicht wagen, darüber nachzudenken, ob die Erfüllung dieser oder jener Norm überhaupt sinnvoll ist. Denn die damalige Forderung - etwa seiner Eltern - dieser Norm zu gehorchen, kann noch so stark sein, dass der leiseste Zweifel an ihrer Berechtigung bereits zu Schuldgefühlen und zu Angst führt, und damit eine bewusste, kritische Stellungnahme zu dieser Norm nicht mehr möglich ist. Bei vielen der sogenannten Selbstverständlichkeiten unseres Lebens handelt es sich sehr oft um solche unreflektierten Überich-Sollensforderungen. Fragt man denjenigen, der behauptet, dass man etwas „selbstverständlich“ (dem eigenen „Selbst“ „verständlich“) zu tun hat oder dass sich etwas einfach nicht gehöre, warum dies eigentlich so sei und ob es nicht auch anders sein könnte, so weiß er darauf - zunächst - keine Antwort, die Voraussetzungen für diese seine Selbstverständlichkeiten sind ihm nicht bewusst: Es gelang ihm nicht, die Überich-Gebote in sein Ich, bzw. dessen Bewusstseinszentrum, zu integrieren und kritisch damit umzugehen. Das Ziel der Entwicklung und damit der entwicklungsfördernden Erziehung ist nach Freuds Persönlichkeitskonzept ein relativ autonomes Ich, also ein Ich, das seiner Integrationsaufgabe so weit gewachsen ist, dass es weder von den Triebbedürfnissen noch von den Überichgeboten zu sehr bedrängt wird. Das Ich sollte nach und nach fähig werden einerseits Triebbedürfnisse je nach Realitätskontext aufzuschieben und im „geeigneten Rahmen“ zu befriedigen oder - wenn nötig - auf deren Befriedigung zu verzichten, andererseits die starren Forderungen des Überich durchsichtig („verständlich“) zu machen, sie auf ihre transsituatio- nale wie situationsspezifische Realitätsangemessenheit („Sinnhaftigkeit“) zu überprüfen und rational kontrolliert - zu korrigieren. Gelingt dem Ich diese Koordinations- und Integrationsaufgabe nicht, so kommt es zu einer Störung der Integrität des Ich. Um der Angst vor dem hilflosen Ausgeliefertsein an Es oder Überich und damit der Aufhebung der Ichautonomie und Selbstachtung des Ich zu entgehen, vollzieht das Ich die Abwehr. Das Ich ist das „Wer“ in diesem Prozess, das „Was“ sind die abzuwehrenden Ansprüche des Es, die mit den Normen des Überich unverträglich sind. Dass Abwehrprozesse im psychoanalytischen Sinne diagnostischen und prognostischen Wert für den weiteren Therapieverlauf haben, ist in psychoanalytisch inspirierten empirischen Untersuchungen nachgewiesen worden (z.B. Silverman 1983, Sackeim 1983, Erdelyi 1985, Gitzinger-Albrecht 1993). Einzelne der Freudschen Abwehrmechanismen (wie z.B. Verdrängung, Verschiebung und Ersatzbefriedigung) haben - nicht selten „auf Umwegen“ - sowohl die gestalt- und feldtheoretische als auch die kognitionspsychologische Forschung (vice versa) befruchtet und sind in hochelaborierten Theorien- und Methodenzusammenhängen untersucht worden (z.B. Lewin 1963, Moser et al. 1968, 1981, Atkinson & Birch 1970, 1986, Wegman 1985, Erdelyi 1985, Brody 1986, Swanson 1988, Weinberger 1990, Waldvogel 1992, Baumeister & Cairns 1992, Newton & Contrada 1992, Sincoff 1992, Astleitner 1992, Astleitner & Herber 1993, Gitzinger-Albrecht 1993, Galli 1997, Luchins & Luchins 1997, Derakshan & Eysenck 1997, 1999). Um einen ersten Eindruck von diesem originär psychoanalytischen Forschungsproblem zu vermitteln, wollen wir A.Freuds (1975) Abhandlung - interpretierend - zusammenfassen, wenn wir in dieser Darstellung auch die mangelnde Disjunktivität zwischen den einzelnen „Abwehrmechanismen“ sowie die insgesamt mangelnde Systematisierung, theoriekern-bezogene Fundierung und experimentell-empirische Überprüfung zu kritisieren habeniv: 1. Allen voran ist der Grundmechanismus der Verdrängung zu nennen. Unter „Verdrängung“ versteht A.Freud die Fernhaltung von Bedürfnissen und Vorstellungen vom Bewusstsein, eine Verweigerung der Verwirklichung von Entwicklungsmöglichkeiten durch Vermeidung der bewussten Auseinandersetzung mit Konflikten. Es kommt zum Abschieben von Wünschen oder Vorstellungen, die nicht befriedigt oder realisiert werden können oder deren Befriedigung bzw. Realisation von der Außenwelt oder vom Überich nicht geduldet werden kann, ins Unbewusste. So sind sie dem bewussten Zugriff entzogen. Ein verdrängter Gedanke hat für die bewusste Wahrnehmung zu existieren aufgehört. Ein Charakteristikum der verdrängten Wünsche, Affekte, Vorstellungen, etc. ist es jedoch, dass sie weiterhin nach Ausdruck streben und diesen auch auf vielerlei indirekten Wegen finden. Verdrängung ist also keine Willensentscheidung, kein bewusstes „Nein“, kein bewusster Triebverzicht, sondern die Abschiebung des Triebes ins Unbewusste durch Wegsehen des Ich. Der Konflikt wird nicht ausgetragen, er wird sofort zugedeckt, einer Entscheidung wird ausgewichen. Eine Regung, die auftaucht, wird sofort aus dem Bewusstsein vertrieben, so wie wir reflektorisch die Augen schließen, wenn uns ein Lichtstrahl blendet. Die Verdrängung geht vom Ich aus, ist aber meist nicht auf die Initiative des Ich zurückzuführen, sondern das Ich bezieht seinerseits Direktiven für die Verdrängung vom Über-Ich, vom Gewissen her. Das Ich schaut bei der Verdrängung sozusagen weg, um nicht in einen Konflikt mit dem Über-Ich zu kommen. Das Verdrängte übt nun einen ständigen Druck auf das Ich aus, solange keine bewusste Auseinandersetzung getätigt wird und damit eine echte Lösung nicht zustande kommt. Daher ist immer zur Erhaltung des Gleichgewichts ein Gegendruck des Ich notwendig. Dieser wird als neurotischer Widerstand bezeichnet. Er zeigt sich auf der Verhaltensebene in Überreaktionen, im situativ oft unverständlichen „Ausrasten“, etc.. „Dahinter“ verbirgt sich eine - bereichsspezifische - hoch emotionale, übersensibilisierte Abwehrhaltung, durch die das Ich sich der Wiederbewusstwerdung der verdrängten Inhalte widersetzt. 2. Ist die Verdrängung die Scheinbewältigung von Konflikten durch Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen, so stellt die Sublimierung eine Art Ersatzbefriedigung in Form einer kreativen Ersatzlösung auf „höherer Ebene“ dar: Sie setzt die Fähigkeit voraus, ein z.B. „primitives“ Triebziel gegen ein anderes, sozial gebilligteres, zu vertauschen. Es kommt zur Transformation vitaler Energien in soziokulturell hochgeschätzte Strebungen (was nicht bedeutet, dass z.B. alle sozialen, künstlerischen und wissenschaftlichen Strebungen nur von primitiven Triebzielen abzuleiten wären, vgl. Freud 1958, 7ff.). Könnte man die Verdrängung als Vogel-Strauß-Mechanismus bezeichnen, so kann man die Sublimierung als Ablenkungs- und „Veredelungs“mechanismus auffassen. Es handelt es sich bei der Sublimierung weniger um eine Abwehr von tabuisierten Wünschen, sondern um die Ausdifferenzierung und Entwicklung einer Vielfalt von - erlaubten - Befriedigungsmöglichkeiten . Die Sublimierung wird insofern den Abwehrmechanismen zugezählt, als im Laufe der soziokulturellen Entwicklung die primitiveren, unmittelbaren Formen der Bedürfnisbefriedigung vom Individuum nicht - quasi automatisch - von selbst aufgegeben werden, sondern von der sozialen Umwelt unterdrückt und dafür andere, von der Umwelt erwünschte Triebbefriedigungsformen gefördert werden. So dürfen wir als Erwachsene z.B. nur das Huhn mit den Fingern essen, beim Schnitzel müssen wir zu Messer und Gabel greifen. Es wird hier also das vitale Bedürfnis der Hungerbefriedigung nicht abgewehrt, sondern es hat sich im Falle des Schnitzels nur die Befriedungsweise geändert. 3. Identifikation und Introjektion: Ausgangspunkt für diesen Mechanismus ist die Tatsache, dass z.B. ein Kind sich normaler Weise mit den Eltern identifiziert, d.h. deren Forderungen werden in das eigene Innere verlegt, sie werden zu Forderungen an sich selbst, praktisch zum Überich (oder Gewissen) des Kindes. Das Gewissen ist nach Freud die Verkörperung der elterlichen Normen im eigenen Selbst, man gehorcht sozusagen den Eltern in sich. Später werden dann auch die Forderungen anderer Autoritätspersonen der Gesellschaft bzw. deren Normen und Werte introjiziert und damit zu Gewissensforderungen der einzelnen Person. Mittels dieser Identifikation mit den Normen der Gesellschaft, in der der Einzelne lebt und deren Summe ja das sogenannte Über-Ich bildet, werden Wünsche, Vorstellungen, Ansprüche, etc., die diesen Normen widersprechen, abgewehrt. Das Überich ist bei Freud (z.B. GW Bd. 13, 264f.) im Wesentlichen der „einverleibte“ Andere - z.B. Eltern und Lehrer mit ihren Normen und Werten -, weniger eine kognitive Ichfunktion, eine konstruktive, selbstreflexive Tätigkeit, die zum eigenen phänomenalen Erleben und praktischen Handeln kritisch Stellung bezieht (wie dies mit der Weiterentwicklung der psychoanalytischen Ich-Psychologie stärker gesehen werden kann, vgl. z.B. Waldvogel 1992). Beispiel: Wenn zwei Menschen von derselben Person unter sonst vergleichbaren Umständen geschlagen werden und beide nicht zurückschlagen, kann das innere Geschehen, obwohl das äußere Verhalten gleich ist, dabei ganz verschieden sein. Der Eine schlägt nicht zurück, weil er gleichsam automatisch denkt: „Man darf nicht schlagen.“ Seine Aggression gegenüber dem, der ihn geschlagen hat, wird von dem selbstverständlichen Gewissensgebot „Du darfst nicht zurückschlagen!“ gleichsam ohne sein eigenes Zutun weggeschoben, d.h. eine bewusste Auseinandersetzung mit der Situation wird von diesem Menschen nicht geleistet, sondern sein Verhalten ist „blind“ von seinem Über-Ich determiniert. Im Anderen, der ebenfalls nicht zurückschlägt, kann sich ein ganz anderer Prozess vollziehen. Er befolgt nicht gleichsam passiv, ohne eigene Stellungnahme, das Gebot, sondern er setzt sich mit der Situation auseinander, indem er Abstand von sich selbst nimmt, überlegt, nachdenkt, warum der andere ihn geschlagen hat, was diesen dazu veranlasst haben mag so zu reagieren, und vor allem, was er (als Opfer) selbst dazu getan hat, dass es so weit gekommen ist. Dieser Mensch steht in der Situation und gleichzeitig auch über ihr. Kurz: Die erste Person handelt unter Ausschaltung der bewussten Stellungnahme zur Situation, gleichsam wie ein programmierter Automat, der zweite Mensch hingegen setzt sich kritisch mit der Situation und damit auch mit sich selbst auseinander, oder anders, der Erste folgt sozusagen seinem Überich in (verhaltens-) konditionierter Form, der Zweite prüft kritisch sein Gewissen, reflektiert, wägt kurz- und langfristige Folgewirkungen ab - etwa auch hinsichtlich der Modellwirkung auf andere Menschen, etc.. 4. Projektion: Es handelt sich hierbei um die Verlegung eines inneren Konfliktes oder (unterdrückten) Wunsches in die Umwelt. Was man an sich selbst nicht wahrhaben will, geißelt man an der Umwelt mit besonderer Hingabe. Ein Kind z.B., das seinen Lehrer ablehnt, deutet dessen Verhalten u.U. als Antipathiekundgebung gegen sich selbst, etc.. Natürlich kann die - methodisch unreflektierte Feststellung einer Projektion auch eine Projektion (im Sinne des Unterstellers) sein. 5. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist die Reaktionsbildung. Dieser Prozess bedeutet die Abwehr eines bestimmten Impulses durch Einsatz eines gegenteiligen Impulses um damit Angst vor dem Überich abzubauen. Wenn z.B. eine Person eine andere hasst und sie sich diesen Hass nicht eingestehen will, da Hass von religiösen oder anderen sozialen Normen her verpönt ist, reagiert sie im Sinne der Reaktionsbildung gegenteilig, also in unserem Falle mit übertriebener, unechter Zärtlichkeit gegenüber dem Menschen, gegen den sie eigentlich aggressiv eingestellt ist um dem introjizierten Gebot, nicht zu hassen, zu genügen. Man könnte kritisch fragen: Kann denn alles Verhalten als vom Gegenteil her bestimmt gesehen werden? Die Antwort ist: Nein. Denn die Reaktionsbildung zeichnet sich durch ihre Starrheit und (situationsbezogene) Unangemessenheit aus. 6. Verschiebung: Ein Bedürfnis, dessen Ziel nicht erreichbar ist, „sucht“ ein Ersatzobjekt. Dies ist möglich, weil das Primärsystem des Vor- und Unbewussten durch vorwiegend diffuses Wünschen ohne einen - vom Ich vermittelten - realistischen, differenzierten Objektbezug gekennzeichnet ist. Das Bedürfnis, der Wunsch ist - phänomenal - als innere Spannung gegeben, aber das Ziel, das Objekt, an dem dieses Bedürfnis befriedigt werden kann, ist in vielerlei Hinsicht austauschbar. So kann sich z.B. die am Tage aufgestaute Wut auf den Chef am Abend beim geringsten Anlass auf den Lebenspartner entladen. Oder ein kinderloses Ehepaar schafft sich als Liebesobjekt einen Hund an, dem es dann die ganze – eigentlich auf das fehlende Kind gerichtete – Zärtlichkeit zukommen lässt. Dies geschieht, ohne dass sich die betreffenden Menschen ihrer Motive bewusst sein müssen. Der Mechanismus der Verschiebung kommt umso leichter ins Spiel, je undifferenzierter ein Mensch ist, je weniger „selbstaufmerksam“ und selbstreflexiv jemand agiert. 7. Rationalisierung: Dabei handelt es sich um die rationale Rechtfertigung eines objektiv nicht gerechtfertigten Verhaltens. Es werden nachträglich (begleitend, vorwegnehmend) vernünftige Begründungen für Handlungen und Einstellungen gegeben, die aus irrationalen (unbewussten) Motiven erwachsen sind. Das Bewusstsein wird um seine Kontrollfunktion gebracht. Durch die vorgeschobenen Gründe wird der eigentliche Sachverhalt vertuscht, das Überich und das Bewusstsein werden vom Unbewussten sozusagen betrogen: Hauptsache, man hat einen einsehbaren Grund für etwas gefunden, was vom reflektierten Gewissen (oder vom Überich) her nicht erlaubt ist, was man aber getan hat oder (wieder) tun möchte. Dieser Mechanismus der Rationalisierung stellt also eine Art Selbstrechtfertigung dar: Böses wird sozusagen als Gutes verkleidet um das edle Gewissen nicht zu beunruhigen. Beispiel: Wenn ein Händler seine Betrügereien damit rechtfertigt, dass er ja selbst auch von vielen übervorteilt wird, dann sucht er im Sinne der Rationalisierung vor sich selbst (und anderen) einen guten Grund um seine unmoralischen Absichten durchzuführen zu können, obwohl sie ethisch nicht richtig sind. Denn Unrecht bleibt Unrecht, ob es nun auch andere tun oder nicht. Rationalisierung behindert eine realistische Einschätzung der eigenen Persönlichkeit, ihres Erlebens und Handelns. Selbsterkenntnis im Sinne einer objektiven Einstellung sich selbst gegenüber scheint eine der schwierigsten Arten von Erkenntnis zu sein, wir identifizieren uns alle lieber mit dem Idealbild von uns, also mit dem, was wir sein möchten, und nicht gerne mit dem, was und wie wir tatsächlich sind. Dieser Mechanismus findet sich häufig auch bei Schulkindern. Nehmen wir als Beispiel ein Kind, das in Geschichte ein bestimmtes Kapitel lernen soll. Nun sind da viele Jahreszahlen, die das Kind nicht zu lernen gewillt ist. Und es lernt diese auch nicht. Die rationale Begründung für dieses Nicht-lernenWollen wird vor sich selbst, den Eltern oder vielleicht auch den Lehrern sein, es komme nicht darauf an, Jahreszahlen zu wissen, sondern den Gesamtkomplex des geschichtlichen Geschehens zu verstehen. Hinter dieser rationalen Begründung steht u.U. nichts Anderes als die Abwehr der unangenehmen Pflicht, das Aufgegebene auch tatsächlich zu lernen. Oder ein Lehrerbeispiel: Ich bin Lehrer und habe mir vorgenommen eine Prüfungsarbeit morgen den Schülern (Studenten) korrigiert zurückzugeben. Nun ist es abends und ich hätte Zeit zur Korrektur. Gleichzeitig aber ist im Fernsehen ein Film, den ich unbedingt sehen möchte. Ich bin in einem Konflikt zwischen Pflichtbewusstsein und Neigung. Schließlich siegt der Wunsch fernzusehen. Der Gedanke: „Eigentlich sollte ich korrigieren, weil es für die Schüler (Studenten) aus lern- und motivationstheoretischen Gründen gut wäre, die korrigierte Arbeit möglichst bald zu bekommen“ wird gar nicht mehr ins Bewusstsein eingelassen, sondern was ich tatsächlich denke, ist vielleicht, ich wäre ohnehin schon zu müde gewesen, hätte deshalb Fehler übersehen, was das Ergebnis verfälscht hätte, und deshalb sei es ohnehin besser, nicht zu korrigieren, sondern fernzusehen. 8. Isolierung heißt, was an Wünschen nicht eingestanden werden kann, wird als ich-fremd erklärt. Als Beispiel kann das bekannte Zitat Nietzsches gelten: „Mein Gedächtnis sagt: Das habe ich getan. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt mein Gedächtnis nach.“ 9. Analoges gilt für den Abwehrmechanismus des Ungeschehenmachens. Dieser stellt eine Sonderform der Isolierung dar. Eine bestimmte Handlung wird zur Verhinderung oder Wiedergutmachung einer anderen, verpönten Handlungen, immer wieder vollzogen. Beispiel „Waschzwang“: Jemand hat ständig das Bedürfnis sich die Hände zu waschen, kaum dass er etwas berührt hat. Psychoanalytisch wird hier der Impuls oder die Angst sich - sexuell oder sonstwie moralisch - zu beschmutzen sofort durch „Abwaschen“ erstickt. So ein - auch bewusst vollzogenes - Ritual gilt für alle Handlungen, die man gerne tun möchte oder getan hat, und durch die man gleichzeitig fürchtet, Schuld auf sich zu laden, indem man mit dieser Handlung (oder Einstellung) gesellschaftlichen Normen bzw. ethischen Werten zuwider handelt. Pilatus: „Ich wasche mein Hände in Unschuld“. 10. Leugnung der Realität: Die Realität wird hier nicht nur wie bei allen anderen Abwehrmechanismen in mehr oder minder starkem Maße verzerrt, sondern sie wird richtiggehend geleugnet. Eine subjektive, sozusagen selbstgemachte Ersatzrealität wird der tatsächlichen entgegengesetzt. Ein häufig zitiertes Beispiel (z.B. Katz & Katz 1959, 376): Soldaten schreiten im dichtesten Geschosshagel aufrecht dahin, gehen quasi mitten in der Schlacht spazieren, weil sie sich z.B. vorstellen, sie befänden sich auf einer wunderschönen Wiese mit Blumen. Diese Vorstellung ist für Menschen in dieser Situation Wirklichkeit geworden mit dem Zweck, der furchtbaren Wirklichkeit, in der er sich tatsächlich befinden, nicht ins Auge sehen zu müssen. 11. Selbstaggression: die aggressive Wendung gegen sich selbst. Die Aggression gegen andere Menschen, die man sich nicht auszudrücken getraut, wird auf die eigene Person umgeleitet. Beispiel: Man möchte gerne andere blamieren und stellt sich anstelle dessen selbst bloß (etwa übertriebene Selbstironie in Anwesenheit einer hochgestellten Persönlichkeit, der man diesen Rang nicht gönnt und die man „herunterziehen“ möchte, so etwa nach dem Motto - frei nach Kuh - : Was bist Du für ein Mensch, wenn Du Dich auf Menschen wie mich einlässt!). 12. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist die Konversion. Damit ist gemeint, dass Erlebnisse, die als peinliche Erinnerung unterdrückt werden, sich in körperliche Symptome umwandeln können. Die Konversion ist oft auch ein Symbol des Nicht-mehr-Könnens, z.B. Kopfschmerzen bei nicht erledigten Arbeiten, bei Leistungsanforderungen, die man sich nicht zutraut oder aus sonstigen Gründen nicht machen will. Hierher gehören - nach Freud & Breuer (1970) - alle Beschwerden hysterischer Art. 13. Schließlich der wichtigste Abwehrmechanismus, die so genannte Regression: Sie tritt dann auf, wenn bestimmten Bedürfnissen andauernd die Befriedigung versagt bleibt. Regression bedeutet das Zurücksinken einer Person von höheren Befriedigungsformen auf primitivere, d.h. biografisch frühere. Bei Kindern ist z.B. das Bettnässen ein Regressionsanzeichen (wenn keine physiologisch bedingte Fehlfunktionen festgestellt werden können). Es tritt bei Kindern auf, die sich von ihren wichtigsten Bezugspersonen (Eltern, Müttern, etc.) bzw. deren Liebesbezeugungen, kommunikativen Zuwendungen, Betreuungsaktivitäten, etc. unterkühlt fühlen, z.B. wenn ein Geschwisterchen zur Welt kommt und die Mutter diesem ihre ganze Zärtlichkeit zuwendet. Das Kind zeigt dann etwa durch Bettnässen symbolisch an, dass es, auch wenn es schon größer ist als das gerade geborene Geschwisterchen, die Zärtlichkeit der Mutter ebenso notwendig braucht wie dieses. Ein charakteristisches Beispiel für Regression im Erwachsenenalter ist der so genannte Kummerspeck. Eine Person, die etwa eine Liebesenttäuschung erfuhr und deren Wunsch z.B. nach einer harmonischen Partnerschaft damit frustriert wurde, greift auf frühere, vergangene Bedürfnisbefriedigungsweisen zurück, z.B. alles Mögliche zu naschen, wie dies Kinder gerne tun. Deshalb sagt man, jemand, der regrediert, verhält sich infantil, d.h. wie ein Kind. Die Regression ist sozusagen ein Rückzug in die Vergangenheit, eine Absage an die gegenwärtige Realität, eine Verweigerung der bewussten Auseinandersetzung mit den aktuellen Gegebenheiten und den daraus erwachsenden rational einschätzbaren (wahrscheinlichen) Folgewirkungen in der Zukunft. Zusammenfassend: Abwehrmechanismen haben nach S.Freud (z.B. 1954, GW Bd. 1, Bd. 9, Bd. 11, Bd. 17) und A.Freud (1975) die Funktion dem Ich dazu verhelfen, 1. gegenüber den Forderungen der Moral, der Gesellschaft, die im Über-Ich repräsentiert sind, 2. gegenüber den Trieben und Wünschen, die dem Es, dem Unbewussten, angehören und 3. gegenüber den störenden Forderungen der Realität autonom zu bleiben, d.h. nicht von diesem dreifachen Druck vernichtet zu werden, sondern eine - zumindest situationsspezifisch wirksame - bestmögliche Harmonie zwischen diesen herzustellen. 1.3 Abreaktion „Wir verstehen hier unter Reaktion die ganze Reihe willkürlicher und unwillkürlicher Reflexe, in denen sich erfahrungsgemäß die Affekte entladen: vom Weinen bis zum Racheakt. Erfolgt diese Reaktion in genügendem Ausmaße, so schwindet dadurch ein großer Teil des Affektes ... Wird die Reaktion unterdrückt, so bleibt der Affekt mit der Erinnerung verbunden. ... Die Reaktion des Geschädigten auf das Trauma hat eigentlich nur dann eine völlig ‘kathartische’ Wirkung, wenn sie eine adäquate Reaktion ist, wie die Rache. Aber in der Sprache findet der Mensch ein Surrogat für die Tat, mit dessen Hilfe der Affekt nahezu ebenso ‘abreagiert’ werden kann.“ (Freud & Breuer 1970, 11) Erdelyi (1985, 28f.) weist darauf hin, dass die in der psychoanalytischen Therapie insgesamt provozierte Abreaktion (Katharsis, Entspannung, Entladung) analog der in der Verhaltenstherapie systematisch herbeigeführten Löschung, Gegenkonditionierung oder Desensibilisierung funktioniert: „The fact that the mechanism of verbal abreaction, namely associative correction, corresponds to the extinction process of classical conditioning is of considerable theoretical interest in view of the fundamental role played by extinction (deconditioning, etc.) in some major behavior-modification techniques, for example, Wolpe’s (1958; 1961; 1973) ‘systematic desensitization’ through ‘reciprocal inhibition’ ...“ Die hier angesprochene Analogie kann - in allgemeiner Form - etwa so expliziert werden (vgl. Freud GW Bd.1, Bd. 11, 9f., Wolpe 1961, Wolpe et al. 1973, Wachtel 1977, 151-210, Erdelyi 1985, 27-32, Skinner 1989, 10): Freuds Methode der freien Assoziation, in der Personen in freier Weise ihre Einfälle mitteilen, während der Therapeut unsichtbar im Hintergrund sitzt und die Produktion so wenig als möglich zu stören, wenn schon - nur wohlwollend, nicht wertend - anzuregen sucht, kann analog zur klassischen Löschungs- bzw. Desensibilisierungsstrategie der Verhaltenstherapie gesehen werden, insofern etwa ein angstbesetzter Erinnerungskomplex in der Vorstellung des Patienten aufsteigt und in einer entspannten Atmosphäre sprachlich geäußert wird um die Erinnerung möglichst vollständig zu rekonstruieren, bis es zur Angstabfuhr kommt - oder die damit verbundene Angst zu groß wird, so dass neuerliche Unterdrückungs- oder Abwehrreaktionen einsetzen. Im Unterschied zur klassischen Verhaltenstherapie steuert der Patient - unter sensibler Begleitung (Ermunterung, Verstärkung) des Therapeuten - weitgehend selbst Art und Weise der Produktion und den Abbruch der Auseinandersetzung mit dem angstbesetzten Inhalt. Eine in diesem Zusammenhang spezifische - von Wachtel (1977) und (Erdelyi 1985) - minutiös durchargumentierte Analogie: Wolpes (1961) Desensibilisierungsstrategie beginnt mit systematischem Entspannungstraining, das funktional analog der hypnotischen Katharsistechnik von Freud und Breuer zu wirken scheint (vgl. Freud GW, Bd. 1, Freud & Breuer 1970). Die Anregung zur Produktion von emotional besetzten Vorstellungen, verknüpft mit Entspan- nungsübungen, kennzeichnet sowohl Wolpes wie Freud & Breuers therapeutisches Vorgehen bei Wolpe allerdings in mehr expliziter und systematischer Form: „The juxtaposition in cathartic therapy of emotional imagery with relaxation (brought about by hypnosis, lying on the couch, trust in the therapist, and so forth) should produce extinction of the conditioned emotional response attached to the imagery, whether the therapist calls it desensitization or abreaction. ... There is little doubt that Freud would have viewed behavior-modification therapies as throwbacks to early psychoanalytic techniques, such as catharsis, prior to psychoanalysis’ becoming a truly cognitive therapy, concerned with structure and meaning.“ (Erdelyi 1985, 29) Dass der therapeutisch hervorgerufene Affekt - statt zu erlöschen - zu stark werden und erneut Abwehr hervorrufen kann, ist nicht nur eine Erfahrung der psychoanalytischen Therapie, wie Wachtel (1977, 190) - in Bezug auf die „flooding“-Technik (Wolpe et al. 1973) - dokumentiert: „Immersing the patient in a cacophony of distressing images can at times enable the multiple sources of his anxiety to be covered and can evoke a range of feelings that might be more readily warded off with the gentler and more gradual desensitization approach.“ Damit erweist sich Desensibilisierung als der Kern sowohl von verhaltenstherapeutischer als auch psychoanalytischer Vorgehensweise bei nicht-wertender, wohlwollender Interaktion mit dem Therapeuten und kann in analoger Form beziehungstheoretisch begründet werden (vgl. Heller 1999). Abreaktion kann bei Freud auf neurophysiogischer Basis auch kognitiv interpretiert werden. Wegman (1985, 74) hält folgende „Arbeitshypothese“ Freuds für die eigentliche theoretische Basis seiner Abreaktionstheorie: „I refer to the concept that in mental functions something is to be distinguished - a quota of affect or sum of excitation - which possesses all the characteristics of a quantity (though we have no means of measuring it), which is capable of increase, dimunition, displacement and discharge, and which is spread over the memory-traces of ideas somewhat as an electric charge is spread over the surface of a body.“ Ein Vergleich mit der kognitionspsychologischen Theorie der Aktivationsausbreitung von Anderson (1985, 1996) zeigt eine verblüffende Analogie, wenn auch bei Anderson die enge Verbindung von kognitiver und affektiver Aufarbeitung eines Problems nicht mehr so explizit zum Ausdruck kommt. In beiden Theorien aber spielen unbewusste Prozesse eine entscheidende Rolle (Anderson 1996, 180ff., mit entsprechenden experimentellen Belegen, vgl. auch Hobisch & Schulter 1985). Aktivationsausbreitung („spreading activation“) bedeutet, dass sich die Aktivation entlang eines kognitiven Netzwerkes ausbreitet: Wenn ein Konzept im Gedächtnis aktiviert worden ist, breitet sich diese Aktivität unvermeidlich auf alle direkt assoziierten Konzepte aus. Das Ausmaß der Ausbreitung ist abhängig von der Anzahl der Knoten, die zwischen dem zentralerregten Konzept und seinen entfernten „verwandten“ Knoten liegen. Der Ausbreitungsprozeß „verläuft sich“, wenn sehr viele, weit entfernte Konzepte angepeilt werden. Die Aktivierungsenergie braucht sich mit dem Durchgang durch viele Knoten sozusagen auf. Beispiel: Wenn einer Versuchsperson etwa das Wort „Hund“ dargeboten wird, so wird nicht nur dieser Begriff (Knoten) aktiviert, sondern diese Aktivation breitet sich „automatisch“ (nicht willentlich, sondern unbewusst) auf Konzepte der näheren und weiteren Umgebung aus, z.B. auf „Knochen“, „Fleisch“, „Katze“, „Streicheln“, etc., bis die Aktivationsenergie verbraucht ist. Therapeutisch initiierte „Abreaktion“ bedeutet bei Freud (GW Bd. 1) allerdings mehr: Nicht nur das Hinlenken der Aufmerksamkeit eines Probanden auf weit entfernte, normalerweise nicht mehr aktivierte Konzepte, also auf „vorbewusste“ Inhalte des Gedächtnisspeichers (ähnliche Auffassungen hat Janet 1914/15 vertreten), sondern auf verdrängte, abgespaltene Ideen, gegen deren Aktivierung eine (neuronale) Blockade („Abwehr“) überwunden werden muss (weil sie für die Identität und Funktionsfähigkeit des aktuellen Ich gefährlich werden könnten). Die Abwehrbereitschaft des Ich muss daher „eingeschläfert“ werden ( Entspannung des Organismus), um - etwa unter Hypnose oder im Traumzustand - an diese verdrängten Inhalte heranzukommen. Dafür konnte Freud (1962) keine neurowissenschaftliche Erklärung geben und brach daher (1896) den Versuch einer neurophysiologischen Fundierung des von ihm postulierten psychologischen Mechanismus ab. Eine teilweise Rehabilitierung dieses Anliegens wird in Guttmann & Scholz-Strasser (1998) versucht. Psychoanalytische Abreaktion bedeutet also, dass die vom aktuellen Bewusstseinsstrom weit entfernten kognitiven Konzepte bzw. die durch Hemmmechanismen abgekoppelten traumatischenv Erinnerungen („fixe Ideen“) durch „Entspannungstechniken“ (wie Hypnose, Liegen auf der Couch, Schlafen, etc.) und „freie Assoziation“ („spreading activation“) wieder aktiviert und bewusst gemacht werden. Eine zunehmende Verträglichkeit mit kognitionspsychologischen (z.B. Erdelyi 1985, Wegman 1985, Perrig et al. 1993, Dörner 1999, Rosenfield 2000) und rezenten neurowissenschaftlich-evolutionstheoretischen Forschungen (z.B.Pöppel 1987, 1993, Claxton 1997, Guttmann & Scholz-Strasser 1998, Greenfield 1999, Varela 2000) ist zu konstatieren. 1.4 Übertragung Im Versuch seine Patienten zum freien Assoziieren zu bringen stellte Freud in spezifischen, individuell offenbar bedeutsamen Zusammenhängen einen hartnäckigen Widerstand (des Ich) fest, Erinnerungen an bestimmte vergangene Gefühlszustände, die sie auslösenden Ereignisse, etc. aus dem Langzeitspeicher wieder „hervorzuholen“. Patienten setzen sich an Stelle dessen lieber - z.B. kritisch - mit dem Therapeuten auseinander, wobei sie - nicht selten begleitet von heftigen, situationsspezifisch unangemessenen Emotionen - eine „falsche Verknüpfung“ zwischen einer Person, die Objekt früherer Wünsche, Aggressionen, etc. war, und dem Therapeuten herstellen. Dabei kommen - oft in Form einer Überreaktion - auch abgewehrte Inhalte zum Vorschein, die mit der aktuellen Patienten-Therapeutenbeziehung nichts (oder nur oberflächlich) zu tun haben: „Aber der Patient versteht es auch, indem er im Rahmen der Analyse bleibt, Widerstände herzustellen ... Anstatt sich zu erinnern, wiederholt er aus seinem Leben solche Einstellungen und Gefühlsregungen, die sich mittels der sogenannten ‘Übertragung’ zum Widerstand gegen Arzt und Kur verwenden lassen. Er entnimmt dieses Material, wenn es ein Mann ist, in der Regel seinem Verhältnis zum Vater, an dessen Stelle er den Arzt treten lässt und macht somit Widerstände ... aus seinem Ehrgeiz, der sein erstes Ziel darin fand, es dem Vater gleichzutun oder ihn zu überwinden, aus seinem Unwillen, die Last der Dankbarkeit ein zweites Mal im Leben auf sich zu laden ... Die Widerstände dieser Art dürfen nicht einseitig verurteilt werden. Sie enthalten so viel von dem wichtigen Material aus der Vergangenheit des Kranken und bringen es in so überzeugender Art wieder, dass sie zu den besten Stützen der Analyse werden ... Man kann auch sagen, es seien Charaktereigenschaften, Einstellungen des Ichs, welche zur Bekämpfung der angestrebten Veränderungen mobil gemacht werden. Man erfährt dabei, wie diese Charaktereigenschaften ... gebildet worden sind, und erkennt Züge dieses Charakters, die sonst nicht, oder nicht in diesem Ausmaße, hervortreten können, die man als latent bezeichnen kann.“ (Freud GW Bd. 11, 300f.) Die Übertragung kann sich in - unangemessener - leidenschaftlicher Liebe, Bewunderung, etc. zum Therapeuten manifestieren (positive Übertragung) oder in heftiger Abwehr, Hassgefühlen, etc. (negative Übertragung). Obwohl eine gründliche psychoanalytische Ausbildung dies verhindern oder doch minimieren sollte („Lehranalyse“), reagiert der Therapeut mehr oder weniger mit „Gegenübertragung“. Elhard (1990, 160) hält das „Schlachtfeld der Übertragung“ als den analytischen „Ort“, auf dem sich die entscheidenden (kognitiven) Einsichten und (emotionalen) Wandlungen vollziehen. Das professionelle Umgehen mit der Übertragung des Patienten und die kontrollierte Verarbeitung der (eigenen) Gegenübertragung (statt Verdrängung oder Ausleben) stellt an den psychoanalytischen Therapeuten große persönliche Anforderungen, da er sich den stattfindenden emotionalen Prozessen weder entziehen, noch ihnen unkontrolliert verfallen darf. Miedl (2000) beschäftigt sich an Hand neoanalytischen Schrifttums und eigener Fallstudien mit Problemen der Übertragung und Gegenübertragung im Lehrer-Schüler-Verhältnis. Es zeigt sich, dass im Umgang mit Kindern Probleme besonderer Art auftauchen, besonders was die Gegenübertragungsbereitschaft von Lehrern, aber auch von Analytikern betrifft, z.B.: Kinder provozieren beim Erwachsenen vor allem Elterngefühle, die bei diesem durch Gefühle und Gedanken aus eigenen (glücklichen bzw. unglücklichen) Kindheitserinnerungen überlagert werden. Dabei können sich - besonders im schulischen Setting - unkontrollierte Beziehungsprobleme entwickeln: „In der Gegenübertragung des Lehrers zeigt sich, inwieweit er durch die Übertragungen des Schülers aufgrund eigener, lebensgeschichtlich entstandener Übertragungsbereitschaften in Erlebens- und Verhaltens-weisen gedrängt wird, die den Verhaltensweisen der Bezugspersonen des Schülers ähnlich sind.“ (Muck 1980, 75) Im Bemühen ihre SchülerInnen zu verstehen sollten sich LehrerInnen selbst als das entscheidende Abbildungsmodell der fremdpsychischen Vorgänge begreifen lernen, d.h. sie sollten das „Kind in sich“ und seine Forderungen, Ansprüche, etc. kennen, denn die eigene Persönlichkeit ist der „Leitfaden“, an dem ihre Schüler gemessen werden. Der Spielraum der Verstehens- und Handlungskompetenz des Lehrers wird von der „Art und Weise seines Seins“ bestimmt (Hey 1978, 243). Aus- und Fortbildung von LehrerInnen sollte daher mehr Persönlichkeitsbildungs- und Selbsterfahrungsanteile enthalten, ist doch die eigene Persönlichkeit das Diagnoseinstrument im Erziehungszusammenhang schlechthin. LehrerInnen sollten ihre „blinden Flecken“ erkennen lernen, denn Erziehungsarbeit sei Beziehungsarbeit - so Miedl (2000, 95) - und Pädagogen kämen in diesem Sinne „nicht umhin, ihre Person mit all ihren Stärken und Schwächen in das Beziehungsgeschehen einzubringen.“ LehrerInnen sollten wie psychoanalytische Therapeuten bemüht sein die unbewussten Anteile ihres kommunikativen Verhaltens dem Bewusstsein und damit der theoriebezogenen Reflexion zugänglich zu machen um nicht allzu gefährdet zu sein in die „Gegenübertragungsfalle“ zu geraten. 1.5 Affekt/Emotion/Motivation Heftige Affekte stören nach Freud & Breuer (1970) das Gleichgewicht des Seelenapparats bzw. des Zentralen Nervensystems (Freud 1962). Erlebnisse mit einem (unerträglich) hohen Schmerzanteil hinterlassen eine traumatische Spur, was in der modernen Neurowissenschaft durchaus Bestätigung findet (vgl. Pöppel 1993, Zieglgänsberger 1998). Abreaktion, Abwehr, Konversion, Bewusstmachen, etc. sind Varianten der Affektreduktion, des (vermeintlichen) Unschädlichmachens eines intensiven Störreizes. Dabei wird ein halbwegs stabiles Gleichgewicht mit nur geringen (lustvollen) Abweichungen (Spannungsgenerierungen und -lösungen) angestrebt (vgl. dazu die analogen Positionen von McClelland et al. 1953, Helson 1964, Deci 1975, McClelland 1995, Herber 1998a, Herber et al. 1999, etc.). Im „Entwurf einer Psychologie“ beschäftigt sich Freud (1962, Original 1895) durchaus in diesem Sinne mit Affekten als (neurophysiologischen) Erregungsquantitäten. In den etwa gleichzeitig entstandenen „Studien über Hysterie“ (Freud & Breuer 1970, Original 1892/1893) werden inhaltlich-psychologische Emotionsbegriffe unterschieden, wie Furcht, Angst, Aggression, Scham, Liebe, Besorgnis, etc.. Freud (1962, 348ff.) versucht hysterische Symptome, wie übermäßige emotionale Reaktionen („Gefühlsausbrüche“, Verdrängung/Abspaltung/Verschiebung von Gefühlen, etc.), mit Veränderungen im Gleichgewicht der Verteilung der neuralen Energie zu erklären. Energie, die durch „Fixierung“ lokal im Nervensystem gebunden ist, fehlt an anderer Stelle: die Summe der Nervenerregung ist nach Freud konstant, eine Vorwegnahme moderner neurowissenschaftlicher Erkenntnisse (vgl. dazu Guttmann 1998). Die relative Homöostase im Organismus (z.B. nach einer partiellen Triebbefriedigung) entspricht einem „Fließgleich-gewicht“ (Menninger 1974), das Streben nach optimaler Aktivierung ist daher von einer entsprechend flexiblen (nicht neurotisch fixierten) Energieverteilung im Organismus abhängig (vgl. Freud 1962). Vor allem in seinen (ebenfalls frühen) Schriften „Psychopathologie des Alltagslebens“ (1904) und der „Traumdeutung“ (1900/1901) verwendet Freud häufig den Ausdruck „Motiv“ um aufzuzeigen, dass scheinbar sinnlose Verhaltensphänomene, wie Fehlleistungen, Träume, etc. durch eine gewisse „seelische Absicht“ zu Stande kommen. In Abhebung von der bewussten, willentlichen Tätigkeit versucht Freud so die Bedeutsamkeit unbewusster Motivationsprozesse aufzuzeigen (GW Bd. 13, 240ff.). Wie später beim Behavioristen Hull (1943) als „tissue need“ spielt der Begriff „Trieb“ eine wichtige Rolle im Theoriekern der Psychoanalyse: „Unter einem ‘Trieb’ können wir zunächst nichts anderes verstehen als die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle, zum Unterschied von ‘Reiz’, der durch vereinzelte und von außen kommende Erregungen hergestellt wird. ... Was die Triebe voneinander unterscheidet und mit spezifischen Eigenschaften ausstattet, ist deren Beziehung zu ihren somatischen Quellen und ihren Zielen. Die Quelle des Triebes ist ein erregender Vorgang in einem Organ und das nächste Ziel des Triebes liegt in der Aufhebung dieses Organreizes.“ (Freud GW Bd. 5, 67) Das Verhältnis der Begriffe „Trieb“ und „Motiv“ in der psychoanalytischen Motivationstheorie (z.B. Holzkamp-Osterkamp 1976, Lichtenberg 1989, Lichtenberg et al. 1992) kann man etwa so skizzieren: Motive sind von (z.B. kognitiven) „Ich-Formanten“ (Caruso 1983, 125ff.) „durchgearbeitete“ Triebe, in gewissem Sinne deren flexiblere (durch Lernen veränderbare) Ersatzbildungen, in denen die starren Triebimpulse des Es mit Überich-Forderungen und realitätsorientierten Ich-Funktionen einen Kompromiss geschlossen haben. Je nach (situativer) Akzentuierung der Es-, Überich- oder Ich-Komponenten können Motive (Motivationen) relativ triebnahe („blind“, dranghaft, „impulsiv“) oder auch triebferne (realitätsgerecht, flexibel, anpassungsfähig, „funktionell automom“) ausgeprägt sein. Entscheidend scheint das Ausmaß an einfließenden Kognitionen zu sein. Dadurch werden vorbewusste („intuitive“) bis bewusste Zwischenprozesse ermöglicht, die situativen Triebaufschub und die Umleitung auf realitätsangepasste Ersatzziele in relativ kontrollierter Weise bewirken, bis direkte Triebbefriedigung durch gezielte (vom Ich ausgehende) Veränderungen des Lebensraumes in „passender“ Weise zugelassen (und auch gefördert) werden kann, ohne die Persönlichkeit als ganzheitliches „Organismus-Umwelt-Feld“ (Murphy 1947, 8) zu beeinträchtigen oder zu schädigen. Damit haben wir Möglichkeiten der gestalt- bzw. feldtheoretischen Weiterentwicklung der Psychoanalyse angesprochen (siehe dazu Kap. 3.2). Charakteristisch für psychoanalytische Theorienbildung ist, dass Verschiebungen und motivationale Ersatzbildungen von Triebenergien - heute längst ein integraler Bestandteil feldtheoretischer Persönlichkeitstheorien bzw. formalisierter Motivationsmodelle (vgl. z.B. die Konstrukte/Parameter „substitution“ und „displacement“ bei Lewin 1935, Atkinson & Birch 1970, Astleitner 1992, Astleitner & Herber 1993) - nicht nur auf (vor-)bewusste, vom Ich kontrollierte (bzw. grundsätzlich kontrollierbare) Weise möglich ist, sondern bereits im Bereich des nicht sofort bewusstseinsfähigen (verdrängten, abgespaltenen) Unbewussten durch verschiedene Mechanismen der Traumbildung (Freud 1961 bzw. GW Bd. 11) bzw. durch Abwehr-mechanismen des tagtäglichen Erlebens und Verhaltens erfolgen können (vgl. oben Kap. 1.2). Die gleichzeitige und gleichberechtigte Ausdifferenzierung der realitätsorientierten, wahrnehmungsbezogenen und bewusstseinsfähigen Ichfunktionen - neben den Trieben des Es - aus der anfänglich gemeinsamen (polymorphen) Es-Ich-Matrix undifferenzierter Partialtriebe des nicht elaborierten „Primärsystems“ (vgl. unten Kap. 3.2) ist seit A.Freud (1975, Original 1935) ein wichtiges Thema neopsychoanalytischer und tiefenpsychologischer Forschung (vgl. z.B. Hartmann 1972, Kohut 1981, Caruso 1983, Lichtenberg et al. 1992, Rath 1995). So hat sich das Ich - ursprünglich als Sammelbegriff für die Abwehrvorgänge gegen das Wiederauftauchen verdrängter Vorstellungsinhalte, Affekte, Strebungen, etc. konzipiert (Freud & Breuer 1970, GW Bd. 13, Bd. 17) - zu einem kognitiven Kontaktsystem zur Außenwelt entwickelt, das eine relative Konstanz der Objektbeziehungen (relativ unabhängig vom jeweiligen Grad der Triebspannung) sicherstellt. Neben den affektiven („antreibenden“ bzw. hemmenden) Komponenten jeglicher Motivation bestimmen zunehmend mehr kognitive (reflexiv-konstruktive) Erwartungshaltungen das psychische Geschehen, so recht nach der Parole Freuds: „Wo Es war, soll Ich sein.“ (Freud 1954, 10) 1.6 Gedächtnis Freuds Gedächtnispsychologie lässt sich in ihrer Eigenart bezeichnender Weise von den verschiedenen Formen des Vergessens her besonders gut charakterisieren (z.B. 1962, GW Bd. 11, 18ff., 1954). Freud kennt die assoziative Gedächtnistheorie seiner Zeit (z.B. Ebbinghaus 1885). Sie ist die Grundlage für „normale“ Gedächtnisleistungen, Vergessen aus Überlastung (ohne emotionale Bedeutung) und emotional bedeutsames Vergessen (unter Einschluss von Fehlleistungen wie Verlegen, Versprechen, etc.). Im letzten Falle werden durch offene, nicht bewusste (verdrängte) Bedürfnisse Assoziationen gestiftet, die von ihrer äußeren Form her mehr oder weniger nahegelegt werden, wenn auch die entscheidende Assoziationsstiftung durch einen „tieferen“ semantischen (kognitiven, emotionalen) Zusammenhang erfolgt und nicht nur durch die Anzahl „identischer Elemente“ (Thorndike & Woodworth 1901): „Am häufigsten verspricht man sich ..., indem man anstatt eines Wortes ein anderes, ihm sehr ähnliches sagt, und diese Ähnlichkeit genügt vielen zur Erklärung des Versprechens. Zum Beispiel ein Professor in seiner Antrittsrede: Ich bin nicht geneigt (geeignet), die Verdienste meines sehr geschätzten Vorgängers zu würdigen. Oder ein anderer Professor: Beim weiblichen Genitale hat man trotz vieler Versuchungen ... Pardon: Versuche ... Die gewöhnlichste und auch die auffälligste Art des Versprechens ist aber die zum genauen Gegenteil dessen, was man zu sagen beabsichtigt ... man ... kann sich darauf berufen, dass Gegensätze eine starke begriffliche Verwandtschaft miteinander haben und einander in der psychologischen Assoziation besonders nahestehen ... Ein Präsident unseres Abgeordnetenhauses eröffnete einmal die Sitzung mit den Worten: Meine Herren, ich konstatiere die Anwesenheit von ... Mitgliedern und erkäre somit die Sitzung für geschlossen.“ (Freud GW Bd. 11,26f.) Mit dem letzten Beispiel zeigt Freud am deutlichsten die Notwendigkeit einer semantisch-kognitiven Fundierung auf - im Unterschied zur (nur) assoziativen Ähnlichkeit durch „identische Elemente“ des Behaviorismus (vgl. Thorndike & Woodworth 1901, Thorndike 1931). Für die Konstatierung der „tieferen“ Bedeutung einer Fehlleistung dient für Freud (GW Bd. 11, 23ff.) die ungewöhnliche, der „Sache“ gar nicht angemessene begleitende Emotionalität (der „innere Zwiespalt“) dieser „Ablenkung“/Abweichung von der gut eingeschliffenen Gewohnheit („habit“) als wesentlicher Indikator - neben der semantisch-kognitiven Inadäquatheit in einem bestimmten Kontext: „Wir machen die Erfahrung, dass solche Fehlhandlungen und solches Vergessen auch bei Personen vorkommen, die nicht ermüdet, zerstreut oder aufgeregt sind, es sei denn, man wolle den Betreffenden gerade wegen der Fehlleistung ... eine Aufgeregtheit zuschreiben ... Wir sehen, ... dass viele Verrichtungen ganz besonders sicher geraten, wenn sie nicht Gegenstand einer besonders hohen Aufmerksamkeit sind, und dass das Missgeschick einer Fehlleistung gerade dann auftreten kann, wenn an der richtigen Leistung besonders viel gelegen ist, eine Ablenkung der nötigen Aufmerksamkeit also sicherlich nicht stattfindet.“ (ebenda, 23) 1.6.1 Freuds Gedächtnistheorie in einem thesenförmigen Überblickvi: Gedächtnisinhalte kommen im Sinne der Assoziationsgesetze zu Stande (räumlichzeitliche Nähe, Wiederholung). Das Gedächtnis entsteht physiologisch, wenn die Kontaktbarrieren zwischen verschiedenen Neuronen gesenkt werden. Die Intensität wie auch die Häufigkeit von Reizeindrücken bewirkt die Stärke eines Gedächtnisses, (desto stärker wird die Verbindung zwischen Neuronen gebahnt). Wenn zwei Neuronen gleichzeitig durch einen Reiz erregt werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Verbindungsbahnung zwischen ihnen. Wenn sie mit starken Gefühlen in Verbindung stehen, haben Gedächtnisinhalte mehr Bedeutung innerhalb des gesamten Netzwerkes von Assoziationen. „Normales“ Vergessen bedeutet, dass zum entsprechenden Inhalt kein Gefühlsbezug (mehr) besteht. Entweder ist die Angelegenheit nicht wichtig genug um eingespeichert zu werden, oder das betreffende Gefühl wurde „abreagiert“, seine Energie aufgebraucht, indem es in adäquates Erleben und Verhalten umgesetzt wurde. Der betreffende Gedächtnisinhalt schwindet mit der Abnahme seiner Bedeutung (des Gefühlsbezuges) für das Leben eines Menschen. Gefühlsbetonte Gedächtnisinhalte werden weniger schnell vergessen und ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit des Ich auf sich. Jeder Affekt muss durch besondere Aktivitäten beantwortet, „ausgeglichen“ werden um das neuronale System bzw. den „Seelenapparat“ einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Das Ich hat die Aufgabe das Entstehen neuer Gefühlsregungen zu verhindern bzw. bestehende „Erregungsüberschüsse“ (die das Gleichgewicht gefährden) aufzuarbeiten bzw. so weit abzublocken, dass sie das neuronale (seelische) Gesamtgeschehen nicht stören und durcheinanderbringen. Dabei kommt es zur Neubesetzung des Affekts: Neue Vorstellungen werden mit dem Affekt kombiniert, so dass die Gefühlsregungen auf ein breiteres Assoziationsareal verteilt und damit besser „aufgearbeitet“ werden können. „Verdrängung“ bedeutet, dass die Hemmschwellen zwischen den Neuronen wieder aufgebaut werden, so dass ihre Durchlässigkeit vermindert und der störende Affekt damit isoliert werden kann (was Freud 1985 1962 zwar neurowissenschaftlich postulierte, aber nicht belegen konnte). „Verdrängung“ kann als Streben nach logischer Konsistenz der Ichanteile interpretiert werden. Das Nichtwissen um die verdrängten Inhalte kann daher als ein Nichtwissen-Wollen aufgefasst werden (um sich peinliche Wünsche „vom Leib“ zu halten). Damit „erspart“ man sich die Aufarbeitung und Modifikation von Konflikten im gesamten assoziativen Netzwerk. Solange der Affekt vorhanden ist, ist auch die (verdrängte) Erinnerung lebendig und kommt über neuronale Umwege zum Ausdruck (verschobene Aufarbeitung), z.B. durch: (1) Konversion als Ausdruck einer „perfekten“ Verdrängung; (2) Spaltung von Vorstellung (Kognition) und Affekt, z.B. bei frei flottierender Angst, die „ihren Inhalt“ verloren hat und durch „alles Mögliche“ (Mäuse, enge oder weite Räume, Höhen, Jahrtausendwechsel, etc.) ausgelöst werden kann: neurotische Angst gegenüber Realangst (Furcht), Affektverschiebung/Substitution/Projektion („tiefe“ Analogiebildungen lassen uneinfühlsame Ängste entstehen, für die keine rationale Erklärung bestenfalls eine „Rationalisierung“ - gegeben werden kann). Die Summe der neuralen Erregung ist nach Freud in etwa konstant, daher findet eine isolierte (von ihrem ursprünglichen Inhalt abgespaltene, verdrängte) affektive Spannung einen anderen - wie Freud sagt - „falschen“ Verbindungsweg zur somatischen/“seelischen“ Bearbeitung. Durch die Abwehrmechanismen Konversion, Verschiebung, Wiederholungszwang, Fixierung, Umkehrung, etc. kommt es zur teilweisen Abarbeitung und damit Schwächung des erregenden Inhalts, dadurch kann die Abwehr wiederum leichter aufrechterhalten werden. Das „unbewusste“ Gedächtnis, soweit es wegen der starken, damit verbundenen Emotionen selber „stark“ bleibt, ist glasklar chronologisch geordnet (wie ein gut geführtes Geheimdossier). Die (therapeutisch evozierte) Erinnerungsproduktion erfolgt in genau umgekehrter Reihenfolge wie die Erinnerungsentstehung: Zuerst erscheint im „file“ die aktuelle Situation als erste „Hülle“, als letztes erst taucht - unter großer Erregung - die Ursprungssituation auf. Die unangenehme Erinnerung kann plötzlich wieder auftauchen, wenn eine Person in eine Situation gerät, die der ursprünglichen traumatischen ähnlich erscheint. Es kommt zu einer übermäßig affektiven Reaktion, die auch der Person selbst auffällt und daher mit (scheinbar) vernünftigen Gründen (Gedächtnisinhalten) legitimiert wird, die mit der Entstehungssituation wenig bis nichts zu tun haben (Überreaktion Rationalisierung, Intellektualisierung). Einen unbewältigten Gedächtnisinhalt aufzuarbeiten ist Freuds Therapieziel: (a) Nacherziehung: ein adäquateres Verhalten lernen (vgl. Verhaltenstherapie); (b) Wenn das nicht geht, weil das quälende (Kindheits-)Ereignis im aktuellen Leben keine Rolle mehr spielt und nur noch in peinlichen (unpassenden) Erinnerungsspuren besteht (die eventuell verdrängt sind), hilft ein (verbales) Wiederherstellen der Situation mittels Übertragung. Ziel: „klares“ und „lebensförderliches“ Denken (vgl. ähnliche Zielsetzungen bei Kognitiven Therapien, z.B. Beck 1999). Es scheint an dieser Stelle sinnvoll Freuds Auffassung über normale und pathologische Gedächtnisprozesse herauszufiltern: 1.6.2 Normales Gedächtnis In seinem frühen „Entwurf einer Psychologie“ (1895) versuchte Freud (1962) ein widerspruchsfreies System seiner psychologischen Instanzen und Mechanismen auf neurowissenschaftlicher Basis zu formulieren: „Es ist die Absicht dieses Entwurfs, eine naturwissenschaftliche Psychologie zu liefern, d.h. psychische Vorgänge darzustellen als quantitativ bestimmte Zustände aufzeigbarer Teile, und sie damit anschaulich und widerspruchsfrei zu machen. Der Entwurf enthält zwei Hauptideen, 1. Das was Tätigkeit von Ruhe unterscheidet als Quantität (Q) aufzufassen, die dem allgemeinen Bewegungsgesetz unterworfen ist, 2. Als materielle Teilchen die Neuronen anzunehmen.“ Auf Basis dieses Entwurfes und verstreuter Bemerkungen in seinem Gesamtwerk (z.B. GW Bd. 11, 27ff.) weiß Freud um die Wirkung der Assoziation (der zeitlich-räumlichen Nachbarschaft von Objekten, der Identität und benachbarten oder „ähnlichen“ Anordnung von Elementen in zwei Objektbereichen, etc.) auf die normale Gedächtnisleistung, aber er weist auch auf die hohe Selektionswirksamkeit von (starken) Gefühlen hin. Oder in Übereinstimmung mit moderner kognitionspsychologischer Forschung (vgl. z.B. Klix 1992, 190ff., Dörner 1999, 117ff., Rosenfield 2000): Erinnerungen sind umso wirksamer, je mehr sie mit zentralen Emotionen der jeweiligen Person verknüpft sind. Solange ein Ereignis, Objekt, etc. mit heftigen Affekten assoziiert wird, kann es nicht vergessen werden (vgl. z.B. Freud & Breuer 1970, 8ff., Freud 1954, 118ff.). Die Erinnerungsleistung lässt im Übrigen in dem Maße nach, wie die entsprechende Reizeinwirkung aufhört. Doch hinterlassen die Reizeinwirkungen Spuren, die Freud in seiner „Neuronentheorie“ zu beschreiben sucht: Neuronen „können nach jeder Erregung in anderem Zustand sein als vorher, ergeben also eine Möglichkeit, das Gedächtnis darzustellen. ... undurchlässige (mit Widerstand behaftete und Quantität zurückhaltende) Neuronen, die Träger des Gedächtnisses“ ... nennt Freud „-Neuronen ... sie werden durch den Erregungsablauf dauernd verändert ... ihre Kontaktschranken geraten in einen dauernd veränderten Zustand. Und da die psychologische Erfahrung zeigt, dass es ein ÜberErlernen gibt auf Grund des Gedächtnisses, muss diese Veränderung darin bestehen, dass die Kontaktschranken leistungsfähiger, minder undurchlässig werden ... Diesen Zustand der Kontaktschranken wollen wir als Grad der Bahnung bezeichnen. Dann kann man sagen: Das Gedächtnis ist dargestellt durch die zwischen den -Neuronen vorhandenen Bahnungen.“ (Freud 1962, 309) Das normale Gedächtnis - und in weiten Teilen auch das pathologische, besonders im Prozess des therapeutisch initiierten „Nachlernens“ - ist im Unterschied zur Darstellung der Freudschen Konzeption in Perrig et al. (1993, 38) ein dynamisches, d.h. in der ständigen (u.U. auch abwehrenden) Auseinandersetzung mit einem (u.U. traumatisch) wirkenden Gedächtnisinhalt wird dieser ständig verändert, nach Freud „abgearbeitet“ (zu Symptomen transformiert), wobei es - auf dieser Erfahrungsgrundlage - zu einer dynamischen Begriffsbildung (Konzeption von „Ideen“) kommt, außer eine Verdrängung wäre vollständig geglückt (z.B. zu einem körperlichen Leiden konvertiert), was aber kaum „in Reinkultur“ vorkommt (vgl. Freud 1962, 334ff.). Diese unsere Analyse wird gestützt durch Sacks (1998, 19) neurowissenschaftlichen Rekonstruktionsversuch: „Freud’s contact barriers were capable of selective facilitation or inhibition, thus allowing permanent neuronal changes which correspondend to the acquisition of new information and new memories - a theory of learning basically similar to that which Donald Hebb was to propose in the 1940s, and which is now supported by experimental findings. Thus remembering, for Freud, though it required such local neuronal traces (of the sort we now call long-term potentiation) ... was essentially dynamic, transforming, reorganizing, throughout the course of life. Nothing was more central for the formation of identity than the power of memory; nothing more guaranteed one’s continuity as an individual. But memories shift, and no one was more sensitive than Freud to the reconstructive potential of memory, the fact that memories are continually worked over and that their essence, indeed, is recategorization.“ Gedächtnis und Motivation hängen bei Freud (1962) untrennbar zusammen, wobei das Gedächtnis die retrospektive Seite der Ideenentwicklung darstellt, Motivation die prospektive, kreative - eine Position, die gut mit den Ergebnissen moderner neurowissenschaftlicher Forschung zusammenpasst (vgl. z.B. Zieglgänsberger 1998, LeDoux 1998, Guttmann & ScholzStrasser 1998, Greenfield 1999). 1.6.3 Pathologisches Gedächtnis Im Zusammenhang mit der Hysterieforschung beschäftigt sich Freud (GW Bd. 1, 1962, Freud & Breuer 1970) mit der Wirkung von (zu) starken Affekten auf die Denk- und Gedächtnisleistung: „Es ist eine ganz alltägliche Erfahrung, dass Affektentwicklung den normalen Denkablauf hemmt ... Erstens, indem viele Denkwege vergessen werden, die sonst in Betracht kämen ... so z.B. ist es mir vorgekommen, dass ich in der Erregung einer großen Besorgnis vergessen habe, mich des seit kurzer Zeit bei mir eingeführten Telephons zu bedienen. Die rezente Bahn unterlag im Affektzustand. Die Bahnung, d.h. die Anciennität gewann die Oberhand.“ (Freud 1962, 357) Insoweit besteht volle Einstimmung mit behavioristischen Annahmen, etwa mit Hulls (1943) berühmter Formel: Verhaltenstendenz = Trieb mal Gewohnheit (Habit). Unsere Reaktionsbereitschaft angesichts bestimmter Reizkonstellationen ist nach der Stärke der eingeschliffenen Gewohnheiten (Habits) festgelegt: Habit 1, Habit 2, usw.. Bei großer Triebstärke werden die Abstände zwischen den Habits entsprechend vergrößert: ein Abstand von 1 zwischen Habit 1 und Habit 2 hinsichtlich ihrer reaktionssteuernden Wirkung bleibt bei einer Triebstärke von 1 ebenfalls 1, wird bei zunehmender Triebstärke aber immer größer. Das bedeutet, dass bei hoher (positiv oder negativ erlebter) Erregung die alteingeschliffenen Gewohnheiten am ehesten zum Zug kommen, ein Oszillieren zu einem zweiten oder dritten Habit in der Hierarchie aber immer unwahrscheinlicher wird: das Verhalten wird rigid, „stur“, fixiert, ist kaum noch flexibel. Ähnlich wirksam sind - nach Freud - „alte Spuren“ im hysterischen Prozess. Während emotional stark wirksame Ereignisse eine Person normaler Weise so lange Zeit beschäftigen, bis sie so weit abreagiert und verändert (dem Ich angepasst) sind, dass man damit ohne neuerliche große Aufregung einigermaßen umgehen kann, zeigen die extrem unangenehmen Gedächtnisinhalte von Hysterikern - besonders bei vollständiger („gelungener“) Verdrängung eine Konkretheit bis ins Detail und eine starke affektive „Ladung“ ( Überreaktion) ähnlich der Situation, in der es zur traumatischen Verdrängung gekommen ist, d.h. sie wurden der normalen Abarbeitung (begrifflichen Rekonstruktion, Veränderung im Handeln) weitgehend durch Abspaltung entzogen. Erst wenn diese Inhalte - z.B. therapeutisch - bewusst gemacht werden, kommt es zu einer Rekonstruktion, begrifflichen (Neu-)Fassung, die eine wirklich nachhaltige Veränderung zum Positiven (Arbeits- und Liebesfähigkeit nach Freud) erlaubt. „Erinnerungsspuren“ werden immer - auch im unbewussten Zustand - transformiert, können dabei aber durch geeignete Auslösereize in ihrer pathogenen Wirkung verstärkt werden (z.B. immer mehr verdrängt werden). Im Unterschied zur bewussten Erinnerungsarbeit werden abgespaltene, traumatische Erlebnisse allerdings weniger in den allgemeinen Entwicklungsprozess einbezogen, sie bleiben „fixiert“, bis sie zufällig oder gezielt therapeutisch aktualisiert werden und zeigen dann ihr „steckengebliebenes“, nicht weiterentwickeltes, unrei- fes, infantiles Gepräge (man verhält sich „kindisch“, sentimental, etc.). Zur (ursprünglichen) Verdrängungvii kommt es, wenn Wahrnehmungen, Vorstellungen, Wünsche, Bedürfnisse, etc. einer Person völlig inkompatibel mit ihrer bewussten oder vorbewussten moralischen Haltung sind und eine unerträgliche affektive Spannung im Seelenapparat hervorrufen. Diese nicht bearbeiteten (weil verdrängten) Gedächtnisinhalte wirken aber - auf Umwegen (z.B. über Konversion und andere Symptombildungen) - auf das „normale“ Erinnern, Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Beurteilen, etc. in verzerrender Weise ein. Konsequenterweise vertreten Freud & Breuer (1970, 10) die Auffassung, „der Hysterische leide größtenteils an Reminiszenzen“. Die Befreiung von dieser pathogenen Gedächtnislast stellt sich dann so dar: „Wir fanden nämlich, anfangs zu unserer größten Überraschung, dass die einzelnen hysterischen Symptome sogleich und ohne Wiederkehr verschwanden, wenn es gelungen war, die Erinnerung an den veranlassenden Vorgang zu voller Helligkeit zu erwecken, damit auch den begleitenden Affekt wachzurufen, und wenn dann der Kranke den Vorgang in möglichst ausführlicher Weise schilderte und dem Affekt Worte gab. ... der psychische Prozess, der ursprünglich abgelaufen war, muss so lebhaft als möglich wiederholt, in statum nascendi gebracht und dann ‘ausgesprochen’ werden. Dabei treten ... Krämpfe, Neuralgien, Halluzinationen - noch einmal in voller Intensität auf und schwinden dann für immer.“ (ebenda, 10) Wieder eine Parallele zur Verhaltenstherapie: Wenn einem Verhalten die Verstärkung entzogen wird, tritt es nochmals in voller bis übersteigerter Intensität auf - quasi um die gewohnte Verstärkerzufuhr doch noch zu „erzwingen“ (vgl. Kuhlen 1973). Besonders bei vorhergehender intermittierender Verstärkung kommt es zur verstärkten Löschungsresistenz und damit zur Ausbildung eines „Prinzip Hoffung“ (à la Ernst Bloch): Hoffnung lebt - so gesehen - von den nur fallweise verstärkten bzw. (kognitiv) unerledigten (verdrängten) Gedächtnisinhalten der eigenen Biografie, die - in unbewusster Weise - unsere Realitätswahrnehmung tendenziell verzerren und zu illusionären Konstruktionen der Wirklichkeit („Hoffnungen“) Anlass geben. Das pathogene Gedächtnis entsteht durch Verdrängung „peinlicher“ Wunschvorstellungen, die ihrerseits das Ergebnis unerfüllter Triebregungen (hervorgerufen durch „passende“ situative Anreize) darstellen. Eine Vorstellung, die mit den „herrschenden“ Vorstellungen in Widerspruch steht, wird vom Assoziationsfluss - und damit bewusster Erinnerung - ausgeschlossen. Obwohl ein starker Widerstand besteht, diese konflikthaften Gedächtnisinhalte zu erinnern, ist die betreffende Person doch ständig damit beschäftigt, ein Teil ihrer Energie wird zur Aufrechterhaltung der Abwehr verbraucht, besonders wenn in der Umwelt ein passender Auslösereiz wieder eine neuronale Verbindung zum neuronalen Substrat des verdrängten Gedächtnisinhalts aktiviert (Freud 1962, 351ff.). Diese zur Errichtung bzw. Wiederherstellung der Abwehr benötigte Energie fehlt für die Entfaltung der vollen Funktionstüchtigkeit der emotionalen und kognitiven Ressourcen einer Person, sie ist nur in eingeschränktem Maße „liebes- und arbeitsfähig“. Fehlleistungen (Vergessen, -sprechen, -legen, etc.) sind ein brauchbarer erster Indikator zur semantischen und - wie es Freud vorschwebte - neuronalen Lokalisierung eines verdrängten (störenden) Gedächtnisinhalts. 1.7 Kognition Das Grundproblem der psychischen Erkrankung ist für Freud (z.B. GW Bd. 1, Freud & Breuer 1970) die Unverträglichkeit von „Vorstellungen“. Eine Vorstellung (oder Idee) ist eine kognitive Repräsentation von „irgendetwas“. Vorstellungen (Ideen) können - nicht unähnlich dem inflationären Gebrauch von „Kognition“ im heutigen Wissenschaftsjargon - unterschiedliche interne Zustände oder Prozesse („unobservals“ sensu Hull 1943) sein: Empfindungen, Wahrnehmungen, Erlebnisse, Gefühle, Wünsche, Erwartungen, Gedanken, Begriffe, Konzepte, Gedächtnisinhalte, Erinnerungen, Fantasien, Halluzinationen, etc. (vgl. weiterführend Wegman 1985, 20ff., Herber 2000). Freuds Terminologie ist - wie schon erwähnt - nicht sehr präziseviii, er umschreibt Phänomene eher extensional-konkret als sie intensional-begrifflich mit Hilfe streng festgelegter „wesentlicher Merkmale“ zu definieren. Wichtig ist ihm, inwieweit eine bestimmte kognitive Repräsentation das trifft, was sie zu repräsentieren vorgibt - eine innere oder äußere Realität. Ideen sind weniger abstrakte Begriffe als konkrete Vorstellungen von komplexen Situationen, weniger transsituationale analytische Dimensionierungen als situationsspezifische Beschreibungen, Darstellungen von Szenen, Handlungs- bzw. Vorstellungsabläufen. Ideen oder Vorstellungen sind einfach das, was Patienten im therapeutischen Zusammenhang an Einfällen, Assoziationen, Erinnerungen, etc. berichten. Er hält nichts von Wundts „reinen Empfindungen“ (vgl. Wundt 1907, 45ff.). Jede Empfindung ist eingebettet in ein Netzwerk von transsituationalen und situationsspezifischen Assoziationen. In analoger Weise ist eine Idee oder Vorstellung kein statisches Faktum, eher ein Prozessverlauf, in dem - vom Beginn (der „ersten“ Idee) an - viele Assoziationen eingebunden sind und ständig neu angebunden werden, so dass der Bedeutungsgehalt situationsspezifisch „verrutscht“ (ganz im Sinne moderner Kognitionspsychologien, wie z.B. bei Mangold-Allwins 1993 bzw. Hofstadters 1996 Konzept- bzw. Analogiebildung). Freud geht vom Begriffsverständnis psychologisch gebildeter Laien aus: Er setzt u.a. die Kenntnis der Ebbinghausschen Assoziationsgesetze voraus und geht von einem ausreichenden gemeinsamen Wortverständnis seiner Leser bei Begriffen wie „Ratio“, „Vorstellung“, „Idee“, „Bewusstsein“, „Denken“, „Denkgewohnheit“, „Gedächtnis“, „Erinnerung“, „Gefühlsregung“, etc. aus (vgl. z.B. Freud 1962, GW Bd. 1, Bd. 11, Freud & Breuer 1970). Assoziationen werden bei ihm ganz im althergebrachten, tradierten Sinne gebildet (etwa sensu Wundt 1907, 271ff.), nämlich durch räumlich-zeitliche Nähe, begrifflichen Kontrast (z.B. öffnen schließen), Kausalität und „Ähnlichkeit“ des Inhalts (Identität der Elemente, analoge Strukturen, Funktionen). Freuds analytische Einheiten sind allerdings nicht so sehr Elemente, die sich einer weiteren theoretischen bzw. methodologischen Analyse entziehen, sondern komplexe Strukturen und Funktionseinheiten von Gedanken und Gefühlen, die sich auf „ganze“ Handlungsverläufe, (pathogene) Vorstellungen, Erinnerungen, etc. beziehen (vgl. Freud & Breuer 1970). Eine Vorstellung (Idee) besteht aus einer mehrdimensional aufgebauten Struktur. Damit werden bestimmte - inhaltlich unterscheidbare - Bedürfnisse repräsentiert, zeitliche Abläufe dargestellt, zentrale (prototypisch „tiefe“) und marginale Elemente (z.B. Oberflächenmerkmale)ix miteinander verknüpft, etc.. Assoziationen bestehen aus mehr als aus zwei Verbindungsgliedern pro Element und sind nicht nur seriell-kettenförmig (wie eine „Perlenkette“) angeordnet. Anders gesagt: Vorstellungen bestehen nicht aus einer linearen Sequenz von Elementen, sondern aus einer hierarchischen Struktur von Ober- und Unterbegriffen, die häufig kausal interagieren - ähnlich „genealogischen Bäumen“ (vgl. GW Bd. 1, 196). Vorstellungen (Ideen) entsprechen komplexen kognitiven Strukturen mit empirischem Gehalt, d.h. sie beziehen sich auf (erinnerte) „Szenen“ des Alltagslebens. Dies ermöglicht (und erfordert) multidimensionale Rekonstruktionen. Um die vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten von Vorstellungen zu erfassen - ausgehend von „manifesten“, beobachtbaren Oberflächenmerkmalen bis zu „latenten“ (vor- bzw. unbewussten) Tiefenstrukturen (z.B. „Komplexen“) - kreierte Freud die Methode der „freien Assoziation“, die (theoretisch und methodisch) in vieler Hinsicht der modernen kognitionspsychologischen Theorie der „Aktivationsausbreitung“ von Anderson (1996, 180f.) entspricht (vgl. oben den Abschnitt über „Abreaktion“): „Ich und viele andere nach mir haben wiederholt ... Untersuchungen für Namen und Zahlen, die man sich ohne jeden Anhalt einfallen lässt, angestellt ... Man verfährt dabei in der Weise, dass man zu dem aufgetauchten Namen fortlaufende Assoziationen weckt, die also nicht mehr ganz frei, sondern wie die Einfälle zu den Traumelementen einmal gebunden sind, und dies so lange, bis man den Antrieb dazu erschöpft findet.“ (GW Bd. 11, 107) Bis man also kein Bedürfnis mehr hat weiterzumachen. Entweder man ist bei seinem Ziel angekommen, die Sache hat sich „erschöpft“, man ist zufrieden, beruhigt, oder es stellt sich - unter starker affektiver Begleitung - ein Gefühl des Widerstandes, eine heftige Abwehrreaktion ein, so etwa nach dem Motto: „Ende der Fahnenstange, weiterklettern gefährlich!“ Für Freud ist der oben zitierte Zustand einer - befreienden „Erschöpfung“ aber nicht ein wertneutrales „Erschlaffen des Anfangsimpulses“, sondern durchaus im Sinne von Klix (1992, 197ff.) - ein motiviertes „Ausschöpfen“ (Entdecken) des affektiven Such- und Steuerungszentrums der entsprechenden kognitiven Aktivität: „Dann hat man aber auch Motivierung und Bedeutung des freien Nameneinfalls aufgeklärt. Die Versuche ergeben immer wieder das nämliche, ihre Mitteilung erstreckt sich oft über reiches Material und macht weitläufige Ausführungen notwendig. Die Assoziationen ... laufen ... schnell ab und gehen mit so unbegreiflicher Sicherheit auf ein verhülltes Ziel los, dass sie wirklich verblüffend wirken.“ Freud greift dabei auf die Assoziationsexperimente von Wundt zurück und ergänzt diese Methode im psychoanalytischen Sinne: „Die Wundtsche Schule hatte das sogenannte Assoziations-experiment angegeben, bei welchem der Versuchsperson der Auftrag erteilt wird, auf ein ihr zugerufenes Reizwort möglichst rasch mit einer beliebigen Reaktion zu antworten. Man kann dann das Intervall studieren, das zwischen Reiz und Reaktion verläuft, die Natur der als Reaktion gegebenen Antwort, den etwaigen Irrtum bei einer späteren Wiederholung desselben Versuches und ähnliches. Die Züricher Schule unter der Führung von Bleuler und Jung hat die Erklärung der beim Assoziationsexperiment erfolgenden Reaktionen gegeben, indem sie die Versuchsperson aufforderte, die von ihr erhaltenen Reaktionen durch nachträgliche Assoziationen zu erläutern, wenn sie etwas Auffälliges an sich trugen. Es stellte sich dann heraus, dass diese auffälligen Reaktionen in der schärfsten Weise durch die Komplexe der Versuchsperson determiniert waren.“ (ebenda) So lässt sich - therapeutisch nutzbar - eine Assoziationsspur bis zum traumatischen Erlebnis zurückverfolgen, das für die Ausbildung unerklärlicher Ängste in bestimmten Situationen und entsprechender Überreaktionen (Abwehr, Vermeidungsverhalten, ungesteuerter Aggressionen, etc.) verantwortlich ist. Pines (1998, 47ff.) zeigt auf, dass Freuds Basismodell der Verbindung von Vorstellungen der Reflexbogen ist (in neuraler Hinsicht und auch was die Verbindung sprachlicher Einheiten betrifft). Diese Assoziationen sind allerdings - z.B. im Sinne von Collins & Quillian (1969), Anderson (1996, 141ff.) - in einem hierarchischen semantischen Netzwerk nach der „Tiefe“ ihrer Bedeutung geordnet (vgl. Freud 1891, 36, 79, GW Bd. 1, 524, Bd. 10, 408, Bd. 17, 446). Freuds Darstellungen der Beziehung von Kognition und Sprache erinnern geradezu an modernes „mind mapping“ oder „concept mapping“ (z.B. sensu Lukesch 1998). 1.8 Sprache Nachdem Freud 1896 den Versuch aufgegeben hatte psychologische Strukturen und Prozesse in neurowissenschaftlichen Begriffen darzustellen (vgl. Freud 1962, 299), bediente er sich zur Veranschaulichung seiner theoretischen Konstrukte einer Fülle von Metaphern und Analogien.x Nach unserer Auffassung ist die Kritik an der Verwendung von Analogien in der Entwicklung und Darstellung wissenschaftlicher Theorien mit Vorurteilen behaftet, die viel mit der Verwechslung von induktiv-heuristischer und deduktiv-überprüfender Funktion von Wissenschaft zu tun haben (vgl. Herber 1996a,b). Man kann im Grunde alle wissenschaftlichen Theorien als Analogien auffassen: Wissenschaft als System von Sätzen „spiegelt“ - wahrgenommene, gedachte, etc. - Strukturen und Prozesse von bestimmten Realitätsbereichen. Der Unterschied zwischen Analogien mit hohem Generalisierungsanspruch (z.B. in der Physik) und eher bereichsspezifischem Geltungsbereich (z.B. in den Sozialwissenschaften) ist kein grundsätzlicher, sondern ein gradueller. Nie wissen wir mit letzter - deterministischer - Sicherheit, wie zukünftige Entwicklungen sein werden (ob das Weltall sich unendlich ausdehnt oder sich im rhythmischen Wechsel ausdehnt und zusammenzieht, etc.). Immer können wir im universalistischen Sinne - aus bewährtem (Gesetzes-)Wissen nur hochrechnen, was uns die Zukunft bringen wird, unser Wissen ist jederzeit fehlbar. Wir stimmen damit mit Popper (z.B. 1976, 1994) überein ohne seine strikte Trennung von Natur- und Sozialwissenschaften in epistemologischer (wohl aber in methodologischer) Hinsicht zu teilen. Mit Bunge (z.B. 1983) sind wir der Auffassung, dass hoch elaborierte Theorien mathematisch oder in sonst einem formalen Symbolisierungssystem formuliert sein sollten. Das ist grundsätzlich im naturwissenschaftlichen wie auch im sozialwissenschaftlichen Bereich möglich (vgl. in letzterem Zusammenhang z.B. Atkinson 1957, Atkinson & Birch 1970, Coombs 1986, Stegmüller 1986). Doch jede explizite Formulierung von (postulierten) Zusammenhängen in der Realität ist nichts Anderes als eine sehr präzise Analogiebildung, in der eine bestimmte theoretische Konstruktion, die gewisse formale Regelfestlegungen beachtet, einen bestimmten Realitätsbereich „abbilden“, „spiegeln“, „erfassen“, etc. soll. Das gilt für das Gravitationsgesetz von Newton genau so wie für das Motivationsmodell von Atkinson. Wenn das Konstrukt aus sprachlich definierten Symbolen die (empirisch erfassbaren) Zustände und Prozesse „draußen“ in der Realität gut vorhersagen kann, halten wir sie für wahr. Die meisten Sozialwissenschaften aber sind weit von mathematischer oder formallogischer Präzision entfernt, die verwendeten Analogien sind ungenau, andeutend, implizit, vage, mit einem großen Interpretationsspielraum behaftet (etwa wenn man menschliche Kognitionen mit einem Computer vergleicht). Es ist in solchen Zusammenhängen a priori ziemlich unklar, wie weit die Vorstellungen verschiedener Menschen bei der Verwendung der gleichen Sprachzeichen voneinander abweichen. Diese (konnotativen) Abweichungen macht sich Freuds Technik des freien Assoziierens zu Nutze: Die „freie“ Verbindung verschiedener Wörter ergibt eine Art „mind map“ der individuellen Bedeutung des so entstehenden Wortfeldes (siehe oben den Abschnitt über Kognition). Die sprachliche Analogie zu entsprechenden kognitiven und emotionalen Prozessen erfasst Oberflächenmerkmale (z.B. identische Elemente wie bei „Versuch - Versuchung“), kognitive Tiefenstrukturen (z.B. Gegensatzpaare wie (er)öffnen - schließen) und emotionale „links“ (z.B. auf jemanden „auf“- statt „anzustoßen“, etc., vgl. Freud GW Bd. 11, 25ff.). Sprachanalysen spielen in der Psychoanalyse bei der Interpretation von Träumen, Versprechern, Witzen und Mythen die entscheidende Rolle. Neben denotativen Analysen der bewussten Sprachgestaltung geht es primär um das Herausarbeiten (gemeinsam mit dem Analy- sanden) der konnotativ-idiosynkratischen (z.T. unbewussten) Bedeutung der Sprachverwendung. Freud verteidigt seine „Redetherapie“ immer wieder, z.B.: „Worte waren ursprünglich Zauber und das Wort hat noch heute viel von seiner alten Zauberkraft bewahrt. ... Worte rufen Affekte hervor und sind das allgemeine Mittel zur Beeinflussung der Menschen untereinander.“ (GW Bd. 11, 10) Die Funktion der Sprache in der Psychoanalyse ist mehrfach: Zunächst einmal dient sie der Kommunikation zwischen Patient und Therapeut. Diese Sprachform hat mehr mit Dichtung als mit Wissenschaft zu tun, sie umschreibt eher viel- denn eindeutig aktuelle und erinnerte Gefühle, Gedanken, Wünsche, Erwartungen, etc.. Außerhalb der Therapie verwendet der Analytiker eine eher nüchterne Sprache, in der die protokollierten Beobachtungen in Hinblick auf die spezifische Situation (das entsprechende Therapiestadium, aktuelle Ereignisse) und in Bezug auf theoretische Terme zusammengefasst und geordnet werden. Auf einer dritten Ebene finden Erklärungen und Bewertungen mit Hilfe hypothetischer Konstrukte statt, die objekttheoretische und metatheoretische Konzepte (z.B. methodologische Kriterien) zueinander systembezogen in Verbindung bringen (vgl. dazu Blatt & Lerner 1983). Die Validität dieser Transformation in die psychoanalytische Objektsprache stützt sich auf empirisches Material, also auf die während oder im Anschluss an die Sitzung verfassten Protokollsätze. Intersubjektivität ist leider weithin noch ein methodologisches Desiderat der psychoanalytischen Praxis und sollte - wenigstens in der einschlägigen Forschung - in voneinander unabhängigen Analysen von Tonbandprotokollen durch Experten seinen Niederschlag finden. Elaborierte Textanalysen im Sinne einer „Übersetzung“ der ersten Sprachebene (therapeutische Kommunikation, Äußerung des Patienten in Bezug auf „Reizworte“ des Therapeuten) in die objekt- und metasprachlich geklärten Ebenen 2 und 3 könnten analog den elaborierten Auswertungsverfahren für den Thematischen Apperzeptionstest (TAT) praktiziert werden, wodurch - zumindest teilweise - hohe konstruktbezogene Auswertungsobjektivität erreicht werden könnte (vgl. z.B. McClelland et al. 1953, Heckhausen 1963, Revers 1973, Atkinson 1982, DeCharms 1982, Fleming 1982, McAdams 1982, Revers & Allesch 1985, Schafer 1986, McClelland et al. 1989, Smith 1992, McClelland 1995, Herber et al. 1999). Eine methodologische Steigerung wären script-basierte, formalisierte Texttransforma-tionen (à la Wegman 1985, 32ff.). Letztlich wäre es - auf lange Sicht - eine lohnende Forschungsaufgabe Texte im Sinne moderner informationstheoretischer Systeme der „data compression“ auf ihren „wesentlichen“ Sinngehalt zu reduzieren (vgl. Seidler 1997). Die hier knapp rekonstruierten Positionen von Freud haben in der modernen kognitionspsychologischen (auch neurowissenschaftlichen und evolutionstheoretischen) Forschung neben kritischen Einschränkungen in wesentlicher Hinsicht auch - weiterführende, differenzierende Bestätigung erfahren (z.B. Hobisch & Schulter 1985, Wegman 1985, Erdelyi 1985, Pöppel 1987, Perrig et al. 1993, Claxton 1997, Mecklenbräuker et al. 1998, Guttmann & ScholzStrasser 1998, Dörner 1999, Rosenfield 2000). 2. Methodologische Rahmenbedingungen „Die Psychoanalyse wird als Wissenschaft nicht durch den Stoff, den sie behandelt, sondern durch die Technik, mit der sie arbeitet, charakterisiert.“ (Freud GW Bd. 11, 403f.) Die Beziehungen zwischen dem psychoanalytischen Theorienbestand und den verwendeten (klinischen) Methoden sind von Beginn an komplex und ergeben insgesamt ein mixtum compositum aus pragmatischen und theoriebezogenen Elementen. Die Benützung der Couch war eine Begleiterscheinung der ursprünglich verwendeten hypnotischen Methode und wurde bei der Anwendung der Methode der freien Assoziation beibehalten, obwohl damit eine Veränderung der „Hintergrundstheorie“ einherging: „Als ich versuchte, die B r e u e r sche Methode der Heilung hysterischer Symptome durch Ausforschung und Abreagieren in der Hypnose an einer größeren Reihe von Kranken zu verwenden, stießen mir zwei Schwierigkeiten auf, in deren Verfolgung ich zu einer Abänderung der Technik wie der Auffassung gelangte. 1) Es waren nicht alle Personen hypnotisierbar ... ; 2) ich musste Stellung zu der Frage nehmen, was denn eigentlich die Hysterie charakterisiert ...“ (Freud 1970, 205) Nach einer auf Basis seines klinischen Materials durchgeführten theoretischen Klärung von „Hysterie“, „Neurose“, etc. („Man darf etwa in einer Reihe von Fällen sagen: a potiori fit denominatio“, ebenda 107) entwickelte Freud seine Methode der freien Assoziation, in der Personen - stimuliert durch (theoretisch begründete) „Reizworte“ des Therapeuten - in freier Weise ihre Einfälle mitteilen, während der Therapeut sie auf Überreaktionen hin beobachtet und diese Beobachtungen notiert, denn übermäßige affektive Reaktionen sind für Freud das Kennzeichen, hinsichtlich eines verdrängten, unbewussten Inhalts im Denken und Erleben des Patienten fündig geworden zu sein. Er verteidigt seine (im Grunde kognitive) „Therapie durch Wörter“ einführend so: „In der analytischen Behandlung geht nichts anderes vor als ein Austausch von Worten zwischen dem Analysierten und dem Arzt. Der Patient spricht, erzählt von vergangenen Erlebnissen und gegenwärtigen Eindrücken, klagt, bekennt seine Wünsche und Gefühlsregungen. Der Arzt hört zu ... drängt seine Aufmerksamkeit nach gewissen Richtungen ... und beobachtet die Reaktionen ... welche er beim Kranken hervorruft. Die ungebildeten Angehörigen unserer Kranken - denen nur Sichtbares und Greibares imponiert, am liebsten Handlungen, wie man sie im Kinotheater sieht - versäumen es auch nie, ihre Zweifel zu äußern wie man ‘durch bloße Reden etwas gegen die Krankheit ausrichten kann’. Das ist natürlich ebenso kurzsinnig wie inkonsequent gedacht. Es sind ja dieselben Leute, die so sicher wissen, dass sich die Kranken ihre Symptome ‘bloß einbilden’. ... Durch Worte kann ein Mensch den anderen selig machen oder zur Verzweiflung treiben, durch Worte überträgt der Lehrer sein Wissen auf die Schüler ... Worte rufen Affekte hervor und sind das allgemeine Mittel zur Beeinflussung der Menschen untereinander. Wir werden also die Verwendung der Worte in der Psychotherapie nicht geringschätzen und werden zufrieden sein, wenn wir Zuhörer der Worte sein können ...“ (Freud GW Bd. 11, 9f.) Skinner (1989, 10) stellt das therapeutische Setting einer psychoanalytischen Behandlung in Analogie zur verhaltenstherapeutischen Desensibilisierung: „Psychoanalysis ... sometimes seems to work by extinguishing the effects of old punishments. When the patient discovers that obscene, blasphemous, or aggressive behavior is tolerated, the therapist emerges as a nonpunitive audience. Behavior ‘repressed’ by former punishments then begins to appear. It ‘becomes conscious’ simply in the sense that it begins to be felt. The once offending behavior is not punished, but it is also not reinforced, and it eventually undergoes extinction, a less troublesome method of eradication than punishment.“ In diesem Sinne kann das Liegen auf der Couch - auf das Freud immer bestand - neben seiner Funktion als für alle Klienten gleichbleibendes „experimentelles“ Setting insbesondere als systematische Desensibilisierung aufgefasst werden: Im entspannten Zustand können Vorstellungen, verbale Assoziationen, etc. zugelassen („gegenkonditioniert“) werden, die sonst mit zu hohen Angst- und Erregungszuständen einhergehen würden. Verstärkt werden kann dieser („gegenkonditionierende“) Desensibilisierungseffekt durch das persönliche Vertrauen zum Therapeuten, durch Hypnose, durch das gezielte Vorstellen beruhigender Bilder aus der Erinnerung, etc. (was durchaus dem Vorgehen bei der systematischen Desensibilisierung von Wolpe, 1961, entspricht). Doch Freuds freie Wortassoziationen, Gedanken- und Gefühlsassoziationen beinhalten mehr als ein emotionales Entspannungstraining. Der Therapeut erhält dadurch wichtige Informationen über die (orthodoxe Verhaltenstherapeuten wenig interessierenden) Innenzustände der Person, über aktuelle Stimmungen, Gedanken, Erinnerungen an damit verknüpfte Situationen, Ereignisse, Objekte aus dem bisherigen Leben (biografisches Material) sowie Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen über Zukünftiges, über antizipierte Selbssteuerungsmöglichkeiten oder Fremdabhängigkeit, Handlungsintentionen, „gelernte Hilflosigkeit“ (Seligman 1975), etc.. Dabei können - nach psychoanalytischer Therapie - verdrängte Kindheitstraumata „wachwerden“ und anderes vorbewusstes bis unbewusstes Material, z.B.: unterdrückte Affekte, Wünsche, Ängste, Aggressionen, „bedürfnisgeladene“ Fantasien, Traumbilder, unbewusste Abwehrmechanismen gegen bedrohliche Es- und Überichforderungen, Konflikte zwischen Ich, Es und Überich, Trennungsängste, Selbstverwirklichungswünsche, paranoide Ideen, depressive Stimmungslagen, Selbstvervollkommnungsfantasien, Verschmelzungswünsche mit geliebten oder verehrten Personen, körperlicher oder sexueller Missbrauch in der Kindheit, Spaltungstendenzen des Ich auf Grund übermäßiger Abwehr, etc. (vgl. z.B. Freud GW Bd. 5, Bd. 17, Lichtenberg 1989). Freud kannte die methodischen Möglichkeiten der heutigen Psychologie nicht (die NeoAnalytiker allerdings sollten sie kennen!). Für ihn war die Couch das experimentelle Setting schlechthin, der Therapeut sollte absichtlich provozieren, quasi „experimentell“ variieren, etc.. Es gab allerdings keine Kodifizierung für systematische Beobachtung (der Therapeut notierte unmittelbar während der Therapie oder im Nachhinein, was ihm - „irgendwie“ - in seinem theoretischen Bezugsrahmen wichtig erschien). Der Patient sollte (durfte) alles äußern, was ihm so - z.T. provoziert durch den Therapeuten - in den Sinn kam. Das sieht wie ein Vorgriff auf die Methode des „Lauten Denkens“ der Gestaltpsychologen aus. Dabei wird die Versuchsperson aufgefordert bzw. ermutigt, „keine noch so flüchtigen oder törichten Einfälle unverlautbart zu lassen.“ (Duncker 1963, 2) Das Objekt der Betrachtung ist im psychotherapeutischen Setting das eigene Erleben, repräsentiert durch aufsteigende Erinnerungen, Gefühle, Gedanken. Insoferne ist „lautes Denken“ im psychotherapeutischen Zusammenhang methodologisch schwer trennbar von der selbstreflexiven Introspektion, in der (generalisierende) Spekulationen, Schlussfolgerungen, Rechtfertigungen, verdeutlichende (polarisierende) Interpretationen mit der Beschreibung spezifischer persönlicher Erlebnisweisen konfundiert sind mit allen Nachteilen, die sich methodisch daraus ergeben (vgl. Mischel 1968, Herber 2000). Was wissenschaftlich notwendig ist, sind allerdings „unbestreitbare“ (intersubjektiv übereinstimmende, voneinander unabhängig protokollierte) Beobachtungsfakten, die Theorien falsifizieren bzw. bekräftigen können (vgl. Popper 1976, 1994). So kann Ideologisierung und Immunisierung eines theoretischen Systems am ehesten vermieden werden, was Freud (GW Bd. 15) offensichtlich bewusst war (wenn auch keine erkennbaren forschungsmethodischen Konsequenzen daraus gezogen werden). Ideologie („Weltanschauung“) ist nach Freud (ebenda, 586) etwas, das „alle Probleme unseres Daseins aus einer übergeordneten Annahme einheitlich löst, in der demnach keine Frage offen bleibt und alles, was unser Interesse hat, seinen bestimmten Platz findet.“ Nur exakte wissenschaftliche Methoden können als Bewährungsinstanzen für eine Theorie in kritischer Überprüfung ihrer jeweiligen - theoriebezogenen - Tauglichkeit herangezogen werden (vgl. Perrez 1972). Hier hat psychoanalytische Forschung (durchaus im Verein mit anderen tiefenpsychologischen, humanistisch-psychologischen Konzepten, etc.) noch viel vor allem quantitativ - aufzuholen, einzelnen empirischen Überprüfungen psychoanalytischer (bzw. psychoanalytisch ableitbarer) Konzepte kann methodologisches Vorgehen lege artis durchaus bescheinigt werden (vgl. z.B. Schafer 1967, Eysenck & Wilson 1973, Masling 1983, 1986, Erdelyi 1985, Davis 1988, Foulkes & Sullivan 1988, Gitzinger-Albrecht 1993, Derakshan & Eysenck 1999). Auch Nicht-Analytiker können psychoanalytische Konzepte direkter empirischer Überprüfung unterziehen (und dies nicht nur - zu Recht - von Psychoanalytikern einmahnen). Ein interessantes Beispiel ist Cattells Forschungsarbeit (zusammenfassend 1985): Um eine Persönlichkeits- bzw. Motivationstheorie auf empirischer Basis zu etablieren führte er über Jahrzehnte Faktorenanalysen über ein breitgestreutes Datenmaterial durch: Ergebnisse verschiedener psychologischer paper-and-pencil-Tests und physiologischer Messungen (Muskelspannung, Blutdruck, galvanischer Hautwiderstand, etc.) ergaben neben vier anderen Faktoren drei motivationale Bereiche der Persönlichkeit, die - obwohl von Cattell nicht intendiert - inhaltlich weitgehend den Freudschen Konzepten von Es, Ich und Überich entsprechen: „The nature of these seven primary components is still, in part, a mystery. Without psychoanalytic inclinations one may nevertheless see the first three as corresponding to Freud’s trio ...“ Wenn man Cattells sieben Primärfaktoren wieder korreliert, ergeben sich zwei Faktoren zweiter Ordnung: „On inspecting these components one feels an understanding at once. The ego and superego come together in what has become called the Integrated (I) factor and the Unintegrated (U) factor, which contains the id, the physiological and other unconscious primaries.“ (Cattell 1985, 3f.) Systematische empirische Forschung auf hohem methodologischem Niveau ist notwendig, da die psychoanalytischen Konzepte komplex und in sich sehr differenziert - „dynamisch“ angelegt sind. Die von Freud und Epigonen praktizierte psychoanalytische Datengewinnung auf Basis sorgfältig dokumentierter Fallstudien - ein so verstandenes „analytisches“ Vorgehen - ist sicher nicht ausreichend, um psychoanalytische Konzepte in ihrem Generalisierungsanspruch zu bekräftigen oder (entscheidend) zu schwächen (zu falsifizieren). Konzepte der Psychoanalyse - nicht „die“ Psychoanalyse - müssten systematisch und exakt formuliert werden, so dass eine strenge Überprüfung möglich wird, die den Generalisierungsbereich - die interessierende Population - auslotet. Die üblichen Daten der psychoanalytischen Forscher sind freie Assoziationen der Klienten zu ihren aktuellen, erinnerten („wiederbelebten“) Erlebnissen, „garniert“ mit Kommentaren des Therapeuten in psychoanalytischen Begriffen. Dieses Vorgehen dient eher einer heuristisch-intuitiven Theorienfindung (wie bei Freud selbst) oder einer entsprechenden Modifikation, Weiterentwicklung, etc., nicht der strengen Überprüfung eines generalisierten Konzepts. „Selbstaussagen“ haben ein enormes Validitätsproblem (vgl. Herber 2000), sie führen im Grunde nicht über die „Geheimnisse“ des einzelnen Falles hinaus, denn subjektive Daten können bestenfalls eine Theorie der konkreten Person ergeben, die sich dem „Universum“ der individuellen Persönlichkeit anzunähern sucht. Abgesehen von den methodologischen Problemen der Introspektion als „Mischmasch“ von Beschreibungen des eigenen Fühlens, Denkens und Handelns und darauf aufbauenden - erinnerungsverfälschenden - Abstraktionen, Schlussfolgerungen, Selektionen im Nachhinein: „Wenn wir mentale Zustände als persönlich relevante, private ‘Daten’ begreifen, müssen wir davon ausgehen, dass solche Daten nicht direkt die Grundlage einer allgemein akzeptablen Theorie sein können ... Wir haben also davon auszugehen, dass Bewusstsein“ (und damit erst recht „Unbewusstsein“) nur der eigenen Selbsterfahrung zugänglich ist. Strikt gesehen, sind schon Mitteilungen von Selbsterfahrungen keine Bewusstseinsdaten mehr. Es handelt sich stets um Transformationen subjektiver Erfahrungen, denen die ‘eigentlichen’ Bewusstseinsqualitäten nicht mehr zugesprochen werden können.“ (Perrig et al. 1993, 17) 3. Vergleich mit den Paradigmen: Behaviorismus, Gestaltpsychologie, Kognitive Psychologie 3.1 Psychoanalyse – Behaviorismus Wir gehen mit anderen Autoren (z.B. Wachtel 1977, Erdelyi 1985, 27ff., 49ff., Juul 1990, 21ff.) davon aus, dass es im praktischen Vollzug von Psychoanalyse und Verhaltenstherapie mehr (funktionale) Gemeinsamkeiten gibt, als dies sprachlich (begrifflich) in der Formulierung des jeweiligen theoretischen „Überbaus“ zum Ausdruck kommt. Wir werden zu zeigen versuchen, dass es in den Theoriekernen beider Paradigmen neben wichtigen Unterschieden auch wesentliche Gemeinsamkeiten gibt - ein Vergleich zwischen beiden Bereichen also sinnvoll ist. Dabei sollen die erheblichen methodologischen Unterschiede nicht verleugnet werden, obwohl punktuell eine kompensatorische Beziehung ausgemacht werden kann. Die strenge operationale Bindung des Behaviorismus an beobachtbare Daten („observals“, vgl. Hull 1943) mangelt der klinischen Methode der Psychoanalyse, insoferne die theoretischen Selektionskriterien und das praktische Vorgehen bei der Datengewinnung weder systematisch getrennt bzw. aufeinander bezogen noch intersubjektiv normiert erscheinen. Theoretische Konstruktion und praktische Beobachtung sind nicht sauber voneinander getrennt, konfundieren in vielfältiger Weise. Der individuelle Analytiker bestimmt im jeweiligen Interaktionsprozess, was als unbezweifelbares Datum zu gelten hat. Diese „naive“ (intersubjektiv meist nicht überprüfte) Gewinnung von Beobachtungsdaten in der Behandlungssituation kann nach behavioristischer Sicht in unkontrollierter Weise Spekulationen bzw. empirisch nicht überprüfbare Abstraktionen und „Schlussfolgerungen“ in sich bergen (jedenfalls nicht eindeutig ausschließen) - ein Problem, das allerdings in vielerlei Hinsicht nicht auf die Psychoanalyse beschränkt ist, insoferne der Zusammenhang von „inneren Prozessen“, „phänomenalem Erleben“, Introspektion und dem sprachlichen Ausdruck dieser Wahrnehmungen auch in Gestalt- und Kognitionspsychologie kaum stringent geregelt ist: Was kann ein sprachlicher Ausdruck „alles“ - in verschiedenen Situations-zusammenhängen - bedeuten, wie hängen normgeregelter sprachlicher (denotativer) Ausdruck und individuelles (phänomenales) Erleben (dessen sprachliche Konnotation) jeweils zusammen (vgl. Herber 1979, 1998c, 2000, Galli 1983, Windmann & Durstewitz 2000). Psychoanalytiker beschäftigen sich primär mit dem Zusammenhang von manifesten (sprachlich geäußerten) und latenten (theoretisch schlussgefolgerten, unterstellten) Gedanken, Wünschen, Fantasien sowie den damit verbundenen „inneren“ Ängsten und Konflikten. Behavioristen hingegen sehen in expliziten Umweltreizen, also Situationsmerkmalen behavioraler oder sprachlich-denotativer Art die entscheidenden Determinanten des Verhaltens. Doch gibt es - vernünftiger Weise möchten wir meinen - Möglichkeiten der Brückenbildung zwischen beiden Paradigmen. So führt Wolpe (1969, 107) aus: „The theme, or common core, of a neurosis is usually derived from extrinsic stimulus situations disturbing to the patient-like spiders or criticisms; but sometimes the core subsists in response-produced stimuli.“ Verhaltenstherapeuten schließen also die besondere Wirkung innerer Reize in Reaktion auf Umweltgegebenheiten nicht aus. Ebenso anerkennen Psychoanalytiker und (moderne) Tiefenpsychologen den (modifizierenden) Einfluss von aktuellen Umweltreizen auf Motivation, Kognition und Verhalten (siehe den Einfluss der äußeren Realität auf das Ich bei Freud GW Bd. 13, 251ff., vgl. auch Wachtel 1977, Erdelyi 1985, Waldvogel 1992, Rath 1995, 1996, 1998). Doch gibt es nach wie vor Präferenzen in der „Suchrichtung“ des Forschens - bedingt durch Unterschiede der Theoriekerne und des methodologischen Rahmens. Im Sinne der behavioristischen Forschungspräferenz ist es verständlich, dass emotional sowie kognitiv gesteuertes Verhalten (z.B. eine Angstreaktion oder Objektbeschreibung) auf äußere Reize zurückgeführt wird (vgl. z.B. Skinner 1989): Theoriekern und Methodologie sind auf direkt (sinnlich) beobachtbare Prozesse zugeschnitten (vgl. Herber 2000). Behavioristen misstrauen psychoanalytischen (tiefenpsychologischen, humanpsychologischen) Interpretationen, Schlussfolgerungen, etc., besonders wenn sie nicht in wiederholbarer Weise in entsprechenden Verhaltensweisen zum Ausdruck kommen (und linear-regressiv abgebildet werden können). Zwar sind organismusinterne Reize seit Hull (1943) als „intervenierende Variablen“ formulierbar, doch ist es in behavioristischer Denkgewohnheit einfacher direkt beobachtbares Verhalten auf direkt beobachtbare Reize zurückzuführen (ohne sich auf die funktionale Indeterminiertheit, welche Varianzanteile im Interaktionsprozess „innen - außen“ primär der einen oder anderen Seite zuzuordnen oder eventuell gar nicht zu unterscheiden sind, in aufwendigen Theoriekern- und Methodologie(re-)konstruktionen einlassen zu müssen). Wenn z.B. Ängste nicht nur mit bedrohlich wahrgenommenen äußeren Reizen (auch im Wahrnehmen liegt immer schon was „Inneres“!) sondern auch mit der (unkontrollierbar gewordenen) inneren Situation zu tun haben, z.B. mit starken Konflikten einander widerstrebender Wünsche (etwa zwischen maximalen Freiheits- und Geborgenheits-strebungen), dann bedarf es komplexerer Theorien, Beobachtungsstrategien, Schlussfol-gerungen, etc., als z.B. die Größe und Angriffslust eines Hundes zu taxieren (wobei natürlich wieder etwas „Inneres“ dazu kommt, z.B. das Ausmaß einer Hundephobie). Wenn ein Mensch beispielsweise Hunde hasst, weil sie ihn an eine bestimmte Person erinnern, die einen Hund besaß, muss das Problem wesentlich komplexer und differenzierter angegangen werden, als sich an kleine und immer größer werdende Hunde nach und nach zu gewöhnen. In so einem Fall kann mittels freier Assoziation der komplexe Sachverhalt als idiosynkratisches Problem valider aufgeklärt werden, als den Patienten mit allen Arten von Hunden mit variierenden Größen und Verhaltensweisen zu konfrontieren. Behavioristisch ausgedrückt: Operantes (Sprach-, Fantasie-) Verhalten zu fördern, kann ein Netzwerk von individuellen „Angstsensorien“ valider erfassen helfen als experimentell streng kontrolliert - respondent - „alle möglichen“ Reize einer bestimmten Reizklasse (etwa mit kontrolliertem Stellungseffekt) in a priori festgelegten Situationseinbettungen als Auslöser (Signalreize, etc.) vorzugeben. Interpersonale, idiosynkratische Faktoren in Gestalt qualitativ besonderer, weitgespannter Vernetzungen von Habits können nicht deswegen als unwahrscheinlich (unwissenschaftlich, etc.) ausgeschlossen werden, weil die isolierte Analyse einzelner Habits (die als unabhängig voneinander postuliert werden) methodisch leichter herstellbar ist. Einfachere methodische Herstellbarkeit sollte nicht mit methodologischer Notwendigkeit und theoretischer Einfachstruktur verwechselt werden. 3.1.1 Exkurs im Sinne einer intendierten Anwendung: Einige Bemerkungen zur therapeutischen und pädagogischen Praxisxi Der Behaviorismus kritisierte die psychoanalytischen Praktiken in Therapie und Pädagogik vor allem aus methodologischen Gründen, weil er letztlich nur (systematisch) beobachtbares Verhalten als wissenschaftlichen Datenträger anerkannte (vgl. Herber 2000), psychoanalytisch orientierte Therapie und Pädagogik aber mehr am „inneren Menschen“, seinen Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen, etc. (bzw. deren „irgendwie“ registrierten verbalen und nonverbalen Ausdrucksformen) orientiert waren. Nach und nach nahmen „kognitive Behavioristen“ das konstruktive „Innere“ von Organismen ernst und damit die entsprechenden sprachlichen Äußerungen. Sie legten nun mehr Wert auf verbale Selbstauskünfte, Interviews und Exploration (und nicht nur auf Verhaltensbeobachtung). Umgekehrt lernten psychoanalytische Therapeu- ten den Wert von systematischer Beobachtung zu schätzen (vgl. Juul 1990) und beachteten Umweltereignisse gezielter als (potentielle) Einflussfaktoren des subjektiven Erlebens (z.B. Wachtel 1977). Auch wenn die Paradigmen Psychoanalyse und Behaviorismus in mancherlei Hinsicht unverträglich bleiben (z.B. in der Annahme unbewusster Verdrängungs- und Abwehrprozesse), können sie einander im kritischen Austausch gegenseitig stimulierend fördern. Ein Vergleich auf der Praxisebene ist sehr schwierig, weil innerhalb jeden Paradigmas Praktiken entwickelt wurden, die im Anwendungsbereich des Paradigmas selbst sehr streuen, aber auch im anderen Paradigma- oft unter anderer Bezeichnung - verwendet werden (vgl. etwa die kathartisch-hypnotische Methode der frühen Psychoanalyse mit diversen Entspannungs- und Desensibilisierungstechniken der Verhaltenstherapie, z.B. Wachtel 1977, Erdelyi 1985). In beiden Paradigmen gehen Veränderungen vor sich, so dass schwer abzuschätzen ist, wie weit Integrationen in Teilbereichen sich noch entwickeln werden (z.B. in Form eines komplementären Zusammenwirkens in Gemeinschaftspraxen, etc.). Eklektizistische Praktiken scheinen im therapeutischen und erzieherischen Alltag zuzunehmen. Wie weit sie in den Theoriekernen bzw. Methodologien wissenschaftlich nachvollzogen werden können, bleibt eine offene Frage. Integrative Fundierungsversuche sind freilich unterwegs (vgl. z.B. Wachtel 1977, Erdelyi 1985, Juul 1990, Dubs 1995, Grawe 1998, Hofmann 2000). Auf ethisch-ideologischer Ebene scheint der Respekt vor den konstruktiven Möglichkeiten der „inneren Person“ wieder zuzunehmen. Auch frühkindliche Erfahrungen gewinnen - gestützt durch moderne neurowissenschaftliche Forschung - wieder an Wert (vgl. Pöppel 1987, 1993, 2000, Pinker 1998a, LeDoux 1998, Zieglgänsberger 1998, Greenfield 1999). Die inneren konstruktiven (kreativen) Möglichkeiten können nicht durch einfache äußere Reizmanipulationen überrannt werden. Fehler der strikt behavioristischen Einflussnahme von außen werden mehr und mehr aufgezeigt (vgl. z.B. Phares 1976, Wachtel 1977, Juul 1990, Grawe 1998). Mehr und mehr setzt sich die - vorwiegend pragmatisch initiierte - Einstellung durch, die existierenden Paradigmen (Theorien, Modelle) nur als aspektivisch relevant zu sehen und in ihrer praxisbezogenen Kombination zu besseren Ergebnissen zu kommen (vgl. z.B. Juul 1990, Dubs 1995, Pöppel et al. 1994). Inwieweit eine entsprechende wissenschaftlich integrative Fundierung gelingt, bleibt abzuwarten (vgl. Wachtel 1977, Erdelyi 1985, Pöppel et al. 1994, Grawe 1998). Jedenfalls scheint sich folgender Trend abzuzeichnen: Wenn schon keine wissenschaftliche Integration in Theoriekern und Methodologie durch ein „tiefer“ fundiertes theoretisches und methodologisches Regelwerk möglich sein sollte, dann ist - unter pragmatischem Gesichtspunkt - lieber ein friedliches Koexistieren als ein ideologischer Grabenkampf zu empfehlen. Paradigmenkonkurrenz orientiert sich oberflächlich oft mehr an äußeren Etiketten (z.B. Sprachzeichen) als an strukturell-funktionalen Unterschieden auf Verhaltens- und Erlebnisebene. Statt einander zu denunzieren oder nicht zu beachten wäre gegenseitige Information und kritischer Austausch wünschenswert. Erst im Überwinden von aversiven „Trotzhaltungen“ wird gegenseitige Bereicherung, Anregung, Stimulation, Herausforderung sowie kritische Selbstbeschränkung fruchtbar werden. So werden intrinsisch motivierte Entwicklungen möglich - gegenüber einem extrinsischen, gesellschaftspolitischen Obsiegen, Streben nach Revier- oder Marktbeherrschung, monopolistischer Ressourcen-ausbeutung, etc.. 3.1.2 Zurück zur Ausgangslage in Freuds Psychoanalyse: Trotz eines gegenüber dem Behaviorismus wesentlich komplexeren Netzwerkes an Assoziationen zwischen (inneren und äußeren) Reizen, Reaktionen, Habits, etc. ist Freuds Psychoanalyse im Wesentlichen assoziationistisch fundiert, wenn er auch Reiz-Verhaltens-Verknüpfungen vom „Seelenapparat“ kognitiv überarbeiten lässt, indem er etwa neben dem Kontiguitätsprinzip die „Ähnlichkeit“ von Reizen als verbindungsstiftendes Prinzip postuliert (z.B. GW Bd. 8, 172) oder indem er antizipierende Vorstellungen (Erwartungen) innengesteuert generieren lässt, wodurch die Reizauswahl und -agglomeration wesentlich beeinflusst wird (z.B. GW Bd. 6, 112f.). Sinnesdaten sind bei Freud ähnlich Wundts (1907, 45ff.) „Empfindungen“ konzipiert - als die Elemente aller psychischen Prozesse (von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Träumen, Fantasieren, etc.). Freuds erkenntnistheoretisches Hauptproblem war - nicht untypisch für seine Zeit - die Konfundierung von (physikalisch-physiologisch beschreibbaren) Sinnesdaten und phänomenalem („psychischem“) Erleben, ein Problem, das im Grunde bis heute nicht gelöst ist (vgl. z.B. Herber 1972, 1977, 1979, Waldvogel 1992, 1997, Windmann & Durstewitz 2000). Freud unterstellt in allen uns bekannten Argumentationszusammenhängen die Objektivität von Sinnesdaten als Ausgangsmaterial für irgendwie überformende, emotional-kognitiv bedingte konstruktive „Überarbeitungen“. So werden (siehe bes. GW Bd. 11, vgl. auch Henle 1984): objektive Sinnesdaten in Träumen bedürfnisbezogen umgedeutet; Gedanken aus der Kombination von Gedächtnisspuren früherer Sinneseindrücke entwickelt; Sinnesdaten unbewusst verarbeitet („verdichtet“), bevor sie bewusst werden; „normale“ (nicht „paranoische“) Vorstellungen, Träume, Fantasien im Kontext objektiver Sinnesdaten entwickelt und der Realitätssinn (des Ich) auf diese Weise aufrecht erhalten; interne Assoziationen abstrahierend-konstruktiver Art (Ähnlichkeiten, funktionale Zusammenhänge wie Kausalbeziehungen, etc.) im Traum durch konkrete Vorstellungen - quasi Sinnesdaten projizierend - ersetzt (analog realen Wahrnehmungen von Zeit und Raum, Gestaltähnlichkeiten, etc.); entstehen Symptome von verdrängten Vorstellungen durch Assoziationen (vgl. etwa Konversionen wie „etwas macht mir Kopfzerbrechen“, „etwas kann ich nicht verdauen, liegt mir im Magen, geht mir auf die Leber, Nieren“, Fehlleistungen, Träume, etc.); Zweifellos nimmt schon Freud - und nehmen erst recht Psychoanalytiker der Jetztzeit (vgl. z.B. Waldvogel 1992, Kernberg 1997, Bollas 2000) - mehr oder weniger elaborierte kognitive Verknüpfungsmechanismen an um auf der Basis räumlich-zeitlich kontingenter Sinnesdaten die idiosynkratischen Vorstellungen des gesunden wie des kranken Seelenlebens rekonstruieren zu können. Wir beschäftigen uns daher in den folgenden zwei Abschnitten mit Vergleichsmöglichkeiten zwischen Psychoanalyse und Gestaltpsychologie einerseits, Psychoanalyse und Kognitiver Psychologie andererseits. 3.2 Psychoanalyse und Gestaltpsychologie Luchins & Luchins (1997) sammelten Aussagen prominenter Gestaltpsychologen über die Psychoanalyse, die wir - als eine Art Problemaufriss - hier verkürzt wiedergeben. Sie beginnen mit einschlägigen Erinnerungen von Oppenheimer, einer ehemaligen Studentin Wertheimers: „To him psychoanalysis belonged to those parts of psychology which approached the human being in piecemeal fashion, not as a whole, and the reason for that was that psychoanalysis works on the basis of free association. ... He denounced it as piecemeal, as not getting at the essence of human life, and so on and so on. This is the more amazing as WERTHEIMER himself originally invented an association test, the same kind of association test that I think JUNG invented, and in the same year ...“ (Oppenheimer 1973, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 128) Levy, ein Assistent von Wertheimer, berichtet über ein missglücktes Seminar, das Wertheimer mit Horney und Glück (einem anderen Psychoanalytiker) in New York hielt und das wegen Wertheimers massiver Kritik nicht mehr fortgesetzt werden konnte: „I do not feel that he was ever really open to psychoanalysis ... His often passionate attacks were essentially based on methodological arguments and a strong reluctance to recognize the role of sexuality as FREUD had proclaimed it. In some way, I think, he would have been much more open to later developments in psychoanalytic ego psychology, but these had begun just a few years before he died, and I do not think that he was acquainted with this work“ (Levy 1969, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 129) Andere ehemalige Seminarteilnehmer hatten nach Luchins & Luchins (ebenda) ähnliche Eindrücke. Sie bedauerten, dass Wertheimer die theoretischen und methodologischen Unterschiede in den Vordergrund rückte und die Parallelen oder Analogien zwischen beiden Bereichen nicht zur Kenntnis nehmen wollte oder „herunterspielte“. Über Köhlers kritisch-distanziertes Verhältnis zur Psychoanalyse berichten Luchins & Luchins Folgendes: „According to the analysts, people often do not know at all why they behave in one way or another. Their actual motivations may be quite different from those which, they believe, are operating. Now, we can admit that some such instances occur in normal life, and there may be many more under pathological conditions. ... We ought to distinguish between two things: in some the Freudians may be right, while in others people merely fail to recognize their inner states. ... Recognition, which operates with perfect ease in perception, is surprisingly sluggish in the case of inner processes. Incidentally, this is true whether or not the inner facts in question deserve to remain unrecognized.“ (Köhler 1947, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 129f.) „... FREUD did reform psychology by placing motivation, which was then badly neglected, into its very center... What, then, is to be criticized in psychoanalysis? The original thesis that sex lurks behind all our actions and thoughts can no longer disturb us seriously ... But we have a far more serious reason: according to the analysts, we seldom know why we act as we do, because our real motives are hidden in the unconscious. ... How is a person to feel responsible for his actions ...? ... Death instinct, anxiety, inferiority, complex, frustration, aggression - what a vocabulary! ... Never will they mention cheer, joy, happiness, hope, or fortitude. It is as though, among the chemists of our time, there were a fashion to talk endlessly about sulphur and arsenic, but never about iron and nickel, silver and gold ...“ (Köhler 1959, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 130f.) Könnte da nicht etwas bürgerlich-affirmative „Heile Welt“- Haltung mit im Spiel sein, ein starkes Bedürfnis nach bewusster Selbstkontrolle (oder gar „Abwehr“ gegenüber so „grauslichen“ Dingen, die über uns hereinbrechen können)? Über Koffkas kritisch-interessiertes Verhältnis zur Psychoanalyse wird berichtet: „The forces which determine our behavior may not always be those we believe to be the determinants. We may do something in order to please X as we think, when in reality we do it to spite Y, when Y need neither be present nor in our thoughts. Psychoanalysis in its various forms has brought to light many such facts ... However far the psychoanalysts may overshoot the mark, it remains true that this type of action exists. ... unconscious or subconscious does not help us ... why did not all psychologists simply distinguish between conscious and merely physiological processes? ... the Ego ... survives as a part of the psychophysical field even when it is not represented in consciousness, and that forces us to the conclusion that normally, when the Ego exists in our behavioral world, this phenomenal, or conscious, Ego is not the whole Ego ... This is, as I see it, the true justification of the various psychoanalytic theories which investigate the particular properties of this permanent Ego, the strain and stresses within it. ... rightly interpreted the principles of psychoanalysis cannot be dismissed by a shrug of the shoulders, much as the special claims of any psychoanalytic school may be open to just and severe criticism. The development of psychoanalysis has been influenced by the two poles which have affected the whole of psychology, the pole of mechanism, which was paramount in FREUDs earlier work, and the pole of vitalism, vitalism, even with a mystical tinge which became so prominent in the later development, particulary in the hands of JUNG. Psychoanalysis will, I dare to predict, enter a new and healthier state of development when it frees itself of the mechanistic and the vitalistic biases.“ (Koffka 1935, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 131ff.) Lewin - in Weiterentwicklung der klassischen Gestaltpsychologie zur Feldtheorie - wird in seinem Verhältnis zur Psychoanalyse wie folgt zitiert: „... we often find facts which FREUD first brought to our attention, thereby rendering a great service even though he has not given a clear dynamic theory in regard to them. One such fact is that of substitution. FREUD uses the concept of substitution extensively to explain both normal and abnormal behavior. Moreover, sublimation, which is closely related to substitution, is according to him an important foundation of our whole cultural life....“ (Lewin 1935, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 134) Nicht nur in seinen Experimenten zur Verschiebung, Substitution und Sublimation bewegt sich Lewin auf theoretischem Terrain der Psychoanalyse und operationalisiert entsprechende Theoreme in so stringenter Weise, dass sie zu tragenden Begriffen einer durchformalisierten Motivatonstheorie werden konnten (vgl. Atkinson & Birch 1970, Astleitner 1992, Astleitner & Herber 1993). Auch zum Problem der Kausalität setzt er sich mit Freud auseinander, indem er zwei Bedeutungen der psychologischen Warum-Frage unterscheidet: „1. Why in a given momentary situation, that is, with a given person (P) in a certain state and in a certain environment (E), does precisely this behavior result? 2. The more historical question: Why at this moment, does the solution have precisely this structure and the person precisely this condition or state? It is important to separate these two questions more clearly than is done, for example, in association psychology and in FREUDs theory.“ (Lewin 1935, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 134) Und weiterführend wohlwollend-kritisch: „Psychoanalysis has probably been the outstanding example of a psychological approach which attempts to reach the depths rather than the superficial layers of behavior... Psychoanalysis has not always kept in line with the requirements of scientific method when making its interpretations of behavior. What is needed are scientific constructs and methods which deal with the underlying forces of behavior but do so in a methodologically sound manner.“ (Lewin 1951, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 135) Goldstein (1934) entwickelte einen gestaltpsychologischen Ansatz der Neurologie. In kritischer Abwägung nahm er psychoanalytisches Gedankengut auf. Luchins & Luchins (1997) folgend lassen wir ihn diesbezüglich wie folgt zu Wort kommen: „Thus, all investigators who have dealt with the problem of anxiety have sought to distinguish between anxiety and fear. I am only mentioning the interpretations of FREUD ... considering fear as fear of something, while anxiety ... deals with ‘nothingness’ ... We have characterized the conditions of braininjured patients, when faced with solvable and unsolvable tasks, as states of ordered behavior and catastrophic reaction. ... The fact that the catastrophic condition involves the impossibility of ordered reactions precludes a subject ‘having’ an object in the outer world ... their anxiety has no corresponding content, and is lacking in object ...“ (Goldstein 1939, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 136) Und weiter - in kritischem Bezug auf psychopathologische Phänomene sensu Freud im Vergleich zu „normaler“ Selbstverwirklichung: „When centering is defective, when parts are split off from the whole, it is certainly possible that the outcome is antagonism, for example, a contest in the field of perceptions or drives, or something in the nature of a struggle between ‘mind’ and ‘drives’. Then it is even possible that a so-called ‘drive’ may become so pathologically dominant that it is mistaken for a true, essential characteristic of the normal organism, as in the anthropology of FREUD. But from such partitive phenomena, it will never be possible to understand, even approximately, the inner coherence and unity of holistic behavior. From no single phenomenon does a path lead to the whole; yet it can be comprehended as a privation of the whole. The possibility of such privations is no objection to the holistic organization; rather, they express the imperfection in self-realizing resulting from a lack of potency ... This lack is either innate ... through a deprivation of the grace of endowments - or it is acquired through disease, or it is a sequel of overpowering demands by the environment.“ (Goldstein 1939, zit.n. Luchins & Luchins 1997, 137f.) Aus der Zitatensammlung von Luchins & Luchins (1997) ergibt sich , dass die Gestaltpsychologen Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin und Goldstein offensichtlich sehr unterschiedliche Auffassungen gegenüber der Psychoanalyse entwickelten. Köhler und Goldstein stimmen darin überein, dass aus psychopathologischen Phänomenen kaum valide auf „normales“ Seelenleben geschlossen werden kann. Auf Basis der Biografie von Waldvogel (1992, 9ff.) lassen sich - trotz aller Unterschiede ihrer theoretischen Ansätze - gemeinsame Wurzeln bei den Begründern beider Paradigmen, Freud und Ehrenfels, in der Helmholtz-Schule, in den Theorien von Fechner, Mach und Brentano - bei letzerem studierten Freud und Ehrenfels - erkennen. Wertheimer, der seinerseits bei Ehrenfels studierte, stand der Psychoanalyse heftig ablehnend gegenüber, obwohl (weil?) er mit seinem Wortassoziationstest eine der freien Assoziation in der Psychoanalyse ähnliche Methode entwickelte, die ebenfalls - zumindest methodologisch ein elementaristisches Menschenbild nahelegte, wie er dies der Psychoanalyse vorwarf (siehe oben das Zitat von Oppenheimer). Kollegen und Schüler von Wertheimer aus dem Berliner Kreis - wie in Luchins & Luchins (1997) ersichtlich - rezipierten differenzierter: Köhler gibt sich kritisch-distanziert, ihn stört vor allem das „negative“ Menschenbild der Psychoanalyse. Seine Analogie, die Interessenshaltung der Psychoanalytiker sei, wie wenn sich Chemiker vorwiegend mit Arsen und Schwefel, kaum aber mit Eisen, Silber und Gold beschäftigen würden (Köhler 1971, 404), stellt einen aufschlussreichen Bewertungsversuch dar. Koffka und Goldstein rezipierten psychoanalytisches Gedankengut kritisch-wohlwollend. Lewin ließ sich - bei aller Kritik - von Freuds Schriften inspirieren und setzte einzelne zentrale Konzepte experimentell um. Damit wurden psychoanalytische Konzepte zu fruchtbaren Anregern der modernen Motivationsforschung (vgl. Herber 1979, McClelland 1995, Weiner 1996). Waldvogel (1992, 11) zu Folge wurde die Gestaltpsychologie erstmals von Hermann (1922) systematisch berücksichtigt. Weitere systematische Vergleiche bezüglich Theoriekern und Methodologie erfolgten in größeren zeitlichen Abständen durch Bernfeld (1934), Schumacher (1971), Argelander (1979), Henle (1984), Galli (1983), Mertens (1990), Waldvogel (1992) und Galli (1997). Diese verschiedenen Analysen stimmen darin überein, dass Freuds Theorien und Methoden - mindestens zu Beginn - weitgehend dem Assoziationismus verpflichtet waren, also elementen-„analytisch“ beschrieben werden können, dass an vielen Stellen seines Werkes aber gestaltpsychologische (und kognitionspsychologische) Annahmen vorweggenommen (oder in späteren Schriften „stillschweigend“ übernommen) wurden. Wir werden im Folgenden einige wichtige Aussagen der eben angeführten Arbeiten - interpretierend - zusammenfassen (teilweise an Waldvogel 1992 orientiert): Besonders Bernfeld (1934) ist der Ansicht, dass Freud lange vor den Gestaltpsychologen eine radikale Abkehr vom Assoziationismus vollzogen hat, wenn er auch „von der Assoziationspsychologie herkam, ihre Termini schlicht verwendete.“ (44) Die Traumsymbole z.B. be- stehen - strukturell wie funktional - aus Gestalten, jeder Traum muss auf „seine Gestalt“ (ein komplexes Befriedigungsziel) hin gedeutet werden. Das Bühlersche „Aha-Erlebnis“ veranschaulicht das Zusammenschließen „des diskret Nebeneinanderstehenden zu einem Sinnganzen.“ (Bernfeld 1934, 50) Neben anderen Gemeinsamkeiten zwischen Psychoanalyse und Gestaltpsychologie, wie der Einheit von Wahrnehmen, Denken, Wollen und Fühlen, der grundsätzlich engen Beziehung von physiologischen und psychologischen Prozessen stellt Bernfeld auch Divergenzen fest: „Von Sexualität, auch nur von Liebe, Hass und Hunger ... weiß die Gestalttheorie ... nichts bedeutsames zu sagen (62). Im Kontrast zur Psychoanalyse falle an der Gestalttheorie auf, dass sie sich dem Klaren, Reinen, dem Intellektuellen und Normgemäßen widmet und alles Dunkle, Verworrene, Schmutzige, Krankhafte meidet ...“ (57) Schumacher (1971) konstatiert eine mangelnde Rezeption der Gestaltpsychologie durch die Psychoanalyse und führt dies darauf zurück, dass die bewusstseinsfähigen Ich-Funktionen in der Psychoanalyse erst zum zentralen Thema wurden als die Gestaltpsychologie ihre Bedeutung in der Schulpsychologie bereits verloren hatte. Er sieht Gemeinsamkeiten zwischen dem psychoanalytischen Streben nach Triebentspannung und der gestaltpsychologischen Prägnanztendenz oder der Tendenz nach Geschlossenheit (vgl. z.B. Koffka 1935, Metzger 1982). Mit Hilfe der Gestaltpsychologie versucht Schumacher (163), die „Beziehung zwischen Primär- und Sekundärvorgängen sowie Fragen des Anschlussgewinnung bzw. Zusammenschlussbildung zwischen Es- und Ich-Anteilen“ zu präzisieren: Die Diffusität und Unabgegrenztheit des primären Erlebens, die Unaufschieb-barkeit der Triebentladung, die Flüchtigkeit und Verschiebbarkeit der Objektbeziehungen führen nach Freud zur Verschiebung und Verdichtung von inneren und äußeren Wahrnehmungselementen. Diese (Abwehr)Prozesse werden von Schumacher gestaltpsychologisch gefasst. Bei der Verdichtung werden einzelne Erlebnisanteile ohne Beachtung von spezifischen, idiosynkratischen Merkmalen und unter Nichtbeachtung von Widersprüchen zu einem Ganzen verschmolzen - „wie es vom Ganzen her gesehen passend erscheint“. (170) „Verschiebung“ bedeutet eine „Transponierung einer Gestalt oder Teile von Gestalten auf andere“ (170), wie immer das - im Sinne einer zu fordernden Prägnanztendenz - im Detail funktionieren mag (vgl. das Problem der Analogiebildung - insbesondere was die Einbeziehung emotional-motivationaler Faktoren betrifft: z.B. bei Herber & Vásárhelyi 1993, Majewski 1994, Herber et al. 1996, Herber 1998d). Auch die Transformation von Es- zu Ich-Anteilen (Freud 1954, 10: „Wo Es war, soll Ich sein.“) interpretiert Schumacher gestaltpsychologisch: Die diffusen, ganzheitlich-primitiven Es-Abkömmlinge werden in „separativ-geordnete, von den Zielen und Interessen des Ganzen her bestimmte Endgestalten“ (185) übergeführt. Auch Argelander (1979) ist der Auffassung, dass sich die Interpretatinen/Schlussfolgerungen von Psychoanalytikern im Grunde nach Gestaltprinzipien vollziehen. Die vom Analysanden vorgebrachten je spezifischen, konkreten Inhalte sind oberflächlich unterschiedliche Ausdrucksformen eines „Ganzen“, einer gemeinsamen Thematik in der Tiefenstruktur. Durch Freuds „freischwebende Aufmerksamkeit“xii organisiert der Analytiker aus den wahrgenommenen konkreten Inhalten eine kohärente Gestalt, vorerst intuitiv-unbewusst, dann mehr und mehr reflektierend-bewusst bis rational-theoriebezogen. Ganz im Sinne der freien Assoziation der Psychoanalyse bzw. des von Gestaltpsychologen propagierten „lauten Denkens“ empfiehlt Argelander alle Mitteilungen eines Probanden zu nützen, auf zeitliche Nachbarschaft und kausale Zusammenhänge zu achten und die Herauskristallisierung der noch unklaren Gesamtstruktur einfach abzuwarten, „bis die einzelnen Element in ihrer funktionalen Bedeutsamkeit aufeinander verweisen und sich daraus das unbewusste Thema als eine Gestalt abzeichnet, von der die einzelnen Elemente ihren Sinn erhalten.“ (ebenda, 127) Galli (1983) widmet sich dem Vergleich der orthodoxen psychoanalytischen Methode Freuds und der klassischen phänomenologischen Methode der Gestaltpsychologie zur Erforschung der phänomenalen Welt. Die phänomenologische Methode erfordert „dass die psychischen Phänomene, die Erlebnisse, als eine Wirklichkeit eigener Art und nicht nur als Anzeichen für das eigentlich Wirkliche (die sogenannte erlebnisjenseitige Realität) bewertet werden“. (ebenda, 23) Galli ortet bei Freud eine gewisse Schwierigkeit in der Überwindung der objektivierenden „naturwissenschaftlichen“ Einstellung (Phänomene als Oberflächenmerkmale einer theoretisch zu postulierenden Tiefenstruktur zu betrachten). Freud ist sich dabei der Probleme, die phänomenale Welt von Individuen wissenschaftlich zu erfassen, durchaus bewusst: „Unter dem Einfluss der an CHARKOT anknüpfenden Trauma-Theorie in der Hysterie war man leicht geneigt, Berichte der Kranken für real und ätiologisch bedeutsam zu halten ... Als diese Ätiologie ... an dem Widerspruche gegen sicher festzustellende Verhältnisse zusammenbrach ... kam die Besinnung ... Wenn die Hysteriker ihre Symptome auf erfundene Traumen zurückführen, so ist eben die neue Tatsache die, dass sie solche Szenen phantasieren, und die psychische Realität verlangt neben der praktischen Realität gewürdigt zu werden.“ (GW Bd. 10, 55) Im Unterschied zur kathartischen Anfangsphase der psychoanalytischen Methode, in der man Patienten - theoriebezogen (durch Hypothesenbildung durch den Therapeuten) - ziemlich aktiv zur „Wahrheitsfindung“ gängelte, wartete man später im Sinne der freien Assoziation eher auf die spontanen Einfälle: „Anstatt den Patienten anzutreiben, etwas zu einem bestimmten Thema zu sagen, forderte man ihn jetzt auf, sich der freien ‘Assoziation’ zu überlassen, d.h. zu sagen, was immer ihm in den Sinn kam ... Nur musste er sich dazu verpflichten, auch wirklich alles mitzuteilen, was ihm seine Selbstwahrnehmung ergab, und den kritischen Einwendungen nicht nachzugeben, die einzelne Einfälle mit den Motivierungen beseitigen wollten, sie seien nicht wichtig genug, gehörten nicht dazu oder seien überhaupt ganz unsinnig.“ (Freud GW Bd. 14, 65) Diese im Grunde phänomenologische Methode wurde von der Gestalttheorie von Anfang an bei den experimentellen Untersuchungen voll zum Einsatz gebracht (vgl. z.B. die Methode des „lauten Denkens“, dargestellt in Duncker 1963, 2, wonach die Versuchspersonen alle Erlebnisse angesichts einer bestimmten Reizkonstellation möglichst unreflektiert von sich geben sollten). Was die Ganzheitlichkeit (strukturelle Nicht-Summativität) als Analyseeinheit betrifft, hebt Galli hervor, dass die Gestaltpsychologie - vom Theoriekern Nicht-Summativität psychischen Erlebens ausgehend - ihre experimentellen Forschungen im Bereich der Wahrnehmung so durchgeführt hat, dass jedes „sinnespsychologische Geschehen in Beziehung mit der Struktur des ganzen Umfeldes untersucht wurde.“ (ebenda, 25) Im psychoanalytischen Ansatz ortet Galli ebenfalls eine ganzheitliche Analyse, wobei das Ganze in der Biografie des Patienten begründet sei. Dadurch würden die einzelnen „Szenen“ seiner Schilderungen übersummativ zu einer Sinneinheit verschmolzen: „Auch durch diese Technik entsteht als Ganzes eine individuelle Biographie, die die tiefen Schichten der Persönlichkeit in einer Weise berührt, die von den experimentellen Methoden kaum erwartet wird, wie es K.LEWIN (1937) erkannt hat.“ (ebenda, 26) Unterschiede zwischen gestaltpsychologischer und psychoanalytischer Methode stellt Galli im Bereich der interpersonalen Beziehungen und der Sprachanalyse fest. Bei den klassischen gestaltpsychologischen Untersuchungen geht es primär um die sachbezogenen Interaktionen, also um die Beziehungen von Versuchspersonen zu experimentell vorgegebenen Aufgaben. Das interpersonelle Verhältnis zwischen Versuchsperson und Versuchsleiter wurde dabei weitgehend außer Acht gelassen. „In der Psychoanalyse dagegen wird die Beziehung zwischen Arzt und Patient von Anfang an thematisiert. Schon in den ‘Studien über Hysterie’ bemerkt FREUD besondere Arten von Arzt-Patient-Beziehungen, die er als ‘Übertragung’ bezeichnete ...“ (ebenda, 26) Die Analyse der verbalen Äußerungen der Bezugspersonen steht in einem direkten Zusammenhang mit der - theoriebezogenen - Thematisierung oder Ausklammerung der interpersonalen Beziehungen in diversen experimentellen, pädagogischen oder therapeutischen Zusammenhängen: „Wenn wir als Grundkriterien der Sprachanalyse jene des klassischen Organon-Modells von K.BÜHLER (Darstellung, Ausdruck, Appell) benutzen, können wir bemerken, dass in der experimentellen Situation der gestalttheoretischen Untersuchungen fast ausschließlich die Darstellungsfunktion der Sprache der Vp. analysiert wird, während in der klinischen Situation der Psychoanalyse alle drei Funktionen analysiert werden.“ (ebenda, 26) Allerdings wurden in der ersten (kathartischen) Phase der Psychoanalyse nach Galli hauptsächlich die Darstellungs- und Ausdrucksfunktionen analysiert: Wenn Patienten bestimmte Szenen ihrer Vergangenheit beschrieben, sollten sie sich auch an die begleitenden Affekte erinnern um sie abreagieren zu können. Nach der stärkeren Einbeziehung des Theoriekernelements „Übertragung“ wurde auch die Appellfunktion der Sprache stärker thematisiert. Damit wurde auch die ursprüngliche Vergangenheitsorientierung immer mehr zu einer Berücksichtigung der aktuellen Arzt-Patient-Beziehung transformiert und aktuell zur Verhaltensaufklärung und -steuerung benutzt (etwa sensu Lorenzer 1971, 1983). Den wesentlichen Unterschied zwischen psychoanalytischen und gestaltpsychologischen Methoden sieht Galli „in der motivationalen Struktur der experimentellen und der klinischen Situation“ (ebenda, 27) verursacht. „... in der experimentellen Situation kann man den momentanen Zusammenhang zwischen Vl. und Vp. auf dem ’Faktor der Ähnlichkeit’ begründet betrachten (der Vl. als Forscher, sucht in seiner Vp. eine neugierige, seiner eigenen ähnliche Haltung zu erwecken); in der klinischen Situation hingegen scheint der überdauernde Zusammenhang zwischen Arzt und Patient auf dem ‘Faktor des gemeinsamen Schicksals’ begründet (der Patient, als der Heilung suchende Mensch, ist bemüht, sorgfältige Haltung in dem Arzt zu erwecken, um als Partner des psychotherapeutischen Dialogs angenommen zu werden).“ (ebenda, 27) Henle (1984) sieht in Freud zwar einen strikten Assoziationisten „like so many others of his day“ (127), registriert aber einige gestaltpsychologisch interpretierbare Abweichungen von der Assoziationspsychologie. Sie bezieht sich vor allem auf die Traumdeutung, in der Freud Vordergrund (manifesten Trauminhalt) und Hintergrund (latenten Trauminhalt) unterscheidet, wobei der Vordergrund vom Hintergrund abhängig ist, der als eigentliches Zentrum, als Tiefenstruktur das Vordergrundsgeschehen in variabler Weise determiniert: Um die psychologische Aussage eines Traumes zu verstehen, muss es also zum „Kippen“ von bisherigem Vorder- und Hintergrund kommen. Eine - wie uns scheint - auch für die Gestaltpsychologie innovative Sichtweise, die Henle nicht zu bemerken scheint. Henle bezieht sich auf Aussagen Freuds, dass alle Elemente eines Traums - in der Interpretation - zu einer einheitlichen Struktur vereinigt werden müssen, dass mentale Prozesse insgesamt zweckgerichtet sind (und damit indirekt offene, unbefriedigte Bedürfnisstrukturen offenbaren), etc.. Wir sehen Analoges bei der Entstehung von Fehlleistungen: Auch hier sind assozionistische Ähnlichkeiten (z.B. „identische Elemente“) , zeitlich-räumlich kontingente Reizeinwirkungen, Gewohnheitsbildungen, etc. wichtige Determinanten (z.B. Freud GW Bd. 11, 26ff., 54). Doch kommt für Freud in vielen Fällen ein „tieferer“ (semantischer) Sinn dazu (siehe oben Kap. 1.6) - manchmal weitab von Oberflächenähnlichkeiten, indem gegensätzliche Inhalte zum Ausdruck kommen (z.B. eine Sitzung zu beenden statt zu eröffnen). Auch dort, wo identische Elemente der Oberflächenstruktur eine Verwechslung nahelegen (wie auf- statt anzustoßen) gilt: Nicht alle sich anbietenden Verwechslungs-möglichkeiten werden in gleicher Weise zur Produktion von Fehlleistungen benützt. Einige machen „Sinn“, werden von unbewussten (etwa gegengerichteten) Tendenzen „benützt“ um auf eine konflikthafte Tiefenstruktur im aktuellen Prozess hin- zuweisen, etc.. Henle weist zur Bestätigung von Freuds Sinnpostulat im Benützen von Oberflächenähnlichkeiten auf Lewins Experimente hin, die das Ebbinghaussche Gesetz im strengen Sinne falsifizierten: „... syllables failed to call up their asssociates, with which they had been paired during 300 repetitions, when instructions were changed so that subjects were asked merely to read the syllables but not actively try to recall. This finding, Koffka remarks, is ‘not derivable from the law of association as usually formulated’.“ (ebenda, 128) Henle vertritt die Auffassung, dass Freud den Assoziationismus, auf den er sich in seiner Psycho„Analyse“ weitgehend stützt, entschiedener zurückgewiesen hätte, falls er mit den Gestaltgesetzen bzw. kognitions-psychologischem Wissen von heute vertraut gewesen wäre: „Freud could not possibly have known what we know today about the nature of associations ... But since this was not his concern, one wishes that he had stayed with the facts instead of adopting a theory in which, after 1895, he was not really interested.“ (ebenda, 128) Die gestalttheoretisch fundierte Suche nach Prägnanz, der immanente „Ordnungsindex“ menschlichen Erlebens, Denkens und Verhaltens (vgl. Metzger 1941, 1982) scheint ebenfalls von Freud vorweggenommen zu sein. Dazu folgendes Freud-Zitat aus Henle (ebenda, 128): „Man’s observation of the great astronomical regularities not only furnished him with a model for introducing order into his life, but gave him the first points of departure for doing so. Order is a kind of compulsion to repeat whitch, when a regulation has been laid down once and for all, decides when, where and how a thing shall be done, so that in every similar circumstance one is spared hesitation and indecision.“ Waldvogel (1992) arbeitet ein kompensatorisches Verhältnis zwischen psychoanalytischer Objektbeziehungstheorie („innerer Welt“) und der „phänomenalen Welt“ der Gestaltpsychologie heraus: „Für die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie stehen die intrapsychischen Repräsentanzen interpersonaler Beziehungen im Zentrum psychischen Geschehens. Die Objektbeziehungsrepräsentanzen bilden sich aus der Verinnerlichung erlebter oder auch phantasierter Interaktionen. Sie bilden ein inneres Beziehungsgeflecht, die innere Welt.“ (ebenda, 95) „Das erkenntnistheoretische Grundmodell der Gestaltpsychologie beinhaltet ... eine fundamentale Unterscheidung hinsichtlich der Erlebbarkeit, nämlich zwischen phänomenaler und transphänomenaler Welt. Die transphänomenale Welt ist die Welt ‘an sich’, die unabhängig von unserem Erkennen und Erleben gegebene objektive Realität. ... Die phänomenale Welt steht zur transphänomenalen Welt in einem repräsentationalen Verhältnis. Sie ist die Welt der subjektiven Erscheinungen der Realität und wird von der Gestaltpsychologie insofern als eine ‘Funktion der Realität’ angesehen.“ (Waldvogel ebenda, 99) Die phänomenale Welt entspricht somit ziemlich genau dem, was Popper (z.B. 1994) „Welt 2“ genannt hat, die transphänomenale Welt Poppers „Welt 3“. Das Postulat einer transzendentalen Realität „außen“ („Ding an sich“) bzw. „innen“ („transzentendales Ich“) geht auf Kant (1923) zurück, von dem es - wie es Waldvogel zu belegen sucht - Freud übernahm: „Wie Kant uns gewarnt hat, die subjektive Bedingtheit unserer Wahrnehmung nicht zu übersehen und unsere Wahrnehmung nicht für identisch mit dem unerkennbaren Wahrgenommenen zu halten, so mahnt die Psychoanalyse, die Bewusstseinswahrnehmung nicht an die Stelle des unbewussten psychischen Vorganges zu setzen, welcher ihr Objekt ist. Wie das Physische, so braucht auch das Psychische nicht in Wirklichkeit so zu sein, wie es uns erscheint.“ (Freud 1913, zit.n. Waldvogel 1992, 99) Damit ist eine gemeinsame Wurzel angedeutet. Aus der vergleichenden Analyse der Theoriekerne der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie und der phänomenalen Welt der Gestaltpsychologie leitet Waldvogel ab, „dass innere Welt und phänomenale Welt in einem wechselseitigen Repräsentationsverhältnis zueinander stehen. Ebenso wie die phänomenale Welt über die Internalisierung erlebter Objektbeziehungen in der inneren Welt repräsentiert ist, ist die innere Welt über die Organisation des aktuellen Beziehungserlebens in der phänomenalen Welt repräsentiert.“ (ebenda, 12) Sowohl die „innere Welt“ der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie als auch die „phänomenale Welt“ der Gestaltpsychologie sind in Teil- und Ganzheitsrepräsentanten strukturiert. Die Theoriekerne stimmen insoferne überein, als die Persönlichkeitsbildung von primären, in sich unstrukturierten Ganzheiten ausgeht und sich z.B. im Sinne von Metzger (1941) - durch zunehmende Ausdifferenzierung und Wiederzusammenschließung der so aufgegliederten Feinstrukturen zu komplexeren, optimal integrierten Ganzheiten entwickelt. Das diffus-unstrukturierte Ganze entwickelt sich durch Ausgliederung und neuerliche Integration zu einem jeweils besser durchstrukturierten Ganzen, das die innere Welt und die phänomenale Welt als interagierende, einander entsprechende (bis kompensierende) Teilstrukturen enthält. Die innere Welt ist so wenig wie die transphänomenale (äußere) Welt direkt der Erfahrung zugänglich, die phänomenale Welt vermittelt zwischen beiden durch Analogiebildung und Motivation: „Die in der inneren Welt gebildeten mentalen Strukturen identifizieren in der phänomenalen Welt Zeichen ihrer selbst. Die phänomenale Welt wird für die innere Welt zu einer Zeichenwelt. Aktuelle Wahrneh-mungen, die früheren in die ersten Repräsentanzen eingegangenen Wahrnehmungen entsprechen, vermögen diese Repräsentanzen zu aktivieren. Aus dem Entsprechungsverhältnis wird ein Ansprechungsverhältnis.“ (Waldvogel ebenda, 173) Die wissenschaftstheoretisch interessanteste Arbeit zu den vielfältigen Beziehungen von Psychoanalyse und Gestaltpsychologie hat Galli (1997) vorgelegt. Er vergleicht Lewins aus der Gestaltpsychologie entwickelte „Feldtheorie“ mit der Psychoanalyse Freuds. Die wesentliche Aussage dieser Arbeit ist, dass Freuds dialogische Methode in der Praxis vieles von dem funktionszentrierten Ansatz der Feldtheorie bereits enthält, während sein „theoretischer Überbau“ monopersonal orientiert ist, indem vor allem die Transforma-tionsprozesse zwischen den personinternen Instanzen Es-Ich-Überich thematisiert werden, die Einflüsse der aktuellen Reizlage hingegen nur marginal zur Sprache kommen. Entscheidend ist für Galli Lewins (1931) „Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise“, der den - paradigmatisch entscheidenden - Übergang von einem monopersonalen zu einem feldtheoretischen Ansatz sowie von einer wesenszentrierten zu einer funktionszentrierten Erklärungsweise der psychischen Phänomene kennzeichnet, wie er in der modernen Motivationsforschung (vgl. Atkinson 1957, Atkinson & Birch 1970, Astleitner 1992, Astleitner & Herber 1993) durchformalisiert und empirisch verankert worden ist. Lewins Theorie besitzt zweifelsohne relationalen Charakter, doch mangelt es seiner experimentellen Methode an entsprechender Diagnostizität, weil das aktuelle Erleben der Versuchsperson nicht konsequent vom Versuchsleiter thematisiert und erfasst wird und weil die Feldtheorie der experimentellen Situation es - nach Galli (ebenda, 83) - nicht gestattet die Tiefenschichten der Person zu erreichen. Umgekehrt scheint es bei Freud zu sein. Galli versucht dies am Beispiel der „Übertragung“ zu zeigen: „... die Übertragung ist selbst nur ein Stück Wiederholung und die Wiederholung ist die Übertragung der Vergangenheit nicht nur auf den Arzt, sondern auch auf alle anderen Gebiete der gegenwärtigen Situation.“ (Freud 1914, zit.n. Galli ebenda, 87) Der Patient ist - monopersonal - mit den vergangenen Gründen seines gegenwärtigen Handelns beschäftigt - der Therapeut nimmt - in der Theorie - nur die Rolle des neutralen Zuschauers, des „reinen Spiegels“ ein. In der Praxis - das ist schon aus Freuds protokollierten Fällen ersichtlich - sind persönliche Interaktionen unvermeidlich. Dem trug Freud selbst schon mit dem Konzept der „Gegenübertragung“ des Analytikers Rechnung (vgl. oben Kap. 1.4). Seit Ferenczi (1932) und diversen postfreudianischen Richtungen (vgl. z.B. Carson 1969, Kets De Vries 1998) lautet die entscheidende Frage im psychoanalytischen Setting nicht mehr primär: „Warum verhält sich der Patient so, warum sagt er das?“ sondern: „Warum verhält sich der Patient in diesem thematischen Zusammenhang so zum Therapeuten, was will er ihm - und nicht nur sich selbst - sagen?“ Entwicklungen der Psychoanalyse im französischen und italienischen Bereich gehen nach Galli stark in Richtung einer dramaturgischen Konzeption der psychoanalytischen Therapie, in der „Therapeut und Patient so eng miteinander verbunden sind, dass sie als ein komplementäres Paar betrachtet werden können. Um dieses Paar als eine Gestalt zu beschreiben, scheint ihnen das Feldmodell das geeignetste zu sein.“ (Galli ebenda, 83) 3.3 Psychoanalyse - Kognitive Psychologie Nach Claxton (1997) und Rosenfield (2000) besteht Freuds wesentlicher Beitrag zur Kognitionswissenschaft in seinem Bestreben, „die Mechanismen zu finden, die der menschlichen Fähigkeit zum Lügen, Täuschen und Bluffen zu Grunde liegen. ... Nach Freud bluffen, belügen und täuschen wir uns und andere ständig. Sein Hauptinteresse ... galt der Bedeutung von Selbsttäuschungen in der alltäglichen Psychologie.“ (Rosenfield 2000, 168) Ein wesentliches Element des Theoriekerns der Psychoanalyse ist das Postulat des Unbewussten (siehe oben Kap. 1.1). Es enthält die Annahme, dass unsere „wirklichen“ Kognitionen, Emotionen und Motivationen sich nicht exakt in dem spiegeln, was wir bewusst erleben, fühlen, denken, erinnern oder sprachlich äußern (z.B. Freud 1891, 36, 79, 83, Freud & Breuer 1970, vgl. auch Borck 1998, 66ff.) . Damit hat er wesentliche Ergebnisse der kognitionspsychologischen Forschung vorweggenommen, z.B. das theoretische und methodologische Problem der Übereinstimmung von sprachlicher Äußerung und entsprechenden internen Prozessen, was in der Gestaltpsychologie noch nicht als Problem thematisiert wurde - etwa bei der Verwendung des „lauten Denkens“ als experimenteller Methode (vgl. Herber 2000, 86). Freuds Konzept des Unbewussten enthält aber nicht nur vorbewusste Prozesse, sondern auch „verdrängte“, vom Bewusstseinsstrom in pathologischer Weise abgespaltene Inhalte (siehe oben Fußnote 1). Daran lag und liegt das Hauptinteresse der Psychoanalyse: „Freud ... und seine Jünger füllten das Lagerhaus des Unbewussten mit verleugneten, verdrängten Aspekten der Persönlichkeit und zeigten auf, wie diese verstoßenen Kinder des Geistes zurückkehren, um uns auf bizarre und furchterregende Weise heimzusuchen. ... Freud hat uns eine Version des Unbewussten zurückgegeben ... eine, die sich ganz und gar auf die Kosten eines ‘taktischen Nicht-zur-Kenntnis-Nehmens’ konzentrierte... Indem er das Unbewusste so definierte, wie er es tat, stellte er es als Gegenspieler zu mentaler Gesundheit dar, als einen Behälter wilder Kräfte, die nur gebändigt und in die Persönlichkeit integriert werden konnten, wenn man sie ans Licht des Bewußtseins holte.“ (Claxton 1997, 212f.) Darüber hinaus - so scheint es auf Erste - hat Freud wenig über die Prozesse des (bewussten) Denkens zu sagen, auch wenn es interessante Rekonstruktionsversuche im Sinne des kognitionspsychologischen Paradigmas gibt (z.B. Henle 1984, Erdelyi 1985, Wegman 1985). Doch - wie Wachtel (1977) zu Recht aufzeigt - ist Freud grundsätzlich dem assoziationistischen Denken verpflichtet (siehe auch oben Kap. 1.7). Denken besteht darin Assoziationen zwischen verschiedenen zueinander passenden, räumlich-zeitlich kontingenten Vorstellungen herzustellen bzw. wiederzubeleben (also Neuronenverbindungen zu bahnen bzw. zu aktualisieren, vgl. Freud 1962). Auch im kreativen Denken wird nach Freud nichts wirklich „Neues“ erzeugt, es werden nur - quasi über identische Elemente (wie Phonem- und Morphemgleichheiten) - Vorstellungen miteinander verbunden, die einander sonst fremd sind (semantisch unterschiedliche Bedeutung haben, wie bei den Wörtern an- bzw. aufstoßen, etc., vgl. Freud GW Bd. 11, 25ff.). Allerdings kann ein verborgener Sinn (Wunsch), eine bisher nicht beachtete Vorstellung oder Semantik so eine - durch assoziative Ähnlichkeit erleichterte Fehlleistung herbeiführen. In Richtung kognitiv-konstruktive Tätigkeit weisen allerdings durch semantischen Gegensatz bewirkte Fehlleistungen (z.B. wenn ein Vorsitzender die Sitzung für „beendet“ erklärt, statt sie zu „eröffnen“). Denken wird also sowohl durch Reizähnlichkeit, räumlich-zeitliche Kontingenz wie kognitiv-inhaltlich Konstruktion von Vorstellungen, im Grunde aber durch unbewusste (emotional bedeutsame) Assoziationen vorbereitet, in bestimmte Bahnen gelenkt (z.B. Freud GW Bd. 11, passim). Erdelyi (1985) arbeitet Parallelen zwischen Psychoanalyse und Kognitionspsychologie in Konfrontation mit dem behavioristischen Paradigma heraus. Während der Behaviorismus durch eine „Finger-und-Daumen-Metaphysik“ (Revers 1962, 44) gekennzeichnet werden kann, also an einer an palpablen Oberflächenmerkmalen, „öffentlich beobachtbaren“ Reizen und Verhaltensweisen orientierten Methodologie (mit einem entsprechenden Theoriekern als Voraussetzung), sind psychische Phänomene in der Psychoanalyse wie in der Kognitiven Psychologie vielschichtig, semantisch tiefenstrukturiert. Die Psychoanalyse ist nicht an den einfach wahrnehm- oder erinnerbaren manifesten Merkmalen interessiert, sondern an deren latenten Verknüpfungen, an derem „tieferen Sinn“ (der sematischen Tiefenstruktur). Bewusstseinsphänomene spielen ebenfalls eine theoretisch und methodologisch völlig unterschiedliche Rolle im Behaviorismus einerseits, in Psychoanalyse und Kognitionspsychologie andererseits, analog verhält es sich mit dem Konstrukt „Unbewusstes“, das auch im kognitionspsychologischen Zusammenhang mehr und mehr an Bedeutung gewinnt (z.B. Perrig et al. 1993, Claxton 1997, Varela 2000): „Behaviorism excluded consciousness from its purview; psychoanalysis made consciousness its therapeutic goal. Unconscious processes played no role in classic behaviorism; unconscious processes were the ‘fundamental premise’ of psychoanalysis.“ (Erdelyi 1985, ix) Die Kognitive Psychologie - im Wesentlichen genährt von der generativen Linguistik (z.B. Chomsky 1957, vgl. auch Pinker 1998a) und der Informationstheorie (z.B. Shannon 1948, Sanders 1971, Dörner 1979, 1999, Simon 1979, Seidler 1997, Maar et al. 2000) - teilt mit der Psychoanalyse einige grundlegende Annahmen, z.B. die von semantischen Tiefenstrukturen: Die Analyse von Träumen (z.B. Freud GW Bd. 11, 79ff. Freud 1961) geht davon aus, dass manifeste Trauminhalte Oberflächenphänomene darstellen, entstanden durch die sogenannte Traumarbeit, in der tiefere sematische Strukturen, die vom Zensor wegen ihres peinlichen Inhalts nicht akzeptiert werden können, in transformierter, verdichteter Form zum Ausdruck kommen. Freud bringt dies in Flussdiagrammen der Informatonsverarbeitung zum Ausdruck (Freud 1961, 438ff.), stellt hinsichtlich der Verdichtungsmechanismen formale Analogien zu Bilderschriften und zu manchen semitischen Schriften her (GW Bd. 11, 236ff.), etc.. Diese Ausführungen sind - wenn auch nicht so systematisch angelegt - in mancher Hinsicht nicht so weit von dem entfernt, was moderne formale Theorien der informationstheoretischen „data compression“ zum Inhalt haben (vgl. z.B. Seidler 1997). Schon in den Studien über Hysterie (Freud & Breuer 1970) werden psychologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen enaktiv-motorischer („Körpersprache“), bildlicher (ikonischer) und verbaler Darstellungsweise diskutiert (vgl. entsprechende „Erinnerungsspuren“ in Bruner 1966, 1990). Fragen der Organisation und Struktur des Gedächtnisses, verschiedener Gedächtnisarten (Konversionen als Ausdruck des Körpergedächtnisses, Bildgedächtnis, implizites und explizites Gedächtnis, etc. in moderner Lesart, z.B. Perrig et al. 1993, Hoffmann 1993, Mecklenbräuker et al. 1998, Perner 1998, 2000, Meier 1999, Pöppel 2000), multiple Anbahnungen der Wiederaktivierung von direkt nicht zugänglichen Gedächtnisinhalten, Mehrspeichersysteme, semantische (denotative) vs. pragmatische (konnotative) Entstehung und Auflösungsmöglichkeiten von Mehrdeutigkeiten (vgl. z.B. Wessels 1984, 311ff., Pinker 1998b, 179ff., Dörner 1999), Fragen der Aufmerksamkeitskonzentration und -verschiebung, der Selektivität der Wahrnehmung, Kapazitätsgrenzen der Informationsverarbeitung und -speicherung werden immer wieder diskutiert, vgl. im Besonderen: „Entwurf einer Psychologie“ (Freud 1962), „Die Traumdeutung“ (Freud 1961), „Zur Psychopathologie des Alltagslebens“ (Freud 1954), „Studien über Hysterie“ (Freud & Breuer 1970) sowie „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ (Freud 1958). Aus diesem Grund ist nach Erdelyi (1985, xi) die Annäherung von Kognitiver Psychologie und Psychoanalyse „vorprogrammiert“: „... the shift of focus toward increasingly complex stimuli (pictures, sentences, narrative texts), the trend of the modern cognitive psychology has been toward rather than away from psychoanalysis’ center of gravity. Some of the signs: the semantization of psycholinquistics; the attendant emphasis of deep semantic contents (‘information processing between the lines’, ‘pragmatics’) and , therefore, upon the unavoidability of interpretation; the triumph of constructivism; the contextualization of cognition; the formal incorporation, through mathematical decision theory, of motivation in the conception of perceptual and memory reports; the ... interest in metaphor; and, not the least, the immense new research interest in unconscious processes.“ Vergleicht man die Inhalte rezenter Buchpublikationen zur Kognitiven Psychologie - insbesondere die komplexen Zusammenhänge von „top down“- und „bottom up“-Prozessen der Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Speicherung, etc., ist dieser Prognose Recht zu geben (vgl. z.B. Klix 1992, Astleitner 1992, 1997, Perrig et al. 1993, Mangold-Allwin 1993, Eysenck 1994, Holyoak & Thagard 1995, Anderson 1996, Hofstadter 1996, Claxton 1997, Pinker 1998a, Dörner 1999, Maar et al. 2000). 4. Zusammenfassung In Freuds Psychoanalyse sind viele Annahmen des Behaviorismus, der Gestaltpsychologie und der Kognitiven Psychologie enthalten - noch relativ wenig elaboriert, differenziert, definitorisch geklärt oder „ausgegliedert“ (um einen zentralen Ausdruck der gestaltpsychologischen Entwicklungstheorie zu verwenden). Der entscheidende Unterschied zu den drei anderen Paradigmen besteht in der Annahme eines „Unbewussten“, das auf Erleben und Verhalten einwirkt, ohne dass es dem Bewusstsein zugänglich ist, weil ein Widerstand dagegen besteht gewisse schmerzliche Assoziationen zu reaktivieren. Heftige Emotionen begleiten den (therapeutischen) Versuch diese verdrängten Inhalte bewusst zu machen. Experimentelle Nachweise für die Existenz und Wirksamkeit verdrängter, abgespaltener psychischer Prozesse liegen vor (z.B. Silverman 1983, Sincoff 1992, Gitzinger-Albrecht 1993, Derakshan & Eysenck 1997, 1999). Der Begriff „Unbewusstes“ umfasst allerdings nicht nur Verdrängtes, Abgespaltenes, sondern auch das „Vorbewusste“, das sind alle Vorgänge im Organismus (bzw. deren Repräsentanz im ZNS), die als Basis aller Lebensvorgänge grundsätzlich bewusstseinsfähig sind, aber nicht im situationsbezogenen Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Das Bewusstsein selbst ist nur die „Spitze eines Eisberges“ aller psychischen Prozesse. Das entspricht durchaus moderner neurowissenschaftlicher und kognitionspychologischer Forschung (z.B. Pöppel 1987, 165ff., 2000, Pinker 1998b, 171ff., Varela 2000, Rosenfield 2000). Freud hat in seinem umfangreichen Werk zu vielen Konzepten der Psychologie Aussagen gemacht (zum Wahrnehmen, Denken, Erinnern, Fühlen, Wollen, etc.). Im Grunde steht er auf derselben theoretischen Basis wie der Behaviorismus, indem er von elementaren Sinnesdaten und deren Erinnerungsspuren ausgeht. Allerdings nimmt er im (komplexen) Verarbeitungsprozess gestaltpsychologische und kognitionspsychologische Konzepte vorweg - meist in undefinierter, theoretisch nicht elaborierter Form. Sein Hauptinteresse galt den Fehlleistungen der psychischen Funktionen, nicht primär deren normalem Funktionsablauf. Nachfolger Freuds haben sich zunehmend den „Ichfunktionen“ und damit den bewussten bzw. bewusstseinfähigen psychischen Prozessen als Basis des phänomenalen Erlebens zugewandt (z.B. Hartmann 1972, Kernberg 1997). In heuristischer Hinsicht kann die Psychoanalyse immer noch zur Theorienentwicklung im sozialwissenschaftlichen, insbesondere im psychologischen und pädagogischen Bereich beitragen. Formalisierungen von Teilbereichen des Theoriekerns liegen ansatzweise vor (z.B. Moser et al. 1968, Wegman 1985), doch fehlt noch eine umfassende Systematisierung der theoretischen Kernannahmen samt entsprechender Methodologie. Fruchtbare Weiterentwicklungen einzelner psychoanalytischer Theoreme sind vor allem in der Gestaltpsychologie, Lewins Feldtheorie und in der modernen Motivationsforschung festzustellen. Literaturverzeichnis Aichhorn, A. (1925). Verwahrloste Jugend. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag Anderson, J.R. (1985). The architecture of cognition. Cambridge: Harvard University Press Anderson, J.R. (1996). Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag (amerikanische Originalausgabe 1995) Argelander, H. (1979). Die kognitive Organisation psychischen Geschehens. Ein Versuch zur Systematisierung der kognitiven Organisation in der Psychoanalyse. Stuttgart: Klett-Cotta Astleitner, H. (1992). Motivations-Modellierung. Spezifikation einer Simulation im Rahmen MotivationalAdaptiver Lehr-Lern-Interaktion. Münster: Waxmann Astleitner, H. & Herber, H.-J. (1993). Rechnersimulation von Auswirkungen unterschiedlicher Erfolgswahrscheinlichkeiten auf motivationale Prozesse. grkg Humankybernetik, 78-88 Astleitner, H. (1997). Lernen in Informationsnetzen. Frankfurt: Lang Atkinson, J.W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological Review 64, 359-372 Atkinson, J.W. & Birch, D. (1970). The dynamics of action. New York: Wiley Atkinson, J.W. & Lens, W. (1980). Fähigkeit und Motivation als Determinanten momentaner und kumulativer Leistung. In Heckhausen, H. (Hg.), Fähigkeiten und Motivation in erwartungswidriger Schulleistung. Göttingen: Hogrefe, 129-192 Atkinson, J.W. (1982). Motivational determinants of thematic apperception. In Stewart, A.J. (Ed.), Motivation and society. San Francisco: Jossey-Bass, 3-40 Atkinson, J.W. & Birch, D. (1986). Fundamentals of the dynamics of action. In Kuhl, J. & Atkinson, J.W. (Eds.), Motivation, thought, and action. New York: Praeger, 16-48 Bandura, A. (1969). Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehardt & Winston Bandura, A. (1976). Lernen am Modell. Stuttgart: Klett-Cotta Baumeister, R.F. & Cairns, K.K. (1992). Repression and self -presentation: When audiences interfere with selfdeceptive strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 851-862 Beck, J.S. (1999). Praxis der Kognitiven Therapie. Weinheim: Psychologie Verlags Union Bernfeld, S. (1934). Die Gestalttheorie. Imago, 20, 32-77 Blakeslee, T.R. (1996). Beyond the conscious mind. New York: Plenum Press Blankenship, V. (1986). Substitution in achievement behavior. In Kuhl, J. & Atkinson, J.W. (Eds.), Motivation, thought, and action. New York: Praeger, 186-202 Blatt, S.J. & Lerner, H. (1983). Investigations in the psychoanalytic theory of object relations and object representations. In Masling, J. (Ed.), Empirical studies of psychoanalytic theories. Hillsdale: Erlbaum, 189-249 Bollas, C. (2000). Genese der Persönlichkeit. Psychoanalyse und Selbsterfahrung. Stuttgart: Klett-Cotta Borck, C. (1998). Visualizing nerve cells and psychical mechanism. In Guttmann, G. & Scholz-Strasser, I. (Eds.), Freud and the neurosciences. From Brain Research to the Unconscious. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 57-86 Brody, N. (1986). Conscious and unconscious processes in the psychology of motivation. In Brown, D.R. & Veroff, J. (Eds.), Frontiers of motivational psychology. Berlin: Springer, 40-53 Bruner, J.S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge: Harvard University Press Bruner, J.S. (1990). Das Unbekannte denken. Stuttgart: Klett-Cotta Bunge, M. (1983). Epistemologie. Mannheim: Bibliographisches Institut Bunge, M. & Ardila, R. (1987). Philosophy of psychology. New York: Springer Bunge, M. (1992/93). Eine Kritik der Grundlagen der Theorie der rationalen Wahl. Zeitschrift für Wissenschaftsforschung, 7/8, 19-33 Carson, R.C. (1969). Interaction concepts of personality. Chicago: Aldine Publishing Company Caruso, I.A. (1983). Die Trennung der Liebenden. Eine Phänomenologie des Todes. Frankfurt: Fischer Cattell, R.B. (1985). Human motivation and the dynamic calculus. New York: Praeger Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague: Mouton Churchland, P.S. (1986). Neurophilosophy. Toward a unified science of the mind-brain. Cambridge: MIT Press Claxton, G. (1997). Die Macht der Selbsttäuschung. München: Piper Collins, A.M. & Quillian, M.R. (1969). Retrieval time from semantic memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 8, 240-247 Coombs, C.H. (1986). Psychology and mathematics. An essay on theory. Ann Arbor: The University of Michigan Press Davis, P.J. (1988). Physiological and subjective effects of catharsis: A case report. Cognition and Emotion, 2, 19-28 DeCharms, R. (1982). That’s not psychology! The implications of McClelland’s approach to motivation. In Stewart, A.J. (Ed.), Motivation and society. San Francisco: Jossey-Bass, 41-62 Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum Derakshan, N. & Eysenck, M.W. (1997). Interpretative biases for one’s own behaviour and physiology in high trait-anxious individuals and repressors. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 816-825 Derakshan, N. & Eysenck, M.W. (1999). Are repressors self-deceivers or other-deceivers? Cognition & Emotion, 13, 1-17 Dörner, D. (1979). Problemlösen als Informationsverarbeitung. Stuttgart: Kohlhammer Dörner, D. (1999). Bauplan für eine Seele. Reinbek: Rowohlt Dubs, R. (1995). Lehrerverhalten. Zürich: Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes Duncker, K. (1963). Zur Psychologie des produktiven Denkens. Berlin: Springer (Erstdruck 1935) Elhardt, S. (1990). Tiefenpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer Erdelyi, M.H. (1985). Psychoanalysis: Freud’s cognitive psychology. New York: Freeman Eysenck, H.J. & Wilson, G.D. (Hg.) (1973). Experimentelle Studien zur Psychoanalyse Sigmund Freuds. Wien: Europa Verlag Ferenczi, S. (1932). Ohne Sympathie keine Heilung. Das klinische Tagebuch von 1932. Frankfurt: Fischer Fleming, J. (1982). Projective and psychometric approaches to measurement: The case of fear of success. In Stewart, A.J. (Ed.), Motivation and society. San Francisco: Jossey-Bass, 63-96 Foulkes, D. & Sullivan, B. (1988). Appropriateness of dream feelings to dreamed situations. Cognition & Emotion, 2, 29-39 Freud, A. (1975). Das Ich und die Abwehrmechanismen. München: Kindler (Erstdruck 1936) Freud, S. (1891). Zur Auffassung der Aphasien. Leipzig: Deuticke Freud, S. (1944). Gesammelte Werke. Frankfurt: Fischer Freud, S. (1954). Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Frankfurt: Fischer Freud, S. (1958). Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Frankfurt: Fischer Freud, S. (1961). Die Traumdeutung. Frankfurt: Fischer Freud, S. (1962). Entwurf einer Psychologie. In Freud, S., Aus den Anfängen der Psychoanalyse. Frankfurt: Fischer, 299-384 Freud, S. (1970). Zur Psychotherapie der Hysterie. In Freud, S. & Breuer, J. (Hg.). Studien über Hysterie. Frankfurt: Fischer, 204-246 Freud, S. & Breuer, J. (1970). Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene. In Freud, S. & Breuer, J. (Hg.). Studien über Hysterie. Frankfurt: Fischer, 204-246 Freud, S. & Breuer, J. (1970) (Hg.). Studien über Hysterie. Frankfurt: Fischer, 7-19 Galli, G. (1983). Psychoanalyse und Gestalttheorie. Zwei Methoden im Vergleich. Gestalt Theory, 23-29 Galli, G. (1997). Beziehungen zwischen Lewins wissenschaftstheoretischen Begriffen und der Psychoanalyse. Gestalt Theory, 19, 80-89 Galperin, P.J. (1972). Die geistige Handlung als Grundlage für die Bildung von Gedanken und Vorstellungen. In Galperin, P.J. & Leontjew, A.N. (Hg.), Probleme der Lerntheorie. Berlin: Volk und Wissen, 33-49 Gentner, D. (1989). The mechanisms of analogical learning. In Vosniadou, S. & Ortony, A. (Eds.), Similarity and analogical reasoning. Cambridge: University Press, 199-241 Gitzinger-Albrecht, I. (1993). Mehrebenendiagnostik von Abwehrprozessen als eine Strategie der Psychotherapieforschung. Frankfurt: Lang Goldberg, A. (1982). The self of psychoanalysis. In Lee, B. & Smith, K. (Eds.), Psychosocial theories of the self. New York: Plenum, 3-22 Goldstein, K. (1934). Der Aufbau des Organismus. Den Haag: Nighoff Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe Greenfield, S.A. (1999). Reiseführer Gehirn. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag Guttmann, G. (1998). From the sum of excitation to the cortical DC potential. Looking back a hundred years. In Guttmann, G. & Scholz-Strasser, I. (Eds.). Freud and the neurosciences. From Brain Research to the Unconscious. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 23-35 Guttmann, G. & Scholz-Strasser, I. (Eds.) (1998). Freud and the neurosciences. From Brain Research to the Unconscious. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Hartmann, H. (1972). Ich-Psychologie. Stuttgart: Klett Heckhausen, H. (1963). Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation. Meisenheim: Hain Heller, S. (1999). Die zwischenmenschliche Beziehung in den theoretischen Konzepten von Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und systemischen Therapien. Salzburg: Unveröff. Dissertation Helson, H. (1964). Adaption-level theory. New York: Harper & Row Henle, M. (1984). Freud’s secret cognitive theories. In Royce, J.R. & Mos, L.P. (Eds.), Annals of theoretical psychology. Vol.1. New York: Plenum Press, 111-134 Herber, H.-J. (1972). Die Bedeutung der Leistungsmotivation für die Selbstverwirklichung. Eine phänomenologische Analyse des operationalen Konzepts der Leistungsmotivation. Salzburg: Unveröff. Dissertation Herber, H.-J. (1977). Motivationsdiagnostik im klinischen Bereich: Vorläufige Thesen zur Kriterienfindung und Definition des hypothetischen Konstrukts „Motivation“. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 25, 302-313 Herber, H.-J. (1979). Motivationstheorie und pädagogische Praxis. Stuttgart: Kohlhammer Herber, H.-J. & Vásárhelyi, É. (1993). Analogiebildung (ein analogisierender Intergrationsversuch im Überblick). Papier zur Tagung österreichischer und ungarischer Mathematikdidaktiker in Nyíregyháza, 1-17 Herber, H.-J. (1996a). Kritisch-rationale Erziehungswissenschaft. In: Hierdeis, H. & Hug, T. (Hg.), Taschenbuch der Pädagogik. Bd. 2. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 418-427 Herber, H.-J. (1996b). Grüne Erfahrung und graue Theorie. Wie kann Fremdes zu Eigenem werden? In Schratz, M. & Thonhauser, J. (Hg.), Arbeit mit pädagogischen Fallgeschichten. Innsbruck: StudienVerlag, 91-122 Herber, H.-J., Astleitner, H., Vásárhelyi, É. & Parisot, K.J. (1996). Versuch der (Re-) Konstruktion mathematisch-didaktischer Analogiebildung durch Anwendung systemisch-metatheoretischer und lernpsychologischobjekttheoretischer Kriterien. Salzburg: Institut für Erziehungswissenschaften (Papier zur theoretischen Grundlegung des Projektes ”Analogien im Mathematikunterricht”) Herber, H.-J., Vásárhelyi, É., Astleitner, H. & Parisot, K.J. (1997). Analogisierende versus sequentielle Instruktion, situativ geänderte Aufgabenschwierigkeiten und Mathematikleistungen. In Parisot, K.J. & Vásárhelyi, É. (Hg.), Integrativer Unterricht in Mathematik. Salzburg: Abakus, 25-40 Herber, H.-J. (1998a). Motivationsanalyse. Führungsprobleme aus psychologischer Sicht. Renningen-Malmsheim: expert verlag. Wien: Linde Verlag Herber, H.-J. (1998b). Innere Differenzierung. Pädagogisches Handeln, 2, 69-82 Herber, H.-J. (1998c). Theorien und Modelle der Pädagogik, Psychologie und pädagogischen Psychologie - Annäherungsmöglichkeiten an ein komplexes Beziehungsproblem. Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, 2, 41-101 Herber, H.-J. (1998d). Das Unterrichtsmodell ”Innere Differenzierung”. Die Bedeutung von Analogiebildungsund Motivationsprozessen. In: Lenz, W. (Hg.), Bildungswege. Von der Schule zur Weiterbildung. Innsbruck: STUDIENVerlag Herber, H.-J., Astleitner, H. & Faulhammer, E. (1999). Musikunterricht und Leistungsmotivation. Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, 3, 41-67 Herber, H.-J. (2000). Behaviorismus, Gestaltpsychologie und Kognitive Psychologie im Vergleich. Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, 4, 80-95 Hermann, I. (1922). Ordnungssinn und Gestaltwerden im Zusammenhang mit der Sittlichkeit. Zeitschrift für angewandte Psychologie 20, 391-401 Hey, G. (1978). Psychoanalyse des Lernens. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwan Hobisch, G. & Schulter, G. (1985). Unbewusste Reizwahrnehmung und Modelle der Informationsverarbeitung. Graz: Bericht 1 aus dem Institut für Psychologie der Karl-Franzens-Universität Graz Hoffmann, J. (1993). Unbewußtes Lernen - eine besondere Lernform? Psychologische Rundschau, 44, 75-89 Hofmann, F. (2000). Schülerinnen und Schüler beim Aufbau von Lernkompetenz fördern. Von vermeintlichen zu begründeten Wegen zur Lösung eines wichtigen pädagogischen Anliegens. Innsbruck: STUDIENVerlag Hofstadter, D.R. (1996): Die FARGonauten. Über Analogie und Kreativität. Stuttgart: Klett-Cotta Holzkamp-Osterkamp, U. (1976). Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung. Bd. 2. Frankfurt: Campus Holyoak, K.J. & Thagard, P. (1995). Mental leaps. Analogy in creative thought. Cambridge: MIT Press Hull, C.L. (1943). Principles of behavior. New York: Appleton-Century-Crofts Juul, K. (1990). Comparing psychodynamic and behavioristic approaches in the management of aggression in children. ERIC Document Reproduction Service Nr. ED 326 023 Kant, I. (1923). Kritik der reinen Vernunft. Berlin: Cassirer Katz, D. & Katz, R. (Hg.) (1959). Kleines Handbuch der Psychologie. Basel: Schwabe Kernberg, O.F. (1997). Innere Welt und äußere Realität. Stuttgart: Verlag Internationale Psychoanalyse Kets De Vries, M.F.R. (1998). Führer, Narren und Hochstapler. Stuttgart: Verlag Internationale Psychoanalyse Klix, F. (1992). Die Natur des Verstandes. Göttingen: Hogrefe Klix, F. (1993). Erwachendes Denken. Geistige Leistungen aus evolutionspsychologischer Sicht. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag Köhler, W. (1971). Obsessions of normal people. In Henle, M. (Ed.), Selected papers of Wolfgang Köhler. New York: Liveright, 398-412 Koffka, K. (1935). Principles of Gestalt psychology. New York: Harcourt Brace Kohut, H. (1981). Die Heilung des Selbst. Frankfurt: Suhrkamp Kuhl, J. & Blankenship, V. (1986). The dynamic theory of achievement motivation: From episodic to dynamic thinking. In Kuhl, J. & Atkinson, J.W. (Eds.), Motivation, thought, and action. New York: Praeger, 141-158 Kuhlen, V. (1973). Verhaltenstherapie im Kindesalter. München: Juventa LeDoux, J. (1998). Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen? München: Hanser Lewin, K. (1935). A dynamic theory of personality. New York: McGraw-Hill Lewin, K. (1963). Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern: Huber Lichtenberg, J.D. (1989). Psychoanalysis and motivation. Hillsdale: The Analytic Press Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M. & Fosshage, J.L. (1992). Self and motivational systems. Toward a theory of psychoanalytic technique. Hillsdale: The Analytic Press Lorenzer, A. (1971). Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Frankfurt: Suhrkamp Luchins, A.S. & Luchins, E.H. (1997). A sampling of Gestalt psychologists’ remarks on psychoanalysis. Gestalt Theory, 19, 129-139 Lukesch, H. (1998). Lehren unter Berücksichtigung von Metakognition und Visualisierung am Beispiel der Technik der Begriffslandschaften („concept maps“). In Popp, S. (Hg.), Grundrisse einer humanen Schule. Festschrift für Rupert Vierlinger. Innsbruck: STUDIENVerlag, 121-141 Maar, C. (2000). Envisioning knowledge - Die Wissensgesellschaft von morgen. In Maar, C., Obrist, H.U. & Pöppel, E. (Hg.), Weltwissen, Wissenswelt. Köln: DuMont, 11-19 Majewski, R. (1994). Über die Rolle der Wissenrepräsentation in einem Analogien bildenden System. Aachen: Mainz Mahoney, M. (1974). Cognition and behavior modification. Cambridge: Ballinger Masling, J. (Ed.) (1983). Empirical studies of psychoanalytical theories. Vol. 1. Hillsdale: Erlbaum Masling, J. (Ed.) (1986). Empirical studies of psychoanalytical theories. Vol. 2. Hillsdale: Erlbaum Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper Maturana, H.R. (1985). Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig: Vieweg Maturana, H.K. & Varela, F.J. (1987). Der Baum der Erkenntnis. Bern: Scherz McAdams, D.P. (1982). Intimacy motivation. In Stewart, A.J. (Ed.), Motivation and society. San Francisco: Jossey-Bass, 133-171 McClelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A. & Lowell, E.L. (1953). The achievement motive. New York: Appleton-Century-Crofts McClelland, D.C. (1966). Die Leistungsgesellschaft. Stuttgart: Kohlhammer McClelland, D.C., Koestner, R. & Weinberger, J. (1989). How do self-attributed and implicit motives differ? In Halisch, F. & Van den Bercken, J.H.L. (Eds.), International perspectives on achievement and task motivation. Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 259-289 McClelland, D.C. (1995). Human motivation. Cambridge: University Press. Mecklenbräuker, S., Wippich, W. & Schulz, I. (1998). Implizites Gedächtnis bei Kindern: Keine Altersunterschiede bei Bilderrätseln. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 30, 13-19 Meichenbaum, D.H. (1979). Kognitive Verhaltensmodifikation. München: Urban & Schwarzenberg Meier, B. (1999). Differentielle Gedächtniseffekte. Implizite und expliziete Erfahrungsnachwirkungen aus experimenteller und psychometrischer Perspektive. Münster: Waxmann Mertens, W. (1990). Einführung in die psychoanalytische Therapie. Bd. 1. Stuttgart: Kohlhammer Metzger, W. (1941). Psychologie. Die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung des Experiments. Dresden: Steinkopff Metzger, W. (1982). Möglichkeiten der Verallgemeinerung des Prägnanzprinzips. Gestalt Theory, 4, 3-22 Miedl, A. (2000). Psychoanalytische Pädagogik und Schulunterricht. Salzburg: Unveröff. Diplomarbeit Mischel, W. (1968). Personality and assessment. New York: Wiley Moser, U., Zeppelin, v.I. & Schneider, W. (1968). Computer Simulation eines Modells neurotischer Abwehrmechanismen: Versuch zur Formalisierung der psychoanalytischen Theorie. Bulletin des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, 2 Moser, U., Zeppelin, v.I. & Schneider, W. (1981). Wunsch, Selbst, Objektbeziehung: Entwurf eines Regulierungsmodells kognitiv-affektiver Prozesse. Berichte aus der Interdisziplinären Konfliktforschungsstelle der Universität Zürich Nr. 9 Muck, M. (1980). Psychoanalyse und Schule. Grundlagen, Situationen, Lösungen. Stuttgart: Klett Mummendey, A. & Simon, B. (1997). Identität und Verschiedenheit. Bern: Huber Newell, A. & Simon, H.A. (1972). Human problem solving. New Jersey: Prentice Hall Newton, T.L. & Contrada, R.J. (1992). Repressive coping and verbal-autonomic response dissociation: The influence of social context. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 159-167 Patry, J.-L. (1991). Transsituationale Konsistenz des Verhaltens und Handelns in der Erziehung. Bern: Lang Perner, J. (1998). The meta-intentional nature of executive functions and theory of mind. In Carruthers, P. & Boucher, J. (Eds.), Language and thought. Cambridge: University Press, 270-283 Perner, J. (2000). Memory and theory of mind. In Tulving, E. & Craik, F.I.M. (Eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York: University of Oxford Press, 297-312 Perrez, M. (1972). Ist die Psychoanalyse eine Wissenschaft? Bern: Huber Perrez, M. (1985). Die Persönlichkeitstheorie von S. Freud. In Herrmann, T. & Lantermann, E.-D. (Hg.), Persönlichkeitspsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen. München: Urban & Schwarzenberg Perrig, W.J., Wippich, W. & Perrig-Chiello, P. (1993). Unbewußte Informationsverarbeitung. Bern: Huber Phares, E.J. (1976). Locus of control. New York: Macmillan Pines, M. (1998). Neurological models and psychoanalysis. In Guttmann, G. & Scholz-Strasser, I. (Eds.), Freud and the neurosciences. From Brain Research to the Unconscious. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 47-55 Pinker, S. (1998a). Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet. München: Knaur Pinker, S. (1998b). Wie das Denken im Kopf entsteht. München: Kindler Pöppel, E. (1987). Grenzen des Bewußtseins. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt Pöppel, E. (1993). Lust und Schmerz: Vom Ursprung der Welt im Gehirn. Berlin: Siedler Pöppel, E., Bullinger, M. & Härtel, U. (1994). Medizinische Psychologie und Soziologie. London: Chapman & Hall Pöppel, E. (2000). Drei Welten des Wissens – Koordinaten einer Wissenswelt. In Maar, C., Obrist, H.U. & Pöppel, E. (Hg.), Weltwissen, Wissenswelt. Köln: DuMont, 21-39 Popper, K.R. (1974). Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hamburg: Hoffmann und Campe Popper, K.R. (1976). Logik der Forschung. Tübingen: Mohr (Erstausgabe: 1934) Popper, K.R. (1994). Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik. München: Piper Rath, I. (1995). Ich-System, Ich-Zustände und Ich-Rollen. JTTA, 1, 43-62 Rath, I. (1996). Transaktionaler Austausch und Lernen. JTTA, 2, 3-30 Rath, I. (1998). Ziel des Lernens und Lehrens: Selbstbestimmte Menschen, Funktionalisten oder virtuelle Autisten. In Herber, H.-J. & Hofmann, F. (Hg.), Schulpädagogik und Lehrerbildung. Innsbruck: STUDIENVerlag, 63-82 Revers, W.J. (1962). Ideologische Horizonte der Psychologie. München: Pustet Riedl, R. (1980). Biologie der Erkenntnis. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft. Berlin: Parey Riedl, R. (1984). Die Spaltung des Weltbildes. Die biologischen Grundlagen des Erklärens und Verstehens. Berlin: Parey Rosenfield, I. (2000). Wissen als Interaktion - Beiträge aus der Hirnforschung und Computerwissenschaft. In Maar, C., Obrist, H.U. & Pöppel, E. (Hg.), Weltwissen, Wissenswelt. Köln: DuMont, 161-169 Ruse, M. (1985). Evolutionary epistemology: Can sociobiology help? In Fetzer, J.H. (Ed.), Sociobiology and epistemology. Dordrecht: Reidel, 249-265 Sackeim, H.A. (1983). Self-deception, self-esteem, and depression: The adaptive value of lying to oneself. In Masling, J. (Ed.), Empirical studies of psychoanalytical theories. Vol. 1, 101-157 Sacks, O. (1998). Sigmund Freud: The other road. In Guttmann, G. & Scholz-Strasser, I. (Eds.), Freud and the neurosciences. From brain research to the unconscious. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 12-22 Sanders, A.F. (1971). Psychologie der Informationsverarbeitung. Bern: Huber Schafer, R. (1986). Projective testing and psychoanalysis. Madison: International Universities Press (Erstdruck 1967) Schumacher, W. (1971). Gestaltdynamik und Ich-Psychologie. Psyche, 25, 161-191 Seidler, J.A. (1997). Information systems and data compression. Dordrecht: Kluwer Seligman, M.E.P. (1975). Helplessness: On depression, development and death. San Francisco: Freeman Serve, H.J. (1995). Förderung der Kreativitätsentfaltung als implizite Bildungsaufgabe der Schule. München: PimS Shannon, C.E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27, 379-423 Silverman, L.H. (1983). The subliminal psychodynamic activation method: Overview and comprehensive listing of studies. In Masling, J. (Ed.) (1983). Empirical studies of psychoanalytical theories. Hillsdale: Erlbaum, 69100 Simon, H.A. (1979). Information processing models of cognition. Annual Review of Psychology, 30, 363-396 Sincoff, J.B. (1992). Ambivalence and defense: Effects of a repressive style on normal adolescents’ young adults’ mixed feelings. Journal of Abnormal Psychology, 101, 251-256 Skinner, B.F. (1973). Wissenschaft und menschliches Verhalten. München: Kindler (englische Erstausgabe 1953) Skinner, B.F. (1974). Futurum Zwei ”Walden Two”. Die Vision einer aggressionsfreien Gesellschaft. Reinbeck: Rowohlt Skinner, B.F. (1988). Beyond freedom and dignity. London: Penguin Books Skinner, B.F. (1989). Recent issues in the analysis of behavior. Columbus: Merrill Publishing Company Smith, C.P. (Ed.) (1992). Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis. Cambridge: University Press Sorrentino, R.M. & Higgins, E.T. (Eds.) (1986). Handbook of motivation and cognition. Chichester: Wiley Stegmüller, W. (1986). Theorie und Erfahrung. Die Entwicklung des neuen Strukturalismus seit 1973. Berlin: Springer Thorndike, E.L. & Woodworth, R. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. Psychological Review, 8, 247-261, 384-395, 553-564 Thorndike, E.L. (1931). Human learning. New York: Century Varela, F.J. (2000). Die biologischen Wurzeln des Wissens – Vier Leitprinzipien für die Zukunft der Kognitionswissenschaft. In Maar, C., Obrist, H.U. & Pöppel, E. (Hg.), Weltwissen, Wissenswelt. Köln: DuMont, 146160 Wachtel, P.L. (1977). Psychoanalysis and behavior therapy. Toward an integration. New York: Basic Books Waldvogel, B. (1992). Psychoanalyse und Gestaltpsychologie. Historische und theoretische Berührungspunkte. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog Waldvogel, B. (1997). Die Entwicklung von phänomenaler Welt und innerer Welt. Gestalt Theory, 19, 1-79 Wegman, C. (1985). Psychoanalysis and cognitive psychology. A formalization of Freud’s earliest theory. London: Academic Press Weinberger, D.A. (1990). The construct validity of the repressive coping style. In Singer, J.L. (Ed.), Repression and dissociation: Implications for personality theory, psychopathology, and health. Chicago: University of Chicago Press Weiner, B. (1996). Human motivation. Metaphors, theories, and research. Newbury Park: Sage Wessells, M.G. (1984). Kognitive Psychologie. New York: Harper & Row Windmann, S. & Durstewitz, D. (2000). Phänomenales Erleben: Ein fundamentales Problem für die Psychologie und die Neurowissenschaften. Psychologische Rundschau, 51, 75-82 Wolf, E.S. (1982). Comments on Heinz Kohut’s conceptualization of bipolar self. In Lee, B. & Smith, K. (Eds.), Psychosocial theories of the self. New York: Plenum, 23-42 Wolpe, J. (1961). The systematic desensitization treatment of neuroses. Journal of Nervous and Mental Disorders, 132, 189-203 Wolpe, J. (1969). The practice of behavior therapy. Elmsford: Pergamon Press. Wolpe, J, Brady, J.P., Serber, M., Agras, W.S. & Liberman, R.P. (1973). The current status of systematic desensitization. American Journal of Psychiatry, 130, 961-965 Wundt, W. (1907). Grundriss der Psychologie. Leipzig: Engelmann Zieglgänsberger, W. (1998). Molekularbiologie der Sucht. Vortrag an der Univ. Salzburg am 4. 12. 1998 (persönliche Mitschrift) Zulliger, H. (1969). Die Angst unserer Kinder. Frankfurt: Fischer i Dieser Artikel ist der zweite Zwischenbericht über die Arbeit im Rahmen des Projektteils 5.1 „Gemeinsamkeiten und Unterschiede pädagogischer und psychologischer Lern-, Motivations- und Interessenstheorien in Bezug auf schulisches Lehren und Lernen” des gesamtuniversitären SFB-Projekts ”Theorien- und Paradigmenpluralismus in den Wissenschaften: Rivalität, Ausschluss, oder Kooperation?” der Universität Salzburg. Dieser Bericht fasst in knapper Form den Theoriekern samt exemplarischen intendierten Anwendungen sowie die Methodologie des Hintergrundsparadigmas „Psychoanalyse“ zusammen und vergleicht sie mit den im ersten Zwischenbericht (Herber 2000) diskutierten Paradigmen „Behaviorismus“, „Gestaltpsychologie“ und „Kognitionspsychologie“. Die in beiden Berichten analysierten Paradigmen haben im letzten Jahrhundert psychologische und pädagogische Theorien des Lernens, der Motivation, des Unterrichtens, Erziehens, Bildens wesentlich beeinflusst und beeinflussen sie bis heute. Einige besonders elaborierte - weitgehend paradigmenverschmelzende - Theorien der Motivation und des Lernens samt entsprechenden innovativen pädagogischen Anwendungsmodellen werden in weiteren Folgen behandelt werden. ii iii iv v vi vii viii ix x Freuds Konzept des Unbewussten enthält das „Vorbewusste“ (nach Pöppel 1987, 166ff. aufdifferenziert in „mit- und nebenbewusst“) und das „eigentliche“ Unbewusste (den z.T. ererbt-„unterbewussten“, vgl. Freud GW Bd. 17, 67ff., Pöppel 1987, 170, sowie den z.T. „verdrängten“ infantilen oder „archaischen“ „Primärprozess“, der jeden Trieb, jedes Bedürfnis und jede Vorstellung „für sich“ zur Verwirklichung bringen möchte, ohne Berücksichtigung von Inkompabilitäten, Widersprüchen, etc., wie dies im vorbewussten bis bewussten „Sekundärprozess“ möglich ist und angestrebt wird - oft mit dem Resultat der „Abwehr“ nicht zueinander passender Bedürfnisse und Vorstellungen, z.B. Freud GW Bd. 11, 183ff., Bd. 13, 248ff., Bd. 15, 85). Das Vorbewusste ist ohne emotionelle Barrieren bewusstseinsfähig, kann quasi jederzeit durch Aufmerksamkeitsverlagerung aus dem aktuellen Wahrnehmungsprozess oder aus dem Langzeitspeicher hervorgeholt bzw. indirekt - schlussfolgernd - rekonstruiert werden. Das (eigentliche) Unbewusste hingegen ist durch Abspaltung aus dem allgemeinen Fluss des Erlebens entstanden, zu seiner Integration ist eine (emotionale) Barriere zu überwinden. Meist handelt es sich beim „verdrängten Material“ um peinliche Erinnerungen oder verpönte Wunschvorstellungen, die vom „Überich“ bzw. „Ich“ nicht akzeptiert werden und z.B. als „ichfremd“ erklärt werden (vgl. Freud, Bd.10, 264ff.). „Ich“ „Bewusstsein“: Viele Prozesse des Ich in der Auseinandersetzung mit sich selbst (dem eigenen Es und Überich) vollziehen sich un- bzw. vorbewusst. Im Vergleich zu den Vorgängen in den beiden anderen Instanzen ist das Ich jedoch - etwa bei diskrepanten Erlebnissen, daraus resultierenden konflikthaften Spannungen, etc. - potentiell in der Lage die Vorgänge innerhalb der eigenen Person und in der umgebenden Realität „objektiv“ (als „Objekte“) zu registrieren und systematisch zu beobachten, Innenzustände realitätsbezogen zu reflektieren und zu sich selbst wie zur Umwelt in rationaler Weise Stellung zu beziehen (vgl. A. Freud 1975, 17ff.). Daher Freuds oft zitiertes Therapieziel: „Wo Es war, soll Ich sein.“ (Freud 1954, 10) Vgl. weiterführend die empirisch gestützte motivationspsychologische Forschung in Sorrentino & Higgins (1986). Inhaltlich Analoges scheint für soziale Kollektive zu gelten (vgl. McClelland 1966, 1995a, Mummendey & Simon 1997). Die Funktion aller Abwehrmechanismen als spezifische Formen der Ersatzbefriedigung unbewusster Bedürfnisse im Primärsystem, deren direkte Realisation von Überich und Ich nicht zugelassen werden, wird als wesentlicher Theoriekernbestandteil nicht entsprechend elaboriert. In weiterer Ausarbeitung unseres Projekts (siehe oben Fußnote 1) werden wir uns diesem Problem bei der Konzeption einer auch motivational begründeten Analogiebildungstheorie ausführlich widmen. Dass die Langzeitwirkung von traumatischen Erlebnissen kein bloßes Freudsches Hirngespinst ist, zeigen moderne neurowissenschaftliche Forschungen (vgl. Zieglgänsberger 1998, Guttmann & Scholz-Strasser 1998, Greenfield 1999). Wir folgen dabei im Wesentlichen Freud (1962, 1954, GW Bd.1, Bd. 5, Bd.11, Bd. 14), Freud & Breuer (1970), Erdelyi (1985), Wegman (1985), Guttmann & Scholz-Strasser (1998) Zum Phänomen der „repression“ (Verdrängung) gibt es in der modernen Forschung eindrucksvolle empirische Belege (z.B. Weinberger 1990, Baumeister & Cairns 1992, Newton & Contrada 1992, Sincoff 1992, Gitzinger-Albrecht 1993, Derakshan & Eysenck 1997, 1999). Freud hält das Definieren im elaborierten Stadium einer Theorienbildung für notwendig, aber eher hinderlich bei der - (durch Analysen exemplarischer Fälle) empiriegestützten - noch im heuristischen Anfangsstadium befindlichen Konzeption neuer Theorien (vgl. GW Bd. 10, 210). Interessant ist in diesem Zusammenhang die wissenschaftstheoretische Position von Popper (1974, 356): „Andererseits betrachte ich Definitionen und Fragen der Reduzierbarkeit als philosophisch nicht besonders wichtig. Wenn man einen Ausdruck nicht definieren kann, so hindert nichts, ihn als undefinierten Ausdruck zu verwenden: der Gebrauch undefinierter Ausdrücke ist nicht nur berechtigt, sondern unvermeidlich, denn jeder definierte Ausdruck muss letzten Endes mit Hilfe undefinierter Ausdrücke definiert werden.“ Vgl. Freuds Unterscheidung von „latentem“ und „manifestem“ Trauminhalt (GW Bd. 11, 111ff.). Metaphern fassen wir im Sinne von Gentner (1989) auf als eine Konfusion von Oberflächenmerkmalen (Objekteigenschaften, wie Farbe, Form, Größe, etc.) und formalen Beziehungseigenschaften - unabhängig von konkreten Objekteigenschaften (vgl. etwa die Struktur von Sonnensystem und Atomaufbau). Beispiel: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Milch und Wasser, Affe und Mensch, zwischen historischem Ödipusdrama und spezifischen psychologischen Vater-Mutter-Sohn-Beziehungen, etc.. Analogien beschränken wir in diesem Sinne auf „tiefenstrukturelle“ und funktionale Übereinstimmungen zwischen zwei Bereichen - unabhängig von deren (oberflächlichen) Objekteigenschaften, z.B.: Beziehungen zwischen realem Straßennetz und Straßenkarte, Plan eines Hauses (Grund-, Auf-, Schrägriss) mit dem realen Haus, Aufbau eines Organismus und Gliederung eines Unternehmens bzw. einer Gesellschaft, zwischen dem Fließen von Wasser und elektrischem Strom, dem Verhältnis von individueller und kollektiver Motivation, xi xii von Dezimalzahlen, Brüchen, Winkelmessungen, Punktmengen, etc. (vgl. Herber & Vásárhelyi 1993, Herber et al. 1997). Wir stützen unsere Ausführungen im Besonderen auf Aichhorn 1925, Zulliger 1969, Wolpe 1969, Kuhlen 1973, Mahoney 1974, Meichenbaum 1979, Wachtel 1977, Erdelyi 1985, Juul 1990, Dubs 1995, Grawe 1998) Zum Problem der methodischen Kontrollierbarkeit dieser Vermischung von Äußerungen des Analysanden und den „freien Assoziationen“ des Analytikers in der freischwebenden Aufmerksamkeit sowie zum Stellenwert der zunehmenden Theorienbezogenheit der Interpretation siehe Freud (GW Bd. 7, 258, Bd. 8, 376), Kernberg (1997, 177f.), Bollas (2000, 99ff.).