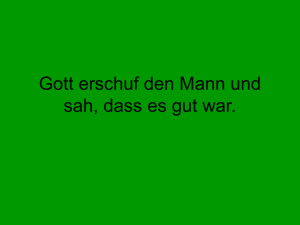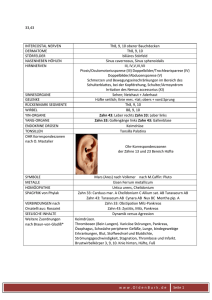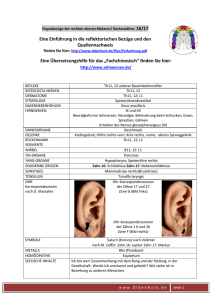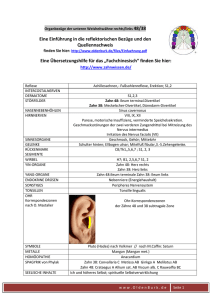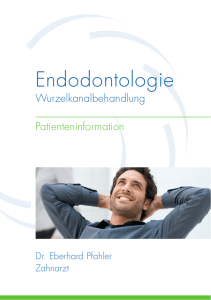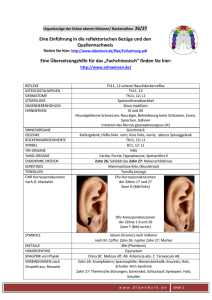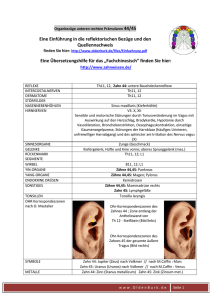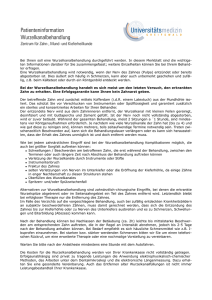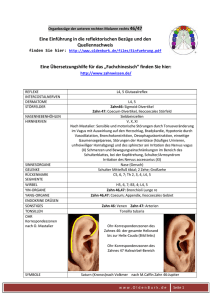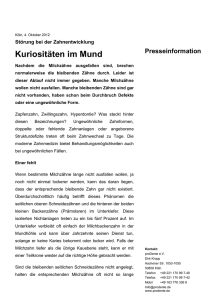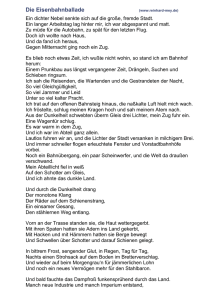Zahnersatz
Werbung
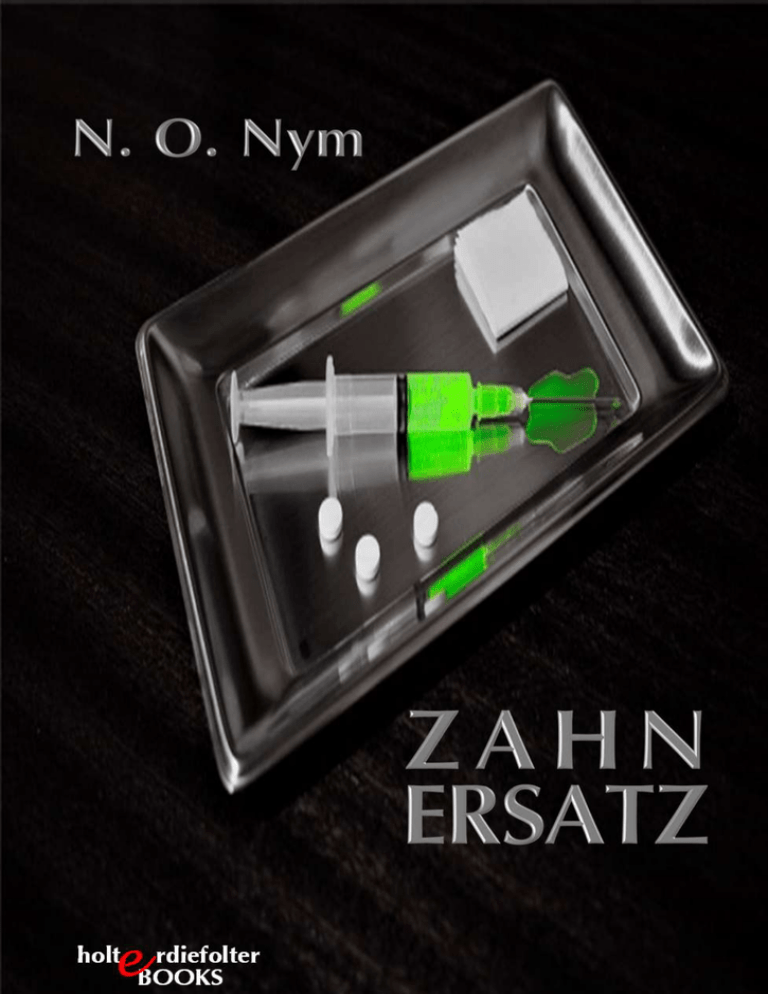
N.O. Nym Zahnersatz – Minikrimi – Coverbild Autor: Nep Titel: "Virus" Some rights reserved Quelle: www.piqs.de Nutzungsbedingung Liebe Nutzerin, lieber Nutzer, bitte respektieren Sie meine Rechte als Autor. Zu privaten Zwecken dürfen Sie diesen Text gern kopieren oder vervielfältigen. Sie dürfen ihn auch weiterreichen, wenn diese Nutzungsbedingung enthalten ist und Sie als Quelle die Website www.holterdiefolter.de angeben. Eine gewerbliche Nutzung ohne meine schriftliche Zustimmung ist ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie mich bei entsprechendem Interesse über die Feedback-Seite der Website. Vielen Dank für Ihr Verständnis! N.O. Nym Liebe Leserin, lieber Leser! Auch ein Krimi, der nichts kostet, sollte nur ordentlich verarbeitet in die Öffentlichkeit gelangen. Denn letztlich kostet er den Leser doch etwas: Lebenszeit. Ich habe mich bemüht, dem gerecht zu werden. Doch beim finalen Korrigieren stoße ich an meine Grenzen: Die Korrekturen laufen – unbemerkt – im Kopf statt auf dem Papier ab. Ob ein Wort zu viel (das aus einer älteren Fassung übrig geblieben ist) oder eine Endung, die nun nicht mehr passt: Ich bin stets versucht, mir meine Texte einfach „richtig“ zu lesen. Und der Duden-Korrektor hat dummerweise ähnliche Aussetzer. Darum: Für die Qualität der Geschichte halte ich den Kopf hin. Für orthografische und grammatikalische Fehler kann ich nur um Entschuldigung bitten! N.O. Nym Nicht jeder, der irrt, ist menschlich. Gerhard Uhlenbruck Wen Gott vernichten will, den schlägt er vorher mit Verblendung. Lateinisches Sprichwort 1. Kapitel Wahre Schönheit kommt von innen, heißt es beschwichtigend, weshalb das Wesentliche für die Augen unsichtbar sei. Darum sehe man nur mit dem Herzen gut! Große Weisheiten, fürwahr. Nur retteten sie Bernwald Blender nicht. Gleichgültig, wie man ihn sich drehte und wendete und wie raffiniert man Schönheit auch deutete: Es blieb ein Unding, ihn sich schönzureden. Man hätte sagen können, seine Hässlichkeit spotte jeder Beschreibung – wenn der Spott nicht stets Wege fände, das Unsägliche in Worte zu fassen. Deshalb gab es auch für Bernwald Blender eine Beschreibung. Ein beruflicher Rivale hatte sich um sie verdient gemacht, der Blender alles neidete, bis auf das Aussehen. Sie lautete: »Beine vom Storch, Arsch vom Elefanten, Wampe vom Hängebauchschwein. Stiernacken, Mopskinn, kleines, feuchtes Fischmaul. Habe ich die Froschaugen schon erwähnt?« Wohlwollen geht anders. Aber ehrlich gesagt: Man konnte das Wohlwollen dehnen, bis es wie eine Seifenblase platzte, ohne zu einem besseren Ergebnis zu gelangen. Dass Blenders altbackene Plumpheit derart ins Auge stach, war allerdings einfach Pech, genauer gesagt: die Ungnade der späten Geburt. Noch in den Siebzigern reichten ein paar Bundesschatzbriefe auf der Sparkasse und etwas Tabac Original ® unter den Achseln, um solche Äußerlichkeiten zu übertünchen. Trug Mann dann noch einen unter nämliche Achseln geklemmten Anzug und wechselte gelegentlich die Unterhose – Master of the Universe! War einmal. In unseren Tagen hilft nicht mal ein unter die Achseln geklemmter Maßanzug gegen die zeitgeistige Missbilligung zellulärer Dissonanzen. Will so ein Plumpsack heutzutage über die Runden und Schönen kommen, muss er mehr vorweisen. Am besten schwarze Zahlen mit massig Stellen vor dem Komma. Zahlen, hinter deren kalter Schwärze man, vor allem aber frau, ein wärmendes Feuer erahnt. Das Feuer puren Golds, lupenreiner Diamanten und eines Kamins in einer Finca auf Malle. Glücklicherweise konnte Blender mit solchen Zahlen aufwarten. Um sie sichtbar zu machen, hatte er sich einige Schmuckstücke ins Schaufenster gestellt, darunter eine Gründerzeitvilla in einer der edelsten Frankfurter Wohnlagen. Die Preziosen verdankte er nicht zuletzt einem diskreten Nummernkonto bei sicheren Kantonisten jenseits der sieben Berge. (Und die eidgenössischen Zwerge verstecken nur ordentliche Summen). Man, vor allem aber frau, musste also nur richtig hinsehen, um das gewisse Etwas von Dr. Blender auszumachen. Das Vermögen war ihm übrigens nicht in die Wiege gelegt worden. Er hatte es sich im Laufe seiner vierundfünfzig Lebensjahre hart erarbeitet. Er sprach von seinen Kronjuwelen, was nicht nur auf ihre betörende Wirkung zielte, sondern auch auf ihren Ursprung: die Münder seiner prominenten Patienten. Die darin enthaltenen, nicht immer filmreifen Beißwerkzeuge verwandelte Dr. Blender mit großem Geschick und vielen Vollkeramikkronen in strahlende Blendwerke. Die solcherart Gekrönten entlohnten ihn fürstlich, und auf diese Weise war mit jedem Zahn, den er aufhübschte, ein nicht minder hübsches Vermögen gewachsen. Er war ja nicht aus purem Sadismus Zahnarzt geworden. Nein, Bernwald Blender hatte es sich zum Ziel gesetzt, in Mündern nach Geldquellen zu bohren. Mit dem Wachsen seines Kronjuwelenschatzes war die Lust auf seinen anderen Schatz verständlicherweise geschrumpft: die Gattin ähnelte ihm leider. Außerdem hatte der Zahn der Zeit in den zwanzig Jahren ihrer Ehe unschön an ihr genagt. Man muss es seinem Zartgefühl zuschreiben, dass er ihr nicht gleich den Zahn zog, sie könnten gemeinsam alt werden. (Wer will schon, dass seine Frau alt wird.) Nein, er wartete ab, bis eine 36jährige in sein Leben trat, die man, um im Bild zu bleiben, nur als steilen Zahn bezeichnen konnte. Selbst sprachlich stellte sie eine Verbesserung dar: Aus Helga wurde Elisabeth, das ließ sich doch ganz anders hören! Nach einigen mehr oder weniger schönen Ehejahren (anfangs mehr, später weniger) hatte er die hormonelle Phase der Zweisamkeit weitgehend hinter sich gelassen. Um ihn zur Benutzung der versteifungsfähigen Röhre zwischen den Beinen zu verleiten, bedurfte es mittlerweile einer gewaltigen Testosteronausschüttung, nicht gleich im Maßstab der Niagarafälle, aber fast. Zumal die Handvoll Männlichkeit da unten langsam, aber sicher unter einem anderen Körperteil verschüttging. Ein Stöhnen im Schlafzimmer deutete jetzt also eher eine Durchfallerkrankung an. Vor diesem Hintergrund ergab es sich von selbst, dass er Männlichkeit inzwischen in einem ganzheitlichen Sinne verstand: der Mercedes, die Finca – solche Sachen. Überhaupt schien ihm der Geschlechtsakt maßlos überbewertet. Ihn selbst jedenfalls interessierten Spesen mehr als Spermien und Steuerschlupflöcher mehr als die Löcher, denen die gliedgeleiteten Geschlechtsgenossen hinterherhechelten. Auch Elisabeth zeigte nach einigen ermüdenden Fehlversuchen, ihre Eierstöcke fortpflanzungsmäßig in die Spur zu bringen, nur noch selten Interesse am Kontinent Down Under. Obwohl Blender seine schöne Frau nur noch selten anfasste, erfüllte es ihn immer noch mit Stolz, sie sich leisten zu können; auch nach sechs Ehejahren sah sie fast wie neu aus. Doch der Preis, den er für sie zahlte, beschränkte sich dummerweise nicht auf das Pekuniäre. Zusätzlich kostete ihn das Luxusweib ein Leiden, das viele Vermögende heimsucht: die Angst vor Verlust. Es war nun nicht so, dass er Elisabeth grundsätzlich oder vollständig misstraute, das nicht. Eigentlich traute er ihr sogar. Nur steckte in dem Wörtchen »eigentlich« eine riesengroße Hintertür, durch die man in eine Parallelwelt gelangte, wo sich alles ins Gegenteil verkehrte. Da war die kleine Ehefrau ein großes Luder, auf das man sich nicht verlassen dufte, wenn man nicht verlassen werden wollte. Und manchmal kam Blender nicht umhin, die Parallelwelt zu betreten. Natürlich nur, wenn er triftige Gründe hatte. Zum Beispiel, wenn er zu ungewohnter Stunde zu Hause anrief und Elisabeth nicht abhob oder erst nach verdächtiger Verzögerung. Da Zahnärzte praktisch veranlagte Menschen sind, ging Blender das Problem entsprechend an: Er stellte eine Haushaltshilfe ein, die beim Putzen und Bügeln das Haus und die Hausfrau im Blick hatte. Wegen der immensen Kosten musste er sich allerdings mit einer Halbtageskraft begnügen. Die Leute machten sich ja keine Vorstellung von den irrwitzigen Forderungen so einer Dunja oder Dubravka; die restjugoslawischen Staubschupsen konnten Feilschen wie armenische Teppichhändler. Er hatte es zuvor natürlich mit einer deutschen Putzfrau versucht, soviel Patriotismus durfte sein, wenn der Preis stimmte. Aber die Frau stank schon vor Arbeitsantritt nach Schweiß wie ein orientalischer Puff nach Patschuli. Oder wonach so ein Puff eben stank. Er hatte nie einen von innen gesehen, weder in Orient noch Okzident. Die Putze deckte also die Nachmittage ab. Damit harrte die Frage, was Elisabeth an den unbeaufsichtigten Vormittagen trieb, immer noch der Antwort. War sie überhaupt zu Hause? Oder besaß sie die Raffinesse, das Telefon auf ihr Handy umzuleiten? Trieb sie sich sonst wo mit sonst wem herum, während er sie im sicheren Hafen der Ehe wähnte? Die beauftragte Detektei hatte behauptet, Elisabeth sei sauber. Aber wer konnte schon mit Sicherheit sagen, ob die Schnüffler selbst sauber waren, ob das nicht alles ein abgekartetes Spiel war? Er musste seiner Frau mal richtig auf den Zahn fühlen. Und mittlerweile wusste er auch wie. Demnächst. Fürs Erste wollte er sich noch mit konventionellen Mitteln begnügen. Blender sah auf die Uhr. Ihm blieb eine Viertelstunde bis zum nächsten Patienten. Er betrat eine mittelgroße Abstellkammer, die ihm als Refugium diente. (In Luxus investierte er vornehmlich fürs Schaufenster.) Die Sprechstundenhilfe hatte einen neuen Schwung der speziellen Studienlektüre für Prominentenzahnärzte auf seinen Campingtisch geladen. Obenauf lagen BUNTE und Gala: die Präsentierteller, auf denen seine Kundschaft ihre Medienexistenz verlebte. Weiter unten im Stoß steckten Small-Talk-Materialien wie Sport BILD, GOLF JOURNAL und Cosmopolitan. Ächzend nahm er auf dem Campingstuhl Platz. Die Herausforderung, sich das alles anzueignen, wurde nur allzu leicht unterschätzt. Blender befand sich auf dem Heimweg von der Praxis ins Holzhausenviertel, wo die Arbeitslosen Privatiers heißen und Millionäre sind. Das Anwesen der viergebissigen Familie Reibach passierte er in Gemeinwohlgeschwindigkeit, um keine Kundschaft über den Haufen zu fahren. Nach Frau Ich-hab-die-Zähneschön Reibach würde auch der Gatte bald einen kompletten Sichtschutz vor dem Mahlwerk brauchen; und die Gören badeten die Beisserchen bereits fleißig in Zuckerwasser. Der Reibach’sche Nobelschuppen verschwand aus dem Rückspiegel und Blender gab Gas. Als die Tachonadel die Siebzigermarke erreichte, schaltete er den Motor aus. Der Schwung reichte genau, um geräuschlos die Auffahrt hinauf bis in die Garage seiner Gründerzeitvilla zu gelangen; er hatte das längst ausgetüftelt. Dort angekommen, schwang er den Elefantenarsch aus dem Auto und huschte auf Storchenbeinen durch die Verbindungstür zum Haus. Leise schloss er hinter sich ab und schlich durch die Vorhalle zum Haupteingang, den er ebenfalls zusperrte. Auf legalem Wege kam hier niemand mehr raus. Die Uhr zeigte Viertel nach elf. Elisabeth konnte unmöglich mit ihm rechnen. Er streifte die Slipper ab (die er am Morgen mit Bedacht gewählt hatte) und trippelte auf Zehenspitzen die Renommiertreppe zum Schlafzimmer hinauf. Vor der Tür atmete er tief durch. Ich liebe dich doch! Wie kannst du mir das antun? Da er nicht an Naivität litt, wusste er selbst, dass es nicht um Liebe im volkstümlichen Sinne ging. Nein, es ging um etwas Größeres, einen aufgeklärten Zustand höchster Wertschätzung. So wie man einen Anzug liebt, in dem man eine gute Figur macht. Oder wie man die vollen Brüste der Gattin liebt. Und die liebte er in der Tat, mehr noch, er war stolz auf sie, die eine wie die andere! Während er die Hand behutsam auf die Türklinke legte, blickten seine Augen wässriger denn je. Es lag am Tränenfilm, der sich in Erwartung demütigender Entdeckungen gebildet hatte. Ein Fehltritt ging ja gar nicht fehl, sondern traf einen Mann an der empfindlichsten Stelle, in seinem Fall am Hängebauch. Ihm grauste. Aber er war Manns genug, die Tür aufzustoßen. Habe ich dich erwischt! Doch das Zimmer lag still und unschuldig vor ihm, das Bett jungfräulich unberührt. Durch das gekippte Fenster drang Vogelgezwitscher, gerade so, als wolle es ihn in Sicherheit wiegen. Der cremeweiße Chiffonvorhang blähte sich in einer Brise und man konnte dahinter die pastellblaue Tapete schimmern sehen. Unverdächtig? Er hatte sich nicht bis hierhin durchgeschlagen, um dem Leichtsinn zu frönen. Doch weder vor noch hinter der Tapete fand sich jemand. Aber vielleicht in der antiken Kommode, die Elisabeth kürzlich erworben hatte? Beruhte der durchaus vertretbare Preis auf baulichen Besonderheiten? Einem mannsgroßen Hohlraum womöglich? Er zog am Griff der mittleren Schublade – und blickte auf champagnerfarbene Dessous. Na gut, diese Runde geht an dich. Aber das Spiel noch lange nicht! Um das Terrain unter dem Bett auszuspähen, drückte er seinen Hängebauch vorsichtig beiseite und schob den Kopf unter den Rahmen. Wenn Elisabeth darauf spekulierte, ein tiefergelegtes Liebesnest sei seinen Blicken anatomisch entzogen, dann unterschätzte sie seine Leidenschaft. Während seine Augen das Schattenreich nach menschlichen Konturen absuchten, war er sich der Lächerlichkeit seiner Lage durchaus bewusst. Doch er ertrug sie kraft der Liebe im weiteren Sinne, die er für seine Frau empfand. Er würde alles für sie tun! Deshalb inspizierte er auch den Schrank. Fehlanzeige. Im Wechselbad der Gefühle, hin und her gerissen zwischen der Hoffnung auf die Lauterkeit seiner Elisabeth und dem Hader über die Durchtriebenheit dieser Frau, fiel sein Blick auf das Parkett: gekalkte Eiche im Landhausstil. (Es kostete normalerweise 125,90 Euro den Quadratmeter, aber er hatte einen Restposten für vernünftige 49,99 Euro erstanden.) Eigentlich unmöglich, darunter ein Versteck einzubauen, es würde sich ja durch die Wohnzimmerdecke drücken. Und uneigentlich? Sein Blick fuhr mit der Präzision eines Laserscanners die Fugen entlang, ohne jedoch Unregelmäßigkeiten zu entdecken. Er hatte Elisabeth Unrecht getan. Und er hätte es wissen müssen! Wozu auch immer sie sich hinreißen ließe, nie würde sie das hohe Risiko des Schlafzimmerbeischlafs eingehen. Dann vielleicht im Salon? Bernwald beförderte seinen 120-Kilo-Korpus eilig ins untere Stockwerk. Gerade als er den Kopf durch die angelehnte Salontür stecken wollte, erklang von hinten eine Stimme. »Du? Jetzt schon?« Er musste sich gar nicht erst umdrehen, um zu wissen, was er zu sehen bekäme. Die Verlegenheit in ihrer Stimme kam einem Schuldeingeständnis gleich. Ihn packte eine schreckliche Angst, doch es half nichts, er musste den Tatsachen ins Auge blicken. Also wandte er sich um. Der Anblick erschütterte ihn zutiefst. Auf ihrem Gesicht zeigten sich verräterische, auf bizarre Weise verschmierte Spuren. Ihr Blick war auf bezeichnende Weise verklärt. Allerdings stand sie nicht etwa nackt oder im Negligé vor ihm, sondern in einer Art Blaumann. Selbst in diesem unförmigen Aufzug stach die Wölbung ihres Busens wunderbar hervor. Du darfst dich jetzt nicht ablenken lassen! Was also hatte der Blaumann zu bedeuten? Neckische Rollenspiele? In der Hand hielt sie allerdings keinen Kelch voll Liebestrank oder die »Zigarette danach«, sondern einen langstieligen Pinsel, von dem Farbe auf den Marmorboden kleckste. Ein merkwürdiger Aufzug – aber verdächtig? Zumindest nicht in der Art, wie Bernwald befürchtet hatte. Doch warum klang sie dann derart verdruckst? »Was ist hier los?«, verlangte er mit belegter Stimme Auskunft. »Warum bist du denn schon da, Bernwald?« »Keine Gegenfragen, ich will wissen, was du hier treibst!« Was du hier treibst. Elisabeth vernahm das Wort mit Bitterkeit. Seine Paranoia war nicht mehr auszuhalten, schon lange nicht mehr. Sie hatte ihn nicht aus Liebe geheiratet, und zu behaupten, sein Vermögen hätte nichts zu ihrem Jawort beigetragen, wäre gelogen gewesen. Sie hatte es einfach sattgehabt, im »sozialen Bereich« für ein asoziales Gehalt zu schuften. Die Geldsorgen loszuwerden, das hatte schon eine Rolle gespielt, doch von purer Berechnung konnte keine Rede sein. Sie hatte ihn gemocht. Seine Versuche, elegant zu erscheinen, hatten sie gerührt: ein Flusspferd im Tutu, bildlich gesprochen. Trotzdem hatte sie ihn respektiert. Für die Zielstrebigkeit, sich aus einfachen Verhältnissen hochzuarbeiten. Und für die Hartnäckigkeit, mit der er sie umwarb. Sein Erscheinungsbild störte sie nicht im Mindesten; sie fand sich ja selbst nicht besonders schön. Eine Meinung, mit der sie zwar weit und breit allein dastand, auf die es aber nun mal ankam. Nein, über Äußerlichkeiten sah sie hinweg, selbst wenn sie sich ihr in aller Nacktheit präsentierten. So hatte sie seinen Antrag mit dem festen Vorsatz angenommen, ihr Bestes zu geben. Er schätzte ihr Äußeres, sie die inneren Werte seiner diversen Konten. Eine Art Verwertungsgemeinschaft. Das war doch eine ordentliche Geschäftsgrundlage. Wenn die Eheleute einander wohlwollend begegneten, konnte sogar etwas Haltbareres daraus werden als die sogenannte große Liebe. Daran hatte sie geglaubt. Deshalb hatte sie auch ohne zu zögern in den Ehevertrag eingewilligt, dem zufolge sie völlig leer ausginge, wenn sie die Scheidung einreichte, oder wenn er es tat, weil sie einen Seitensprung begangen hatte. Genau genommen ginge sie in beinahe jedem Fall leer aus, den die menschliche Fantasie zu ersinnen vermag. Zunächst lief es wirklich gut. Bis er sie mit seiner Eifersucht traktierte, die zunächst nur lästig gewesen war, bald jedoch entnervend und schließlich entwürdigend. Trotzdem bemühte sie sich immer wieder, Zeichen guten Willens zu setzen. »Es sollte eine Geburtstagsüberraschung werden«, beantwortete sie die Frage nach ihrem Treiben. Sie schaute frustriert zu Boden, hob aber schnell wieder den Blick. Wenn Bernwald ihre Enttäuschung falsch deutete, würde er das ganze Haus auf den Kopf stellen. Er sah sie irritiert an. »Wieso Überraschung? Fragt sich doch, wer hier wen überrascht hat!« Es berührte ihn selbst unangenehm, nach Volksgerichtshof zu klingen. »Komm mit«, entgegnete sie müde. Er würde ohnehin keine Ruhe geben, bis er sich nicht zweifelsfrei überzeugt hatte. Sie führte ihn die Treppe hinauf zum Dachboden und zeigte ihm das halb fertige Ergebnis ihres Bemühens: ein Ölbild seiner mallorquinischen Finca, auf die er so stolz war. »Für mich? Zum Geburtstag? Du bist die Beste!« Plötzlich lief er rot an. Wegen seiner dämlichen Eifersucht hatte er ihr die Überraschung verpatzt. »Bitte entschuldige. Ich liebe dich über alles, darum schieße ich manchmal übers Ziel hinaus. Das kommt nun nie mehr vor! Nie mehr!« Nie mehr währte bis zum Nachmittag, allerdings des übernächsten Tages, was für Blenders Eifersucht eine ziemlich lange Durststrecke darstellte. Er rief sie an und sprach von seinen Patienten und fragte nach ihren Plänen und gestand ihr seine Liebe und fragte nach ihren Geständnissen. Das liebenswürdige Geplauder eines aufmerksamen Gatten. Doch unverhofft hörte er etwas höchst Merkwürdiges im Hintergrund: ein Scheppern, das mit dem gewohnten Klangbild im Haus und ums Haus herum nicht zu vereinbaren war. Wo steckst du in Wahrheit? Mit nahezu übermenschlicher Selbstbeherrschung widerstand er dem Drang, sich auf der Stelle Gewissheit zu verschaffen. Geistesabwesend stocherte er in Mündern herum, während er in Gedanken den kürzlich ersonnenen Plan konkretisierte, der ihr schändliches Tun endlich entlarven würde. Das dafür benötigte Utensil hatte er sich bereits beschafft. Als er gegen halb sieben zu Hause ankam, war er fest entschlossen, den Plan zügig umzusetzen. Daran konnte weder Elisabeths wohlfeile Erklärung, die Geräusche seien auf Straßenbauarbeiten zurückzuführen, noch der demonstrativ aufgerissene Gehsteig vor dem Haus etwas ändern. Elisabeth hatte seine Lieblingsspeise auf den Tisch gezaubert, einen Sauerbraten, der die Bezeichnung verdiente. Er lobte ihre Kochkünste, war jedoch mit den Gedanken woanders. Beim Dessert angelangt, eröffnete er Phase I der Operation: Er sah sie mit zusammengekniffenen Augen an, als wäre er auf etwas aufmerksam geworden. »Habe ich etwas zwischen den Zähnen?« »Nein, mein Engel, nicht zwischen, sondern an den Zähnen.« Er beobachtete, wie sie verstohlen mit der Zunge über ihr Gebiss wischte. »Was denn?« »Einer deiner Zähne weist eine Verfärbung auf. Noch nicht dramatisch, aber wir sollten prophylaktisch dagegen vorgehen.« »Wenn du es sagst«, entgegnete sie zurückhaltend. Er würde ihr ja nicht gleich die Zähne ziehen, um potenzielle Nebenbuhler abzuschrecken. Oder? Er nickte zufrieden. Jetzt erwies es sich doch noch als Glück, dass sie von seinem ursprünglichen Hochzeitsgeschenk nichts hatte wissen wollen: der Verblendung ihres Kauwerkzeugs. Es war zwar nicht übel, nur eben nicht von dem strahlenden Weiß, wie es einer Zahnarztfrau gut zu Gesichte stünde. Elisabeth hatte die »unnötige Kosmetik« abgewehrt, was er einerseits etwas naiv fand, ihm andererseits aber bewiesen hatte, dass sie ihn nicht um schnöder Vorteile willen heiratete. »Komm Montag während meiner Mittagspause in die Praxis, dann habe ich die nötige Ruhe.« Die Zeit bis dahin brauchte er, um einen Testlauf zu starten. 2. Kapitel Blender zögerte, die Klinke zu drücken. Ihn erwartete der letzte Patient, bevor er von Bankern zu Parkbankern wechseln würde, von Leuten, die im Scheinwerferlicht standen, zu solchen, die nicht mal die Scheinwerfer halten durften. Denn in neunzig Minuten stand sein monatlicher Auftritt in der Elisabeth-Straßen-Ambulanz an. Dort behandelte er im Namen der Caritas – und der Menschlichkeit! – ehrenamtlich Obdachlose; die lokalen Medien hatten wohlwollend darüber berichtet. Dieses Mal würde er sich besondere Mühe geben: Wen immer es in den Behandlungsraum verschlagen sollte, würde eine Spezialbehandlung erhalten. Aber erst musste er den Problemfall hinter der Tür abarbeiten. Dort erwartete ihn Dr. Zähler, eine schnittige Bilderbuchschönheit mit grau melierten Kotflügeln. Der toughe Vorstandsvorsitzende des Investmentkonzerns Wallpapers war äußerst schmerzempfindlich. Zwar gehörte gelegentliches Stöhnen zur normalen Geräuschkulisse einer Zahnarztpraxis (wenngleich Blender zu Recht ein Fummler vor dem Herrn genannt wurde und zu solchen Missfallensäußerungen keinerlei Anlass gab). Doch dieser Patient stöhnte definitiv anders. Und mied die schmerzstillende Spritze wie der Teufel das Weihwasser! Angeblich hatte er Angst vor dem Piecks. Von wegen, der Mann wollte sich nur nicht um sein Vergnügen bringen lassen. Er genoss die Schmerzen! Obwohl längst im Besitz eines Dentalkunstwerks, tauchte er immer wieder wegen irgendwelcher nebulösen Probleme auf und nötigte seinen Zahnarzt, zum Bohrer zu greifen. Wenn Blender das Instrument in dessen Mund führte, um einen Zahn »zu penetrieren«, fühlte er sich wie … das konnte man gar nicht in Worte fassen! Empörend, seine Praxis war doch kein Sadomaso-Kabinett! Nur: Was sollte er tun, der Mann zwang ihn gewissermaßen dazu – mit hohen Barzahlungen und geringem Interesse an Rechnungen. Trotz dieser Verlockungen hätte Blender ihn am liebsten vor die Tür gesetzt. Doch Leithammel Zähler würde vielleicht andere mit sich ziehen. Und wenn erst der Herdentrieb einsetzte … Blender war eben, allen Bemühungen zum Trotz, selbst kein Promi. Immer noch nicht. Natürlich konnte er eine gewisse Stellung auf der lokalen Bühne beanspruchen, zumal er einige respektable Ehrenämter innehatte, doch zur Crème de la Crème zählte er nicht. Er hätte in seiner eigenen Praxis mit den Behandlungsräumen für No-Names vorliebnehmen müssen, in denen drei angestellte Zahnärzte die Business Class bearbeiteten. Irgendwie war er für die Hautevolee immer nur der Zahnwart ihres Vertrauens geblieben. Einen popeligen Haarschneider wie Udo Walz ließ man mitspielen, aber einem promovierten Dr. Blender verwehrte man den Zutritt. Musste er erst mit Männern ins Bett steigen? Er verstand es nicht. Seufzend drückte er die elegant geschwungene Türklinke und betrat den VIP-OP, ein Designerstück für dentale Events mit Terrakottaboden und gewischten Wänden. Aus letzteren plätscherte gerade Händels Wassermusik. Zähler rekelte sich mit nur mäßig kaschierter Vorfreude im lederbespannten und klimagepolsterten Thron. Blender begrüßte den Investmentfürsten mit süßsaurem Lächeln und nahm eine Kürette vom Designer-Tray. Die Öffentlichkeit hatte ja nicht die geringste Ahnung, mit was für Leuten Zahnärzte sich herumschlagen mussten. Als Blender eineinhalb Stunden später auf den Eingang der Elisabeth-Straßen-Ambulanz in der Frankfurter Innenstadt zuging, kam ihm Michaela Lauter entgegen, die ehrenamtliche Leiterin der zahnärztlichen Abteilung. Der kühle Gruß, den sie ihm mit minimalistischem Nicken entbot, war eine Frechheit, die sich ein Dr. Blender nicht bieten lassen musste! Blöde Sau! Er wusste schon, warum die kleine Zahnärztin ihn nicht mochte: purer Neid! Er legte für ihren Geschmack zu großen Wert auf die Würdigung seines Beitrags in der Presse. Die Zahnreißerin hatte ja keine Ahnung! Wenn er längst das Bundesverdienstkreuz am Revers hängen hätte, würde sie es zu nicht mehr gebracht haben als einer Ehrenurkunde der Caritas. Die konnte sie sich dann ins Klo hängen. Lauter würde es nie zu etwas bringen! Zwar fuhr sie ebenfalls einen Benz, aber nur die A-Klasse: A wie armselig. Der Baby-Benz glich seiner eigenen S-Klasse wie Löwenzahn einem Raubtiergebiss! Im Behandlungsraum erwartete ihn bereits ein Patient. Blender konnte sein Glück kaum fassen: Ausgerechnet Johnny Walker hatte es auf den Stuhl verweht. Den Namen hatte sich der Penner einerseits wegen seines Lieblingsgetränks eingehandelt (für das sein Geld wahrscheinlich selten reichte), andererseits wegen seiner Fußmärsche. Wer Johnny heute in Frankfurt antraf, konnte ihn morgen in Friedberg vorfinden und übermorgen womöglich in Florenz. Der Mann gierte richtiggehend nach Bewegung – und das passte Blender hervorragend in den Kram. Einen besseren Kandidaten für den Testlauf konnte es gar nicht geben. Danach würde er wissen, ob und gegebenenfalls wie der Plan funktionierte, mit dem er Elisabeth auf die Schliche kommen wollte. Er hörte nur mit halbem Ohr zu, als Johnny von Schmerzen faselte. Darum würde er sich beim nächsten Mal kümmern, bis dahin müssten es Tabletten tun. Hier und heute blieb nur Zeit für die spezielle Behandlung. »Diesmal ist es eine etwas größere Sache, mein Freund«, sagte er jovial, nachdem er Johnnys Mundhöhle pro forma inspiziert hatte. »Keine Sorge, wir schaukeln das schon. Am besten, die Augen geschlossen halten und an etwas anderes denken. Und wenn wir brav sind, gibt es zur Belohnung hinterher eine kleine Geldspende – für eine Flasche Johnny Walker!« 3. Kapitel Seit drei Tagen legte Dr. Blender ungewöhnlich viele Pausen während der Arbeit ein. Die Sache mit Johnny Walker klappte noch besser als gehofft und überbot an Spannung jeden Krimi; er war beinahe süchtig danach. Auch jetzt zog es ihn wieder in die Lounge, den exklusiven, aber kaum genutzten Patientenwartebereich für die VIPs. (Blender packte jeden Termin in großzügige Zeitpolster, denn VIPs litten von Natur aus an Wartezimmerintoleranz.) Er kam hierhin, weil die WLAN-Verbindung in der Abstellkammer nicht funktionierte. Denn sein Interesse galt zwei frisch erworbenen mobilen Kommunikationsgeräten aus dem Hause Apple: ein Handy namens iPhone und ein Tablet-Computer namens iPad. Sein altes Handy hatte sieben Jahre auf der Platine und in seinem Laptop werkelte ein einsamer Kern, wenn überhaupt. Zu schwachbrüstig für die Durchführung seines Plans. Er brauchte leistungsfähige Geräte und zu seinem Unglück hatte man ihm die unfassbar teuren Produkte von Apple empfohlen. Blender schloss die Tür hinter sich und nahm am Tisch Platz, den Rücken wie immer dem Sideboard zugewandt. Das Möbel stammte vom italienischen Stardesigner Ettore Sottsass und sah aus, als hätten es Dreijährige im Drogenrausch entworfen. Blenders Meinung nach passte es in die mediterrane Umgebung wie bunte Smarties auf eine Pannacotta. Nur dass es auf seine Meinung nicht ankam. Das Sideboard kontrapunktiere in seinem Formwillen die Lässigkeit italienischer Lebensart, hatte ihm sein Innenarchitekt beigebracht. Und der musste es ausweislich seiner exorbitanten Honorare wissen. Blender konnte nur hoffen, die Kundschaft möge das »Kultobjekt« als solches erkennen; am liebsten hätte er das Preisschild drangelassen. Er entriegelte das iPad und tippte auf ein Icon, begierig darauf zu erfahren, was es Neues von Johnny Walker gab. Der Testläufer sollte um neunzehn Uhr zur ›Nachsorgeuntersuchung‹ erscheinen. Blender hatte ihn in seine am Rossmarkt gelegene Praxis bestellt. Johnny dürfe den Termin keineswegs versäumen, wenn er seinem Restgebiss nicht den Todesstoß versetzen wolle, hatte er ihm eingeimpft. Außerdem hatte er mit einem Zuschuss für weitere Whiskeyflaschen gewinkt. Und den Informationen im iPad zufolge bemühte sich Johnny, den Termin einzuhalten. Zufrieden wandte sich Blender der geplanten Krönung von Pinky zu, wie er Gloria Pinkwart insgeheim nannte. Das dralle Ding hatte nach einem freizügigen Aufenthalt im Big-Brother-Container die erhoffte Popularität und entsprechende Einnahmen abgesahnt. Letztere wollte sie in erfreulicher Höhe in dentales Dekor stecken. »Man muss in sein Lachen investieren, Doktor, damit es einem nicht vergeht«, hatte die Neuprominente ihn neunmalklug belehrt – als wäre er irgendein dahergelaufener Zahnpfleger. Er hatte nur unbestimmt genickt; das Schmerzensgeld für die Erduldung dummen Geredes bildete einen unsichtbaren Posten in seinen Rechnungen. Außerdem spekulierte er darauf, dass Pinky ihm aus dem Kreis ihrer neuen Lebensabschnittsfreunde jemanden von haltbarerer Prominenz zuführte. Sie selbst würde ja bald wieder in der Versenkung verschwinden. Punkt neunzehn Uhr stand Johnny auf der Matte. Der Mann war ein Penner, aber ein pünktlicher, das musste man ihm zugestehen. Blender führte ihn in sein Behandlungszimmer. »Mensch, Doc, was nur ’ne Verschwendung!« »Wie meinen?« Blender klang erbost. Lieber hätte er sich einen Totschläger nennen lassen als einen Verschwender. »Na, was schon? Hier sieht’s ja aus wie in Schöner wohnen. Als ob einem beim Zahnklempner nach Toskana wär.« »Ach so, das.« Den »Zahnklempner« schluckte Blender nur mit Mühe, aber den Einwand teilte er voll und ganz. »Ist nicht auf meinem Mist gewachsen«, erklärte er. »Das hat ein Innenarchitekt verbrochen. Und der schwört, dass meine Kundschaft in der Kulisse eines italienischen Landhauses behandelt werden will – selbst wenn sie gar nicht hinsieht. So ist das eben in meinem Business. Und nun bitte Platz zu nehmen. Ich habe auch was Schönes.« Er holte eine Flasche Johnny Walker für Johnny Walker hervor und ermunterte letztere, erstere zu öffnen. Bald hatte er den Penner von seiner Füllung befreit und das Loch fachmännisch verschlossen. Anschließend widmete er sich dem eigentlichen Problemzahn, dem die Sanierung eine letzte Galgenfrist bescheren würde. »Bist ’n prima Kerl, Doc«, bedankte sich Johnny achtzig Minuten später leicht angesäuselt. »Wenn noch ma was is, soll ich dann gleich hierhin kommen?« Blender schüttelte entsetzt den Kopf. »Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder in der Ambulanz, verstanden?« Der Penner nickte nonchalant und verschwand. Blender atmete auf. Der Test hatte perfekt geklappt, es gab Anlass zu Optimismus. Vom Jagdfieber gepackt, war er sich gar nicht mehr sicher, ob er lieber Elisabeths Schuld oder Unschuld herausfinden wollte. So oder so würde er bald Gewissheit haben. »Vergiss bitte nicht, morgen pünktlich um zwölf zu kommen, ich lasse extra für dich meine Mittagspause ausfallen«, ermahnte Blender die Gattin gegen Ende des sonntäglichen Abendessens. »Das ist nett von dir. Nur, weißt du, Schatz, meine Zähne fühlen sich vollkommen gesund an.« »Ziehst du gerade meine Kompetenz in Zweifel?« »Nein, nein, niemals. Ich meine nur … Also, ich spüre nicht den Anflug von Schmerzen.« »Eine Zahnarztfrau wartet nicht, bis es schmerzt«, entgegnete er trocken. Elisabeth nickte resigniert. Sie fühlte sich zurzeit wie eine Lagergefangene und die Vorstellung, der Lagerarzt würde sich an ihren Zähnen zu schaffen machen, verursachte ihr eine Gänsehaut. Schlagartig erkannte sie, wie schlecht es ihr ging. Die Kräfte verließen sie. Es musste sich endlich etwas zum Besseren wenden, sonst würde sie wie Schilf in der Wüste verdorren. Sie sehnte sich nach Wertschätzung und von Bernwald war sie offenbar nicht mehr zu erwarten. Selbst ihre Rundungen interessierten ihn nicht mehr, es sei denn, sie steckten in einem engen Cocktailkleid und erregten Aufmerksamkeit. Kommt Zeit, kommt hoffentlich Rat, dachte sie. Aber am Behandlungsstuhl führte wohl kein Weg vorbei. 4. Kapitel Elisabeth rutschte nervös im Stuhl herum, während Bernwald die Röntgenaufnahme betrachtete. Sie fühlte sich wie auf einer Folterbank. »Falscher Zahn, richtiger Verdacht. Machen wir uns gleich ans Werk.« Sie zuckte zusammen. »Was ist denn los, Bernwald?« Er hielt ihr die Aufnahme vor die Nase. »Der Zahn, der mir aufgefallen ist, hat noch etwas Zeit. Ein anderer hingegen gibt Anlass zur Sorge.« Er deutete auf die untere Zahnreihe. »Schau, hier im dritten Quadranten, 37. Ist kariös. Ich werde bohren müssen.« »Nein, bitte nicht, so schlimm kann es doch gar nicht sein.« »Ist es, ich zeige es dir.« Er schaltete den Bildschirm ein und führte die Intraoralkamera an den Backenzahn. »Siehst du die kleine dunkle Stelle? Das ist Karies, eine kariöse Läsion, um präzise zu sein. Ich werde sie exkavieren, dann ist alles wieder gut.« Elisabeth sah keine dunkle Stelle, aber was sollte sie machen? Dem Meister widersprechen? »Ich fühle mich heute nicht so gut«, wandte sie zaghaft ein, was nicht einmal gelogen war. »Bestimmt hat es noch etwas Zeit, Schatz.« »Wehret den Anfängen.« Er zog eine Betäubungsspritze auf. »Bitte nimm die Augenmaske, dann kannst du besser entspannen.« Zögernd ergriff sie die schwarze, samtweiche Maske. Sie war hin und her gerissen: Einerseits wollte sie lieber nicht sehen, was er machte, andererseits wollte sie es genau sehen. Er ist dein Mann, du musst ihm vertrauen, mahnte sie sich und ergab sich ihrem Schicksal. Blender spritzte ihr das Anästhetikum. Nebenbei berieselte er sie wie von selbst mit launigen Betrachtungen über das aktuelle Promigeschehen, eine Art Pawlowscher Reflex: Patient – Small Talk. Die Einwirkzeit nutzte er, um seinen Arbeitsplatz herzurichten. Seine Assistentin hatte er in die Mittagspause geschickt – es durfte natürlich niemand sehen, zu welchen Missetaten seine Frau ihn nötigte. Die Betäubung wirkte, es konnte losgehen. Er zog den Diamantbohrer aus dem Instrumententräger und begann, den Zahn zu eröffnen. Der Zahnschmelz war äußerst hart. Einen heileren Zahn konnte man sich kaum vorstellen und er hatte Skrupel, ihn aufzubohren. Nicht zu ändern, was sein musste, musste nun mal sein. Immerhin stellte er Elisabeth die Barclaycard Double Platinum zur Verfügung, da durfte er wohl eine gewisse Nachsicht erwarten. Er verstärkte den Druck auf den Bohrkopf, um schneller voranzukommen, schon sammelte sich Speichel, der abgesaugt werden musste. Eine helfende Hand hätte der Sache nicht geschadet. Elisabeth starrte in die Düsternis der Augenmaske und versuchte mit allen verfügbaren Sinnen zu ergründen, was in ihrem aufgerissenen Mund vor sich ging. Aber sie konnte weder das mysteriöse Surren, Brummen und Zischen irgendeiner sinnvollen Tätigkeit zuordnen, noch die seltsamen Bewegungen, die dort stattfanden. Vielleicht wurde dort in einem Zahn gebohrt. Vielleicht auch nicht. Ihrem Gefühl nach fuhrwerkte Bernwald immer heftiger herum. Plötzlich durchfuhr sie ein messerscharfer Schmerz. »AUA!« Sie riss sich die Maske von den Augen. Bernwald stand in extremer Schräglage über sie gebeugt, ein Bein auf den Boden gestemmt, das andere abgespreizt. Von seinem puterroten Kopf tropfte Schweiß auf ihre Schutzserviette. »Scheiße!« Er richtete sich auf und wischte sich die Stirn ab. »Deine Zähne sind wirklich kein Vergnügen für einen Zahnarzt!« »Was machst du denn die ganze Zeit?« »Den verdammten Zahn aufbohren, was sonst? Das Ding ist hart wie Panzerplatten.« »Ist das denn nicht gut?« »Setz die Maske wieder auf, ich bin fast durch.« »Und warum assistiert niemand?« »Kam nicht aus. Nun mach schon.« Schließlich hatte er den Zahn so weit wie möglich ausgehöhlt. Elisabeth lag verkrampft im Behandlungsstuhl, die Hände wie zum Gebet im Schoß gefaltet. Aber sie muckte nicht auf. Um keine Zeit zu verlieren, rührte er bereits die medizinische Einlagefüllung an. Sie sollte das Druckgefühl dämpfen, das der Gegenstand vielleicht verursachen würde, den er in den Zahn einzubringen gedachte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass Elisabeths Augenmaske keinen Sichtspalt aufwies, schlich er zur Schrankzeile und holte den Gegenstand heraus: einen Minipeilsender. Es gab auf der ganzen Welt angeblich keinen kleineren. Dem anonymen Internethändler zufolge stammte das Wunderwerk der Miniaturisierung vom israelischen Auslandsgeheimdienst. Angeblich hatte der Mossad es selbst hergestellt, wenngleich wahrscheinlich nicht speziell für die Verbauung in Backenzähnen. Im Handel frei erhältliche Sendegeräte, sogenannte GPS-Tracker, hatten mindestens die Größe einer Streichholzschachtel. Den Minisender hingegen würde er mit etwas Geschick und/oder Gewalt in Elisabeths Zahn unterbringen. Das Gerät würde ihn mit einer Positionsgenauigkeit von drei Metern über Elisabeths Stehen und Gehen informieren. Blieb nur zu hoffen, dass der Mossad nicht plötzlich in der Tür stand. Nach einigem Vor und Zurück hatte er den Sender endlich versenkt. Er passte gerade so, Glück gehabt. Nur die haarfeine Antenne ragte noch heraus. Er popelte sie mit einer Sonde hinein. Anschließend nahm er den Kugelstopfer und legte die Füllung, dann modellierte er sie mit dem Heidemannspatel. Noch ein wenig Polieren, und die Sache war geschafft. Er atmete auf. »Das war es schon, mein Engel!« Er zog ihr die Maske von den Augen und drückte ihr einen Kuss auf die Lippen. Wie er sie doch liebte. »Kann ich es mal sehen?« »Natürlich«, sagte er beschwingt und reichte ihr einen Mundspiegel. Ängstlich ergriff Elisabeth den Spiegel. Kein Zahn fehlte, Gott sei Dank! Vielleicht hatte sie sich nur eingebildet, Bernwald wolle ihr etwas Böses. »Siehst du, alles in bester Ordnung. In einigen Tagen, wenn ich von der Konferenz zurück bin, bekommst du das Inlay und schon hast du es überstanden.« Es sei denn, ich erwische dich bei einem Fehltritt, fügte er in Gedanken hinzu. Am Abend packte Blender seinen Koffer für die dreitägige Konferenz. Gewöhnlich übernahm Elisabeth diese Aufgabe. Doch da er nicht wirklich zu einer Konferenz fuhr und diesmal mehr Wert auf Fernglas und Kamera als auf Krawatten und Einstecktücher legte, erledigte er es ausnahmsweise selbst. Was sein Ziel betraf, das Courtyard Marriott in Gelsenkirchen, hatte er hingegen nicht gelogen. Sobald er morgen Mittag dort angekommen war, würde er sie anrufen, ihr seine Zimmernummer durchgeben und sich von ihr zurückrufen lassen. Sie sollte sich in Sicherheit wiegen! Danach ginge es auf schnellstem Weg die rund 250 Kilometer nach Frankfurt zurück – und dann immer den Signalen des Peilsenders nach. Er hatte den vermeintlichen Tagungsort mit Bedacht gewählt: Einerseits sollte Elisabeth ihn relativ weit weg wähnen und andererseits musste er schnell genug pendeln können, um ihr im Moment der Wahrheit die Maske vom Gesicht zu reißen. Er war gewappnet! Das Courtyard Marriott erwies sich als einer der typischen Hotelkettenkästen. Immerhin konnte man die großzügige, mit Wurzelholz gespickte Suite als standesgemäß akzeptieren. Die beiden Telefonate mit Elisabeth hatte Blender bereits hinter sich, nun begann er, seine Überwachungsstation einzurichten. Er platzierte iPhone, iPad und die Bedienungsanleitung für den Peilsender vor sich auf dem Kingsizebett. Den Sender hatte er bereits daheim konfiguriert: Er würde Elisabeths Positionsdaten per SMS an das iPhone senden, sobald sie den virtuellen Geo-Zaun überschritt. Dabei handelte es sich um eine durch GPS-Daten definierte Zone. Er nahm das iPad und rief die Kartensoftware auf. Indem er mit der Fingerspitze ein Rechteck auf der Karte markierte, zog er den »Zaun«. Er reichte vom Haus bis zum Bioladen, wo Elisabeth kleinere Einkäufe tätigte. In diesen Grenzen konnte sie sich unbemerkt bewegen. Oder sollte er den Zaun noch enger fassen? Nein, zu riskant. Der Miniakku des Senders würde nicht ewig reichen. Wenn er ständig Daten übermitteln musste, würde er womöglich schlappmachen, bevor Elisabeth ihre schändlichen Gedanken in die frivole Tat umsetzte. Blender nahm das iPhone und rief den Sender in Elisabeths Backenzahn an. Die Verbindung war nun hergestellt. Sobald der Sender Positionsdaten an das iPhone schickte, würden sie per Bluetooth an das iPad weitergeleitet. Dort würde eine Software die Daten auswerten und die Position in der Karte einzeichnen. Zwar konnte sich Elisabeth den Lover auch ins Haus holen, doch er glaubte nicht daran. Madame würde sich nicht der Unbequemlichkeit aussetzen, Spuren beseitigen zu müssen. Er starrte auf das Handy, wo sich aber bislang ebenso wenig tat wie auf dem Tablet. Es kribbelte ihn am ganzen Körper. Die Warterei machte ihn schier verrückt! Als er entsetzt bemerkte, wie er an den Fingernägeln zu kauen begann, gab er sich einen Ruck. Statt sinnlos auf Meldungen zu warten, sollte er sich lieber auf den Rückweg machen! Um achtzehn Uhr saß Blender in einem Zimmer des Frankfurter Ramada nahe der Messe. Und er saß da wie auf heißen Kohlen. Denn seine Kommunikationsgeräte schwiegen, als wären sie einem Schweigeorden beigetreten. Er musste endlich wissen, ob der Sender überhaupt funktionierte, vielleicht war bei der Implantierung etwas kaputtgegangen. Allerdings hatte er die Bedienungsanleitung dummerweise in Gelesenkirchen vergessen. Wenn er nun eine Sonderabfrage der aktuellen Position startete, beging er womöglich einen nicht wiedergutzumachenden Fehler. Einfach abzuwarten, war allerdings auch keine Option, seine Nerven ertrugen diese Ungewissheit nicht mehr. Er hatte sich zwar vorgenommen, Elisabeth in Ruhe zu lassen, sie sollte sich ja frei fühlen, doch jetzt griff er zum Handy. Sie meldete sich bereits nach dem zweiten Klingeln – als habe sie vor dem Telefon gelauert, um ihm vorzugaukeln, sie sei weiterhin sein treues Heimchen. Er befinde sich in Harry’s Bar, unten in der Hotellobby, log er. (Aber es gab in der Gelsenkirchener Bettenbude wirklich eine Bar gleichen Namens, das hatte er gecheckt.) Die Tagung sei für heute beendet und bald gäbe es ein gemeinsames Abendessen. »Und du, mein Engel?« Wenn sie nervös war, dann überspielte sie es gekonnt, man hätte sie für die Unschuld vom Lande halten können. Sie sei den ganzen Tag daheim gewesen, plauderte sie drauflos, habe im Garten gearbeitet und die Vorhänge fürs Wohnzimmer umgenäht. Das Haus habe sie nur kurz verlassen, um im Bioladen Joghurt zu kaufen. Später habe sie ein neues Buch begonnen, Die Apothekerin von Ingrid Noll. Die Apothekerin? Ein Krimi, in dem auch ein Student der Zahnmedizin und ein präpariertes Gebiss vorkamen? Was weißt du? Hatte die Schlange etwa seinen Versuch gewittert, endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen? Hatte sie seinen Plan längst durchkreuzt? Gab der Peilsender keine Meldung, weil er keine geben konnte? Blender versuchte, ihr durch Fangfragen auf die Schliche zu kommen, doch das raffinierte Luder stellte sich dumm. Na, schön, wie du willst, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten! Missmutig beendete er das Gespräch. Er war verunsichert. Einerseits musste er bei Elisabeth offensichtlich mit allem rechnen, andererseits: Er liebte sie doch! Wie konnte er ihr so böse Absichten zutrauen? Sie war doch sein Engel! Unsinn! Wenn sie ein Engel war, dann ein gefallener. Und was genau war ein gefallener Engel? Der Teufel! Nein, nein, nur keine falsche Nachsicht. Warte, Fräulein, ich krieg dich! Grimmig zerpflückte er die rote Rose auf dem Schreibtisch. Noch konnte er Elisabeth nichts beweisen, aber das würde sich bald ändern. Und was sollte er jetzt machen? Ins Holzhausenviertel fahren und sich einfach vor dem Haus auf die Lauer legen? Nein, entschied er, er musste ruhig Blut bewahren. Gegen dreiundzwanzig Uhr gab er die Hoffnung auf, dass sich heute noch was tun würde. Er konnte nach Gelsenkirchen zurückfahren. Eigentlich konnte er sich die lästige Fahrerei aber auch sparen. Heute würde sie ihn mit Sicherheit nicht mehr anrufen. Und morgen früh? Ein lieber Weckanruf? Unwahrscheinlich. Von selbst würde sie sich bis zum Jüngsten Tag nicht melden. Sie ertrug die Pflichtgespräche, mit denen er sie belästigte, mehr nicht. Der Gedanke brach im beinahe das Herz. Warum hatte Elisabeth sich nur derart verändert? Mit einem traurigen Ächzen erhob er sich vom Kingsizebett und ging ins Bad, um sich für die Nacht fertigzumachen. Er musste morgen fit sein. Morgen würde es geschehen, irgendwie fühlte er es. Auch Elisabeth fühlte es irgendwie, dass nämlich etwas mit ihr nicht stimmte. Sie fühlte sich so schlapp, als zehre etwas an ihren Lebenskräften. Eine Krankheit? Der seelische Stress? Ein Problem mit dem Zahn? Wenn sie mit der Zunge drüberfuhr, spürte sie eine kleine Erhebung. Die Idee, es könne sich um die Antenne eines Minipeilsenders handeln, wäre ihr nicht im Traum gekommen. Doch der Gedanke, Bernwald habe sich auf eine unlautere Weise an ihren Zähnen zu schaffen gemacht, vielleicht etwas reingespritzt, um sie während seiner Abwesenheit außer Gefecht zu setzen, kam ihr entsetzlicherweise gar nicht mehr so abwegig vor. Auch sie ging früh zu Bett. Sie fühlte sich müde und hilflos und hoffte, bald einzuschlafen, um morgen vielleicht ohne böse Zweifel zu erwachen. Wahrscheinlich spielten einfach nur ihre Hormone verrückt, weibliche Hysterie. Ja, das musste es sein, sie durfte Bernwald nicht unrecht tun! 5. Kapitel »Nein, bitte nicht, ich liebe dich doch!«, flehte er sie an. Er hatte sich schon den ganzen Tag benommen gefühlt, beinahe wie – vergiftet. Deshalb wusste er nicht, wie er auf seinen Behandlungsstuhl gelangt war. Elisabeth musste ihn hierhin gelockt haben. Den Stuhl hatte sie ganz nach hinten gekippt, sodass er wie ein Sack darin hing, den Kopf unten, die Beine oben. Und zwischen den Beinen Nässe. Ein festgebundener nasser Sack. Als er wieder das Surren des Bohrers hörte, nahm das Nässegefühl zu. »Bitte, bitte nicht.« »Was sein muss, muss nun mal sein, Bernwald«, sagte sie und beugte sich über seinen Schoß. »Einer deiner Hoden weist eine Verfärbung auf – das ist Eifersucht. Siehst du die kleine dunkle Stelle? Ich werde sie exkavieren, dann ist alles wieder gut. Bitte nimm die Augenmaske, dann kannst du besser entspannen. Oder möchtest du vorher was trinken? Ich habe eine Flasche Johnny Walker für dich besorgt.« Bevor er antworten konnte, spürte er die Vibration des Bohrers. Brrrrrrr. Brrrrrrr. Brrrrrrr. Vor Entsetzen hielt Bernwald die Luft an. Er riss sich los. Bäumte sich auf. Schlug um sich. Als er sein Gesicht traf, wachte er auf. Schweißgebadet. Er befreite seine Beine aus der verknoteten Decke und setzte sich auf die Bettkante. Noch immer hörte er das Vibrieren des Bohrers. Woher kam das Geräusch? Schließlich verstand er: Das iPhone meldete den Eingang einer Nachricht. Er sah auf die Uhr, schon halb zehn. Gewöhnlich stand er selbst sonntags vor sieben auf. Die Suche nach der Wahrheit erschöpfte ihn offenbar. Und dann der Traum. Seine Hände zitterten immer noch, es war so real gewesen, wie etwas nur real sein konnte. Um auf die Beine zu kommen, brauchte er einen Adrenalinstoß. Er verschaffte ihn sich, indem er das Grauen in Empörung verwandelte und Elisabeth Rache für ihre Gemeinheit schwor. Dann besah er sich die eingegangene SMS. Der Sender hatte sich gemeldet. Mit einem Schlag war er hellwach. Er griff nach dem iPad und öffnete mit fliegenden Fingern die Kartensoftware. Die Zielperson hatte den Geo-Zaun überschritten! Von nun an würde er alle drei Minuten eine Positionsmitteilung erhalten. Das iPhone vibrierte erneut. Beinahe gleichzeitig zeigte die Karte einen aktualisierten Standort an: Elisabeth war in die Holzhausenstraße eingebogen, angesichts der geringen Geschwindigkeit wahrscheinlich zu Fuß. Blender fluchte. Endlich tat sich etwas, und er saß hier im Pyjama rum. Er wäre am liebsten sofort losgestürmt, aber unrasiert konnte er natürlich nicht in die Öffentlichkeit. Ein Herr Dr. Blender im Pennerlook – auf so etwas warteten die Medien doch nur. Vielleicht war es ohnehin klüger abzuwarten, welches Ziel Elisabeth ansteuerte. Wenn sie zu einem Techtelmechtel fuhr, würde sie sich Zeit lassen, jetzt, da der ungeliebte Ehemann endlich mal nicht im Weg stand. Er ging ins Bad und verrichtete das Reinigungsprogramm schnell, aber korrekt. Während er sich abtrocknete, fiel ihm auf, dass sein Handy nicht mehr vibrierte. Stirnrunzelnd blickte er auf die Karte. Als er den Ausschnitt vergrößerte, entdeckte er das U-Bahn-Symbol und begriff: Sie bewegte sich unterirdisch fort. Kein Problem, irgendwann musste sie an die Oberfläche zurück und dann hatte er sie. Stolz auf seine kriminalistische Kombinationsgabe, grinste er vor sich hin, während er einen grauen Doppelreiher anzog. Das Handy vibrierte wieder. Perfekt! Er stand bereits wie aus dem Ei gepellt vor dem Spiegel und musste nur noch den Sitz des Einstecktuchs kontrollieren. Alles bestens. Die Jagd konnte beginnen! Im Fahrstuhl erhielt er die nächste Positionsmitteilung, diesmal aus der Innenstadt. Wahrscheinlich hockte sie jetzt in einer S-Bahn. Warum verlegte sie sich auf anonyme Massenverkehrsmittel, wo er ihr doch ein schickes Cabrio zur Verfügung stellte? Bis er den Mercedes gestartet hatte, war Elisabeth im Stadtwesten angelangt. An der Galluswarte schien ihre Fahrt zu enden. Was, bitte schön, wollte sie im Gallusviertel? Ihn mit einem Arbeitslosen oder Ausländer betrügen? Warte nur! Zwanzig Minuten später verspürte Blender mehr Sympathie für die öffentlichen Verkehrsmittel, denn er steckte in einem Stau in der Osloer Straße fest. Nervös starrte er auf das neben ihm liegende iPad. Elisabeths Standort veränderte sich nicht mehr. Anscheinend hatte sie ein Haus betreten. Er holte sich Google Maps aufs Display und gab die Adresse ein: Mainzer Landstraße 265. Danach aktivierte er Streetview. Jetzt hatte er das Haus gestochen scharf vor sich. Über dem Eingang hing eine Schrifttafel: Ärztehaus Galluswarte. Blenders Blick fiel auf die Spalte links neben dem Bildfenster. Sie enthielt ein gutes Dutzend Links zu den einzelnen Praxen. Klar, das Prekariat kränkelte gern mal vor sich hin und das zog gewisse Ärzte wahrscheinlich an wie Kuhmist Fliegen. Nur – was wollte seine Frau dort? Die Wagenkolone fuhr an und kam nach zwei Metern Raumgewinn wieder zum Stehen. Blender sah sich die Links genauer an, aber die meisten ließen nicht erkennen, zu welcher Art Praxis sie führten. Er tippte auf die Suchmaske von Google und gab »Mainzer Landstraße 265 AND Ärztehaus« ein. Treffer: Das Ärztehaus unterhielt eine eigene Website, auf der die Fachrichtungen gelistet waren: Urologie, Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Neurologie, ein ambulantes Operationszentrum – und ein Zahnarzt! Bitte nicht zu dem, betete Blender. Er spürte das Adrenalin aus der Nebenniere in die Blutbahnen schießen. Als die Kolonne wieder anfuhr, ging er ungeduldig aufs Gas – und merkte zu spät, wie maßlos er die Fortbewegungsfreiheit überschätzt hatte. Er trat hektisch in die Bremse. Bevor er sie ganz durchgedrückt hatte, schepperte es. Na, wunderbar! Wenigstens war er mit einem Bagatellschaden davongekommen. Er fuhr rechts ran. Noch im Aussteigen zückte er das Portemonnaie. Er würde das wie ein Ehrenmann regeln, vor allem schnell. Auch der Fahrer des vorderen Fahrzeugs stieg aus. Eine Rentnergestalt mit entsprechendem Hut. Alles in allem machte er einen unsicheren Eindruck, mit dem würde man leichtes Spiel haben. Blender warf einen Blick auf das Heck des Ford Fiesta, ohne nennenswerte Beulen auszumachen. Mit konziliantem Lächeln holte er zwei Fünfziger hervor und hielt sie dem Mann hin. Denkste, der Alte schüttelte den Kopf. Halsabschneider! Da Blender keine Zeit für Debatten hatte, legte er zwei Fünfziger drauf, nun musste es aber reichen. Der Mann schüttelte immer noch den Kopf. »Was ist los, müssen wir erst die Polizei rufen, um Ihre Mitschuld zu klären?«, herrschte er den Alten an. »Sie hätten unter keinen Umständen so scharf bremsen dürfen. Das war ein provozierter Auffahrunfall!« »Ja«, entgegnete der Mann ruhig, »mit der Polizei bin ich einverstanden. Rufen Sie an?« Was sollte das denn jetzt? Wieso wollte der Idiot die Polizei wegen dieser Bagatelle rufen? »Welche Summe stellen Sie sich denn vor?«, fragte er gereizt. »Gar keine. Ich will nur keinen Fehler machen, wissen Sie? Das ist nämlich der Wagen von meinem Enkelkind.« »Ihr Enkel wird dankbar sein, wenn Sie ein paar Scheine mit nach Hause bringen!« »Meinen Sie? Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin nur ein einfacher Mann, der nichts falsch machen möchte.« »Dann rufen Sie Ihren Enkel an, verdammt noch mal!« »Er ist im Urlaub, da werde ich ihn nicht erreichen. Sehen Sie die Telefonzelle? Da gehe ich jetzt die Polizei anrufen. Dann hat alles seine Ordnung.« Es verstrich eine geschlagene halbe Stunde, bis sich eine Streife zum Unfallort bequemte. Blender räumte sofort seine Alleinschuld ein, Hauptsache, er kam hier schleunigst weg. Doch er traf anscheinend nicht den richtigen Ton – die beiden Polizisten überkam plötzlich eine Ruhe, als besäßen sie das Rezept fürs ewige Leben. Was Blender zu dem dezenten Hinweis veranlasste, er sei eine bekannte Frankfurter Persönlichkeit und »bestens vernetzt«. Die Beamten nickten beeindruckt und schenkten ihm nun die Aufmerksamkeit, wie sie einer hochstehenden Persönlichkeit zukommt. Zunächst ersuchten sie ihn untertänigst, den Kofferraum zu öffnen, dann den Innenraum. Während sich der jüngere der uniformierten Untertanen auf den Fahrersitz beugte, begann das iPhone zu vibrieren. Das iPad quittierte die empfangenen GPS-Daten mit einem leisen Signalton. »Sie haben hier ja eine richtige Kommunikationszentrale, Herr Dr. Blender«, meinte der Untertan und holte das iPad heraus. »Können Sie es mal … wie sagt man?« »Entriegeln.« »Also?« »Ich denke nicht daran.« »Es würde den Vorgang beschleunigen.« Das Gesicht des Bullen nahm die Züge eines Smileys an, Informationsgehalt: Ich habe alle Zeit der Welt, du auch? Blender gab sich geschlagen. Er entriegelte das Gerät. Auf dem Display erschien die Karte, in der ein blinkender Kreis Elisabeths neuen Standort markierte. »Sie erlauben doch?« Der Bulle nahm ihm das iPad aus der Hand und betrachtete die Karte. »Was bedeutet der rote Kreis? Ist das ein Programm, um jemanden zu verfolgen?« »Ist das ein Thema für die Schutzpolizei?« »Sie meinen, wir sollen den Verkehr regeln und sonst die Klappe halten? Apropos Verkehr: Wie reagieren Sie eigentlich, wenn es auf Ihrem Beifahrersitz so piepst und vibriert?« »Gar nicht, ich kenne meine Pflichten«, entgegnete Blender pikiert. »So, so.« Der Untertan ging zur Beifahrerseite und kniete vorm Fußraum nieder. »Feldstecher und Kamera haben Sie auch dabei? In Ihrem Wagen sieht’s ja aus wie beim Bundesnachrichtendienst. Wozu brauchen Sie das ganze Zeugs, Herr Doktor?« Blenders Kopf schwoll vor Wut rot an. Ein Funke, und er würde explodieren. »Lass gut, Lars«, schlichtete der ältere Polizist. »Wir haben Wichtigeres zu tun, als bekannten Frankfurter Persönlichkeiten ihre kleinen privaten Geheimnisse aus der Nase zu ziehen.« Die beiden zogen ab. Blender sah ihnen nach. Wenn Blicke töten könnten, sie hätten es nicht überlebt. Fast zwei Stunden waren vergangen, seit Elisabeth das Ärztehaus betreten hatte. Mittlerweile hatte sie es offenbar wieder verlassen. Wenn er es richtig deutete, fuhr sie gerade zur Hauptwache. Er setzte sich in den Wagen und wartete ab. Elisabeth tauchte schließlich an der U-Bahn-Station Holzhausenstraße auf und verschwand auf direktem Weg hinter den Geo-Zaun. Schöne Scheiße! Und was nun? Er versuchte, seine Gedanken zu sortieren. Wenn sie tatsächlich beim Zahnarzt gewesen war, kam nur ein Grund in Betracht: Sie hatte Verdacht geschöpft und einen Stümper im Gallusviertel gewählt, weil er mit solchen ›Kollegen‹ nichts zu schaffen hatte. Konnte sein, konnte nicht sein – er brauchte Fakten! Allerdings verbot es sich, einfach in der Zahnarztpraxis anzurufen und nachzufragen. Wenn Elisabeth es erführe, würde sie misstrauisch werden. Quatsch! Wenn sie den Zahnarzt aufgesucht hatte, wusste sie ohnehin schon Bescheid! Er musste sich besser konzentrieren, um auf diesem ungewohnten kriminalistischen Terrain nicht die Übersicht zu verlieren. Er durchdachte die Sache erneut und entschied anzurufen. Zuvor unterdrückte er die Rufnummernanzeige seines Handys, sicher war sicher. »Blender«, meldete er sich. Er ließ den Doktortitel weg, weil die sonst sofort wüssten, dass es sich um den bekannten Zahnarzt vom Rossmarkt handelte. »Ich rufe im Auftrag meiner Frau an. Sie war heute bei Ihnen und hat die Terminerinnerung liegen gelassen. Könnten Sie mal nachsehen, wann sie wieder kommen soll?« »Ich bin noch neu hier«, antwortete die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung unsicher. »Warten Sie, da kommt der Doktor, ich reiche Sie weiter.« Nach Blenders Zeitgefühl verging eine kleine Ewigkeit, bis der Arzt endlich an den Apparat kam. »Turrek, mit wem spreche ich?« »Blender. Meine Frau war heute Vormittag bei Ihnen, gegen zehn.« »Blender, sagten Sie? Tut mir leid, da muss ein Irrtum vorliegen. Bei mir war Ihre werte Gattin nicht.« »Ah, ja? Da muss ich sie wohl noch mal fragen. Besten Dank, Herr Kollege!« »Herr Kollege?« Mist! »Ähm, ich meinte das gewissermaßen von Mann zu Mann, weil wir ja wohl alle ein bisschen unter unseren schusseligen Frauen leiden, also gewissermaßen von Leidensgenosse zu Leidensgenosse.« »Aha. Na dann einen schönen Tag.« Obwohl die Klimaanlage lief, rann Blender der Schweiß. Elisabeth zog ihn Schritt für Schritt in eine düstere Unterwelt, für die er einfach nicht gemacht war. Aber es half ja nichts. Er stieg aus dem Wagen und ging einige Meter auf und ab, um sich zu beruhigen. Vielleicht hatte die Spur ins Ärztehaus doch nichts zu besagen. Wahrscheinlich würde sich die Erklärung als ganz harmlos entpuppen. Halt! Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Unter den Ärzten befand sich auch ein Gynäkologe – und zu dem war Elisabeth gegangen, weil ihr Liebhaber sie geschwängert hatte! Natürlich, so musste es sein. Das erklärte erst recht, warum sie sich an einen Kurpfuscher im Gallusgetto wandte. Er rannte zum Wagen zurück und rief in der Praxis an. Von einer Frau Blender wusste man – angeblich – nichts. Na gut, die mochten ihn belügen können, Elisabeth würde das nicht gelingen! Er drückte die Kurzwahltaste. »Hallo, mein Engel«, begrüßte er sie mit den gewohnten Worten, aber zittriger Stimme. »Du? Wieso ist denn deine Nummer unterdrückt?« Erschöpft schloss er die Augen. Ein Fehler folgte auf den anderen, er hatte die Sache längst nicht mehr im Griff. »Ach, weißt du«, sagte er schließlich, »mein Handy liegt im Zimmer, zum Aufladen. Da hat mir ein Tagungskollege freundlicherweise seins geliehen.« »Jedenfalls ist es schön, dass du anrufst. Hast du gespürt, wie schlecht es mir geht?« Es ging ihr schlecht? Schwangerschaftssymptomatik? Wollte sie beichten? »Wieso denn?« Sie schluchzte. »Ich fühle mich schon seit Längerem krank.« Krank? Er war verwirrt, das passte nicht in seine Vorstellung vom wilden Treiben, dem sie sich in seiner Abwesenheit hingab. »Und heute habe ich den Befund erhalten. Ich bin wirklich krank, Bernwald!« Ihn überfiel ein mulmiges Gefühl. Elisabeth neigte nicht zu hysterischen Anfällen. »Was heißt das, krank?« »Ich mag darüber nicht am Telefon reden.« Sie schluchzte wieder. »Kannst du nicht kommen, Schatz? Bitte!« In Bernwald Blender wuchsen die Schuldgefühle bis auf die Höhe der Frankfurter Bankentürme. Wie hatte er seiner geliebten Frau all die schlimmen Dinge unterstellen können? »Natürlich komme ich. Ich bin sofort da!« »Sofort? Wie weit ist es denn von Gelsenkirchen ...« »Ich meinte, so schnell wie möglich«, unterbrach er sie hastig. »Halte noch ein wenig durch, mein Engel, ich beeile mich, bin schon auf dem Weg zum Wagen.« »Du kannst doch nicht das Handy mitnehmen.« »Wieso?« »Hast du nicht gesagt, es gehört einem Kollegen?« Einerseits hätte er sich in den Hintern beißen können, andererseits bewunderte er Elisabeth dafür, die Vernunft trotz Krisenstimmung nicht schleifen zu lassen. »Der Kollege ist draußen, dem müsste ich auf dem Weg zum Auto begegnen. Bis gleich!« Er kappte die Leitung, bevor er sich weitere Blößen geben konnte. Mit einem tiefen Stöhnen sank er in den Sitz. Er wusste nicht, ob er sich freuen oder weinen sollte. Zwar musste er sich um Elisabeths Treue nicht mehr sorgen, dafür aber um ihre Gesundheit. Wie krank war sie? Und wie sollte er es aushalten, mindestens eineinhalb Stunden Däumchen zu drehen? Schneller hatte es bestimmt noch niemand von Gelsenkirchen nach Frankfurt geschafft. Er begann wieder, an den Fingernägeln zu kauen, doch dieses Mal bemerkte er es nicht. 6. Kapitel Um dreizehn Uhr sechsundzwanzig bog er in die Auffahrt ein. Seine Sorgen waren in der Zwischenzeit nicht kleiner geworden. Elisabeth stand schon im Eingangsportal, sie sah grauenhaft aus: zittrige Hände, das Gesicht verweint, die Schminke verwischt. Bernwald atmete tief durch. Du musst jetzt Souveränität ausstrahlen, mahnte er sich. Stemme dich gegen deine Ängste! Während er gemessenen Schrittes auf sie zuging, versuchte er sich an einem beruhigenden Lächeln. Er umarmte sie und führte sie in den Salon, wo er sie behutsam auf die Couch drückte. Ein Cognac würde ihr gut tun. Doch sie winkte ab. Um seine Besorgnis zu überspielen, bedrängte er sie nicht gleich mit seinen quälenden Fragen, sondern goss sich zunächst einen doppelten Brandy ein, den er in einem Zug kippte. Dann setzte er sich zu ihr auf die Couch. »Nun erzähle mal«, sagte er mit aufmunterndem Lächeln und nahm ihre Hand. Elisabeth berichtete, sie habe sich schon längere Zeit matt und antriebslos gefühlt. Zunächst hatte sie es abgetan, eine schlechte Phase, aber das Unwohlsein nahm zu. Eine Freundin hatte ihr daraufhin geraten, einen Internisten aufzusuchen, und Dr. Greiner empfohlen. Bernwald erinnerte sich: Der Name stand auf der Liste der im Ärztehaus praktizierenden Mediziner. »Warum hast du nichts gesagt?« »Ach, Bernwald, du hast schon so viel um die Ohren, da wollte ich dich nicht zusätzlich belasten. Vielleicht hatte ich auch Angst, meine Befürchtungen auszusprechen. Als würden sie dann eher Wirklichkeit, verstehst du?« »Und du warst bei diesem Dr. Greiner?« »Ja, mehrfach. Er hat mich zunächst an einen Radiologen überwiesen und ...« »Und ich habe von alldem nichts gemerkt?« Es versetzte ihm einen Stich, wie sie ihm eine heile Welt vorgespielt hatte, wenngleich aus ehrenwerten Gründen, was natürlich einen Unterschied machte. »Schon gut. Sprich weiter.« »Heute war ich wieder bei Dr. Greiner, wegen der radiologischen Befunde. Er hat nicht viel gesagt, nur, dass keine Zeit zu verlieren ist und ich mich umgehend bei Dr. Gurt melden soll. Der weiß schon Bescheid.« »Weiter!« Sie senkte die Augen und sprach mit kleiner, zerbrechlicher Stimme: »Er ist Onkologe.« Bernwald schluckte. Sein Körper begann, im Takt seines wild schlagenden Herzens zu zittern. Ein tödliches Schweigen legte sich über den Raum, und ihm war, als nähme es ihm die Luft zum Atmen. Die Pendeluhr beim Kamin zählte mit unnatürlich lautem Ticken die Sekunden ab. Schließlich überwand er den Schock und nahm Elisabeth in die Arme. »Ganz ruhig, mein Engel. Keine Angst, es wird alles wieder gut, ich verspreche es dir.« Er streichelte ihr eine Weile gedankenverloren über das Haar und fühlte seiner eigenen Angst nach. Schließlich gab er sich einen Ruck – mit Gefühlsduseleien half er weder ihr noch sich selbst! Er stand auf. »Wenn du einverstanden bist, rufe ich Dr. Gurt an.« Sie nickte. Beim Telefon liege ein Zettel mit der Nummer. »Bernwald«, sagte sie kaum hörbar, »ich weiß, ich muss mich der Krankheit stellen, nur bitte nicht schon heute. Heute habe ich nicht mehr die Kraft dazu. Kannst du an meiner Stelle zu Dr. Gurt gehen? Bitte, nur dieses eine Mal!« Er dachte nach. Vielleicht war es gar nicht schlecht, zunächst von Mediziner zu Mediziner zu reden. »Ja, aber erst musst du ans Telefon kommen und Dr. Gurt deinen Wunsch mitteilen, sonst darf er mich nicht ins Vertrauen ziehen.« Dr. Gurt, ein schmächtiger Mann von Anfang vierzig mit dicken Brillengläsern, ließ ihn sofort ins Behandlungszimmer führen und machte nicht viel Federlesens. »Ich denke, unter Kollegen können wir offen reden. Kommen wir also gleich zur Sache. Wir haben bei Ihrer Frau drei Tumore festgestellt. Die schlechte Nachricht: Wir müssen von Malignomen ausgehen. Die gute: Ich halten sie für operabel. Zunächst haben wir es – vorbehaltlich der Biopsie – mit zwei Mammakarzinomen zu tun, eins in jeder Brust. Da hilft dann nur noch eine Mastektomie. Und dann ist da noch ein Rektumkarzinom. Da es nahe am Anus liegt, müssen wir voraussichtlich den Schließmuskel entfernen. Das liefe dann auf einen Anus praeter hinaus. Künstlicher Darmausgang, Sie wissen schon. Es trifft sich wirklich gut, dass wir hier unter vier Augen sprechen können. Denn auch auf Sie kommt kein Zuckerschlecken zu, Herr Kollege.« Herr Kollege? Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte sich Dr. Blender nicht wie ein Mediziner. Zwischen Karies und Krebs lagen Kontinente, wenn nicht Welten. Er versenkte das Gesicht in den Händen. Gleich drei Tumore. Ein Kotbeutel vorn am Bauch. Die prächtigen Brüste einfach abgeschnitten. »Dr. Blender?« Er reagierte nicht. »Na kommen Sie, ein Kollege wird mir doch nicht schlappmachen, das haben schon ganz andere durchgestanden.« »Wie sicher ist der Befund?«, fragte Blender mit brüchiger Stimme. »Es stehen noch ein paar Untersuchungen aus, aber ich würde mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich nicht ausreichend sicher wäre.« »Die Heilungschancen?« »Besser als es sich im ersten Moment anhört. Ob Ihre Frau es überlebt, hängt natürlich auch von Ihnen ab. Seelischer Beistand kann kriegsentscheidend sein. Ich habe folgende Empfehlungen für Sie: Erstens: Zeigen Sie Ihrer Frau, dass ihr Busen Sie gar nicht interessiert. Schauen Sie sich zum Beispiel gemeinsam Bilder brustamputierter Frauen an. Lassen Sie sie spüren, wie unwichtig Brüste sind! Punkt zwei ist der nach vorn verlegte Darmausgang, da sind Sie besonders gefordert: Betrachten Sie den Kotbeutel als Ihren gemeinsamen Beutel. Vielleicht helfen Sie Ihrer Frau bei der Toilette, um ihr zu zeigen, dass Sie sich nicht vor ihr ekeln. Knüpfen Sie das Band Ihrer Ehe so fest, dass sich Ihre Frau daran hochziehen kann. Es wird nicht leicht, ist aber auch eine Chance, menschlich zu wachsen. Ich weiß von Ehen, die sich erst zu voller Blüte entfaltet haben, nachdem die Eheleute zusammen quasi durch die Scheiße gewatet sind. Na, dieser Vergleich war vielleicht nicht so glücklich.« Blender hatte von Natur aus einen bleichen Teint. Als er nach Hause zurückkehrte, ähnelte er einem Leichentuch. Er war eine Zeit lang ziellos durch die Stadt gefahren, ohne seine Fassung zurückzuerlangen, hatte geheult, ohne Erleichterung zu verspüren. Elisabeth saß immer noch auf der Couch. Sie sah ihn mit großen Augen an. Er spürte schon wieder Tränen aufsteigen. Wie sollte er es ihr bloß beibringen? »Dr. Gurt spricht von hervorragenden Heilungschancen«, zog er die einzig gute Nachricht mit leichter Übertreibung vor. Er sprach mit tonloser Stimme und starrte vor sich hin. »Aber sie müssen operieren.« Er räusperte sich. »Es geht um die Brust und den Darm, es tut mir leid!« Er weinte und Elisabeth streichelte seine Hand. Verkehrte Welt. Eine Stunde später wusste sie über alles Bescheid. Sie hatte Bernwald gebeten, nichts auszulassen, und daran hatte er sich gehalten; ausgenommen den Ratschlag, diesen schrecklichen Kotbeutel als seinen eigenen zu betrachten und Elisabeth beim Wechseln zu helfen. Die gutmenschliche Gefühlskälte, mit der ihn Dr. Gurt traktiert hatte, behielt er ebenfalls für sich, er durfte seine Frau jetzt nicht verunsichern. Sie reagierte bewundernswert gefasst, bedankte sich und zog sich ins Gästezimmer zurück, sie müsse jetzt allein sein. Am nächsten Morgen fand Bernwald die andere Bettseite verlassen vor, Elisabeth war offenbar im Gästezimmer geblieben. Er schämte sich ein wenig für seine Erleichterung. Nachdem er eine Weile seine Zehen betrachtet hatte, klopfte es an der Tür. Elisabeth trat ein. Verstohlen warf er einen Blick auf ihr Gesicht. Sie sah fertig aus, aber wahrscheinlich sah er noch viel schlimmer aus, er fühlte sich wie ein Zombie. »Wir müssen reden«, sagte sie ruhig und setzte sich auf die Bettkante. »Ich weiß, dass du für mich da sein wirst, Bernwald. Allein der schwere Gang zum Onkologen … Ich … ich kann nur Danke sagen.« Sie küsste ihn auf die Wange. »Doch ich mache mir auch Sorgen um dich.« »Aber um mich musst du dich doch nicht sorgen«, wehrte er selbstlos ab. Insgeheim allerdings teilte er ihre Sorge ein wenig. »Ich habe heute Nacht lange nicht schlafen können und im Internet recherchiert, was auf uns zukommt. Und nun frage ich mich, wie viel ich von dir erwarten darf. Auch ein Kranker sollte kein Egoist sein.« »Nein, natürlich nicht.« »Du hast schon so viele Verpflichtungen. Für deine Mitarbeiter, für die Obdachlosen, für die Gesellschaft. Ich spüre schon jetzt manchmal, wie müde du bist. Und nun noch meine Krankheit obenauf. Das bereitet mir wirklich Sorgen, Schatz. Wirst du das durchstehen?« Sie ergriff seine Hand und sah ihm in die Augen. Bernwald wusste nicht, was er sagen sollte. Ja, er fühlte sich wirklich zuweilen etwas ausgebrannt – die viele Arbeit, die Vereinsämter. »Es ist doch nur menschlich«, fuhr sie fort, »dass dir die unterschiedlichsten Gedanken durch den Kopf jagen. Um unsere Ehe war es zuletzt ja auch nicht so gut bestellt, ich denke, das wissen wir beide.« Er nickte zögernd. »Lass uns einander Ehrlichkeit versprechen, ja? Wenn wir nicht den Mut aufbringen, ehrlich zu sein, schaden wir uns gegenseitig.« Er nickte, was einer Lüge gleichkam, denn seine geheimsten Gedanken würde er keinesfalls offenbaren, schon um Elisabeth nicht zu kränken. »Also, Bernwald, denke bitte über das nach, was ich dir gesagt habe. Um deinetwillen – und um meinetwillen. Ich muss festen Boden unter den Füßen haben, um mich dem Krebs zu stellen. Mitleid wäre nur Treibsand. Wir würden beide darin untergehen. Jeder muss zuerst auf sich selbst achten, und dann überlegen wir gemeinsam, was sich für uns daraus ergibt, ja? Heute Abend, wenn es dir recht ist. Ich will jetzt ins Sanitätshaus, mir diesen Beutel ansehen. Ich würde dich ja fragen, ob du mich begleiten magst, aber … die Konferenz.« »Ich nehme natürlich nicht weiter daran teil», stellte er seine beruflichen Interessen großzügig zurück. »Aber meine Sachen … die müsste ich eigentlich abholen.« Die Sachen bestanden aus einem Krimi, einer fast vollen Schachtel Aspirin und der Bedienungsanleitung für den Minipeilsender. Der Rest befand sich in seinem Frankfurter Hotelzimmer. »Wenn du jedoch Beistand …« »Nein, Bernwald, fahr nach Gelsenkirchen. Wir dürfen uns nicht alles von der Krankheit diktieren lassen!« Um Aufrichtigkeit bemüht, fuhr er tatsächlich nach Gelsenkirchen und holte die Habseligkeiten ab. Nachdem er auch das Frankfurter Hotelzimmer geräumt hatte, fuhr er in die Praxis. Er blieb bis achtzehn Uhr dreißig. Dass er Elisabeth nicht angerufen hatte, deutete er als gutes Zeichen: Er hatte seine Eifersucht endgültig überwunden. Auch sie hatte sich nicht gemeldet, und auch das war positiv zu sehen: Sie rief ja nie ohne wichtigen Grund an. Business as usual also, sie durften sich wirklich nicht alles von der Krankheit diktieren lassen. Sie sollten ihr Leben so weit irgend möglich weiter leben wie bisher! Du Traumtänzer! Die Absurdität seines Vorsatzes enthüllte sich ihm mit überwältigender Klarsicht. Nichts würde mehr wie früher sein, nie mehr! Auch nicht annäherungsweise. Unter dem Kleid seiner Frau würde sich ein Kotbeutel statt des Busens abzeichnen. Vielleicht würde sie nie mehr imstande sein, die repräsentativen Pflichten wahrzunehmen, die einer Frau an der Seite eines Mannes in herausgehobener Position eigentlich oblagen. Vielleicht würde sie nie mehr zu alter Stärke zurückfinden. Nicht mal nach einem Brustaufbau mit Implantaten. Wie sollte Elisabeth über den Kotbeutel am Bauch hinwegsehen können, wenn nicht mal er, der sie über alles liebte, es könnte? Was hatte Elisabeth gesagt? Wenn sie jetzt nicht den Mut aufbrachten, ehrlich zu sein, dann schadeten sie sich gegenseitig. Und er wollte ihr nicht schaden! Womöglich würde ihre eigene Erwartung, ihn bei seinem gesellschaftlichen Engagement zu unterstützen, sie erst recht krankmachen. Vielleicht war es ein Gebot der Fairness, diesen Druck von ihr zu nehmen. Vielleicht musste man sie von den Zwängen befreien, die der Zweisamkeit unvermeidlich innewohnten. Wie weit konnte man denn einem Menschen wirklich helfen, der gegen sich selbst kämpfen, der den Feind im eigenen Körper besiegen musste? Was dieser Dr. Gurt schwadroniert hatte, war doch Groschenromanrhetorik! Wahrscheinlich hatte Elisabeth ihm mit ihrem Vortrag am Morgen nur schonend beibringen wollen, dass sie allein sein musste, um all ihre Kräfte auf den Kampf gegen den Krebs zu konzentrieren. Dass sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollte. Dass sie darauf vertraute, er werde sie freigeben. Was für ein Unmensch musste man denn sein, um sich diesem Wunsch zu verweigern? Das Einzige, was er in ihrer schlimmen Situation für sie tun konnte, war doch, ihr den Rücken frei zu halten. Und da konnte sie selbstverständlich auf ihn bauen. Er hatte ihr die Treue geschworen und nun würde er sich nicht lumpen lassen! 7. Kapitel Vier Monate später saß Elisabeth in einem Café auf der Kaiserstraße und wartete auf ihren künftigen Exmann, dem sie seit drei Monaten, drei Wochen und zwei Tagen nicht mehr begegnet war. Bernwald hatte sie bei der Trennung mit einer »Finanzspritze gegen den Krebs« in tiefes Erstaunen versetzt; er war über seinen sparsamen Schatten gesprungen, und das sehr weit. Sie freute sich auf ihn. Die Freude war ganz auf ihrer Seite, denn Bernwald hatte vor der Begegnung größtmöglichen Bammel. Er fürchtete, ein Gespenst zu treffen, mehr tot als lebendig, und musste sich gleichzeitig gegen aufkommende Schuldgefühle wappnen. Während er sich dem Café näherte, grübelte er, ob sie ihm vielleicht Vorwürfe machen wollte. War das denkbar? Trotz der astronomischen Summe, die er aus seinem schweizer Depot herausoperiert und ihr zugesteckt hatte? Als er die Tür öffnete, sah er sie hinten rechts sitzen. Ihn traf beinahe der Schlag. Auf diesen Anblick war er nicht gefasst. Niemals hatte Elisabeth besser ausgesehen! Zumindest aus der Ferne. Wahrscheinlich ging sie ins Solarium, um eine kränkliche Blässe zu übertünchen. Ja, so musste es sein. Aus der Nähe würden die geschickt kaschierten Strapazen ihres Überlebenskampfes sich umso deutlicher zeigen. Langsam bewegte er sich auf den Tisch zu und warf einen verstohlenen Blick auf ihren Busen. Man sah keinen Unterschied. »Hallo, mein Schatz, du hast erwartet, mich platt wie eine Flunder vorzufinden, und nun bist du platt, weil man nichts sieht? Rührend, wie du dir immer noch Sorgen um mich machst. Setz dich doch endlich.« »Ja, klar. Hallo, ich, ähm, grüße dich.« Bernwald zwängte seinen umfangreichen Körper in das enge Eck zwischen Wand und Tisch, froh, damit eine kleine Weile beschäftigt zu sein. Er fühlte sich überfordert und wusste nicht, was er sagen sollte. Sie wirkte so – lebendig. Und warum nannte sie ihn immer noch Schatz, wo bereits der Scheidungstermin feststand? Er war ihrem Vorschlag gefolgt, kurzen Prozess zu machen, nachdem er sich – unter Außerachtlassung seiner eigenen Bedürfnisse! – bereit erklärt hatte, sie freizugeben. Wie Elisabeth um ihn besorgt gewesen war und er erst recht um sie, das hatte ihn zutiefst berührt: Was sie beide am Ende ihrer Ehe an Rücksicht und Mitgefühl füreinander aufbrachten, fand sich bei anderen Paaren nicht mal am honigsüßen Anfang! Vor diesem Hintergrund hatte es sich von selbst verstanden, Elisabeth, der ja laut Ehevertrag nichts (rein gar nichts!) zustand, großzügig zu unterstützen. An eine Million hatte er zunächst gedacht, doch war ihm die Summe unerklärlicherweise nicht großzügig genug erschienen, irgendetwas hatte ihn gedrängt, noch mehr seines hart erarbeiteten Geldes abzugeben – das Doppelte! Er verstand bis heute nicht, was ihn da geritten hatte. Irgendwie hatte er im Bestreben, ein guter Mensch zu sein, den Kopf verloren. Nur eine einzige – angesichts seiner herausgehobenen Position eigentlich selbstverständliche – Bedingung hatte er gestellt: Die Öffentlichkeit musste aus Elisabeths Mund erfahren, dass er sehr wohl bereit war, an ihrer Seite dem Krebs entgegenzutreten. Dass sie es aber aus nicht näher zu nennenden Gründen – die jedenfalls nicht gegen ihn sprachen! – vorzog, den Kampf allein zu führen. Sie hatte akzeptiert und kurzerhand einige Zahnarztgattinnen zum Kaffeekränzchen eingeladen und die Bedingung tadellos erfüllt, wie er sich vom Schlafzimmer aus per Babyfon überzeugt hatte. »Du siehst gut aus«, sagte er, was auf irritierende Weise der Wahrheit entsprach, der erste Eindruck hatte doch nicht getäuscht. Wie konnte es sein, dass ihm das blühende Leben gegenübersaß? Wahrscheinlich eine trügerische Phase des Auflebens, wie sie bei Krebs offenbar häufig vorkam. Irgendwie fühlte er sich verpflichtet, sie nach ihrem Befinden zu fragen, wenngleich er von ihrer Krankheit lieber nichts hören wollte. Schließlich siegte seine Neugier: »Du bist auf dem Weg der Besserung?« »Es geht mir prächtig.« Sie schenkte ihm das perlende Lachen, das ihn in der Anfangszeit ihrer Ehe ungemein angezogen hatte. »Wie das denn?«, drängte seine Verblüffung ungefiltert ans Tageslicht. »Eine Wunderheilung!« Sie grinste ihn auf eine Weise an, die entfernt an Spott erinnerte. »Du wirst es gleich verstehen, Schatz. Ich bin derart großzügig abgefunden worden, dass der edle Spender zu erfahren verdient, was er trotz seiner Spionageaktionen alles nicht mitbekommen hat. Also, hör gut zu, dann lernst du was fürs Leben!« Sie erzählte ihm die ganze Geschichte, beginnend mit der Aufzeichnung, die sie in der Nacht, bevor alles ins Rollen gekommen war, in seinem Schreibtisch gefunden hatte. Es handelte sich um den »Wünsche-Bogen« der Partnervermittlung, die sie zusammengebracht hatte. Es war für sie sehr erhellend gewesen zu erfahren, nach was für einer Frau er Ausschau gehalten hatte. Sie zog einen Zettel aus der Brusttasche ihres Kostüms und las einige Begriffe vor: repräsentabel, vollbusig, mittlere Intelligenz. »Im ersten Moment war ich etwas gekränkt. Doch deine Präferenzen zu kennen, hat mir dann sehr geholfen.« »Du hast es gewagt, mich auszuspionieren?« »Klappe. Hör lieber zu.« Am nächsten Morgen hatte sie sich entschieden, einen Zahnarzt aufzusuchen, um nach dem Backenzahn zu sehen; es hatte sich nämlich etwas Spitzes durch die Füllung gebohrt. »Als Doktor Turrek meinte, das Ding sehe nach einem Peilsender aus, konnte ich es nicht glauben. Einerseits. Andererseits musste ich einsehen, wie gut so eine Aktion zu dir passt. Doktor Turrek wollte die Polizei rufen, war dann aber liebenswürdigerweise bereit, mir auf andere Art zu helfen. Zunächst, indem er den Peilsender aufbewahrte, während ich mit dem Taxi zu einem Jugendfreund gefahren bin. Zusammen haben wir die Krebserkrankung ausgetüftelt, deren Nebenwirkungen dir so unappetitlich erschienen. Dann bin ich in die Zahnarztpraxis zurückgerast, um den Sender abzuholen und Doktor Turrek zu bitten, mich zu verleugnen, solltest du dich melden. Damit war ja zu rechnen, du musstest natürlich wissen, was ich in einem Ärztehaus treibe, das unter der Würde eines Herrn Dr. Blender nebst Gemahlin ist. Anschließend bin ich nach Hause gefahren und habe mich auf meinen Auftritt vorbereitet – drei Pötte Kaffee, eine Zwiebel für die Augen, Gesichtspuder, du weißt schon. Den Rest müsstest du dir eigentlich zusammenreimen können, du BonsaiBond.« Sie sah Bernwald ungläubig dreinblicken. Unglaublich blöd dreinblicken. Ein Grinsen überzog ihr Gesicht. »Dr. Gurt hat dir ziemlich zugesetzt, stimmt’s?« Er nickte unwillkürlich. »Es hat ihm diebische Freude bereitet. Der Name meines Jugendfreundes lautet übrigens Alexander, Doktor Alexander Gurt. Ich mochte ihn schon immer gern, sehr gern. Aber er war leider gebunden. Als ich ihn jetzt wiedersah, war er es nicht mehr. Du verstehst?« Blender starrte sie hasserfüllt an. »Wusste ich doch, dass du einen anderen hast.« »Es gibt da ein Zitat: ›Die Eifersucht ist ein Polizist, der den Verdächtigen zur Tat erst anstiftet.‹ Solltest du mal drüber nachdenken.« »Du solltest dich in Grund und Boden schämen! Dein infamer Plan ...« »Mach dich nicht zur Witzfigur. Ich habe nur für ein bisschen mehr Waffengleichheit gesorgt. Obwohl ich in Sachen miese Spielchen nur bewundernd zu dir aufblicken kann, du gemeiner Lump.« »Ich werde dich verklagen und jeden Cent zurückfordern«, zischte er. »Ach ja? Sollte sich das ein Mann in herausgehobener Position nicht besser noch mal überlegen? Was meinst du, wie sich die Presse auf die beiden Prozesse freut. Auf all die schmutzige Wäsche, die da zutage treten wird.« »Wieso zwei Prozesse?« »Der zweite ist dein Strafverfahren. Oder meinst du, ich würde dich nicht auf der Stelle anzeigen? Ich bin ja keine Juristin, doch bei schwerer Körperverletzung sollte schon eine Haftstrafe rausspringen, meinst du nicht?« Sie trank einen Schluck Cappuccino. »Hattest du eigentlich vor, mich bis zum Lebensende mit dem Peilsender im Mund rumlaufen zu lassen?« »Selbstverständlich nicht.« Es war ihm sichtlich peinlich, darauf angesprochen zu werden. »Bei der Nachsorgeuntersuchung sollte er wieder raus. Aber dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Und nach ein paar Tagen war der Akku ohnehin leer, es handelte sich also nur noch um ein bisschen Metall und Plastik. Bestimmt weniger bedenklich als eine Amalgamfüllung.« »Du hast gehofft, das Ding würde bald mit mir begraben, nicht?« »Unsinn, was denkst du denn nur«, entgegnete er hastig und lief rot an. Er räusperte sich. »Bitte gib mir den Sender zurück. Um unserer guten Zeiten willen.« »Lieber nicht. Du sollst jeden Morgen mit dem Wissen aufwachen, dass ich deine saubere Existenz mit einem Anruf bei der Polizei beenden kann. Strafe muss sein – Schatz. Und nun ist gut, du kannst gehen. Ich wollte nur dein blödes Gesicht sehen.« Während Blender wie ein geprügelter Hund aus dem Café schlich, trank Elisabeth ihren Cappuccino aus. Wie schön das Leben doch sein konnte! Kurz darauf verließ auch sie das Café. Als sie gerade durch die Tür ins Freie treten wollte, kam ihr eine Frau entgegen, die sie bei einem Empfang in der Elisabeth-Straßen-Ambulanz kennengelernt hatte. »Hallo, Frau Lauter, nett Sie zu sehen.« Sie mochte die zierliche Zahnärztin, die sich auf so positive Weise von ihrem Kollegen, Herrn Dr. Blender, unterschied. »Ach, hallo Frau Blender.« »Sagen Sie einfach Elisabeth, den Namen Blender muss ich zum Glück nicht mehr lange mit mir rumschleppen.« »Gern. Ich heiße Michaela. – Gut sehen Sie aus, Elisabeth. Geht es Ihnen wieder besser?« Nach den im zahnmedizinischen Milieu kursierenden Gerüchten hätte Elisabeth Blender eigentlich schon mehrfach gestorben sein müssen. Elisabeth lachte laut. »Viel besser, um nicht zu sagen blendend.« Michaela Lauter hörte es mit Zufriedenheit. Es würde der sympathischen Frau also nicht schaden, was auf den Kollegen Blender zukam. Am Vormittag hatte sie Besuch in ihrer Praxis gehabt. Von Beamten der Steuerfahndung, die sich für ihn interessierten. Die überhöhten Aufwendungen, die er für seine Tätigkeit in der Elisabeth-Straßen-Ambulanz geltend gemacht hatte, seien aber nur nebensächlich, hatte ein Fahnder durchblicken lassen. Offenbar hatte Blender sechs- oder siebenstellige Beträge am Fiskus vorbei in der Schweiz gebunkert. Michaela freute es ungemein, dass Elisabeth damit nun nichts mehr zu schaffen hatte. Manchmal war das Leben doch gerecht.