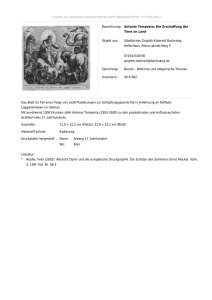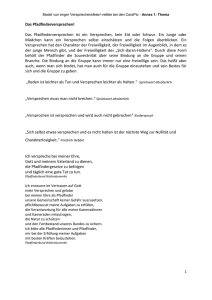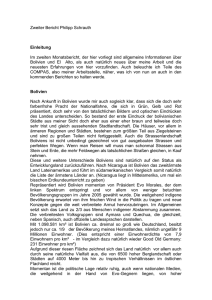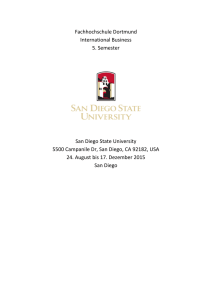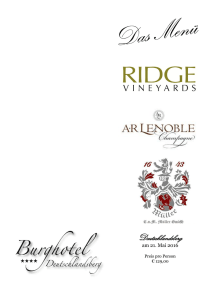Ein Jahr mit Luzi.doc - Haus der Solidarität
Werbung
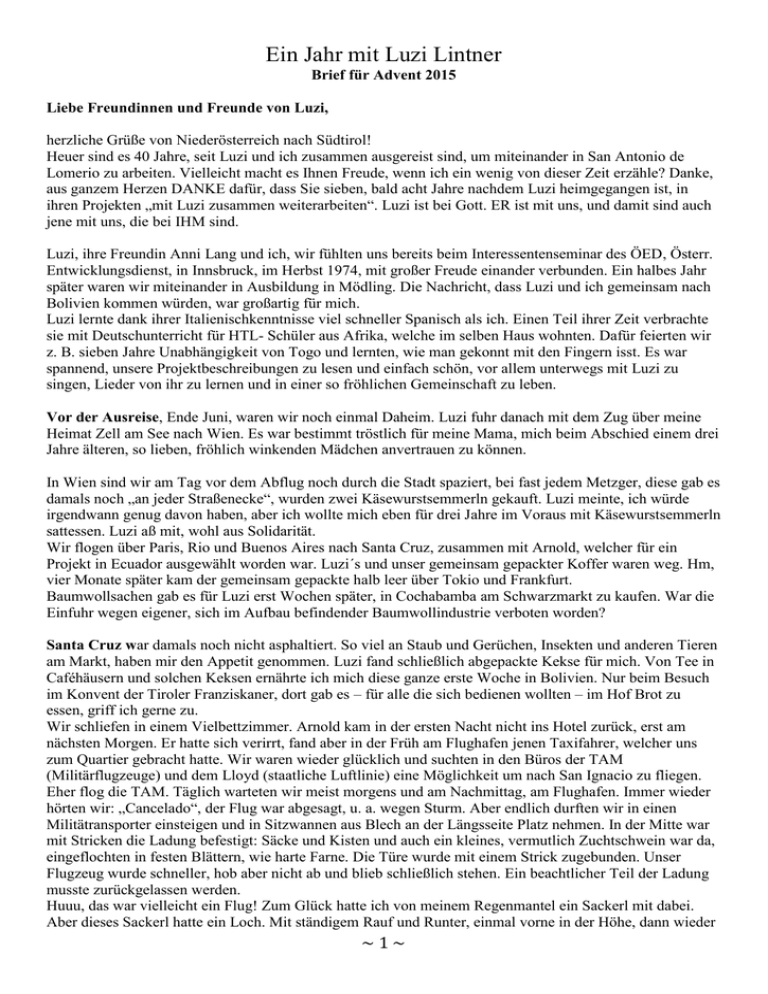
Ein Jahr mit Luzi Lintner Brief für Advent 2015 Liebe Freundinnen und Freunde von Luzi, herzliche Grüße von Niederösterreich nach Südtirol! Heuer sind es 40 Jahre, seit Luzi und ich zusammen ausgereist sind, um miteinander in San Antonio de Lomerio zu arbeiten. Vielleicht macht es Ihnen Freude, wenn ich ein wenig von dieser Zeit erzähle? Danke, aus ganzem Herzen DANKE dafür, dass Sie sieben, bald acht Jahre nachdem Luzi heimgegangen ist, in ihren Projekten „mit Luzi zusammen weiterarbeiten“. Luzi ist bei Gott. ER ist mit uns, und damit sind auch jene mit uns, die bei IHM sind. Luzi, ihre Freundin Anni Lang und ich, wir fühlten uns bereits beim Interessentenseminar des ÖED, Österr. Entwicklungsdienst, in Innsbruck, im Herbst 1974, mit großer Freude einander verbunden. Ein halbes Jahr später waren wir miteinander in Ausbildung in Mödling. Die Nachricht, dass Luzi und ich gemeinsam nach Bolivien kommen würden, war großartig für mich. Luzi lernte dank ihrer Italienischkenntnisse viel schneller Spanisch als ich. Einen Teil ihrer Zeit verbrachte sie mit Deutschunterricht für HTL- Schüler aus Afrika, welche im selben Haus wohnten. Dafür feierten wir z. B. sieben Jahre Unabhängigkeit von Togo und lernten, wie man gekonnt mit den Fingern isst. Es war spannend, unsere Projektbeschreibungen zu lesen und einfach schön, vor allem unterwegs mit Luzi zu singen, Lieder von ihr zu lernen und in einer so fröhlichen Gemeinschaft zu leben. Vor der Ausreise, Ende Juni, waren wir noch einmal Daheim. Luzi fuhr danach mit dem Zug über meine Heimat Zell am See nach Wien. Es war bestimmt tröstlich für meine Mama, mich beim Abschied einem drei Jahre älteren, so lieben, fröhlich winkenden Mädchen anvertrauen zu können. In Wien sind wir am Tag vor dem Abflug noch durch die Stadt spaziert, bei fast jedem Metzger, diese gab es damals noch „an jeder Straßenecke“, wurden zwei Käsewurstsemmerln gekauft. Luzi meinte, ich würde irgendwann genug davon haben, aber ich wollte mich eben für drei Jahre im Voraus mit Käsewurstsemmerln sattessen. Luzi aß mit, wohl aus Solidarität. Wir flogen über Paris, Rio und Buenos Aires nach Santa Cruz, zusammen mit Arnold, welcher für ein Projekt in Ecuador ausgewählt worden war. Luzi´s und unser gemeinsam gepackter Koffer waren weg. Hm, vier Monate später kam der gemeinsam gepackte halb leer über Tokio und Frankfurt. Baumwollsachen gab es für Luzi erst Wochen später, in Cochabamba am Schwarzmarkt zu kaufen. War die Einfuhr wegen eigener, sich im Aufbau befindender Baumwollindustrie verboten worden? Santa Cruz war damals noch nicht asphaltiert. So viel an Staub und Gerüchen, Insekten und anderen Tieren am Markt, haben mir den Appetit genommen. Luzi fand schließlich abgepackte Kekse für mich. Von Tee in Caféhäusern und solchen Keksen ernährte ich mich diese ganze erste Woche in Bolivien. Nur beim Besuch im Konvent der Tiroler Franziskaner, dort gab es – für alle die sich bedienen wollten – im Hof Brot zu essen, griff ich gerne zu. Wir schliefen in einem Vielbettzimmer. Arnold kam in der ersten Nacht nicht ins Hotel zurück, erst am nächsten Morgen. Er hatte sich verirrt, fand aber in der Früh am Flughafen jenen Taxifahrer, welcher uns zum Quartier gebracht hatte. Wir waren wieder glücklich und suchten in den Büros der TAM (Militärflugzeuge) und dem Lloyd (staatliche Luftlinie) eine Möglichkeit um nach San Ignacio zu fliegen. Eher flog die TAM. Täglich warteten wir meist morgens und am Nachmittag, am Flughafen. Immer wieder hörten wir: „Cancelado“, der Flug war abgesagt, u. a. wegen Sturm. Aber endlich durften wir in einen Militätransporter einsteigen und in Sitzwannen aus Blech an der Längsseite Platz nehmen. In der Mitte war mit Stricken die Ladung befestigt: Säcke und Kisten und auch ein kleines, vermutlich Zuchtschwein war da, eingeflochten in festen Blättern, wie harte Farne. Die Türe wurde mit einem Strick zugebunden. Unser Flugzeug wurde schneller, hob aber nicht ab und blieb schließlich stehen. Ein beachtlicher Teil der Ladung musste zurückgelassen werden. Huuu, das war vielleicht ein Flug! Zum Glück hatte ich von meinem Regenmantel ein Sackerl mit dabei. Aber dieses Sackerl hatte ein Loch. Mit ständigem Rauf und Runter, einmal vorne in der Höhe, dann wieder ~1~ hinten, füllte sich mein Sackerl immer mehr, bis diese Sache schon knapp unterm Loch war. Ich stellte mir vor, was jetzt kommen könnte, wenn es nämlich auch anderen Passagieren so ergehen würde wie mir: Der Boden hatte Rillen, also könnten sich Mageninhalte in ihnen, vorbei an der Ladung, einmal nach hinten, dann wieder nach vorne bewegen. Aber zum Glück war in Concepcion Zwischenlandung, ich konnte mein Sackerl früh genug ausleeren. San Ignacio de Velesco war unser erstes Ziel. Ohne Geburtshilfepraktikum wollte ich nicht ausreisen, so wurde uns vorgeschlagen, wir sollten nach San Ignacio. In einem großen Missionsspital, so dachte unser Einsatzleiter, könnte ich viel mehr lernen als in der Heimat. Luzi arbeitete und wohnte dort, im Zentrum der Tiroler Franziskanerprovinz, in der „Crancha“, Hauswirtschaftsschule, mit und Arnold sah sich in der Tischlerei und anderen Betrieben um. Ich wohnte bei einer Kindergärtnerin. Sie bat mich, mit ihr T- Shirt zu tauschen. So hatten wir beide ein neues. Jenes von ihr hat mir übrigens sehr viel besser gefallen als das meine. Luzi hat mir viele Jahre später auch das T- Shirt geschenkt, welches sie getragen hatte. Es wurde mir sehr kostbar, trage es nur ganz selten. Ungewöhnlich war für mich, in der Nacht im Krankenhaus, alle Türen führten ins Freie, von einem Hund begleitet zu werden. Ich lernte dort einiges, von der Arbeit im Labor z. B. Aber nichts von Geburtshilfe, denn in dieser Zeit gab es nur eine einzige Geburt, in der Nacht und dafür wurde ich nicht geholt, weil es eine normale Geburt war. Am LKH in Salzburg, Geburt war am Lehrplan, habe ich 4 Geburten mitbekommen, bis endlich eine normal war! Bei einer davon ist sogar die Mutter im Operationssaal gestorben, deshalb hatte ich so riesigst großen „Respekt“, ganz besonders vor Geburtshilfe. Wir wurden in diesen zwei Wochen von Entwicklungshelfern auch nach San Miguelito eingeladen, auf die Estancia, den großen Bauernhof des Bischofs. Nach der Arbeit, ich half Hans dabei Maden aus den Schleimhautbereichen der Kälber zu fischen, ritten wir noch ziemlich weit. Allerdings, ich war viel früher wieder daheim als die anderen, mein Pferd ist durchgegangen. Luzi war auch im Sattel sicherer als ich. Abends lehrte sie mich dort, in fröhlicher Runde, Karten zu spielen. Zurück ging es am nächsten Tag zu dritt am Motorrad, streckenweise durch tiefe, sandige Erde, ein wenig so wie schwimmen war das. Cochabamba, im Hochland von Bolivien, liegt auf über 2 000 Meter. Im Sprachinstitut von MaryknollMissionaren aus den USA, sollten wir unser Spanisch verbessern. Luzi und ich wohnten bei einer Familie und bekamen dort auch unser Essen. Zum Frühstück gab es oft „Dulce de leche“, einen aus Milch, 10- 12 Stunden mit irgendwelchen Zutaten gekochten Aufstrich. Herrlich schmeckt das. Luzi war, wohl durch ihre Erfahrungen als Familienhelferin, bereits in ihrer Jugend eine so reife, wunderbar liebe und starke Person, „ganz da“, vor allem dann, wenn es darum ging Not und Sorge zu teilen, zu helfen. Sie erzählte mir auch von schwierigen Situationen in Südtirol und mit welchen Worten sie Menschen zu trösten wusste, die schwer überfordert waren: „Dass Sies lei datian!“ Von Cochabamba ist mir in besonderer Erinnerung unser Krankenhausbesuch bei einer Langzeitpatientin aus Lomerio, sie hatte schwere innere Verletzungen erlitten. Luzi sprach mit dieser so armen, traurigen Frau, ich brachte kaum ein Wort über die Lippen. Sie saß vor diesem Krankenhaus, ein wenig abseits von anderen Patienten und Besuchern, welche auf dem Boden gemeinsam Erdnüsse ausgelösten und auf den abgetrennten Boden eines Fasses rösteten. Allüberall und auch in unseren Gedanken, ist uns liebevolle Begegnung als Berufung geschenkt. Weihnachten möge uns Segenswünsche ins Herz legen, nach allüberall, für arme, gute, aber auch für vom Irrtum des Bösen gefangen gehaltene Menschen. Mit allerbesten Wünschen für eine wunderschöne, gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, Josefa Maurer Sie können diese Geschichte (16 Seiten) auch via Mail oder ausgedruckt anfordern: im HdS ??? Josefa Maurer, Tannengasse 1, A 3352, [email protected], Tel.: 043 (0) 7477 44731 ~2~ Einzelunterricht gab es in Cochabamba, jede Stunde mit einem anderen Lehrer und einem englischen Spanischbuch. Alle diese Lehrer verstanden nur Spanisch und Indianersprachen, welche hier ebenfalls unterrichtet wurden. Gleich hinterm Institut war La Pyramide, ein 4 000ender. Natürlich wollten Luzi und ich da hinauf. Arnold, Mathilde, Margarete und eine Schwester aus den USA kamen mit. Die Indios im Hochland sind sehr scheu, wir sahen niemand, als wir an winzig kleinen Häuschens, Äckern voller Steine und einigen mageren Tieren vorbeiwanderten. Später gab es überhaupt keinen Weg mehr. Wir gingen durch Gestrüpp und Geröll bergauf, aber diese Pyramide kam nicht näher. Schließlich landeten wir in einer Felsenrinne, über uns sah es derart abweisend aus, dass wir nur noch jausneten, in der Sonne saßen und wieder umkehrten. Cochabamba war schon asphaltiert. Am Grün- (Braun) streifen, auf dem Weg zum Institut, war ein kleiner Ziegenbock angehängt, welchem wir oft eine kleine süße Banane mitbrachten. Es war Trockenzeit, es gab dort nur einzelne braune Stengel. Bananen kauften wir bei Kindern, welche auf der Straße verkauften, auch Schuhputzer gab es. Luzi hat sich selbstverständlich von ihnen die Schuhe putzen lassen. Ich wollte nicht von einem Kind bedient werden. Diese Haltung hat mir später leid getan. Wir besuchten mehrere Male das SOS Kinderdorf dieser zweitgrößten Stadt von Bolivien. Luzi hatte viel Kraft und besondere Anziehung. Sie fand sich dort sehr schnell inmitten vieler Kinder. Bei mir waren es nur fünf mit denen ich, wie Luzi, Flieger etc. spielt. Sr. Consolata von den Halleiner Schulschwestern hat uns herzlich empfangen und gleich erzählt, wie schlecht es jenen Österreicherinnen gehen würde, die einen Boliviano geheiratet hätten. Sie stellte uns aber auch einen sicherlich besonders lieben jungen Mann vor, ihren damals 16- jährigen Adoptivsohn, welcher ihr Nachfolger als Leiter des Hauses wurde. Pablo (?), ich weiß leider nicht mehr sicher, ob er so heißt, war als Baby zum Hals in den Bergen eingegraben worden, als Opfer für den Sonnengott gedacht. Die Geier hätten ihn gefressen, wäre er nicht gerettet worden. Diese Naturreligion empfiehlt, auch, dass man bei Lamas Fehlgeburten einleitet, wenn man ein Haus baut, um die Frucht als „Schutz“ einzumauern. Am Markt gab es getrocknete Lamaembryonen zu kaufen. Einmal meinte unsere Gastfamilie, dass wir unbedingt ins Kino gehen sollten. Es gab die Geschichte der Familie Trapp, englisch mit spanischem Untertitel. Ich kannte die Berge! Es war so schön, vor allem auch wegen der Begeisterung der Kinobesucher! Noch viel geklatscht und gerufen wurde bei einem Konzert mit Instrumenten und Melodien aus dem andinen Raum. So was von schön! Als Zugabe für die Ausländer wurde noch die Melodie vom Milchmann aus Anatevka gespielt. Die Leute brüllten, hieben mit ihren Sesseln auf den Boden oder, oben auf dem Balkon, schlugen mit den Stühlen aufs Geländer. Danach wollten wir mit dem Taxi heimfahren. Rauf, runter und ein Rad war verloren. Auch Taxis hatten dort kaputte Fensterscheiben, waren zerbeult und rostig. Daran waren wir schnell gewöhnt. Also: zurückwandern und doch auf den Bus warten! Nun aber musste der Bus einen Umweg nehmen, denn er konnte in jener Straße nicht an unserem Taxi vorbei. Nachts waren diese Busse wenigstens nicht mehr ganz so voll. Beim hinteren, wie auch beim vorderen Eingang hingen während der Fahrt meist Menschentrauben heraus. Ein kleiner Bub kassierte, er konnte durchschliefen und die Situation der Fahrgäste im Auge behalten. Eine großartige Leistung. Beeindruckt waren wir von der Militärparade zum Fest von 150 Jahre Unabhängigkeit Boliviens. Soldaten kamen im Stechschritt, sowas hatte ich noch nie gesehen. Dazu ohne Ende Kriegsgeräte. In einem Krieg gegen Chile war der Küstenstreifen verloren gegangen, weil die Bolivianer nicht auf Neujahr und Karneval verzichten wollten. Zum Glück heißt es nur noch in Liedern: „Mein Leben für das Meer!“ Nach einem Monat nahmen wir Abschied von unseren Freunden, von Missionsschwestern und Missionaren aus den USA. Wir hatten uns in den Pausen angefreundet. Anfangs mit größten Sprachschwierigkeiten. Ich konnte ihr Englisch kaum verstehen und sie lachten nicht über meine, mit viel Mühe in ihrer Sprache erzählten Witze. Später waren wenigstens „Minigespräche“ spanisch möglich. Am letzten Abend waren wir eingeladen zu einer Fahrt in die Nacht. Mit ihrem Geländeauto, wir waren viele, hinten oben stehend, es gab Stangen an denen wir uns festhalten konnten, brausten wir unter einem ~3~ prachtvollen Sternenhimmel in die Weite und waren einfach nur still. Hilarion, welcher mir von seiner besonders innigen Conzelebration bei Hl. Messen in Erinnerung geblieben ist, würde, ebenso wie der lustige John, in einem Elendsviertel arbeiten. Nie, nie mehr wieder im Leben könnten wir uns begegnen. Aber eines unserer Lieder aus den Sonntagsgottesdiensten verbindet mich immer noch mit dort: „Más allá del sol….“ Ja, wir haben einen Ort, näher der Sonne und Luzi ist schon dort! Schon im Flugzeug hat Luzi mir einiges vom Sternenhimmel erklärt. Der „Gürtel des Orion“ heißt in Südamerika „Tres Maries“, also „Drei Marias“. Das „Kreuz des Südens besteht aus 4 Sternen, welche wie die Enden eines Kreuzes mit langem Längsbalken angeordnet sind. In der gedachten Linie zwischen rechtem Ende des Querbalken und dem unteren langen Ende, ist im oberen Drittel, weiter innen, noch ein kleiner fünfter Stern. Der Mond liegt am südlichen Sternenhimmel auf dem Rücken, oder aber mit den Spitzen nach unten Unterwegs in Santa Cruz suchten Luzi und ich den Konvent der Bayrischen Franziskaner, auch dieser heißt „San Antonio“. Dort wohnte übrigens Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Bolivien. Als wir eintrafen, kam uns ein Arbeiter entgegen, welcher eben dabei war, einen LKW zu entladen. Das Vikariat Nuflo de Chaves ist riesig. Von hier wurde für alle Missionsstationen das Notwendige eingekauft und für den Osten zusammen mit der Post im Flugzeug nach Concepcion gebraucht. Es gab damals noch keine Brücke über den Rio Grande. Ich hörte wohl von einer Fähre, aber von niemanden der sie benutzt hätte. Jener deutsche Arbeiter freute sich drüber, dass wir endlich da waren, brachte zu trinken, setzte sich zu uns und schwärmte von San Antonio. Gerne würde auch er in diesem Dorf arbeiten, nur leider könne er wegen der Mitra nicht dort hin. Also, ich wusste vermutlich schon als Kind, dass der Bischofshut Mitra heißt, aber in diesem Zusammenhang verstand ich nicht und fragte was denn eine Mitra wäre. Luzi und der Bischof haben sich amüsiert. Wir flogen dann mit ihm nach Concepcion, diesmal mit dem Lloyd und im Jeep mit dem Monsignore, Missionsbischöfe lassen sich lieber so nennen, vom Flugplatz ins Zentrum. Diese eine Fahrt hat uns auch klar gemacht, wieso Bischof Eduardo Bösl zu seinem Spitznamen „Pata del gringo“, „ausländischer Entenfuß“, gekommen ist. Er fuhr so gerne viel zu schnell für dortige Verhältnisse. Im Bischofsdorf der Bayrischen Franziskaner wohnten wir in der Schule. Luzi war vermutlich viel bei unserem „Großtati“, wie wir ihn bald nennen durften, Bruder Wendelin, auf der Estancia des Bischofs. Er kümmerte sich dort auch um Kinder. Bei ihm sahen wir u. a. wie fein geschnittens Fleisch, wie Tücher, zum Trocknen aufgehängt wird. Meine Großmama hat Luzi sich auch als ihre Großmama gewünscht. Sie schrieb ihr so liebe Zeilen in meinen Briefen. Luzi hatte eine Schwester als Baby verloren, diese durfte nun ich für sie sein. Es war großartig, „gemeinsame Großeltern“ zu haben! In Concepcion war ich mit Dr. José Arzabe unterwegs, morgens in der Ambulanz, danach führ ich mit ihm am Motorrad ins Krankenhaus. Meine allererste Aufgabe in jener Ambulanz war es, am Brustkorb eines Mannes neue Verbände anzulegen. Er hatte links 2 Wunden, eine vorne, eine hinten: Lungendurchschuss! Bei der Fahrt ins KH fragte der Arzt ob ich wüsste was Pelagra wäre. Es war gut, dass ich im Jahr davor noch in Ausbildung, also „frisch gelernt“ war. Jenes Kind im KH, welches unter schwerem Mangel an Vitamin B zu leiden hatte, war todgeweiht. Die Ursache: einseitige Ernährung, immer nur Mais. Luzi´s Aufgabe war u. a. Gartenbau und gemeinsames Kochen für eine ausgewogene Ernährung. San Antonio de Lomerio, 100 km südlich von Concepcion, gab es als Missionsstation damals erst das siebte Jahr. Hier wohnten 300, in all den Dörfern rundum verstreut 3 000 Menschen, in einem Gebiet von ca. 5 000 km 2. Luzi und ich bekamen Sporthondas, ein Leichtmotorrad mit hohem Auspuff, damit konnte man auch zu Beginn der Regenzeit noch Flüsse passieren. Das meine war in Concepcion, wo es repariert worden war. Für den Weg nach Lomerio bekam es der Novize Jorge, inzwischen P. Georg und in Deutschland tätig, zu ~4~ fahren. Jorge baute Stürze, musste verbunden werden, so fühlte ich mich schon unterwegs „im Einsatz“. Fahrzeuge für Urwaldstraßen werden vom Mechaniker „fit gemacht“, d. h., sämtliche Unnötigkeiten wie Rückspiegel, Blinker usw. werden abgenommen, ausgebaut. In San Antonio gab es einen sehr herzlichen Empfang, ein Fest zu unserer Begrüßung. Ich wusste zwar, wie Chicha, also Maisbier gebraut wird, verstand aber nicht, dass ich nicht immer alles hätte austrinken müssen, was mir angeboten wurde. Zur Erzeugung von Chicha wird Maismehl, vor allem von alten Frauen und Kindern, welche dafür Zeit haben, im Mund tüchtig eingespeichelt, danach in einen Häfen gespuckt, gekocht und vergoren. Ich wollte sehr tapfer sein, niemanden beleidigen und trank, trank, trank. Später hörte ich, dass man sich darüber wunderte, wie trinkfest diese neue Krankenschwester wäre. Nur einmal bekam ich in einem Dorf eine „Chicha“ zu trinken, die wirklich sehr gut geschmeckt hat. Auf meine bewundernde Bemerkung wurde mir erklärt, dass dies keine Kinderchicha sondern Zitronenlimonade wäre: mit Flusswasser zubereitet, also genauso grau wie Chicha, nur eben ohne Mehlkörnderln und mit Zuckerrohr gesüßt. Padre Matthias Lentsch, ein Burgenländer, er musste kurz bevor wir kamen schwer krank heimreisen, hatte ein schönes großes Pfarrhaus gebaut. Besonders wichtig: das weite Dach, um Regenwasser sammeln zu können. War der Hochbehälter leer, so holten wir die Pumpe, legten Schläuche und hatten wieder Fließwasser. Am Wasserturm eingemauert war der Trog zum Wäschewaschen. Wenn es regnete, kamen sehr gerne die Kinder, um an einer Stelle beim Regenrohr Wasser umzuleiten, zu spielen, sich Wasser mit zu nehmen. Den Indios schmeckte das Regenwasser aber nicht wirklich, sie bevorzugten jenes von einem Bach, unterhalb der Schule. Brunnen zu bohren war dort überaus schwierig, wegen dem „Brasilianischem Schild“, einer sehr dicken Steinplatte, weit unten, durch die es fast kein Durchkommen gibt. Unsere Kapelle war, wie die meisten Häuser der Indios – manche hatten nur aus Bananenblättern geflochtene Wände – aus ungebrannten Lehmziegeln bebaut und mit Stroh gedeckt. Luzi hat später, zusammen mit P. José Schicker eine schöne neue Kirche gebaut. Luzis Aufgaben waren überaus vielfältig. Maria Fabianek aus Retz, Niederösterreich, begleitete Luzi noch mehrere Wochen. Gleich in den ersten Tagen nach unserer Ankunft lernte Luzi wie man Hütten ausgast, um sie von der Vinchuca zu befreien, einem Käfer, welcher den „Mal de Chagas“ verursacht. Diese Krankheit befällt vor allem die glatte Muskulatur, kann zu stellenweiser Darmlähmung, Operation möglich, aber auch zur Lähmung des Herzmuskels und damit zum Tod führen. Später hat Luzi der Vinchuca mit einer Ziegelei, zuallererst für Dachziegeln, den Wohnraum genommen. Auf giftiges Gas konnte damit verzichtet werden. Anfangs hatten wir noch eine Köchin. Als wir später nur noch zu zweit waren, fanden wir es gemütlicher, alleine zu sein. Luzi kochte gerne und sehr gut. Ich half ihr gelegentlich, wenigstens beim Abwasch. Luzi backte Fladenbrot, so wie in ihrer Heimat. Wir hatten einen mit Cerusen betriebenen Tiefkühlschrank, so konnten wir sogar immer leckeres, weiches Brot essen. Luzi war, vor allem auch als Ansprechperson für die Missionsstation, irgendwie eigentlich immer beschäftigt. Es gab in San Antonio ihre Arbeit mit den Frauen, u. a. im Garten, unten beim Atachado, einem großen Teich. Und da waren die „Mariposas“, Schmetterlinge, größere Mädchen, welchen sie besonders viel Zeit widmete, oft auch zwischendurch. Luzi organisierte für den „Club Social“ und zeitweise wohl auch für die Cooperativa der Bauern. Ich erinnere mich dunkel daran, dass Luzi auch zur „Patrina“ des Fußballclubs von San Antonio ernannt wurde. Leider weiß ich nicht mehr, was mit dieser Ehre an Aufgaben verbunden war. Am Campo, in den weit verstreuten Dörfern, war die Freude groß, wenn Luzi kam. Sie lehrte dort in meiner Zeit vor allem zu stricken. Es ist so schön Fertigkeiten weitergeben zu dürfen, an Menschen die gierig danach sind zu lernen. Was für eine Freude, für Zeiten vom kalten Südwind, für die Kleinen Sockerln und Jackerln zu stricken. Ich las in einem alten Brief, dass Luzi sich bei einer Freundin meiner Mama für Geld bedankte, von dem sie Wolle einkaufen konnte. Im Krankenhaus waren am ersten Morgen nach unserer Ankunft die Bänke im Eingangsbereich voll besetzt. Da waren auch die Lehrerin und der Direktor der Schule. Vermutlich wollten sie mich nur ~5~ kennenlernen, Weiße, welche einige Zeit am Land arbeiten mussten. Die junge Lehrerin kam öfters. Erst später verstand ich, dass sie ganz einfach Freundschaft suchte und Luzi ihr viel besser hätte helfen können, als mein „Ratgeber für praktische Ärzte“. An meinen ersten Hausbesuch erinnere ich mich auch noch. Ein Vater kam um Salbe. Seine kleine Tochter war ins Feuer gestiegen und hatte sich das Füßchen verbrannt. Ich wollte sie gerne selber verbinden und ging mit ihm auf einem Pfad nach Irisiwikia, einer kleinen Siedlung in der Nachbarschaft. So wunderschön war diese Gegend, auf einem Hügel gelegen… und so lieb war dieses kleine Mädchen. Im Spital half mir Domingo, ein Campesino, Bauer, welcher von meiner Vorgängerin ausgebildet, auch ein sehr geschickter Sanitario war. Domingo wohnte mit seiner Familie in der Nähe unseres kleinen Krankenhauses. Auch in den meisten anderen Dörfern gab es ausgebildete Sanitarios. Es war meine Aufgabe sie gelegentlich zu besuchen, ihre Apotheke zu kontrollieren, mich über Krankheitsfälle zu erkundigen und Weiterbildungen zu organisieren. Luzi ist erst später draufgekommen, wie groß die Not von behinderten Menschen in Lomerio war. Ich habe nie welche gesehen. Nie erzählte uns jemand davon. Zum Glück hatten Luzi und Anni in Mödling selbstgenähte, kleine Kasperpuppen mit dabei. Die Ausbildung war teilweise so organisiert, dass wir uns gegenseitig unterrichteten. Mechaniker lehrten u. a. was man anstelle von Keilriemen einsetzen könnte, wir Krankenschwestern gaben Erste Hilfe Kurse, die Hebamme lehrte uns Geburtshilfe. Luzi´s Kasperl diente nun dazu, dass sie uns zeigen konnte, wie man einem Babys in Steißlage zur Welt hilft. Der kleine Kasperl wurde durch zu einem Becken geformten Fingern und Daumen geführt. Schon nach 10 Tagen kam eine Frau mit Querlage. Wie überglücklich war ich über den kräftigen kleinen Erdenbürger, „meinem“ ersten Baby! Allerdings, ich hatte einen großen Fehler gemacht, mein wichtigstes Buch, der Geburtshilfepschyrembel, kam erst im November. Dort las ich dann, dass ich nur hätte helfen dürfen, bis die Füßchen geboren waren, damit die Ärmchen auf der Brust bleiben, und nicht Gefahr besteht, dass sie über den Kopf rutschen. Ich hatte so viel Glück in Situationen, für die ich zu wenig ausgebildet war. Meistens schlief niemand im Krankenhaus. Leute die zur Behandlung nach San Antonio kamen, hatten Platz bei ihren Verwandten, sie waren es nicht gewohnt, in Betten zu liegen. Einmal sah ich nachts, bei einem Krankenbesuch in einer eher kleinen Hütte, wie unglaublich viele Menschen hier in ihren Hängematten Platz fanden, oben, unten, einfach auch durcheinander. Es war deshalb auch überhaupt kein Problem, mehrtägige große Kurse abzuhalten für Sakristane z. B., aus allen Ranchos. Heidi, eine deutsche Krankenschwester welche in Concepcion arbeitete, hatte mich in die Impfprogramme eingeführt. Die Menschen waren dankbar dafür, denn es war noch nicht lange, dass in Lomerio viele an Gelbfieber gestorben waren. Heidi besuchte mit mir im September mehrere Ranchos und hat auch für uns Impfstoffe bestellt. Besonders wichtig war es die Neugeborenen möglichst bald gegen Tuberkulose zu impfen. Mein Lieblingspatient wurde der 5- jährige Jesus. Dieser so heilige Name ist dort üblich. Er hatte sich, beim einzigen Fahrrad, welches es vermutlich in ganz Lomerio gab, die Ferse schwer verletzt. Zuvor ist das auch schon einem größeren Kind passiert, welches am Packelträger hatte aufsitzen dürfen. Täglich wurde er von seiner vielleicht 10- jährigen Schwester ins KH getragen. Sein besorgtes „despascito Senorita!“ – langsam, vorsichtig, Fräulein, hat in mir so besonders viel Zärtlichkeit für ihn geweckt. Es war mir wichtig, Jesus jeden Tag in seine Hütte zurücktragen zu dürfen. Zweimal täglich war Funkkontakt, notfalls auch öfters. Vom Konvent in Santa Cruz, meist von Bruder Diego, wurden alle Pfarren kontaktiert, zum Schluss war frei für Gespräche Concepcion – San Antonio. Ich konnte auch den Arzt zum Radio holen lassen. Dr. Arzabe kam monatlich, wenn notwendig auch öfters nach Lomerio. P. Pio war irgendwie besorgt um uns und kam noch öfter den weiten Weg nach San Antonio. Kapellen gab es in allen größeren Dörfern. Hier wurden von 2 – 3 Sakristanen gemeinsam wunderschöne Wortgottesdienste gestaltet. Zentrum unserer Liturgie war die Verehrung der Bibel, oder in der Fastenzeit ~6~ die Verehrung des Kreuzes. Ich war sehr berührt von den so klaren, einprägsamen Predigten der Campesinos, von ihrem tiefen Glauben. Einmal, so erzählte Pio, wollten der Nuntius und noch ein anderer Bischof aus dem Hochland in der Trockenzeit auf dem Landweg nach Concepcion. Als gerade die Glocke zum sonntäglichen Gottesdienst läutete, kamen sie in Santo Rosario vorbei, unserem nördlichsten Rancho. Sie machten Halt um sich „das zu geben“. Die Bischöfe erzählten überaus beeindruckt und berührt von der schönen, innigen Art unserer Sakristane Gottesdienst zu feiern. Damals, vor 40 Jahren, wurde in unseren Dörfern beim Gottesdienst noch ausschließlich Geige gespielt. Manche Melodien waren mir von rhythmischen Kirchenliedern bekannt. Erst später kamen auch Trommeln und Flöten in den Gottesdienst. Dieser Brauch, nur Geigen zu verwenden, ging noch zurück auf die Zeit des Jesuitenstaates in Paraguay, welcher heraufreichte bis ins südöstliche Bolivien. Einmal hatte unser Geigenbauer sein Messer im Wald verloren. Ich schenkte ihm mein Taschenmesser, es hatte nach heutigem Geld vielleicht 3 Euro gekostet. Er baute für mich eine Geige! Luzi hat mir diese später mitgebracht: Nur die Saiten wurden vom Händler gekauft, alles andere sind Naturmaterialien, vom Rinderhornteil, an welchem die Saiten unten befestigt sind, bis zu den Pferdehaaren vom Bogen. Für mich wurde diese Geige ein Zeichen dafür, dass man von Freundschaften sehr viel mehr zurückbekommt, als man geben kann. War P. Pio da, so gab es am Sonntag Heilige Messe, dazu kamen dann auch die Bewohner der umliegenden Dörfer nach San Antonio. Begonnen wurden alle unsere Gottesdienste nach dem Eintreffen der Bewohner von Asunta, diese hatten nämlich damals noch keine eigene Kapelle. Unser Pfarrer verstand sich u. v. a. auch darauf Cerusenherd und Motorräder zu reparieren. Es war einfach schön, miteinander zu sein, zu hören, wie lustig es in Franziskanerklöstern sein kann, oder welche Erfahrungen er mit seinen Freunden, u. a. ganz ausgezeichneten Piloten, gemacht hatte. Luzi, Pio und ich, wir waren wie Geschwister. So gerne hörten wir Pios Geschichten. Geschichten von P. Pius Waldenmaier Es gab da ein Abenteuer mit eingebildeten deutschen Jugendlichen, welche auf ihrer Weltreise bis Concepcion gekommen waren. Sie unterhielten sich am Flugplatz mit Pio über die Künste deutscher Piloten und meinten, Bolivianer würden niemals so gut fliegen können wie Deutsche. Pios Freund wollte wissen, was die beiden gesagt hätten. Pio übersetzte, da bat sie der Flieger einzusteigen und zeigte ihnen seine Künste, es war einfach irre. Unglaublichste Kunststücke konnten nun miterlebt werden. Käseweiß und schlottrig, heilfroh aussteigen zu dürfen, verabschiedeten sich die beiden. Auch von einer perfekten Notlandung hörten wir: Eine feine Dame wurde erst beim Aussteigen ohnmächtig, als sie sah, dass sie nicht auf einem Flugplatz, sondern einem Feld, von Wildnis umgeben, gelandet war. Pio erzählte auch von meiner Vor- Vorgängerin, einer deutschen Krankenschwester. Sie trank gerne Schnaps, wenn sie längere Zeit im Regen unterwegs gewesen war und hatte Angst vor Moskitos, deshalb verwendete sie eine Hängematte mit Moskitonetz. Sie hatte auch Angst vor Schlangen, deshalb befestigte sie ihre Hängematte möglichst hoch in den Bäumen. Einmal passierte es ihr, dass sie aus der Hängematte fiel und hilflos im Netz baumelte. Einmal ist Pio mit einem seiner Freunde zwei Wochen lang nach Norden in die Gummiwälder geritten, zu winzigen Dörfern, welche zur Pfarrei Concepcion gehörten. Nachts haben die beiden den Weg durch den Wald mit ihren Hängematten verschlossen, dazwischen konnten die Pferde grasen. Kam man zu einer Wasserlache, so tranken zuerst die Pferde. Nahmen sie von dem Wasser, so war es auch für Menschen genießbar. Muss man mit einem Pferd durch einen Fluss, so ist es notwendig in dessen Nähe zu schwimmen. Denn, wenn es das Tier mit der Angst zu tun bekommt, so bläht es sich auf, kann nicht mehr schwimmen ~7~ und wird abgetrieben. Wenn sich das Pferd aufbläht, so muss man es fest an den Ohren ziehen, damit es die Luft wieder raus lässt und weiter schwimmt. Nur einmal hörte ich davon, dass ein Mädchen von einem Piranha verletz worden wäre. Pio aber erzählte wie es wäre, Kühe durch von Piranhas verseuchte Flüsse zu treiben. Eine Kuh würde geopfert, die anderen könnten danach gefahrlos flußabwärts den Fluss überqueren. Es gab da nämlich früher einen Schlachthof in Concepcion. Fast jede Woche soll eines der Flugzeuge, welche Fleisch abtransportierten, unterwegs nach Chile abgestürzt sein. Irgendwann gab es keine „Fleischbomber“ und keinen Schlachthof mehr. Viele Kühe ersetzen Baumaschinen: Um einen Flugplatz zu festigen, werden Herden so lange hin und her getrieben, bis sicherlich keine unterirdischen Gänge und Höhlen mehr vorhanden sind. Ganz so einfach ist es für Piloten auf einem solchen Flugfeld freilich nicht. Luzi hat mir einmal ein Foto geschickt von einer festsitzenden Lloyd, das Vorderrad war in der Regenzeit sehr tief eingesunken, es wurde freigeschaufelt! Unterwegs in Lomerio Längere Strecken waren wir gemeinsam unterwegs. Hatte ich meine Arbeit getan, so strickte ich zusammen mit Luzi und den Frauen, damit es beim nächsten „Sur“, einem kalten Südwind, wenigstens den kleinen Kinder es ein wenig warm hätten. In unseren Sommermonaten konnte es in Lomerio tagelang ziemlich kalt sein. Die Indios blieben an solchen Tagen in ihren Hütten und zündeten drinnen ein Feuer an. Sie rochen danach sehr stark nach Rauch. Mit starkem Rauch hatten wir es zu tun, wenn unser Weg an neuen Chacos vorbeiführte, in denen gerade Brandrodung stattfand. Einmal wollte ich gegen Abend vom Campo wieder zurück sein, verpasste bei San José Obrero die Abzweigung, fuhr weiter nach Süden und kam danach über einen breiteren Weg, schwer verspätet nach San Antonio. Kein Mensch war zu sehen, auch Luzi war weg. Müde wie ich war, ging ich schlafen. Lange nach Mitternacht wurde ich mit Gejohle geweckt. Luzi kam ins Zimmer und meinte, ich müsse dringend aufstehen und meine vielen Retter bewirten. Als ich bei Einbruch der Dunkelheit noch nicht zurück war, hatte sich ein ganzer Anhänger voll mit Leuten mit dem Traktor der Cooperativa, eine Leihgabe des Bischofs, auf den Weg gemacht um mir zu helfen. Es hätte ja sein können, dass mein Moto ein Problem gehabt hätte. Außerdem war ein Traktorausflug natürlich lustig, noch dazu in der Nacht. Meine Spur wurde verfolgt bis zu einem Baum, welcher quer lag. Das gab Geschrei und harte Arbeit. Mit dem Motorrad hatte ich locker daneben durch den Wald schliefen können. Es war eine so fröhliche nächtliche Runde! Die Indios waren aber auch wirklich besorgt um uns. Einmal haben die Männer P. Pio zu einer Ratsversammlung gebeten, weil das Gerücht umging, ein in Santa Cruz entlaufener Mörder würde sich in unserer Gegend aufhalten. Also: entweder sollten wir nur noch in Begleitung reiten, oder immer einen der Männer am Motorrad mitnehmen. Pio meinte, weder das eine noch das andere wäre notwendig, denn: „Die Señoritas stehen unter dem Schutz der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz!“ Ein Besucher von „Terre des Hommes“ aus der Schweiz, diese Organisation hatte an unserem Krankenhaus mitgebaut und stellte Impfstoffe zur Verfügung, meinte, wir sollten unbedingt Helme tragen. Wenn irgend ein Schutz, so wären vielleicht Lederhosen sinnvoll gewesen, denn einmal rutschte ich in der Regenzeit vom zerklüfteten Weg ab und brannte mir am Auspuff den Schenkel. Es war mühsam, mich aus der tiefen Rinne zu befreien. Sofort operieren… kann fast 14 Stunden dauern Für November bekamen wir eine Einladung zu einem Entwicklungshelfertreffen, in ein Dorf im Nachbarvikariat. Eine lange Reise, wenn dafür Flüge notwendig sind. Ich blieb lieber zurück und das war gut so. Von Coloradillio, einem Dorf in etwas mehr als 10 km Entfernung, kam die Nachricht, dass es Probleme bei einer Geburt gäbe. Ich fuhr hin, bemerkte zuviel an Fruchtwasser, dachte die Herztöne des Babys zu hören, weil ich nicht wusste, dass ich vergleichen hätte müssen: Auch Gebärende können einen sehr hohen Puls haben. Mit dem Auftrag mich zu holen wenn die Wehen stärker würden, verzog ich mich mit meiner Hängematte in den Nebenraum der Kapelle. Gegen Mitternacht wurde ich wach und fand die Gebärende ~8~ blutend hinter der Hütte. Ich tastete eine vorgelagerte Plazenta, ein sofortiger Kaiserschnitt war notwendig. Die bereits achtfache (? höchstwahrscheinlich habe ich es mir richtig gemerkt) Mutter wurde in eine mit Leder ausgelegte Hängematte gelegt, selbige an eine Stange gebunden, immer zwei und zwei Männer liefen mit der Patientin in Richtung Krankenhaus. Ich spritzte Wehenhemmer, überlegte die Dosen, um den Blutdruck nicht gar zu weit abfallen zu lassen und fuhr voraus. In San Pablo und San Martin umrundete ich den Dorfplatz, Hunde halfen mir dabei Männer aufzuwecken, damit die Träger sich möglichst oft abwechseln konnten. In San Antonio angekommen nötigte ich einige dieser Helfer dann auch noch dazu, Blut zu spenden. Das ist nicht ganz so leicht für Indios. Ich appellierte an ihren Mut, dann aber auch an meinen eigenen: hatte übersehen, dass im Labor eines der Seren fehlte, ohne welche man Blut nicht transfundieren darf. Zum Glück wusste ich, dass fast alle reinrassigen Indios die Blutgruppe 0 pos haben. Ich fragte also nach ev. Weißen in der Familiengeschichte, solche gab es keine. Als Belohnung ging ich an Pios Vorrat an Bier. An diesem Tag erlebte ich ganz tiefe Geborgenheit und Sicherheit in mir. Ich wusste einfach, dass das gut ausgeht. Mir war bewusst geworden, unterwegs in der Nacht, dass Gott da ist, ich nicht alleine bin mit schwierigen Entscheidungen. Um 6:00 war Funkkontakt möglich. Erst um 13:15 war der Arzt da. Er fuhr er mit dem Auto, was länger dauerte, um zwei Operationsschwestern mitnehmen zu können. In der Zwischenzeit saß ich u. a. vor dem Instrumentenschrank und überlegte, was zu sterilisieren sei, ausgekocht werden müsse und stellte den von Isabell Lea Prüller, meiner Vorgängerin entworfenen, von einem Handwerker in Concepcion angefertigten „Dampfsterilisator“ mit OP- Wäsche auf den Herd. Aber dieses Gefäß mit Einsatz und Blechdeckel war doch niemals ein Sterilisator!!! Steril wird das Zeug doch nur unter Druck! Sollte ich bügeln? Aber damit hatte ich sehr schlechte Erfahrung. Einmal wollte ich mich im Haushalt nützlich machen und bügelte Kirchenwäsche. Für eine Albe war ich zweimal bei der Nachbarin um glühende Kohlen für unser Bügeleisen! Also: mir vorstellen, dass es reicht, wenn Mäntel, Tücher….. irgendwie eben bedampft würden. Inzwischen gibt es in San Antonio natürlich längst einen Autoklaven. Was ich nicht vorbereitet hatte: Die Lumbalpunktionsnadel. Ich wusste nicht, dass man Kaiserschnitt mit „Rückenmarkanästhesie“ machen kann. Als das Baby da war, bemühte ich mich es zu beleben. Ich sollte das bleiben lassen, meinte der Arzt. „Sicher?“ – „Allersicherst!!!“ Ich wollte nicht glauben, aber er sah Zeichen dafür, Haut hatte sich bereits abgelöst, dass das Baby schon seit mindestens zwei Tagen tot war. Eine Woche danach ging die Patientin schon wieder nach Hause. Besuche waren herzlich willkommen. P. Pius Waldthaler, einen besonders lieben, schon recht alten Tiroler Franziskaner, hatte Luzi in San Ignacio kennengelernt. Er war begeistert von der Idee, bei uns in Lomerio Urlaub machen zu können. Einmal wollte der alte Pius Vogel essen. Er hatte seine Büchse mitgebracht, also begleitete Luzi ihn hinunter zum Atachado. Sie musste zu einem angeschossenen Vogel schwimmen um ihn ans Ufer zu holen. Luzi zeigte mir danach ihren ziemlich arg zerkratzten und angehakten Arm….. Dieser Pius freute sich besonders über unsere gut eingerichtete Speisekammer. Einmal wünschte er sich mittags feine kleine Nuderln zu essen. Luzi war dagegen, sie wollte diese nur als Suppeneinlage kochen. Die lustigste Geschichte vom alten Pio: Er war jahrzehntelang in Bolivien, bis er, so um 1960 über Rom, wieder einmal heim nach Südtirol reisen konnte. Die Grenzbeamten dachten er wäre verrückt, weil sie nicht wussten, dass dieser Mann mit italienischem Pass eben spanisch sprach und nicht verrücktes Italienisch. Manchmal nahm der junge Pius auch Schwestern mit nach Lomerio. Die Oberin der mexikanischen Ordensgemeinschaft von Concepcion war außer sich darüber, dass Luzi selber für uns kochte, wir den Haushalt alleine machten und animierte damit ihre Schwestern so sehr, dass sie unbedingt für uns Hausarbeit leisten wollten. Sie putzten rundum. ~9~ Abends unterrichtete ich, als wir nicht mehr so weit wie sonst ins Campo fahren konnten, einige Male die Männer der Cooperativa im Rechnen. Damals gab es nur vier Jahre Schulpflicht und die Lehrer kamen oft mit großer Verspätung nach Beginn des Schuljahres. Es soll Lehrer gegeben haben, die selber nur fünf Jahre lang die Schule besucht hatten. Als P. Pio Waldenmaier, unser Chef, einmal wieder Schwestern mitbrachte, wollte deren Oberin miterleben wie ich unterrichtete, aber ich blieb solange stumm, bis sie und Pio wieder weg waren. Schließlich war sie Lehrerin und ich nicht und mein Spanisch war im Vergleich zu Luzis schwer mangelhaft geblieben. Es war jedenfalls großartig, wie so, so schnell diese Männer alles verstanden, wie gierig sie drauf waren zu lernen, einfach alles, was ihnen angeboten werden konnte. Einmal, nachts, bei einer Geburt auf dem Campo, erklärte ich zwischendurch vor der Hütte wie sich Mond und Erde bewegen. Gerne erzählte ich auch von meiner Heimat. Einmal zeigte ich ein Foto von meinem Elternhaus, erntete damit aber irgendwie eine Art von Erschrecken. Ich versuchte zu erklären, dass es eben wegen der Kälte in meiner Heimat so fest und gut gebaute Häuser gäbe. Als unser Tiefkühlschrank abgetaut werden musste, zeigten wir den Kindern eine Schaufel voll von sowas wie Eisschnee. Sie staunten sehr, als wir erzählten, dass bei uns im Winter anstelle von Regen Schnee vom Himmel fällt und monatelang die Landschaft bedeckt hält. Besuche bei den Indios um ihre Arbeit, ihr Leben kennenzulernen, waren nicht nur für Luzi, sondern auch für mich interessant. So setzte ich mich abends einmal in der Nachbarschaft an einen schmalen Holztrog um mit einer Steinplatte Mais zu mahlen. Nach kurzer Zeit waren meine Hände mit Blasen übersät. Reis schälen ging leichter. Reis kommt in eine tief ausgehöhlte Mulde eines stehenden, ungefähr einen Meter hohen, bearbeiteten Baumstamm. Mit einem großen hölzernen Stößel werden die Schalen aufgebrochen. Mit zwei Schüsseln aus einer Art von getrockneter Kürbisschale, wird das Getreide geputzt. Man gießt den Inhalt der Schale von möglichst weit oben in die mit der anderen Hand unten gehaltene Schale. Das gehört einige Male wiederholt, der Luftzug verbläst die Spreu. Unsere Tiere waren die Hunde Flicki und Flocki, die Pferde Niataki und Uschiantai, sowie Hühner. Einmal hatten wir ein „Fakierhenne“, sie brütete in der Werkstatt in der Nagelkiste. Eine andere wollte in der Kapelle im Beichtstuhl brüten. Mit Glück überlebten ein paar Kücken. Zeitweise fanden wir sogar täglich ein, zwei Eier. In meinen ersten Tagen im Krankenhaus fragte ich Domingo um den Namen von großen dicken Vögeln, welche auf einem hohem Baum hinter dem Krankenhaus hockten. Er lachte! Es waren seine Hühner! Flicki und Flocki bewachten hauptsächlich den Eingang zur Küche. Kam ein Schweinchen zu nahe, so wurde es beim Ohrwaschl gepackt und auf den Weg hinaus begleitet. Als Luzi eine Woche lang beim ÖEDTreffen war, gesellten sich zu den beiden auch noch ein Flecki und ein Flucki. Schließlich umschmeichelte mich auch noch ein Flacki. Pio meinte, 2 Hunde würden genügen, Luzi hat die zugelaufen drei dann nicht mehr gefüttert. Wir waren dankbar, dass wir täglich von einem Nachbarn Milch bekommen konnten. Gemolken wurde dort zu dritt: Einer hält die Kuh, einer das Kalb, der Dritte hält mit einer Hand die Flasche, melkt mit der anderen in den Flaschenhals. Auch Fleisch konnten wir von den Indios kaufen. Unsere Pferde weideten im Portrero, einer durch Brandrodung geschaffenen Wiese, oder auch heroben beim Spital. Einmal traf ich im Wald, auf dem Weg zurück von den Pferden, Augustina, die Frau des Sanitarios, welche dort Holz gesammelt hatte und half ihr. Sie konnte sehr viel mehr auf ihrem Kopf tragen, als ich in den Armen. Einmal kam ein Mann von einem acht Reitstunden entfernten Dorf um Babymilch. Es gab dorthin nur einen Reitpfad. Auf solchen Pfaden waren wir nie unterwegs. Im weiten Wald lebten auch Ayoreoindianer, Nomaden. Von ihnen weiß ich nur aus Erzählungen, dass sie sich in Notfällen medizinische Hilfe holten. Dafür kommt eine Gruppe von ihnen mit dem Patienten nur bis ~ 10 ~ zum Waldrand, nicht ins Dorf, da sie große Scheu haben vor Weißen. Ich sah nur, was Pius von ihnen für Hilfe geschenkt bekam, er an uns weiterschenkte: Wunderschön geflochtene Taschen, aus natürlich eingefärbten Fasern, welche sie mit eingeflochtenem Band über der Stirn tragen. Affen sahen wir vor Beginn der Regenzeit unterwegs sehr viele, hoch oben auf den Bäumen. Als der Regen einsetzte, war das Laub im Wald stellenweise auch über dem Weg wie ein dichtes Dach. Affen sahen wir dann nur noch als Hausaffen in einem weiter entfernten Rancho. Sie saßen oben auf den Dächern. Von mehreren hatte ich den Namen erfahren: sie alle hießen Martin! Nur Martins wurden mir bekannt gemacht. Von Raubkatzen waren nur Felle in Concepcion zu sehen. Diese Tiere sind sehr scheu. Schlangen gäbe es viele in Lomerio, so hörten wir schon in Mödling von einem Tropenarzt, welcher von dieser Gegend wusste. Einmal trafen Luzi und ich im Jeep mit P. Pio auf ein Cascabel- Boa, eine sehr seltene Art von giftiger Riesenschlange. Die allermeisten Riesenschlangen sind nämlich nicht giftig. Sie lag quer über dem Weg, so, dass wir weder Kopf noch Schwanzende sehen konnten. Pio überfuhr die Schlange, sie ringelte sich ein, ein riesiger Haufen! Er musste sie töten, weil sie sonst gefährlich geworden wäre für andere Leute. Pio überfuhr sie zigmal, bis sie sicher tot war. Die allergiftigste Schlange dort ist eine kleine, die Korallenschlange. Eine solche lag einmal auf dem Schreibtisch, bei den Schreibgeräten vom schwer sehbehinderten Bischof Rosenhammer in San Ingnacio. Der Sekretär erstarrte. Er hielt den Kopf mit einem Lineal fest und schnitt mit dem Messer den Leib ab. Dieser Bischof war übrigens der Onkel vom Schwager meiner Schwiegermutter in Maria Schmolln, OÖ. Vor Bolivien hatte ich Angst vor Schlangen. Dort aber war klar, dass man im Freien im Dunkeln keinen Schritt ohne Taschenlampe machen dürfe und die Türen geschlossen gehalten werden müssen. Einmal kam eine Vogelspinne zu uns ins Esszimmer. Pio war gerade da, nahm einen Besenstiel und hielt ihn über die Spinne. Da krallte sie sich von allen Seiten an diesem Stiel fest und konnte erdrückt werden. Wir hatten natürlich Mittel gegen Schlangenbisse, nie habe ich davon gebraucht. Und in jener kurzen Zeit, acht Monate, in denen ich in Lomerio war, habe ich auch nicht davon gehört, dass es einen Schlangenbiss gegeben hätte. Gefährlich ist die Jagd nach Gürteltieren, weil diese oft zusammen mit Schlangen wohnen, sowie die Erdnussernte. Mein Kollege, so nannte ich den Curandero, den Heiler von San Martin, erlaubt mir, Patienten in seiner Hütte zu besuchen. Wenn ich kam, so ging er hinaus in den Wald. Der Arzt war nur dann zuständig, wenn Patienten bereit waren ins Krankenhaus zu kommen. Eines Tages fand ich dort einen schwerstkranken jungen Mann, mit für mich völlig unklaren Symptomen. Er erkärte mir, dass seine Krankheit vom Bösen wäre und weiße Medizin sie nicht heilen könnte. Deshalb hatte er sich, beim Krankenhaus vorbei, von Asunta nach San Martin tragen lassen. Ein paar Tage später trug man seinen Leichnam durch San Antonio. Dieser Mann war mit vergifteter Chicha getötet worden, schon das 4. Opfer einer Brucha, einer „Hexe“. Man hatte eine oben abgeschlagene Flasche mit Gift in ihrer Hütte vergraben gefunden und in die Pfarrei gebracht. Die Grundsubstanz war Friedhofserde, dazu pflanzliche Gifte und auch Schlagengift, sowie Säure, oder Paste? aus einer Batterie. Alleine schon der ätzende Geruch war so was von schlimm. Bestrafung musste sein. Die Frage war, ob alte oder neue Justiz. Also: Schläge oder Gefängnis. Alle waren für alte Justiz, denn auch andere Frauen hätten Gift, so wurde behauptet bzw. befürchtet. Außerdem würde die Frau im Gefängnis der Stadt verhungern, wenn ihr niemand zu essen bringen würde. Für mich war diese Entscheidung völlig unmöglich. Ich stellte mich gegen alle, versuche mit der Gefangenen zu sprechen, wollte sie als irgendwie „geistig unzurechnungsfähig“ erklären, aber das ging nicht, weil ich einen Übersetzter brauchte. Sie sprach nur Chiquitano. Ich wollte unbedingt eine Möglichkeit finden, diese grausame Strafe von ihr abzuwenden. Keine Chance, auch der Arzt, der Pfarrer, einfach alle waren für alte Justiz. Soweit ich mich erinnere, hat Luzi sich nicht dazu geäußert. ~ 11 ~ P. Pio beschloss, es war kurz vor dem 8. Dezember, dass wir zum Fest nach Concepcion fahren müssten. Als wir weg waren, wurde das Urteil vollstreckt: 125 Hiebe. Eigentlich waren es 100, aber ihr eigener Vater hatte zusätzliche 25 geben lassen. Die Frau überlebte. Mit jener Strafe und mehrere Wochen später einer Beichte dieser Frau, war alles wieder gut. Die Bewohner von Asunta hatten bereits überlegt woanders hin zu ziehen. Nun waren sie entschlossen zu bleiben und sich in Asunta sogar eine eigene Kapelle zu bauen. Der weite Weg nach Concepcion war so schön auf unseren Motos. Sogar Hugo Banzer, der deutschstämmige Staatspräsident, Bolivien war damals eine Militärdiktatur, kam in diesem Jahr mit seiner Frau zum großen Fest. Concepcion war sein Heimatdorf, er ist hier geboren worden. Luzi wollte für das Fest ihre Haare geschnitten haben. Obwohl ich das nicht konnte, musste ich ihr die Haare schneiden. Das Ergebnis war schlimm, aber wir fanden eine nette Lehrerin, welche meinen Pfusch ausbessern konnte. Die Frauen von Concepcion, sie stammten z. T. von Einwanderern ab, hätten größte Freude mit Katalogen, wie z. B. jenen von Quelle, erzählte Pio. Sie nähen damit Mode nach. Als Maßband genügen die gespreizten Finger einer Hand. Sehr geschickt messen und schneiden sie so Stoffe zu. Einmal fuhren wir zu dritt, im Jeep in Salinas, unserem südlichsten Dorf. Da mit dem Auto, hatte ich zum Glück auch Infusionen mitgenommen. Eine Frau mit schwerem Schwangerschaftserbrechen, war damit schnell geheilt. Es war ja so einfach, aber das Erstaunen der Leute darüber war groß. Luzi und ich staunten ganz besonders darüber, wie fest und fein dort eine Frau Hängematten webte. Ihr Webstuhl war nichts anderes als zwei Holzbalken in einem Gestell übereinander. Darauf war die „Kette“ (Längsfäden) gespannt. Von einem Fadengeflecht wurden mit den Fingern der einen Hand die Fäden auseinander gehalten. Die zweite Hand schiebt den “Schuss“, Querfaden, soweit durch, bis die andere Hand wieder an jenem Geflecht fingern muss, welches wie das „Geschirr“ auf unseren Webstühlen, die Fäden abwechselnd hinauf und hinunter, hier eben nur nach vorne zieht. Gesponnen wurde am Boden sitzend, Frauen und Mädchen drehten die Spindel mit der rechten Hand zwischen großer und zweiter Zehe. Mit der linken Hand wird Baumwolle in Kopfhöhe gehalten und der Faden vorbereitet. Luzi hatte einen Rucksack voll Wolle mitgenommen. Leider weiß ich nicht mehr, wie das mit den Nadeln war. Wenn ich mich recht erinnere, so haben manche Frauen sich auch Nadeln aus Holz zugerichtet. Wir handarbeiteten mit den Frauen, bis es dunkel wurde. Als es schon ganz finster war, hockte Pio noch immer bei Beichtgesprächen. Er schlief in seiner Hängematte in einem Verschlag der Kapelle, wir in der Schule. Morgens bekamen wir dort sogar gewärmtes Wasser um uns ein wenig zu waschen. Bewirtet wurden wir, wenn wir über die Nacht am Campo waren, mit gebratener Yuca, oder auch Reis mit Trockenfleisch darin gekocht. Einmal gab es winzig kleine Fische, auf zwei feinen Hölzern aufgespießt, gebraten. Ich knapperte daran herum, weil ich noch nicht wusste, dass man diese Fische eben als ganze isst. „Locro“ heißt das übliche Festessen, dabei handelt es sich um eine Art von dicker Reissuppe mit Hühnerfleisch. „Minga“ bedeutet sowohl miteinander am Gemeinschaftschaco arbeiten, als auch miteinander essen. Campesinos haben ihre eigenen Äcker, aber auch solche, welche gemeinsam bearbeitet werden. Jene gemeinsam bewirtschafteten Chacos, brachten die Freude der Minga, bei welcher auch meist Locro gegessen wurde, mit sich. Zu Beginn der Regenzeit kam Pio mit dem Unimog. Buben wurden eingeladen die Umgebung vom Krankenhaus mit Buschmessern zu roden. Als Belohnung fuhren wir miteinander an eine Stelle des Rio Zapoco, wo man gut baden konnte. Es war herrlich. Einmal ritten Luzi und ich nach Fatima und blieben über die Nacht. Abends, nach der Arbeit, als wir unsere Pferde versorgt, die Hängematten angebracht hatten, kam noch ein junger Papa und bat mich zu kommen um sein Neugeborenes zu untersuchen. Die Eltern erzählten nichts, was Besorgnis hätte erregen können. Ich sah ein so liebes Baby und es war einfach schön, mich mit den Eltern darüber zu freuen. ~ 12 ~ Die junge Familie wohnte auf der anderen Seite des Flusses. Es gab dort eine Hängebrücke, das Wasser war tief. Ich musste einfach noch ein paarmal von der Brücke köpfeln, es war so wunderschön! Singend ritten wir am nächsten Tag zurück. Daran erinnere ich mich gut. Wir mussten einfach singen und suchten Lieder die nur Freude ausdrücken. Wie herrlich war dieses Leben! Unterwegs in den Städten, schon in Mödling und Wien, haben wir auch Heimwehlieder gesungen: Z. B. von den Rosen die in der Heimat blühen „Schwer mit den Schätzen des Orients beladen, ziehet ein Schlifflein am Horizont dahin“. Luzi hat mir auch das so traurige Lied gesungen: „Muatal geh, vazöhl mir, woasch sell nimmamea. Wia mia zu Tirol kean, isch wohl longe her. – Eijo fraili woas i, muas wohl a so sein. – Biabal schliaßt de Auiglan und schloft trauri ein…“ Die Geschichte Südtirols ist mir als kleines Kind sehr nahe gegangen. Ich konnte nicht verstehen, warum der Heilige Vater, welcher doch auch in Italien lebt, nichts gegen so großes Unrecht tut. Es ging bei jenem Lied auch um einen großen Graben, über welchen es keine Brücke gibt. Inzwischen aber gibt es viele Brücken in Südtirol: Vor allem jene eines so vorbildlichen Miteinanders. Und unserer Luzi war es möglich, in ihrem ganz besonders intensiven, überaus reichen Leben, viele neue Brücken zu bauen! Wie die Brennerautobahnbrücke, so weit und so besonders! Dr. Arzabe, ein überaus begabter und hochengagierter Arzt, blieb viel länger als von der Regierung vorgeschrieben am Campo. Er war Cochabambino und hätte in seiner Heimatstadt Karriere machen können, wollte aber lieber mit seiner Familie in Concepcion bleiben um den Indios zu helfen. Ein paarmal war er genau dann bei uns, wenn er hier besonders notwendig gebraucht wurde. Einmal war ein zweijähriger Bub aus einer brennenden Hütte gerettet worden. Der Arzt wusch mit Kalium Permanganat alle verbrannte Haut ab, mich lehrte er dazu Gasnarkose. Wir improvisierten einen Bettbogen, damit die Wunden möglichst offen bleiben konnten. Die Mama des Kleinen war selbstverständlich immer bei ihm. Ein andermal kam ein Mädchen mit Atemproblemen. Damals war ich selber schon krank und dachte nicht richtig zu hören. Die Lunge war „voll“, nur noch auf einer Seite ganz oben „hell“. Antibiotika, klar! Am nächsten Tag kam der Arzt, verordnete Höchstdosen von einem Mix, aber es war längst zu spät. Als ich einmal ganz dringend Infusionen brauchte, war Dr. Arzabe nicht weit von San Antonio. Wie groß war meine Freude, diesem wunderbaren Arzt und seiner Tochter, zusammen mit Lea, meiner Vorgängerin, und Matthias Lentsch, vor vielleicht 10 Jahren, bei Luzi am Ritten oben zu begegnen. Zurück zum Dezember 1975: Bevor die Flüsse zu hoch wurden, wollte José Arzabe noch einmal nach Lomerio, aber er kam nicht. Am nächsten Tag fuhren Domingo und ich ihm mit dem Moto entgegen, über Fatima. Dort konnte man den Zapoco, mit Hilfe von Indios, welche das Motorrad auf eine Stange gebunden über die Hängebrücke tragen, queren. Der Arzt begegnete uns ohne Moto und ohne seine Tasche. Sein Motorrad war bereits im ersten Fluss abgesoffen. Er hatte sich ein Pferd ausgeborgt, ritt durch die Nacht, stieg irgendwann ab um sich eine Zigarettenpause zu gönnen. Das Pferd, erschrocken durch den Feuerschein, es war nicht fest genug gehalten, galoppierte heim. Der Inhalt seiner Tasche, welche sich geöffnet hatte, war von den Indios eingesammelt worden, u. a. die vielen Instrumente seines Zahnziehsets. Domingo und der Arzt wollten, dass ich vorausfahre, sie würden lieber zu Fuß gehen. Arzabe organisierte auch mit an der Cooperativa und da gab es viel zu überlegen und zu besprechen. Der Weg führte auch durch einen Sumpf. Dieser war mit Rundlingen ausgelegt, d. h., dass alle dieser Hölzer in der Regenzeit geschwommen sind. Auf der Hinfahrt ist Domingo vorausgegangen um den Weg zu bahnen. Ich war zu wenig vorsichtig, eines der Hölzer spießte, durch den Sturz wurde die Gangschaltung beschädigt. Ich konnte zwar den Griff abmontieren, aber das Gangseil nicht wieder einfädeln, dazu fehlte es mir an Geschick oder an Kraft. Jedenfalls habe ich vor dem nächsten Fluss das Moto stehen lassen. Für den normalen Weg war das Wasser schon zu hoch und mit Vollgas wollte ich auch im 1. Gang nicht über den glitschigen Felsen fahren. ~ 13 ~ Die Folge davon: Ich hatte einen Patienten im Spital! Den Arzt – er hatte ohnehin dort sein Zimmer. Dr. Arzabe hatte das Moto repariert, ist dann aber auf jenem Felsen im Fluss gestürzt und hatte ein paar Tage lang ein ziemlich „schlimmes“ Knie. Vor Weihnachten kam P. Pio noch einmal mit dem Unimog. Für die Rückfahrt hat er dann zweieinhalb Tage gebraucht, denn er war, wegen glaziger Reifen, vom Weg abgerutscht. Ein Eisenbaumwurzelstock musste teilweise unter dem Dieseltank zersägt werden. Zum Glück hatten wir noch den Traktor mit Seilwinde da. Wir bewunderten sehr, wie geschickt die Campesinos arbeiten. Und, ich war sehr froh darüber, dass der Traktor den Unimog begleiten musste. Pio hatte ein kleines Zahnziehset nach Lomerio gebracht, der Arzt mich gelehrt Zähne zu ziehen. Aber es fehlte mir vor allem an Erfahrung. Beim armen Traktorfahrer war mir der Zahn abgebrochen. In Concepcion entfernte der Arzt dann auch die Wurzel. Stille Nacht wurde von unseren Indios wie Marschmusik gesungen, ich versuchte ihnen das bei den Vorbereitungen auf Weihnachten abzugewöhnen, fühlte mich als Salzburgerin verpflichtet ihnen beizubringen, dass man nicht abgehackt: „Tötötö, tötötö“ singt, vergebens. Schon lange Zeit vor Weihnachten war ein Packerl mit Lebkuchen von meiner Mama in Santa Cruz eingetroffen. Sie hatte diesen bereits im Sommer gebacken! Bruder Diego meinte am Radio: „Leckere Sache! Ein Eck ist abgerissen, habe die Schachtel bereits halbleer gegessen!“ Dabei war sie noch fast ganz voll. Meine Schwester hatte uns ein Tischtuch mit Schneerosen drauf gedruckt geschickt. Es war so schön, wie sich die Kinder freuten, und auch die Frauen, beim Backen von Milchbrötchen aus weißem Mehl, zusammen mit Luzi! Es gab dazu Kakao aus Pulvermilch, gekocht in einem der Länge nach halbierten Benzinfass. Mit Pio feierten wir Weihnachten erst im Jänner. Er hatte uns u. a. einen Plastikchristbaum mitgebracht und Äpfel aus Chile. Neujahr wird vor allem mit Alkohol gefeiert. Leider auch mit Schnaps. Schnaps kam in der Trochenzeit mit einem Händler aus Santa Cruz. Er kaufte Erdnüsse, eine Aroba, das sind 11 kg, um 86 Pesos. Die Rolle Stacheldraht, notwendig um Wildtiere von der Ernte fernzuhalten, kostete 250 Peso. Wie viel Zuckerrohrschnaps kostete, weiß ich nicht. Da die meisten Erwachsenen die ersten Tage des neuen Jahres von Hütte zu Hütte wandern, dort die Olien, große Tongefäße, mit Chicha leertrinken, kümmerte sich Luzi um die Kinder. Zu mir kam eine Frau mit Platzwunde am Kopf, um sich nähen zu lassen. Ihr Mann hatte sie geschlagen. Der Unterschied zwischen Neujahrsfest und Karneval ist der, dass sich am dritten Tag vom Karneval die Männer das Gesicht mit Schlamm beschmieren und diesen eintrocknen lassen. Mein größter Erfolg war um diese Zeit, dass mein Kollege, der Curandero von San Martin, sich von mir hat helfen lassen! Bei einer Rauferei war ihm das Schlüsselbein gebrochen worden. Was für eine Freude für mich, ihm einen Tornisterverband anlegen zu dürfen. Er war zufrieden damit, dieser Verband stillt den Schmerz durch Fixierung. Später wollte ich gerne von ihm lernen, aber das war leider nicht mehr möglich. Neujahr und Karneval waren mitschuldig an Sklaverei, welche es damals in Bolivien auch noch im direkten Sinne gab. „Patrones“ gaben zu diesen Festen Schnaps aus, jeder bekam tagelang zu trinken, so viel er mochte. Damit aber waren diese Menschen ihrem Herrn für das gesamte neue Jahr die Arbeit schuldig. Mit dem Militärdienst, so die Hoffnung, würde sich dieses Unrecht aufhören, weil nun alle jungen Männer ein anderes Leben kennenlernen konnten. Unser Bischof schickte zur Vorsicht Landvermesser, damit die Campesinos ins Grundbuch eingetragen wurden und nicht mehr so leicht enteignet werden konnten. Als Pio im Jänner die Flüsse wieder passieren konnte, war ich sehr froh, weil er Miguel mitnehmen konnte. In der Hütte des Curandero hatte ich den 12- jährigen gefunden. Lange war er wegen Gelenkstuberkulose bei uns in Behandlung gewesen. Der Arzt meinte, er müsse nun in das große Missionssspital, nach San ~ 14 ~ Ignacio, wo es viel Erfahrung mit TBC gab. Bei der Untersuchung in Concepcion war dann aber klar, dass der Bub zur Amputation nach Santa Cruz müsste. Die Geschwulst war bereits entartet. Was für ein Schreck. Ich konnte mir Miguel ganz alleine in der Stadt, für eine so große Operation, nicht vorstellen und beschloss, ihn bei nächster Gelegenheit zu besuchen. Abgeschnitten, durch die Flüsse, waren wir nur ein paar Wochen, es war überhaupt kein Problem. Wir konnten sogar über Radio kurze Nachrichten diktieren, Pio schrieb nach Südtirol und in den Pinzgau. Wenn wir abends den Lichtmotor anwarfen, es war ja auch die Batterie für das Radio ab und zu aufzuladen, so konnten wir Platten hören mit klassischer Musik. Gerne half ich Luzi nun mehr bei ihrer Arbeit mit den Frauen, z. B. beim Zuschneiden. Ich weiß nicht, ob sie die Schnitte für Kinderhosen selber gezeichnet hatte, jedenfalls bewunderte ich so sehr, wie viel sie irgendwie gleichzeitig tat. Auch über die Fertigkeit der Frauen, welche mit winzig kleinen Stichen wunderschön nähen konnten, habe ich gestaunt. Nun war auch der Kurs für die Sakristane vorzubereiten. Von allen Dörfern würden in ein paar Wochen die Gottesdienstleiter für mehrere Tage nach San Antonio kommen, P. Miguel aus Santa Cruz war angesagt. Als P. Pio das nächste Mal da war, nahm er mich beim Wort und meinte, ich sollte unbedingt zur Entspannung eine Woche in die Stadt, Miguel besuchen und mich ausruhen. Er meinte, ich wäre irgendwie erholungsbedürftig. Ich wollte nicht, hatte überhaupt keine Lust darauf wegzufahren, aber schließlich willigte ich ein. In Concepcion traf ich am Flugplatz die Generaloberin der mexikanischen Schwestern. Sie lud mich ein, in Santa Cruz in ihrem Schwesternhaus zu wohnen. Das war sehr lieb von ihr. Aber, was war mit mir los? Ich war sehr krank geworden. In Santa Cruz konnte ich gerade noch Miguel besuchen, ihm bringen was er sich wünschte, mehr nicht. Es gab ein Mädchen bei diesen Schwestern, welches manchmal mit mir spazieren ging. Ansonsten irrte ich durch die Stadt und fand nirgends Ruhe. In der Kathedrale waren Zimmerleute am Werk. Abgeschnitten, im brutalsten Sinn des Wortes, von den so vielen lieben Menschen rundum und von allen inneren Kräften, fühlte ich mich danach auch in San Antonio. Ich musste und konnte fast nichts, bis gar nichts mehr tun. Ganz unmöglich war es mir beim Sakristanenkurs Erste Hilfe zu unterrichten wie geplant. Ich konnte nur noch bei Leseübungen sitzen, ab und zu ausbessern, eine Zeile wiederholen lassen. Wie schrecklich muss das für Luzi gewesen sein und für Pio. Einmal fühlte ich mich fast wieder gesund, hatte aber über 40° Fieber. Als das Fieber wieder weg war, ging es mir so schlecht, dass die Patienten zu mir ans Bett kamen. Ich schrieb für Domingo auf einen Zettel, was er an Medikamenten etc. geben sollte. An einem Morgen konnte ich nur noch einen Fuß ein wenig bewegen, nicht mehr sprechen, nur noch lallen. Damit war klar, dass ich heimfliegen musste. Zum Glück war Dr. Arzabe nicht weit von San Antonio am Campo. Er kam, hängte mir Infusionen an, danach konnte ich mich wieder bewegen. Im Rahmen einer schweren, unbehandelten Depression kann es zu Elektrolytentgleisungen kommen, welche Lähmungen mit sich bringen. Luzi begleitete mich nach Santa Cruz und zwang mich Mitbringsel einzukaufen. D. h. sie wählte ganz einfach für mich aus. Dafür war ich ihr später ganz besonders dankbar. Heidi begleitete mich nach Wien, sie wollte ohnehin gerade nach Deutschland fliegen. Warum nur kam ich in eine so schlimme Situation, wo ich doch so glücklich war in Lomerio!? Zwei Jahre später wusste ich es, dank eines Zeitungsartikels und eines Priesters, welcher sich mit Psychologie beschäftigte: 6- 8 Wochen nach einem massiven Ereignis kann eine „Endogene“ Depression ausbrechen. Mein Vater war ein herzensguter, überaus fleißiger und hochmusikalischer Mann, ich liebte ihn sehr. Schwer belastet durch den Krieg und die Tatsache, dass auf unserem Bergbauernhof eine Generation lang „der Mann gefehlt“ hatte, war er zeitweise sehr „nervös“. Tati musste unendlich viel und sehr hart arbeiten. Als das gesündeste (schlimmste) von den vier älteren Kindern wusste ich, was es heißt eingesperrt zu sein ~ 15 ~ und auf Schläge zu warten. Diese Erfahrung aus meinem Unterbewussten hatte sich mit der Situation jener Frau aus Asunta getroffen, welche in einer Kammer der Schule eingesperrt war und auf Schläge warten musste. Dankbar bin ich auch für die so schwierigen letzten Monate, von Mitte Jänner bis Ende April 1976 in Bolivien. Luzi hatte mir zum Namenstag einen „Baumstamm“, eine Rollade gebacken. Sie wusste von mir abzuhalten, was mich zusätzlich belastet hätte, als sie einsehen musste, dass aufmunternde Worte nichts nützten. Ihre Anwesenheit war eine große Erleichterung, vor allem wenn sie mir, darum bettelte ich sie, Geschichten erzählte. Geschichten lenkten mich ab von meiner Verzweiflung. Besonders kostbar ist es für mich jetzt zu wissen, dass man „aus eigener Kraft“ rein gar nichts tun kann, sich nicht einmal bewegen. Mir wurde dadurch mit der Zeit große Dankbarkeit, Freude und Gelassenheit geschenkt. Überaus vorsichtig wurde ich mit Bemerkungen wie: „Er müsste doch..“, „sie sollte unbedingt….“. Es kann eine Glanzleistung sein, wenn Menschen, aus welchen Gründen auch immer, wenigstens für sich selber sorgen können. Schlüssel in der Nachfolge Jesu Seit Luzi tot ist, stelle ich sie mir oft in unserer Kirche von St. Peter/ Au, in einem wunderschönen Gemälde von der Schlüsselübergabe vor. Ein berühmter Maler, der „Kremser Schmidt“, hat dem Petrus eine kräftige Hand gemalt. Auch Luzi hatte eine „starke Hand“, auch sie hat „Schlüssel von Jesus angenommen“ und damit vielen „den Himmel aufgesperrt“, mehr Freude am Leben geschenkt, weiß Gott wie und wo, überall wo sie hingekommen ist. Eine schöne Aufgabe wurde es für mich, dank Freunden meines Gatten, Informations- und Vernetzungsarbeit für eine gerechtere Geldordnung zu leisten. Meine so schmerzliche Erfahrung aus Bolivien wurde hier wichtig, denn: Personen, welche auf Grund von viel zu viel an Geld allen Herausforderungen des Lebens aus dem Weg gehen können, sind gefährdet, so um die 60, an Sinn- und Vertrauenskrisen zu erkranken, depressiv zu werden. Dazu kommt, dass strukturbedingt voraussehbare Entwicklungen an den Finanzmärkten, 2008/ 09 eine ganze Reihe prominenter Banker in Verzweiflung stürzten. Sie sahen eigenes Versagen und wurden so zum Selbstmord verleitet, weil sie dachten „ihr Gesicht verloren zu haben“. Gerne möchte ich weiterzusagen, wie bitter arm und elend Superreiche sein können! Im Gespräch mit einem Mitglied von einer der reichsten Familien in Österreich habe ich erfahren, dass es Menschen in seinem Bekanntenkreis jetzt so geht, als hätten sie ein Kind an der Front! Es wäre ihnen viel geholfen mit mehr Wissen über gerechtere Modelle für unsere Geldordnung. Es wäre möglich, Geld in einer „Wertaufbewahrungswährung“ einzufrieren. Ich hörte auch von Lustlosigkeit, z. B. von einer Frau, welche nicht einmal selber Tee kochen kann. Sie hatte zum Geburtstag ein Haus an einer Küste geschenkt bekommen. Aber wozu, wenn die Freude daran fehlt. Es geht nicht nur um den Umgang mit Geld, um viel oder wenig haben, sondern darum, dass unsere Geldordnung mit einem alten, längst überforderten Computer vergleichbar ist. Neue Programme, beste Software nützt nichts, wenn der Rechner selber ein Ablaufdatum hat und nur noch mühsam in Gang zu halten ist. Es gibt einige wenige Menschen, welche meinen sich gegen eine bessere Finanzstruktur wehren zu müssen, weil sie die Macht des Unrechts durch Geld als Ersatzbefriedigung brauchen. Beten wir für die Verantwortlichen um Freude am überparteilichen Miteinander, für Auswege aus der Krise. Wir alle dürfen mitbauen an Wegen des Friedens! Vor allem auch mit Freundschaft, welche Ihre Hilfe schenkt. Sie helfen schwierige Situationen zu überwinden, zufrieden, dankbar und frei zu werden. In Luzis Namen darf ich Ihnen schreiben: DANKE für ALLES! Südtirol ist, seiner Geschichte wegen, ein so wunderschönes Vorzeigeland für den Frieden! Mit jedem guten Gedanken bauen Sie mit an der Hoffnung auf neue Wege – für weltweit! ~ 16 ~