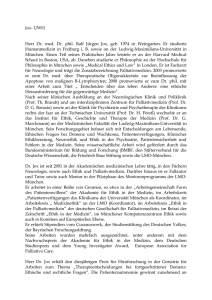Die Angehörigenbürgschaft
Werbung

Einführung in die Pflegeethik WS 2007/08 Institut für Ethik und Recht in der Medizin O.Univ.Prof. Dr. Ulrich Körtner Semesterplan Ort: Großer Hörsaal am Institut für Physiologie (MedUni), Schwarzspanierstr. 17, 1090 Wien Termine Mi, 10.10.07 Vorlesungsbeginn Mi, 17.10.07 Mi, 31.10.07 Mi, 7.11.07 Mi, 14.11.07 Mi, 28.11.07 Mi, 5.12.07 Mi, 12.12.07 Mi, 9.1.08 Mi, 16.1.08 Mi, 24.1.08 Klausur 2 Aufbau der Vorlesung 0. Einleitung 0.1 Pflegeethik – ein neues Fachgebiet der Gesundheitsethik 0.2 Zielsetzung und Aufbau der Vorlesung 0.3 Literatur 1. Ethik, Ethos und Moral 1.1 Ethik und Moral im Alltag 1.2 Begriffsbestimmungen 1.3 Grunddimensionen der Ethik 1.4 Typen der Ethik 1.4.1 Normative und deskriptive Ethik 1.4.2 Deontologische und teleologische Ethik 1.4.3 Pflichtenlehre, Tugendlehre und Güterlehre 1.4.4 Verantwortungsethik und Diskursethik 1.5 Theoretische Ethik, angewandte Ethik und Bereichsethik 3 2. Gesundheitsethik, Medizinethik, Pflegeethik 2.1 Ethik des Gesundheitswesens 2.2 Gegenstand und Aufgabe medizinischer Ethik 2.3 Ethik des Heilens und „therapeutischer Imperativ“ 2.4 Medizinethik und Pflegeethik 3. Ethik und Recht in der Pflege 3.1 Medizinrecht 3.2 Rechtliche Bestimmungen für den gehobenen Pflegedienst und die Pflegehilfe 3.3 Patientenrechte 3.3.1 Menschenrechte und Grundrechte 3.3.2 Spezielle Patientenrechte 4. Ethik und Anthropologie 4.1 Pflegeethik, Medizinethik und Menschenbild 4.2 Der Begriff der Person 4.3 Das Subjekt der Pflege und der Medizin 4 5. Grundlagen und Probleme der Pflegeethik 5.1 „professional attitudes“ in der Pflege 5.2 Strukturprobleme des Pflegeberufs 5.3 Pflegeethik, Care-Ethik und Ethik des Helfens 5.3.1 Ethik des Helfens 5.3.2 Macht und Ohnmacht in der Pflege 5.3.3 Care-Ethik 5.4 Der Begriff Verantwortung 5.4.1 Begriffsgeschichte 5.4.2 Verantwortung als Begriff der Moral 5.4.3 Pflichtenlehre, Güterlehre und Tugendlehre aus verantwortungsethischer Sicht 5.5 Ethosforschung und Geschichte der Pflege 5.6 Interkulturelle und transkulturelle Pflege 5.6.1 Pflege in einer multikulturellen Gesellschaft 5.6.2 Transkulturelle Pflege, Naturrecht und Menschenrechte 5 6. Ethische Prinzipien und pflegeethische Kompetenz 6.1 Ebenen pflege- und medizinethischer Probleme 6.2 Prinzipien und Grundregeln der Pflegeethik und der Medizinethik 6.2.1 Kulturelle Normen und Werte 6.2.2 Vier Prinzipien der Pflegeethik und der Medizinethik 6.2.3 Gerechtigkeit in Pflege und Medizin 6.2.4 Weitere ethische Regeln 6 7. Schritte ethischer Urteilsbildung 7.1 Methoden der Ethik und ihre Grenzen 7.2 Modell der ethischen Urteilsbildung nach D. Lange 7.3 Einzelfallgerechtigkeit 8. Arbeits- und Funktionsweise Klinischer Ethikkomitees 8.1 Ethik im Krankenhaus 8.2 Arbeitsweise Klinischer Ethikkomitees 8.3 Zusammensetzung eines Klinischen Ethikkomitees 9. Ethik in der Pflegeforschung 9.1 Pflegewissenschaft und Pflegeforschung 9.2 Ethische Grundsätze der Pflegeforschung 7 10. Menschenwürdig sterben 10.1 Das medizinisch begleitete Sterben 10.2 Die Einsamkeit der Sterbenden 10.3 Autonomie am Lebensende 10.4 Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit von Leiden 10.5 Tun und Lassen 11. Behandlungsabbruch und Sterbehilfe 11.1 Palliative Care 11.2 Begriff und Formen der Sterbehilfe 11.3 Passive und indirekte Euthanasie 11.4 Tötung auf Verlangen und medizinisch assistierter Suizid 11.4.1 Euthanasie 11.4.2 Medizinisch assistierter Suizid 11.5 Leitsätze zum Verständnis von Menschsein und Menschlichkeit im Blick auf das Euthanasieproblem 8 12. Intensivmedizin und Transplantationsmedizin 12.1 Hirntod 12.2 Zur Ethik der Transplantationsmedizin 12.3 Gesetzliche Regelungen 12.4 Ethische Probleme der Transplantationsmedizin 12.5 Organaustausch und Allokation 9 Literatur Körtner, U. (2004): Grundkurs Pflegeethik (UTB 2514), Facultas, Wien van der Arend, A. (1998): Pflegeethik. Urban & Fischer, München van der Arend, A. / Gastmans, Chr. (1996): Ethik für Pflegende, Verlag Hans Huber, Bern Beauchamp, T.L. / Childress, J.F. (1994): Principles of Biomedical Ethics, 4. Aufl. Oxford University Press, New York / Oxford 10 Benner, P. (2000): Stufen zur Pflegekompetenz. From Novice to Expert, 3. Nachdruck. Verlag Hans Huber, Bern Bobbert, M. (2003): Pflegeethik als neue Bereichsethik: Konturen, Inhalte, Beispiele, in: Zeitschrift für medizinische Ethik 49, S. 43-63 Fry, S.T. (1994): Ethik in der Pflegepraxis. Anleitung zu ethischen Entscheidungsfindungen. Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, Eschborn Großklaus-Seidel, M. (2001): Ethik im Pflegealltag. Wie Pflegekräfte ihr Handeln reflektieren und begründen können, Kohlhammer, Stuttgart Kemetmüller, E. (Hg.) (2001): Berufsethik und Berufskunde für Pflegeberufe. Verlag Wilhelm Maudrich, Wien Körtner,U. (2007): Ethik im Krankenhaus. Diakonie – Seelsorge – Medizin, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 11 Lay, R. (2004): Ethik in der Pflege. Ein Lehrbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover Remmers, H. (2003): Die Eigenständigkeit einer Pflegeethik, in: Cl. Wiesemann/N. Erichsen/H. Behrendt/N. Biller-Andorno/A. Frewer (Hg.), Pflege und Ethik. Leitfaden für Wissenschaft und Praxis, Kohlhammer, Stuttgart, S. 47-70 van Schayck, A. (2001): Ethisch handeln und entscheiden. Spielräume von Pflegenden und die Selbstbestimmung des Patienten, Kohlhammer, Stuttgart Wallner, J. (2004): Ethik im Gesundheitssystem (UTB 2612), Facultas, Wien Wallner, J. (2007): Health Care zwischen Ethik und Recht, Facultas, Wien Wiesemann, Cl./Erichsen, N./Behrendt, H./Biller-Andorno, N./Frewer, A. (Hg.) (2003): Pflege und Ethik. Leitfaden für Wissenschaft und Praxis, Kohlhammer, Stuttgart 12 Nachträge zu Kap. 2.2: Krankheit als Selbsterfahrung Die „Verborgenheit der Gesundheit“ (H.-G. Gadamer) Gesundheit: „ein Leben unter dem Schweigen der Organe“ (R. Leriche, frz. Chirurg) „Krankheiten verleihen der Beziehung von Körper und Kultur neue Dimensionen. Im Kranksein wird dem Menschen sein Körper oft erst bewußt. [...] Das durch Krankheit veränderte Körpergefühl verändert das Raumund Zeitgefühl wie die sozialen Kontakte und das Selbstbild des Kranken.“ (D. v. Engelhardt) 13 Krankheit erschließt den grundlegenden „Lastcharakter des Daseins“ (M. Heidegger), dessen Bewältigung zu einem guten Leben gehört (F. Akashe-Böhme und G. Böhme). 14 Illness, Sickness und Disease Illness/Sickness: subjektives Krankheitserleben Disease: objektiver Krankheitsbegriff Aus Sicht der Medizin kann jemand eine Krankheit haben, ohne sich subjektiv krank zu fühlen (to feel sick). 15 Die Sichtweise der Psychosomatik: Thema der Medizin und der Pflege sind nicht von der Person abgespaltene Krankheiten, sondern ist der kranke Mensch. WHO-Definition: Gesundheit ist der Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Kritik der WHO-Definition Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Störungen, sondern die Kraft, mit ihnen zu leben (D. Rössler). Es kann also gesunde Kranke und kranke Gesunde geben. 16 Begriffliches Geviert: „gesund“ – „nicht gesund“ „krank“ – „nicht krank“ 17 Krankheit als gesellschaftliche Konstruktion „Medizin ist Naturgeschichte und Kulturgeschichte, sie kann nicht auf Biologie oder Physik begrenzt werden. Gesundheit und Krankheit sind stets deskriptive und zugleich normative Begriffe, sind Seins- und Werturteile – für den einzelnen Menschen wie für die Gesellschaft. (D. v. Engelhardt) 18 Ein biokulturelles Krankheitsmodell David B. Morris (2000) plädiert für ein biokulturelles Krankheitsmodell, das auch die spezifischen Bedingungen von Krankheit und Gesundheit in der postmodernen Gesellschaft verstehen lehrt. Die Einwirkungen der menschlichen Kultur auf die Natur führen nicht nur zu veränderten Interpretationen, sondern zu Eingriffen in Natur und Umwelt, wodurch die Ausbreitung von Krankheiten, aber auch ihre Gestalt verändert werden. Alte Krankheiten verschwinden, völlig neue entstehen. 19 Würdigt man zusätzlich die Eigenständigkeit der Psyche, gelangt man schließlich zu einem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell, wie es J. Willi und E. Heim (1986) vorschlagen. 20 Ein biokulturelles bzw. bio-psycho-soziales Modell von Krankheit und Gesundheit verbessert das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Krankheit und sozialer Stellung, zwischen Krankheit und Geschlecht (in der doppelten Bedeutung von gender und sex) oder auch für die Besonderheiten von Krankheit im Alter. Männer haben z.B. eine durchschnittlich geringere Lebenserwartung als Frauen, diese dagegen eine höhere Morbidität als Männer. Eine Differenzierung der Krankheiten nach Geschlechtern hat sich aber nicht nur am biologischen Geschlecht zu orientieren, sondern auch an unterschiedlichen Krankheitsverläufen, die von sozialen bzw. kulturellen Geschlechterrollen abhängen. 21 Menschen mit niedrigem Einkommen und schlechter Bildung haben ein höheres Krankheitsrisiko als z.B. Akademiker. Spezifische Krankheitsrisiken und Versorgungsprobleme von Migranten Ursachen: - Ausgrenzung - Stigmatisierung - kulturelle Unterschiede - Sprachprobleme 22 Krankheit, Schmerz und Leiden Wie die Krankheit ist auch der Schmerz bio-kulturell zu verstehen. Auch er ist Natur und Kultur zugleich und bedarf der Interpretation. Kulturgeschichte des Schmerzes Krankheit und Schmerz sind zu unterscheiden, können aber auch zu einer ununterscheidbaren Einheit verschmelzen. Das gilt vor allem für chronische Schmerzen, die von akuten Schmerzen zu unterscheiden sind. Die moderne Schmerzmedizin geht davon aus, daß der Schmerz in vielen Fällen nicht etwa nur als Symptom von Krankheit, sondern selbst als Krankheit begriffen werden muß. 23 Ein biokulturelles bzw. bio-psycho-soziales Modell des Schmerzes lehrt uns, den Schmerz nicht nur als Symptom, auch nicht nur als Krankheit zu begreifen, sondern wie Krankheit auch als Metapher (S. Sontag) zu verstehen und zu deuten. Das bedeutet aber auch, daß individuelle oder kollektive Bedeutungszuschreibungen die Schmerzerfahrung wesentlich beeinflussen können. 24 Wie grundsätzlich zwischen Krankheit und Schmerz zu unterscheiden ist, so auch zwischen Krankheit und Leiden. Entsprechend der Unterscheidung zwischen „disease“ und „illness“ bzw. „sickness“ kann man eine Krankheit haben, ohne an ihr zu leiden. Das Leiden ist aber auch vom Schmerz zu unterscheiden, insoweit man auch Schmerzen haben kann ohne zu leiden oder leiden, ohne Schmerzen zu haben. 25 Die Frage des Leidens hat die moderne Medizin – sieht man von der Psychosomatik ab – aus ihrem Zuständigkeitsbereich weitgehend ausgegrenzt und an die Seelsorge oder an die Psychotherapie verwiesen. Das Problem des Leidens führt zur Frage nach dem Sinn von Krankheit, zum Problem der Schuld und von Schuldgefühlen, sowie zum mehrschichtigen Begriff des Opfers (victim oder sacrifice) und der Opferrolle, die Kranken zugeschrieben wird, oder die sich selbst zuschreiben. 26 Trotz seiner Verknüpfung mit biologischen Prozessen ist Leiden also keine feststehende Größe, „sondern ein fließender sozialer Zustand: ein Status, den wir einem anderen zubilligen oder verweigern“ (D.B. Morris). Dabei spielen Werthaltungen einschließlich religiöser Grundorientierungen eine erhebliche Rolle. 27 Krankheit und Biographie Jede Krankheit ist Teil einer Biographie. Die Krankengeschichte geht über die Datensammlung in der Krankenakte weit hinaus. Nicht nur sind die Ursachen von Krankheit möglicherweise in der Biographie eines Patienten zu suchen, sondern Krankheiten strukturieren auch das Leben. „Das war vor, das nach meiner Operation.“ 28 D. Ritschls medizin- und pflegeethisches Story-Konzept W. Schapp: „In Geschichten verstrickt“ Ethische Entscheidungen am Krankenbett setzen eine intensive Beschäftigung mit der Biographie des Patienten voraus. Dazu gehört einerseits seine bisherige Lebensgeschichte in Form seiner „’stilisierte[n]’ Vergangenheit“, andererseits aber auch die „antizipierte Lebensstory“ des Patienten (D. Ritschl). Ohne solche Antizipation läßt sich die Sinnhaftigkeit medizinischen und pflegerischen Tuns und Unterlassens nicht beurteilen. 29 Im Kontext einer Lebensgeschichte bekommt Krankheit ihren spezifischen Sinn. Krankheiten sind Krisenerfahrungen, die einem Leben eine ganz neue Richtung geben können. Und schließlich kann Krankheit geradezu zu einer Lebensform werden, wenn sie einen chronischen oder progredienten Verlauf nimmt. Die Krankheit in das eigene Leben bzw. in die Selbstsicht zu integrieren, stellt den Einzelnen, aber auch seine Familie oder Umgebung vor eine große Herausforderung. 30 Krankheit und Religion Von jeher sind Krankheit und Gesundheit religiöse Themen. Dazu gehört nicht nur die Frage nach dem Zusammenhang von Krankheit und Schuld bzw. Krankheit und Sünde, sondern auch die Frage nach der möglichen Verbindung von Heil und Heilung. Die Kulturgeschichte von Krankheit und Gesundheit ist bis in die Moderne weitgehend auch Religionsgeschichte. Erst die naturwissenschaftlich begründete moderne Medizin führt zu einer Trennung von Medizin und Religion, damit aber auch von Heil und Heilung. 31 Die heutige Aufwertung der Gesundheit zum höchsten Gut („Hauptsache gesund“) ist als neue Form von Religion und Transzendenzsuche im Diesseits einer Gesellschaft zu verstehen, die unter Transzendenzverlust leidet. Auch bei den unterschiedlichen Spielarten einer Alternativ- oder Ganzheitsmedizin, die sich gegen das technokratische Denken der sogenannten Schulmedizin richtet, sind die religiösen Konnotationen unübersehbar. 32 ◊ Die Sinnfrage: • Warum gerade ich? • Warum ausgerechnet diese Krankheit? • Warum jetzt? ◊ Schuld und Schuldgefühle ◊ Angst ◊ Hoffnung ◊ Glaube 33 Heil und Heilung Medizinische Heilung und Heil im religiösen Sinne sind zu unterscheiden, aber nicht strikt zu trennen (Gefahr des Reduktionismus). Gesund und Heil, Heilung und Erlösung, Sein und Sinn betreffen den in sich unteilbaren Menschen, der mehr ist als die Summe seiner anatomischen, physischen und mentalen Teile. 34 Praktisch bedeutet dies, daß nicht nur die somatische Medizin und Psychotherapie, sondern daß auch Medizin, Philosophie und Theologie noch stärker als bisher miteinander ins Gespräch kommen müssen, und zwar nicht nur auf dem Gebiet einer im wesentlichen auf Risikoabschätzung reduzierten medizinischen Ethik, sondern im Bereich anthropologischer Grundfragen. 35 An die Stelle hochgradiger Arbeitsteilung muß das Teamwork aller heilenden Berufe einschließlich der Seelsorge treten, soll der Mensch als Person nicht aus dem Blickfeld geraten. 36 Nachträge zu Kap. 2.4: Pflegeethik – Begriff und Gegenstand Pflegeethik: ein Gebiet der angewandten Ethik bzw. eine Bereichsethik Engl.: nursing ethics/ethics in nursing Andere Beispiele für Bereichsethiken: Medizinethik, Wirtschaftsethik, Wissenschaftsethik, Umweltethik, Technikethik, Medienethik 37 Gegenstand von Pflegeethik ist die ethische Reflexion pflegerischen Handelns. Pflegeethik befaßt sich nicht nur mit Einzelfragen oder Einzelkonflikten im Alltag des Pflegeberufs, sondern reflektiert auch die ethischen Grundlagen und Prinzipien von Pflege und Pflegeberufen. 38 Krankheit, Gesundheit und Pflegebedürftigkeit Frage: Inwiefern sind Krankheit und Gesundheit nicht nur für die die Medizin, sondern auch für die Disziplin der Pflege die legitimatorische bzw. die teleologische Kategorie? Die legitimatorischen Kategorien der Pflege sind Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf. Teleologische Kategorie der Pflege sind Wiedererlangung der Selbständigkeit (d.h. auch Fähigkeit zur Selbstpflege!), Wohlbefinden, Lebensqualität. 39 Ist Krankheit der einzig mögliche Grund für Pflegebedürftigkeit? Ist Selbständigkeit oder Wohlbefinden gleichbedeutend mit Gesundheit? Berufsbezeichnung und Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege beziehen sich auf jenes Feld, in dem sich Krankheit und Pflegebedürftigkeit überschneiden. 40 Verhältnis der Leitbegriffe von Medizin und Pflege Medizin Pflege Krankheit/ Gesundheit Der kranke u. pflegebedürftige Mensch Pflegebedürftigkeit/ Selbständigkeit/Wohlbefinden 41 Entsprechend der verschiedenen Handlungsfelder der Pflege reflektiert Pflegeethik ▷ Pflegepraxis ▷ Pflegemanagement ▷ Pflegepädagogik ▷ Pflegewissenschaft (science in nursing) (Lay 2004: 64ff; im Anschluß an Weidner 2000:12) 42 Verbindungen der Pflegeethik zu anderen Bereichsethiken Ethik in der Pflegepraxis: ☞ Ethik in der Medizin ☞ Ethik in der sozialen Arbeit ● Ethik im Pflegemanagement: ☞ Wirtschaftsethik ☞ Sozialethik ☞ politische Ethik 43 Ethik in der Pflegepädagogik: ☞ Pädagogische Ethik Ethik in der Pflegewissenschaft: ☞ Wissenschaftsethik ☞ Forschungsethik (vgl. Lay 2004: 66) 44 Pflegeethik: Angewandte Ethik oder Bereichsethik? Lay wählt als Oberbegriff „Ethik in der Pflege“ und grenzt den Begriff „Pflegeethik“ auf die Ethik in der Pflegepraxis ein. Die Bezeichnung „Ethik in der Pflege“ entspricht dem Konzept Angewandter Ethik, die hier vorgeschlagene Terminologie dem Konzept der Bereichsethik. Beides ist zu unterscheiden, wogegen Lay die Begriffe „angewandte Ethik“ und „Bereichsethik“ synonym verwendet. 45 Pflege: Aufgabe und Begriff „Pflege ist eine Praxisdisziplin und hat die Aufgabe einzelne Menschen und Gruppen von Menschen verschiedenen Geschlechts, Alters und kultureller Prägung in ihrer Gesundheit zu fördern und zu beraten, sie während einer Krankheit im Genesungsprozess zu unterstützen oder, in chronischen nicht heilbaren Stadien, Wohlbefinden zu ermöglichen und Schmerzen zu lindern.“ (Kühne-Ponesch 2004: 11) 46 „Pflege ist eine Disziplin, bestehen aus Elementen der Forschung, der Philosophie, der Praxis und der Theorie.“ (Kühne-Ponesch 2004: 14) ● Pflege entwickelt sich international immer mehr von einer erfahrungsbezogenen zu einer wissenschaftsbasierten Disziplin. (Mayer 2002) 47 Die Aufgaben der Pflege nach dem ICN-Ethikkodex für Pflegende (Fassung 2000) ● Gesundheit fördern ● Krankheit verhüten ● Gesundheit wieder herstellen ● Leiden lindern. 48 Bereiche der Pflegepraxis (nach P. Benner) Helfen Beraten und Betreuen Diagnostik und Patientenüberwachung Wirkungsvolles Handeln bei Notfällen Durchführen und Übverwachen von Behandlungen Überwachung und Sicherstellung der Qualität der medizinischen Versorgung Organisation und Zusammenarbeit (Benner 2000: 64) 49 Es gibt einen engeren und einen weiteren Begriff der Pflege. Weiter Begriff: Pflege als allgemeine menschliche Fähigkeit, Bedingungen für das Überleben oder Wohlbefinden von Menschen zu sichern (care/caring) Enger Begriff: Pflege als Beruf bzw. als professionelles Handeln (nursing) 50 Pflegeethik im Sinne von „nursing ethics“ setzt den engeren Begriff der Pflege voraus. Eine wichtige Aufgabe für die Grundlegung der Pflegeethik besteht darin, das Verhältnis von caring und nursing zu bestimmen. 51 Nachtrag zu Kap. 3.1 Auch berufsrechtlich wird anerkannt, daß Pflegende es aus Gewissensgründen ablehnen können, an bestimmten Maßnahmen mitzuwirken, auch wenn diese gesetzlich erlaubt oder straffrei sind (Beispiel: Schwangerschaftsabbruch). 52 Nachtrag zu Kap. 4.2: Personbegriff und Leiblichkeit Wenn Personsein und Menschsein in gleichzusetzen sind, gehört die Leiblichkeit wesensmäßig zu unserem Personsein. Was den Leib und die Psyche betrifft, ist von der Person einerseits zu unterscheiden und betrifft andererseits immer auch die Person selbst. Eben darum folgt aus der Würde der Person das Recht auf Leben und Unverletzlichkeit. 53 Was das Verhältnis von Leib und Person betrifft, gilt ein Doppeltes: ● einerseits: Ich bin Leib, ● andererseits: Ich habe einen Leib. Der Leib ist der Träger unserer Personalität und das Medium, durch welches wir mit unserer Umwelt und anderen Menschen kommunizieren. Wenn die Tradition den Menschen als „animal rationale“ (Aristoteles), d.h. als Vernunftwesen definiert, so ist doch unsere Vernunft leibliche Vernunft (M. Merleau-Ponty). 54 Nachtrag zu Kap. 4.3: Frailty – ein neues Konzept in der Geriatrie „Frailty“: „Gebrechlichkeit“, Hinfälligkeit“, „Pflegeabhängigkeit“, „vielfältige Reduktion von Fähigkeiten und funktioneller Autonomie“ Mit diesem Konzept sollen das (vor)schnelle organische Altern des Menschen und die fragile Stabilität bei vielen Hochbetagten beschrieben werden. Der Begriff „Frailty“ stammt ursprünglich aus der Neonatologie. Dort wird der Umstand, daß Frühgeborene trotz Unauffälligkeit der üblichen Laborparameter und Vitalfunktionen nicht gedeihen, als „failure to thrive“ bezeichnet. 55 Außerdem taucht der Frailty-Begriff in demographischen Studien zur Mortalität auf. Z.B. wird das „correlated frailty“Modell im Rahmen von Zwillingsforschung für die genetische Analyse von todesursachenspezifischer Sterblichkeit genutzt. Gebrechlichkeit und Multimorbidität gehören zu den Merkmalen, die man typischerweise mit dem (hohen) Alter verbindet. Hochbetagte haben z.B. ein erhöhtes Risiko von Stürzen, die eine häufige Ursache von Verletzungen, Behinderungen und Tod darstellen. Ein weitere Faktor für Gebrechlichkeit im Alter sind Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder Ernährungsmängel wie Sarkopenie. 56 Allerdings stellt sich die Frage, ob „Frailty“ ein klar umrissenes geriatrisches Konzept oder ein ähnlich unscharfer und subjektiv interpretierbarer Begriff wie „Lebensqualität“ ist. In beiden Fälle ist es nicht leicht, sich auf objektive Parameter zu einigen. Gebrechlichkeit ist schließlich keine Einzelkrankheit, sondern ein krankheits- und alterungsbedingtes, aber auch von lebensweltlichen und sozialen Faktoren abhängiges Syndrom. 57 Bei „Frailty“ handelt es sich um einen „umbrella term“, der sich der Begriff auf sehr unterschiedliche körperliche, psychische oder mentale Zustände und eine mit ihnen verbundene Hilfsbedürftigkeit anwenden läßt. Entsprechend vieldeutig ist die therapeutische und pflegerische Zielsetzung, Gebrechlichkeit durch entsprechende Prophylaxe zu vermeiden oder durch geeignete Konzepte der Rehabilitation zu reduzieren. Gebrechlichkeit und dauerhafte Pflegebedürftigkeit sind nicht selten die bleibenden Folgen von Schlaganfällen, die freilich auch bei jüngeren Menschen auftreten können und insofern kein ausschließlich geriatrisches Krankheitsbild sind. Gebrechlichkeit entsteht schließlich auch im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen. 58 Trotz der definitorischen Schwierigkeiten ist der Begriff der Gebrechlichkeit aber im geriatrischen Kontext sinnvoll, weil er eine „ganzheitliche“ Sichtweise von Multimorbidität und ihrer Anwirkungen auf die individuellen Lebensumstände und die subjektiv empfundene Lebensqualität alter Menschen fördert. Unzureichend wäre es freilich, Gebrechlichkeit unter rein medizinischen Gesichtspunkten zu diskutieren. Ein umfassendes Konzept von Gebrechlichkeit muß sozialwissenschaftliche, anthropologische und ethische Aspekte einbeziehen. 59 Nachtrag zu Kap. 7.2 ▷ Beachte: Viele vermeintlich ethische Probleme in Pflege und Medizin sind in Wahrheit Kommunikationsprobleme. ▷ Die Schritte 1-3 dienen der Klärung folgender Frage: Handelt es sich bei dem konkreten Problem tatsächlich um ein ethisches? Was ist die ethische Komponente im konkreten Konfliktfall? 60 Nachtrag zu Kap. 10.1: Recht auf Leben – Recht auf Sterben Allerdings ist ethisch und rechtlich zu beachten, daß aus dem Recht auf Leben keine Pflicht zum Leben abzuleiten ist. Praktisch folgt hieraus das Recht auf Verweigerung einer Heilbehandlung. Wie das Sterben zum Leben gehört, so gibt es auch ein Recht auf das Sterben. Frage allerdings, ob das Recht auf den eigenen Tod auch im Sinne eines Rechts, sich zu töten oder auf Verlangen getötet zu werden, auszulegen ist. 61 Nachträge zu Kap. 10.3: Autonomie und Souveränität Gehören Krankheit und Sterben zum Leben dazu, ist nicht Autonomie, sondern Souveränität das angemessene Persönlichkeitsideal. „Ein Mensch ist souverän, wenn er mit sich etwas geschehen lassen und Abhängigkeiten hinnehmen kann.“ (Akashe-Böhme/Böhme 2005: 62). Dieser Gedanke berührt sich mit wesentlichen Einsichten des christlichen Glaubens und seines Verständnisses von Menschenwürde, die auch Schwerstkranke und Menschen mit Behinderungen nicht verlieren können. 62 Patientenverfügungen Für den Fall, daß ein Patient oder eine Patientin selbst nicht (mehr) entscheidungsfähig ist, besteht die Möglichkeit, seine Selbstbestimmung durch eine Patientenverfügung oder eine Patientenvollmacht zu sichern. • Eine Patientenverfügung ist ein Dokument, in dem die Patientin oder der Patient für den Fall, daß er seinen Willen nicht mehr bilden oder äußern kann, Verfügungen über Anwendung oder Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen oder den Einsatz bestimmter Therapien trifft. 63 Eine Vorsorgevollmacht ist ein Dokument, in dem der Patient oder die Patientin für den Fall eigener Entscheidungsunfähigkeit eine Person ihres Vertrauens bevollmächtigt, an ihrer Stelle alle erforderlichen Entscheidungen über ihre ärztliche Behandlung zu treffen und sie mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin abzusprechen. 64 Verbindlichkeit und Reichweite von Patientenverfügungen Die Verbindlichkeit und die Reichweite von Patientenverfügungen ist rechtlich und ethisch umstritten. Fragen: 1. Was sind die Kriterien für die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen? 2. Sollen Patientenverfügungen nur für „irreversibel zum Tode führenden Grundleiden“ und für die „Sterbephase“ gelten? (Sog. Reichweitenbegrenzung) 3. Was heißt „mutmaßlicher Wille“? Trägt diese Gedankenfigur z.B. noch bei Patienten mit fortgeschrittener Demenzerkrankung oder bei langjährigem Wachkoma? 65 Argumente für Reichweitenbegrenzung Die Pflicht zur Fürsorge kann in Spannung und Konflikt zum Postulat der Selbstbestimmung treten. Im Zweifel für das Leben Ohne Reichweitenbegrenzung können Patienten durch ihre Umgebung unter Druck gesetzt werden. Mißbrauchsmöglichkeiten und mangelnde Abgrenzung gegen Euthanasie und Suizidbeihilfe. 66 Argumente gegen Reichweitenbegrenzung Formulierungen wie „Wille des Patienten“ oder Begrenzung auf ein „irreversibel zum Tod führendes Grundleiden“ täuschen eine Exaktheit vor, die es so im wirklichen leben nicht gibt Bei Multimorbidität kann Therapiebegrenzung oder –abbruch ethisch gerechtfertigt sein, obwohl keines der einzelnen Leiden irreversibel zum Tode führt. 67 Umgekehrt kann trotz irreversiblen Grundleidens – z.B. einer Krebserkrankung – über Jahre ein weitgehend normales Leben möglich sein, d.h. vor einem eintretenden Notfall eine relativ günstige Prognose bestehen. Patienten dürfen nicht durch das Fürsorgeprinzip paternalistisch bevormundet werden. Der Respekt vor der Selbstbestimmung des Patienten ist vielmehr eine Implikation der Fürsorge. 68 Patientencharta (BGBl 153/2002): Art. 18: „Patienten und Patientinnen haben das Recht, im Vorhinein Willensäußerungen abzugeben, durch die sie für den Fall des Verlustes ihrer Handlungsfähigkeit das Unterbleiben einer Behandlung oder bestimmter Behandlungsmethoden wünschen, damit bei künftigen medizinischen Entscheidungen so weit wie möglich darauf Bedacht genommen werden kann.“ 69 Rechtlich bedeutsam sind v.a. Art. 110 StGB (Verbot der eigenmächtigen Heilbehandlung) Art. 8 EMRK Österreichisches Patientenverfügungsgesetz 2006 (PatVG; BGBl Nr.55, 8.5.2006) Novelle des Sachwalterrechts: § 284 f-h Sachwalterrechts-Änderungsgesetz (SWRÄG) 2006 (BGBl Nr. 92, 23.6.2006) 70 Hauptinhalte des PatVG Eine Patientenverfügung ist eine Willenserklärung, deren Gegenstand nur Ablehnung einer bestimmten medizinische Maßnahme sein kann. Gegenstand sind also keine Maßnahmen der Pflege! Die Grundversorgung mit Nahrung und Flüssigkeit als Teil der Pflege kann durch eine Patientenverfügung nicht ausgeschlossen werden. Das gilt jedoch nicht für die Sondenernährung, da es sich hierbei um eine medizinische Maßnahme handelt. Grundsätzlich gibt es keine Reichweitenbegrenzung. 71 Der Patient oder die Patientin kann nichts rechtlich Verbotenes vom Arzt oder der Ärztin verlangen. Es ist daher ausgeschlossen, den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe in einer Patientenverfügung zu formulieren. Derartige Bestimmungen wäre nichtig. Patientenverfügungen können sich nur auf medizinische Maßnahmen erstrecken, die dem Stand der Forschung entsprechen. Der Patient oder die Patientin kann keine medizinisch nicht indizierte Behandlung verlangen. 72 Ist nur eine einzige Behandlungsform nach ärztlicher Wissenschaft und Erfahrung indiziert, dann ist diese durchzuführen, vorausgesetzt, es liegt die Zustimmung des Patienten (informed consent) vor. Nur wenn zwei oder mehrere verschiedene Behandlungsmethoden vorliegen, steht dem Patienten oder der Patientin die Entscheidungsbefugnis über die Wahl der Methode zu, indem er oder sie die nicht gewünschte(n) Maßnahmen ablehnt. 73 Die Verbindlichkeit ist an folgende Bedingungen geknüpft: Eine Patientenverfügung kann nur von einem einsichts- und urteilsfähigen Patienten errichtet werden (ab 14 Jahren!). Sie muß frei und ernstlich erklärt sein; sie darf nicht durch Irrtum, durch List, durch Täuschung oder durch physischen oder psychischen Zwang veranlaßt sein. Der Errichtung einer Patientenverfügung muß eine der Krankheitssituation und der medizinischen Behandlung entsprechende ärztliche Aufklärung vorausgehen, die der Arzt in der Patientenverfügung urkundlich zu bestätigen hat. Zusätzlich ist eine rechtliche, urkundlich bestätigte Aufklärung erforderlich. 74 Die Patientenverfügung muß schriftlich errichtet werden, indem der Patient die Urkunde entweder eigenhändig schreibt und unterfertigt oder in Gegenwart von drei unbefangenen und eigenberechtigten Zeugen unterfertigt. Kann der Patient die schriftliche Patientenverfügung nicht selbst unterfertigen, so hat er, nachdem ihm die Verfügung in Gegenwart von drei unbefangenen und eigenberechtigten zeugen vorgelesen wurde, zu bekräftigen, daß sie seinem Willen entspricht. Das ist von den Zeugen durch eigenhändige Unterschrift zu bestätigen. 75 Die Krankheitssituation und jene medizinischen Maßnahmen, die Gegenstand der Ablehnung oder Einwilligung sind, müssen konkret beschrieben sein oder eindeutig aus dem Gesamtzusammenhang der verbindlichen Patientenverfügung hervorgehen. Eine verbindliche Patientenverfügung ist spätestens fünf Jahre nach ihrer Errichtung oder ihrer letzten Erneuerung unter Einhaltung der genannten Formerfordernisse (Schriftlichkeit) zu erneuern. Dafür ist abermals eine entsprechende ärztliche und rechtliche Aufklärung erforderlich, die jeweils neu zu dokumentieren ist. 76 Patientenverfügungen, die nicht verbindlich sind, sind jedenfalls als Orientierungshilfe heranzuziehen. Eine Patientenverfügung, die von vornherein als Orientierungshilfe gedacht ist – und das werden in der Praxis die meisten Patientenverfügungen sein – kann entweder schriftlich (eigenhändig verfertigt) oder mündlich gegenüber einem Arzt errichtet werden. 77 Erlöschen oder Aufhebung der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen Eine Patientenverfügung erlischt, wenn der Patient selbst zu erkennen gibt, daß er an diese nicht mehr gebunden sein will. Eine Patientenverfügung verliert ihre Verbindlichkeit, wenn der Stand der medizinischen Wissenschaft seit der Errichtung der Urkunde eine für den konkreten Fall oder die sonstigen Lebensumstände eine erhebliche Veränderung erfahren haben. Patientenverfügungen, die ihre Verbindlichkeit verlieren, sind jedoch weiterhin als Orientierungshilfe bei der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens heranzuziehen. Bestimmung für Notfälle: Patientenverfügungen sind nicht zu beachten, Sofern der mit der Suche nach einer Patientenverfügung verbundene Zeitaufwand das Leben oder die Gesundheit des Patienten ernstlich gefährden würde. 78 Grundsätzliche Überlegungen zur Sinnhaftigkeit von Patientenverfügungen Das PatVG kann zwar in etlichen Fällen für mehr Rechtssicherheit sorgen. Es werden aber genügend Fälle bleiben, bei denen eine verbindliche und eindeutige Verfügung nicht vorliegt und wo es auch künftig schwierig bleibt, den mutmaßlichen Patientenwillen zu ergründen und zu befolgen. Die meisten Patientenverfügungen werden auch in Zukunft nur eine Orientierungshilfe und nicht rechtlich strikt verbindlich sein. Für die verantwortlichen Ärzte bleiben Entscheidungsspielräume. 79 Daher ist die Koppelung einer Patientenverfügung an eine Vorsorgevollmacht ratsam, in der ein Patient für den Fall seiner Entscheidungsunfähigkeit eine Person seine Vertrauens benennt. Eine gesetzliche Reichweitenbegrenzung ist nicht ratsam. Der österreichische Gesetzgeber hat davon Abstand genommen. Wer die Reichweite von Patientenverfügungen begrenzen will, provoziert letztlich nur neue Rechtskonflikte darüber, was im Einzelfall unter Todesnähe zu verstehen ist. 80 Recht auf Leben – Recht zu sterben Das Recht auf Leben (Art. 2 EMRK) bedeutet keine Pflicht zum Leben um jeden Preis. Der Grundsatz des Lebensschutzes legitimiert weder ethisch noch rechtlich die Bevormundung und Entmündigung von Patienten. Sofern die Grenzen geachtet werden, die das österreichische Strafrecht gegenüber aktiver Sterbehilfe und Suizidbeihilfe zieht, ist die Freiheit der Menschen zu achten. Wer glaubt, mündige Bürger vor sich selbst schützen zu müssen, gibt letztlich der Forderung nach einer Liberalisierung der Euthanasie neue Nahrung. 81 Töten und Sterbelassen Es bleibt rechtlich und moralisch ein Unterschied, ob ich verfüge, daß man mich sterben läßt, oder aber, daß man mich tötet. Dennoch: auch die ausgefeiltesten Gesetze werden nicht verhindern, daß wir an den Grenzen des Lebens in ethische Dilemmata geraten, in denen das Urteil, ob es sich um ein Sterbenlassen oder eine aktive Herbeiführung des Todes handelt, eine Frage des Blickwinkels ist. „Ein ethisch verantwortungsvoller Umgang mit Sterben und Tod läßt sich nicht durch Präzisierung von Gesetzesformulierungen erreichen, sondern setzt eine Reflexion und Integration des Sterbens in unser alltägliches Leben voraus.“ (G. Ehninger, FAZ, 31.1.2005) 82 Nachtrag zu Kap. 10.5: Leben als Fragment Menschliches Leben ist fragmentarisch. Endlichkeit bedeutet nicht nur Sterblichkeit, sondern zum Leben gehören auch unsere Unvollkommenheit, Mißlingen und Brüche. Der Tod ist das Ende, aber nicht die Vollendung des Lebens. Hoffnungen können zerbrechen und enttäuscht werden. Christlicher Glaube hofft auf eine höhere, vom Mensch nicht leistbare Vollendung. 83 Zur Endlichkeit und Fragmenthaftigkeit des Lebens gehört auch die Begrenztheit ärztlicher Heilkunst. Sowohl in der Medizin als auch in der Pflege gilt es sich von Allmachtsphantasien, deren Enttäuschung zu narzißtischen Kränkungen führen muß, freizumachen. Das gilt gerade im Umgang mit Krebserkrankungen. Patienten, Ärzte und Pflegende sollen sich hier wechselseitig nicht mit unrealistischen und somit unmenschlichen Erwartungen und Hoffnungen überfordern. 84 Nachtrag zu Kap. 11.3: Rechtliche Grundlagen für Therapieverzicht oder Therapieabbruch § 110 StGB verbietet die eigenmächtige Heilbehandlung. „(1) Wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft, behandelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. (2) Hat der Täter die Einwilligung des Behandelten in der Annahme nicht eingeholt, daß durch den Aufschub der Behandlung das Leben oder die Gesundheit des Behandelten ernstlich gefährdet wäre, so ist er nach Abs. 1 nur zu bestrafen, wenn die vermeintliche Gefahr nicht bestanden hat und er sich dessen bei Aufwendung der nötigen Sorgfalt ( § 6) hätte bewußt sein können. (3) Der Täter ist nur auf Verlangen des eigenmächtig Behandelten zu verfolgen.“ 85 Verweigerung oder Einstellung der Sondenernährung Unter die Bestimmungen des § 110 StGB fällt auch die Sondenernährung (PEG-Sonde). Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr gehören grundsätzlich zum pflegerischen und nicht zum medizinischen Bereich (eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich der Pflege. Die Sondenernährung gehört aber zum mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich der Pflege, wie sich z.B. aus den Bestimmungen des GuKG für den Tätigkeitsbereich der Pflegehilfe eindeutig ergibt. 86 § 84 GuKG „(4) Im Rahmen der Mitarbeit bei therapeutischen und diagnostischen Verrichtungen dürfen im Einzelfall nach schriftlicher ärztlicher Anordnung und unter Aufsicht von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder von Ärzten folgende Tätigkeiten durchgeführt werden: ... 4. Durchführung von Sondenernährung bei liegenden Magensonden“ 87 Grundsätzlich spielt bei der Entscheidung für oder gegen therapeutische Maßnahmen ihre Einordnung in die Biographie des bzw. der Betroffenen eine wesentliche Rolle (Biographiearbeit; Story-Konzept). Beispiel: Zwei Patienten haben die gleiche infauste Karzinomprognose. Während aber die eine Patientin in Rücksprache mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen auf eine weitere Chemotherapie verzichtet, weil sie mit ihrem Leben abgeschlossen hat und den Tod nicht länger hinauszögern will, möchte der andere noch einige Wochen, vielleicht Monate an Lebenszeit gewinnen, vielleicht weil er noch die Hochzeit seines Kindes oder die Taufe seines ersten Enkels erleben möchte. 88