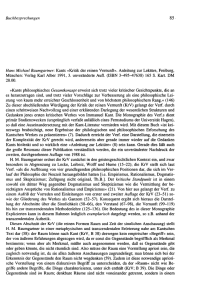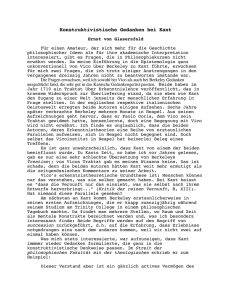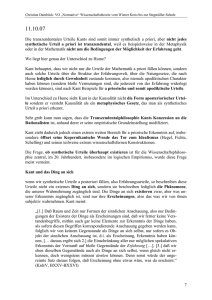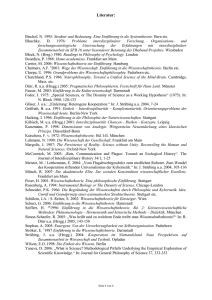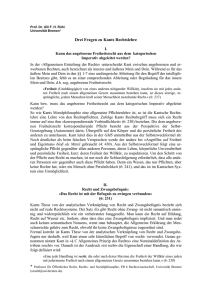Vorlesung4.WS.2016-17 - Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz
Werbung

Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz Die epistemische Koexistenz von Theorie und Wissen - aus wissenschaftstheoretischer Perspektive Vorlesung Ludwig-Maximilians-Universität München WS 2016/17 2 3 VORLESUNG 4 (09.11.2016) 4.1.4. Kant und die idealistische Phase 4.1.4.1. Kant und Wissenschaftstheorie zweiter Stufe 4.1.4.1.1. Kritische Überlegungen 4.1.4.2. Fichte und Wissenschaftslehre 4.1.4.3. Hegels wissenschaftstheoretische Leistung 4.1.4.4. Die neukantianische Bewegung 4.2. Die moderne Entstehungsphase der Wissenschaftstheorie 4.2.1. Die Ursprünge der Wissenschaftstheorie Kant und Wissenschaftstheorie zweiter Stufe In seiner Schrift „Der Streit der Fakultäten“ fordert Kant (1724-1804), dass es bei den Wissenschaften nicht auf Nützlichkeit, sondern auf Wahrheit ankommen sollte. Bei der Suche nach Wahrheit ist die philosophische Fakultät überlegen u.a. der theologischen, juristischen und medizinischen Fakultät. Wenn man herausfinden will, welche Gründe dafür sprechen, dann ist man ganz schnell fündig vor allem in der „Kritik der reinen Vernunft“, dem Hauptwerk Kants. Das Resultat der in diesem Werk durchgeführten Analysen kann man ohne weiteres als „transzendentale Methode“ bezeichnen; sie ist nicht nur aus epistemischer, sondern auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht bedeutsam. Anders formuliert: Die transzendentale Methode erweist sich als nützlich sowohl für die Erkenntnistheorie als auch für die Wissenschaftstheorie (WT). Wenn uns also die transzendentale Methode zur Verfügung steht, können wir sie auch für die Zwecke der WT gebrauchen, um dann die Frage nach dem „Wiedes-Wissens“ zu beantworten: Wissen kommt auf dem transzendentalen Weg zustande. Nachdem Kant durch die Anregungen Humes aus dem „Schlaf der vorkritischen Periode erweckt“ wurde, begann er den kritischen transzendentalen Weg zu 4 gehen. Wollen wir diesen Weg Kants bündig auf den Punkt bringen, dann heißt das: Die Überwindung des Rationalismus und Empirismus. Dazu behauptet Kant: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ (vgl. KrV B 74f.). Auf dieser Grundlage kommt es erst dann zu der sogenannten „kopernikanischen Wende“, deren Folge der Übergang von einer Seinsmetaphysik zu einer Erkenntnismetaphysik ist: Nicht unsere Erkenntnis richtet sich nach Gegenständen, sondern umgekehrt die Gegenstände nach unseren Erkenntnismöglichkeiten. Das Subjekt stellt den Gegenständen die Bedingungen und entwirft seinen apriorischen Denkgesetzen gemäß Naturgesetze. Nach Kant wird ferner der Gegenstand nicht vom einzelnen Subjekt mit seinen Zufälligkeiten bestimmt, sondern von einem transzendentalen Subjekt, d.h. einem Subjekt, dessen apriorische Anschauungsund Denkformen für alle gleich uns denkenden Wesen geltendes Gesetz sind (vgl. KrV B XIIIf.). Kants erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Überlegungen sind mit seiner Kritik an der Metaphysik aufs engste verbunden. Unter Metaphysik versteht er eine philosophische Disziplin, die es mit den Gegenständen zu tun hat, die nicht in der Erfahrung gegeben sind, d.h. mit den Begriffen „a priori“, denen keine sinnliche Erfahrung entspricht (vgl. KrV B XIXf.). Kant fragt, ob Metaphysik als Wissenschaft überhaupt möglich ist (vgl. KrV B 22). Und er beantwortet diese Frage folgendermaßen: Die Metaphysik ist nicht möglich als Transzendenzphilosophie, d.h. als eine Disziplin, die sich mit Gott, der Seele und der Welt (konkret: der menschlichen Freiheit) befasst. Sie ist aber möglich als Transzendentalphilosophie, d.h. als eine Disziplin, die sich mit der apriorischen Struktur der menschlichen Vernunft befasst, also mit den Bedingungen der Möglichkeit aller Erkenntnis (vgl. KrV B XIXf, 6f.). Kant erläutert den Begriff „transzendental“ wie folgt: „Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnis von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt“ (KrV B 25). Zum Entstehen des empirischen Gegenstandes sind also nach Kant sowohl die sinnliche Anschauung als auch die apriorischen Formen notwendig, die das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung gestalten. 5 Die Aufgabe der Transzendentalphilosophie besteht darin, das System der apriorischen Formen, das die Bedingung unserer Erfahrungswelt ist, aufzuweisen. Und dieses apriorische System beinhaltet zwei prinzipielle Komponenten: (1) die Strukturen a priori der sinnlichen Wahrnehmung (Raum, Zeit), und (2) die Strukturen a priori des menschlichen Verstandes (Kategorien) (vgl. KrV B 33f., 93f.). Die richtige Anwendung der Kategorien auf die sinnlichen Anschauungen wird durch die Urteilskraft gesichert. In dem Kontext wird nun klar, dass für die Wissenschaftstheorie vor allem zwei kantische Begriffspaare relevant sind, die man auch als Kriterien der Wissenschaftlichkeit bezeichnen kann: (1) Das Begriffspaar „Apriori-Aposteriori“ – kann man terminologisch und erkenntnistheoretisch betrachten. Während die terminologische Betrachtung die auf Aristoteles zurückgehende Differenzierung von Beweisführungen betont (Apriori – der Beweis vom Früheren auf Wirkungen; Aposteriori – der Beweis vom Späteren auf Ursachen), bestimmt die erkenntnistheoretische Betrachtung die Herkunft (vorempirisch oder empirisch) und die Geltungsweise (universal oder nicht) von Erkenntnis. Kant interessiert sich ausschließlich für die erkenntnistheoretische Betrachtung. Demnach besagen diese Begriffe Folgendes: Apriori – unabhängig von der Erfahrung; Aposteriori – hängt von der Erfahrung ab. Innerhalb des Apriori unterscheidet Kant weiter zwischen dem relativen Apriori (wer z.B. das Fundament seines Hauses untergrabe, wisse, dass das Haus einfallen werde) und dem reinen Apriori (wo die Erfahrungsunabhängigkeit auf den Prinzipien von Notwendigkeit und Allgemeinheit beruhe) (vgl. KrV B 2f.); und (2) das Begriffspaar „synthetisch-analytisch“ – bestimmt die Legitimation und das Innovationspotential von Erkenntnis und tritt in der Verbindung mit Urteilen auf. So gibt es nach Kant analytische Urteile (d.h. Erläuterungsurteile), z.B. „Jeder Schimmel ist weiß“ oder „Jeder Junggeselle ist unverheiratet“, und synthetische Urteile (d.h. Erweiterungsurteile), z.B. „Dieses Wasser enthält Bakterien“. Synthetisch heißen also alle Urteile, deren Wahrheit sich mit Hilfe logischer Gesetze und sprachlicher Bedeutungsregeln allein nicht entscheiden lässt. Im Unterschied zu den analytischen Urteilen enthalten sie das eigentliche Innovationspotential (vgl. KrV B 11f.). Auch wenn Kant den empirischen Faktor neben dem rationalistischen beim Zustandekommen von Erkennen generell für notwendig hält, zählt er doch das (empirische) Experiment nicht zu den Elementen, die als synthetisches Apriori 6 die Erkenntnis konstituieren. Herausgefordert durch skeptische Einwände, sucht Kant den der Wissenschaftspraxis innewohnenden Anspruch auf Wahrheit zu rechtfertigen. Wohl wissend, dass die Philosophie auf ihrem eigenen Gebiet unersetzbar ist, hingegen gewiss den kürzeren Weg geht, wenn sie den Wissenschaften unter dem Mantel des Apriorischen Vorschriften macht, entwickelt er eine Wissenschaftstheorie zweiter Stufe, die zwar auf das Selbstverständnis der Wissenschaften, aber kaum auf ihre Praxis zurückwirkt. Kritische Überlegungen zu Kant Kants Wissenschaftstheorie zweiter Stufe ist also in zwei oben geklärten Begriffspaaren „a priori – a posteriori“ und „synthetisch – analytisch“ fundiert. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch gegen diese kantischen Begriffe einige Einwände formuliert. Hier sollen zwei Einwände kurz angeführt werden: von Saul Kripke und W.V.O. Quine. Kripke Der Einwand von Kripke wurzelt in seiner Bedeutungstheorie von Eigennamen und richtet sich gegen die etwa von Frege und Russell vertretene These, die Bedeutung eines Eigennamens wie „Moses“ werde durch Beschreibungen gegeben: „die Person, die die Juden aus Ägypten führte“. Dieser These stellt Kripke eine kausale Bedeutungstheorie entgegen: Zunächst findet, entweder in Form einer Beschreibung oder durch Hinzeigen, eine Taufe des Gegenstandes statt, dann wird aber der Name in einer Kommunikationskette, also kausal vermittelt weitergegeben, wobei die ursprüngliche Taufe des Gegenstandes belanglos wird und nur die kausal vermittelte Beziehung zwischen den Ausdrücken und den bezeichneten Gegenständen entscheidend ist. Kripkes neue Semantik, die Theorie kausaler Referenz, hat zweifelsohne beachtenswerte urteilstheoretische Folgen. Während man vorher die Bedeutung von Eigennamen als (analytische) Festlegung ansah, gelten jetzt Namen als starre Bezeichnungsausdrücke, die in allen möglichen Welten denselben Gegenstand bezeichnen. Infolge dessen ist die Wahrheit von Identitätsaussagen wie „Der Abendstern ist der Morgenstern“ empirisch zu entdecken, so dass die Aussagen notwendig wahr und trotzdem nur über die Erfahrung wißbar sind. Im Gegensatz zu Kant soll es also notwendig wahre und trotzdem nur a posteriori gültige Aussagen geben, darüber hinaus auch kontingent wahre und trotzdem a priori gültige Aussagen wie z.B. die Definitionen der Längeneinheit „1 m“ durch das Urmeter in Paris. (vgl. Kripke, S., Naming and Necessity, Oxford 1980) 7 Quine Der Einwand von Quine bezieht sich hingegen auf Kants Bestimmungen des Begriffspaars „analytisch – synthetisch“. Nach Quine sind diese Bestimmungen nicht genau genug und deshalb problematisch. In seiner Schrift „Word and Object“ sieht er darum keine empirische Möglichkeit, analytische gegen synthetische Sätze abzugrenzen, und schließt daraus, zwischen beiden bestehe nur ein komparativer, aber kein wesentlicher Unterschied. Diese Behauptung ist für den logischen Empirismus folgenreich. Inspiriert durch den amerikanischen Pragmatismus, löst Quine einen Teil des Empirismus von innen heraus auf. Sobald sich nämlich analytische von synthetischen Sätzen nur noch komparativ unterscheiden, lässt sich die vorher vertretene Arbeitsteilung (d.h. der Dualismus eines der Philosophie vorbehaltenen logisch-begrifflichen Wissens, und eines den Wissenschaften aufgegebenen empirisch-faktischen Wissens) nicht mehr aufrechterhalten. Folgerichtig plädiert Quine für einen „semantischen Aufstieg“, der die bisherige Arbeitsteilung zugunsten eines „Gradualismus“ auflöst. In ihm bilden die Wissenschaften und die Philosophie zusammen ein Netz von Aussagen, dessen Zentrum Logik und dessen Rand die Beobachtungssätze bilden, während der empirische Gehalt sich über das ganze Netz verteile. Im Prinzip seien dabei alle Sätze revidierbar, eine Änderung der Sätze im Zentrum erfordert aber einen weit größeren Aufwand als eine der Sätze am Rand. (vgl. Quine, W.V.O., Word and Object, Cambridge 1960) Fichte und Wissenschaftslehre Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) will den Zwiespalt der theoretischen und der praktischen Vernunft bei Kant überwinden. Dabei befürwortet er den von Kant erklärten Primat der praktischen Vernunft. Das stellt den Kontext dar, in dem Fichte seinen Beitrag zur Wissenschaftstheorie leistet. Dabei gebraucht er den Begriff „Wissenschaftslehre“ und versteht darunter die transzendentale Grundwissenschaft, die das abdecken soll, was bisher Philosophie oder Metaphysik hieß. Wissenschaftslehre (WL) ist die Wissenschaft von Wissen überhaupt: Wissen des Wissens. Fichte geht davon aus, dass jede Wissenschaft einen Grundsatz habe, den sie voraussetzen muss, aber selbst nicht begründen kann. Die WL hat die Grundsätze aller Wissenschaften zu begründen, also die Grundlage aller Wissenschaften zu liefern, sich selbst aber von ihrem ersten Grundsatz her zu begründen, der keines Beweises fähig, sondern unmittelbar gewiss ist. Dieser erste Grundsatz ist als Grund alles Wissens und aller Gewissheit in allem Wissen enthalten und vorausgesetzt. 8 In seiner WL stellt Fichte drei Grundsätze auf, die allem Wissen zugrunde liegen, und von denen alle weiteren Grundsätze des Wissens (GW) abgeleitet werden müssen: (1) der unbedingte GW – lautet „Das Ich setzt sich schlechthin selbst“. Wenn immer ich um einen Gegenstand weiß oder ihn - wie auch immer - im Bewusstsein setze, so setze ich unbedingt mich selbst - das eigene Ich - voraus: Ich weiß, dass ich weiß, dass ich will oder handle. Jede Setzung des gegenständlichen Inhalts setzt die Selbstsetzung des Ich voraus. Dieses Wissen liegt jedem Bewusstsein zugrunde; (2) der seinem Gehalt nach bedingte GW – bildet die Antithese zum ersten GW: „Das Ich setzt sich schlechthin ein Nicht-Ich entgegen“. Im Bewusstsein finden wir also nicht nur ein reines Ich vor, sondern auch ein Nicht-Ich, ein Anderes, den Gegenstand. Wir finden ihn aber im Bewusstsein immer als etwas vom Ich Gewusstes, als Gegenstand meines Wissens, d.h. als einen im Bewusstsein des Ich gesetzten und dem Ich entgegengesetzten Inhalt. Damit wird eine ursprüngliche Notwendigkeit hervorgehoben, um den Widerspruch zu vermeiden: Ich ist nicht Nicht-Ich, sondern setzt sich das Nicht-Ich als anderes entgegen; und (3) der seiner Form nach bedingte GW – ermöglicht eine Synthese zwischen der These und Antithese, d.h. zwischen den zwei obigen GW. Es geht darum, dass die Setzung des Ich und die Entgegensetzung des Nicht-Ich widerspruchlos zur Einheit gebracht werden. Diese Einheit ist jedoch durch eine teilweise Negation oder Beschränkung charakterisiert. Das Ich wird beschränkt durch das Nicht-Ich und umgekehrt. Durch die Entgegensetzung ist das eine am anderen begrenzt und wird durch das andere bestimmt. Der dritte GW besteht aus zwei Teilen: (a) dem Grundsatz der praktischen WL: Im Wollen und Handeln bestimmt das Ich sein Nicht-Ich; und (b) dem Grundsatz der theoretischen WL: Erkennen oder Wissen ist die Bestimmung des Ich durch das Nicht-Ich. Es ist leicht erkennbar, dass Fichtes Wissenschaftslehre in der Aktivität des Ich, bzw. des Subjekts fundiert ist. Diese Aktivität lässt sich aber dann genauer erklären, wenn die Begriffe „Bewusstsein“ und „Vermittlung“ herangezogen werden, die man auch als Prinzipien verstehen kann. So ergibt sich das Bewusstseinsprinzip, das besagt, dass wenn ich etwas erkenne, denke oder mir vorstelle, es schon als Inhalt meines Bewusstseins gesetzt ist. Mit dem Bewusstseinsprinzip ist das Vermittlungsprinzip aufs engste verbunden. Das bedeutet, dass das Absolute im Anderen und durch das Andere hindurch „vermitteln“ muss, um im Wissen um dieses Andere zu sich selbst zu kommen, d.h. Selbstbewusstsein zu gewinnen. 9 Hegels wissenschaftstheoretische Leistung Bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), der für einen der umstrittensten und schwierigsten Philosophen gehalten wird, bekommt das von Fichte als idealistisch eingeführte Modell „These-Antithese-Synthese“ eine ganz neue Dimension, und zwar aufgrund der dialektischen Bewegung, bzw. Dynamik. Während bei Kant Subjekt und Objekt der Erkenntnis zwei verschiedene, getrennte Bereiche der Welt sind und bei Fichte das absolute Subjekt sich im Objekt systematisch präsentiert, kommt es bei Hegel hingegen zu einer dynamischen Entwicklung. In seiner Schrift „Phänomenologie des Geistes“ lesen wir: „Dieses wahrhafte Wesen der Dinge hat sich […] so bestimmt, dass es nicht unmittelbar für das Bewusstsein ist, sondern dass dieses ein mittelbares Verhältnis zu dem Innern hat, und als Verstand durch diese Mitte des Spiels der Kräfte in den wahren Hintergrund der Dinge blickt. […] Dieses Spiel der Kräfte ist daher das entwickelte Negative, aber die Wahrheit desselben ist das Positive, nämlich das Allgemeine, der an sich seiende Gegenstand. Das Sein desselben für das Bewusstsein ist vermittelt durch die Bewegung der Erscheinung, worin das Sein der Wahrnehmung […] überhaupt nur negative Bedeutung hat […]“ (vgl. S. 87-88) Dieses Zitat betont die Relevanz der dialektischen Bewegung, die sich (bekanntlich) in drei Schritten abspielt: These-Antithese-Synthese. Der Ausgangspunkt ist die einfache Erfahrung, die unmittelbare sinnliche Gewissheit des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist aber das unmittelbare Dasein des Geistes und weist zwei wesentliche Momente auf: Das Moment des Wissens und das der Negation des Wissens. Indem der Geist diese beiden entgegengesetzten Momente schöpferisch interpretiert und vermittelt, kann er sich selbst entfalten. Jeder erreichte Standpunkt (=These) muss also im Prozess der Vermittlung in seiner bestimmten Negation (=Antithesis) dialektisch als beschränkt und vorläufig erwiesen und in einem höheren Standpunkt (=Synthesis: Negation der Negation) aufgehoben werden. Diese dialektische Bewegung zeigt einerseits, dass Hegel die Wirklichkeit als dynamischen widersprüchlichen Prozess (bzw. als das „Zu-Sich-Kommen“ der Wirklichkeit) betrachtet, dessen Teile sich gegenseitig bedingen und bestimmen, andererseits ermöglicht sie dem Geist die Selbstverwirklichung in den verschiedenen Gestalten: subjektiver, objektiver und absoluter Geist. So erscheint der subjektive Geist in seinem individuellen Charakter und geht über drei Stufen hindurch: die Seele, das Bewusstsein, den Geist. Die Gesellschaft, der Staat, die Geschichte, die Institutionen usf., wo Recht, Moralität und Sittlichkeit sichtbar werden, sind also Stationen der epistemologischen Entwicklung des objektiven Geistes. 10 Die Synthese des subjektiven und des objektiven Geistes führt dann zum Entstehen des absoluten Geistes, der auch drei Stationen durchschreitet: die Kunst, die Religion und die Philosophie. Die Philosophie Hegels, die im Gedanken des absoluten Geistes aufgeht, will nun klar machen, dass die absolute Idee in ihrem Anderssein sich als Geist weiß, dass sie in ihren Objektivierungen (als objektiver Geist) zugleich bei sich (als subjektiver Geist) ist. Die neukantianische Bewegung Kants Philosophie wurde einerseits durch die gedanklichen Strömungen des Deutschen Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) verdrängt, zum anderen durch die Entfaltung des Positivismus (Comte), des Materialismus (Büchner, Vogt), der atheistischen Religionskritik (Feuerbach) und des dialektischen Materialismus (Marx, Engels). All diese Bewegungen führten jedoch Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem philosophischen Tiefstand. Die Folge davon war die Erhebung des Rufes „Zurück zu Kant!“. So erscheint Ende des 19. Jahrhunderts die philosophische Denkrichtung des Neukantianismus. Trotz sachlicher Vielfältigkeit, wie wir dies unten sehen werden, gilt im Allgemeinen die These Kants über die Unmöglichkeit der Metaphysik. Wenn es aber keine Metaphysik gibt, so stellt sich die Frage: Welche Aufgabe hat dann noch die Philosophie, nachdem die empirischen Gegenstandsbereiche von den Einzelwissenschaften übernommen worden sind? Und die Antwort lautet: Die Philosophie hat keinen eigenen Sachbereich, ihre Aufgabe liegt auf dem Gebiet der „Wissenschaftstheorie“, d.h. sie besteht in erkenntnistheoretischer und methodologischer Reflexion der positiven Wissenschaften. Je nachdem, worauf sich diese Reflexion bezieht, so kann man zwischen zwei grundlegenden Schulen des Neukantianismus differenzieren: (1) der Marburger Schule, und (2) der Badischen Schule. Die Marburger Schule befasst sich mit einer Theorie der exakten Naturwissenschaften. Ihre Hauptvertreter sind Herman Cohen (1842-1918) als deren Begründer und Paul Natorp (1854-1924). Cohen versteht die Kritik Kants als Theorie der Erfahrung und entwickelt ein eigenes System der Logik, Ethik und Ästhetik. Ausgehend von Kant entwickelt er nun eine Theorie der mathematischen Naturwissenschaften, welche auf einem „logischen Idealismus“ beruht: Es ist ein Idealismus, insofern er das Ding an sich ausschalten will; dabei soll die transzendentale Konstitution der mathematischnaturwissenschaftlichen Erkenntnis erforscht werden, und zwar ohne von außen 11 stammendes Empfindungsmaterial. Es geht also nicht um die Erkenntnis konkreter Einzelobjekte, sondern allein um die allgemeinen formalen Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnis. Der logische Idealismus wird auch von Paul Natorp vertreten, er deutet die Ideenlehre Platons als rein logisches Apriori des Denkens. Die Badische Schule greift hingegen die Geisteswissenschaften (d.h. Geschichtsund Kulturwissenschaften) auf und versucht deren Theorie herauszuarbeiten. Als bedeutende Persönlichkeiten gelten hier vor allem Wilhelm Windelband (1848-1915) und Heinrich Rickert (1863-1936). Im Kontext der Geisteswissenschaften vollzieht Windelband eine wissenschaftstheoretisch relevante Unterscheidung zwischen: (1) verallgemeinernden bzw. nomothetischen Wissenschaften – die allgemeine Gesetze erstellen; und (2) individualisierenden bzw. ideographischen Wissenschaften – die suchen, das Einzelne zu beschreiben. Auf dieser Grundlage bemüht sich dann Rickert einen methodologischen Unterschied zwischen Natur- und Geisteswissenschaften herauszuarbeiten. Seine These lautet: Die Natur ist durch Gesetze zu erklären, die Geschichte und die geschichtliche Kultur aus Werten zu verstehen. So vollzieht sich im Rahmen der Badischen Schule der Übergang zur Wertproblematik – geprägt durch die Fragestellung: Wenn die Erkenntnis auf bloße Feststellung empirischer Fakten beschränkt ist, kann daraus keine sittliche Verbindlichkeit folgen; wenn wir aber sittlich handeln sollen, woher stammen die Inhalte sittlicher Verpflichtung? Woher stammen Werte? Deshalb kann man auch mit Recht fragen, wie der Neukantianismus die WT bei der Bewältigung dieser Aufgabe eventuell unterstützen könnte. Hier scheinen drei Begriffe behilflich zu sein: Symbol, Geltung und Relativierung der Methode. Als objektive Wissenschaft benötigt die WT nur überzeugende und klare Symbole. Diese können aber effizienter erstellt werden, wenn man auch die neukantianischen Anregungen mit einbezieht. Darüber hinaus ist zu betonen, dass die wissenschaftstheoretischen Symbole (ähnlich wie Werte) problemlos zu gelten haben, damit die WT ihre Aufgabe absolut erfüllen kann. Symbole, welche als fragwürdig erscheinen, können kaum etwas zum Erfolg der WT beitragen. Es kann sein, dass einige Symbole nur für eine bestimmte Methode gelten können, für eine andere aber schon nicht mehr. Diese Konstellation zieht also die Annahme der Relativierung der Methode nach sich. 12 Die moderne Entstehungsphase der Wissenschaftstheorie Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts begann sich die Wissenschaftstheorie (WT) in ihrer modernen Form zu entfalten. Allerdings geschah es nicht in einem einzigen Schritt, sondern auf vielen Etappen, welche meist durch bestimmte Elemente wie Neopositivismus, Paradigmen oder Modelle gekennzeichnet sind. Dieser Entfaltungsprozess dauert bis heute an, mit einer mehr oder weniger plausiblen Deutlichkeit. Zwei Dinge bleiben dabei aufrechterhalten: (1) Zum einen wird die WT hauptsächlich begriffen als eine theoretische Disziplin „zweiter Ordnung“ bezüglich der existierenden Wissenschaften, d.h. als eine „Metawissenschaft“. Das bedeutet, dass der Zweck der WT letzten Endes in der Konstruktion und Überprüfung von (metawissenschaftlichen) Modellen zur Explikation der wesentlichen Aspekte von Begriffen, Theorien, Methoden und intertheoretischen Beziehungen der etablierten Wissenschaften besteht. (2) Zum anderen gilt es zwischen der allgemeinen und der speziellen WT zu unterscheiden, wobei die letztere als WT spezieller Wissenschaften angesehen wird. Die Ursprünge der Wissenschaftstheorie Die Anfänge der Wissenschaftstheorie (WT) haben ihre Wurzeln generell in der Geschichte der Philosophie und der Wissenschaften. Als philosophische Disziplin, deren eigenes Profil deutlich erkennbar war, konnte sich die WT erst Ende des 19. und Anfang des 20. Jh. durchsetzen. Entscheidend war dabei nicht zuletzt die positivistische Denkweise.