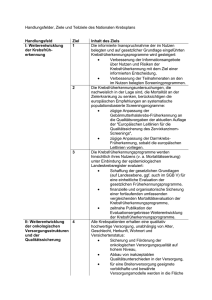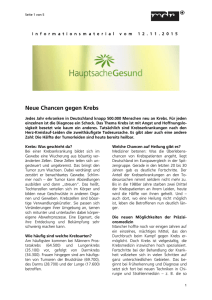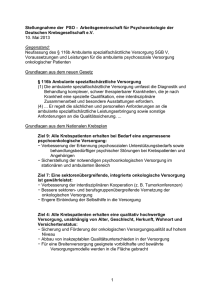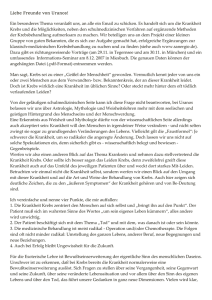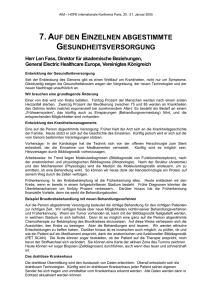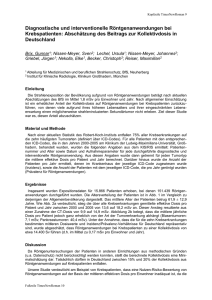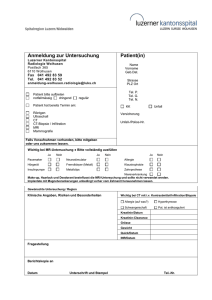Jede Krebsdiagnose ist eine Abzweigung im Leben
Werbung

Psycho-Onkologie 12 „Jede Krebsdiagnose ist eine ­Abzweigung im Leben“ Im Gespräch mit krebs:hilfe! beleuchten die Dermato-Onkologin Priv.-Doz. Dr. Christiane Thallinger, Comprehensive Cancer Center Wien, und der Psychiater und Psycho-Onkologe Dr. Alexander Bernhaut den Zusammenhang von Das Gespräch führte Mag. Christina Lechner Tumorerkrankungen und häufigen psychiatrischen Komorbiditäten. Lernen Sie das in Ihrer Ausbildung? Thallinger: Nein. Es hängt von jedem einzelnen Arzt ab, wie viel Empathie er dem Patienten entgegenbringt, und nicht zuletzt leider auch davon, welchen Zeitrahmen die strukturellen Bedingungen an der jeweiligen Institution für das Gespräch mit dem einzelnen Patienten ermöglichen. An unserer Abteilung wie an den meisten onkologischen Stationen steht permanent ein psycho-onkologisches Team zur Verfügung, welches eine optimale psychologische Betreuung garantiert. Bernhaut: Die Bereitschaft der Patienten für eine psycho-onkologische Beratung vari- Bernhaut: „Psycho-Edukation kann Ängste vor den bevorstehenden Behandlungszyklen relativieren und Depressionen bis zu einem gewissen Grad verhindern.“ iert jedoch stark. Wenn wir es aber schaffen, durch Psycho-Edukation bereits etwa die Ängste vor den bevorstehenden Behandlungszyklen zu relativieren, so können wir bis zu einem gewissen Grad reaktive depressive Episoden verhindern. Abgesehen davon zeigen sich viele Patienten im Nachhinein sehr dankbar, dass ihnen die psycho-onkologische Beratung bzw. auch eine psychiatrische Behandlung nahegelegt wurde. Welche Rolle spielen konkrete Ängste vor onkologischen Therapien – werden sie vielleicht als noch schlimmer empfunden als die Therapie selbst? Thallinger: Die Ängste von Krebspatienten sind groß und vielgestaltig: Es sind Ängs­te vor der Diagnose, vor dem Tod und para­ doxerweise auch die Angst vor dem Le­ ben – und zwar vor dem Leben mit der Erkrankung. Besonders dann, wenn die Erkrankung offensichtlich wird – sei es durch Kachexie oder durch Nebenwirkungen der Therapien wie Haarausfall, Haut- ausschläge oder Ödeme. Zusätzlich kommen noch soziale, nicht selten auch wirtschaftliche Ängste und Aspekte hinzu. In Summe kostet die Erkrankung den Patienten sehr viel Energie auf verschiedenen Ebenen. Jede Krebsdiagnose ist eine Abzweigung vom geplanten Lebenspfad des Patienten. Bernhaut: Aber auch unter diesem Aspekt müssen wir einmal mehr auf die Individualität verweisen, nicht zuletzt auch auf geschlechtsspezifische Unterschiede. Kommen zu den erwähnten Belastungen existenzielle Belastungen wie Atemnot und oder andere traumatisierende Erfahrungen hinzu, dann sind Behandlungswege gefordert, um mit den Patienten ein ganz neues Bewusstsein für sein Leben zu erarbeiten. Wie steht es um die Möglichkeiten der psychopharmakologischen Behandlung, wo gerade Krebspatienten häufig eine Reihe verschiedener Substanzen erhalten? Bernhaut: Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, die wir im Bedarfsfall auch nützen sollten: Moderne Antidepressiva sind – wenn sie einschleichend dosiert werden und wir das Nebenwirkungsprofil beachten – für Krebspatienten mit begleitender Depression sehr hilfreich. Auch sollten wir keine falschen Berührungsängste vor dem Einsatz von Benzodiazepinen haben. Werden Patienten von Angst und innerer Unruhe gequält, dann sind diese Substanzen immer noch die besten Angstlöser und helfen, die Situation zu bewältigen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Patienten auch entsprekrebs:hilfe! 5:2012 FOTOs: Barbara Krobath, Privat krebs:hilfe!: Wie gehen Menschen mit der psychisch belastenden Diagnose „Krebs“ um? Dr. Alexander Bernhaut: Je nach Persönlichkeit gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Es ist gewissermaßen ein Kontinuum, das bis zur reaktiven Depression reichen kann. Wie der Einzelne reagiert und ob es im Kontext einer Krebsdiagnose zu einer psychiatrischen Störung kommt, hängt letztlich von den zur Verfügung stehen Coping-Mechanismen und natürlich auch von Vorerkrankungen ab. Priv.-Doz. Dr. Christiane Thallinger: Ohne Zweifel ist die Diagnose Krebs ein einschneidendes Lebensereignis. Unabhängig von der Prognose bedeutet es, eine Patientenkarriere vor sich zu haben, die auch mit vielen frustranen Erlebnissen einhergeht. Als Onkologen sind wir gefordert, rechtzeitig zu erkennen, ob und wie jemand mit der Diagnose zurechtkommt und wer im psychischen Bereich zusätzliche Unterstützung benötigt. 13 chend begleitet werden. Leider werden viele Patienten in dieser Hinsicht aber selbst von Fachleuten wie Ärzten oder Apothekern immer noch stark verunsichert, wenn sie ein entsprechendes Rezept bekommen haben. Thallinger: Tatsächlich bekommt ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz von Krebspatienten Psychopharmaka und – wenn indiziert – auch Benzodiazepine verordnet. Das ist gerechtfertigt, interdisziplinär akkordiert und kann dem Patienten große Erleichterung bringen. Generell haben wir es in der Onkologie stets mit unterschiedlichen Arzneimittelinteraktionen auch aufgrund einer Polymedikation zu tun. Zusätzlich verändern nicht zuletzt eingeschränkte Organfunktionen bei onkologischen Patienten im fortgeschrittenen Stadium Pharmakodynamik und -kinetik der verabreichten Medikamente. Darum ist die enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen für uns von sehr großer Bedeutung. Die Furcht vor einer Abhängigkeit sollte keinesfalls dazu führen, im Bedarfsfall von Psychopharmaka Abstand zu nehmen. Ganz entscheidend ist zudem die Einbindung des Patienten in ein entsprechendes soziales und ärztliches Netz, wo für den Patienten Relevantes thematisiert und ausgesprochen werden kann. Qualität und damit der Erfolg mit der „Beziehungs-Chemie“ zwischen Therapeut und Patient steht und fällt. Um die Qualität zu sichern, gibt es entsprechende Ausbildungskriterien oder Supervisionsangebote. Thallinger: „Ganz entscheidend ist die Einbindung des Patienten in ein entsprechendes soziales und ärztliches Netz.“ Die Effekte der psycho-onkologischen Behandlung sind nur schwer zu quantifizieren, denn Psychotherapie und psychologische Beratung lassen sich nicht plazebokontrolliert überprüfen. Könnte es daher sein, dass ihr Effekt womöglich noch unterschätzt wird? Thallinger: Das ist sicher ein Grund, warum viele Studienautoren sagen, wir benötigen noch mehr Daten (siehe Kasten, Anm.). Allerdings glaube ich nicht, dass heute noch jemand ernsthaft den Nutzen dieser Angebote bezweifelt. Wenn sie dem Patienten keinen Nutzen bringen, dann ist wohl mehr die Person dahinter als die Methode selbst zu hinterfragen. Bernhaut: Jene, die seriös im psychologischen oder psychotherapeutischen Setting tätig sind, wissen nur zu gut, dass die „Keine einfachen Lösungen“ Anpassungsstörungen, Depressionen oder Angsterkrankungen treten bei Krebspatienten deutlich häufiger auf als im Bevölkerungsdurchschnitt. Allerdings gibt es ein Kontinuum von der nicht pathologischen Trauerreaktion über subklinische bis hin zur klinisch manifesten „Major Depression“, schreiben etwa Traeger et al. in einem rezenten Übersichtsartikel im „Journal of Clinical Oncology“ (2012). Auch sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die individuelle Vulnerabilität: „Eine Angststörung (bei Krebspatienten, Anm.) dürfte häufiger eine Reaktivierung einer vorbestehenden Störung sein als eine neu auftretende psychische Erkrankung.“ Ähnlich wie auch Li et al. (2012) im Kontext von depressiven Störungen betonen Traeger et al. zudem die Bedeutung psycho-pharmakologischer Interventionen bei onkologischen Patienten, vor allem aber die Notwendigkeit gemeinsamer psychiatrisch-onkologischer Forschungsarbeiten: Es gebe sicher keine einfachen Lösungen, wesentlich sei es jedoch, die Bedürfnisse der Patienten überhaupt bzw. rechtzeitig zu erkennen. Schon ein routinemäßiges Screening der psychischen Belastung oder die richtige und rechtzeitige ­Information der Patienten könne helfen, psychische Probleme zu erkennen. Patienten, die unvollständig informiert sind, können nur schwer wichtige Therapieentscheidungen treffen – umso mehr, wenn sie durch Depressionen oder Ängste beeinträchtigt sind. krebs:hilfe! 5:2012 Oft wird noch übersehen, dass eine Depression erst dann manifest werden kann, wenn der Patient als geheilt gilt und die Therapien hinter sich hat. Thallinger: Auch daran zeigt sich ganz deutlich, dass das Leben nach einer Krebsdiagnose nie mehr so ist wie vorher. Während der Therapie hat der Patient engen Kontakt zu seinem betreuenden Onkologen und ist sich oft der Unterstützung und Zuwendung seiner Familie und Freunde sicher. Nach Abschluss der Therapie oder in Therapiepausen ist der Patient mehr sich selbst überlassen, die Aufmerksamkeit und Zuwendung seiner nahen Umgebung kann über die Zeit abnehmen. Dies ist umso relevanter, da viele Tumorerkrankungen durch die Fortschritte der letzten Jahre zu chronischen Erkrankungen wurden. Bernhaut: Wenn während der Therapie die Psyche durch den Mechanismus der Verdrängung vielleicht noch geschützt war, so zeigt sich oft erst nach der Therapie, dass sie unser stärkstes „Organ“ ist. Die Herausforderung liegt darin, prophylaktische Konzepte zu entwickeln und zu sehen: wann fühlt sich der Patient seelisch gut und wann nicht – auch wenn man es angesichts der momentanen Situation vielleicht gerade ganz anders erwarten würde. Vielen Dank für das Gespräch! Dr. Alexander Bernhaut ist niedergelassener Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie Psychoonkologe in Wien, der auch Krebspa­ tienten und deren Angehörige behandelt und begleitet. Priv.-Doz. Dr. Christiane Thallinger ist Dermato-Onkologin am Comprehensive Cancer Center Wien, Klinische Abteilung für Onkologie, Universitätsklinik für Innere Medizin I, Wahlärztin für Dermatologie in Murau und Konsiliardermatologin am LKH Stolzalpe, Steiermark