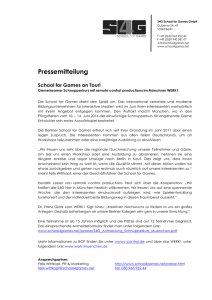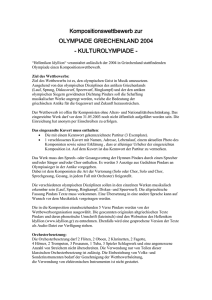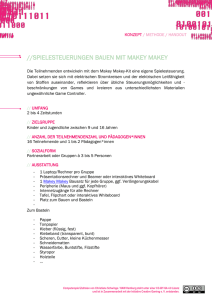„Der Sport ist Träger der universellen olympischen Werte, erreicht
Werbung

Erschienen in Diethelm Blecking & Petra Gieß-Stüber (Hrsg.) 2006: Sport bewegt Europa. Beiträge zur interkulturellen Verständigung. (= Bewegungspädagogik. 3) Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. Olympische und andere Bewegungskulturen Über Exklusion, Anerkennung und Fest Henning Eichberg Süddänische Universität, Forschungszentrum für Sport, Gesundheit und Zivilgesellschaft, Gerlev Inhalt 1. St. Louis 1904: Ein olympischer Case Hierarchisieren, ausschliessen, einschliessen 2. Neuere Inklusionstendenzen Olympische Sonderspiele ’Sport für alle’ Volksbewegungen und sozialer Konflikt 3. Anthropologie der Bewegungskultur... ... und die Politik der Anerkennung Die Sprache der Spiele Das Fest Neue Tribalisierungen? _____________________________________________________ „Der Sport ist Träger der universellen olympischen Werte, erreicht Profis und Amateure aus allen Ländern in den Mannschaften und Stadien, und zieht bei internationalen Wettkämpfen das Interesse der ganzen Welt, besonders der jungen Menschen, auf sich. Er stellt daher einen privilegierten Raum für den Dialog zwischen den Völkern dar.“ So hiess es im kulturpolitischen Organ der Europäischen Kommission unter der Überschrift „Der Sport als natürlicher Ort der Verständigung“. 1 Die Aussagen bestimmen den Ort der Sportpolitik in dem im Aufbau befindlichen europäischen Staat. Sie begründen die Stellung des Sports in der europäischen Verfassung und seine Bedeutung für den Konstruktionsprozess der ’europäischen Identität’. „Sport spricht alle Sprachen.“ 2 Natürlichkeit, Integration und olympische Werte – die in diesem Sinne autoritativen Worte werfen jedoch indirekt auch ein Licht auf das, was darin nicht genannt ist. Es ist nicht die Rede von Sport- und Bewegungskulturen im Plural – und damit nicht von der Vielfalt und Widersprüchlichkeit von Identitäten, wie sie in den Sports zum Ausdruck kommen. Wieso heisst es eigentlich „der Sport“? Vielleicht hat ’der Sport’ hier ein Problem. Welche Anerkennung – oder Nichtanerkennung – erfahren die regionalen Bewegungskulturen im hegemonialen Sportsystem? Dazu ist es nützlich, sich die Stellung regionaler Bewegungskulturen im olympischen Sport historisch genauer anzusehen. 1. St. Louis 1904: Ein olympischer Case Die Olympischen Spiele von 1904 in St. Louis waren insofern eine Ausnahme, als sie zum ersten und letzten Mal in der Geschichte der modernen Olympischen Spiele Menschen ’anderer’ Kulturen als andere auf die Wettkampfbahn sandten. Die offiziellen Wettkämpfe waren nämlich ergänzt um sogenannte Pre-Olympic Anthropology Days, manchmal auch Tribal Games genannt. 3 Die gleichzeitig stattfindende Weltausstellung von St. Louis – Louisiana Purchase Exposition – stellte Menschen exotischer Kulturen im Stil der damaligen ’Völkerschauen’ aus. Dreizehn dieser 1 ’Stämme’ wurden von den Veranstaltern der Olympischen Spiele ausgewählt, um sie in verschiedenen Sportarten miteinander konkurrieren zu lassen. Die Wettkämpfe der savage tribes erstreckten sich über zwei Tage. Unter den 18 Disziplinen waren sieben Laufwettbewerbe, zwei Sprungarten sowie verschiedene Würfe und Stösse – mit Speer, Baseball, Kugel, 56-Pfund-Gewicht und Bolo. Weitere Wettkämpfe fanden in Bogenschiessen, Tauziehen, Pfahlklettern und Schlammringen statt. Die Teilnehmer waren nordamerikanische Indianer, Patagonier, Filipinos, afrikanische Pygmäen und japanische Ainu. Frauen waren nicht unter den Teilnehmern; sie waren ja auch bei den offiziellen Olympischen Spielen jener Zeit ausgeschlossen. Die meisten ihrer Wettkämpfe waren nach den Mustern des westlich olympischen Leistungssports und seiner Resultatproduktion eingerichtet. Sie hatten einen künstlichexperimentellen Charakter, insofern als sie von den Veranstaltern den kolonialen Untertanen oktroyiert waren und keinen Rückhalt in den kulturellen Praktiken der Teilnehmer hatten. Daraus ergaben sich zahlreiche Missverständnisse, zumal die Übersetzung auch rein sprachlich ein kaum lösbares Problem darstellte. Die hieraus resultierenden Sonderbarkeiten gaben Anlass zu verärgertem Hochmut bei den Veranstaltern, zu Gelächter auf der Seite einiger Teilnehmer und zum Amüsement der Presse. Einzelne der Übungen waren allerdings auch ’indigenous’ in ihrem Charakter. Deswegen mussten sie zum Teil ohne Konkurrenten aus den anderen Ländern durchgeführt werden. So waren es nur die Patagonier, die Bolo warfen. Zum Pfahlklettern traten nur Afrikaner und Filipinos an, und beim Schlammringen waren die Pygmäen unter sich. Den Sinn der Anthropology Days sahen die Veranstalter allerdings nicht in solcher bewegungskultureller Vielfalt, sondern im systematischen Leistungsvergleich. Sport sollte als Laboratorium dienen, um auf experimentelle Weise die bestehenden Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen ’Rassen’ zu registrieren. Dieses ranking hatte seinen Hintergrund im Fortschrittsdenken des ausgehenden 19. Jahrhunderts und seiner wissenschaftlichen Ausgabe, dem anthropologischen Evolutionsdenken. William J. McGee, der zusammen mit den Sportfunktionär James E. Sullivan das Sportereignis leitete, organisierte zugleich die Anthropologieabteilung der Weltausstellung und war als Gründungspräsident der American Anthropological Association ein Zentralfigur dieser Wissenschaft. In Übereinstimmung mit der kolonialen Rassenlehre nahm McGee eine „Entwicklung“ der Menschheit von der „Wildheit“ über die „Barbarei“ hin zur „Zivilisation“ und schliesslich zur „Aufklärung“ an, bei der bislang nur die „Weissen“ oder „Kaukasier“ angelangt seien. Dieser Evolutionismus sah sich beunruhigt durch weitverbreitete Vorstellungen vom ’edlen Wilden’, der gesund und harmonisch in Übereinstimmung mit der Natur lebe. Die romantische Vorstellung vom „natürlichen Athleten“ galt es in St. Louis zu widerlegen. Das ’Experiment’ gelang. Die Ergebnisse der „Präolympischen Tage“, gemessen in Zentimetern, Gramm und Sekunden, belegten ganz überwiegend die Unterlegenheit der ’anderen’. Abgesehen vom Pfahlklettern, bei dem ein Filipino sich hervortat, vermerkte der offizielle Bericht der Olympischen Spiele fast nichts anderes als „armselige“, „haarsträubende“ und „lächerliche“ Ergebnisse. Die Athletenbeschimpfung gipfelte in der Feststellung eines ’negativen’ Rekords, wie er in der Geschichte des modernen Olympismus wohl einmalig war: „Nie zuvor in der Geschichte des Sports der Welt wurden für den Gewichtwurf so armselige Leistungen festgestellt“ (Sullivan, 1905: 253). Die interracial athletic records, wie McGee sie nannte, setzten die Messbarkeit von Leistungen voraus. Sie waren also an Sportarten gebunden, die entweder dem westlichen c-g-s-System entstammten oder ihm adaptiert werden konnten. Pfahlklettern, Bolowurf und Schlammringen wurden für das allgemeine olympische Programm nie erwogen, und der volkstümliche Wettkampf 2 des Tauziehens, den man ursprünglich für olympisierbar gehalten hatte, wurde später wieder ausgeschlossen (Eichberg 2001). Zwar war das Unternehmen von St. Louis keineswegs im Sinne von Pierre de Coubertin, dem Gründer und Hauptverantwortlichen der olympischen Organisation. Coubertin war mit den Veranstaltern schon aus rein organisatorischen Gründen im Konflikt und lehnte eine Teilnahme an den Spielen ab. Darüber hinaus formulierte er einige prinzipielle Einwände, die sich speziell gegen die Anthropology Days richteten. Sein Interesse lag nicht (primär) darin, ’Wilde ’ und ’Zivilisierte’ zu vermessen und zu vergleichen, sondern die Menschheit insgesamt zu entwickeln. Statt als Laboratorium sollte der Sport als Schule dienen. Darum erschienen die Tribal Games als eine „abscheuliche Scharade“, über die der – so Coubertin – „Fortschritt“ hinweggehen werde. Irgendwann in der Zukunft würden „schwarze Männer, rote Männer und gelbe Männer lernen zu rennen, zu springen und zu werfen und den weissen Mann weit hinter sich lassen. Dann werden wir Fortschritt haben.“ 4 In diesem Konzept war für baskisches Pelota, das Coubertin für Paris 1900 als vulgär abgelehnt hatte, ebenso wenig Platz wie für das Tabaksaftspucken, über das im Zusammenhang mit St. Louis Gerüchte zirkulierten. Die Anthropology Days blieben eine einmalige Veranstaltung im olympischen Programm. Aber aus Coubertins Worten lässt sich doch ablesen, dass er den Tribal Games nicht ganz so fern stand, jedenfalls nicht ihrem olympisch standardisierten Teil. Coubertin befürwortete durchaus regionale Spiele, da diese im Sinne des erzieherischen Fortschritts wirken könnten. Daraus ergaben sich die regionalen Wettkämpfe, die die olympische Organisation später hervorbrachte – African Games, Asian Games, South East Asian Games, Latin American Games etc. – und die in ihrem Aktivitätsprogramm und mit ihrer Leistungsmessung ganz dem westlichen Muster folgten. Insofern stimmte Coubertin mit seinen Konkurrenten in St. Louis überein, mit denen er auch den Begriff des ’Fortschritts’, den Begriff der ’Rasse’ und die Methode des zu vermessenden c-g-sSports gemeinsam hatte. Damit wären wir an den Quellen jener ’ursprünglichen olympischen Ideen’ und ’universellen Werte’, wie sie eingangs zitiert wurden. Hierarchisieren, ausschliessen, einschliessen Die Rückseite des olympischen Universalismus war also eine Politik des Ausschlusses: Ausgeschlossen wurden nicht-quantifizierbare Sportarten und andere anderskulturelle Elemente. Das Bolowerfen, Pfahlklettern und Schlammringen von St. Louis sollte sich nicht wiederholen. Die regionalen Sonderspiele sollten stattdessen etwas anderes leisten: die Einübung in den olympischen Standardsport. Darum folgten sie eng dessen Normen. Sie unterschieden sich nicht in der Aktivitätsform, sondern nur durch ihr in der Regel ’niedrigeres’ Leistungsniveau. Es ist nicht zufällig, dass der Begriff special games später auf Behindertenspiele eingeschränkt wurde – alle ’anderen’ sind so etwas wie Behinderte in Bezug auf die ’Normalität’ des westlichen Kulturmodells. Das olympische Konzept, das Völker nach Leistungen hierarchisiert und damit eine Nichtanerkennung des kulturell Besonderen beinhaltet, wurde nicht erst um 1900 erfunden. Seine Geschichte und Hegemonie begann einhundert Jahre früher, in der ’Sattelzeit’ der Moderne. In den Jahren 1800-1804 reiste der französische Naturwissenschaftler François Peron in die Südsee, um dort an verschiedenen Völkern Untersuchungen anzustellen. Mit dem Dynamometer, einem Instrument zur Messung von Kraftleistungen, vermass er die Körperkräfte einer Reihe von Tasmaniern, australischen Aborigines und Malaien auf Timor. Er ordnete seine Messungen in Tabellen und errechnete daraus die durchschnittliche Körperkraft dieser Völker. Sie entsprach, wie Peron feststellte, genau der von ihm so genannten „Zivilisationsstufe“ der jeweiligen 3 Eingeborenen. Mit dem Blick auf Daten aus England und Frankreich folgerte er, dass je „wilder“ ein Volk sei, desto schwächer die körperlichen Kräfte. Und umgekehrt: je höher die Kraftleistungen, um so mehr entspreche dem die „Vollendung der Zivilisation“ (Peron 1807). Damit war das Muster hierarchischer Über- und Unterordnung etabliert, das später in den (Prä-) Olympischen Spielen von St. Louis seinen Ausdruck finden sollte. Der Sport als „Träger der universellen olympischen Werte“ hat somit eine Geschichte von zwei Jahrhunderten, und sie zeugt von der Exklusion und Inklusion nach kolonialen Prämissen. Die Exklusion geschah unter dem Vorrang von Leistung: Sport wurde als ein Ritual der Produktion gestaltet. Ausgeschlossen oder marginalisiert wurden demgegenüber das Spiel, das Gelächter und das Fest, die bis dahin Grundelemente volklicher Bewegungskulturen gewesen waren. Wenn Pygmäen auf der Wettkampfbahn von St. Louis 1904 lachten – über einen purzelnden Japaner, über einander und über sich selbst – so wurde das von der Presse als bemerkenswert und unterhaltsam registriert, aber in den olympischen Verhaltenskodex gehörte es nicht. 2. Neuere Inklusionstendenzen Ein Jahrhundert später sieht das Gesamtbild der Bewegungskulturen jedoch etwas anders aus. Auf die koloniale Exklusion folgten im Verlaufe des 20. Jahrhunderts Inklusionen verschiedener Art. Besonders drei Tendenzen sind zu bemerken: die olympischen Special Games, der Sport for all und neue Volksbewegungen von unten. Sie trugen auf ganz unterschiedliche Weise zur Regionalisierung der Bewegungskultur bei. Olympische Sonderspiele Die Idee von Sonderspielen oder Special Games leitet sich von der Logik des Olympischen Sports ab und von dessen Problem, sich zu ’den anderen’ zu verhalten. In der hierarchischen Ordnung des klassischen Wettkampfsports war die Platzierung an der Spitze der Pyramide eindeutig – sie zementierte den Vorrang des jungen weissen Mannes (erst sekundär trat später die Frau hinzu), und der war typisch protestantisch, gehörte der Mittelklasse an und repräsentierte eine der grossen Staatsnationen. Der Ort der ’anderen’ – der Frauen, der Arbeiterklasse, der Völker ausserhalb Europas, der religiösen oder ethnischen Minderheiten, der sexuellen Minderheiten, der Alten, der Kinder etc. – war irgendwo ’dort unten’ unter den Deklassierten und Verlierern. Die Pyramidenordnung des Olympischen Sports bringt ein grundlegendes Prinzip zum Ausdruck: Wir sind alle vereint im Streben nach derselben Höchstleistung, aber einige sind eben besser – und der Rest ist nicht eigentlich von Bedeutung. Solche Rigidität war nur dadurch aufzuweichen, dass man Wege einer breiteren Inklusion fand. Genau das schwebt bereits Coubertin vor, als er Afrikanische Spiele und Asiatische Spiele konzipierte und – gegen mögliche Einwände – auch die Arbeiterolympiaden positiv bewertete. Für die ’anderen’ sollten Pyramiden derselben Art errichtet werden wie für den olympischen Mainstream, so dass jede Sondergruppe in ihrem eigenen hierarchischen System um die Wette kämpfen konnte. So erschien im Laufe des 20. Jahrhunderts ein immer breiteres, potentiell unbegrenztes Panorama, das sich zwischen den Paralympics der Behinderten einerseits und den als politische Alternative konzipierten Ganefo (Games of the New Emerging Forces) – einer Art antikolonialer Olympischer Spiele (Sie 1978) – andererseits erstreckte. Um 2000/02 wurden folgende special events des Weltsports registriert: Scholar Games (für Jugendliche), World Masters Games (für Ältere), Games for the Disabled, Transplant Games, Games for Athletes with Cerebral Palsy, Games for the Blind, Games for the Deaf, Games for Catholic Students, Games of the Small Countries, Island Games, Francophone Games, South East Asian Games, Games of Non-Olympic Sports, Gay Games und World Dwarf Games. Auf diese Weise findet schliesslich jede Art von Besonderheit ihre eigene Arena. Obwohl diese Spiele prinzipiell entlang der Muster des olympischen Wettkampfs organisiert und in 4 der Regel vom Internationalen Olympischen Komitee patronisiert werden, eröffnen sie Möglichkeiten in Richtung auf eine grössere Vielfalt von Bewegungskulturen. Das wurde besonders in den 1980er Jahren deutlich. Die ersten Games of the Small States of Europe (im Mai 1985 in San Marino) und die ersten Inter-Island Games (im Juni 1985 auf der Isle of Man) hielten sich noch an den olympischen Standardsport und das olympische Zeremoniell. Aber bald folgte die erste Eurolympiade der kleineren Völker und Minderheiten (im September 1985 in Friesland), in der konventionelle Sportarten mit einheimischen Spielen vermischt auftraten. Daran schlossen bald eine Reihe von internationalen Begegnungen mit traditionellen Spielen verschiedener Regionen an. Der Europarat wurde als organisatorischer und politischer Förderer aktiv (Dufaitre 1989). Auch die Forschung wandte ihre Aufmerksamkeit diesem Trend zu (Pfister 1996, 1997, 2004, Liponski 2001). Die regionalen Volksspiele hatten damit einen offiziellen ’Status’ erhalten. Sie waren anerkannt. ’Sport für alle’ Die Ausbreitung von Festivals regionaler Bewegungskulturen muss auch im Zusammenhang des sogenannten Sport for all gesehen werden. Die Parole des „Sport für alle“ wurde gegen Ende der sechziger Jahre von Sportministern und Sportorganisationen ausgegeben als eine Strategie, breitere Volksmassen in den Sport einzubeziehen. Das war im Sinne einer neuartigen Wohlfahrtspolitik (DaCosta 2002, Heinemann 2004, Eichberg 2004 b). Obwohl ’Sport für alle’ von oben her als relativ einheitliches Konzept lanciert wurde, kam er in den verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise an. Es wurde nämlich in Anlehnung an jeweils bestehende Vorverständnisse interpretiert und spezifisch umgesetzt. Es wurde regionalisiert (Hartmann-Tews 1996). In einigen Ländern ordnete Sport for all sich in Traditionen sozialhygienischen Denkens ein. Insbesondere verband es sich mit dem ’Kampf gegen die Fettleibigkeit’, die Regierungen nun zunehmend Anlass zur Besorgnis gibt. Sport for all wurde hier ein Element der Volksgesundheits- und Fitnesspolitik. In anderen Ländern begegnete Sport for all organisierten sozialen Bewegungen, die aus unterschiedlichen historischen Wurzeln stammten und sich nun im Konzept des Breitensports wiedererkennen konnten. Dabei handelte es sich oft um Gymnastikbewegungen aus nationalromantischer Tradition wie das deutsche Turnen, die dänische ’volkliche Gymnastik’ und die Sokol-Gymnastik in Tschechien, Slowenien und anderen slawischen Ländern, die vorübergehend kommunistisch umdefiniert worden war (Blecking 1991). Auch Arbeitersportbewegungen (wie in Italien) und Betriebssportbewegungen (in Skandinavien), christliche Sportbewegungen (wie in den Niederlanden) und laizistische Sportbewegungen (in Frankreich) griffen den Trend auf. Jenseits aller Differenzen war man sich darin einig, Sport for all als eine neue Gelegenheit zu sehen, soziale, erzieherische und ökologische Aspekte des Sports hervorzuheben. ’Sport für alle’ wurde hier gleichbedeutend mit ’Sport und Kultur’ oder ’Sport als Kultur’. Und nicht zuletzt schaltete sich bereits frühzeitig der organisierte olympische Sport ein. Obwohl Sport for all das Wettkampfprinzip herunterspielte, versuchte das IOC, über eine betonte Förderung des neuen Breitensports die Entwicklung zu kontrollieren und seinem Anspruch auf Einheitssport unterzuordnen. Als Teil dieses regional differenzierten Panoramas von Fitnessport, Kultursport und Wettkampfbreitensport erfuhren bald auch traditionelle Spiele, ethnische Regionalkulturen und Volkssportarten eine besondere Beachtung. Sprecher des Sport for all bemerkten selbstkritisch, dass afrikanische Tänze, chinesisches Tai Chi Chuan, Eskimospiele, portugiesisches Stelzenlaufen und ähnliches im Rahmen des organisierten Sports unbeachtet geblieben oder gar verdrängt worden 5 seien. 5 Und man begann, sich um die Dokumentation und Förderung regionaler Bewegungskulturen zu bemühen. Ein Ergebnis solcher Bemühungen war das Festival Sportkulturen der Welt, das 1992 in Bonn stattfand. Es wurde vom Deutschen Sportbund und der Trim and Fitness – International Sport for All Association (Tafisa) getragen und unter anderem von Volkswagen und Lufthansa gesponsert. Im Namen kultureller Identität präsentierte man hier ein breites Panorama, das von dänischen Dorfspielen bis zum brasilianischen Kampftanz Capoeira, vom chinesischen Wushu bis zu flämischen Wirtshausspielen reichte. Das Festival wurde ein Erfolg und darum 1996 in Bangkok und 2000 in Hannover wiederholt. In Hannover war es an die Expo angebunden, und damit hatten sich Weltausstellung und die ’tribalen’ Spiele erneut getroffen, wenngleich auf einem anderen historischen Niveau als 1904. Die Entfaltung regionaler Spielkulturen kann indes nicht voll verstanden werden, wenn man nur die Intentionen der Herrschenden im Staat und im organisierten Sport zum Ausgangspunkt nimmt. Die Strategien aus den Chefetagen reagierten auf etwas, das von unten her kam, aus der Welt der Volksbewegungen. Die Bewegungskultur regionalisierte sich nicht zuletzt von der Zivilgesellschaft und von deren inneren Widersprüchen und Unberechenbarkeiten her. Volksbewegungen und sozialer Konflikt Einige Impulse zur Neuentdeckung von Volksspielen waren seit Beginn der siebziger Jahre von den New Games her gekommen. New Games gehörten zu jener ’neuen Bewegungskultur’, die im Zusammenhang mit der Hippiekultur und dem Protest gegen den Vietnamkrieg in Kalifornien entstand. Jugendliche engagierten sich in wettkampffreien Spielen, experimentierten mit neuen Sportarten und entdeckten alte Spiele wieder (Fluegelman 1976). Zur gleichen Zeit regten sich in verschiedenen Teilen Europas Initiativen, traditionelle Spiele neu zu beleben. Unter den ersten regionalen Spielen, die Beachtung fanden, waren diejenigen des flämischen Volkssport. Flämischer Volkssport bestand traditionellerweise aus städtischen Wirtshausspielen, die überwiegend von älteren Männern unterer sozialer Schichten betrieben wurden und in lokalen Klubs organisiert waren (Renson 1997). Sie erfuhren jetzt Beachtung im Kontext neuartiger sozialer und nationaler Spannungen. Die internationale Jugendrevolte gab einer flämischen Autonomiebewegung Auftrieb, die sich gegen den belgischen Zentralstaat richtete. Sport for all erschien in Belgien als ein Weg zur Demokratisierung des Sports und verband sich mit der Föderalisierung des Staats. In diesem Zusammenhang erhielten die Volksspiele akademischen Status und politische Förderung. Von vergleichbaren Unruhesituationen und Identitätsprozessen profitierten die Volksspiele und die Tanzfeste Fest-noz in der Bretagne sowie die baskischen Kraftübungen und die katalonischen Spiele in Spanien. 6 In eine andere – geographische – Richtung wirkten die Volkssportarten, die sich aus der Dritten Welt in den Metropolen des Westens verbreiteten. Auch sie verknüpften sich oft mit den neuen Jugendbewegungen und Jugendkulturen. Der Kampftanz Capoeira fasste, von seinem afrobrasilianischen Ausgangspunkt her, in europäischen Städten wie Amsterdam, Berlin und Paris Fuss (Crum 2001). Tai Chi und Wushu, die ihren Hintergrund in chinesischem Kriegertraining und magischen Praktiken hatten, gingen weltweit in eine neue Praxis von Gesundheitsübungen ein. Die indonesische Kampfkunst Pencak silat wurde auf internationaler Ebene in einen westlichen Sport transformiert, ohne dabei jedoch ihre regionale Dynamik unter den Völkern Indonesiens zu verlieren (Cordes 1992). An der Internationalisierung des Pencak wirkten auch ’Gurus’ aus der indonesischen postkolonialen Minderheit in den Niederlanden mit. Wie denn überhaupt Einwandererkulturen für die ’Wiederentdeckung’ und Neuentwicklung von regionalen Bewegungskulturen fruchtbar wurden – der südasiatische Bhangra-Tanz in Grossbritannien ist dafür ein Beispiel (Hargreaves 1989). Antikoloniale Bewegungen in der Dritten Welt trugen ebenfalls zur Wiederbelebung einheimischer Spiele bei, jedoch mit charakteristischen Begrenzungen. Angeregt durch den „Geist 6 von Bandung“, in dem sich afrikanische und asiatische Nationen gegen die Kolonialmächte verbunden sahen, 7 förderten einige ’radikale’ Länder wie Libyen und Algerien die traditionellen Spiele als Alternative zum westlich-kolonialen Sport (Fatès 1994, Eichberg 1998: 87-99). Solche Bestrebungen blieben allerdings eng an die staatliche Politik und deren Schwankungen gebunden. 8 In körperkultureller Sicht waren und sind diese Diffusionen und Innovationen durchaus widersprüchlich. Auf der einen Seite wurden ’ethnische’ Muster immer wieder nach westlichem Leistungsmodell in Sportarten umgewandelt, die durch kontrollierte Resultatproduktion, Turniere und bürokratische Organisation, durch Spezialisierung und Entkulturalisierung gekennzeichnet waren. Auf der anderen Seite brachte die Diffusion ’exotischer’ Sportarten in der westlichen Welt auch Alternativen zum Standardsport hervor. Und schliesslich konnten neuartige Aktivitäten entstehen, die sich weder traditionellen noch modernen Begriffen von Sport fügten. Der Bungee jump ist eine solche Innovation; er basiert auf einem melanesischen Volksritual des Turmspringens, das erst in den sechziger Jahren ’entdeckt’ und danach in Neuseeland vermarktet wurde (Muller 1970). Umgekehrt haben westliche Bewegungsformen in Afrika, Asien und den Amerikas auch neue Entwicklungen angestossen. Trobriand cricket wurde das bekannteste Bespiel dafür, wie ein kolonialer Sport in ein melanesisches Volksfest aus Tanz, Wettkampf, Gabentausch und Karneval verwandelt werden konnte (Leach 1976). In China erschien der westliche Disco-Tanz als Disike, als Tanz der Alten; er wurde besonders populär unter älteren Frauen, die sich damit zugleich eine Eigenwelt gegenüber dem herrschenden Patriarchat schafften (Brownell 1995: 277-288). Schärfere politische Ecken und Kanten zeigte die Regionalisierung der Spiele, als die Sowjetunion um 1989/91 unter dem Druck demokratischer Bewegungen und neuer ethnischer Nationalismen auseinanderbrach. Volkssportarten und Volksfeste, die durch Generationen hindurch als ’unsowjetisch’ unterdrückt worden waren, erschienen nun in verschiedenen Teilen des sich auflösenden Reiches erneut an der Oberfläche. Kasachen feierten wieder ihr Neujahrsfest Nauryz mit Tänzen und Spielen. Mongolen wandten sich im Zeichen des Dschingis Khan ihren Festen mit nomadischen Reiterkünsten, Gürtelringen und Bogenschiessen zu. Inuit des sibirischen Norden trafen sich mit ihren ’Brüdern und Schwestern’ aus Alaska im Trommeltanz des Winterfests Kivgiq. Tataren hielten erneut ihr Frühjahrsfest Sabantuy, in dessen Mittelpunkt starke Männer im Gürtelringen Korash konkurrieren (Kuznezova/Milstein 1992). Als man sich in den Stadien baltischer Länder in den achtziger Jahren zu grossen Gesangsfesten versammelte, brachte das dem bald darauf erfolgenden Systemwandel den Namen einer „singenden Revolution“ ein. Beim neuen tatarischen Sabantuy wurden höchst unterschiedlicher Bewegungstraditionen miteinander verbunden. Das machte sichtbar, dass es sich nicht um antiquarische ’Wiederherstellung’ von etwas Vorzeitlichem handelte, sondern um neues Patchwork. Am Fest der sibirische Buriaten, am Sukharban, hat man beobachtet, wie Traditionen des buddhistischen Lamaismus mit Elementen aus Sowjetsport, moderner Staatsfolklore und Sportmoden des kapitalistischen Marktes kombiniert werden (Krist 2005). Das Fest wird zum Feld neue Kämpfe um Macht und kulturelle Hegemonie. Irgendwo zwischen militantem Nationalismus und demokratischem Fest gehen hier Absonderung und Inklusion neue hybride Mischungen ein. Im Spanien nach der Franco-Diktatur war der Prozess demokratischer Föderalisierung ebenfalls mit eine Renaissance von Volkssportarten verflochten. Im Baskenland, in Katalonien und auf den kanarischen Inseln wurden Volksspiele und Volksfeste aktive Manifestationen regionaler Identitätsbildung (Amador 1997; Lavega in Eichberg 2004). Im August 1992 ergänzte – oder kontrastierte – man die Olympischen Spiele in Barcelona durch ein Festival der spanischen Volkssportarten, das vierzig Kraftübungen, Wurfspiele, traditionelle Ringkämpfe und das Ballspiel Pelota versammelte. Das geschah im Kontext eines demonstrativen katalanischen Nationalismus, der sich nicht nur durch einen „Kampf der Fahnen“ um die Olympischen Spiele herum manifestierte, sondern auch dazu führte, dass der katalanische Tanz Sardana und die Akrobatik der 7 Menschentürme, Castells de xiquets, in die olympischen Zeremonien eingebaut wurden (Hargreaves 2000: 89-95, 101-104). Ein knappes Jahrhundert nach den Tribal Games von 1904 erschienen damit ’tribale Spiele’ erneut in Verbindung mit dem olympischen Sport. 3. Anthropologie der Bewegungskultur... Der historische Überblick zeigt, wie regionale Bewegungskulturen im Weltsportsystem auf durchaus widersprüchliche Weise wahrgenommen, verdrängt oder ’zurückgeholt’ wurden. Perspektive und Praxis schwankten zwischen Ausschluss und Einschliessung, zwischen Integration und Desintegration. Für die Forschung bedeutet das neue Herausforderungen an eine Anthropologie der Bewegungskulturen. Anthropologie ist nicht mehr, als was sie sich vor hundert Jahren in den Anthropology Days von St. Louis zeigte. Statt metrischer Laborwissenschaft handelt es sich nun um eine kulturenvergleichende Menschenwissenschaft. Und anstatt eine lineare ’Evolution’ durch die Menschheitsgeschichte hindurch zu zeichnen, geht es nun um Widersprüche in modernen, kolonialen und postkolonialen Gesellschaften (Bale 1996 und 2002). Der dialektische Charakter des Prozesses ist umso mehr zu unterstreichen, als es Anzeichen eines neuen Entwicklungsdenkens gibt, das unter dem Programmwort der ’Modernisierung’ steht. Dabei wird der Prozess kolonialer Reichsbildung affirmativ so (re-) konstruiert, dass das Bild einer sportiven Einbahnstrasse erscheint, neben der es nur Nischen des Widerstands und marginale Überreste gibt (tendenziell bei Guttmann 1994). Das Denken in Widersprüchen erfordert eine komplexere Anthropologie (Brownell 2005). Zu einer solchen Anthropologie kann der Begriff der Anerkennung beitragen, der in den letzten Jahren einen markanten Aufschwung erlebt hat (Taylor 1992, Fraser 2000, Fischer 2004). Die ’Politik der Anerkennung’ nahm ihren Ausgangspunkt in einer Philosophie, die sich in Kanada vor dem Hintergrund des ethnischen Diversifizierung des dortigen postkolonialen Staats entfaltete. In den achtziger und neunziger Jahren reagierte das britisch dominierte Kanada auf den zunehmenden Druck seiner kulturellen Minderheiten und versah die Regionen Quebec (französisches Kanada) und Nunavut (inuitisches Kanada) mit weitreichenden Autonomierechten. Indianische Bestrebungen drängen nun in die gleiche Richtung – es würde der erste indianische Staat der neueren Geschichte. Die Anpassung des demokratischen Staats an die kulturellen Bestrebungen und Identitäten der Völker hat philosophisch-anthropologische Implikationen und Voraussetzungen. Sie setzt voraus, dass das ’Volk der Demokratie’ als konkrete Grundlage politischen Handelns anerkannt wird – und solche Anerkennung ist schwieriger, als es auf den ersten Blick erscheint. Anerkennung auch der Weg der nordischen Länder. Wo vor 200 Jahren, beim Anbruch der Moderne, nur die beiden Staaten Dänemark und Schweden existierten, gab es am Ende des Jahrhunderts als selbstbestimmte Einheiten ausserdem Norwegen, Finnland, Island, die Færöer, Grönland und Åland – sowie im weiteren Umkreis Estland, Lettland und Litauen. Damit sind auch im Norden keineswegs alle Minderheitenfragen gelöst (z.B. was das Saamiland und Karelien betrifft), und die neuen Einwanderungsminoritäten Skandinaviens stellen vor ganz neue Probleme. Aber ein Weg demokratischer Lösungen ist vorgezeichnet, und er beginnt mit der Anerkennung – aus einer Haltung der Gelassenheit heraus: ’Warum lassen wir sie eigentlich nicht...’? ... und die Politik der Anerkennung Anerkennung ist also mehr als nur eine Frage politischer Verfahren oder politischer Meinungen. In ihr verbindet sich das Verhältnis von Mensch zu Mensch mit dem Verhältnis zwischen ’uns’ und anderen Kollektiven, zwischen dem Subjekt und ’dem anderen’. In der neueren philosophischen Anthropologie hat die Anerkennung daher einen zentralen Platz erhalten (Todorov 1996). Martin Buber (1923 und 1948) hatte dem mit einer Phänomenologie der Ich-Du-Beziehung und des 8 dialogischen Prinzips vorgearbeitet – „Der Mensch ist der Mensch mit dem Menschen“ – ohne doch damit viel Gehör zu finden. Zugleich geht es bei der Anerkennung um mehr denn nur individuelle, persönliche Anerkennung. 9 Es geht um die Spannungen zwischen relationaler Kränkung einerseits und interpersonelle Gelassenheit andererseits, also um soziale Verhältnisse. Kritische Theorie hat es sich mit der Frage der Anerkennung oftmals schwer gemacht. Denn hier gibt es eine Tradition, Identitäten nicht anzuerkennen und den Identitätsbegriff als ’gefährliche’ Erfindung wegzudrücken (Niethammer 2000). Ernsthafter sind neuere Versuche, das Verhältnis von Anerkennung und Distribution zu problematisieren (Fraser 2000). Anerkennung ist – wie sich dabei zeigt – nicht nur ein idealistisches Wollen oder Gewähren (wie in bestimmten kommunitaristischen Ansätzen), sondern verbunden mit Kämpfen um sozialen Status, um die Distribution ökonomischer Mittel und um institutionelle Machtverhältnisse. Der Fall der Bewegungskultur(en) ist darum so bedeutungsvoll, als er darauf aufmerksam macht, dass auch die Verbindung von Anerkennung und Distribution noch allzu dicht am idealistischen Überbau liegt. Zur Frage nach den materiellen Grundlagen gesellschaftlichen Handelns ist es ein weiterer Schritt, und er führt zur sozialen Praxis als körperlicher Praxis. Die Olympischen Spiele von Sydney 2000 lieferten dazu ein aussagekräftiges Beispiel. In den Mittelpunkt des olympischen Logos setzten die Veranstalter ein Bumerang. Das Wurfholz der vorkolonialen Australier sollte, wie das Organisationskomitee mitteilte, die Idee der multicultural games symbolisieren. Zusammen mit anderen symbolischen Akten wie der Einbeziehung der Aboriginees in die olympischen Zeremonien, in das Kunstfestival und in den Fackellauf war das als ein Stück Anerkennung zu verstehen. Ausserdem richtete man ein National Indigenous Advisory Committee mit Repräsentanten von Aboriginees und Torres Strait-Insulanern ein und stellte finanzielle Mittel für ein Trainingslager indigener Athleten zur Verfügung – das war ein distributiver Beitrag. Und doch – bei den Sportwettkämpfen von Sydney spielte der Bumerang keine Rolle. Keine der anerkannten Sportarten kam aus der Kultur der Einheimischen und kaum eine aus einer nichtwestlichen Kultur. Das folkloristische Ornament und die ökonomische Investition – so sinnvoll sie waren – hatten keine Entsprechung im harten Kern des olympischen Wettbewerbs. Was auch weiterhin fehlte war die entscheidende Anerkennung des ’anderen’ als des körperkulturell anderen. Symbolische Gesten und distributives Entgegenkommen – im Überbaubereich – waren offenbar leichter zu verwirklichen als die Anerkennung einer anderen Praxis an der ’realen Basis gesellschaftlicher Verhältnisse’. 10 Vielleicht fehlt es gerade im Sport an der dazu notwendigen habituellen Gelassenheit... Die Sprache der Spiele „Soziale Gruppen und Völker mehr allgemein unterscheiden sich voneinander durch ihre Spiele nicht weniger als durch ihre Sprachen: Schottisches Baumstammstossen, amerikanischer Baseball, englisches Cricket, baskisches Pelota, afrikanisches Einbaumrudern und afghanisches Buzkashi sind als Praxisformen ebenso unterschiedlich wie die Heimat und die Herkunft ihrer Völker. Daraus ergibt sich eine Ethnologie der körperlichen Bewegung, die man Ethnomotrizität (französisch ethnomotricité) nennen könnte.“ So kennzeichnete der französische Pädagoge Pierre Parlebas (2003: 16) die Aufgabe einer Ethnologie regionaler Bewegungskulturen. Ethnomotrizität als Bearbeitung der Pluralismus von Bewegungskulturen – das ist ein Gegenentwurf zum monolithischen, ’einsprachigen’ Sportbegriff, wie er ansonsten üblich ist. 11 Spiel und Sport sind als kultureller Plural zu verstehen, so wie es Sprache nur in Gestalt von Sprachen gibt. Nicht ’der Sport spricht alle Sprachen’, sondern Bewegungskulturen sind Sprachen – wie lässt sich diese Einsicht in Analyse umsetzen? 9 (1.) Nationalsportarten: Am nächsten liegt es, so wie Parlebas gewisse Formen von ’nationaltypischen Sportarten’ zum Ausgangspunkt zu nehmen, also Spiele und Wettkampfarten, die mit regionaler Identität in einer historisch-geographischen Verbindung stehen: Pencak silat und Indonesien, Gürtelringen Gouren und die Bretagne, Glima und Island, Lucha Canaria und die Kanarischen Inseln, Yagli und die Türkei, Zurkhaneh und der Iran, Sumo und Japan, das Schlagspiel Tsan und das Aostatal in Italien, Pelota und das Baskenland... Bemerkenswert ist die Nennung des amerikanischen Baseball, da sie zeigt, dass der Mainstream selbst regional ist (dazu auch Zurcher/Meadow 1967 und Guttmann 1978: 91-116). Dazu gibt es auch eine gewissermassen ’negative’ Version in Gestalt des in neuere Zeit vieldiskutierten – und möglicherweise durch die Praxis bereits überholten – American exceptionalism: „Warum es in den USA keinen Fussball gibt“ (Markovits 1994 und 2003, Cogliano 2004). Das Nichtvorhandensein ebenso wie das markante Vorhandensein bestimmter Sportarten kann für eine regionale Kultur aussagekräftig sein. 12 Allerdings stellen sich dabei eine Reihe von Problemen. Wie repräsentativ sind eigentlich einzelne Sportarten? Und wie abgrenzbar? Die Frage der Repräsentativität stellt sich insbesondere aus geschlechtspolitischer Sicht, da die Mehrzahl der ’nationalen’ Sportarten nur oder ganz überwiegend von Männern betrieben wird. (Das gilt auch für das frühe Turnen in Europa und für die ersten Jahrzehnte des olympischen Sports.) Daraus folgt gewiss nicht, dass Frauen ausserhalb der Identitätsproblematik stehen, sondern dass eben die Analyse ein Problem hat. Ausserdem ist die üblicherweise angenommene Authentizität einer bestimmten ’regionalen’ Sportart problematisch. Im Regelfall handelt es sich dabei um moderne Konstruktionen. Insofern sind ’Nationalsportarten’ oft vergleichbar den folkloristischen Trachtenkonstruktionen des 19. Jahrhunderts. 13 Nicht zuletzt gehen die realen Identifikationsprozesse oft andere Wege, als der auf ’Ursprünge’ ausgerichtete Ethnograph oder Nationalpolitiker sie sich zurechtlegten mag. In Amsterdam hat man im Zusammenhang neuer urbaner Bewegungsszenen ein eigentümliches Paradox beobachtet. Der ursprünglich ’schwarze’ Sport Capoeira wird nämlich durch ’weisse’ Jugendliche ausgeübt, während ’weisser’ Fussball ein Volksfest niederländischer Surinamer hervorbrachte und damit der Kristallisationspunkt einer ’schwarzen’ Subkultur wurde (Crum 2001). Die Identifikationsprozesse – ’dies hier ist unsere Sportart’ – sind also unberechenbarem historischem Wandel unterworfen. (2.) Eigenschaften: Einen weiteren analytischen Schritt tut man, wenn man Spiele, Sportarten und Bewegungsformen auf diejenigen Eigenschaften hin ’regionalisiert’, die sie erfordern, hervorbringen oder trainieren. Geht man, wie Parlebas es nahe legte, vom Spiel als Sprache aus, so entsprechen die ’Eigenschaften’ in der Spielkultur dem Vokabular in der Wortsprache. Eine Kultur mag im Lichte ihrer Spiele als konkurrierend oder konkurrenzvermeidend, kraftbetont, schnelligkeitsbetont, individualistisch oder kollektivistisch, zeremoniell, tänzerisch, meditativ, kämpferisch oder kampfvermeidend, prahlend oder selbstzurücknehmend erscheinen… Das klingt an ältere ethnologische Annahmen von ’Nationalcharakteren’ an, die von der jeweiligen Kultur ein statisches Bild erzeugten. Man kann kritisch von einer Containerkultur sprechen, insofern Kultur, so verstanden, gewisse Eigenschaften, Gewohnheiten oder Praktiken enthält. Oder von ’methodischem Nationalismus’. Bisweilen mag ein solcher in der Gestalt des Bourdieu’schen Habitusbegriffs wiederkehren. Dieser hat durchaus seine Berechtigung: Kultur ist verkörperlicht, und insofern gibt es Sinn, den Habitus als inkorporierte Kultur zu verstehen (Bröskamp 1994). Auch ist jede Kultur um Mitteilung bemüht und neigt deshalb dazu, eine besonderes Merkmal am Eigenen wie auch am Fremden besonders hervorzuheben. Damit droht jedoch eine kommunikative Verdinglichung, die der Reifizierung ’nationaler Sportarten’ ähnlich ist. Die historische Veränderlichkeit wird auch hier leicht unterschätzt. (3.) Konfigurationen: Wieder auf einer anderen Ebene bewegt sich die Analyse, sobald sie statt auf das ’Vokabular’ auf die ’Grammatik’ der Bewegungskulturen gerichtet wird – 10 und sie wird komplexer. Es zeigen sich dann bestimmte Konfigurationen des Bewegens: Konfigurationen des Raums und der Zeit von Bewegungsabläufen, Muster der Energie und der zwischenmenschlichen Relationen, unterschiedliche Formen der Vergegenständlichung von Bewegungen sowie Konfigurationen der ideellen und organisatorischen Überbauten. An diesen ’grammatikalischen’ Mustern unterscheiden sich jedoch nicht nur die einzelnen regionalen Bewegungskulturen voneinander, sondern es werden auch Differenzen innerhalb bestehender Kulturen sichtbar. Bewegungskulturen innerhalb einer Kultur – ebenso wie Dialekte und Soziolekte innerhalb einer Sprache. Ausserdem führen die Konfigurationen des Bewegens auch auf historische Brüche hin, auf ein Vorher/Nachher. Mittels der Konfigurationsanalyse kann man die Spiele traditioneller Kulturen von denjenigen des resultatproduzierenden modernen Sports und davon wiederum die neu-regionalen Bewegungskulturen ’postmoderner’ Art unterscheiden (Eichberg 1998: 145). (4.) Widersprüche: Beobachtet man regionale Sportarten und regionstypische ’Eigenschaften’, so setzt man sich, wie gesagt, leicht der Versuchung aus, bestehende Verhältnisse zu reifizieren, zu verdinglichen. Demgegenüber führt es weiter, wenn der Blick auf die inneren Widersprüche von Bewegungskulturen gerichtet wird, auf manifeste Konflikte und latente Gegensätze. So zeigen sich Widersprüche der Räumlichkeit und der Zeitabläufe, Widersprüche der Atmosphärenbildung, der zwischenmenschlichen Relationen und der Objektivationen... 14 Die Konfigurationsanalyse ist, so verstanden, ein Verfahren, Bewegungskultur dialektisch denken. (5.) Regionale Identifikation entwickelt sich nicht zuletzt über die Begegnung im Fest. Das Fest Regionale Bewegungskulturen organisieren sich in hohem Masse um das Fest. In Spiel, Tanz und Wettkampf findet zwischen Menschen festliche Begegnung statt – und die Bewegungspraktiken fügen sich in einen umfassenderen Zusammenhang von Festkultur (Eichberg 1995). Dieser Zusammenhang ist bei näherer Betrachtung nicht harmonisch oder idyllisch, sondern voll von Widersprüchen. Spannungen zeigen sich im Verhältnis der Geschlechter und der Macht, im Verhältnis von Insidern und Outsidern. Wir sahen das hier bereits am inneren Gegensatz zwischen den Anthropology Days als Labor und dem olympischen Fest. Der historische Wandel macht die Dialektik zwischen dem Labor (der Vermessungsarbeit) und dem Fest noch deutlicher. In den vormodernen Gesellschaften Europas war Sport (oder genauer: diejenige Spielkultur, die später zum ’Sport’ wurde) ein Teil volklichen Festtreibens. Bauern veranstalteten ihre Mai- und Kirchweihfeste ebenso wie Stadtbürger ihre Karnevals und Schützenfeste, während der Adel sich fortschreitend mit seinen Turnieren und Carrousels sozial absonderte. Im Fest waren Zusammenspiel und Distinktion der sozialen Klassen miteinander verflochten. Immer aber waren die Bewegungsaktivitäten von Spiel, Tanz und Wettkampf im Fest integriert in eine umfassendere Einheit von Ritual, Musik und Lachkultur. Das Fest war ein körperlich-sozialer Ausnahmezustand von zentraler gesellschaftlicher Bedeutung. Mit dem Aufkommen der Industriegesellschaft veränderte sich dieses Verhältnis grundlegend. Im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert wurden Gymnastik und Sport zu ’autonomen’ Sektoren. Hier entwickelten sich neue Formen körperlicher Disziplinierung und Selbstdisziplinierung, die neue Regeln für das soziale Miteinander (und Gegeneinander) hervorbrachten. Was zuvor Volksspiel gewesen war, wurde nun zu hoch spezialisierten ’Sportarten’ mit je eigener Organisation, die die Systematisierung, Messung und Standardisierung der Resultatproduktion kontrollierte. Das Fest war ersetzt durch die spezialisierte Arbeit. Damit bildete sich der moderne Widerspruch von Fest und Fachlichkeit heraus. Und es wurde möglich, Sport als Labor zu nutzen – für die anthropologische Messung von Leistungsdifferenzen, für Gesundheitsarbeit, für multikulturelle Integrationsarbeit etc. Allerdings verschwand das Fest auch in der Welt sportiver Arbeit nicht ganz aus dem Bilde. Es ging in den ’Untergrund’. Die bürgerlichen Sportklubs hielten ihre Jahresfeste mit Ball 11 und Bankett, nicht zuletzt um sich zu finanzieren. Gymnastikvolk versammelte sich in Turnfesten und zeigte sich in neuen Formen der Massenvorführung. Arbeiterkultur und Arbeitersport schlossen daran an und organisierten sich um Maifeste, Arbeiterolympiaden und andere demonstrative Festveranstaltungen. Pierre de Coubertin entwickelte, angeregt von den Weltausstellungen, Ideen eines periodisch wiederkehrenden Sportfestivals mit neureligiösen Untertönen einer ’olympischen Religion’. Später entwickelten Fussballfans mit Massengesängen, Sprechchören, Gesichtsbemalung, Trommelmusik und körperlichen ’Wellen’ auf den Tribünen, aber auch mit Alkoholkonsum und Gewaltausbrüchen eine karnevalistische Festkultur eigener Art, die den ’unterirdischen’ Charakter des Fests im Sport besonders deutlich machte. Das Verhältnis zwischen Sport und Fest scheint sich nun seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert erneut zu verschieben. Das geschieht nicht zuletzt im Zusammenspiel mit Medienentwicklung und Unterhaltungsindustrie. Sowohl die Olympischen Spiele als auch breitensportliche Feste wie das Deutsche Turnfest und das ’Landestreffen’ der dänischen Volksgymnastik geraten zunehmend in den Sog der ’Eventkultur’ und der ’Erlebnisökonomie’. Neue Tribalisierungen? Es ist nicht zufällig, dass man vom Problem multikultureller Erziehung und Konfliktbewältigung her auf das Fest gestossen ist (Emmendörfer-Brössler 1999 und 2000). Der Reichtum der Feste liefert ein farbiges Gegenbild zu den ansonsten verbreiteten ’Problem’-Szenarien, die sich auf Ghettobildung, religiösen Fanatismus und Minderheitenkriminalität beziehen. Das Fest wird zum Hoffnungsträger multikultureller Bildung. Hier stellen sich jedoch Aufgaben neuer Art auch für die Analyse. Vom Sport her kommend, hat man sich bislang überwiegend auf Selbstorganisation und Verein konzentriert – Sport als Labor der Integration – und dabei dazu tendiert, das Fest zu übersehen. Am Sport wäre also weniger auf Fachlichkeit und Freizeit denn auf das Fest zu achten. 15 Und vom Fest her kommend, blieb die Rolle der Körperbewegungen – hierunter des Sports – bislang unterbelichtet. Sie verdient es, markanter ins Bewusstsein gehoben zu werden. Zudem ist man bisweilen versucht, an die Wiederentdeckung des Fests allzu idyllische Erwartungen zu knüpfen. Das kann zu Enttäuschungen führen. Die Situation des Fests führt in eine Welt von Widersprüchen. Wo Menschen zusammenkommen – auch im Fest – entstehen Konflikte, Unsicherheit und Entfremdung – Unbalancen der Macht werden sichtbar. Zu diesen inneren Gegensätzen gehört das Spannungsverhältnis zwischen der Einbahnstrasse des westlichen Wettkampfsports und dem breiten Spektrum an Fest-Aktivitäten. Auch der Widerspruch zwischen der kultur-nationalen Absonderung um ’unseren eigenen Sport’ und dem Zusammenspiel mit anderen Bewegungskulturen wurde bereits genannt. Das Streben nach Authentizität als dem Kriterium des ’richtigen’ Spiels, der ’richtigen’ Eigenschaften und der ’richtigen’ Identität ist problematisch, wenngleich es auf reale Erfahrungen gesellschaftlicher Entfremdung und Nichtanerkennung reagiert und von daher ernst zu nehmen ist. 16 Die skizzierten Überlegungen geben Anlass zu drei abschliessenden Thesen. (1.) Nicht-Anerkennung bewirkt Reifizierung, und dies auf der Seite der NichtAnerkenner ebenso wie bei den Nicht-Anerkannten. Das Ergebnis solcher Verdinglichung ist die Annahme von regional-identitären Sportarten und deren ’Eigenschaften’ ebenso wie von nationalen ’Charakteren’ und deren ’Eigenschaften’. Anerkennung ist hingegen relational, sie eröffnet Wege zur Gestaltung von Relationen durch körperliche Praxis. Menschen haben mit unreduzierbarer Verschiedenheit zu leben – und das Fest bietet dafür einen Rahmen. In der Begegnung entsteht etwas Neues, Drittes. (2.) Anerkennung der Vielfalt heisst auch, dass mit Neubildungen zu rechnen ist. Neue Spiele erscheinen – auch wenn sie sich bisweilen als ’alte’ geben – ebenso wie neue Nationen und neue Tribes sich auf der Landkarte markieren (Maffesoli 1988). Die Kräfte sozialer Beharrung 12 sollten zwar keineswegs unterschätzt werden. 17 Aber die Stämme der Zukunft bilden sich nicht in der Vergangenheit, sondern aus den Widersprüchen der Gegenwart heraus. (3.) Damit stellt sich nicht die Frage nach dem Beitrag ’des’ Sports, sondern die Frage: Welcher Sport? Der Blick wird frei auf eine andere Integration als diejenige der olympischen Menschenvermessung von 1904 und auf ein anderes Zusammenspiel zwischen ’uns’ und ’den anderen’. Der Sport als „Träger der universellen olympischen Werte“ ist zu solchem Dialog wenig hilfreich. Der Singular löst sich in einen nicht-reduzierbaren Plural auf. Und in Feste neuen Typs. Literatur Aisen, Adam Nussbaum 2002: Venskabskampe. Fodbold og identitetsdannelse blandt drenge med indvandrerbaggrund. Aarhus: Institut for Historie og Områdestudier, Abschlussarbeit. Amador Ramirez, Fernando, Ulises Castro Nunez & José Miguel Alamo Mendoza 1997 (eds.): Luchas, deportes de combate y juegos tradicionales. Madrid: Gymnos. Bale, John & Joe Sang 1996: Kenyan Running. Movement Culture, Geography and Global Change. London: Frank Cass. - 2002: Imagined Olympians: Body Culture and Colonial Representation in Rwanda. Minneapolis: University of Minnesota Press. Barreau, Jean-Jacques & Guy Jaouen 1998 (eds.): Éclipse et renaissance des jeux populaires. Des traditions aux régions de l’Europe de demain. Karaez: FALSAB (first ed. 1991). - & Guy Jaouen 2001 (eds.): Les jeux traditionnels en Europe. Éducation, culture et société au 21e siècle./Los juegos tradicionales en Europa. Educación, cultura y sociedad en el siglo 21. Plonéour Ronarc’h: Confédération FALSAB. Baumann, Wolfgang 1986 (ed.): Fundamentals of Sport for All. International Congress. Frankfurt/M.: DSB. Blecking, Diethelm 1991 (Hrsg.): Die slawische Sokolbewegung. Beiträge zur Geschichte von Sport und Nationalismus in Osteuropa. Dortmund: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität. - 2001: Polen, Türken, Sozialisten. Sport und soziale Bewegungen in Deutschland. Münster: Lit. Bockrath, Franz 1998: ”Mythos Highland Games – zur Zivilisierung einer Volkskultur.” In: W. Siebers & U. Zagratzki (Hrsg.): Deutsche Schottlandbilder – Beiträge zur Kulturgeschichte. Osnabrück, 187-204. Bröskamp, Bernd 1994: Körperliche Fremdheit. Zum Problem der interkulturellen Begegnung im Sport. Sankt Augustin: Academia. Brownell, Susan 1995: Training the Body for China. Sports in the Moral Order of the People’s Republic. Chicago, London: University of Chicago Press. - 2005: “Anthropology.” In: Roger Bartlett, Chris Gratton & Christer Rolf (eds.): International Encyclopedia of Sport Studies. Routledge, in press. - 2007 (ed.): The 1904 Anthropology Days and Olympic Games: Sport, Race, and American Imperialism. University of Nebraska Press (in press). Buber, Martin 1923: Ich und Du. Nachdruck in: Das dialogische Prinzip. Heidelberg: Lambert Schneider 1973. - 1948: Das Problem des Menschen. Heidelberg: Lambert Schneider. Cogliano, Francis D. 2004: “Baseball and American exceptionalism.” In: Adrian Smith & Dilwyn Porter (eds.): Sport and National Identity in the Post-War World. London/New York: Routledge, 145-167. 13 Cordes, Hiltrud 1992: Pencak Silat. Die Kampfkunst der Minangkabau und ihr kulturelles Umfeld. Frankfurt/M.: Afra. Coubertin, Pierre de 1931: Mémoires Olympiques. Lausanne: Bureau International de Pédagogie Sportive. (Neuausgabe Paris: Revue EP.S, 1996.) – Auf Deutsch 1936: Olympische Erinnerungen. Limpert. – Auf Englisch 1979: Olympic Memoirs. Lausanne: IOC, Nachdruck 1989. Crum, Bart 2001: “Bewegungskulturen schwarzer Minoritäten in Amsterdam.“ In: Jürgen Funke-Wieneke & Klaus Moegling (Hrsg.): Stadt und Bewegung. Immenhaus: Prolog, 159-171. DaCosta, Lamartine & Ana Miragaya 2002 (eds.): Worldwide Experiences and Trends in Sport for All. Aachen: Meyer & Meyer. Dufaitre, Anne 1989: Traditional Games. Preliminary Observations on the Preparation of a National or Regional Catalogue or inventory. Paper of the Council of Europe, Strasbourg. Egan, Sean 2003: “An holistic approach to the educational components of traditional games.” In: Studies in Physical Culture& Tourism, Poznan, 10: 1, 39-49. Eichberg, Henning 1991: „Der Körper als Idential. Zum historischen Materialismus der nationalen Frage.“ In: Diethelm Blecking (Hrsg.): Die slawische Sokolbewegung. Dortmund: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität, 219-241. - 1993: „Das Lachen der Pygmäen auf der Rennbahn. Über den olympischen Sport im Nord-Süd-Konflikt.“ In: Hubert Christian Ehalt & Otmar Weiss (Hrsg.): Sport zwischen Disziplinierung und neuen sozialen Bewegungen. Wien u.a.: Böhlau, 55-81. - 1995: „Vom Fest zur Fachlichkeit. Über die Sportifizierung des Spiels.“ In: Ludica, annali di storia e civiltà del gioco, Viella, 1:183-200. - 1998: Body Cultures. Essays on Sport, Space and Identity. London: Routledge. - 2000: „Sport, Nation und Identität.“ In: Klaus Heinemann & Manfred Schubert (Hrsg.): Sport und Gesellschaften. Schorndorf: Hofmann, 37-61. - 2001: „Es, Ich und Du in Bewegung.“ In: Klaus Moegling (Hrsg.): Integrative Bewegungslehre. Immenhausen/Kassel: Prolog, Bd.1: 219-244. - 2004 a: The People of Democracy. Understanding Self-Determination on the Basis of Body and Movement. Århus: Klim. - 2004 b (ed.): Education through Sport: Towards an International Academy of Sport for All. A report to the International Sport and Culture Association (ISCA) and the European Community. Gerlev: International Movement Studies. Elias, Norbert 1989: Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Emmendörfer-Brössler, Claudia 1999: Feste der Völker. Ein multikulturelles Lesebuch. Hrsg. Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Frankfurt/M.: VAS. - et al. 2000: Feste der Völker. Ein pädagogischer Leitfaden. Hrsg. Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Frankfurt/M.: VAS. Fatès, Youcef 1994: Sport et Tiers-Monde. Paris: PUF. Fischer, Jean 2004: “Multikulturel folkelighed – noget om anerkendelse.” In: Jørn Møller (Hrsg.): Folk – om et grundbegreb i demokrati og kultur. Århus: klim. Fluegelman, Andrew 1976: The New Games Book. Tiburon/California: Headlands & Garden City/N.Y.: Dolphins. Fraser, Nancy 2000: „Rethinking recognition.“ In: New Left Review, May/June, 3: 107-120. 14 Guttmann, Allen 1978: From Ritual to Record. The Nature of Modern Sport. New York: Columbia University Press. - 1994: Games and Empires. Modern Sports and Cultural Imperialism. New York: Columbia University Press. Hargreaves, Jennifer 1989: “Urban dance styles and self-identities. The specific case of bhangra.” In: Henning Eichberg & Jørn Hansen (Hrsg.): Körperkulturen und Identität. Münster: Lit, 149-160. Hargreaves, John 2000: Freedom for Catalonia? Catalan Nationalism, Spanish Identity and the Barcelona Olympic Games. Cambridge: Cambridge University Press. Hartmann-Tews, Ilse 1996: Sport für alle!? Strukturwandel europäischer Sportsysteme im Vergleich: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Grossbritannien. Schorndorf: Hofmann. Heinemann, Klaus 2004 (ed.): Sport and Welfare Policies. Six European Case Studies. Schorndorf: Hofmann. International Journal of Eastern Sports & Physical Culture. Ed. Jong Young Lee. Suwon/Korea: University of Suwon. Jarvie, Grant 1991: Highland Games. The Making of the Myth. Edinburgh: Edinburgh University Press. - 2003: “Highland Games, ancient sporting traditions and social capital in modern international communities.” In: Studies in Physical Culture& Tourism, Poznan, 10: 1, 27-37. JUGAJE/European Traditional Sports & Games Association – http://www.jugaje.com/ Junghanns, Wolf-Dietrich 2003: „Daj boju – Drauf und dran! Traditioneller ostslawischer Faustkampf und heutige Popularisierung eines ‚russischen Stils’.“ In: Berliner Debatte Initial, Berlin, 14: 4/5, 63-113. Kandil, Fuad 1983: Nativismus in der Dritten Welt. Wiederentdeckung der Tradition als Modell für die Gegenwart. St. Michael: Bläschke. Krist, Stefan 2005: “Where going back is a step forward. The re-traditionalising of sport games in post-Soviet Buriatia.” In: Sibirica, Journal of Siberian Studies, 4: 1, in press. Kuznezova, Zinaida & Oleg Milstein 1992: “Traditions of the Tatar cultural minority.” In: Leena Laine (ed.): Sport and Cultural Minorities. Helsinki: Finnish Society for Research in Sport and Physical Education, 282-84. Larsen, Knud 2003: Idrætsdeltagelse og idrætsforbrug i Danmark. (= Bevægelsesstudier. 4) Århus: Klim. Leach, Jerry W. 1976: Trobriand Cricket – an Ingenious Response to Colonialism. Film. Berkeley: University of California. Liponski, Wojciech 2001: Encyklopedia sportow swiata. Poznan: Atena. – English: World Sports Encyclopedia. St. Paul/Minn.: MBI 2003. - & Guy Jaouen 2003 (eds.): Ethnology of Sport. Special issue of Studies in Physical Culture and Tourism, Poznan, 10: 1. Maffesoli, Michel 1988: Le temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes. Paris: La Table Ronde. – Auf englisch: The Time of the Tribes. London: Sage 1996. Das Magazin, Bildung und Kultur in Europa. Hrsg. Europäische Kommission, Brüssel, Nr. 24, 2004. Markovits, Andrei S. 1994: Kein Ball – nirgends. Warum es in den USA keinen Fussball gibt. (= IKUS lectures. 3: 15) Wien: Institut für Kulturstudien. - & Steven L. Hellerman 2003: Offside: Soccer and American Exceptionalism. Princeton & Oxford: Princeton University Press. Møller, Jørn 1990/91: Gamle idrætslege i Danmark. Neuaufl. Gerlev: Idrætshistorisk Værksted 1997, Bd.1-4. 15 Muller, Kal 1970: „Land diving with the Pentecost Islanders.“ In: National Geographic Magazine, 138: 6, 799-817. Niethammer, Lutz & Axel Dossmann 2000: Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur. Reinbek: Rowohlt. Parlebas, Pierre 2003: “The destiny of games heritage and lineage.” In: Studies in Physical Culture and Tourism, Poznan, 10: 1, 15-26. Peron, François 1807: Voyage de Découvertes aux Terres Australes. Paris, Bd. 1. Pfister, Gertrud, Toni Niewerth & Gerd Steins 1996 (Hrsg.): Spiele der Welt im Spannungsfeld von Tradition und Moderne. Les jeux du monde entre tradition et modernité. Games of the World between Tradition and Modernity. Sankt Augustin: Academia, Bd. 1. - 1997 (ed.): Traditional Games. Special issue of: Journal of Comparative Physical Education and Sport, Schorndorf, 19:2. - 2004 (ed.): Games of the Past – Sports for the Future? Globalisation, Diversification, Transformation. Sankt Augustin: Academia. PMP Consultants 2004: Studies on Education and Sport – Sport and Multiculturalism. Final Report. In partnership with the Institute of Sport and Leisure Policy, Loughborough University. European Commission: DG Education & Culture. http://europa.eu.int/comm/sport/documents/lot3.pdf Renson, Roland, Eddy de Cramer & Erik de Vroede 1997: "Local heroes: Beyond the stereotype of the participants in traditional games." In: International Review for the Sociology of Sport, 32: 1, 59-68. Sie, Swanpo 1978: “Sports and politics: The case of the Asian Games and the Ganefo.” In: Benjamin Lowe et al. (eds.): Sport and International Relations. Champaign/Ill.: Stipes, 279-296. Sloterdijk, Peter 1998/2004: Sphären. Bd. 1-3. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Sullivan, James Edward 1905 (ed.): Spalding’s Official Athletic Almanac for 1905: Special Olympic Number, Containing the Official Report of the Olympic Games of 1904. New York: American Sports Publishing. Taylor, Charles 1992: Multiculturalism and “The Politics of Recognition”. Princeton/N.J.: Princeton University Press. Thode-Arora, Hilke 1989: Für fünfzig Pfennig um die Welt. Die Hagenbeckschen Völkerschauen. Frankfurt & New York: Campus. Todorov, Tzvetan 1996: Abenteuer des Zusammenlebens. Versuch einer allgemeinen Anthropologie. Berlin: Klaus Wagenbach. Zuerst Paris: Seuil 1995. Ziegler, Jean 1988: La victoire des vaincus. Paris: Seuil. – Deutsch: Der Sieg der Besiegten. Unterdrückung und kultureller Widerstand. Wuppertal: Peter Hammer 1989. Zurcher, Louis A. & Arnold Meadow 1967: “On bullfights and baseball. An example of interaction of social institutions.” Reprint in: Günther Lüschen (ed.): The Cross-Cultural Analysis of Sport and Games. Champaign/Ill.: Stipes, 1970, 109-131. 1 Magazin 2004, 24: 26. Dieses Wort hat einen festen Platz in Festreden und Vorworten von Politikern, so des deutschen Bundesinnenministers Otto Schily in der Schrift des DSB: Integration im Sportverein. Stuttgart 2003, 2. 3 Hauptquelle: Sullivan 1905. Eine genauere Dokumentation über die Anthropology Days von 1904 ist in Vorbereitung im Sammelband einer Konferenz, die 2004 an der University of Missouri – St. Louis unter der Leitung der Anthropologin Susan Brownell stattfand. Dort sind die folgenden Angaben im einzelnen belegt (Brownell 2007). Siehe ansonsten: Eichberg 1993 und über die Völkerschauen Thode-Arora 1989. 2 16 4 Das ausführliche Zitat findet sich bei Nancy Parezo in Brownell 2007. Eine gekürzte und entschärfte Fassung enthalten die Ausgaben von Coubertin 1931: 68, 1936: 73 und 1979: 43. 5 So der damalige DSB-Präsident Willy Weyer und der Generalsekretär des DSB, Jürgen Palm, in einem internationalen Kongress für Sport for all: Baumann 1986. 6 Siehe die Kongress-Sammelbände von Barreau/Jaouen 1998 und 2001 und Liponski/Jaouen 2003. Einen organisatorischen Zusammenhang bildet seit 2003/4: JUGAJE. 7 1955 trafen sich in Bandung Vertreter von 29 afrikanischen und asiatischen Ländern, um über wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit und – vor allem – über die weltpolitische Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus zu beraten. Die Stimmung des Kongresses war so freundschaftlich und vielversprechend, dass danach der „Geist von Bandung“ zu einem festen Begriff wurde. Auf der Grundlage des Bandung-Treffens wurde 1961 der Zusammenschluss der blockfreien Staaten ins Leben gerufen, der eine dritte Kraft gegenüber den USA und der Sowjetunion darstellen sollte und durch die Namen Nasser, Nehru, Nkrumah, Sukarno und Tito gekennzeichnet war. Obwohl man noch Anfang der 1980er Jahren in Fortsetzung dieser Versuche von einer „Neuen Weltordnung“ sprach, erwies sich auf die Dauer die afrikanisch-asiatisch-lateinamerikanische Einheit als Illusion. 8 Neue Vorstösse in Richtung auf traditionelle Spiele und regionale Bewegungskulturen, insbesondere von Ostasien her, siehe: International Journal 2004. 9 In diesem Sinne ist Bubers dialogisches Prinzip bisweilen entschärft und privatisiert worden. 10 Damit wird vorgeschlagen, Karl Marx neu zu lesen – bzw. gegen den ökonomistischen Strich zu bürsten, siehe auch Eichberg 1991. 11 Das eingangs zitierte Postulat der EU-Politik zeigt einen Zusammenhang von monolithischem Sportbegriff und ’europäischer Integration’, wie er durchaus typisch ist. Siehe auch PMP 2004 über die Leitfrage: „The contribution of sport, as an instrument of non-formal education, to the multicultural dialogue between young people, and the part it plays in promoting the integration of recent migratory flows.” Der unitäre Sportbegriff ist offenbar auch eng verwandt mit der instrumentellen Betrachtungsweise, die ’den Sport’ als tool, means, instrument und vehicle für gewisse vorgegebene Zwecke thematisiert. 12 Zwar am Rande des Sports, aber im Zentrum des soziologischen Problems befindet sich die Studie zum Duell in der preussisch-deutschen Geschichte: Elias 1989. 13 Das hat man anhand der “alten Spiele in Dänemark“ unterstrichen, weshalb vermieden wird, von ’dänischen alten Spielen’ zu sprechen: Møller 1990/91. Über die neuere Konstruktion des russischen Faustkampf: Junghanns 2003. Über die schottischen Highland Games: Jarvie 1991 und 2003 sowie Bockrath 1998. 14 Hier wäre die Raumphilosophie oder Sphärologie von Sloterdijk 1998/2004 fruchtbar zu machen. 15 Vom Sport her gibt es mit Blick auf die neuen Einwanderungskulturen nuancierte Ansätze bei Bröskamp 1994 und Blecking 2001, in Dänemark von Aisen 2002. 16 In Bezug auf die Spiel- und Bewegungskultur kann man von ’Nativismus’ sprechen, etwa im Sinne des ägyptischen Soziologen Kandil, dessen nuancierte Studie von 1983 sich im Lichte der Erfahrungen mit dem neueren islamischen Fundamentalismus als hellsichtig erwiesen hat. Kandil wies auf die Differenz zwischen unterschiedlichen ’nationalitären’ Phänomenen hin. Dem staatsbezogenen ’Nationalismus’ westlicher Tradition stellte er den kulturellen ’Nativismus’ (besonders in der Dritten Welt) gegenüber. Im Nativismus, wie er zum Beispiel von der ägyptischen Moslembruderschaft repräsentiert wurde, spielte die ’eigene’ Körperlichkeit eine wichtige Rolle. Allerdings ging Kandil charakteristischerweise nur auf körperliche Inszenierungen (Schleier und Bart) ein, nicht auf Bewegungskultur und Sport. Über körperliche Kultur im Zusammenhang des kulturellen Widerstands in der Dritten Welt siehe Ziegler 1988. Über Demokratie und Körperlichkeit: Eichberg 2004 a. 17 Wie es die luftigen Theorien der ’Modernität’ und der ’Individualisierung’ von der postmodernen Nomadenphilosophie bis hin zu Anthony Giddens und Ulrich Beck tun. Dagegen stehen die empirischen Befunde zur Kontinuität des Habitus und der sozialen Klassenverhältnisse, siehe Pierre Bourdieu und zum Sport: Larsen 2003. 17