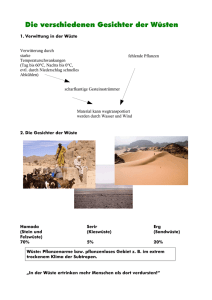Schutz vor der Sonne
Werbung

1 Hintergrund An der Todesgrenze – Leben in extremer Umwelt Autor: Florian Hildebrand Überleben in eisiger Kälte Die Antarktis im Winter: schwärzeste Finsternis und eine große, weiße Einöde. Dazwischen überall Flecken, in denen es immer etwas Bewegung gibt. Es sind Haufen von Kaiserpinguinen, die hier dichtgedrängt auf ihren Eiern brüten. Wie kommen die Tiere dazu, ihre Kinder dort großzuziehen, wo es auf der Erde so ziemlich am ungemütlichsten ist? Sie müssen Stürme von zum Teil 180 Stundenkilometern und Temperaturen bis zu 80 Grad minus aushalten. Es gibt nichts zu fressen, denn das Meer mit seinen reichen Fischgründen ist Hunderte von Kilometern entfernt. Tiere in der Antarktis haben sich zum Teil ausgefallene Lösungen einfallen lassen, um mit solchen extremen Umweltsituationen fertig zu werden. Nicht allein auf Fett und Federn konzentrieren sich dabei die Anpassungsleistungen. So schicken Robben und Pinguine gezielt Blut in die Körperregionen, die auch bei schärfster Kälte immer warm bleiben müssen. Fische haben Gefrierschutzmittel im Blut. Die Weddellrobbe – Meisterin im Tauchen Alle Tiere der Antarktis leben vom Meer, das unerwartet reich an Nahrung ist. Eine Weddellrobbe taucht bis zu 700 Meter tief, um sich fette Fische schnappen zu können. In einer halben Stunde ist sie wieder an der Oberfläche, ohne in der Zwischenzeit atmen zu können. Ihren Energieverbrauch muss sie dabei so gut einteilen, dass sie vom Fischfang mehr hat als sich nur gerade das wieder zuzuführen, was sie beim Tauchen verbraucht hat. Doch wie findet sie das Loch im Eis wieder, durch das sie in die Tiefe geglitten ist? Dieser Frage gehen Wissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven nach. Sie fahren mit dem institutseigenen Forschungsschiff “Polarstern” in den antarktischen Sommer, um an Ort und Stelle den Überlebenstricks der Tiere nachzugehen. Da ist zum Beispiel Joachim Gutt, der mit seiner Unterwasserkamera gerne am Meeresboden gründelt. Er war selbst überrascht, dass sich dort unten bei beständig knapp unter null Grad stellenweise ein atemberaubender, geradezu tropischer Reichtum an Arten und Formen entfaltet hat. Was da in Hunderten von Metern unter der Wasseroberfläche im Einzelnen alles sitzt, kriecht, filtriert, saugt, schwebt, wühlt und lauert, kann er trotz elektronischer Kamera nur ahnen. Eis wohin das Auge blickt Eine bis zu 4.000 Meter dicke Gletscherschicht presst Antarktika tief in die Erdkruste. Die Kontinentalränder stürzen daher meist unvermittelt 600, 700 Meter tief ab. Vom Licht der Oberfläche dringt kaum ein Strahl bis zum Meeresboden vor. Die Saison biologischer Aktivität dauert nur zwei bis drei Monate im Jahr. Da im langen, dunklen Winter die Produktion von Biomasse praktisch ruht, schwebt in dieser Zeit kaum organisches Material zu den Lebewesen am Boden hinunter. Das Nahrungsangebot ist also begrenzt. Was in der Tiefe gedeiht, wächst langsamer und in geringerer Stückzahl als in gemäßigteren Breitengraden. 2 Bisher haben Gutt und seine Kollegen weltweit allenfalls ein Prozent des Artenspektrums auf dem antarktischen Meeresboden erfasst. Erst in den beiden letzten Jahrzehnten ist überhaupt das wissenschaftliche Interesse für diesen kalten unterseeischen Lebensraum erwacht. Heute treibt die Suche nach neuen Naturstoffen und biotechnologisch verwertbaren Genen die Forscher ins tiefe, kalte Wasser. Die größte Überraschung erlebten die Forscher erst vor wenigen Jahren, als sie genauer untersuchten, warum das Schelfeis vor der Küste des sechsten Kontinents von braunen Schlieren durchzogen ist. Sie fanden nicht Staub oder Gesteinsmehl, sondern winzige Algen und Krebschen, die im, am und vom Eis leben. Sie entdeckten auch, dass der Krill – kleine Leuchtgarnelen, die im antarktischen Sommer zu riesigen Teppichen verhakt auf der Meeresoberfläche treiben – im Winter von den Algen an der Eisunterseite ernährt. Bisher war nämlich ungeklärt, wie die Krebschen die kalte Jahreszeit überleben. Selbst sind sie Lebensgrundlage für Bartenwale und unzählige Fischarten. Der Krill gilt heute als gefährdet; japanische Fischtrawler wollen ihn wie Sahne abschöpfen und zu Tierfutter verarbeiten. Für die antarktischen Lebensgemeinschaften wäre das eine Katastrophe. Überleben bei 50 Grad im Schatten “Allah”, sagt ein arabisches Sprichwort, “hat alles überflüssige Leben aus seinem Garten, der Wüste, entfernt, um in Frieden lustwandeln zu können.” ‚Überflüssig‘ ist in der Tat in der Wüste nichts. Nur eins gibt es dort in Hülle und Fülle: Hitze. Wer also tagsüber durch die Wüste “lustwandelt”, wird sie öde und leer vorfinden. Doch in der Dunkelheit wird sie lebendig. Um vor der Hitze zu fliehen, gehen die meisten Tiere in den Untergrund, schlafen dort und kommen erst nachts an die Oberfläche. Dann freilich ist es zum Beispiel in der Sahara sehr kalt. Die Lebenssäfte von Insekten und Käfern werden da gallertartig, die Tiere erstarren. In der Wüste fordern die zum Teil extremen Temperaturschwankungen von über 80 Grad innerhalb von 24 Stunden viele Tiere mehr heraus als die schiere Hitze. Schutz vor der Sonne Wer tags aktiv ist, muss sich der Hitze stellen, ohne von ihr erschlagen zu werden. Eine Taktik ist, Licht an der Körperoberfläche abzuweisen. Wüstenraben zum Beispiel glänzen mit ihren Federn und viele Insekten mit ihrem Chitinpanzer, darunter auch Ameisen der Gattung Cataglyphis. Sie leisten sich außerdem in ihrem Staat einen eigenen Berufsstand, den der Thermometer. Jeden Morgen sind die lebenden Wärmefühler die ersten, die vor den in den Sand gegrabenen Bau treten und die Temperatur messen. Ist die Umgebung richtig temperiert, benachrichtigen sie die Stammesgenossen, und schlagartig schwärmen Tausende Ameisen aus, um Nahrung zu suchen. Echsen wie Skink und Wüstenwaran tragen ein Thermometer in der Gestalt eines dritten Auges auf dem Scheitel. Dieses Auge enthält lichtempfindliche Zellen, mit denen die Tiere die Intensität der Sonneneinstrahlung messen. Um ein Leben in der Wüste zu führen, müssen Tiere und Pflanzen drei Probleme lösen: wie halte ich die Hitze aus? Wie beschaffe ich mir meine Nahrung in einer Umgebung, die prinzipiell arm an Biomasse ist? Und: Wie komme ich mit dem Wassermangel zurecht? Die letzte Frage interessiert natürlich am meisten Amphibien und Fische, die es in kleineren 3 Wüsten tatsächlich gibt. Sie haben zum Teil abenteuerlich ausgeklügelte Verfahren entwickelt, wie sie in dieser für sie absolut lebensfeindlichen Umgebung ihre Art über die Runden bringen. Wasser – das wertvollste Gut in der Wüste Einst hatte der Postflieger und französische Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry nach einer Notlandung in der Sahara Tücher ausgelegt, um seinen Durst wenigstens mit morgendlichem Tau zu stillen. Auf diese Taktik sind viele Wüstentiere schon lange vor ihm gekommen. Kleinen Tieren mag das für ihren Tagesbedarf genügen. Ein großes Säugetier wie das Kamel hat sich hingegen für seinen Wasserhaushalt eine ausgefeilte Strategie einfallen lassen müssen, denn die wichtigste Regel heißt: sparen. Es ist aber ein ebenso altes wie unausrottbares Ammenmärchen, ein Kamel saufe den ganzen Wasservorrat in den Höcker. Dort hat das Wüstenschiff keinen Tank, sondern einen beträchtlichen Fettsteiß. Einige Vogelarten können bei entsprechend sparsamer Lebensführung sogar Wochen ohne Wasser auskommen. Die Wüstenläuferlerche zum Beispiel lebt in ihrem Tarngefieder zwischen Steinen mitten in der Sahara und weitab von jeder Wasserstelle. Auch die Palmtaube entfernt sich gelegentlich von ihrer Oase und treibt sich viel mehr als einen Tagesflug entfernt an den trockensten und heißesten Stellen herum. Für einen Vogel mit seinem durchs Fliegen hohen Energieumsatz und Wasserbedarf ist das schon eine bemerkenswerte Anpassung ans Leben in der Wüste. Noch weiter treiben es allerdings Spinnen und Skorpione: die trinken gar nicht. Dromedar und Co. Am schwersten tun sich grundsätzlich Säugetiere mit der Wüstenanpassung; sie brauchen eine Menge Wasser und Energie schon, um ihre Körperwärme auf gleichem Niveau zu halten. Die Aufgabe wächst mit dem Volumen der Tiere. Daher nimmt in der Wüste die Artenvielfalt mit der Größe ab. So haben sich mit der Wüste nur wenige Säugetiere anfreunden können: etliche Mäusearten, der Wüstenfuchs Fennek, ein paar Wildkatzenarten, Mähnenschaf, einige Gazellen- und Antilopenarten, schließlich Dromedar und Trampeltier. Wer in der Wüste überleben will, darf mit seinem Speiseplan nicht wählerisch sein. Da die Wüste nicht von leckeren Pflanzen und Beutetieren überquillt, muss man sich bei Gelegenheit auch einmal überfressen, denn man weiß nie, wann die nächste Mahlzeit vorbeikommt. Die Walzenspinne, eine ziemlich urtümliche Gattung unter den Spinnentieren, hat dazu einen sehr dehnbaren Hinterleib, und wenn sie ein Beutetier überwältigt hat, dann frisst sie es, auch wenn sie selbst kleiner als das Opfer ist. Diese Spinne hat keinen Reflex, mit dem Fressen aufzuhören, wenn sie genug hat. Bei einem überreichen Nahrungsangebot kann das sogar dazu führen, dass das Tier platzt. Leben in der Tiefsee In der schwarzen und merkwürdigen Tiefe tun sich die letzten Geheimnisse dieser Erde auf. Nur ein paar Dutzend Menschen haben sie kennen gelernt, und auch das nur auf Stippvisite. Der Kosmos tief unter der Meeresoberfläche ist riesig, der größte Lebensraum des Planeten überhaupt und nahezu unerforscht. Jules Verne hat immer noch Recht: “Das Meer allein, das sich nie verändert, könnte in seinen unerforschlichen Tiefen noch einige Warenmuster der urzeitlichen Schöpfungen enthalten.” 4 Riesenkraken – Bewohner der Dunkelheit Die Tiefsee ist der ursprünglichste Lebensraum der Erde. Mochten an der Oberfläche die Kontinente auseinanderdriften, die Meteoriten einschlagen und fast alles Landleben auslöschen, die Eiszeiten kommen und gehen, die Ameisen die Welt erobern, die Saurier aussterben, die Säugetiere immer größer werden – hier unten herrschte und herrscht ewige Ruhe und kühle Finsternis. In diesem abgeschlossenen schwarzen Universum leben Tiere fort, die bereits das Erdaltertum geboren hatte: Krebse, Muscheln und andere Weichtiere, und darunter auch er: Archeteuthis. Seine Ahnengalerie ist beeindruckend, sie geht 540 Millionen Jahre zurück bis ins Kambrium. Paläontologen, die seine geradezu mythische Geschichte verfolgen, finden keine Tiergruppe, die sich länger auf der Erde halten konnte. Der Riesenkrake, keine Legende, existiert wirklich, er hat es im Lauf seiner Entwicklung zu so gewaltigen Ausmaßen gebracht, dass er selbst dem Kampf mit dem Pottwal nicht aus dem Weg geht. Bizarre Landschaften am Meeresgrund 4.000 Meter unter dem Meeresspiegel: vom Boden wachsen haushohe Schlote nach oben, Kamine, aus denen es schwarz herauskocht. Hier reiben die Kontinentalplatten der Erdkruste aneinander, Magma quillt aus dem Meeresboden, und Meereswasser verschwindet im Untergrund, mit ungeheurem Druck durch die Schlote wieder herausgeschossen zu kommen. Bakterien wachsen hier, die statt von Sauerstoff von Schwefel leben und nur bei kochendem Wasser existieren können. ‚Hyperthermophile Archäen‘ hat sie deshalb ihr Entdecker, der Regensburger Mikrobiologe Karl Stetter, genannt. Die nächste Überraschung wartet um die Ecke, wo das vulkanische Tiefenwasser auf tropische Wärme abgekühlt ist - wo die Temperatur normalerweise bei gerade einmal 1,4 Grad liegt. Da wiegen sich, am Boden angewachsen, meterhohe Röhrenwürmer im Wasser. Es gibt aber auch festsitzende Krebse, Schnecken, riesige Muscheln und Fische. Der vulkanische Untergrund setzt eine ungeheure Menge anorganischer Energie frei, die die Tiere mit Hilfe Schwefel liebender Bakterien ausnutzen. Überall sonst ist die Tiefsee nämlich außerordentlich arm an Nährstoffen. 6.000 Meter. So tief liegt gewöhnlich der Meeresboden des Pazifischen Ozeans. Oberhalb des Marianengraben ist aber auf dieser Ebene freier Ozean, belebt mit einer schweigenden, leuchtenden und bizarren Tierwelt in abenteuerlichsten und märchenhaftesten Gestalten. Hier schwebt eine zaghaft blinkende, fast immaterielle Wolke vorbei, ein riesiger Verband von Leuchtbakterien. Dort steht ein zartes Gespinst im Wasser, das wie eine ferne Stadt glitzert. So genannte Staatsquallen, Megaorganismen, zusammengesetzt aus einer riesigen Anzahl winziger und ganz verschiedener durchsichtiger Polypen, von denen jeder eine andere Aufgabe hat: manche durchkämmen das Wasser nach Nahrung, andere erledigen die Verdauung, beleuchten den ganzen Staat oder sorgen für den Nachwuchs. Leuchten im Dunkeln In der Tiefsee hat sich beinahe jede Tiergruppe ein Leuchtorgan zugelegt. Die Tiere halten sich Licht abgebende Bakterien, die sie nach Bedarf an- oder ausschalten können. Sie benutzen sie, um Beutetiere und Geschlechtspartner anzulocken. 5 11.000 Meter. So tief ist der Marianengraben, tiefer als der Mount Everest hoch. Jacques Piccard war der Pionier, der 1962 soweit hinunter tauchte. Das erste, was er entdeckte, war ein Plattfisch, etwa 30 Zentimeter lang, der die Tauchkugel mit seinen runden Augen wohl etwas verwundert anstarrte und dann gemächlich von dannen zog, womit Piccard schon gleich ein Indiz dafür hatte, dass es selbst dort noch Lebewesen gibt. © Bayerischer Rundfunk 2001