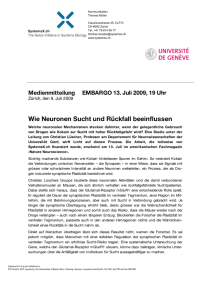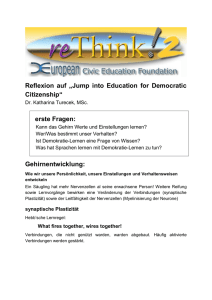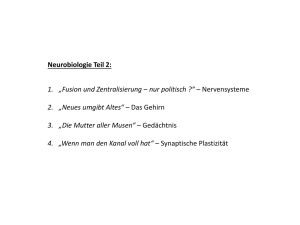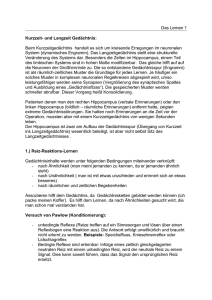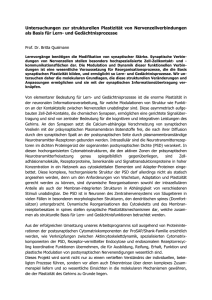Artikel im Textformat ()
Werbung
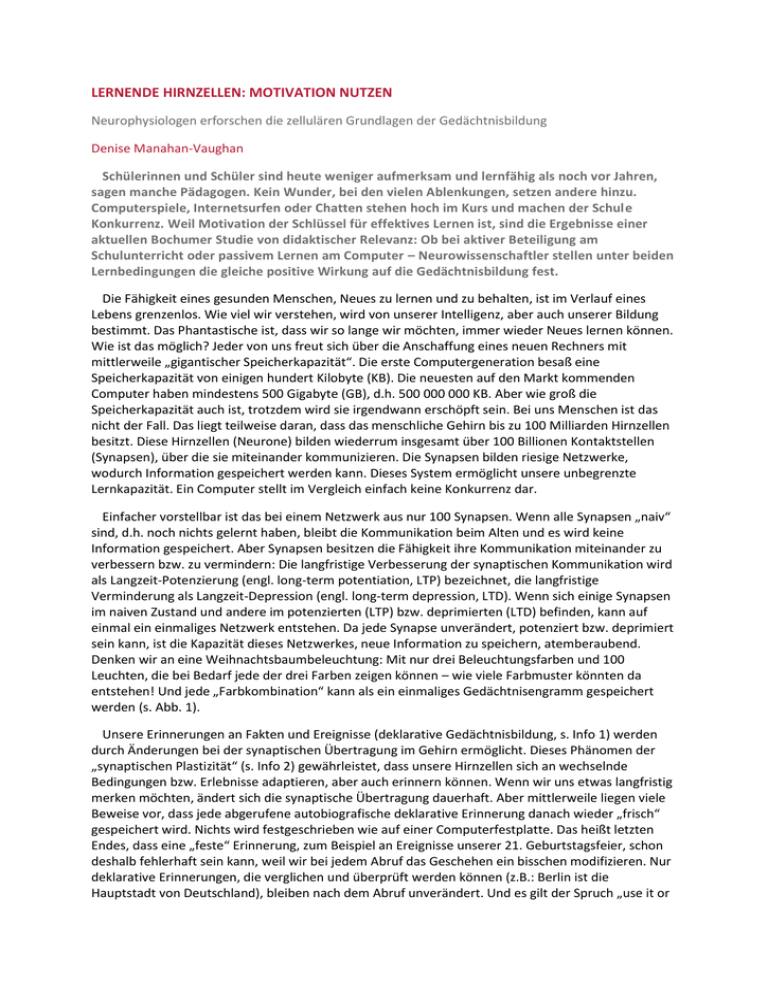
LERNENDE HIRNZELLEN: MOTIVATION NUTZEN Neurophysiologen erforschen die zellulären Grundlagen der Gedächtnisbildung Denise Manahan-Vaughan Schülerinnen und Schüler sind heute weniger aufmerksam und lernfähig als noch vor Jahren, sagen manche Pädagogen. Kein Wunder, bei den vielen Ablenkungen, setzen andere hinzu. Computerspiele, Internetsurfen oder Chatten stehen hoch im Kurs und machen der Schule Konkurrenz. Weil Motivation der Schlüssel für effektives Lernen ist, sind die Ergebnisse einer aktuellen Bochumer Studie von didaktischer Relevanz: Ob bei aktiver Beteiligung am Schulunterricht oder passivem Lernen am Computer – Neurowissenschaftler stellen unter beiden Lernbedingungen die gleiche positive Wirkung auf die Gedächtnisbildung fest. Die Fähigkeit eines gesunden Menschen, Neues zu lernen und zu behalten, ist im Verlauf eines Lebens grenzenlos. Wie viel wir verstehen, wird von unserer Intelligenz, aber auch unserer Bildung bestimmt. Das Phantastische ist, dass wir so lange wir möchten, immer wieder Neues lernen können. Wie ist das möglich? Jeder von uns freut sich über die Anschaffung eines neuen Rechners mit mittlerweile „gigantischer Speicherkapazität“. Die erste Computergeneration besaß eine Speicherkapazität von einigen hundert Kilobyte (KB). Die neuesten auf den Markt kommenden Computer haben mindestens 500 Gigabyte (GB), d.h. 500 000 000 KB. Aber wie groß die Speicherkapazität auch ist, trotzdem wird sie irgendwann erschöpft sein. Bei uns Menschen ist das nicht der Fall. Das liegt teilweise daran, dass das menschliche Gehirn bis zu 100 Milliarden Hirnzellen besitzt. Diese Hirnzellen (Neurone) bilden wiederrum insgesamt über 100 Billionen Kontaktstellen (Synapsen), über die sie miteinander kommunizieren. Die Synapsen bilden riesige Netzwerke, wodurch Information gespeichert werden kann. Dieses System ermöglicht unsere unbegrenzte Lernkapazität. Ein Computer stellt im Vergleich einfach keine Konkurrenz dar. Einfacher vorstellbar ist das bei einem Netzwerk aus nur 100 Synapsen. Wenn alle Synapsen „naiv“ sind, d.h. noch nichts gelernt haben, bleibt die Kommunikation beim Alten und es wird keine Information gespeichert. Aber Synapsen besitzen die Fähigkeit ihre Kommunikation miteinander zu verbessern bzw. zu vermindern: Die langfristige Verbesserung der synaptischen Kommunikation wird als Langzeit-Potenzierung (engl. long-term potentiation, LTP) bezeichnet, die langfristige Verminderung als Langzeit-Depression (engl. long-term depression, LTD). Wenn sich einige Synapsen im naiven Zustand und andere im potenzierten (LTP) bzw. deprimierten (LTD) befinden, kann auf einmal ein einmaliges Netzwerk entstehen. Da jede Synapse unverändert, potenziert bzw. deprimiert sein kann, ist die Kapazität dieses Netzwerkes, neue Information zu speichern, atemberaubend. Denken wir an eine Weihnachtsbaumbeleuchtung: Mit nur drei Beleuchtungsfarben und 100 Leuchten, die bei Bedarf jede der drei Farben zeigen können – wie viele Farbmuster könnten da entstehen! Und jede „Farbkombination“ kann als ein einmaliges Gedächtnisengramm gespeichert werden (s. Abb. 1). Unsere Erinnerungen an Fakten und Ereignisse (deklarative Gedächtnisbildung, s. Info 1) werden durch Änderungen bei der synaptischen Übertragung im Gehirn ermöglicht. Dieses Phänomen der „synaptischen Plastizität“ (s. Info 2) gewährleistet, dass unsere Hirnzellen sich an wechselnde Bedingungen bzw. Erlebnisse adaptieren, aber auch erinnern können. Wenn wir uns etwas langfristig merken möchten, ändert sich die synaptische Übertragung dauerhaft. Aber mittlerweile liegen viele Beweise vor, dass jede abgerufene autobiografische deklarative Erinnerung danach wieder „frisch“ gespeichert wird. Nichts wird festgeschrieben wie auf einer Computerfestplatte. Das heißt letzten Endes, dass eine „feste“ Erinnerung, zum Beispiel an Ereignisse unserer 21. Geburtstagsfeier, schon deshalb fehlerhaft sein kann, weil wir bei jedem Abruf das Geschehen ein bisschen modifizieren. Nur deklarative Erinnerungen, die verglichen und überprüft werden können (z.B.: Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland), bleiben nach dem Abruf unverändert. Und es gilt der Spruch „use it or lose it“: Erinnerungen und Gelerntes, das wir nicht regelmäßig abrufen, werden zunehmend lückenhaft und werden uns irgendwann verloren gehen. Der Schlüssel zum effektiven Lernen ist Motivation. Wenn wir uns langweilen, müde, gestresst oder gar apathisch sind, ist es viel schwieriger, Information zu behalten und zu lernen, als wenn wir wach, entspannt, interessiert und hochmotiviert sind (Abb. 2). Neuromodulatorische Botenstoffe wie z.B. Noradrenalin, Dopamin, Nikotin und Stresshormone nehmen starken Einfluss auf unsere Lernfähigkeiten. In einer Studie zur Auswirkung von Noradrenalin und Dopamin auf die synaptische Plastizität und auf die Kognition bei Nagern hat Neal Lemon während seiner Doktorarbeit in der Abteilung für Neurophysiologie der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität gezeigt, dass eine Hemmung der Rezeptoren für diese Botenstoffe sowohl die synaptische Plastizität als auch das deklarative Lernen hemmt. Im Gegensatz dazu stärkt eine Aktivierung des noradrenergen bzw. des dopaminergen Systems die synaptische Plastizität und damit das Lernen. Nager besitzen die Fähigkeit, Gedächtnisse von episodischer Qualität zu bilden: Sie erinnern, was sie bereits erlebt haben, wo sie etwas erlebt haben und wann sie es erlebt haben. Dieses „Was-Wo-Wann-Gedächtnis“ überprüfte Neal Lemon im Verhaltensversuch mit Nagern (Abb. 3a u. b): Sie lernten im Rhythmus von einer fünfminütigen Erkundungszeit und einer sich anschließenden Pause von etwa einer Stunde immer wieder neue Objekte kennen, die jeweils an ganz bestimmten Stellen innerhalb eines Raums platziert waren. Die Tiere zeigten das größte Interesse an einem der zuerst gesehenen Objekte, wenn sich dieses gegen Ende der Testreihe an einer anderen Stelle befand. Sie hatten sich gemerkt, was sie wann und wo gesehen hatten. Eine Stärkung des noradrenergen bzw. des dopaminergen Systems verbesserte diese Fähigkeit noch. Manche Erinnerungen möchten wir gar nicht behalten: Traumatische Erinnerungen von Unfällen, Katastrophen bzw. Kriegserlebnissen führen zu Stresssyndromen, die die Lebensqualität beinträchtigen. Eine gezielte Manipulation der noradrenergen Rezeptoren lässt sich daher als Behandlungsstrategie des Posttraumatischen Stresssyndroms nutzen. Neal Lemons Daten zeigen, wie vielversprechend diese Therapien sind. Wenn wir lernen, benutzen wir unsere Sinnessysteme und unsere Vorerfahrung, um Gedächtnisse zu bilden. Wenn wir unsere Augen schließen und zurückdenken an den Heiligabend im vergangenen Jahr, dann sehen wir vielleicht den geschmückten Weihnachtsbaum, riechen den Geruch des Festessens oder können sogar die Melodie der Weihnachtsmusik abrufen oder das Gefühl, auf der harten Kirchenbank zu sitzen. Was wir gesehen, gerochen, gehört und gespürt haben, trägt zu dieser Erinnerung bei. Diese Sinnesinformation wurde zur Hauptgedächtnisstruktur des Gehirns, dem Hippocampus (s. Info 3), transportiert. Durch synaptische Plastizität wurde ein Gedächtnisengramm gebildet, dessen Inhalt nicht nur unsere Sinneserlebnisse prägt, sondern auch unsere Gefühle und Erwartungen. Bei den traditionellen Unterrichtsstrukturen sitzen Schüler und Schülerinnen gemeinsam in einem Klassenraum und schauen der Lehrerin oder dem Lehrer zu, wenn diese etwas erzählen. Man schaut und hört zu, oft schreibt (und redet) man mit. Nach der Schule gibt es noch Hausaufgaben. Erfahrene Lehrer und Lehrerinnen berichten heute oft, dass nach ihrem Empfinden sowohl die Aufmerksamkeitsspanne als auch das Lernvermögen der Schüler nachgelassen hat im Vergleich zu früheren Generationen. Der Nobelpreisträger Eric Kandel hat bei Nagern und anderen Spezies gezeigt, dass eine regelmäßige Wiederholung frisch (und vorher) gelernter Informationen zu einer bleibenden Erinnerung führt. Also, was läuft heutzutage schief? Obwohl es Fernsehen auch „früher“ schon gab, leben die heutigen Generationen doch zunehmend in einer digitalen Welt. Direkt nach der Schule wird nicht nur ferngesehen – Computerspiele, Internetsurfen oder Chatten kommen noch hinzu (Abb. 4). Möglicherweise konkurrieren diese Erfahrungen mit dem, was am Morgen in der Schule gelernt und dargeboten wurde. Schließlich werden hierfür dieselben Sinnesbahnen benutzt. Pädagogen werden argumentieren, dass eine aktive Beteiligung am Schulunterricht effektiver sein sollte als das passive Lernen vor einem Computer. Um das zu überprüfen, haben wir kürzlich eine Studie durchgeführt: Dabei wurden das Lernvermögen und die synaptische Plastizität bei Nagern verglichen unter Bedingungen des aktiven Lernens in anregenden Umgebungen (enriched environments) und des passiven Lernens vor einem Computerbildschirm. Die Doktorandin Anne Kemp beobachtete eine langanhaltende Änderung der synaptischen Plastizität unter beiden Lernbedingungen (Abb. 5a). Die Nager konnten genauso gut lernen und erinnern, wenn sie die Erinnerungen durch aktives bzw. passives Lernen gebildet hatten. Anne Kemp fand im Hippocampus eine Veränderung (LTD) in der Kommunikation der Nervenzellen, wenn sie Ratten neue Umgebungen auf dem Monitor präsentierte und konnte damit zum ersten Mal nachweisen, dass eine aktive Erkundung der Umgebung für diesen Effekt nicht erforderlich ist (Abb. 5b). Dieser Befund regt zumindest zu Überlegungen an, die digitalen Medien stärker in den Schulunterricht einzubeziehen; entsprechende didaktische Materialien zu entwickeln. In den meisten Schulen Deutschlands hat sich Projektarbeit mit Hilfe von digitalen Informationsquellen wie z.B. Wikipedia etabliert. Andere Länder sind bereits ein Stück weiter. Sie nutzen elektronische Schultafeln (über die sich Hausaufgaben täglich direkt an die Eltern schicken lassen) und statten ihre Schüler mit iPads aus. Die Devise lautet: „If you can’t beat them, join them“. Langzeitstudien sollen nun belegen, wie effektiv diese Strategien sind. Trotz alldem bleibt regelmäßige Bewegung ein wesentlicher Faktor, um das Gehirn gesund zu halten. Wenn wir uns aktiv bewegen, können sich sogar neue Neurone bilden, die unsere Gehirne belastungsfähiger machen können. Aber Sport allein reicht offenbar als Maßnahme nicht aus, um die Gehirnzellproduktion anzuregen. Hirnforscher am Salk Institut in den USA haben gezeigt, dass „neugeborene“ Hirnzellen länger bestehen bleiben, wenn Lernen stattgefunden hat. Daher ist es besonders problematisch, wenn Kleinkinder und ältere Menschen unter relativ reizarmen Bedingungen leben. Betroffen sind jene Kleinkinder, die häufig nur den Fernseher als Unterhaltungsund Bildungsquelle haben, und manche ältere Menschen in Pflegeheimen. Tanja Novkovic und Arne Buschler haben in ihren Doktorarbeiten am Beispiel von Nagern untersucht, welche Auswirkung ein „bereichertes Leben“ haben kann (s. S. 52). Sie konnten zeigen, dass sowohl die synaptische Plastizität als auch das Lernen besser werden, wenn die Nager täglich eine neue Umgebung erforschen konnten oder wenn ihnen Spielzeug zur Verfügung stand. Die Auswirkungen waren noch stärker, wenn die Tiere in Gesellschaft lebten, d.h. spielen und erkunden „unter Freunden“ ist effektiver. Diese und andere Befunde tragen zur kognitiven Pufferhypothese (bzw. kognitiven Reservehypothese) bei. Nachweislich sind Menschen, die sich ein Leben lang intellektuell bzw. geistig fit halten, zu einer höheren kognitiven und kortikalen Plastizität fähig. Geistig inaktive Menschen zeigten die verheerenden kognitiven Verluste, die die Alzheimersche Krankheit charakterisieren, mehrere Jahre früher als geistig aktive Personen (Info 4). Sich geistig fit halten, kann vermutlich nicht verhindern, an Demenz zu erkranken, wenn dies unser Schicksal ist. Durch eine erworbene höhere Flexibilität des Gehirns wird es aber mehr aushalten können, bevor sich die Krankheitssymptome manifestieren. Konkret bedeutet dies, Jahre an „aktiver“ Lebenszeit zu gewinnen. „Use it or lose it.“ – Dies ist letztlich die Entscheidung. Prof. Dr. phil. habil. Denise Manahan-Vaughan, Abteilung für Neurophysiologie, Medizinische Fakultät info 1 GEDÄCHTNISFORMEN: BEWUSSTES ODER UNBEWUSSTES ABRUFEN Das Gedächtnis als Phänomen stellt keine Einheit dar, es bildet zwei Formen aus: deklaratives und nicht-deklaratives Gedächtnis. Das deklarative (explizite) Gedächtnis umfasst alle Erinnerungen, die wir bewusst abrufen. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Kategorien, die semantischen und die episodischen Erinnerungen. Semantische Erinnerungen beschäftigen sich mit Fakten und Tatsachen, während episodische Erinnerungen auf die Autobiografie unseres Lebens gerichtet sind. Nichtdeklarative (implizite) Gedächtnisinhalte werden nicht bewusst abgerufen, nachdem wir sie gelernt haben. Dazu gehören Fähigkeiten wie Fahrradfahren, Klavierspielen oder ganz einfache Reflexe. info 2 SYNAPTISCHE PLASTIZITÄT Der Hippocampus ist für die Bildung deklarativer Gedächtnisinhalte zuständig. Damit die Information in den Hippocampus gelangen und dort gespeichert werden kann, ändert sich die Fähigkeit von Synapsen, neuronale Informationen weiterzuleiten (synaptische Plastizität). Synapsen sind die Kommunikationsstellen zwischen den Hirnzellen (Neurone). An der Synapse berühren sich die Neurone nicht. Ein Signal wird durch Botenstoffe von einem Neuron zum anderen weitergeleitet. Botenstoffe binden an Rezeptoren und ermöglichen so die Weiterleitung des Signals. Die synaptische Übertragung kann sich dauerhaft verbessern (Langzeitpotenzierung, LTP) oder dauerhaft vermindern (Langzeitdepression, LTD) – ein Phänomen, das „synaptische Plastizität“ genannt wird. LTP und LTD stellen die zellulären Grundlagen der Gedächtnisbildung dar. Um Information zu speichern, bilden sich synaptische Populationen in Netzwerken. info 3 DER HIPPOCAMPUS War ich schon hier? Befinde ich mich in einer bekannten Umgebung oder ist alles neu für mich und muss erforscht werden? In Bruchteilen von Sekunden „weiß“ unser Gehirn, ob zum Beispiel ein Ort bekannt ist oder nicht. Ist er es nicht, prägen wir uns bewusst eine räumliche Konstellation ein, etwa anhand markanter Punkte wie Restaurants, Einkaufsläden oder einem Park. Für diese Informationen entsteht quasi ein neues Gedächtnis im Gehirn – auch episodisches oder autobiographisches Gedächtnis genannt. Zuständig für die Einprägung dieses „bewussten“ (sog. deklarativen) Gedächtnisses ist die als Hippocampus bekannte Region des Gehirns, die ein Teil des sog. Medialtemporallappens ist. Patienten, denen diese Hirnlappen operativ entfernt wurden, können sich zum Beispiel überhaupt keine neuen Fakten oder Erfahrungen merken. Der Hippocampus ist unser wichtigstes Lernorgan. Ohne ihn können wir keine langanhaltenden deklarativen Erinnerungen bilden. Er ist auch die Struktur, die am schwersten betroffen ist bei gedächtnisschädigenden neurodegenerativen Erkrankungen wie z.B. bei der Alzheimerschen Krankheit und bei Demenz. Seinen Namen hat er wegen seiner einem Seepferdchen (lateinisch Hippocampus) ähnlichen Form erhalten. info 4 ALZHEIMERSCHE KRANKHEIT Die Alzheimersche Krankheit ist eine progressive neurodegenerative Erkrankung, die vor allem den Hippocampus betrifft. Zwei Hauptveränderungen des Gehirns werden heute als Ursachen der Krankheit diskutiert: fibrilläre Ablagerungen (neurofibrillary tangles) eines Proteins (Tau), die sich außerhalb der Hirnzellen anlagern, und die Ansammlung des Peptides -Amyloid als Plaquebildung innerhalb der Hirnzellen. Beide Veränderungen sind Merkmale der Krankheit, die typischerweise mit ausgeprägten Demenzsymptomen verbunden ist. Hier entstehen nicht nur große Gedächtnislücken, sondern neue Erinnerungen können nicht langfristig behalten werden. Interessanterweise haben sowohl die Doktorandin Honghong Yang der Abteilung Neurophysiologie der Ruhr-Universität als auch andere internationale Forscher nachgewiesen, dass -Amyloid zu einer starken Beeinträchtigung der synaptischen Plastizität im Hippocampus führt. info 5 WIE AUS WAHRNEHMUNG GEDÄCHTNIS WIRD Wie aus Wahrnehmung Gedächtnis und Verhalten entstehen, erforscht der SFB 874 „Integration und Repräsentation sensorischer Prozesse“ (Sprecherin: Prof. Dr. Denise Manahan-Vaughan). Sechs allgemeine Systeme spielen bei Wirbeltieren eine Rolle: Gehör, Gleichgewicht, Geruch, Geschmack, Körperwahrnehmung und Schmerz sowie Sehen. Im letzten Jahrhundert sind die Grundlagen von Sinneswahrnehmungen erkannt worden, unklar ist aber, wie die sensorischen Signale im Gehirn integriert und repräsentiert werden. Der neue SFB will über eine systemorientierte neurowissenschaftliche Strategie wesentliche Aspekte der sensorischen Verarbeitung erforschen. Am Beispiel von Geruch, Somatosensorik und Sehen wollen die Wissenschaftler die Verarbeitung der Signale von der Ebene der kortikalen Integration bis hin zum endgültigen Erwerb eines auf Sinneswahrnehmung basierenden Gedächtnis-„Eintrags“ (Engramm) aufklären.