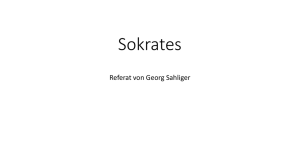Die Platonische Logik der Harmonie. Versuch der Rekonstruktion
Werbung

Markus Arnold, Wien Die Platonische Logik der Harmonie: Versuch der Rekonstruktion eines initiatorischen Handelns* "Es soll also gesagt werden, und sollte es mich auch mit Schmach und Gelächter ordentlich wie eine aufsprudelnde Welle überschütten .... Wenn nicht ... entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die jetzt so genannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren und also dieses beides zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie, ... eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten ... und ich denke auch nicht für das menschliche Geschlecht."1 Platon ahnte es. Schon sein Schüler Aristoteles ließ ihn im Gelächter der Nachwelt allein, indem er als Philosoph für alle Zeiten den politischen HerrschaftsansprüchenderPhilosophenentsagte. 2 Und es scheint damit bis heute alles, was dazu zu sagen bleibt, gesagt. Irritiert ist man - vielleicht - allein von der Selbstverständlichkeit mit der Platon, der selbsternannte Anwärter auf die Herrschaft, die Lächerlichkeit und Weltfremdheit der Philosophen nicht nur beschreibt, sondern im Grunde sogar feiert. Stolz bekennt er sich zu Thales' tiefem Sturz in den Brunnen, erklärt, ein Philosoph wisse nichts von den Gesetzen seiner Heimatstadt, über seinen nächsten Nachbarn oder wo sich das Gericht und das Ratshaus befinde, und gerade dies würde ihn als Philosophen auszeichnen. 3 Was anderes als den Hohn oder bestenfalls die entschuldigende Nachsicht der Nachwelt kann Platons politische Theorie erwarten? Daß man sich trotz allem noch gerne auf das Staunen (thaumazein), das dialogisch-dialektische Denken und auf Platons Kampf gegen die verschiedensten "Sophismen" beruft, wenn es darum geht, zu bestimmen, was Philosophieren ist, wird nicht als Widerspruch empfunden. Er ist mit seiner "Ideenlehre" ein so oft betrachteter und kommentierter Teil unserer Tradition, daß selten genug - außerhalb des Kreises der vielesverzeihenden Philologen - statt wis• Diese Arbeit verdankt ihr Entstehen der Unterstützung eines zweijährigen Forschungsstipendiums des Österreichischen "Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung" zum Thema: "Logik, und kategoriale Erfassung der realen Welt". 1 Politeia 473c - d; zit. nach: Plato, "Werke" (in 8 Bänden), Hrsg. v. Gunther Eigler; Darmstadt 1990. 2 R647, nach Aristoteles, Fragmenta, ed. V. Rose, Lipsiae 1886: "Philosophie zu treiben ist für einen König nicht nur nicht notwendig, sondern sogar hinderlich; dagegen soll er auf wirkliche Philosophen hören und ihnen folgen." (Wilhelm Nestle, Aristoteles Hauptwerke, Stuttgart 1977, S.76) 3 Theaitetos 173c - 174b. 46 47 sendem Hohn, staunendes Befremden über das für uns Befremdliche aufkommt. Ziel ist es, wenn auch nur in einigen Aspekten, so doch, die gravierenden Unterschiede in der Konzeption und Funktion der Philosophie - und damit der Logik - aufzuzeigen, die Platon von uns, aber auch schon von Aristoteles trennen. Im ersten Teil werden dazu die meiner Meinung nach zuwenig beachteten Beziehungen zur griechischen Religiosität behandelt, um ein erstes "Befremden" zu ermöglichen; im zweiten will ich versuchen, Platons religiöse Konnotationen dem Verdacht des der Philosophie bloß Äußerlichen zu entziehen, indem sie in dessen Verständnis von Sprache und Denken begründet werden. Abgeschlossen werden diese Überlegungen - drittens - durch den Versuch das platonische Grundparadigma herauszuarbeiten, das vermittels der Logik der Ideen sowohl die philosophische Theorie, als auch deren psychagogische Praxis leitet: die Harmonien der kultisch-getanzten Musik. I. Die Götter Platons Beschreibung der Tätigkeit des Philosophen mit der einer Hebamme ist bekannt4 ; weniger bekannt scheint die Tätigkeit einer antiken Hebamme. Denn sie auf praktisch-medizinische Hilfeleistungen im modernen Sinne zu reduzieren, verdunkelt wohl eher die Seite bei der Geburt, die - neben dem eigentlichen Gebären - den Vergleich mit dem Wahrheit "gebärenden" philosophischen Gespräch für Platon so verlockend machte. So waren in der Welt des Altertums neben volkstümlichem Brauchtum auch Gebete und Zauber in dieser kritischen Situation selbstverständlich: "Vor, bei u[nd) nach der G[eburt) werden an Mutter u[nd) Kind vielerlei Riten vollzogen. Mehr als zu anderen Zeiten des Lebens sind Mutter u[nd) Kind von bösen Dämonen u[nd) anderen Gefahren bedroht, die es zu erkennen u[nd) durch Gebet, Opfer, Magie u[nd) schlaue Praktiken abzuwehren gilt."s Der Geburtsakt steht in besonderer Beziehung - im Positiven wie im Negativen - mit dem Transzendenten, denn er selbst ist Zeichen göttlichen Willens, da nur durch die Gnade der Götter diese erfolgreich beendet werden kann, während ein Scheitern auf deren Zorn schließen ließe. 6 Sowohl die Gebärende und das Geborene, aber auch alle bei der Geburt Anwesenden, sind von der normalen menschlichen Gesellschaft abgesondert; denn das Haus, in dem eine Geburt stattfindet, ist unrein, so auch jeder der dieses Haus betritt! Zentrum dieser Unreinheit ist die Wöchnerin, sodaß, da alles, was mit dieser während der Schwangerschaft nur in Berührung kommt, unrein wird - ihre Kleider und andere Dinge, wie Gürtel und Haarbinden - einer Gottheit geopfert werden muß.? Diese Ausgrenzung des unreinen, da animalischen, Gebä4 Theaitetos 148e - 151 d. 5 G. Binder: "Geburt 11", in: Reallexikon f. Ant. u. Christ., Hrsg. Theodor Klauser, Stuttgart 1976; Bd. IX. Sp. 45. 6 G. Binder: a.a.O.; Sp. 92. 7 "Einige Epigramme sprechen davon, daß Haare und Kleidungsstücke der Wöchnerinnen ver- rens wird auch darin manifest, daß die Geburt symbolisch außerhalb der städtischen Gemeinschaft stattfindet; die Mutter und vor allem das Kind müssen nachher erst (wieder) aufgenommen werden. 8 Auf den Ritus, der zur kultischen Reinigung des fünftägigen, noch namenlosen Kindes vollführt wird, um es in die Familie aufzunehmen, spielt Platon sogar an, wenn er sagt: "Nach der Geburt aber müssen wir nun das wahre Umtragen im Kreise damit [d.h. mit der neugewonnenen Definition) vornehmen, indem wir durch weitere Untersuchung erforschen, ob nicht das Geborene, vielleicht ohne daß wir es wußten, nicht wert ist, auferzogen zu werden, sondern ein leeres Windel."g Bei diesem kultischen Fest, dem Amphidromia, wurde das Kind entweder "auf den Armen des'Vaters oder einer Amme, im Laufschritt um das Herdfeuer des Hauses getragen", wobei der Träger bzw. die Trägerin nackt zu sein hatte. Durch den gesamten Ritus, den Platon als eine Art Prüfung für das Neugeborene beschreibt, wurde zugleich auch die "Reinigung" des ganzen Hauses endgültig erreicht. (Nicht aber die der Mutter, die weitere 40 Tage "unrein" blieb und zu deren Reinigungsriten Hundeopfer an Geburtsgottheiten gehörten!) Erst einige Tage später bekam das Kind bei einem weiteren Fest mit Gebet und Opfer einen Namen. Doch damit war die rituelle Integration in die Gesellschaft noch nicht beendet, denn erst später, beim Fest der Aputuria, wird es auch Mitglied der Phratrie, indem es unter den Schutz der Stammesgötter gestellt wird. 1O schiedenen Göttern, vor allem der Arfemis, geweiht wurden." M. P. Nilsson, "Geschichte der Griechischen Religion", (2. Aufl.) München 1955; S. 137 - 138 (Hervorh. d. Verf.). 8 "Außerdem verleiht die Niederkunft der gesellschaftlichen Institution der Ehe gleichsam ein Moment der Animalität - erstens weil das eheliche Paar, dessen Vereinigung auf einem Vertrag beruht, durch Fortpflanzung einen Sprößling hervorbringt, der einem kleinen Tier gleicht, das noch völlig außerhalb jeder kulturellen Regel steht; zweitens, weil das Band, welches das Kind mit der Mutter vereint, ein ,natürliches' und kein gesellschaftliches ist, wie dasjenige, das es an den Vater bindet; drittens, weil durch die Zeugung eines menschlichen Sprößlings nach Art der Tiere die von Schreien, Schmerzen und einem dem Rausch verwandten Zustand begleitete Niederkunft in den Augen der Griechen die wilde und animalische Seite der Weiblichkeit genau in dem Augenblick zum Ausdruck bringt, da die Ehegattin, die der Polis - die sie dadurch reproduzierteinen künftigen Bürger schenkt, am besten in die Welt der Kultur integriert zu sein scheint." Jean-Pierre Vernant, "Tod in den Augen: Figuren des Anderen im griechischen Altertum: Artemis und Gorgo", Frankfurt a.M. 1988; S. 16. 9 Theaitetos 160e. 10 Zum Rituellen bei der Geburt, s. G. Binder: "Geburt 11", in: RE Bd. IX. Sp. 85 - 89. Unabhängig davon besitzt jeder Mensch seit seiner Geburt einen guten Geist (daimon), der bei der Geburt schon die bösen Geister vertreiben sollte, bis zum Tode bei ihm bleibt und auch Mittler zwischen dem Menschen und den Göttern sein kann (ibid. Sp. 82). Platon scheint diesen persönlichen daimon des griechischen Glaubens mit dem philosophischen daimon des Sokrates zu identifizieren, wenn er ihn sagen läßt: "Denn man sagt ja, daß jeden Gestorbenen sein Dämon [daimonj, der ihn schon lebend zu besorgen hatte, dieser ihn auch dann an einen Ort zu führen sucht, von wo aus mehrere zusammen, nachdem sie gerichtet sind, in die Unterwelt gehen mit jenem Führer, dem es aufgetragen ist, die von hier dorthin zu führen." (Phaidon 107d), wobei er aber im "Timaios" letztlich die menschliche Vernunft mit diesem identifiziert, da "nämlich Gott sie jedem als einen Schutzgeist [daimon] verliehen hat; von ihr behaupten wir, daß sie im obersten Teil unseres Körpers wohnt und uns von der Erde zu unserer Verwandtschaft im Himmel erhebt, da wir kein irdisches, sondern ein himmlisches Gewächs sind" (90a). 49 48 Versteht man so, daß für einen Menschen der damaligen Zeit Gebären nur in einem solchen religiös-rituellen Zusammenhang gedacht werden konnte, bekommen manche Sätze Platons eine ganz andere Gewichtigkeit; etwa der Hinweis auf Artemis als derjenigen, die den Hebammen (bzw. Philosophen), den des Alters wegen Unfruchtbaren, ihre Gabe verliehen hat. Eine Gabe, die nicht mehr einfach als bloße handwerkliche Technik gesehen werden kann, sondern wohl vor allem auf göttlicher Inspiration fußend. In Platons Worten: "die Geburtshilfe indes leisten dabei der Gott und ich"; oder wenn er - sich gegen die üble Nachrede und die Unterstellungen seiner männlichen "Wöchnerinnen" verteidigend - beklagt, daß diese "weit entfernt sind einzusehen, daß kein Gott jemals den Menschen mißgünstig ist, und daß auch ich nichts dergleichen aus Übelwollen tue".11 Diese Verteidigungsstrategie bekommt nur dann Sinn, wenn man davon ausgeht, daß die Handlungen eines Philosophen nicht bloß menschlich sind. Jeder Angriff auf ihn somit auch, wenn nicht sogar vorwiegend, einen Angriff auf die Geburtsgöttin Artemis impliziert. Doch wäre zu untersuchen, ob dies die einzige Stelle bei Platon ist, wo er sich auf die Artemis beruft. Wenn z.B. im "Symposion" eine Priesterin, Diotima, von Sokrates als seine Lehrerin in Liebessachen - und damit der Philosophie - benannt wird, ohne zu sagen, welcher Gottheit sie geweiht war, dann sollte man wohl nach Hinweisen suchen, die einem gebildeten Zeitgenossen Platons genügt hätten, dies aus dem Kontext zu entschlüsseln. Es ist heute die opinio communis unter Philologen, daß mit der platonischen "Diotima" keine historische Person gemeint ist, damit wird aber jede noch so beiläufig gemachte Bemerkung zu einer von Platon literarisch bewußt gewählten Kennzeichnung. Zwei davon gibt er uns in Sokrates Lobrede auf den Eros 12 : erstens sie soll Mantineerin sein und zweitens die Athener durch ein Opfer zehn Jahre vor der Pest bewahrt haben. Um letzteres tun zu können, muß sie wohl eine Priesterin sein, die mit Hilfe eines Göttlichen Einfluß auf Krankheiten haben kann. Daß ApolIon über die Pest gebietet, war schon durch die lIias 13 allgemein bezeugt; daß ebenso die Artemis Krankheit und Tod schicken oder zurückhalten kann, wird von den Philologen versichert 14 . Doch allein auf diesen Informationen aufbauend die Diotima beiden oder einem der zwei als Priesterin zuzuordnen, hätte zwar einige Wahrscheinlichkeit für sich, bliebe aber als Isoliertes, d.h. ohne Berücksichtigung der anderen Charakterisierung, zweifelhaft. Obwohl ein Zeitgenosse Platons durchaus solche Assoziationen gehabt haben dürfte, da die antike Tradition gerade Sokrates einen Päan (Lobgesang) zugeschrieben hatte, der sich ApolIon und Artemis, "den hehren Geschwistern", widmet. 15 "Mantinea" jedoch, verstanden 11 12 13 14 Theai1etos 149b - 151 c. Symposion 201d. llias, 1.8 - 56; K. Wernicke: ,,ApolIon", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 17. K. Wernicke: ,,Artemis", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 1351. Th. Schreiber: "Artemis", in: Lex. d. Griech. u. Röm. Mythologie, Hrsg. W. H. Roscher, Leipzig 1884 - 1886, Bd. I. Sp. 584. 15 Diogenes Laertius 11.42. nicht bloß als Geburtsort, sondern vor allem als Ort der normalen "Arbeitsstätte", könnte unserem Zeitgenossen Platons mehr sagen. Denn es gab ein Heiligtum das alle Kennzeichen geradezu ideal erfüllte. Es liegt in Mantinea, ist sowohl mit ApolIon als auch mit Artemis verbunden und - noch mehr - es hat mit Krankheit und Gesundheit zu tun. Es ist das Heiligtum, das Pausanias als erstes in Mantinea beschreibt: der Doppeltempel des Asklepios, Gott der Medizin, und der Leto und ihrer Kinder, des ApolIon und der Artemis!16 Über die konkrete kultische Praxis in diesem Heiligtum ist uns nichts überliefert. So kann nicht mehr gesagt werden, ob neben der Tatsache der "richtigen" Götter noch andere Motive vorlagen, warum Platon sich gerade eine Priesterin dieses (Doppel-)Tempels vorgestellt haben könnte, wenn er behauptete: sie sei in den Dingen des Eros "und auch sonst sehr weise", und sie sogar zu Sokrates' Lehrerin erhebtY Schon Asklepios, der Heilgott, ist mythologisch nicht mit Leto, sondern mit ApolIon und Artemis verbunden. Denn ApolIon ist sein Vater und Artemis Mörderin seiner Mutter. Wobei die Initiative der Tat von Apollon ausging. Hatte doch die sterbliche Frau schwer gefrevelt, als sie den Wunsch hatte, trotz der Vereinigung mit dem Gotte, einen Sterblichen zu heiraten. Kranke wurden in den Tempeln des Asklepios geheilt, indem der Heros vermittels der Träume den im Tempel schlafenden Hilfesuchenden ,,zeichen" gab, die dann von den Priestern zu religiös-medizinischen Behandlungen verwendet wurden. 18 Leto, die (nominale) Hauptgöttin des Tempels, fristet hingegen schon im Volksglauben das Schicksal einer von ihren Kindern an Bedeutung überflügelten Göttin. Geschichtlich ist sie vermutlich überhaupt nur eine Hypostase der Artemis, sodaß es häufig zu einer "Vereinigung von Leto und A[rtemis) im Kult" gekommen ist. 19 Die große Rolle des Apollon für das platonische Philosophieren ist bekannt und war immer offensichtlich, allein schon durch die Berufung auf das delphische Orakel in der Apologie 20 , das immer wieder erneut aufgegriffene delphische "Erkenne dich selbst" (gnothi seautonJ21 und direkter noch durch die Überantwortung aller religiös-kultischer Angelegenheiten des Idealstaates an den auf dem "Nabel", d.h. dem Mittelpunkt der Erde, thronenden ApolIon in Delphi. So ist vor allem zu fragen, was die Göttin Artemis neben ihrem Bruder 16 Pausanias V1I1.9; zu ApolIon und Asklepios s. K. Wernicke: "ApolIon", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp.40. 17 Symposion 201d; so könnte im Tempel etwa den von Platon geforderten kultischen Regeln entsprechend gehandelt worden sein (s. Nomoi 800b - 801 a), z.B. keine Gesangswettkämpfe beim Opfer. Doch erklärt dies noch nicht die Beziehung zur dargelegten "Eros"-Lehre, wegen der Sokrates bewußt diese Frau aufgesucht hat: ,,[ ... ] eben deshalb, sprach ich, bin ich ja zu dir gekommen, 0 Diotima, [... ]" (Symposion 207c). Siehe dazu aber auch unten Anm. 91. 18 Thomas Schnalke: "Heilgott ASklepios - Zur religiösen Medizin in der Antike", in: Kunst des Heilens. Aus der Geschichte der Medizin und der Pharmazie; (Kat.) Wien 1991, S. 206 - 212; zur Rolle von Träumen bei der platonischen Wahrheitssuche, siehe z.B.: Phaidon 60e - 61b, Theaitetos 201 e - 202c. 19 Th. Schreiber: "Artemis", in: LGRM Bd. I. Sp. 577. 20 Apologie 20e - 21 a. 21 Z.B. Phaidros 22ge; Protagoras 343a; Charmides 164d: Philebos 48c - 49a. 50 51 für Besonderheiten hat, die für das Verständnis des platonischen Konzepts eines (Hebammen-)Philosophen bedeutsam wären. Mit dem Religionsgeschichtler Jean-Pierre Vernant läßt sich feststellen: "Artemis ist die Kurotrophos schlechthin. Sie nimmt sich aller Sprößlinge an, jener der Tiere und der Menschen, gleichgültig, ob männlich oder weiblich. Ihre Funktion besteht darin, sie zu ernähren, sie zum Wachsen und Reifen zu bringen, bis sie vollständig erwachsen sind. Die Menschenkinder führt sie bis an die Schwelle der Adoloszenz, die sie, [ ... ], mit Zustimmung und Hilfe der Artemis überwinden müssen, um über die von ihr geleiteten Initiationsriten die volle Gesellschaftsfähigkeit (socialite) zu erlangen - das junge Mädchen tritt in den Stand der Gattin und Mutter ein, der Jüngling in den des Bürger-Soldaten." Ihr Ort sind die "Ränder, Grenzzonen, Übergangsbereiche, [ ... ], wo Wildes und Kultiviertes einander berühren, sich zwar gegenüberstehen, sich aber auch gegenseitig durchdringen." Von dort aus "sichert Artemis dem Jugendlichen, indem sie ihre Bildung in die Hand nimmt, die Integration in die Gemeinschaft der Bürger." Sie überwacht "diesen Sprung, mit dem die Jugendlichen ihre Jugend beschließen, um Erwachsene zu werden, ohne daß dadurch Jugend und Erwachsenenzustand in ihrem Status vermischt und ihre Grenzen beseitigt würden".22 So zeigt sich die Artemis als die ewige VermittJerinzwischen reiner Animalität und Kultur, die auf diese Weise die Göttin der Jagd und die des Weges wird, die den Wanderer sicher leitet. Aber sie ist auch die Wächterin, die die Grenzen sichert und den Ein- und Ausgang hütet, wie etwa beim delphischen Heiligtum. 23 Sie achtet darauf, daß man sowohl im Krieg als auch auf der Jagd nicht "durch übermäßige Gewaltanwendung den zivilisierten Rahmen verläßt, [ ... ], und in brutaler Weise ins ungezügelt Wilde umschlägt".24 So hat in diesem Sinne Platons Etymologisierung der Artemis als "Kennerin der Tugend" ihre volle Berechtigung. 25 Aber wovon spricht die mantineische Priesterin Diotima? Von Eros. Dieser, selbst kein Gott, soll zwischen Menschen und Göttern, zwischen Torheit und Weisheit als auch zwischen dem Häßlichen und dem Schönen das Mittlere sein; unter anderem "ein gewaltiger Jäger, [ ... ], nach Einsicht strebend, sinnreich, sein ganzes Leben lang philosophierend, ... ". Als Sohn des Weges (porosP ist Eros gerade das personifizierte Streben, sich von seiner Mutter, der Armut, zu lösen, um das göttliche Schöne, die 22 Vernant (1988), S. 11 - 15 (Hervorh. d. Verf.). 23 Th. Schreiber: ,,Artemis", in: LGRM Bd. I. Sp. 572; K. Wernicke: ,,Artemis", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 1350; So "bewacht sie mit ihrer Meute auch das delphische Heiligtum" (ibid. Sp. 1350); und "auf Teilnahme am delphischen Orakel scheint zu deuten, dass nach Paus. X 12,2 die delphische Sibylle Herophile sich [... ] bald dessen [ApolIons] ScHwester oder auch Tochter nannte; so heisst A[rtemis] bei elem. Alex. Strom. I 323 [... ] geradezu sibilla delphis. Der Dreifuss (Zeichen des Orakels) kommt auf Silbermünzen von Knidos als Revers des A[rtemis]-Kopfes vor" (ibid. Sp. 1354). "Im Giebel des Apollontempels zu Delphi sah man ApolIon mit Mutter und Schwester von den neun Musen umgeben" (Th. Schreiber: "Artemis", in: LGRM. Bd. I. Sp. 577); Platon selbst sieht in den "Nomoi" ein "Heiligtum des ApolIon und der Artemis" (833b) vor. 24 Vernant (1988), S. 16 -17. 25 Kratylos 406b. 26 Symposion 203c - 204b; er ist auch "unbeschuht, ohne Behausung, auf dem Boden immer herumliegend und unbedeckt schläft er vor den Türen auf den Straßen im Freien"(ibid.; Hervorh. v. verf.). Weisheit, zu erlangen. Immer nur vorübergehende Befriedigung erreichend, ewiger Wanderer auf einer nie endenwollenden Jagd, ist der Eros von Geburt an dem Herrschaftsbereich der Artemis zugeordnet, auf deren Schutz und Führung er (implizit) angewiesen bleibt - wie jeder andere Philosoph! Und das heißt, wie jeder Mensch, da es keinen nicht vom Eros erfaßten Menschen geben kann 27 , denn schon die Tiere verleihen mit ihrer niederen, d.h. unphilosophischen, Seinsweise dem sich nach göttlicher Unsterblichkeit sehnenden Eros Ausdruck: durch ständiges Gebären neuer Nachkommen, die etwas vom eigenen Leben weitertragen sollen, wenn man selbst schon der Verwesung preisgegeben ist. Diese Verbindung des Animalischen, in dem der daimonische Eros zuerst sich zeigt, mit dem Göttlichen, das er eigentlich immer schon wollte, wird auf andere Weise von der Artemis geleistet, die selber dem Göttlichen angehört, aber als solche gerade die fruchtbare Fortpflanzung der Tiere und Menschen verantwortet, und darüber hinaus dem Menschen hilft, sich von der völligen Gebundenheit an die Natur zu lösen, um aus dieser heraus mit anderen zusammen eine genuin menschliche Gemeinschaft zu bilden, die Tugend und Sinn fürs Göttliche erst ermöglicht. 28 Nimmt man diese Charakterisierung, fällt es nicht weiter schwer, zu verstehen, warum Platon die zweite Untersuchung über den Eros, im "Phaidros", in die freie Natur verlegt, die er uns dann in für ihn einmaliger Weise literarisch nahebringt. Wobei wir nicht übersehen dürfen, daß trotz der für unsere Ohren fast "romantischen" Naturbegeisterung, die in den Worten mitzuschwingen scheint, hier nicht Natur als Natur, sondern mit dieser Landschaft und all ihrer Teile eine "mythologisierte" Natur beschrieben wird, in der nicht zufällig ein Heiligtum neben dem anderen steht. So ist Platon auch äußerst freizügig mit Anspielungen auf irgendwelche Götter, wobei jedoch gerade am Ruheplatz und Ort des Dialoges nur Nymphen und der Flußgott Acheloos zusammen mit dem die Mittagszeit liebenden Pan und den durch die Zikaden vertretenen Musen anwesend zu sein scheinen, ApolIon oder erst recht Artemis werden hier nicht genannt. Aber dies ist nur die halbe Wahrheit. Wenden wir uns den Gesprächen zu, die Sokrates und Phaidros führen, bevor sie ihren Lagerplatz erreichten. Da unterhalten sie sich über einen Lokalmythos, der berichtet, daß der Windgott Boreas die Oreithyia hier geraubt habe, und Sokrates nebenbei erwähnt, daß dies den Fluß weiter abwärts gewesen sei "etwa um zwei oder drei Stadien, wo man durchgeht zum Tempel der Artemis. 29 Auch ist dort irgendwo ein Altar des Boreas".30 27 Symposion 205a - b, 207a - 20ge. 28 So könnte man J.-P. Vernants Analyse der Artemis paraphrasieren, der betont seine Analyse wolle die Artemis "so betrachten: nicht die ganze Artemis in allen Einzelheiten ihrer Heiligtümer und Gestalten, sondern im wesentlichen also in dem, was dieser göttliChen Macht ihre Besonderheit, ihren vielfachen Funktionen Zusammenhalt und Einheit verleiht". Vernant (1988), S. 8. 29 Schleiermacher-Übersetzung von "Ag ras", das man aber nicht nur als Namen des Artemistempels verstehen könnte, sondern auch als Bezeichnung der Athener Vorstadt in derdieserTempel liegt (siehe hierzu Dietrich Kurz: Anm. 7 und 9 zu "Phaidros", in: Platon, Darmstadt 1990; zur Lage: K. Wernicke: "Artemis", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 1378). Aber der Zusammenhang mit Boreas und der Landschaft stützen wohl Schleiermacher. 30 Phaidros 229c. 53 52 Worauf sie sich über die Realität des Boreas unterhalten, ob er, wie der Mythos behauptet, jemanden auf seinen Armen davon tragen könne oder, wie rationalistische Aufklärer meinen, bloß eine alltägliche Wind böe das Mädchen vom Felsen in den Abgrund gestürzt hat. Auch ohne den Hinweis auf einen dort in der Nähe vorhandenen Artemistempel, erinnert diese Geschichte an die dramatische Geburt des ApolIon und der Artemis, denn deren Mutter, die hochschwangere Leto, wurde, auf der Flucht vor dem Drachen Python, gerade von diesem Windgott Boreas gerettet, indem dieser sie davontrug zu Poseidon, der sie an einem sicheren Ort versteckte, wo sie ihre beiden Kinder zur Welt bringen konnte. So zweifelt auch jeder, der an Boreas zweifelt, unmittelbar am Mythos der Leto, des ApolIon und der Artemis. Sokrates' ironische Abwehr rationalistischer Entmythologisierungen ist schlicht, aber eindeutig. Er will sich nicht wie andere "mit einer wahrlich unzierlichen Weisheit viel Zeit verderben", denn seine ganze Zeit wird, wie er betont, von etwas anderem beansprucht: "Ich kann noch immer nicht nach dem delphischen Spruch mich selbst erkennen. "31 Womit Platon es geschafft hat, ApolIons Geburtsmythos mit dem delphischen ApolIon zu verteidigen, ohne auch nur dessen Namen zu nennen! Vor diesem Hintergrund ist auch verständlich, warum Boreas ein Altar nahe einem Tempel der Artemis geweiht war. Die beiden Gesprächspartner gehen weiter den lIissos hinab, d.h. auf den Artemistempel zu, biegen dann offenbar als sie eine hohe Platane entdecken ein Stück landeinwärts: "Sokrates: [ ... ] dies ist ein schöner Aufenthalt. Denn die Platane selbst ist prächtig belaubt und hoch, und des GesträuchesHöhe und Umschaltung gar schön, und so steht es in voller Blüte, daß es den Ort mit Wohlgeruch ganz erfüllt. Und unter der Platane fließt die lieblichste Quelle des kühlsten Wassers, wenn man seinen Füßen trauen darf. Auch scheint hier nach den Statuen und Figuren ein Heiligtum einiger Nymphen und des Acheloos zu sein. Und wenn du das suchst, auch die Luft weht hier willkommen und süß, sommerlich und schrill tönt sie wieder vom Chor der Zikaden. Unter allen am herrlichsten aber ist das Gras am saftigen Abhang in solcher Fülle, daß man hingestreckt das Haupt gemächlich kann ruhen lassen. Kurz, du hast vortrefflich den Führer gemacht, lieber Phaidros."32 Sokrates kann der Superlative gar nicht genug finden, um diesen Ort zu beschreiben. Später wird er ergänzen: "in Wahrheit göttlich scheint dieser Ort zu sein"33, doch direkt bezogen nur auf die Nymphen. Dennoch müßten Platons Zeitgenossen dies als einzige Anspielung auf Apgllon und dessen Schwester Artemis gelesen haben. Denn ist schon eine Verehrung der beiden in Baumhainen häufig gewesen, ist die Anwesenheit ApolIons stellvertretend durch jene "höchste Platane"34 garantiert, steht diese Baumart doch unter besonderen Schutz Apollons. 35 So kann Phaidros halb scherzend noch auf diese Stellvertretung hinweisen, wenn er droht: 31 32 33 34 Phaidros Phaidros Phaidros Phaidros 22ge - 230a. 230b - c. 238c. 229a. "Ich schwöre dir also - ja bei welchem Golte doch? oder willst du bei dieser Platane? -, daß wahrlich, wenn du mir nicht die Rede hälst, hier angesichts ihrer selbst, ich dir nie .. .',36 Auch die andere von Platon erwähnte Pflanze war für die Griechen mehr als nur ein Fall für die Botanik, da das in voller Blüte stehende, hohe und schattige Gesträuch im griechischen Original ein Keuschbaum (agnos) ist, ein wichtiger Punkt, denn dieser "keusche" (agn6s) Baum war der jungfräulichen Artemis heilig 37 . So soll in Sparta das Kultbild der Artemis Orthia in einem Keuschbaum gefunden worden sein, indem es auch verehrt wurde. 38 Durch die duftende Blütenpracht des Strauches wird auch die Jahreszeit gekennzeichnet, zu der die zwei Philosophen über den Eros und die "Einweihung" in die Philosophie sprechen - es ist Frühling. Die Jahreszeit, deren jährliche Wiederkehr mit dem Tag zusammenfällt, an dem Leto ihre Kinder geboren hat, deren erste Tat es ist, den Drachen Python zu erschlagen, die Personifizierung des Winters. 39 Vor allem aber die Jahreszeit, in der die ganze Natur neu geboren wird und die daher der Geburtsgöttin Artemis am liebsten ist. 4o Die Luft an diesem idyllischen Ort ist aber schon "sommerlich", weist somit schon auf die Jahreszeit des ApolIon voraus - den Sommer. 41 Auch wo die Nymphen (und Flußgötter) auftauchen, ist Artemis sehr nahe: "Mit ihnen [den Nymphen] ist Artemis am nächsten verwandt, sie hat dieselben Wirkungsgebiete wie jene und noch einige mehr, da die Flußnymphen den Flußgöltern gewichen sind; [ ... ] Die Nymphen sind Geburtsgöttinnen und werden von schwangeren Frauen verehrt [ ... ] Abgesehen von Dionysos ist Artemis die einzige Gottheit, die regelmäßig von einem Gefolge, von den Nymphen umgeben erscheint, und zwar nicht nur in der Poesie, sondern auch im Kult und in Kultlegenden, .. .',42 35 K. Wernicke: "Apollon", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 9. 36 Phaidros 236d - e; ApolIon galt darüber hinaus als SChützer der Eide! (K. Wernicke: ,,ApolIon", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 14) 37 Siehe hierzu: Liddei & Scott, Greek-English Lexicon: "agnos ... Att[isch] ... = lugos, chaste-tree, the branches of wh ich were strewed by malrons on their beds at the Thesmophoria, Vitex Agnus-castus [... ] (Associated with the notion of chastity from the likeness of its name to agn6s.)" "agn6s, e, 6n [... ] pure, chaste, holy [... ]1. of places and things dedicated to gods [... ]2. of divine persons, chaste, pure, Hom., mostly of Artemis." (Hervorh. d. Verf.) "Dieser Strauch [Vitex Agnus-castus] ist seit dem Altertum ein Symbol der sexuellen Enthaltsamkeit; er wurde früher als Anaphrodisiacum benutz!." Daher heißt er im Volksmund auch "Keuschbaum", bzw. "Mönchspfeffer" (Urania Pflanzenreich, Höhere Pflanzen, Leipzig 1973, Bd. 11., S. 235; Hervorh. d. Verf.). Doch scheint - zumindest in Sparta - der Keuschbaum auch mit der Gesundheit assoziiert gewesen zu sein, da eines der vier Heiligtümer des Asklepios in Sparta einem ASklepios "Agnftas" geweiht war, dessen Name, laut Pausanias, von dem aus dem Holz des Keuschbaums gefertigten Götterbild stammen soll. Ziehen: "Sparta (Kulte)", in: Paulys R - E, 2. Reihe, Bd. 111. Sp. 1471. 38 Nilsson (1955), Bd. I. S. 487; Walter Burkert: "Demaretos, Astrabakos und Herakles: Königsmythos und Politik zur Zeit der Perserkriege", in: ders. (1990), S. 95. 39 Th. Schreiber: "Artemis", in: LGRM Bd. I. Sp. 577; Roscher u. Furtwängler: "Apollon", in: LGRM Bd. I. Sp. 428. 40 K. Wernicke: ,,Artemis", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 1343 - 1344; "Darum sind auch ihre Feste im Frühling, ist der ihr geheiligte Monat ein Frühlingsmonat." 41 K. Wernicke: "Apollon", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 10; Roscher u. Furtwängler: ,,ApolIon", in: LGRM Bd. I. Sp. 427. 42 Nilsson (1955), Bd. 1., S. 499 (Hervorh. d. Verf.); "Nach ältester Anschauung [ ... ] ist sie eine ,Na- 55 54 So ist auch der von Sokrates so bejubelte Bach aufs engste mit ihr verbunden, denn: "Immer [ ... ] ist die Feuchtigkeit in Wald und Flur das befruchtende Element, in dem sich ihr Wirken äußert. [ ... ] Quellen finden sich häufig in Tempeln der Artemis oder in deren Nähe."43 Als direkte Folge davon wird sie charakteristischer Weise dort verehrt, "wo die Vegetation üppig war und nicht von der Sonne verbrannt wurde"44, so daß auch Sokrates Hinweis auf das an diesem Ort in solcher Fülle wachsende Gras in einem anderen Licht erscheint. Doch gerade, wenn man diese religiösen Bezüge als gegeben akzeptiert vor allem diejenigen, die ständig das Thema der Geburt hereinbringen -, drängt sich einem die Frage auf: Was soll eigentlich geboren werden? Die "Geburt" wahrer Gedanken - im modernen Sinne - würde einen solchen Aufwand an Anspielungen nicht rechtfertigen. Die Antwort findet sich wiederum im antikreligiösen Kontext. Mythologisch verdankt Artemis ihre kurotrophen Eigenschaften ihrer Rolle als Hebamme bei der Geburt des ApolIon, denn sie, die einen Tag vor ihrem Bruder auf die Welt kam, half sogleich ihrer Mutter bei deren Niederkunft. So muß ApolIon als Gott der heißen Jahreszeit auch jedes Jahr nach dem Winter "wiedergeboren" werden, bzw. zurückkehren und diesen besiegen 45 , so wie Apollon kurz nach seiner Geburt mit Hilfe der älteren Schwester Artemis die Drachenschlange Python besiegen muß, welche "wohl nur als ein Symbol des Winters gefaßt werden" kann. Danach von Zeus nach Delphi gesandt, "wo er allen Griechen Recht und Gesetz verkünden soll", "flog er auf einem Schwanenwagen nach Delphi, und zwar mitten in der warmen Jahreszeit, weswegen bei der Ankunft des Gottes derselbe mit einem Frühlin2sliede begrüßt wird, und die Nachtigallen, Schwalben und Cikaden ihn besingen". 6 Dieselben Zikaden, die zu dem Gesp"räch von Sokrates und Phaidros singen. 47 Scheint in der griechischen Religion die Geburt bzw. Ankunft ApolIons vor allem die Natur zum Schauplatz zu haben, verwendet Platon diese in seinem Dialog hauptsächlich als Metapher, um das Geschehen an dem für ihn wichtigsten Schauplatz zu charakterisieren. Denn ApolIons Epiphanie soll vor allem in der Seele der beiden Philosophen stattfinden, als Verwirklichung des "Erkenne dich selbst"48. Artemis als Göttin der Hebammen und Philosophen 43 44 45 46 47 48 turgöttin von ähnlichem, nur allgemeinerem Wesen, als die Nymphen der Berge, Flüsse und Bäche'." (Th. Schreiber: ..Artemis", in: LGRM Bd. I. Sp. 560) Th. Schreiber: ,Artemis", in: LGRM Bd. I. Sp. 560; Sokrate~ vergißt nicht darauf hinzuweisen, daß sein göttlicher daimon, der wie jeder daimon eine Verbindung zu dem Göttlichen herstellt (Symp. 202d - 203a), sich gemeldet hat, als er im Wasser der Quelle stand (Phaidros 242b - cl. Nilsson (1955), Bd. 1., S. 493. So ist auch in Delphi während des Winters nicht ApolIon, sondern Dionysos der weissagende Gott (K. Wernicke: ..ApolIon", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 35). Roscher u. Furtwängler: ..ApolIon", in: LGRM Bd. I. Sp. 426 (Hervorh. d. Verf.). Als Anhänger der Musen (Phaidros 259b - c) sind sie auch Anhänger des ..Musenführers" ApolIon. .. Seine [ApolIons] Epiphanie geschieht im Frühling, seine Feste fallen insgesamt in die sommerliche Jahreszeit." (K. Wernicke: ,ApolIon", in: Paulys R - E, Bd. 11. Sp. 10); ..Mysteriensprache soll bei dieser "Geburt" helfen, bzw. den Weg zur Weisheit des delphischen ApolIon sichern. 49 Doch warum sollen diese religiösen Konnotationen in Platons Werk heute noch philosophisch interessieren? Oder bescheidener: Was ist durch diese Interpretation für das Verständnis der "eigentlichen" Philosophie Platons gewonnen? 11. Die Sprache Platons Sprachmodell zeigt sich in seiner Einfachheit (und auch Schwäche) wohl am deutlichsten in der unterschiedslosen Verwendung von Buchstaben, Silben und Worten zur Verdeutlichung der Strukturen der Sprache: So wie mehrere Buchstaben zusammen eine Silbe, mehrere Silben zusammen ein Wort ergäben, so sollen auch mehrere Worte einen Satz bilden. Allen zusammen soll das Verhältnis von Urbestandteil (stoicheion) und Zusammengesetztem (syllabe) gemeinsam sein. Lassen sich zwar nicht alle Silben wahllos zu einem sinnvollen Wort, oder alle Worte zu einem sinnvollen Satz verbinden, so bleiben doch alle darüber hinausgehenden grammatischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Satzteilen unthematisiert. Nicht nur die Rolle von Präpositionen und ähnlichem bleibt unbedacht, sondern vor allem die Unterscheidung zwischen Subjekt und Prädikat (ontologisch: Substanz - Akzidens).5o Ob "Mensch", ob "schön" oder "gesund", alle sind in gleicherweise wird verwendet, um andersartige geistige oder seelische Prozesse zu veranschaulichen oder zu überhöhen [... ] Der einflußreichste Text über Mysterienerfahrung stammt aus Platons Phaidros; [... ] Schon im Symposion hatte Platon die Offenbarung des wahren Seins, die Eros vermitteln kann, in der Sprache der Mysterien beschrieben." Dem ..Philologen bleibt festzustellen, daß Einzelheiten offensichtlich von Eleusis genommen sind, vor allem die Doppelung von Mysten [Eingeweihten] und Epopten [zur Weihe Zugelassenen], auch der tanzende Chor, die heilige Schau, die unvergeßliche Seligkeit ist in anderen Texten [... ] belegt". Walter Burkert (1991), S. 77 - 78; zu den Metaphern des .. Ammendienstes" und der ..Geburt" in Eleusis, s. S. 84; zur gleichzeitigen Kritik an den Leistungen der dortigen Mysterien, s ...VII. Brief" (333d - 334c). 49 Ist auch Artemis diejenige, in deren von Geburt und Tod erfüllten ..Bereich" sich das Philosophieren abspielt, kann aber darüberhinaus jeder Weise, d.h. jeder der zwölf olympischen Götter zur Ideenschau hinführen (Phaidros 252c - 253c). 50 Die Unterscheidung zwischen .. onomata" und ..hremata" ist nur eine Unterscheidung wie sie in der Sprache erSCheint. Platon behandelt diese nur im Zusammenhang mit der Frage, welche Ideen miteinander in Verbindung treten können und welche nicht. Er zieht explizit die Analogie zur Verbindung von Buchstaben und der von Silben (Soph. 261 d), und läßt so - trotz aller Unterschiede - keine prinzipielle Differenz zu: Worte beider Arten ähneln sich letztlich wie ein Buchstabe dem anderen! Auch die UnterSCheidung zwischen der "ousia" und dem ..poion ti an die Aristoteles später anknüpfen konnte, ist bei Platon keine Subjekt-Prädikatstheorie, da sie keine Differenz zwischen zwei Seinsarten begründet, sondern jedes Seiende spaltet: also nicht nur alle Dinge in ihr Wesen (ousia) und ihr sinnliches Abbild (poion ti), sondern sie spaltet auch das, was wir heute Akzidenzien nennen würden - z.B. in die erscheinende Farbe und das Wesen der Farbe (Kratylos 23e). Wird das Wort selbst zum Gegenstand der Untersuchung gemacht, trennt sie den Teil des Wortes, der - selbst Sinnliches - nur ein wahrnehmbares Abbild (poion ti) präsentiert, von dem eigentlichen Wesen (VII. Brief 342e - 343c). Die bei den Begriffe sind so zusammen nur eine andere Bezeichnung für den ..chorismos"(s. dazu auch über ..Schau- und Hörbegierige" vs. die "das Wahre Liebenden": Politeia 476b). Diese Zweiseitigkeit macht die SpraU , 56 57 als "Mensch(heit)", "Schönheit" und "Gesundheit" stoicheia, d.h. in diesem Fall Ideen. So ist auch ein konkreter, schöner Mensch nicht ein Mensch, der die Schönheit akzidentell an sich hat, sondern ein Etwas, das in gleicher Weise an der "Schönheit" wie an der "Mensch(heit)" teil hat. Letzteres ist nicht Zugrundeliegendes (subiectum) gegenüber dem ersteren. Das "Mensch"-sein kann so auch nicht dem einzelnen Menschen als besonderes Wesen zugesprochen werden, da er durch seine Teilhabe Abbild mehrerer Ideen ist, wobei keiner ein ontologischer Vorrang zugesprochen werden könnte. Ohne ein Wesen, und das heißt ein Wesen, wird aber die Einheit des konkret Wahrgenommenen zur Illusion. So gerät die gesamte Wahrnehmung in den Status einer bloßen Täuschung: Zwar noch Abbild der Ideen, aber doch schon mehr diese verstellend, statt darstellend. Aus der Differenz zwischen dem (einen) wandelbaren Wahrgenommenen und den (vielen) in sich unwandelbaren Bedeutungen scheint unversehens ein unüberbrückbarer "chorismos" zu drohen. Die direkteste Beziehung zu dem jeweiligen Eidos hat in der empirischen Sprache nicht ein ganzer Satz, sondern das einzelne Wort, der Name, der im Satzgefüge diesen repräsentiert. Seine Aufgabe müßte daher auch sein, als möglichst getreue Nachbildung das Urbild im Sinnlichen präsent zu halten. Die sich aus solchen Anforderungen ergebenden Probleme behandelt Platon teils ernsthaft, teils äußerst ironisch in den Untersuchungen des "Kratylos". Denn um der Idee ähnlich zu sein, dürften die Benennungen nicht auf bloßer Tradition, oder willkürlicher Übereinkunft beruhen. Um im "Diesseits" die Erkenntnis der jenseitigen Ideen zu befördern, müßten sie "richtig" sein und nicht irreführend. Aber gerade dabei waren menschliche Gesetzgeber (nomothetes) der Sprache letztendlich doch etwas überfordert. Welcher Mensch hat schon eine so genaue Kenntnis des zu Benennenden, daß er wagen kann, seine Wortschöpfungen als wirklich ähnlich (und somit adäquat) zu bezeichnen? Schon Homer unterschied - wie Platon bemerkt - zwischen den Benennungen, die die Götter den Dingen geben und denen der Menschen. Aber es kann wohl nur eine Benennung geben, die adäquat ist, und "offenbar werden doch die Götter [ ... ] vollkommen richtig mit den Wörten benennen, die es von Natur sind".51 So bleiben auch alle Versuche, allein durch Etymologien der menschlichen Worte auf das Benannte zu schließen, zweifelhaft. Besonders, da das empirische Sprach material - die Töne - das Schicksal alles Wahrnehmbaren teilt, che als Wissensvermittlerin so unzuverlässig, da sie (ohne dialogische Rückversicherung) in ihrer Rezeption unberechenbar wird (VII. Brief 343a). Eine ähnliche Unterscheidung gibt es auch in der Sphäre der Ideen, die an sich selbst (pros anto) und in Beziehung aufeinander (pros aI/eta) untersucht werden müssen (parm. 136c). Doch wie die Durchführung im "Parmenides" zeigt und Platon im "Sophistes" explizit erklärt, geht es auch hier nicht um ontologische Differenzierungen zwischen einem Wesen und Akzidenzien: die Beziehung auf andere wird, so wie Platon sie versteht, wieder durch eine eigenständige (dritte) Idee gestiftet, die zwei andere, entweder verbindend oder trennend, in Beziehung zueinander setzt (Soph. 253C). D.h. Platon interpretiert die verwendeten Begriffe nicht innerhalb einer Substanz-Akzidens-Theorie. Auf letzteres ist noch zurückzukommen. 51 Kratylos 391d - e. die mit ihm gerade überwunden werden sollte: die prinzipiell drohende Ideenferne, den chorismos. 52 So zieht sich Platon explizit - zunächst nur in religiösen Belangen - auf eine kultische Praxis zurück, die er dadurch mitsamt ihrer Vorstellung des Verhältnisses zwischen Menschen und Göttern affirmiert. Denn am vernünftigsten wäre zu sagen, "daß wir [ ... ] von den Göttern nichts wissen, weder von ihnen selbst noch von ihren Namen, wie sie sich untereinander nennen. Denn offenbar werden sie selbst sich richtig benennen. Die nächst dieser am meisten richtige Art aber wäre, wie es bei den Gebeten Brauch ist, daß, wie und woher sie selbst begehren genannt zu werden, so auch wir sie nennen, weil wir nämlich weiter von nichts wissen. Denn das scheint mir ein sehr guter Brauch".53 So rechtfertigt Platons Sprachtheorie eine nicht unwesentliche Handlung der antiken Religionspraxis. 54 Doch wie die Vielfalt der menschlichen Sprachen zeigt, haben die Götter uns nicht nur ihre wahren Namen vorenthalten, sondern auch die einzig wahren Benennungen der Ideen uns nicht offenbart. Die in unseren Worten enthaltene Mischung aus begrenzt-mimetischer Darstellung des Gemeinten und bloß konventionell Festgelegtem mag ein schon Wissender auf ihren Wahrheitsgehalt hin durchschauen, jeder andere muß sich in ihr hilflos verheddern. Sprache ist so - wie alles andere Sinnliche - für Erkenntnis nur sekundär. Das Fehlen einer echten Subjekt-Prädikat-Konzeption führt dazu, daß keine Bedeutung (eidos) sich durch ein Prädikat explizieren kann. "Mensch" ist nur "Mensch", und nichts weiter. So mußte Platon Bedeutungen in Gestalt der Ideen jenseits der Sprache annehmen, die diese zwar erst begründen, doch nicht in und durch sie in Sätzen ausgesagt werden können; sie bleiben einem Uneingeweihten völlig stumm! Kein Wort kann seine Bedeutung, wenn sie nicht in irgendeiner Weise schon gewußt wird, durch ein anderes Wort und dessen Bedeutung verstehbar machen. Jede Definition kann daher nur zwar notwendige, aber der reinen Bedeutung der Idee fremde, d.h. äußerliche, Verhältnisse zu anderen Ideen darstellen. Doch schon die Formulierung dieses Tatbestandes spricht der in sich ruhenden Bedeutung mehr zu, als sie an sich hat. Denn die Identität, die Schleiermachersche "Selbigkeit", ist konsequenterweise selbst eine eigene Idee, sodaß im Satz: "Das Eidos ,Mensch' ist (nur) mit sich selbst identisch", dem "Mensch" seine "Identität" äußerlich hinzugefügt wird. Ansich ist "Mensch" aber nicht einmal von allen anderen Bedeutungen, wie z.B. "Hund", verschieden, erst durch die Gemeinschaft mit der Idee der "Verschiedenheit" sind sie unterscheidbar. Platon beharrt konsequenter als wohl die meisten Formallogiker auf der formallogischen Identität, d.h. Ein52 S. zur Trennung der Lautgestalt vom speziellen Eidos und der Idee des Namens als solchem: K. Gaiser, Name und Sache in Platons ,Kratylos', Heidelberg 1974; S. 40 - 44. 53 Kratylos 400e - 401 a (Hervorh. d. Verf.). 54 ,,zeus, wer auch immer er ist, wenn ihm dieser Name lieb ist, ruf ich ihn unter diesem an." (Aischylos, "Agamemnon", Vers 160 - 62; für den Hinweis danke ich W. Schwabe.) Zur Funktion und der dahinterstehenden Weitsicht dieser Gebetsformel in der Antike, S.: R. M. Ugilvie, " ... und bauten die Tempel wieder auf", Die Römer und ihre Götter im Zeitalter des Augustus, München 1984; S. 31 - 35. 59 58 deutigkeit aller Bedeutungen, denn gerade deshalb sieht er, daß schon jeder Versuch diese Eindeutigkeit sprachlich zu formulieren, die Eindeutigkeit und damit Identität der Bedeutung sprengt. Im "Sophistes" läßt er seinen eleatischen Fremden darauf beharren, daß " ... jedes einzelne [Bewegung, Ruhe, Seiendes, Selbigkeit) verschieden ist von den übrigen, nicht vermöge seiner Natur [... ), sondern vermöge seines Anteils an der Idee des Verschiedenen".55 Platon trennt somit jede Bedeutung von ihrer eigenen Negation, für ihn gilt nicht der Satz: "omnis determinatio est negatio". Dieses bedingungslose Festhalten an einer absoluten Widerspruchsfreiheit ist aber nicht freiwillig gewählt, da zum Beispiel, ohne die erst von Aristoteles erkannte besondere (ontologische) Beziehung von Prädikaten zu ihrem Subjekt, dialektisch Widersprüchliches nicht zu "Momenten" (im Sinne Hegels) gemacht werden kann. So bleibt ihm nur, darauf zu insistieren, daß, auch wenn jede Bedeutung "Selbiges sei und auch nicht Selbiges", es "doch nicht auf gleiche Art"56 gemeint sein könne, denn anderenfalls in diesem theoretischen Rahmen nicht nur jeder Sophistik alles zugegeben werden müßte, sondern Sprache selbst unmöglich würde. Unseren Zugang zu den außersprachlichen Bedeutungen kann nur eine nichtsprachliche Erkenntnis garantieren, die wir im Jenseits, vor unserem Leben in diesem Körper und vor jedem Sprechen erlangen: die mystische, vorgeburtliche "Ideenschau". Von ihren Einsichten müssen wir zehren bis zu unserem Tode, ohne sie im strengen Sinne einem "Uneingeweihten" beweisen zu können. Nur weil alle Menschen gleichermaßen die Ideenschau erfahren haben, ist im Kreise von Freunden durch dialektische Untersuchungen ein Punkt zu erreichen, wo man gemeinsam die Wahrheit aufleuchten sieht 57 , sodaß man ohne Beweise Übereinstimmung über das Wahre erzielen kann. Denn das von dieser "Schau" begründete potentielle Wissen ist mit Hilfe von Erinnerungshilfen aktualisierbar. Sind daher auch die Namen (onomata), die Definitionen (logoi) und die sinnlichen Erscheinungen (eidola) der Ideen nicht wissensbegründend, so sind sie in der Funktion solcher Erinnerungshilfen als Mittel der Erkenntnis gerechtfertigt, da unverzichtbar. Beweisen - zumindest indirekt -läßt sich höchstens die Notwendigkeit, eine vorsprachliche Einsicht generell vorauszusetzen, um all den Aporien zu entgehen; doch die jeweiligen Definitionen der einzelnen Ideen selbst müssen unbewiesen bleiben, d.h. auf prä reflexive Gewißheiten bauen. Platon behauptet nicht, als erster Erkenntnis als Erinnerung an vorgeburtliche "Einweihungen"58 interpretiert zu haben. Ausdrücklich erklärt er: 55 Sophistes 255e (Hervorh. d. Verf.); Entgegen G. Prauss (Platon und der logische Eleatismus, Berlin 1966) wird der sog. "logische Eleatismus" nicht von der späten - am Satz orientierten Ideenlehre des "Sophistes" überwunden, sondern ist anscheinend dort ein bestens integrierter Bestandteil. Doch wie? Dazu später. 56 Sophistes 256a. 57 VII. Brief 341d. 58 Phaidros 250b. i,;h .habe e.s von .Männern un~ Frau.en, die in göttlichen Dingen gar weise waren. Dles~ "sind Priester und Priesterinnen, denen allen, daran gelegen ist, von dem was sie verwalten, Rechenschaft geben zu können".59 W·. Vergegenwärtigt man sich auch noch, daß der Verlust der Ideenschau beim Sturz in unsere körperliche Welt Ursprung des Eros ist60 , dann wird Platon durch seine theoretischen Probleme wieder in den Tempel zu den Priestern und deren Lösungen gewiesen, speziell nach Mantineia zur weisen Diotima. Denn woher hat ein Philosoph die Gewißheit, daß das a-Iogische "Aufleuchten" der Wahrheit durch "aneinanderreiben" des Namens, der Definition und der sinnlichen Erscheinung nicht doch Täuschung ist? In dem Moment, in dem man - wie jeder Mensch - die Fähigkeitzum Irrtum hat, leidet jede Gewißheit des Menschen unter einem Legitimationsdefizit. Nur das Vertrauen immer geführt worden zu sein, von jemandem, der prinzipiell nie dem Irrtum verfällt, also ein Gott ist, kann die eigene Überzeugung davor bewahren wie Münchhausen zu behaupten, es alleine geschafft zu haben. Doch wie kö~nen die griechischen Götter die Menschen leiten, bzw. wo und wann glaubte Platon ihrer Hilfe gewiß zu sein? 111. Die tanzende Stadt Die Lage der Menschen scheint prekär. Ein "charismas" spaltet den logos in zwei Teile: auf der einen Seite das gesprochene Wort in seiner lautlichen Gestalt, auf der anderen die reine Bedeutung des Eidos, die ersteres erst zu einem Bezeichnenden machen kann. 61 Zwischen diesen dyadisch aufeinander Bezogenen entfaltet Platon eine geistige Landkarte, auf der der aufsteigende Weg zur Erkenntnis einzeichenbar ist, sowie - streng hierarchisch - der Ort auf dem jeder Mensch seinem derzeitigen Entwicklungsstand gemäß sich be~ findet: die fast völlig unwissende Menge nahe den empirischen Worten leb~nd, beinahe ohne Kenntnis von deren eigentlichen Bedeutungen, allen Einf!usterungen von Rhetoren und Sophisten widerstandslos ausgeliefert. Noch tiefer ist nur die Position der Tiere, die bloß Laute ohne Bedeutung wahrnehmen können, wo Sprache gesprochen wird. Am anderen - oberen - Ende des Weges die wahren Weisen, die nur Götter sein können. Für sie, die so nahe den Bedeutungenleben, gibt es keine Trennung zwischen wahrer Bedeutung und dem von ihnen ausgesprochenen Wort, sie wissen die richtigen Namen aller Dinge. Irgendwo auf dem langen Weg dazwischen müht sich der Philosoph ab. Als Mensch zur ewigen Vollkommenheit nicht fähig, ist er nach oben strebend 59 Menon 81 ab. 60 Phaidros 245bc. 61 v..:0bei das, was als Referent bezeichnet werden soll, erst in zweiter Linie das wahrgenommene Ding 1St. Das mit dem Wort Gemeinte (der Referent) ist eigentlich immer die seiend verstandene Bedeutung, die Idee selbst. So kann, obwohl das Ding von der Bedeutung streng geschieden wird, dennoch nicht, wie in der modernen Sprachtheorie, die Bedeutung vom Referenten abgehoben werden. 60 61 auf dem Weg. Sein Sprechen muß unablässig durch dialektische Untersuchungen zur Einheit mit den Ideen gebracht werden. Vorübergehend (scheinbar) erfolgreich, ist das Ergebnis doch nie von einer durch Menschen kontrollierbarenSicherheit begleitet. Die "Liebe zur Weisheit", die im Kern eine Liebe zu den Bedeutungen (Ideen) ist, schafft erst das, was man Sprache nennen kann. Denn die aus der Liebe entstehende Beziehung zwischen dem gesprochenen Wort und angestrebter Bedeutung begründet den Zeichencharakter des Wortes. Diese Entwicklungsmöglichkeit des menschlichen "Eros" ist so dasjenige, welches den Menschen zum "zoon logon echon" macht, welches ihn vom Tier unterscheidet, das seinen Eros nicht von den sinnlichen Dingen trennen kann. 62 Daher sind letztlich Mensch und Philosoph Synonyma, wobei letzteres die Grenzen des ersteren genauer bestimmt. Denn die Weisheit nur lieben zu können, unterscheidet ihn von den Göttern. Alle weiteren Differenzierungen innerhalb der species Mensch entstehen durch die unterschiedliche "Qualität" der Seelen und damit deren Fähigkeit das geliebte Ziel zu erkennen und zu erreichen. 63 Ein großer Teil der Menschheit schwebt so in beständiger Gefahr die Grenze zum Tierischen zu überschreiten. (Ein Problem, das schon die griechische Mythologie beschäftigte.) Aber erst wenn man die Identifizierung des spezifisch Menschlichen mit der Philosophie nachvollzieht, läßt sich die Selbstverständlichkeit verstehen, mit der Platon - trotz der peinlichen Brunnenstürze des Thales und aller anderen der empirischen Welt distanziert gegenüberstehenden Philosophen - sich nur eben diese als Herrscher und Gestalter des idealen Staates vorstellen kann. Mit ihnen sollen diejenigen führen, die auf dem Weg zum wahren Sein am weitesten vorangekommen sind, die das Menschliche am weitesten entwickelt haben. 64 Doch wie? Die Seele des Philosophen Ideenschau. 65 Ein Pferd, ein weißes, soll dabei willig - eingereiht in den "göttlichen Chor" - beinahe von selbst den richtigen Weg einschlagen, während das zweite, schwarze, ständig auszubrechen droht. 66 Die Überwindung dieses innerseelischen Problems ist so offensichtlich Voraussetzung für die Erkenntnis der Ideen. Doch welcher Konflikt und welche Lösung wird mit diesem Bild von Platon gezeichnet? In der "Politeia" taucht dieselbe Dreiteilung der Seele in der Form einiger rhetorischer Fragen wieder auf, ausführlicher, diesmal beschrieben in Analogie zu einem ständisch geordneten Staat: "Nun ..ge~ührt doch dem Vernünftigen [logistikon] zu herrschen, weil es weise ist und fur die gesamte Seele. Vorsorge hat? Dem Eifrigen [thymoeidos] aber, diesem folgsam. z.u sein un~ verbundet? [ ... ] Und diese beiden nun, so auferzogen und in Wa~rhelt In. dem Ihrigen unterwiesen und gebildet, werden dann dem Begehrlichen [epJthy:nefikos] vorstehen, welches wohl das meiste ist in der Seele eines jeden und seiner Natur nach das Unersättlichste; welches sie dann beobachten werden damit es nicht etwa durch Anfüllung der sogenannten Lust des Leibes groß und stark geworden, unternehme, anstatt das Seinige zu verrichten, vielmehr zu unterjochen und zu beherrschen, was ihm nach seinem Stand nicht gebührt und so das ganze Leben aller verwirre."67 ' Das Problem ist also eines der Ordnung und Herrschaft. Auf das Gleichnis des "Phaidros" angewendet, läßt sich sagen: Das Vernünftige soll die Gefühle: das Eifrige und das Begehrliche, leiten, davon hängt ein gelingender "Aufstieg" ab. Dabei hat aber das Vernünftige keine Zwangsmittel, um das unersättliche Begehren zum Gehorsam zu zwingen. Jener "kleinere Teil" wäre alleine den Wünschen des größten Teils, dem Begehrlichen, ausgeliefert. So kommt der tätigen Hilfe des Eifrigen die Rolle des sprichwörtlichen Züngleins an der Waage zu. Dessen Folgsamkeit dem Vernünftigen gegenüber soll garantieren, daß "seine Tapferkeit das Beschlossene vollzieht"68. Die alles bestimmende Kraft ist der "Eros". Dieser allein entscheidet durch seine Ausrichtung, ob man "tierisch" bloß dem sinnlich Einzelnen hinterherjagt, um die wechselnden Lüste von Hunger und Sexualität zu stillen, oder ob man den Göttern nacheifernd, sich "erhebt" zum Allgemeinen, dem Schönen und Guten an sich. Im "Phaidros" zeigt Platon den innerseelischen Konflikt im Bild des verzweifelten Wagenlenkers, der seine Rösser möglichst lange hinter den Göttern her auf dem Weg zum Rande der Welt zu führen versucht, zur 62 Zur Trennung der Seelen in tierische und menschliche durch..die "Ideenschau": ,jede Seele eines Menschen muß [... ] ihrer Natur nach das Seiende geschaut haben, oder sie wäre in dieses Gebilde nicht gekommen" (Phaidros 24ge). Zur Gewinnung und Verlust des Menschlichen: Phaidros 249bc. 63 Theaitetos 191 c. 64 Allgemein erkennt Platon die Notwendigkeit empirisch-praktischen Wissens neben dem philosophischen an (Philebos 62a - d), aber jenes bleibt für ihn das Geringere (hystera; ibid. 59c), um das er sich letztlich nicht kümmert. Aus diesem Grund halte ich auch H. J. Krämers Versuch den Philosophen gerade als Prototechnokraten zu verstehen, der als solcher zum Herrschen prädestiniert sei, für verfehlt (ders., Das Problem der Philosophenherrschaft bei Platon, in: Phil. Jahrb. d. GÖrres-Ges. 74/1967; S. 254 - 270). Doch stellt sich Platon dies nicht als permanente Unterdrückung Widerspenstiger vor, was einem endlosen innerseelischen Bürgerkrieg gleichkäme, den er gerade beseitigen will, sondern das Eifrige soll allein indem es von der Seele die Lüste des Körpers fernhält, allE! Gefühle folgsam u~d besonnen machen. Denn nur wenn das Begehrliche durch diese Lüste des Körpers gestärkt wird, überschreitet es seine vorgegebenen Grenzen, um die Herrschaft dem Vernünftigen streitig zu machen. Das Ziel ist eine harmonische, und d.h. gewaltfreie Zusammenarbeit, in der jeder Teil freiwillig "das Seinige" tut. Dieser Zustand ist die wahre Gerechtigkeit. 69 Denn dann wären alle drei miteinander befreundet, indem "das Herrschende mit den beiden beherrschten Teilen einmütig ist darüber daß das Vernünftige herrschen soll", ' 65 66 67 68 69 Phaidros 248ab. Phaidros 253de; Chor: Phaidros 250b. Politeia 441e - 442b. Politeia 442b, 441a. Politeia 441d; s. auch Timaios 72a. 62 63 sodaß "sie nicht miteinander im Streit sind"7o. Das verlangt eine freiwillige Zustimmung der Beherrschten, die nicht erzwungen werden kann. 71 Allein schon ein Herrschenwollen eines der nichtvernünftigen Teile der Seele würde, unabhängig von dem Erfolg seiner Bestrebungen, die Besonnenheit und damit Gerechtigkeit dieses Menschen beseitigen. Bevor wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, eine solche Harmonie herzustellen, sollte der Charakter dieser Vereinigung vielleicht noch deutlicher herausgestrichen werden. Denn es überschneiden sich bei der Bestimmung der drei Teile zwei divergierende Einteilungsschemata: Greifen wir nochmals auf das Bild des "Phaidros" zurück, so läßt sich einerseits klar der menschliche Wagenlenker von den zwei Tieren unterscheiden; andererseits wird eines der Pferde als so gutmütig und folgsam dem Lenker an die Seite gestellt, daß diese zusammen das Gute gegenüber dem schlechten, schwarzen Pferd repräsentieren. So zeigt Platon eine Verbindung von zwei, deren Art entgegengesetzt ist: von Vernunft und Gefühl, von Rationalem und Irrationalem. In den zwei Pferden sind die zwei Seiten des Eros bildhaft gemacht, die aber beide "mania" sind - WahnsinnJ2 Kämpft das unersättliche Begehrliche um die Herrschaft in der Seele, ist der Mensch als Philosoph gescheitert. Die Alternative ist aber nun nicht eine neuzeitliche Nüchternheit, die sich jedem Wahnsinn entgegenstellt, sondern die besonnene Liebe! Sie ist die harmonische Vereinigung von Logos und Eros, Vernunft und Wahnsinn. Denn die "wahre Liebe" (orthos eros) ist: "besonnen und gleichsam musikalisch zu lieben"J3 Der Seelenwagen stellt als Ganzer diese paradoxe, aber notwendige Einheit des Entgegengesetzten dar: einerseits kommt der Lenker, auch werm er den richtigen Weg kennt, ohne Pferde nicht vorwärts zu den Ideen hinauf; andererseits würden die Pferde ohne die zügelnde und leitende Hand des Vernünftigen auseinander strebend 70 Politeia 442cd; Denn gerecht ist, wer "sich selbst beherrscht und ordnet und Freund seiner selbst ist und die drei in Zusammenstimmung bringt, ordentlich wie die drei Hauptglieder jeder Harmonie, den Grundton und den dritten und fünften, [... ] und auf alle Weise einer wird aus vielen, besonnen und wohl gestimmt" (Pol. 443de) "Harmonia" meint hier wie auch im weiteren nicht einen neuzeitlichen Akkord, den die Antike nicht kannte, sondern die durch mathematischproportionale Teilung der Saite des Monochords erzeugte "Tonskala", d.h. des der Melodie vorgegebenen Tonvorrates, aus dem diese sich zusammensetzt. Die "harmonischen" Töne klingen daher nicht gleichzeitig als Akkord, sie folgen zeitlich aufeinander: als auf- und absteigende Melodie. 71 Nomoi 689b. 72 Phaidros 244a; der "göttliche Wahnsinn" des Eros (und der Aphrodite) wird von Platon definiert, indem er ihn neben den wahrsagenden Wahnsinn des ApolIon, den einweihenden des Dionysos und den dichterischen der Musen stellt (z.B. Phaidros 265b). Aber die Philosophie als Dialektik muß das "überall Zerstreute anschauend zusammenfassen" und "auch wieder nach Begriffen zerteilen", und so ein Wissen über dem Definierten sein (ibid. 265de); sie ist selbst das alle vier Verbindende; wie auch im Kult zumindest ApolIon, Dionysos und die Musen verbunden waren. Die Philosophie ist sowohl "Einweihung", als auch direkte Konkurrentin der Dichter (Tragöden), sie ist "Liebe" und "wahr-"sagend, auf das Immer-Seiende blickend auch Zukünftiges erfassend. 73 Politeia 403a (Hervorh. d. Verf.); s. auch die Unterscheidung zwischen "wahrer" und "falscher" Lust (Phil. 39d -41b). sich führungslos voneinander trennen und im zügellosen Wahnsinn enden, dem keine Erkenntnis beschieden ist. 74 Diese angestrebte, aber äußerst bedrohte Harmonie führt Platon am Ende fast in die Aporie, denn das Ziel erreichen nur wenige, und auch diese "geängstigt (thoryboumene) [... ] von den Rossen und kaum das Seiende erblickend". Von den übrigen, die sich treten und stoßen, wird erwähnt: "Getümmel entsteht [ ... ], Streit und Angstschweiß (hidros), wobei durch Schuld schlechter Führer viele verstümmelt werden, [... ]; alle aber gehen nach viel erlittenen Beschwerden unteilhaft der Anschauung des Seienden davon."75 Die Angst vor den unkontrollierten, d.h. unbesonnenen, Gefühlen verläßt den Platoniker nicht, mag er noch so oft die Schuld für das bedrohlich erlebte Getümmel, das den Menschen in seinem Menschsein bedroht, bei schlechten Wagenlenkern suchen. 76 Der Tanz der Philosophen Wie kann die besonnene Liebe erzeugt werden, sodaß einem selbst als guter Führer all seiner Gefühle der Aufstieg bis zu den Ideen gelingt? Die Antwort scheint uns mit dem Begriff der "musikalischen "Liebe gegeben zu sein, denn dort, wo Platon das Verhältnis des Vernünftigen und Eifrigen behandelt, sagt er über diese: "Und wird nun nicht [ ... ] die rechte Mischung der Musik und Gymnastik sie zusammenstimmend machen, indem sie das eine anspornt und nährt durch schöne Reden und Kenntnisse, das andere aber zuredend und besänftigend durch Harmonie und Rhythmus mildert?"77 Dadurch wird erst die (gemeinsame) Herrschaft über das Begehrliche möglichJB An einer anderen Stelle betont er, daß die Musik sich am stärksten in die Seele einpräge, und wenn sie selbst wohlanständig sei, Wohlanständigkeiterzeuge. 79 Diese hat einerseits den Vorzug zu wirken, auch wenn die Ver74 So auch K. Gaiser, "Das Gold der Weisheit, Zum Gebet des Philosophen am Schluß des Phaidros"; in: Rhein. Mus. f. Phil. 132 (1989), S. 134 - 136. Nur ein Weissagen dank "göttlicher Schickung" (theia moira) wäre möglich, oder auch mit Hilfe der Musen Dichter zu sein, aber beides hätte nichts mit bewußter Erkenntnis zu tun (Phaidros 244c, 245a; Timaios 71e - 72b). Demgegenüber versteht sich die neuzeitliche Philosophie selbst - mit der platonischen Seelenlehre interpretiert - als ausschließliche Angelegenheit des logistikon. Zu dieser veränderten Selbstsicht der Philosophen seit dem 12. Jahrhundert und ihrer Gründe s. P. Hadot, "Philosophie als Lebensform: Geistige Übungen in der Antike", Berlin 1991; S. 45. 75 Phaidros 248ab (Hervorh. d. Verf.). 76 Zu Platons Angst vor der "Raserei" der Gefühle, siehe Nomoi 782d - 783b; aber auch 835b 842a. 77 Politeia 441 e - 442b; s. auch 411 e. 78 Die Einflußmöglichkeit durch Erzeugung von Furcht oder Sanftheit auf das Begehrliche, wie es im "Timaios" (70d - 72b), physiologisch begründet wird, ist als "therapeutische" Methode des Besprechens wichtig, würde aber alleine nicht genügen. 79 Politeia 401 d. ---------------------_._---~_.- 65 64 nunft noch nicht entwickelt ist, wie etwa bei den Kindern und der übergroßen Mehrheit der Menschen, andererseits ist sie aber gerade auch Voraussetzung für die Erkenntnis der Philosophen, indem erst sie das Vernünftige und das Eifrige zu Verbündeten macht. So hat ja auch der vorgeburtliche Aufstieg zu den Ideen nur eingereiht in den göttlichen Chor gelingen können, der als Einheit von Gesang und Tanz wohl die rechte Mischung von Musik und Gymnastik darstellt. Überhaupt ist der kultische Chorreigen von den Göttern geschaffen worden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich vom Tierischen zu erheben und dem Göttlichen nahe zu sein. Da, wie die "Nomoi" betonen, "in der richtigen Heranbildung [ ... der] Lust- und Schmerzgefühle die Erziehung besteht, so läßt diese bei den Menschen oft in ihrer Wirkung nach und schwindet vielfach in ihrem Leben; die Götter aber haben aus Mitleid mit dem zur Mühsal geborenen Geschlecht der Menschen zu ihrer Erholung von den Mühen die wechselnde Folge der Feste zu Ehren der Götter angeordnet und ihnen die Musen, den Musenführer ApolIon und den Dionysos zu Festgenossen gegeben, damit diese die Feste richtig leiten, und haben ihnen somit die Erziehung geschenkt, die bei den Festen mit Hilfe der Götter geschieht. [ ... ] Die übrigen Lebewesen [ ... haben] kein Gefühl für Ordnung und Unordnung in den Bewegungen, für das also, was Rhythmus und Harmonie heißt; uns Menschen dagegen [haben] dieselben Götter [ ... ], auch das mit Lust verbundene Gefühl für Rhythmus und Harmonie gegeben, und diese [setzen ... ] uns ferner auch in Bewegung und [leiten] unsere Chöre, indem sie uns in Gesängen und Tänzen miteinander zusammenreihen".8o Auffallend ist aber die Beschreibung der Menschen als bloß passiv Empfangender. Gerade das, was ihnen ihre spezifische Menschlichkeit im Unterschied zu den Tieren verleiht - das Gefühl für Rhythmus und Harmonie, ist nicht unmittelbarer und damit unentreißbarer Besitz der Menschen, sondern etwas, das ihnen gegeben wurde. So werden sie auch geleitet; die Feste wurden ihnen angeordnet; die ganze Erziehung ist geschenkt (es läßt sich also über den "Lehrplan" nicht diskutieren); und durch diese Chorreigen werden die Menschen zusammengereiht (d.h. in eine soziale Ordnung gebracht).81 Doch die krasseste Behauptung ist wohl die, daß es die Götter sind, die uns in Bewegung setzen. Nicht nur daß die festliche (und soziale) Ordnung als Rahmenbedingung vorgegeben ist, in der die Menschen sich bewegen könnten, nein, den Menschen sind die eigenen Bewegungen entfremdet: das, was als ihre Aktivität erscheint, ist eigentlich nur das (lustvolle) Erleiden der Aktivität der Götter. So hatte Platon schon vorher seinen Gesprächspartner gedrängt: "Denken wir uns ein jedes von uns lebenden Wesen als eine Marionette der Götter, mag sie nun als Spielzeug für diese oder zu irgendeinem ernsten Zweck zusammengesetzt worden sein; denn das wissen wir ja doch nicht; das aber begreifen wir, daß die erwähnten Gefühle, die gleichsam eine Art Sehnen oder Schnüre in uns darstellen, an uns ziehen, und zwar, da sie einander entgegengesetzt sind, daß sie einander entgegen wirkend uns zu entgegengesetzten Handlungen hinreißen, dahin wo bekanntlich Tugend und Schlechtigkeit voneinander geschieden liegen."82 80 Nomoi 653de (Hervorh. d. Verf.); s. auch Timaios 47d. 81 S. den Zusammenhang von Musik und jeder Unterordnung unter familiäre und politische Obrigkeiten (Nomoi 700b -701c). Der Mensch ist so für Platon jemand, der zwar weiß, daß es das Gute und das Schlechte gibt, doch der gar nicht die Alternative hat, entweder durch zügellose Gefühle in äußere Abhängigkeiten gerissen zu werden, oder in neuzeitlicher Manier als autonomes, tugendhaftes Subjekt diese seiner eigenen Kontrolle zu unterwerfen. Denn ob tugendhaft oder nicht: der Mensch bleibt Marionette. Die eine (goldene) Schnur, die der vernünftigen Überlegung entspricht, soll zwar der Leitfaden sein, kann aber keinen Zwang ausüben. Allein der Neidlosigkeit der Götter ist es zu verdanken, daß diese bereit sind, mittels der Chorreigen den Menschen beim Weg zur göttlichen Tugend und damit zum wahrhaften Seienden zu helfen. 83 Bei einer solchen Subjektskonstruktion, die gerade ein selbständiges "Subjekt"-Sein des Menschen ausschließt, kann "Freiheit" nur negativ bewertet werden 84 , "Selbsterkenntnis" nur die Erkenntnis meinen, von einer notwendigen Eingliederung in eine vorgegebene kosmisch-hierarchischeOrdnung. 85 So kann es auch nicht Ziel des dialektischen Philosophierens sein, eine "selbständige Produktivität" zu entwickeln, wie Szlezak irrtümlich formuliert 86 , denn es sind gerade alle (scheinbar) selbständig Produktiven, die mit ihren Thesen in den platonischen Dialogen scheitern, und diese nicht verteidigen können. Sokrates - der einzige der "produktiv" hilft - erklärt, er selbst sei unfruchtbar wie die Artemis, und gerade das zeichne ihn als Philosophen aus. Seine Lösungsvorschläge seien ihm entweder in Träumen erschienen 87 , oder er habe sie von anderen gehört. Doch darf die Hilfe der Götter nicht mit einer unverdienten Gnade verwechselt werden, oder mit einer Offenbarung im christlichen Sinne. Die göttlichen Gaben sind eher notwendige Hilfen, nicht hinreichende Bedingungen. Indem sie mit der kultischen Musik dafür sorgen, daß man "von Anfang an bis zum Ende haßt, was man hassen, und liebt, was man lieben muß"88, legen sie den Grund für die weitere philosophische Erkenntnisarbeit der Menschen. Denn nur für den Gerechten, d.h. Besonnenen, ist das Gute auch gut, dem Bösen erscheint gerade das Übel als das erstrebenswerte Gute 89 . Das heißt aber: eine von der qualitativen Ordnung der jeweiligen Seele unabhängige Erkenntnis ist nicht möglich. Die psychagogische Wirkung der dialektischen logoi ist zur Verwirklichung der Ideenerkenntnis wohl unverzichtbar, doch muß bei dem jeweiligen Gesprächspartner schon an sich die richtige Einstellung der Seele vorhanden 82 Nomoi 644d - 645a (Hervorh. d. Verf.). 83 Platon bezeichnet als "Glücksfall" (entyches), wenn einige Menschen endlich im hohen Alter Einsicht und festgegründete wahre Meinungen erlangen (Nomoi 653a) und "alle [tun] nur unfreiwillig Unrecht" (Nomoi 860d, Hervorh. d. Ver!.; s. auch Protagoras 345de, 352bff., 358c - e; Gorgias 468c - e, 50ge; Menon 77bff.; Politeia 382a, 413a, 444aff., 589c; Sophistes 228c; Timaios 86de). 84 Nomoi 701 ab. 85 Z.B. Politeia 500c; Timaios 90c; Phaidros 270a - c (s. dazu Pierre Hadot, Philosophie als Lebensform: Geistige Übungen in der Antike; Berlin 1991, S. 128). 86 T. A. Szlezak in dem sonst sehr überzeugenden Artikel "Gespräche unter Ungleichen: Zur Struktur und Zielsetzung der platonischen Dialoge"; Antike und Abendland 34, 1988, S. 109. 87 Charmides 173a; Politeia 443bc; Philebos 20b; Apologie 33bc; Kratylos 439c. 88 Nomoi 653c. 89 Nomoi 661 d. 67 66 sein, denn erst die schon durch die Musik "wohlanständig" gemachte Seele wird sich den schönen logoi verwandt fühlen, und diese daher lieben. 9o So ist es für Platon eine Selbstverständlichkeit, daß eine Vernachlässigung der traditionellen Chorreigen automatisch auch einen Erkenntnisverlust bei den (Philosophen-)Herrschern nach sich zieht 91 . Denn der Verlust der seelischen Harmonie (symphonia) bewirkt, daß "einer etwas, obwohl es ihm schön oder gut scheint, nicht liebt, sondern haßt, das aber, was ihm schlecht und ungerecht erscheint, liebt und werthält"92, also Vernunft und Gefühle sich trennen, was die "äußerste Unwissenheit" bedeutet. Solche Menschen können vielleicht noch schlau ihren Verstand gebrauchen, wie etwa die Sophisten, aber weise sind sie nicht mehr. "Denn wie [ ... ] könnte ohne Einklang (symphonies) auch nur der geringste Grad von Einsicht entstehen? Das ist unmöglich. Vielmehr dürfte der schönste und größte Einklang (symphonion) mit vollstem Recht für die größte Weisheit erklärt werden, woran der teilhat, der nach der Vernunft (kata logon) lebt, während einer, der es daran fehlen läßt, sich als Zerstörer seines Hauses und für den ganzen Staat sich in keinem Fall als Erhalter, sondern sich ganz im Gegenteil bei jeder Gelegenheit als unwissend auf diesem Gebiet erweisen wird."93 Der vielgeschmähte "ethische Rationalist" Platon - war keiner! Wenn er davon sprach, daß niemand freiwillig oder wissentlich böse sei, meinte er nicht, daß die rationale Erkenntnis die Menschen gut mache, sondern gerade umgekehrt: Die gute und besonnene Lebensweise, bei der alle Seelenteile das logistikon als Führer akzeptieren, verschafft letztlich die Erkenntnis. 94 Folglich müssen nicht nur alle diejenigen, die unfähig sind der Vernunft zu folgen, sich der musikalisch-tänzerischen Erziehung unterwerfen, sondern auch die Philosophen! Dies legen auch andere - hier nur kurz zu nennende - Argumente nahe: In der Politeia werden die Philosophen-Herrscher schon prinzipiell nur aus der 90 Politeia 401 c - 402a; zur Ohnmacht der logoi, wenn sie ohne göttliche Hilfe sophistischen Versuchungen ausgesetzt sind, s. Pol. 492de. 91 Politeia 546d - 547a; dies könnte letztlich der Grund sein, warum die Priesterin Diotima aus Mantinea stammt. Denn noch nach dem Tode Platons scheint Mantinea bekannt für ihre traditionelle Einstellung zur Musik gewesen zu sein. So hat Aristoxenos, ein Vertreter der alten, strengen Musik und Gegner ihrer MOdernisierung, diese Stadt besucht, "um die ältere Musik, wie sie dort gepflegt wurde, kennen zu lernen. [ ... ] Auch die Tanzart der Mantineer, [ ... ] fand seinen Beifall. [ ... ] Auch sonst schienen Aristoxenos die Sitten der Mantineer beachtenswert genug, um in einer besonderen Schrift von ihnen zu berichten" (Felix Bölte: "Mantinea", in: Paulys R - E, Hrsg. Georg Wissowa, Stuttgart 1930, Bd. XIV.; Sp. 1326). 92 Nomoi 698a; entscheidend ist der Widerspruch an sich, der in der Seele zwischen der eigenen Meinung, was das Gute sei, und dessen, was man ersehnt, entsteht. Sekundär ist hier, ob diese Meinung das Wahre trifft, oder nicht. Daß sie dem Ziel der Gefühle widerspricht, macht per se ihr eigenes jedenfalls nicht wahrer als das andere. Denn das logistikon selbst wird durch einen solchen seelischen "Bürgerkrieg" geschädigt und geschwächt (Tim. 44a - cl. 93 Nomoi 689d (Hervorh. d. Verf.). 94 Politeia 443de; geordnete Seelen als Bedingung richtigen Benennens: Timaios 42e - 44c; s.a. K. Gaiser, a.a.O., (1989); S. 105 - 140; und P. Hadot zum Platonismus: "Um erkennen zu können, muß man sich selbst umformen. Allein wer die moralische Reinigung vollzieht, ist in der Lage zu erkennen." (a.a.O., S. 37) Gruppe des singenden und tanzenden Wächterstandes rekrutiert 95 ; Frage ist daher nicht, ob sie überhaupt tanzen und singen, sondern nur, ob sie dies auch noch als Erwachsene, d.h. noch im Alter tun. Und genau dies scheint Platon von ihnen zu verlangen. 96 Nimmt ja auch - zweitens - die Erziehungsbedürftigkeit nicht mit der philosophischen Begabung ab, sondern zu. Denn während die unbegabten, "stumpfen" (phaulos) Seelen gerade aufgrund ihrer "Stumpfheit" nicht wirklich verdorben werden können, sind es gerade die philosophischen Seelen, die den Schutz, die Stärkung und Hilfe der Erziehung bedürfen 97 , und "Erziehung" ist für Platon mit den kultischen Chorreigen synonym. Oder wie er betont: "Also scheint ein Gott [ ... ] den Menschen zwei Künste (techna) gegeben zu haben, die Musike und die Gymnastik, für das Mutige in uns und das Philosophische, [ ... ] damit sie zusammenstimmen (symphona), angespannt und nachgelassen, soweit es sich gebührt."98 Und gerade der Philosoph kann auf keine göttliche Hilfe verzichten. Denn bei unphilosophischen Verfassungen - und Platon hatte nur die schlechteste Meinung von den zeitgenössischen Zuständen 99 - kann nur ein "göttliches Geschick" (theon moiran) die philosophische Seele vor der Verderbnis bewahren, die entsteht, wenn ihre Interessen von der Philosophie abgezogen werden. 1oo Drittens war die platonische Akademie als privater Kultverein zu Ehren der Musen organisiert. Pausanias fand zu seiner Zeit in der Akademie einen Altar des Eros, einen Prometheusaltar und einen Altar der Musen vor. 101 Es wäre verwunderlich, hätte man sie nicht auch benutzt, d.h. den damaligen religiöskultischen Gepflogenheiten folgend, nicht auch regelmäßig Chorreigen zu Ehren der Götter aufgeführt. Viertens ließe sich unschwer der platonische "Bericht" im "Phaidon" über die letzten Stunden des Sokrates als aitiologischer Mythos für die akademische Praxis deuten. Die Erzählung, Sokrates wäre so oft im Traum befohlen worden: "mach und treibe Musike". Eine Aufforderung, die er immer als weitere Ermunterung zur Philosophie betrachtet habe, da diese die "vortrefflichste Musike" sei. Doch aus Besorgnis den Traum vielleicht doch mißzuverstehen, habe er noch im Gefängnis die Fabeln des Äsops in Verse gefaßt und einen Vorgesang (prooimion) zu Ehren ApolIons verfaßt. 102 Wenn Platons philosophischer Prototyp in einer so 95 "In der Gymnastik und der Musik aber sind sie [die angehenden Philosophen, M. A.] uns ja [ ... ] schon unterwiesen worden." (Politeia 521e) 96 In den Nomoi bestimmt Platon, daß jeder Bürger von der Geburt bis zum 60. Lebensjahr aktives Mitglied eines singenden und tanzenden Chores zu sein hat. Erst diejenigen, die älter als 60 Jahre sind, dürfen wegen ihrer Gebrechlichkeit darauf verzichten (Nomoi 664d). 97 Politeia 491 e - 495b. 98 Politeia 411e - 412a; beide technai sind vereinigt im Chorreigen (Nomoi 672e - 673b). 99 Z.B. Politeia 497b. 100 Politeia 493a; s. auch die Erinnerungsfunktion der Chöre für Erwachsene: Nomoi 653d. 101 Pausanias 1.31,9; zit. bei Karl Albert, Griechische Religion und Platonische Philosophie, Hamburg 1980; S. 19,61. 102 Phaidon 61b; zur Untrennbarkeit von Versen und Musik bei den Griechen, s. Thrasybulos Geor- --------------------_._--~-"-_.- 69 68 schicksalsschweren Stunde keine andere Sorge hatte, sollten da nicht auch alle, die ihm "nachfolgen" wollten, wie Sokrates gerade an dieser Stelle zweideutig - fordert, ebenso zu Lebzeiten dieser Sorge in der einen oder anderen Weise begegnen? Es hat ja auch Platon - fünftens - explizit im sog. "Philosophenexkurs" des "Theaitetos" den Sophisten dadurch von den wahren Philosophen unterschieden, indem dieser angeblich "nicht versteht, wie ein Freier den [Gesang] nach rechts weiterzugehen, noch die Harmonie der Sprache richtig zu erfassen und das Leben der Götter und glückseligen Männer richtig zu besingen".103 Hermann Koller kommentiert dies: Es "wäre nun doch unbedingt zu erwarten gewesen, daß vom Unfreien nochmals betont würde, er sei unfähig, philosophischen Gedankengängen zu folgen. Stattdessen ist der apeideutos der Mensch, der keine musische Erziehung genossen hat, der beim Gelage den Rundgesang nicht weitergeben kann, der überhaupt gänzlich amusisch ist". Alles nur eine Metapher? Haupteinwand gegen eine Überbewertung des Tanzens und Singens ist wohl Platons eigenes Diktum, Musik und Gymnastik (zusammen mit der Gewerbekunst) gehöre zu den "banausischen" Künsten. Sie seien keine Wissenschaft, nur durch Gewöhnungen wirkend im Werdenden und Vergehenden. 104 So beginnt gerade die speziellere Ausbildung der Philosophen mit einer Abwertung der Chorreigen gegenüber den Wissenschaften (der Arithmetik, Geometrie, Stereometrie, Astronomie, der Harmonielehre und der Dialektik). Doch wird dabei übersehen, daß die Wissenschaften explizit nicht als etwas Neues neben der Musik und Gymnastik angesehen werden, sondern etwas sind, was diesen banausischen Künsten gemeinsam (koinon) sei, d.h. das unreflektierte Gute in diesen wird wissenschaftlich behandelt. 105 Ohne genauer auf dieses giades, Musik und Rhythmus bei den Griechen: Zum Ursprung der abendländischen Musik, Hamburg 1958; und: ders., Der griechische Rhythmus: Musik, Reigen, Vers und Sprache, Hamburg 1949. Das Sokrates zugeschriebene Prooimion an ApolIon und Artemis, das die Antike überlieferte, könnte so aus dem Umfeld der Akademie stammen (s. Anm. 15). 103 Theaitetos 175e; ich folge der Übersetzung und Interpretation dieser Stelle von Hermann Koller: Enkyklios Paideia, Glotta 34 (1955), 174 - 190. Dies und folgendes Zitat S. 177 (Hervorh. d. Verf.). 104 Politeia 522ab. 105 Zusammen mit der Gewerbekunde (nicht zu verwechseln mit einer raffgierigen Chrematistik) setzen die Musik und die Gymnastik gemeinsam implizit das, was die Arithmetik, Geometrie, Stereometrie, die Astronomie und die Harmonienlehre wissenschaftlich behandeln, voraus (Politeia 522bc). Und diese Wissenschaften haben wiederum in gleicher Weise den Gegenstandsbereich, der der Dialektik als obersten Wissenschaft eigen ist, gemeinsam (531 d). Wobei die Wissenschaft der Dialektik nicht von diesen gänzlich abgetrennt werden kann, da sie bei ihrer therapeutischen Aufgabe, die Seele zu "reinigen" und zum Wahren zu leiten, auf deren Hilfe angewiesen bleibt: "Nun aber [... ] geht die dialektische Methode allein [ ... ], alle Voraussetzungen aufhebend, gerade zum Anfange selbst, damit dieser fest werde, und das in Wahrheit in barbarischem Schlamm vergrabene Auge der Seele zieht sie gelinde hervor und führt es aufwärts, wobei sie als Mitdienerinnen und Mitleiterinnen die angeführten Künste gebraucht"(Politeia 533cd). Theoretisch begründet ist dies durch die Beziehung der durch die Dialektik erfaßbaren (göttlichen) Ursachen der Vernunft (den Ideen) und den sinnlichen Ursachen aus Notwendigkeit: "die göttli- Wissenschaftskonzept hier einzugehen, z.B. auf die Frage, was Chorreigen mit der Astronomie zu tun haben, müßte so vor allem einsichtig sein, warum gegen Ende des Bildungsganges der Philosophen, unmittelbar vor der abschließenden Dialektik, die wissenschaftlich behandelten hörbaren Harmonien - also (wieder) die Musik (neben den sichtbaren der Astronomie) als letzte wahrnehmbare "Beispiele" (paradeigmasiY06 für das eigentlich Wahre genannt werden, das die (unsinnliche) Dialektik zu erfassen sucht. Die Musik ist noch dieselbe, nur die Einstellung ihr gegenüber ist nun nicht mehr "banausisch", sondern philosophisch reflektiert. Denn Musik gewährt "den Unverständigen Sinnengenuß, den Verständigen aber intellektuellesVergnügen (euphrosynen) durch die Nachahmung der göttlichen Harmonie,die in sterblichen Bewegungen erfolgt".107 Das kann - sechstens - aber nur heißen, daß es in der Platonischen Akademie eine musikalische Aufführungspraxis gegeben hat, denn in Zeiten ohne Plattenspieler und ähnlicher Hilfsmittel war dies die einzige Möglichkeit, solche sinnlichen Paradeigmata als Hilfsmittel zu bekommen. Jedoch was macht die Musik (mit der Astronomie) zu einem bevorzugten sinnlichen Abbild des wahrhaft Seienden? Denn dies geht über die emotional-erzieherische Funktion der Chorreigen bei der Heranbildung der Seelen weit hinaus. Die Harmonie der Begriffe Alle Wissenschaften waren bis jetzt nur das "Vorspiel", die eigentliche "Melodie" ist erst die Dialektik, wie Platon sagt. 1OS Diese führt er im "Sophistes" mit folgenden Bemerkungen ein: "Der, welcher die Kunst besitzt einzusehen, welche [Töne] sich miteinander vermischen lassen und welche nicht, ist der Tonkünstler, wer dies aber nicht versteht, der Untonkünstlerische. [ ... ] Und bei jeder anderen Kunst und unkünstlerischen Verfahren werden wir anderes Ähnliche finden." Um dann fortzufahren: "Da wir nun zugestanden haben, daß auch die Begriffe (ta gene) sich gegeneinander auf gleiche Weise in Absicht auf Mischung verhalten.' muß nicht auch mit einer Wissenschaft seine Rede durchführen, wer richtig zeigen will, welche Begriffe mit welchen zusammenstimmen (symphonei), und welche einander nicht aufnehmen? Und wiederum ob es solche sie allgemein zusammenhaltende gibt, daß sie imstande sind sich zu vermischen? Und wiederum in den Trennungen, ob andere durchgängig der Trennung Ursache sind?"109 106 107 108 109 che aber muß man, um zu einem glückseligen Leben zu gelangen, in allen Dingen suchen, soweit unsere Natur es gestaltet, die notwendige [Ursache] aber um jener göttlichen willen, indem man überlegt, daß es ohne diese nicht möglich ist, eben jene, um deretwillen wir uns ernstlich bemühen, für sich allein zu verstehen, noch auch sie zu erfassen, noch ihrer sonst irgendwie teilhaftig zu werden" (Timaios 68e - 69a). Politeia 529d - 531c; Timaios 47b - e. Timaios 80b. Politeia 531d - 532a. Sophistes 253bc (Hervorh. d. Verf.); s. auch Philebos 17c - e; und in einer Analogie mit den Tragödiendichtern wirft er den Sophisten vor, "nur die Vorkenntnisse (mathemata epistasai), die zur Harmonie notwendig gehören, aber nicht die Harmonie selbst (au ta harmonika)"zu besitzen (Phaidr.268e). 70 71 Diese analog zur Tonkunst gesehene Wissenschaft, nennt er gleich darauf selbst "Dialektik". Wieder taucht der Begriff der "symphonia" auf. Diesmal, um die sog. symploke ton eidon als solche näher zu charakterisieren. Mit ihr wird nun deutlich, daß Zweifel an der chronologisch-biographischen Aufteilung Platons in einen "frühen" und einen "späten" Vertreter der Ideenlehre angebracht wären, als einer zu vorschnellen Kapitulation vor dem nur scheinbar Unvereinbaren. 110 Die Beibehaltung der formallogischen Reinheit der Ideen bei gleichzeitiger Vereinigung derselben war für Platon denkbar! Denn was versteht Platon unter einer "symphonia"? Bei der Beschreibung der Harmonie der Seele konnten wir dies schon sehen. Dort 111 wird die harmonische Einheit aller Teile erreicht, indem gerade jeder dieser einzelnen Teile "das Seinige" verrichtet; d.h. nicht der aktive Versuch sich mit den anderen zu vereinigen - etwa durch gegenseitige Annäherung oder Vermischung führt zum Ziel, sondern würde gerade die Einheit verhindern. Alle Teile müssen gleichsam "gereinigt" werden. So versucht man ja auch nicht die Töne (eines harmonischen Akkords) miteinander zu vermischen, um nur einen Ton herzustellen, sondern indem man jeden einzelnen der Töne möglichst rein erklingen läßt - verschieden voneinander -, ergibt sich die Harmonie der Klänge. 112 Wobei sowohl die harmonia als auch die symphonia hierarchische Beziehungen zwischen ihren Teilen herstellen. 113 In der Musik zwischen dem höchsten Ton (Hypate), der "Mese" und dem untersten, der "Nete"114; in der Seele von der herrschenden Vernunft über das Mittlere, Eifrige, hinab zu dem Begehrlichen als Unterstem; im Staat die Philosophen über den Wächtern und dem einfachen Volk. Analog werden wohl auch die Ideen zu Begriffspyramiden geordnet. 110 111 112 113 114 Nachtrag: Konrad Gaiser bemerkte schon: "Wahrscheinlich hat man sich auch die Dihairesis der Ideen, da sie bei Platon nach Art einer linearen Einteilung beschrieben zu werden pflegt [... ] im Vergleich mit der Unterteilung der musikalischen Tonskala vorzustellen. [... ]- Unter diesem Gesichtspunkt wäre besonders Sophistes 253B/E genauer zu untersuchen." (ders., Platons Farbenlehre, in: Synusia, Festgabe für W. Schadewaldt, Hrsg.: H. Flashar u. K. Gaiser, Pfullingen 1965; S. 217, Anm. 86) G. Prauss glaubt zu einer solchen Konstruktion Zuflucht nehmen zu müssen: "Vollständig revidiert wird dieser Eleatismus [der .,frühen" Ideenlehre] ... mit der Entdeckung Platons, daß die Ideen keine je für sich bestehenden Einfachheiten darstellen, sondern in Beziehung stehen und, von daher vielfach bestimmt, komplexe [!] Gebilde sind." (ders., Platon und der logische Eleatismus, Berlin 1966: S. 202) Politeia 441 e - 442b. Der Verweis auf Begriff und Phänomen der ,Akkords" ist hier anachronistisch, da die antik-griechische Musik keine Mehrstimmigkeit kannte (s. oben, Fußnote 70). Wie weiter unten die Geschichte des Er zeigt, ist Platon jedoch gezwungen, weil er die Zeitlosigkeitder kosmischen Harmonie darstellen muß, die Vorstellung von gleichzeitig erklingenden, harmonischen Tönen metaphorisch zu nutzen, d.h. gleichsam die Vorstellung eines "Akkordes" zu antizipieren. - Allgemein gilt: "Das Verständnis der H.[armonie] als eines Gefüges, dessen Teile voneinander unabhängig, aber in ihren Bewegungen aufeinander bezogen sind, blieb als Erbe der Pythagoreer und Platons in der Geistesgeschichte des Abendlands wirksam." (Art. "Harmonie", in: Riemann Musiklexikon, S. 362) S. Politeia 617bc. Politeia 432a, 441 e - 442d. Frieder Zaminer, Musik im archaischen und klassischen Griechenland, in: Neues Handbuch der Musikwissenschaften, hrsg. v. Garl Dahlhaus, Laaber 1989; Bd. I. S. 185. So lassen sich die Untersuchungen von H. Koller bestätigen, der die Harmonik als paradigmatisches Vorbild für die anderen griechischen Wissenschaften - speziell für die Logik - aufwies, und zusammenfassend zur dihäretischen Methode erklärte: "Nicht nur die Terminologie der musikalischen Dihärese hat Platon in die dialektos übernommen, sondern die ganze Methode, wie sich in den Regeln zeigt, denen beide Dihäresen gehorchen. Die strenge Zweiteilung (dicha engista), die zahlenmäßige Bestimmung der Einzelglieder (I) und der ganzen Gruppe, ebenso die Begrenzung des an sich unendlichen dichotomischen Prozesses im atmeton oder stoicheion sind nicht primär logische oder mathematische Forderungen. Sie lassen sich nur aus der Dihärese des Harmonikers begreifen.,,115 Erst vor dem Hintergrund einer harmonischen Ideenlehre läßt sich die Rolle des Chorreigen in der Erziehung verstehen. Denn da dieser als Einheit von Musik und Gymnastik nicht nur ein Mittel unter anderen, sondern mit der ganzen Erziehung identisch ist, muß er die Wahrheit und damit Tugend, die er in die Seele der Menschen einprägt, in dem Medium des Musikalischen auf seine Weise vermitteln können, muß dieser ähnlich sein. 116 Und da ja metaphorische Charakterisierungen und Denkmodelle immer vom Bekannteren, d.h. Sinnlicheren, auf das Unsinnliche schließen müssen, bleibt Platon gerade in der Abwertung der sinnlichen Harmonien gegenüber der wahren Dialektik immer dem musikalischen Modell einer Ordnung der Elemente zu einem Ganzen verpflichtet. So wird eine Prädikationstheorie durch diesen Gedanken eines harmonischen Zusammenklangs der Begriffe der wahren Definitionen nicht nur überflüssig, sondern zu etwas Undenkbaren: Denn wer würde in einer Harmonie schon einen Ton zu einem Prädikat seines Nachbartons erklären, sodaß letzterer dann ein Subjekt des ersteren wäre?ll? 115 Hermann Koller, Die dihäretische Methode, Glotta 39 (1961). S. 23 - 24; zur Logik: ders., Das Modell der griechischen Logik, in: Glotta 38 (1959); S. 61 - 74; zum Verhältnis der Musik, der Harmonie der Seele und der des Kosmos s.a.: ders., Harmonie und Tetraktys, in: Mus. Helv. (1959); S. 238 - 248. Weiters allgemein: ders., Stoicheion, Glotta 34 (1955); S. 161 - 174, sowie: ders., Die Anfänge der griechischen Grammatik, in: Glotta 37 (1958); S. 5 - 40; und: Musik und Philosophie, in: ders., Musik und Dichtung im alten Griechenland, (1963); S. 180 - 189. Nachtrag: Erst nach Fertigstellung des vorliegenden Artikels ist mir die Kritik Wilhelm Schwabes an H. Kollers historischen Herleitung des Begriffs "stoicheion" aus der pythagoreischen Harmonik bekannt geworden (in: "Mischung" und "Element" im GriechiSChen bis Platon, Bonn 1980; bes. S. 133 - 147). Schwabe zeigt, daß dieser Begriff wohl doch ursprünglich aus der metrischen Untersuchung der sprachlichen Laute, und somit der Buchstaben, entstammt. Für den von uns behandelten Zusammenhang bleibt - trotz dieser wesentlichen Korrektur - entscheidend, daß Platon diesen Begriff aus der sprachlichen Metrik auch im Bereich der Harmonik verwendet hat, d.h. daß spätestens er sprachliche Laute und musikalische Töne in gleicher Weise als "stoicheia" bezeichnen konnte (Theait. 206ab); gleichzeitig die Ideen mit "stoicheia"verglich, und darüberhinaus - neben allen anderen Bezügen zur Harmonik - einen musikalischen Terminus, wie die "symphonia'~ zur Beschreibung des Verhältnisses der Ideen untereinander für treffend hielt. 116 Die Menschen werden ja eigentlich durch die Ordnung des wahrhaft Seienden selbst geordnet (Pol. 500cd). 117 So mußte Aristoteles als Vertreter einer kategorialen Prädikationstheorie folgerichtig die Harmonik als paradeigma ablehnen. Für ihn war innerhalb des Sinnlichen nur noch die Astronomie dem unsinnlichen, philosophischen Erkenntnisobjekt ähnlich, da am nächsten (Met. XI1.1 073b). Und auch dies Gleichnishafte konnte sie nur sein, nachdem Platons himmliSChe Sphärenharmonie beseitigt worden war (Über den Himmel 11.9). Siehe hierzu auch die Eliminierung der Harmo- 72 Zu zeigen wäre aber noch, was überhaupt erst ermöglicht, daß die verschiedenen Ideen in symphonischen Beziehungen zueinander stehen. Denn abgesehen von indirekten Andeutungen gibt Platon auch eine zwar kurze, jedoch explizite Begründung für die Verhältnisse der Ideen zueinander. An der vielfach diskutierten - jedoch oft mißverstandenen - Stelle des "Sophistes" 248d - 249d betont er: Um erkannt werden zu können, muß das wahre Seiende, d.h. die Sphäre der Ideen, notwendigerweise selbst eine Seele haben. Denn nur "in" dieser, ergo durch diese, sei sie vernünftig, lebendig und vor allem bewegt (kineton). Durch nichts Stoffliches gestörte Bewegungen der Seele sind aber, wie wir sahen, prinzipiell harmonisch! Gleichzeitig sollen die Ideen trotz Bewegung auch der Ruhe (stasis) teilhaftig sein, was innerhalb harmonischer Bewegungen denkbar scheint. Denn auch die Planeten sind in harmonischer Bewegung zueinander geordnet, jedoch bleiben in diesen (idealisierten) kreisförmigen Bewegungen gerade ihre Entfernungen konstant. Die Planeten sind überhaupt nur in ihrer aufeinanderbezogenen Bewegung als Planetensystem zu erfahren. Wären sie unbewegt, man würde ihre konstante Entfernungen für bloßen Zufall halten. Jeder Planet könnte nur als Einzelner betrachtet werden, aber nicht alle gemeinsam als ein Ganzes - als eine Sphärenharmonie. Man fühlt sich dabei an den "Parmenides" erinnert, in dem Platon am Beispiel des "Einen" zeigt, daß die Teile im Ganzen zwar ruhen, aber gleichzeitig das Ganze in Bewegung sein muß.118 All diese Gemeinsamkeiten dürften nicht verwundern, ist doch die Astronomie eines der Paradeigmata der Dialektik. Oder anders gesagt: Sind doch die Planeten "dem vollkommenen und von der Vernunft erkennbaren Lebewesen so ähnlich wie möglich" - d.h. der lebenden, weil beseelten, Sphäre der Ideen. 119 nie und des Bewegt- und Ausgedehntseins der Seele, speziell des Nous, in: deo an. 1.406b26408a30. 118 Parm.145c-146a. 119 Timaios 39de (Hervorh. V. Verf.); das ..vollkommene Lebewesen" bezieht sich explizit auf die vom Demiurgen als Vorbild genommene beseelte Sphäre der Ideen (29ab, 37cd, 92c). Nebenbei bemerkt: Zwischen dieser und dem körperlichen Sein vermittelt eine ..Weltseele" (30b, 36de), die die notwendige Teilhabe des Sinnlichen am Vernünftigen stiften soll. Denn analog der harmonischen Seele des Menschen, die ihren Leib beherrscht und harmonisch macht, lenkt und ordnet die Weltseele alles sinnlich Seiende. In den Nomoi: Wir müssen also ..zugeben, daß die Seele die Ursache (aitia) des Guten und des Schlechten, des Schönen und des Häßlichen, des Gerechten und des Ungerechten und überhaupt aller Gegensätze ist, [... da] wir sie als Ursache von allem [!] annehmen" (896d). So wäre auch eine Interpretation von Parmenides 132bc auf dem Hintergrund der Lehre des Timaios 36d - 37c zu leisten. Denn die Ideen in den Dingen sind ..Gedanken" (noema), aber nicht Gedanken des Erkennenden, sondern Gedanken der Weltseele, die selbst wieder Nachahmungen der Gedanken der Ideenseele sind. So spricht Platon auch der Ideensphäre ..phronesis"zu (Soph. 248e - 249d), obwohl sie ja das ist, was die menschliche Seele erkennen soll- also was neuzeitlich das ..Objekt" wäre. Doch darf ..Gedanke" (noema) bei Platon nicht als ..Subjektives" mißverstanden werden. Die Ideen bleiben auch als Gedachtes Seiendes! Denn die Seele ist für Platon bloß das bewegende und ordnende Prinzip des Seienden, und deren ..Denken" eine das Seiende ordnende Bewegung (s. dazu die aristotelische Darstellung der platonischen Lehre in deo an. 1.407a20: .. notwendig [ist] dieser Kreis der Geist, denn die Bewegung des Geistes ist das Denken") So ist die Seele nicht Subjekt und das Seiende nicht Objekt, denn das Seelische (einschließlich der Gedanken) kann innerhalb dieses Konzepts nicht dem Seienden entgegengesetzt werden: Beide sind sowohl auf der Seite des Erkennenden 73 Das Erleiden einer Bewegung durch die harmonische Seele des wahren Seienden ist so offenbar Voraussetzung für das Erkanntwerden der Ideen durch die harmonische Seele des Philosophen. Denn erkennen, kann man nur das einem selbst "Verwandte" durch eine Einwirkung homoion pros homoion. 120 Beendet wird die "Politeia" bezeichnenderweise von Platon mit dem Mythos des Er. Diese an schamanistische Seelenreisen erinnernde Erzählung der Erlebnisse des Er nach dessen Tode, entwickelt noch eine geradezu musikalische Metaphysik, liefert eine nun mit mythischen Mitteln vorgetragene Begründung der Harmonie als paradeigma. Wie in der Seelen lehre des "Phaidros" steht hier eine antike Theodizee im Mittelpunkt, in der di~ Götter vom Vorwurf der Ungerechtigkeit und der Verantwortung für die Leiden der Menschen freigesprochen werden. Schuldig sind diesmal nicht die Menschen als "ungeschickte Wagenlenker", stattdessen diese als ungeschickte Wähler ihres eigenen Lebensloses. Doch für uns interessanter ist die Beschreibung des von Er gesehenen Zentrums der Welt - einer Lichtsäule als Achse, um die die kreisförmigen acht Sphären des Himmels angebracht sind. Gedreht werden diese nach Art einer "Spindel im Schoße der Notwendigkeit. Auf den Kreisen derselben aber säßen oben auf jeglichem eine mitumschwingende Sirene, eine Stimme von sich gebend, jede immer den nämlichen Ton, aus allen achten aber insgesamt klänge dann ein Wohllaut zusammen (harmonian xymphonein)." Weiters sitzen in gleichen Abständen ringsherum die drei ..Töchter der Notwendigkeit, die Moiren Lachesis, Klotho als auch auf der des Erkannten zu finden. Erkennen ist so nicht das aktive Erfassen passiver Objekte, sondern ließe sich wohl eher als ..Resonanz" -Phänomen zwischen den seelischen Bewegungen im Erkennenden und den seelischen Bewegungen der Ideen charakterisieren. So wie derjenige, der sich mit Harmonischem beschäftigt, selbst harmonisch wird - werden muß (lim. 90cd, Pol. 401d - 402a; s.a. H. Koller: Musik und Philosophie, in: Musik und Dichtung im alten Griechenland, 1963; S. 180). Dies ist eine spezifische Ausprägung einer ..analogischen Kausalität". Der Wissenschaftshistoriker Gerard Si mon zu Platon: ..Wir ermessen nicht mehr, wie zwingend die, während der ganzen Antike konstante und bis ins klassische Zeitalter reichende, rationale Notwendigkeit dessen war, was man eine analog ische Kausalität nennen muß: einzig das Gleiche kann auf Gleiches wirken, oder Entgegengesetztes auf Entgegengesetztes - was, wohlgemerkt, noch eine gattungsmäßige Gemeinsamkeit impliziert." (Der Blick, das Sein und die Erscheinung in der antiken Optik; München 1992, S. 40) Und später zur analogischen Kausalität allgemein: ..die Ähnlichkeit von aktivem und leidendem Teil erklärt die Wirkung des einen auf das andere, und die konstatierte Wirkung wiederum beweist die Ähnlichkeit" (S. 205). So erwähnt auch noch Aristoteles bei der Begründung der erzieherischen Wirkung von Musik die "verwandtschaft" zwischen Seele und Musik, ..weshalb manche Philosophen behaupten, die Seele sei Harmonie, andere, sie enthalte eine solche in sich" (Pol. VII1.1340b17 - 20). 120 S. z.B.: Timaios 45b - d, Politeia 402a. Die Tatsache, daß in Soph. 248de das Problem einer aktiven (poiein) Erkenntnis behandelt wird, der ein bloß passiv leidendes (paschein) Erkanntes gegenübersteht, widerspricht dem nicht. Denn an jener Stelle soll nur die These der sog ...Ideenfreunde" widerlegt werden. Diese behaupten, das zu erkennende Sein (ousia) wäre weder fähig etwas zu erleiden, noch selbst etwas zu tun, da es völlig unbewegt sei. Platon hat daher zu zeigen, daß sogar jemand, der das Sein als unbewegt (und passiv) annimmt, letztlich doch zumindest eine Einwirkung (pathe) - und damit Bewegung - anerkennen muß. Die weiteren Zugeständnisse gehen dann darüber weit hinaus. Als selbst Lebendiges und Beseeltes ist das zu Erkennende aus sich heraus bewegt und damit selbst ,,poiein". 75 74 und Atropos" und singen ,,zu der Harmonie der Sirenen, und zwar Lachesis das Geschehene, Klotho das Gegenwärtige, Atropos aber das Bevorstehende".121 Die kosmische Harmonie der Sphären ist so für Platon die strukturierende Grundlage für alles, was in dieser Welt einmal war, ist und sein wird! Das, was kein Mensch kann, nämlich die gesamte Wahrheit zu kennen und zu sagen, wird von den drei Moiren singend geleistet. Platon kann als Mensch nichts von dem göttergleichen Wissen erzählen, das sie offensichtlich haben, aber er zeigt, was zu einem solchen Wissen offenbar notwendig gehört: jeder ihrer Sätze ist prinzipiell harmonisch! Das Singen scheint ihrem Wissen nicht äußerlich zu sein, da sie erstens die Töchter der Notwendigkeit sind, in derem Schoße die gesamte Harmonie erzeugt wird, zweitens sie selber bei ihrem Singen darauf achten müssen, die drehende Bewegung der Sphären zu erhalten 122, und vor allem, drittens, das Singen ihr Sprechen mit der Harmonie vereinigt. Die eine (zeitlose) Weltharmonie ist so offenbar eine Art apriorische Voraussetzung des wahren Sprechens über die Welt. Der Philosoph kann aus all dem nur folgern, daß die von ihm gesuchte Wahrheit "harmonisch" sein muß 123 und der beste (wenn nicht einzige) Weg, um den chorismos, der das Sinnliche vom Seienden trennt, zu überwinden, der ist, den Gesang als Erziehung hin zur Wahrheit zu gebrauchen, um vorbereitet zu sein, für die dialektische Suche nach den Harmonien der Begriffe. Mögen die sinnlichen Harmonien selbst auch nicht die Wahrheit sein, durch ihre Ordnung und Schönheit kommen sie innerhalb des Vergänglichen dem wahren Seienden noch am nächsten, und verbinden den Menschen schon im Diesseits mit den wahren Worten der göttlichen Moiren im Jenseits. Der von den Göttern ge stiftete Chorreigen verwandelt so zusammen mit dem Eros den chorismos in einen für den Menschen begehbaren Weg! Er ist mit "Erziehung" synonym, da er die Möglichkeit des Menschen über das Tierische hinauszugehen überhaupt erst begründet. Denn es ist der Mensch, der das Schöne an der Harmonie genießt, der das tugendhafte Gute im Harmonischen erblickt und der die Wahrheit in der Harmonie der Begriffe erkennt. Es ist diese Harmonie, in der sich die berühmte, aber auch berüchtigte platonische Einheit des Wahren, des Guten und des Schönen verwirklicht! Resümee Immer wieder fragte Platon, wie etwas gelernt werden könnte, was man nicht weiß. Der erste Schritt der Lösung war die Lehre;daß jedes Lernen ein Wie121 Politeia 617bc (Hervorh. d. Verf.). 122 Mit Bezug zu "Sophistes" 248d - 249d ließe sich wohl sagen, daß dieses mythische Bild die Verbindung zwischen dem Erkennenden und der zum Erkennen notwendigen Bewegung des erkannten wahren Seienden betonen soll. 123 Im "Phaidros" 259d findet sich eine andere mythische Begründung mit dem selben Ziel: Die philosophischen Logoi werden dort den Musen Urania und Kalliope zugeordnet, und diese "sollen doch wohl, wie ihr Name sagt, für die Logoi (Proportionen) der Astronomie und der Harmonielehre [... ] zuständig sein" (K. Gaiser, Das Gold der Weisheit, in: Rheinisches Museum f. Philologie 132/1989; S. 137 Anm. 60). dererinnern früherer Erkenntnis ist. Die zweite Hürde, warum man Erkenntnis nicht unmittelbar hat, wenn man sie doch immer schon besitzt, überwindet im Theoretischen die Unterscheidung zwischen den harmonischen und den disharmonischen Seelen - deren praktische Überwindung ist der singende Chor. Er soll den inneren Bürgerkrieg der drei Seelenteile befrieden, damit diese, dem wahren Sein nachstrebend, sich erinnern, ihr verlorenes Wissen wieder ergreifen und vermittels des Gedächtnisses schon im Diesseits das Jenseitige erneut erlangen. 124 Denn die Griechen waren überzeugt: "Erkennen" kann nur das Gleiche (d.i. hier die harmonische Seele) das ihm Gleiche (die harmonischen Verhältnisse der Ideen).125 So läßt sich also die "symphonia" als das theoretische Grundmodell betrachten, das Platon zur Lösung der Probleme und scheinbaren Aporien heranzieht: Die Seele und die Polis sollen ihre Teile in symphonische Verhältnisse bringen, indem jeder Teil nur "das Seinige" tut. Nur so ist sein Hauptziel, die Tugend, verwirklichbar. Um aber zu wissen, was jeweils das spezifisch "Seinige" für jeden Einzelnen ist, muß jeder zuerst wissen, wer bzw. was er ist. Nicht eine psychologische Selbstbetrachtung, sondern die Befolgung des apollinischen "Erkenne Dich selbst!" ist verlangt, d.h. das Erkennen seines eigenen Platzes in der Ordnung des Kosmos, als Mensch, und in der Polis, als Mitglied seines Standes mit spezifischen Aufgaben. 126 Dies ist wiederum nur möglich, wenn man weiß, was "Gerechtigkeit", die verschiedenen "Tugenden", das "Gute" als Ganzes ist. Also wenn man sich der Ideen erinnert und über ihre Verhältnisse zueinander Bescheid weiß, jede in einer dihäretischen (harmonischen) Ordnung definieren kann. Ein Ziel, das auf dem Wege des ritualisierten, gemeinsamen dialektischen Gesprächs erreichbar ist 127 , das als Wahrheitskriterium nur die symphonia der im Laufe des Gesprächs aufgestellten Hypothesen und behaupteten Logoi verwenden kann. 128 Derdahinterstehende Grundgedanke Platons müßte wohl so formuliert werden: Würde alles und jedes im gesamten Kosmos immer nur das Seinige tun, wäre auch alles miteinander in Harmonie wie es die Ideen - als wirklich Seiende - von Haus aus immer schon sind!129 ' 124 Die Unordnung als Krankheit der Seele führt neben anderen Unannehmlichkeiten - zur Vergeßlichkeit (Timaios 87a). 125 Von den harmonischen Proportionen zwischen den Seelenteilen sind noch die harmonischen Proportionen der "Bewegungen" im (unsterblichen) logistikon (sowie innerhalb der anderen Seelenteile) zu unterscheiden. Alleine das harmonische logistikon erkennt im engeren Sinne, wobei dieses aber ohne die erstere nicht erhalt- bzw. erreichbar ist (s. z.B. Timaios 8ge - 90d, 91e). Nur der, dessen Seelenteile harmonisch sind, kann diese zu einer ganzen, harmonischen Seele zusammenfügen - und vi ce versa. 126 Diese Forderung nach einer Eigenständigkeit bei einer hierarchisierenden Ordnung der Gesellschaft ist nicht spezifisch Platonisch, sondern - wie E. Gellner zeigt - eine für vorindustriell-traditionale Gesellschaften übliches arbeitsteiliges Ordnungsmuster (Ernst Gellner, Nationalismus und Moderne, Berlin 1991, Kap. 2: Kultur in der Agrargesellschaft, S. 18 - 33). 127 S. P. Hadot, a.a.O., S. 143. 128 Phaidon 100a (logoi); 101 d (hypotheseis). 129 Es wäre Wert zu untersuchen, ob die zwei obersten Prinzipien der indirekten Überlieferung, das (begrenzende) "Eine" und die "Unbegrenzte Zweiheit", nicht aus der Harmonik stammen (einschlägige Stellen hierfür wären z.B.: Tim. 35a, 37a). Denn wie H. Koller schon 1959 erklärte: "Die Entdeckung der mathematischen Gesetze, die das apeiron der Töne in das peras der 10- 77 76 Das erstrebte Ziel der platonischen Wissenschaft ist so nicht das Herstellen von einem neuen Produkt, im Sinne einer neuzeitlichen "Erfindung", sondern der harmonische Mensch, der durch seine Reden, Taten und vor allem gosbestimmten harmonia verwandeln, hat nicht nur die pythagoreische Akustik hervorgebracht, sondern die Wissensgebiete der Arithmetik, Geometrie und Astronomie zum erstenmal strukturiert." (Das Modell der griechischen Logik, S. 73) Das dieser Zusammenhang Platon bekannt war, zeigt "Philebos" 25de, wo er über das aus dem Begrenzten und dem Unbegrenzten Zusammengesetzte handelt, und dieses "durch Einbringung einer Zahl in das rechte Verhältnis und zur Harmonie (symphonia) bringt". Und als prägnantes Beispiel wieder die Musik nimmt: Denn "wenn in Hohes und Tiefes, in Schnelles und Langsames, die unbegrenzt (apeirois) sind, eben dieses selbige [die Zahl] hineinkommt, schafft dies nicht zugleich Begrenzung und die gesamte [!] Musike (mousiken sympasan) aufs vollkommenste?" (26a). Wobei für Platon die Philosophie als vortrefflichste Musike (Phaidon 61 a) wohl Teil der gesamten ist. Für eine Interpretation der Prinzipienlehre an Hand des akustischen ,,paradeigma" spräche auch, daß etwa H. J. Krämer als führender Verfechter der indirekten Platonüberlieferung, auf der Suche nach den schriftlichen Auswirkungen der ungeschriebenen Lehre, betont: "daß in der ,Politeia' selbst die Vorstellungen der Ordnung und der Einheit weitgehend alternieren: Die oberste Norm des Staates wird im 4. und 5. Buch immer wieder dahin beschrieben, er solle Einersein, nicht aber viele. Aber auch der Einzelne soll in sich einig sein [ ... ] und auch nur ein Geschäft betreiben, damit er Einersei und dadurch auch den Staat zu Einem mache. Die Idee des Guten ist also in der ,Politeia' nicht nur Prinzip und Vorbild von Ordnung, sondern auch geradewegs Prinzip von Einheit" (Die grundsätzlichen Fragen der indirekten Platonüberlieferung, in: Idee und Zahl, hrsg. v. H. G. Gadamer u.a., Heidelberg 1968, S. 132). Also dazu gerade Themenbereiche heranzieht, in denenwie wir gesehen haben - Platon explizit von symphonischen Einheiten spricht. Das "Eine" als Prinzip von harmonischen Einheiten könnte helfen zu verstehen, warum das "Eine" so eng mit dem "Guten" und "Schönen" verbunden ist. Denn schön ist nicht ein bloß Eines, sondern nur eine schön strukturierte (harmonische) Einheit (Tim. 87cff.; Arist. Met. XIV. 6. 1093ab). Dasselbe würde Platon wohl vom ethisch Guten sagen. Denn wie dieses muß jede Harmonie durch die richtige Plazierung des mittleren Tones (mese) zwischen den beiden äußeren (Extremen), sowohl ein unharmonisches Zuviel als auch ein Zuwenig vermeiden. So würde das "Eine" als "Maß" im Vielen wirken. Es könnte vielleicht ein "schwieriges Problem", wie K. Gaiser es nennt, lösen: Wieso von den Pythagoreern (und in gleicherweise von den Platonikern) "neben der prinzipiellen Gegenüberstellung von en und plethos auch die Lehre bezeugt ist, das Eine (en, monas) umfasse beides, Peras undApeiron" (K. Gaiser, Platons Menon und die Akademie, in: Archiv!. Gesch. d. Phil. 46, 1964; S. 249. Anm. 18). Denn das harmonisch Eine ist als Eines zwar dem Vielen entgegengesetzt, gleichzeitig ist es aber auch eine Einheit von Vielen. Das Auffinden von Harmonien - auch im Bereich der Ideen - würde als übergeordnetes Ziel des platonischen Denkens die zwei philosophischen Methoden in ihrer Ausrichtung verbinden, "die in der platonisch-akademischen Ontologie gleichberechtigt nebeneinander standen: die von Sokrates herkommende, auf das Allgemeine abzielende Dialektik der Arten und Gattungen - und die vom mathematisch-pythagoreischen Gedankenkreis bestimmte Elementenanalyse, die die Wirklichkeit auf ihre letzten, kleinsten Bestandteile zurückführt" (H. J. Krämer, Über den Zusammenhang von Prinzipienlehre und Dialektik bei Platon, in: Philologus 110, 1966; S. 51). Neues Licht fiele auch auf die Frage, warum diese Prinzipien zwar nicht unsagbar, aber doch ungeschrieben bleiben sollten (T. A. Szlezäk, Gespräche unter Ungle1chen, in: Antike und Abendland 34, 1988, S. 100). Denn so wichtig eine theoretisch-prinzipielle Begründung der harmonischen Strukturen auch wäre, harmonisch macht sie deshalb noch nicht. Ihre Bedeutung ließe sich nicht erfassen, wenn man nicht schon die überall herrschende Harmonie in der Welt sehen und erfahren gelernt hat. Allein durch die Prinzipien könnte keine einzige Idee in ihren harmonischen Verhältnissen erkannt werden. So eignete sie sich nur als theoretischer Schlußstein einer langen Erziehung, die erst die Seele den nachfolgenden Erkenntnissen "verwandt" macht, um im Gegensatz zu den bloß vernünftelnden Sophisten einen wirklich philosophischen Gebrauch von ihnen machen zu können, also die aufgestellten logoi jederzeit in ihrer Harmonie erkennen und gegen alle unharmonischen Einwände verteidigen könnte. Daher würde auch die seelenlose(!) Schrift (Phaidros 276a) immer eine (harmonische) Seele zur mündlichen Verteidigung brauchen. durch sein Fühlen sich in die kosmische Harmonie integriert130 , sodaß er bei besonderer Begabung auch eine theoretische Einsicht in die bestehende Gesamtharmonie der Welt (bewirkt durch die Weltseele), des wahren Seienden und der benötigten in der Polis bekommt 131 - ohne diese Begabung aber freiwillig die Leitung seines Lebens Wissenden überantwortet. Führt einerseits die Angst vor anarchischer Auflösung der Staaten und der menschlichen Kultur zu egalitären Tendenzen, da alle zur apollinischen Selbsterkenntnis gebracht werden müssen 132 , wird andererseits durch diese eine allgemeine Zensur und geheimdienstliche Kontrolle zu etwas Gefordertem. Die Wahrheit der Idee ist weit und der Weg lang und gefährlich, jeder Irrtum und jedes Abweichen vom einzig richtigen Pfad führt in die Katastrophe. Dies sind die Voraussetzungen für eine Art von permanenter "Initiation", da der allgemeine Konsens nur durch eine fast verhaltenstherapeutische Konditionierung erreichbar scheint, um nicht das harte Wort der "Dressur" zu gebrauchen. 133 Vorbild ist daher eher das straff organisierte Sparta, das seine Gesetze auf ApolIon zurückführt, während dessen Schwester, die Artemis( -Orthia), als Stadtgründerin über die Gemeinschaft der Spartaner wacht 134 , in130 Timaios 90c; Phaidros 270a - c; s. auch P. Hadot: "Der Weise in der Antike ist sich zu jedem Augenblick bewußt, daß er im Kosmos lebt, und paßt sich dem Weltall an, so daß er sich mit ihm in Einklang befindet." (a.a.O., S. 116; speziell zu Platon: S. 128) 131 S. dazu: Konrad Gaiser, Die Rede der Musen über den Grund von Ordnung und Unordnung: Platon, Politeia VIII 545d - 547a; in: Studia Platonica, Festschrift für H. Gundert, Hrsg. K. Döring u. W. Kullmann, Amsterdam 1973, S. 49 - 85. 132 Zumindest in der Form einer wahren doxa, wenn derjenige zu einer Erkenntnis des Wahren nicht fähig ist, denn das genügt für ein tugendhaftes Leben (Menon 97b). Es "ist das, was heutzutage bei uns zulande geschieht, der Gipfel der Unvernunft, daß nämlich nicht mit aller Kraft alle Männer und Frauen einmütig dieselben Übungen ausführen" (Nom. 805a). 133 Ziel ist, daß "ein jeder, Erwachsener und Kind, Freier und Sklave, Frau und Mann, ja der ganze Staat dem ganzen Staat ohne Unterlaß (me pauesthai) die von uns besprochenen Grundsätze als einen Zauber vorsingen muß, und zwar mit allen möglichen Abwandlungen und in der größten Mannigfaltigkeit, so daß daraus für die Sänger eine Art Unersättlichkeit nach Hymnen und Lust daran erwächst" (Nomoi 665c; s.a. 803e). Denn: "Hier also [ ... ] müssen sich wie es sCheint unsere Wächter ihre Hauptwacht erbauen, in der Musik." (Politeia 424d) 134 Walter Burkert: "Demaratos, Astrakos und Herakles: Königsmythos und Politik zur Zeit der Perserkriege", in: ders. (1990), S. 86 - 95; Ziehen, L.: "Sparta (Kulte)", in: PW Sp. 1467 - 1471; als der platonische Sokrates sich, und damit alle Philosophen, als "Hebammen" bezeichnete, dachte er vielleicht auch an die Artemis Korythalia in Sparta. Denn "ihr zu Ehren wurden obszöne Tänze aufgeführt, und die Ammen trugen die Säuglinge am Fest der Titheniden zu ihrem Tempel, um ihren Schutz zu erflehert' (Nilsson [1955], Bd. I. S. 123). Wobei er wohl dem Sexuell-obszönen ablehnend gegenüber gestanden ist. So hat er sich ja gerade in dem Dialog auf die gebärunfähige, da jungfräuliche Artemis berufen (149b), in dem er sich ausführlich mit Heraklit auseinandersetzt. Wo er dessen "Flußtheorie" als älter als Homer bezeichnet und deren Anhänger von ihm allgemein diejenigen "zu Ephesos" genannt werden (Theaitetos 17ge). Ephesos war aber in der Antike erst in zweiter Linie für ihren Sohn Heraklit bekannt; das Artemisheiligtum, eines der 7 Weltwunder, war berühmter. Doch die dort verehrte Artemis war nicht die jungfräuliche, sondern im Gegenteil eine vielbrüstige, orgiastische Fruchtbarkeitsgöttin orientalischen Ursprungs (Wernicke: ,,Artemis", Sp. 1372 - 1373; Schreiber: "Artemis", Sp. 588 - 593). Heraklit hat mit der Betonung des ewigen Vergehens und Wiedererstehens der Welt eine Lehre vertreten, die die "widerstreitende" Harmonie des ApolIon (DK 22B8, 22B51) durch Vorstellungen interpretiert, die den religiösen Anschauungen eines Fruchtbarkeitskultes entstammen könnten. So behauptet die antike Überlieferung auch, daß dieser sein Werk über die Natur im Artemistempel in Ephesos hinterlegt habe (Diogenes Laertios IX.6). Es war auch dieses Artemi- 78 dem sie in den von ihr "geleiteten" Initiationsriten "Hebammendienste" an den dortigen Knaben vollbringt. Ihr wird die Aufgabe zugesprochen diese zu Männern zu erklären und in die spartanisch(-menschliche) Kultur zu initiieren. So wird die Breite des chorismos zur Begründung für die absolute Herrschaft der Philosophen und die religiös-kultische Musik zu deren Mittel. Geleitet werden diese Chöre (gemeinsam mit Dionysos), dessen ist sich Platon gewiß, von ApolIon - dem Gott der Harmonie!135 sion, in das er sich - frustriert vom politischen Leben seiner Stadt - angeblich zurückzog (IX.3). Ob die Erklärung Heraklits, des Dunklen, sein Werk sei nur verständlich, wenn ein Eingeweihter (mystes) den Leser leitet (IX.16), mit dem dortigen Kult etwas zu tun hat, ist wohl nicht mehr zu entscheiden, wobei seine rationalisierte Gottestheorie sicher nicht mit der praktizierten Volksreligion verwechselt werden darf. Doch indem Platon Heraklits Lehre als "ephesisch" und "vorhomerisch" kennzeichnet, rückt er ihn in deren Nähe und bestätigt den antik-theologischen Hintergrund seiner Ablehnung, die der in Delphi vertretenen Deutung der olympischen Götterverpflichtet ist. 135 Kratylos 405d; Im Angesicht des eigenen Todes erklärt Sokrates, er selbst sei ein Diener des ApolIon und ebenso wie die ,,singenden Schwäne" diesem Gott heilig! Platon erklärt damit die Hinrichtung des Philosophen Sokrates' zu einem Frevel an ApolIon, der durch ihn gewirkt habe (Phaidros 84e - 85b). WIENER JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE BEGRÜNDET VON ERICH HEINTEL HERAUSGEGEBEN IN ZUSAMMENARBEIT MIT MICHAEL BENEDIKT / KLAUS DETHLOFF / KAREN GLOY TRAUGOTT KOCH / WOLFGANG MARX / ERHARD OESER JOHANN REIKERSTORFER / WOLFGANG SCHILD WOLFDIETRICH SCHMIED-KOWARZIK WOLFGANG SCHRADER / WILHELM SCHWABE VON HANS-DIETER KLEIN Band XXVI1/1995 WILHELM BRAU MÜLLER • WIEN Universitäts-Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H.