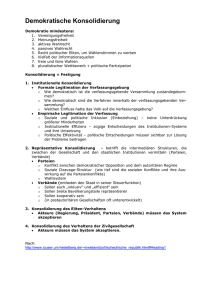ZIP - FreiDok plus
Werbung

Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels Wissenschaftliche Arbeit angefertigt im Rahmen der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien an der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau im Fach Politikwissenschaft vorgelegt von Holger Blaul aus Bissersheim WS 2005/2006 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ......................................................................................................... iv Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................ iv Einführung............................................................................................................................. 1 1. Demokratische Konsolidierung als Teil des Systemwechsels........................................... 4 1.1 Der Wandel von autoritären / totalitären zu demokratischen Systemen............................. 4 1.2 Das politische System, der Begriff des Systemwechsels und Systemwechseltypen.......... 5 1.3 Globale und regionale Wellen demokratischen Systemwechsels....................................... 7 1.4 Systemwechselforschung - Die drei Phasen des Systemwechsels...................................... 8 2. Die Konsolidierung der Demokratie - Die dritte Phase des Systemwechsels ................ 10 2.1 Der Demokratiebegriff der Konsolidierungsphase............................................................ 11 2.1.1 Das minimalistische Demokratiekonzept................................................................... 11 2.1.2 Das maximalistische Demokratiekonzept .................................................................. 12 2.2 Ein Konzept zur Analyse demokratischer Konsolidierung............................................... 15 2.2.1 Die Konsolidierungsphase als offener oder endlicher Prozess? ................................ 15 2.2.1 Ziele demokratischer Konsolidierung ........................................................................ 17 2.2.2 Analyseebenen, Akteursbeziehungen und Merkmale der demokratischen Staatsform ................................................................................................................... 17 Zusammenfassung............................................................................................................... 20 3. Systemwechsel in Südafrika: Transformation und demokratische Konsolidierung .... 21 3.1 Die Phasen der südafrikanischen Transformation............................................................. 21 3.1.1 Die Liberalisierungsphase - Kolonialismus, Apartheid und Krise ............................ 21 3.1.2 Die Demokratisierungsphase - die ‚negotiated revolution’ ....................................... 26 3.2 Das neue Südafrika - Der Konsolidierungsprozess der Demokratie ................................ 28 3.2.1 Die politische Kultur ................................................................................................... 28 3.2.2 Politischer Wettbewerb und Pluralismus innerhalb der Gesellschaft?...................... 30 3.2.3 Partizipationsformen und Interessenrepräsentation ................................................... 32 3.2.4 Substantielle und prozedurale Legitimation der Regierungsinstitutionen................. 34 3.2.5 Das Prinzip der horizontalen Verantwortlichkeit....................................................... 38 Zusammenfassung: Probleme demokratischer Konsolidierung in Südafrika.................. 40 4 Beschäftigung mit Vergangenheit in politischen Systemen nach Systemunrecht .......... 41 4.1 Erinnerung oder Vergessen? Grundsätzliches zur gegenwärtigen Vergangenheit .......... 42 4.2 Der Begriff der Vergangenheitspolitik und seine realpolitischen Inhalte ........................ 43 4.3. Konzept zur Analyse des Politikfeldes Vergangenheitspolitik........................................ 45 4.3.1 Akteure, akteursbezogene Analyseebenen und Ausgangssituation der Vergangenheitspolitik................................................................................................. 46 4.3.2 Handlungsziele der Vergangenheitspolitik ................................................................ 48 4.3.3 Überblick vergangenheitspolitischer Handlungsfelder und Handlungsoptionen...... 49 4.4 Vergangenheitspolitik innerhalb der Konsolidierungsforschung ..................................... 52 Zusammenfassung............................................................................................................... 54 5 Politikfeldanalyse der südafrikanischen Vergangenheitspolitik..................................... 56 5.1 Akteure, akteursbezogene Analyseebenen und Ausgangssituation der südafrikanischen Vergangenheitspolitik ....................................................................................................... 57 5.2 Handlungsziele der südafrikanischen Vergangenheitspolitik ........................................... 60 5.3 Vergangenheitspolitische Handlungen in Südafrika: Zustande gekommene und ausgebliebenen Maßnahmen............................................................................................. 63 5.3.1 Normbezogene Handlungen ....................................................................................... 63 5.3.2 Institutionenbezogene Handlungen ............................................................................ 66 5.3.3 Handlungen bezüglich der Tätergruppe ..................................................................... 73 5.3.4 Handlungen bezüglich der Opfergruppe .................................................................... 80 5.4 Erschwerende Bedingungen vergangenheitspolitischen Handelns in Südafrika ............. 90 Zusammenfassung............................................................................................................... 95 6. Die Rolle der südafrikanischen Vergangenheitspolitik innerhalb des demokratischen Konsolidierungsprozesses - Empfehlungen zum ‚unfinished business’........................... 100 6.1 Vergangenheitspolitik und ihre Auswirkungen auf die politische Kultur ...................... 100 6.1 Politischer Wettbewerb, Pluralismus und Vergangenheitspolitik .................................. 101 6.2 Die Auswirkungen der Vergangenheitspolitik auf Partizipationsformen und Interessenrepräsentation.................................................................................................. 102 6.3 Vergangenheitspolitik und ihre Auswirkungen auf die substantielle und prozedurale Legitimation der Regierungsinstitutionen ...................................................................... 103 6.4 Vergangenheitspolitische Auswirkungen auf die horizontale Verantwortlichkeit......... 105 Zusammenfassung: Die Ziele von Vergangenheitspolitik und demokratischer Konsolidierung - Wegbereiter oder Hindernisse?............................................................ 105 Schlussbetrachtung............................................................................................................ 107 Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 110 Appendix: Liste der interviewten Expertinnen Experten................................................ 119 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Politische Karte des heutigen Südafrika........................................................................... ii Abb. 2: Die ‚Homelands’ in Apartheid-Südafrika ........................................................................ ii Abb. 3: Das Kontinuum politischer Systeme................................................................................ 4 Abb. 4: Analyseebenen, Akteursbeziehungen und Merkmale demokratischer Staatsform .......... 19 Abb. 5: Ziele und Einflussfaktoren auf die Vergangenheitspolitik im Systemwechsel ................ 46 Abkürzungsverzeichnis ANC African National Congress AZAPO Azanian People’s Organisation BEE Black Economic Empowerment SACP South African Communist Party BIG Basic Income Grant SALRC South African Law Reform Com- CODESA Conference for a Democratic South Africa COSATU CRLR SABC South African Broadcasting Corporation mission SANDF Congress of South African Trade South African National Defence Force Unions SANGOCO South African NGO Coalition Commission on the Restitution of SAPS South African Police Service Land Rights SDUs Self Defence Units (früher dem DA Democratic Alliance EG Europäische Gemeinschaft GEAR Growth, Employment and Redistri- ANC zugehörig) SPUs Self Protection Units (früher der IFP zugehörig) bution TAC Treatment Action Campaign GNU Government of National Unity TRC Truth and Reconciliation Commis- IFP Inkatha Freedom Party KSG Khulumani Support Group VSP Voluntary Severance Package LPM Landless People’s Movement KZN KwaZulu-Natal MK Umkhonto we Sizwe UDF United Democratic Front NPA National Prosecution Authority UN United Nations NP/NNP National Party / New National Party UNDP United Nations Development Pro- OAU Organisation of African Unity RDP Reconstruction and Development Programme sion of South Africa gramme VF Plus Freedom Front Plus Abb. 1: Politische Karte des heutigen Südafrika (Ross 1999: 191) Abb. 2: Die ‚Homelands’ in Apartheid-Südafrika (Wilson 2001, a: xii) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 1 ____________________________________________________________________________________________________________________ Einführung „One of the most difficult challenges facing transitional regimes is the problem of the past [HB, Hervorhebung im Original]. Regimes undergoing transitions from dictatorial to democratic government are often faced with dealing with their histories in one form or another, since it is rare that those who fought for and against democratic change are willing to ‘simply forgive and forget’. How new regimes deal with the past has much to do with the likelihood that their democratic transitions will be successfully consolidated.” (Gibson 2002: 540) Die klassische Systemwechselforschung gesteht jedoch der ‚Vergangenheitspolitik’1 keine besondere Bedeutung zu (vgl. Höchst 2003: 23). Aufgrund der politischen Wende in den Ländern des ehemaligen Ostblocks nach Ende des Kalten Krieges konzentriert sich die Systemwechselforschung mittlerweile auf die Phase der demokratischen Konsolidierung, in der sich eben diese Länder derzeit befinden. Die Vergangenheitspolitik wird zwar in der Transformationsphase des Systemwechsels ausgehandelt, jedoch in der Zeit, in der sich das neue System stabilisiert, aus- und weitergeführt. So ist ein größerer Einfluss der Vergangenheitspolitik auf die demokratische Konsolidierung zu vermuten, und es stellt sich die bisher noch nicht ausreichend beantwortete Frage, welche Rolle die Vergangenheitspolitik innerhalb der demokratischen Konsolidierung spielt? Die Vergangenheitspolitik Südafrikas wurde durch die dort eingesetzte Wahrheitskommission und deren weitreichende Kompetenzen und Zielsetzungen berühmt. Die alltäglich wahrnehmbaren sozialen, kulturellen, sozioökonomischen und politischen Auswirkungen der jahrzehntelangen Trennung und Diskriminierung von bürokratisch eingeteilten Rassengruppen beweisen eine Gegenwärtigkeit der Vergangenheit in Südafrika. Die Fülle der Medienberichte zu vergangenheitspolitischen Themen zeigen, dass das politische System immer noch tiefgreifend vom Vorgängersystem der Apartheid beeinflusst wird.2 Die Apartheid- und Vergangenheitspolitik Südafrikas sind einzigartige politische Phänomene, und daher ist es für die Konsolidierungsforschung von Interesse, anhand des südafrikanischen Fallbeispiels die Rolle der Vergangenheitspolitik im demokratischen Konsolidierungsprozess auszuloten, das heißt den Rahmen neu zu setzen. Der Übergang vom Apartheidstaat zur Demokratie wird in Südafrika und anderswo oft als „the miracle“ (Calland/Graham 2005: 3) bezeichnet. Dieses Wunder wird in der Hinwendung zu einem politischen System gesehen, das sich eine Verfassung zugrunde legte, die pluralistische und liberale Prinzipien konstituiert, demokratische Strukturen fordert, die universellen Menschenrechte festschreibt und sich dadurch entsprechend vom Vorgängersystem absetzt. Durch diese festgeschriebenen Werte konnte eine weitgehend friedliche Transformation erreicht werden, die die konkurrierenden Akteure einstweilen zufrieden stellte. Der Verfassungsgebungsprozess, ob Wunder oder nicht, 1 Der Begriff Vergangenheitspolitik wird von Norbert Frei durch sein Buch Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit (1996) eingeführt. 2 Die Website http://www.int.iol.co.za liefert einen beispiellosen Überblick mit detaillierten Suchfunktionen über die südafrikanischen Printmedien und deren Berichterstattung u.a. auch zum Thema Vergangenheitspolitik. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 2 ____________________________________________________________________________________________________________________ wurde von einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit begleitet und bestimmt. Daher sah die Verfassung auch die Einsetzung einer Wahrheitskommission vor - die ‘Truth and Reconciliation Commission of South Africa’ (TRC), die mit der Aufgabe betraut wurde, zur Konsolidierung der jungen Demokratie in den Bereichen Wahrheitsfindung, ‚Nation-building’ und Versöhnung der einzelnen Gesellschaftsgruppierungen innerhalb der Republik Südafrika beizutragen. Die TRC veröffentlichte im Jahr 1998 ihren vorläufigen Abschlussbericht (vgl. TRC-Bericht, a: Band 1, Kap. 1, Abs. 6), dem 2002 die Veröffentlichung zu den Opfern und am 21. März 2003 noch der endgültige Abschlussbericht folgte, nachdem auch das Amnestiekomitee seine Arbeit formal beendet hatte (vgl. TRC-Bericht, a). Trotz der Errungenschaften der TRC und weiterer vergangenheitsbezogener Normen und Institutionen, existieren noch viele ungelöste Probleme im Bereich der Vergangenheitspolitik. “There is a huge amount of unfinished business in South Africa relating to the country’s past. Failure to deal with it leaves the country crippled in many ways. It is also generally agreed that the past must be confronted in order to have any real hope of progressing openly and democratically in the future. Yet how much have we really confronted the past?” (Bell 2001: 1) Durch die kurze Skizzierung des bisherigen südafrikanischen Systemwechsels und die pointierte Darstellung Terry Bells zum Stand der südafrikanischen Demokratie stellen sich zwei grundlegende Fragen: - Vor welche Herausforderungen sieht sich die südafrikanische Demokratie in ihrem Konsolidierungsprozess gestellt? - Welche Rolle spielt die Vergangenheitspolitik im Konsolidierungsprozess der südafrikanischen Demokratie, und kann die weiterführende politische Beschäftigung mit der Vergangenheit den Prozess demokratischer Konsolidierung fördern? Um die erste Frage zu beantworten, ist es notwendig aufzuzeigen, wie der südafrikanische Transformationsprozess verlief und welche Folgen dieser Prozess für die Konsolidierung der Demokratie hatte. Des Weiteren muss eine Analyse der Konsolidierung vorgenommen werden, um die Problembereiche des Prozesses lokalisieren und benennen zu können. Zur Bewältigung dieser Aufgabe wird im ersten und zweiten Teil dieser Arbeit Bezug auf die Systemwechsel- und Konsolidierungsforschung genommen, mit deren Hilfe die Fallstudie in einen theoretischen Kontext eingeordnet wird. Daraufhin wird ein Analysekonzept aufgebaut, welches dann im dritten Teil der Arbeit durch die Untersuchung der Konsolidierungsphase der südafrikanischen Demokratie leitet. Ein weiteres Analysekonzept zur Untersuchung des Politikfeldes Vergangenheitspolitik wird dann im vierten Teil der Arbeit erstellt, das Bezug auf die grundsätzliche Beschäftigung mit der gegenwärtigen Vergangenheit nimmt. Dieses Analysemuster führt im fünften Teil der Arbeit durch die Analyse der südafrikani- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 3 ____________________________________________________________________________________________________________________ schen Vergangenheitspolitik und ermöglicht die strukturierte Lokalisierung und Benennung von bisherigen Handlungen und derzeit noch ungelösten Aufgaben. Eine Zusammenführung der beiden Themenkomplexe Vergangenheitspolitik und demokratischer Konsolidierungsprozess wird dann im sechsten Teil vorgenommen. Die bisherigen Auswirkungen der Vergangenheitspolitik auf die demokratische Konsolidierung in Südafrika werden neben dem noch aktivierbaren Potential der Beschäftigung mit Vergangenheit für den Fall Südafrika dargestellt. Experteninterviews und Vorortrecherche Mit Hilfe von Experteninterviews, die in Südafrika durchgeführt wurden, konnte eine Sensibilität für die Thematik und dessen derzeitige Brisanz entwickelt werden.3 Durch die Gespräche mit Politikwissenschaftlern südafrikanischer Universitäten entstand die Idee zur Verknüpfung der Beschäftigung mit Vergangenheit nach Systemunrecht und der Politikfeldforschung. Das Erkennen eines „policy-gaps“ (Interview Ian Liebenberg 29.08.2005: 1/33) ermöglicht es, ein ganzheitliches Bild der Vergangenheitspolitik in Südafrika entstehen zu lassen, da nur die Analyse des ‚policy-output’ der Regierung nicht ausreichend für dieses Ziel ist. Die Gespräche mit ‚Insidern’ gestatten, trotz der spärlichen Literaturlage zum Thema Vergangenheitspolitik im post-TRC-Zeitalter, eine aktuelle Darstellung. Die befragten Experten und Expertinnen repräsentieren die Regierung, diverse NGOs sowie die TRC und geben die zeitgenössische Lehrmeinung an den Universitäten wieder. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, auf verschiedenen Ebenen des politischen Systems die Vergangenheitspolitik Südafrikas darzustellen und zu analysieren. Die in Deutschland vorhandene Literatur zu Südafrika ist zwar breitgefächert. Jedoch hat eine zusätzliche Literaturbeschaffung vor Ort das gesichtete Literaturspektrum um aktuelle und in Deutschland schwer zugängliche Schriften erweitet. So wurde die Grundlage geschaffen, die südafrikanischen Vergangenheitspolitik aktuell und umfassend zu bearbeiten. 3 Die Experten und Expertinnen wurden nach den Methoden von Dr. Jan Kruse und Prof. Dr. Cornelia Helfferich mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens interviewt (vgl. Kruse/Helfferich 2005). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 4 ____________________________________________________________________________________________________________________ 1. Demokratische Konsolidierung als Teil des Systemwechsels Im Folgenden wird der derzeitige Stand der Systemwechselforschung dargestellt. Die Definition von Begriffen, die Darstellung politik-geschichtlicher Entwicklungen und die Strukturierung des Systemwechsels in zeitlich und entwicklungsspezifisch sich von einander unterscheidende Phasen ermöglichen eine Einordnung des südafrikanischen Falls in den theoretisch-politikwissenschaftlichen und den globalen Kontext. 1.1 Der Wandel von autoritären / totalitären zu demokratischen Systemen Wolfgang Merkel entwirft zur Veranschaulichung des Wandels politischer Systeme in Zeit und Typus das Modell eines Kontinuums politischer Systeme, das zwischen idealen und realen, sowie zwischen demokratischen, autoritären und totalitären Systemen unterscheidet. Abb. 3: Das Kontinuum politischer Systeme (Merkel 1999: 55) An den beiden Extrempolen des Kontinuums befinden sich die ideale Demokratie und das perfekte totalitäre System. Die Realtypen der Demokratie sind beispielsweise Mehrheitsdemokratie und Konsensdemokratie. Merkel unterscheidet auf theoretischer Ebene die vollkommene Demokratie von der Polyarchie und der defekten Demokratie. Autokratische Systeme unterscheiden sich von demokratischen Systemen vor allem durch die Differenzen in der Art der Herrschaftslegitimation, der Möglichkeiten des Herrschaftszugangs (Wahlrecht), durch die unterschiedlich legitimierten Inhaber des Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 5 ____________________________________________________________________________________________________________________ Herrschaftsmonopols, der Herrschaftsstrukturen (Gewaltenteilung) und der Ausdehnung des Herrschaftsanspruchs der Regierenden und deren Herrschaftsweise, die sich im demokratischen System beispielsweise auf das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit beruft (vgl. Merkel 1999: 23-56). 1.2 Das politische System, der Begriff des Systemwechsels und Systemwechseltypen Das politische System Der politikwissenschaftlich geprägte Begriff des Systemwechsels bezieht sich auf das Modell der Gesellschaft als politisches System und bezeichnet eine Veränderung ihrer Herrschaftsform, die die Strukturen und Regeln des politischen Systems durchdringend neu bestimmt. „Politische Systeme lassen sich als die Gesamtheit von Strukturen (Institutionen) und Regeln (Verfahren) begreifen, die politische und gesellschaftliche Akteure (Parteien, Verbände, Organisationen, Individuen) in regelgeleitete Aktionsbeziehungen zueinander setzt.“ (Merkel 1999: 57) Das politische System und somit dessen Strukturen und Regeln, das Verhalten der Akteure und ihre Beziehungen zueinander sind immer Teil eines Wandlungsprozesses, nicht nur in Systemwechselphasen. Dieser Wandel ist nach Almond und Powell bedingt durch fünf fundamentale Aufgaben, die ein politisches System zur Stabilitätswahrung bewältigen muss (vgl. Sandschneider 1995: 121): 1. Politische und gesellschaftliche Integration (Integrationskapazität) 2. Ressourcenmobilisierung (Mobilisierungskapazität) 3. Aufrechterhaltung friedlich geregelter Beziehungen mit anderen Staaten (internationale Anpassungskapazität) 4. Beteiligung der Bevölkerung am politischen Entscheidungsprozess (Partizipationskapazität) 5. Verteilung des Sozialproduktes durch wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen auch jenseits des Marktes (Distributionskapazität) Kann ein politisches System diese Aufgaben nicht zufriedenstellend bewältigen, ermöglicht die institutionalisierte Wahl in einem demokratischen System einen Regierungswechsel und eine neue Chance zur Behebung von Missständen. Ist die Herrschaftselite eines autokratischen Systems nicht in der Lage die o.g. Herausforderungen zufriedenstellend zu meistern, kann nur noch durch verstärkte Repression der freie Herrschaftszugang verhindert werden. In dieser Phase der Instabilität eines autokratischen Systems kann es in einem Wechselspiel zwischen Repression und Freiheitsdrang zur demokratischen Transformation kommen (vgl. Merkel 1999: 57-63). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 6 ____________________________________________________________________________________________________________________ Der Begriff des Systemwechsels Neben dem Begriff Systemwechsel werden weitere Termini wie Regimewechsel bzw. -wandel, Transition, Transformation um Demokratisierung genutzt, um sich auf den gleichen Sachverhalt zu beziehen (vgl. Nohlen 2001: 54). Der im Weiteren genutzte Begriff des Systemwechsels schließt alle „Formen, Zeitstrukturen und Aspekte“ (Merkel 1999: 76) des Wechsels eines politischen Systems zu einem anderen mit ein und lässt sich somit als Oberbegriff für die Begriffsvielfalt innerhalb der Systemwechselforschung verwenden. Ist von Systemwechsel die Rede, bezeichnet dieser generell den Wechsel eines autoritären politischen Systems zu einem politischen System demokratischer Art.4 Der Systembegriff ist umfassender als die Termini Staat und Regime und bezieht daher auch die Teilsysteme Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in die politikwissenschaftliche Analyse mit ein (vgl. Merkel 1999: 73-76). Speziell der o.g. Begriff der Demokratisierung ist mit einer Doppelbedeutung belegt. Außer der schon genannten Gleichbedeutung mit Systemwechsel wird unter Demokratisierung auch eine Vertiefung der Demokratie verstanden, die durch die Ausweitung der Partizipationsrechte der Bürger auf allen Ebenen des politischen Systems erfolgt, die jedoch in der klassischen Systemwechselforschung erst in der Phase des Systemwechsels eine Rolle spielt, in der sich die Demokratie stabilisiert hat (vgl. Nohlen 2001: 54). Systemwechseltypen Die interne (nationale) und externe (internationale) Situationslage in der Zeit vor und während des Umbruchs, ist ausschlaggebend für den Typus des Systemwechsels.5 Der Systemwechselprozess spielt sich, neben der politisch-institutionellen Ebene, auch auf der ökonomischen, der gesellschaftlichen Ebene und der Ebene der politischen Kultur ab (vgl. Varwick 2000: 399). Systeminterne Faktoren, das Militär und die zivilen Machthaber sowie die Opposition betreffend, sind ein Teilbereich der kurzfristigen, situativen und prozessualen Bestimmungen, die beim Systemwechsel eine Rolle spielen. (vgl. Beyme/Nohlen 1998: 770; vgl. Kap. 2.2.1). Arenhövel unterscheidet bestimmte Übergangstypen eines politischen Systems hin zur Demokratie.6 Die Demokratie kann einerseits als Folge äußerer Einwirkung erreicht werden. Selbstinduzierte Demokratisierungsprozesse sind ebenso möglich. Diese werden entweder von den politischen Eliten wie der zivilen Führung des autoritären Regimes, der Militärregierung oder dem Militär als Institution durchgeführt. Davon unterscheiden sich wiederum der Systemwechsel unter Führung gesellschaftlicher Kräfte sowie der Systemwechsel als 4 Der Wandel einer Demokratie hin zu einem autoritären System wird als Zusammenbruch der Demokratie, als ‚breakdown of democracy’, oder als Erosion demokratischer Strukturen bezeichnet (vgl. Merkel 1999: 73-76). 5 Im Fall Südafrikas ist der externe Druck, in Form kontinuierlichen Entzugs internationaler Anerkennung, internationaler Bloßstellung durch UN-Verurteilungen und Menschenrechtskampagnen von weitreichender Auswirkung gewesen (vgl. Beyme/Nohlen 1998: 770). 6 Arenhövel bezieht sich mit seiner Typologie - der empirische Fall eines Systemwechsels weist sicherlich mehrere Charakteristika aus unterschiedlichen Typen auf - auf ein Paradigma Alfred Stepans (vgl. Stepan 1986: 64). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 7 ____________________________________________________________________________________________________________________ paktierter Übergang und der Systemwechsel durch Revolte oder Revolution (vgl. Arenhövel 1998: 99-116). 1.3 Globale und regionale Wellen demokratischen Systemwechsels Globale Wellen des Systemwechsels Die Anzahl demokratisch regierter Länder stieg seit 1974 ungefähr um das Vierfache an. Bei einem minimalen Demokratieverständnis kann von einer globalen demokratischen Revolution gesprochen werden, da mittlerweile nicht nur die westlichen Industrienationen, sondern etwa die Hälfte aller Staaten der Erde sich durch zumindest grundlegende demokratische Grundsätze leiten lassen (vgl. Foweraker 2001: 355). Diese Welle des Systemwechsels von autoritären hin zu demokratischen Systemen wird von Huntington als „The Third Wave“ (Huntington 1991) bezeichnet und wurde durch die Systemwechsel in den südeuropäischen Staaten Portugal, Griechenland und Spanien eingeleitet. Viele autoritär regierte Länder in Lateinamerika, Osteuropa, Afrika und Asien wandelten sich, verstärkt durch die Implosion der sozialistischen 2. Welt, Ende der 80er Anfang der 90er Jahre zu Demokratien. (vgl. Beyme/Nohlen 1995: 636). Das 20. Jahrhundert wurde zuvor von zwei weiteren großen Demokratisierungswellen durchzogen. Die Erste hatte ihre Ursprünge in der französischen und der US-amerikanischen Revolution, kulminierte jedoch in den Jahren nach dem 1.Weltkrieg, als sich die europäischen Monarchien zu Demokratien wandelten. Die Zweite nahm ihren Lauf nach dem Niedergang des Faschismus im Europa und Lateinamerika der 1940/50er Jahre und konnte zumindest eine in Europa noch nie da gewesene Stabilität demokratischer Systeme erreichen. Autoritäre Gegenwellen, wie das Erstarken faschistischer Strömungen im Europa der 20er Jahre oder die aufkommenden Militärdiktaturen in Lateinamerika in den 1950/60er Jahren zerstörten zwei Mal große Teile der demokratischen Strukturen in den betreffenden Ländern (vgl. Merkel 2000: 691). Die Phase gegen Ende des 20. Jahrhunderts wird auch als „Ära der Transformation“ (Beyme/Offe 1996) bezeichnet, was die Benennung einer vierten Welle nach Ende des Kalten Krieges rechtfertigt (vgl. Varwick 2000: 398).7 Regionale Wellen des Systemwechsels Die zeitgenössische Systemwechselforschung ist in ihren Fallstudien und Erklärungsbemühungen weitestgehend auf Europa und Lateinamerika konzentriert. Insbesondere in Afrika ergeben sich auf7 Die Wellen des demokratischen Systemwechsels werden begleitet durch begünstigende internationale Gegebenheiten. Das Ende des Ost-West-Konflikts löste Veränderungen innerhalb der internationalen Beziehungen aus, die auch auf die politische Situation in Südafrika wirkten. Der Wegfall des Ost-Blocks ließ so viele Staaten wie nie zuvor den Wechsel hin zu Demokratie und Marktwirtschaft vollziehen. Diese Unterscheidung zur dritten Welle wird durch den Wandel der mittel- und osteuropäischen Staaten - im Gegensatz zu den südeuropäischen Staaten und lateinamerikanischen Staaten - nicht nur auf gesellschaftspolitischer (pluralistische Demokratie), sondern auch auf wirtschaftspolitischer (Marktwirtschaft) Ebene bekräftigt (vgl. Beyme/Nohlen 1995: 636). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 8 ____________________________________________________________________________________________________________________ grund des oftmals von außen induzierten Systemwechsels und den Richtungswechseln innerhalb der Wirtschafts- und Entwicklungspolitik Probleme auf den Ebenen des politischen und ökonomischen Wandels (vgl. Beyme/Nohlen 1995: 636). Der südafrikanische Systemwechsel ist jedoch im regionalen Kontext viel präziser als ‚zweite Systemwechselphase’ zu verstehen, da sich die ersten afrikanischen Nationen in der nachkolonialen Phase der 1960er Jahre ihre Unabhängigkeit erkämpften und erst die 1990er Jahre speziell im südlichen Afrika eine zweite Bewegung des demokratischen Wechsels darstellen. Aufgrund der Kolonialgeschichte Südafrikas und der speziellen Situation des Landes im Kalten Krieg hatten die dritte und vierte Welle des globalen Systemwechsels weitreichende Folgen für das Land (vgl. Meyns 2000: 148).8 Die Nationen, die sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts von autoritären zu demokratischen Systemen wandelten, befinden sich heute weitestgehend in einer Phase der voranschreitenden Stabilisierung des demokratischen Systems. Die Forschungen zum Systemwechsel folgen dieser Entwicklung und setzen ihren Fokus eben auf dieses Gebiet. So soll auch im Folgenden die Theorie zur demokratischen Konsolidierung und deren gegenwärtiger Stand der demokratischen Konsolidierung Südafrikas im Mittelpunkt stehen (vgl. Bendel/Croissant/Rüb 2002: 8). 1.4 Systemwechselforschung - Die drei Phasen des Systemwechsels Theorien des Systemwechsels Innerhalb der Systemwechselforschung werden vier theoretische Ansätze unterschieden, die entweder den Fokus auf das politische System, auf die Machtstrukturen, auf religiös-kulturelle Faktoren oder auf das Handeln der politisch relevanten Akteure legen (vgl. Merkel 2000: 691-693). Der Schub, den die Systemwechselforschung in den 1990ern erfuhr, verändert auch die Konzepte der Analyse für die Entwicklungsländer durch akteursbezogene Konzepte, die die Welle des Systemwechsels in Osteuropa, vorangetrieben durch die demonstrierenden Massen, erklären. Neben Modernisierungs- und Dependenztheorien geraten daher politische Akteure, Institutionen und Prozesse zur Analyse vermehrt in den Vordergrund und lassen so auch ein verändertes und detaillierteres Bild der afrikanischen Entwicklungsländer entstehen, die sich seit den 1990er Jahren im Systemwechselprozess befinden (vgl. Beyme/Nohlen 1995: 634).9 8 Der Zusammenbruch des Caetano-Regimes in Portugal bewirkte, dass Südafrika bzw. die ‚Weiße Allianz’ im südlichen Afrika ihren ‚cordon sanitaire’ gegenüber den unabhängigen Staaten Afrikas verlor, da die portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik in ihre Unabhängigkeit entlassen wurden. Dadurch wurden die Befreiungsbewegungen in den südafrikanischen Nachbarstaaten ermutigt. Die regionale Hegemonialmacht Südafrika musste sich im Inneren nach der Niederschlagung des bewaffneten Widerstands zu Beginn der 60er Jahre nun erneut gegen eine erstarkende Bewegung der Schwarzen durchsetzen, die durch die antikolonialen Kämpfen in der Region Auftrieb erhalten hatten (vgl. Meyns 2000: 57). 9 Der Modernisierungstheoretiker Seymour Martin Lipset zeigte in den 1960er Jahren anhand von fünf Indikatoren Einkommen, Massenkommunikation, Industrialisierung, Verstädterung und Schulbildung - den Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Entwicklung und Demokratie. Die Welle der demokratischen Systemtransformation Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 9 ____________________________________________________________________________________________________________________ Eine allgemeingültige sozialwissenschaftliche Systemwechseltheorie ist jedoch noch nicht entwickelt worden. In den Abhandlungen von Rüb (1996) sowie Varwick (2000) zu den politischen Institutionen innerhalb der Demokratisierungsphase wird deutlich, dass ein einheitlicher Kriterienkatalog zur Analyse der Transformationsprozesse nicht besteht. Verschiedenste Ansätze aus den unterschiedlichen Theorieschulen werden derzeit oft synthetisiert und an empirischen Studien angewandt, um die Defizite der einzelnen Richtungen zu umgehen (vgl. Merkel 1996: 31). Die Schaffung eines einheitlichen Modells zum politischen Systemwechsel ist aufgrund der Komplexität des Vorgangs bisher auch durch die Komparatistik nicht gelungen, da zu viele abhängige Variablen eine Rolle spielen: „Vergleiche mit Transitionen in anderen Weltregionen fördern mehr Differenz als Konkordanz zutage“ (Beyme/Nohlen 1995: 646). Systemwechsel in Afrika, die zusätzlich noch tiefe Entwicklungskrisen zu überwinden haben, lassen theoretische Aussagen regionaler Reichweite kaum zu, und gerade Südafrika steht als ein Fallbeispiel historischer Einmaligkeit, welches auch vor allem durch seine Geschichte zu erklären ist. Der Ablauf von Systemwechselprozessen „ist weder geographisch, noch sozial, noch im zeitlichen Ablauf uniform“ (Beyme/Nohlen 1995: 638), und ein halbwegs vereinheitlichtes Messen demokratischer Institutionen auf den Grad ihrer Funktionsfähigkeit ist nicht möglich (vgl. Beyme/Nohlen 1995: 636-648). Die Aufgaben und Ziele eines Systemwechselprozesses sind jedoch eindeutig bestimmt. Merkel beschreibt den Systemwechselprozess als aus Teilsystemen, Systemebenen und Systemwechselphasen bestehend, in denen erklärende Aussagen getroffen werden müssen, um den Prozess ganzheitlich zu beschreiben: - Die systemspezifische Triade: Aussagen müssten sinnvoll möglich sein, auf welche je spezifische Weise soziale, ökonomische und politische Transformationsprozesse in den entsprechenden Teilsystemen ablaufen und welche wechselseitigen Interdependenzen den gesamtsystemischen Transformationsprozess beeinflussen. - Die ebenenspezifische Triade: Aussagen müssten getroffen werden können, auf welche Weise Transformationsprozesse auf der Makro-, Meso- und Mikroebene des sozialen, ökonomischen und politischen Systems ablaufen und wie sie sich wechselseitig beeinflussen. - Die phasenspezifische Triade: Aussagen müssten ermöglicht werden, die gleichermaßen Antworten zum Ablauf aller drei großen Phasen der Transformation (Ende des alten Systems, Demokratisierung, Konsolidierung des neuen Systems) sowie ihrer Dependenzen zulassen (vgl. Merkel 1996: 32). im Afrika der 1990er Jahre widerlegte jedoch seine These, dass die einzige Variable der sozioökonomischen Entwicklung das Entstehen und Konsolidieren von Demokratien erklären könne (vgl. Lipset 1960:48; vgl. Tetzlaff 2005: 153). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 10 ____________________________________________________________________________________________________________________ Aufgrund dieser Komplexität des Prozesses muss sich die Systemwechselforschung auf verschiedene Teilbereiche konzentrieren, um Ergebnisse zu erzielen, die der Erstellung einer Systemwechseltheorie nützlich sind. Die drei Phasen des Systemwechsels Die derzeit einflussreichste theoretische Schrift innerhalb der Systemwechselforschung ist eine von O’Donnell, Schmitter und Whitehead herausgegebene Studie aus dem Jahre 1986. Die deskriptivempirisch angelegte Untersuchung ist akteurszentriert und macht so den Systemwechsel weitgehend von subjektivem Handeln der Akteure abhängig.10 O’Donnell et. al. teilen den Systemwechsel idealtypisch in drei Phasen auf: Die erste Phase beinhaltet das Ende des autokratischen Regimes (Liberalisierungsphase). In der zweiten Phase wird die Demokratie institutionalisiert (Demokratisierungsphase), um dann in der dritten Phase zu Krisenresistenz und Stabilität geführt zu werden (Konsolidierungsphase). Liberalisierungsphase und Demokratisierungsphase sind zusammen als Systemtransformation zu verstehen. Die Phase der Konsolidierung knüpft laut O’Donnell et. al. an eine erfolgreiche Systemtransformation an (vgl. O’Donnell / Schmitter: 1986: 6; vgl. Merkel 1996: 36). Die vorliegende Arbeit bezieht die vergangenheitspolitische Komponente auf die Abläufe innerhalb der Konsolidierungsphase und konzentriert sich daher auf diesen Abschnitt des Systemwechselprozesses.11 Bei der Analyse der Konsolidierungsphase bzw. der Vergangenheitspolitik Südafrikas werden, so weit es der Rahmen der Arbeit erlaubt, die systemspezifische und die ebenenspezifische Triade berücksichtigt. Durch die Integration der Vergangenheitspolitik in den Konsolidierungsprozess soll ein weiterer Stein eingefügt werden, um dem Mosaik der ganzheitlichen Transformationstheorie ein Stück näher zu kommen. 2. Die Konsolidierung der Demokratie - Die dritte Phase des Systemwechsels Die Konsolidierungsforschung unterscheidet minimalistische Konzepte, die das Nichtvorhandensein von Vetoakteuren als Konsolidierung ansehen, von maximalistischen, die erst die Verfassungsinstitutionen, die Parteien, die Interessenverbände, die politische Kultur und die Zivilgesellschaft in einem demokratisch unkritischen Zustand sehen wollen, um die Demokratie als konsolidiert gelten zu las- 10 Für die Relevanz von Akteurstheorien spricht, dass die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Pakte, die gleichmächtige Eliten in der Frühphase des Systemwechsels schließen, einen größeren Einfluss auf den Verlauf des weiteren Systemwechselprozesses als sozioökonomische Modernisierungsprozesse haben (vgl. Merkel 1999: 102104). 11 Die Demokratisierungsphase ist für die späteren Handlungen innerhalb des Politikfeldes Vergangenheitspolitik bestimmend, da in diesem Zeitraum die Strukturen und Regeln durch die politischen Eliten für das neue politische System festgelegt werden. Die Liberalisierungsphase und ein kurzer Abriss der ihr vorausgehenden südafrikanischen politischen Geschichte werden ebenfalls in dieser Arbeit dargestellt. Die Notwendig für diesen politikhistorischen Teil ergibt sich aus dem Thema der Arbeit. Die Vergangenheitspolitik des neuen demokratischen Systems ist nur aus dem Kontext des Vorgängersystems heraus zu verstehen. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 11 ____________________________________________________________________________________________________________________ sen. Diese Diskussion und der ihr zugrunde gelegte Demokratiebegriff werden im Folgenden dargestellt (vgl. Merkel 2000: 693). 2.1 Der Demokratiebegriff der Konsolidierungsphase Der Begriff der Demokratie ist ein allgemein gebräuchlicher Begriff und bedarf näherer Erläuterung, um ihn für die Konsolidierungsforschung nutzbar zu machen. Die Klärung des Demokratiebegriffs steht grundlegend zur demokratischen Konsolidierung, da sich die Ausrichtung der Demokratie direkt auf die Prämissen für eine Konsolidierung des politischen Systems auswirkt (vgl. Heinrich 2001: 5). 2.1.1 Das minimalistische Demokratiekonzept Ein minimalistisches Analysekonzept der demokratischen Konsolidierung wird beispielsweise von Przeworski präferiert, der eine Demokratie dann für konsolidiert hält, wenn die relevanten politischen Akteure, d.h. die Eliten, die demokratisch institutionalisierten Normen anerkennen und auch nur innerhalb dieses Rahmens agieren (vgl. Przeworski 1991: 26; vgl. Merkel 1996: 36). Rüb verlangt von minimal-demokratischen politischen Systemen konkurrierende, kollektive Akteure, die ihre Normen und Interessen innerhalb institutionalisierter Regeln durchzusetzen versuchen, der Ausgang der politischen Konkurrenz unsicher ist und alle verbindlichen Entscheidungen der politischen Repräsentanten regelmäßig vor den Staatsbürgern und der Öffentlichkeit zu verantworten sind. (Rüb 1996: 113) Die Systemwechselforschung hat sich schon sehr früh für ein minimalistisches Demokratiekonzept als Ausgangspunkt für ihre Analysen entschieden. Dieses Konzept Robert A. Dahls (1971) stellt zwei grundlegende Dimensionen der Demokratie vor, die sie von einem autokratischen System unterscheidet: demokratischer Wettbewerb und politische Partizipation.12 Beide Dimensionen bilden die Schlüsselcharakteristika für eine Demokratie und manifestieren sich durch acht Garantien des Staates gegenüber seinen Bürgern und deren politische Präferenzen: 12 a. Freiheit eine Organisation zu gründen oder ihr beizutreten b. Freiheit zur Meinungsäußerung c. Das Recht zu wählen d. Recht für ein öffentliches Amt zu kandidieren e. Das Recht der politischen Führer um Stimmen und Unterstützung zu werben f. Alternative Informationsquellen Diese Zweiteilung ist eine auf der Schumpeterschen Demokratietheorie aufbauende Konzeption, die „die demokratische Methode als diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen versteht, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen des Volkes erwerben“ (Schumpeter 1950: 427). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 12 ____________________________________________________________________________________________________________________ g. Freie und faire Wahlen h. Institutionen, die garantieren, dass die Politik der Regierung von den Stimmen der Wählenden und anderen Präferenzbekundungen abhängig ist. (vgl. Dahl 1971: 3) Die Systemwechselforschung bedient sich dieser Minimalkriterien für ihre Analysen. Um ein neu entstandenes politisches System als demokratisch zu identifizieren, reichen diese Kriterien als Abgrenzung zu einem autoritären System aus. Pridham unterscheidet darüber hinaus zwischen negativer und positiver Konsolidierung. Negative Konsolidierung liegt vor, wenn die Akteure die demokratischen Regeln als die einzigen anerkennen. Positive Konsolidierung herrscht vor, wenn nicht nur die Eliten, sondern auch die Bürger durch ihre Einstellung das demokratische System und seine Institutionen legitimieren (vgl. Pridham 1995: 168). Pridham fügt dadurch ein zusätzliches Kriterium in den Katalog mit ein, welches der Konsolidierungsforschung dienlich ist. Die Konsolidierung einer Demokratie erfordert mehr als nur die Erfüllung eines Katalogs an Minimalkriterien. Die Einstellung der Bürger zum Staat ist dabei von zentraler Bedeutung. Zusätzliche Kanäle zur Repräsentation der Interessen außer den politischen Wahlen, d.h. erweiterte Partizipationsmöglichkeiten, Absicherung der demokratischen Wahlprozeduren und die Sicherung des demokratischen Prozesses sowie die Absicherung von international anerkannten Freiheits- und Menschenrechten durch den Rechtsstaat sind notwendig (vgl. Heinrich 2001: 6-7). Aufgrund der Tendenz, dass „heute nahezu jedes politische System versucht, im Namen der Demokratie die Herrschaft zu legitimieren“ (Arenhövel 2002: 161) ist die Definition der Demokratie in minimalistischer Tradition ebenfalls nicht ausreichend, um einer globalen Erosion demokratischer Werte vorzubeugen. 2.1.2 Das maximalistische Demokratiekonzept Volkhart Heinrich operationalisiert die Dahlsche Demokratiekonzeption für seine Untersuchungen zu Südafrika und integriert den expliziten Rechts- und Minderheitenschutz durch ein erweitertes Verständnis der Freiheits- und Menschenrechte. Er versteht die Demokratie dadurch als ein politisches System, welches explizit das rechtsstaatliche Prinzip dazu nutzt, um die bürgerlichen Freiheitsund Menschenrechte zu schützen. Des Weiteren expandiert er die Partizipation am politischen Entscheidungsprozess. Er stellt nicht nur wie Dahl das Recht auf Wahlbeteiligung in den Vordergrund, sondern fordert zusätzliche alternative Formen der Interessenartikulation des Bürgers ein und leistet so einem liberalen Demokratiemodell Vorschub (vgl. Heinrich 2001: 5-7). Gerade die partizipative Komponente scheint im Hinblick auf die südafrikanische Geschichte (vgl. Kap. 3.1) besonders wichtig. Doch wird hier auch deutlich, dass eine liberale Demokratiedefinition in Anlehnung an Heinrich (2001) der Vertiefung bedarf. Dazu werden Theorien herangezogen, die es ermöglichen, einen libe- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 13 ____________________________________________________________________________________________________________________ ralen Demokratiebegriff zu prägen, der einer nach Gruppen und Identitäten differenzierten Gesellschaft und der daraus resultierenden Exklusionsproblematik sowie der Notwendigkeit der Etablierung eines Wohlfahrtsstaates gerecht wird. Privilegiertheit und Unterdrückung Iris Marion Young beschreibt das Problem der nach Gruppen und Identitäten differenzierten Gesellschaft als politisches Problem von Privilegiertheit und Unterdrückung. Unterdrückung definiert sie anhand von fünf Kriterien: - Ausbeutung, d.h. wenig Nutzen trotz hohen Arbeitsaufwands - Marginalisierung, d.h. Ausschluss von sozialen Tätigkeiten wie einem Arbeitsplatz - Machtlosigkeit, d.h. wenig Autonomie und wenig Autorität vor allem am Arbeitsplatz - Kulturimperialismus, d.h. die Stereotypisierung der eigenen Gruppe und deren Marginalisierung im öffentlichen Raum - physische und psychische Gewalt (vgl. Young 1989: 261) Unterdrückung kann in einem demokratischen politischen System, welches von Gruppenidentitäten geprägt ist, durch Methoden wie ‚affirmative action’ und durch Mechanismen der Gruppenvertretung innerhalb des demokratischen Entscheidungsprozesses zusätzlich zum parlamentarischen System beseitigt werden (vgl. Young 1989: 261). So muss eine Demokratie nicht nur die Freiheits- und Menschenrechte durch den Rechtsstaat wahren, sondern auch, neben demokratischen Wahlen, die Durchsetzung weiterer Interessenartikulationskanäle ermöglichen und die Unterdrückung beseitigen, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen ausgrenzt. Demokratische Inklusion Für Charles Taylor ist die liberale Demokratie „a great philosophy of inclusion“ (Taylor 1998: 143). Obwohl die zeitgenössische Form der Demokratie den geschichtlich bisher höchsten Inklusionsgrad erreicht, ist die Exklusion gesellschaftsinterner Individuen aber immer noch ein Nebenprodukt von demokratisch regierten Gesellschaften. Eine gemeinsame Identität innerhalb einer demokratischen Gesellschaft erzeugt stabilisierende Kohäsionskräfte. Diese können entweder durch einen Universalismus oder durch einen neutralen Liberalismus erreicht werden, der es ermöglicht, dass Menschen trotz ihrer Unterschiede fair und gleich in einer Gesellschaft zusammen leben, da sie ihre laut Taylor ihre Gemeinsamkeiten erkennen: that we make choices, opt for some things rather than others and want to be helped rather than hindered in pursuing our ends. So, an enterprise that promises to further everyone’s life plan, on some fair basis, seems to be the ideal common ground. (Taylor 1998: 153) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 14 ____________________________________________________________________________________________________________________ Jedoch ist es für Taylor möglich, nicht nur durch die Gemeinsamkeiten der Menschen, sondern auch durch deren Unterschiede die Kohäsion einer Nation noch zu verstärken: „The crucial idea is that people can bond not in spite of their differences but because of them“ (Taylor 1998: 153). Taylor stellt damit auf der Basis der Konzepte von Johann Gottfried von Herder und Emile Durkheim einen komplementären Bezug der Menschen untereinander her, indem individuelle Freiheit nicht einzig über die Entwicklung des Ich entsteht, sondern nur komplementär über die Anerkennung, die Entwicklung und das Lernen des Anderen möglich ist: „We are meant to understand one another. This mutual understanding leads to growth and completion” (Taylor 1998: 154). Durch eine Anerkennung des Anderen als komplementären Faktor zum Ich entstehen gesellschaftliche Bindekräfte. Diese Bindekräfte spielen auch für die Entwicklung der südafrikanischen Identität, die durch die apartheidbedingte Fragmentierung der Gesellschaft nicht existierte, eine große Rolle. Der Leitgedanke des ‚unity in diversity’ aus der Verfassungspräambel ist eine speziell südafrikanische Variante, die Kohäsion der Nation durch die Differenzen der Menschen zu stärken (vgl. SA Gov. Info, b). Das Sozialkapital, das als zentrale Ressource einer Gesellschaft aufgrund seiner Wirkung als öffentliches Gut sogar Individuen außerhalb der sozialen Netzwerke zum Vorteil wird, weist sich durch soziale Netzwerke aus, die neben physischem Kapital (Ausrüstung) und Humankapital (Ausbildung) für die Prosperität einer Gesellschaft nicht nur im wirtschaftlichen Sinne verantwortlich sind (vgl. Putnam 2001: 15-40). Etablierung des Wohlfahrtsstaats Von Claus Offe wird die in Prozessen demokratischer Konsolidierung die fehlende Dimension des Regierungsoutput im Bereich der sozialen Sicherung kritisiert. Da die Staaten der späten Demokratisierungswellen keine Langzeitphasen zur Etablierung von Rechtsstaat, Demokratie und Wohlfahrtsstaat hatten, „ist mit einer Stabilisierung des liberaldemokratischen Regimes nur dann zu rechnen, wenn gleichzeitig mit Demokratie und Kapitalismus auch weitreichende soziale Sicherungen institutionalisiert werden“ (Offe 1994: 93). Die soziale Sicherung ist Teil der o.g. Distributionskapazität des politischen Systems, die es zu erweitern gilt, um Stabilität zu erreichen (vgl. Sandschneider 1995: 121). Demokratiedefinition Aus den bisherigen Ausführungen wird eine maximalistische liberale Demokratiedefinition in Anlehnung an Heinrichs Demokratiemodell vorgenommen, die Demokratie definiert als Form eines politischen Systems, in dem alle Menschen soziale Sicherung und einen rechtsstaatlichen Schutz der politischen und bürgerlichen Freiheits- und Menschenrechte erfahren und somit, durch soziale Sicherung und mit Bürgerrechten ausgestattet, am politischen Entscheidungsprozess durch Wahlen Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 15 ____________________________________________________________________________________________________________________ und andere Partizipationsmöglichkeiten am politischen Entscheidungsprozess teilnehmen können, der durch demokratischen Wettbewerb zwischen den Kandidaten die Besetzung einer souveränen Regierung hervorbringt, die wiederum die Präferenzbekundungen der Wählenden achtet. Diese Definition der Demokratie wird als Maßstab an das südafrikanische System angelegt, um zwischen einem Soll- und Ist-Zustand unterscheiden zu können. Die dabei lokalisierten Problemfelder demokratischer Konsolidierung dienen als Verknüpfungspunkte mit dem vergangenheitspolitischen Potential, das für den Konsolidierungsprozess nutzbar gemacht werden soll. 2.2 Ein Konzept zur Analyse demokratischer Konsolidierung Im Folgenden wird ein Analysekonzept vorgestellt, anhand dessen die Probleme der demokratischen Konsolidierung Südafrikas bestimmt werden können. 2.2.1 Die Konsolidierungsphase als offener oder endlicher Prozess? Innerhalb des Diskurses zur Konsolidierungsforschung wird zwischen der Möglichkeit, die Phase der Konsolidierung als offenen oder endlichen Prozess zu definieren, unterschieden. Der endliche Prozess wird meist dahingehend kritisiert, dass er kontextuelle Besonderheiten nicht genug beachtet.13 Daher ist eine Forschungsrichtung zu präferieren, die der Komplexität demokratischer Konsolidierungsprozesse genügt und sich nicht auf Endlichkeitsdiskussionen einlässt, da kein Faktor eine absolute Garantie gegen den Zusammenbruch des demokratischen Systems darstellt (vgl. Merkel 1996: 37). Schedler entscheidet sich bewusst für ein teleologisches Konzept von demokratischer Konsolidierung, das jedoch auf der Zulassung von Pluralismus der Ziele und der Prozesse fußt (vgl. Schedler 1998: 95). Schedler nutzt ein eindimensionales Kontinuum zwischen dem autoritären Regime, der elektoralen Demokratie, die - ganz Dahls Kriterien entsprechend - einzig die freien, allgemeinen und fairen Wahlen auf der Basis von Parteienwettbewerb zulässt, und der liberalen Demokratie, die zusätzlich zu den Charakteristika der elektoralen Demokratie, noch die Zivil- und Bürgerrechte mit anerkennt. Am Ende des Kontinuums steht die normativ gute „Advanced Democracy“ (Schedler 1998: 93). Die DemokratInnen, die im Rahmen der verschiedenen Systeme leben, haben entsprechend des situationsgebundenen Standes des Systems verschiedene Auffassungen von demokratischer Konsolidierung. Einerseits muss möglicherweise der Zusammenbruch der Demokratie verhindert werden, 13 Huntingtons maximalistisches Konzept ist eine solch endliche Vorstellung. Diese sieht eine Demokratie als konsolidiert an, wenn die politische Macht zwei Mal auf unterschiedliche Parteien übertragen wurde, da die beiden größten politischen Lager dadurch beweisen, einen Machtverlust zu akzeptieren, und die Massen den Eliten zeigen, dass sie das vorherrschende System legitimieren (vgl. Huntington 1991: 266). Jedoch wäre nach diesem Verständnis die deutsche Demokratie erst 1982 konsolidiert gewesen, Japan in den 1990er Jahren immer noch unkonsolidiert und Italien 1994 konsolidiert, obwohl gerade dort heftige Dekonsolidierungserscheinungen auftraten (vgl. Merkel 1996: 37). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 16 ____________________________________________________________________________________________________________________ indem antidemokratische Kräfte zur Einhaltung demokratischer Spielregeln gebracht werden, um die Demokratie kurz- und mittelfristig zu sichern. Andererseits ist vielleicht das Verhindern einer langsamen Erosion der Demokratie Ziel demokratischer Konsolidierungsbestrebungen, die sich durch folgende Erscheinungen äußern können: state violence, state weakness that may subvert the rule of law; the rise of hegemonic parties that may suffocate the electoral competition; the decay of electoral institutions that may affect the honesty of vote counting; incumbents that may use their privileged access to state resources and to the mass media in ways that violate minimum standards of electoral fairness and equal opportunity; or the introduction of exclusionary citizenship; laws that may violate democratic norms of inclusiveness. (Schedler 1998: 97-98) Die Vertiefung der Demokratie bezieht sich auf alle Bereiche des politischen Systems, in denen Demokratiedefizite herrschen. Auf diesem Stand ist die Demokratie nicht mehr nur um das kurzund mittelfristige Überleben bemüht, sondern ist dabei, demokratischen Boden in allen Bereichen langfristig zu sichern. Diese Vertiefung, oftmals auch als Demokratisierung bezeichnet, führt dann eine liberale hin zur ‚advanced democracy’, die in allen politischen Teilsystemen, wie der öffentlichen Verwaltung, dem Rechts- und Parteiensystem, dem Bereich organisierter zivilgesellschaftlicher Interessen, ausgedehnte demokratische Strukturen vorzuweisen hat (vgl. Schedler 2004: 99100). Im gesamten Prozess der Konsolidierung spielen für das Land endogene wie exogene Faktoren eine bedeutende Rolle bezüglich des Verlaufs der Konsolidierungsphase (vgl. Kap 1.4): Demokratieerfahrungen, die Beschaffenheit des vorangegangenen autoritären Systems, die Art und Weise des Vorangegangenen, was auch das Verhalten der Akteure Eliten und Massen einbezieht, in der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphase, die Stabilität der Nachbarstaaten, die Einbindung in ökonomische und politische Bündnisse, sowie internationale Hilfen und die Teilnahme am internationalen Handel und die ökonomischen Konjunkturzyklen (vgl. Merkel 1996: 35-37) Aufgrund der Notwendigkeit einer logischen Operationalisierung des Begriffs Konsolidierung ist folgendes Modell der Konsolidierungsphase für die weitere Betrachtung maßgebend: Die Transformationsphase ist abgeschlossen mit der Verfassungsgebung, mit der gleichzeitig die Konsolidierungsphase idealtypisch beginnt (vgl. Merkel 1996: 41). Die Konsolidierungsphase des Systemwechsels wird als ein offener Prozess verstanden, der auf die Erreichung einer ‚Advanced Democracy’, abzielt. In allen bestehenden Demokratien treten immer wieder Verletzungen demokratischer Normen u.a. im Bereich der Menschenrechtswahrung, der politischen Kultur und der Behandlung von Minderheiten auf. Dieses Destabilisierungspotential, verstärkt durch die unzureichende Lösung in den Aufgabenfeldern von Distribution, Partizipation, Integration und Mobilisierung, machen eine Demokratie immer für das Einschleichen autoritärer Strukturen angreifbar (vgl. Sandschneider 1995: 121). Die genaue Festlegung, wann eine Demokratie als gänzlich konsolidiert gelten kann, ist somit aufgrund eines zu komplexen Faktorenfeldes nicht zu treffen. Eine völlige Stabilität des Systems ist nicht möglich, wohl aber die Verkleinerung der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls. Die Ziele der Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 17 ____________________________________________________________________________________________________________________ Konsolidierungsbemühungen fußend auf einem idealistischen Menschenbild sind bekannt, der Weg folgt jedoch unterschiedlichen Prozessverläufen. Es gilt, die im Folgenden noch genauer definierten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, um die Demokratie so weit als möglich von autoritären und totalitären Strukturen zu befreien. 2.2.1 Ziele demokratischer Konsolidierung Das sich konsolidierende demokratische System hat den Rückfall in die vormaligen autoritären Strukturen zu verhindern. Dazu müssen die Integrationskapazität, die Mobilisierungskapazität, die internationale Anpassungskapazität, die Partizipationskapazität und die Distributionskapazität gesteigert werden. In welchem Verhältnis jedoch die Teilaufgaben verwirklicht werden sollen, um das o.g. Ziel zu erreichen, ist Gegenstand eines demokratischen Aushandlungsprozesses.14 Jeder Faktor, der den Rückfall begünstigt, muss jedoch aufgrund der Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, vor allem gegenüber den Opfern und Überlebenden des autoritären Systems, beseitigt werden. Die demokratischen Spielregeln sind auf allen Ebenen der Gesellschaft zu etablieren und zu verteidigen. Die Schaffung einer gerechten Ordnung durch die Etablierung, Ausweitung und Durchsetzung des Rechtsstaats ist eine weitere Aufgabe demokratischer Konsolidierung. Im Systemwechselprozess ist jedoch mit vielen Schwierigkeiten in diesem Bereich zu rechnen aufgrund der autoritären Vergangenheit des Staates und den erfolgten Menschenrechtsverletzungen. Ebenso ist die Einhaltung von Menschenrechten und deren Ausweitung in der Bevölkerung elementar für die Legitimation und die Stabilität eines demokratischen Systems. 2.2.2 Analyseebenen, Akteursbeziehungen und Merkmale der demokratischen Staats- form Heinrich untersucht mittels eines Merkmalskatalogs die Faktoren, die sich positiv wie negativ auf den Konsolidierungsprozess auswirken. Sein Analyseraster ist an die Modelle von Linz und Stepan (1996) sowie Plasser (1997) angelehnt und unterscheidet die Verhaltens- und Einstellungsebene der Akteure.15 Heinrich nutzt einen Merkmalskatalog für die demokratische Staatsform, der sich auf die vorangegangene Demokratiedefinition bezieht. Dieser vierteilige Merkmalskatalog soll den Stand der Konsolidierung fassbar beschreiben (vgl. Heinrich 2001: 20): 1. Politische Konkurrenz und Pluralismus (Verhaltensebene) 14 Hierbei stehen sich die gegensätzlichen Argumentationslinien der ‚Gesinnungsethik’ und der ‚Verantwortungsethik’, die Max Weber 1919 in seinem Buch Politik als Beruf beschrieben hat, gegenüber (vgl. Kap 4.2). 15 Die strukturellen Ebenen der institutionellen und repräsentativen Konsolidierung, die noch bei Merkel (1996) zur Anwendung kommen, werden bei Plasser vernachlässigt, da schon bei Beginn der Konsolidierungsphase die institutionelle Konsolidierung abgeschlossen ist und die repräsentative Konsolidierung in die Ebene der Verhaltenskonsolidierung integriert wird. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 18 ____________________________________________________________________________________________________________________ 2. Partizipationsformen und Interessenrepräsentationskanäle (Verhaltensebene) 3. Substantielle und prozedurale Legitimation (Verhaltensebene) 4. System der horizontalen Verantwortlichkeit (Verhaltensebene) 5. Demokratische politische Kultur (Einstellungsebene)16 Die Ergebnisse zahlreicher Studien zum südafrikanischen Konsolidierungsprozess werden miteinander synthetisiert und in Heinrichs Kategorisierungen aufgeschlüsselt. Die Analysen wurden aufgrund des fortschreitenden Prozesses der Konsolidierung nach dem Kriterium der relativen Aktualität aus einem Pool von Autoren verschiedener Nationalität ausgewählt, um Südafrika und seine politischen Probleme aus verschiedenen Perspektiven beleuchten zu können.17 Bei der Analyse werden die Ausführungen zur Vergangenheitspolitik zuerst außen vor bleiben, um dann später explizit untersucht werden zu können. Konsolidierungsfördernde und konsolidierungshemmende Faktoren gehen direkt von bestimmten Akteuren innerhalb des politischen Systems aus. Daher wird der Rahmen des Analysemodells, das politische System, idealtypisch aufgeteilt in die Teilbereiche der beiden beteiligten Akteure: Die Regierungsinstitutionen und die Gesellschaft (bestehend aus Parteien, Zivilgesellschaft und Gesamtbevölkerung). Diese Akteure stehen in Wechselbeziehung zueinander, wobei bestimmte Probleme diese Beziehungen belasten und sich negativ auf die demokratische Konsolidierung auswirken: 1. Innergesellschaftlichen Beziehungen: Mangelnde politische Konkurrenz und Pluralismus 2. Einflussbeziehungen der Gesellschaft auf die Regierungsinstitutionen: Mangelnde Partizipations- und Interessenrepräsentationskanäle 3. Einflussbeziehungen der Regierungsinstitutionen auf die Gesellschaft: Mangelnde substantielle und prozedurale Legitimation 4. Beziehungen innerhalb der Regierungsinstitutionen: Mangelnde horizontale Verantwortlichkeit Potenzielle Gefahren für den südafrikanischen Konsolidierungsprozess liegen innerhalb der Dimension der innergesellschaftlichen Beziehungen. Die fragmentierte Gesellschaft und die soziale Intole- 16 Der Merkmalskatalog sowie die genutzten Indikatoren zur Analyse der demokratischen Konsolidierung basieren auf den Analysemustern aus Länderstudien Indiens, Brasiliens und diversen Sub-Sahara Ländern. Diese wurden ausgewählt, um eine relative Ähnlichkeit der Kontexte zu Südafrika zu gewährleisten (vgl. Heinrich 2001: 17). 17 Um aktuelle Angaben zum Stand der Konsolidierung machen zu können, müssen die älteren Arbeiten von Van Vuuren (1995) oder Giliomee (1995) hinsichtlich ihrer Angaben um die demokratische Konsolidierung ausgespart bleiben. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 19 ____________________________________________________________________________________________________________________ ranz als Erbe der Apartheid und der jahrhundertelangen rassistischen Hierarchisierung und Segregation der Bevölkerung ist dabei der gewichtigste Faktor. Politische Gewalt und eine ineffektive Interessenrepräsentation sind die Gegenspieler innerhalb der zweiten Dimension bestimmt durch die Einflussbeziehungen der Gesellschaft auf die Regierungsinstitutionen. Die Missachtung und Ablehnung von Bürgerrechten durch den Staat und die Verankerung von antidemokratischen Werten durch fehlenden Elitenaustausch in Bereichen des Staatsapparates sind innerhalb der dritten Dimension (Einflussbeziehungen der Regierungsinstitutionen auf die Gesellschaft) Antagonisten für eine Stabilisierung der Demokratie.18 Die Korruption innerhalb der Staatsbürokratie und eine Verschmelzung der Gewalten sowie ein Prozess der Konzentration von Macht innerhalb der Regierungsinstitutionen beschädigen die Demokratie in der vierten Dimension. Das Verhalten der Akteure innerhalb dieser Dimensionen ist ein entscheidender Indikator für die demokratische Konsolidierung. Doch nicht nur auf der Verhaltensebene, auf der sich die beiden Akteure bewegen, sondern auch von der Einstellungsebene ist die Stabilität einer Demokratie abhängig. In der gesamten Bevölkerung wird eine staatsbürgerliche Identität und die weitreichende Legitimation der demokratischen Staatsform benötigt, um Südafrika in einer Zwischenbilanz seit dem Ende des Transformationsprozesses Stabilität attestieren zu können. Abb. 4: Analyseebenen, Akteursbeziehungen und Merkmale demokratischer Staatsform Analyseebenen (akteursbezogen) Akteursbeziehungen Einstellungsebene Verhaltensebene Innergesellschaftliche Beziehungen Merkmale für die Politische Kondemokurrenz und Plukratische ralismus Staatsform EinflussEinflussbeziehungen der beziehungen der ReGesellschaft auf die Regierungsgierungsinstitutionen (bot- institutionen auf die tom-up Prozesse) Gesellschaft (topdown Prozesse) Partizipations- und Interessenrepräsentationskanäle Substantielle und prozedurale Legitimation Beziehungen innerhalb der Regierungsinstitutionen Die Gesamtgesellschaft System der horizontalen Verantwortlich-keit Demokratische politische Kultur (vgl. Heinrich 2001: 20) 18 Der Elitenaustausch bzw. die Werteveränderung auf Seiten der Bediensteten des Staates ist ebenso wichtig wie der Austausch und die Akzeptanz demokratischer Grundregeln bei den Eliten in Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft allgemein. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Zusammenfassung Die theoretische Systemwechselforschung beschreibt innerhalb eines Kontinuums politischer Systeme den Wechsel von autoritären bzw. totalitären zu demokratischen Systemen. Ein Systemwechsel findet statt, wenn die Integrations-, die Mobilisierungs-, die internationale Anpassungs-, die Partizipations- und die Distributionskapazität des Staates nicht mehr ausreichen, um das bestehende System zu stützen. Der Typus eines Systemwechsels entscheidet sich durch die interne und externe Machtsituation, in der sich das System befindet. Zur Untersuchung des Systemwechselprozesses hat die Systemwechselforschung unterschiedliche Ansätze entwickelt, wobei die folgende Analyse einem akteursbezogenen Ansatz am nächsten steht. Diese teilt den politischen Systemwechsel in drei zeitlich aufeinanderfolgende Phasen ein. Die Liberalisierungsphase gefolgt von der Demokratisierungsphase bilden hierbei die Transformation des Systems. Die Konsolidierungsphase vollendet idealtypisch den demokratischen Systemwechsel. Die Analyse soll ebenfalls die Prozesse in den gesellschaftlichen Teilsystemen wie Wirtschaft, Politik und Kultur auf der Mikro-, Meso- und Makroebene berücksichtigen, um - sofern dies im Rahmen dieser Arbeit möglich ist - ein umfassendes Bild der südafrikanischen Konsolidierung zu liefern. Die Analyse der demokratischen Konsolidierung steht in unmittelbarer Verbindung zum Begriff der Demokratie, daher wird, in Abgrenzung zu minimalistischen Demokratiekonzepten, für den südafrikanischen Fall ein maximalistischer Ansatz herangezogen und eine Demokratiedefinition der Analyse vorangestellt (vgl. Kap. 2.1.2) Die Phase der demokratischen Konsolidierung beginnt mit der Verfassungsgebung und wird als offener Prozess verstanden, der auf einem idealistischen Weltbild fußt. Aufgrund eines immerwährenden Destabilisierungspotenzials und eines zu komplexen Faktorenfeldes ist der Punkt der völligen Stabilisierung des Systems nicht bestimmbar. Es besteht keine Garantie für ein demokratisches System, nicht wieder in autoritäre Strukturen zurückzufallen. Die Verhinderung eines Rückfalls durch die Verbreitung demokratischer Spielregeln auf allen Ebenen und in allen Teilbereichen des politischen Systems ist oberstes Ziel demokratischer Konsolidierung. Vor allem die Integrations- und Partizipationskapazitäten sind in Südafrika, das von Fragmentierung und Diskriminierung geprägt ist, auszubauen, um durch Inklusion eine nationale Einheit zu erhalten. Des Weiteren ist die Etablierung, Ausweitung und Stabilisierung des Rechtsstaates anzustreben, um die Menschenrechte gewähren zu können. Zur Untersuchung der südafrikanischen Konsolidierung müssen auf der Verhaltensebene vier Merkmale untersucht werden: die Akzeptanz politischer Konkurrenz und Pluralismus in der Gesellschaft, das Vorhandensein von Partizipationsformen und Interessenrepräsentation, ein System horizontaler Verantwortlichkeit und substantielle und prozedurale Legitimität. Durch die folgende Analyse der Einstellungen und des Verhaltens der südafrikanischen Akteure innerhalb der o.g. Merkmalskategorien eines demokratischen politischen Systems und durch Berücksichtigung der Zie- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 21 ____________________________________________________________________________________________________________________ le demokratischer Konsolidierung wird am Ende des nächsten Kapitels aufgezeigt, welchen Herausforderungen die demokratische Konsolidierung zu begegnen hat. 3. Systemwechsel in Südafrika: Transformation und demokratische Konsolidierung Die bisher dargestellte theoretische Systemwechsel- und Konsolidierungsforschung und das darauf basierende Analysemuster soll nun im folgenden Abschnitt mittels empirischer Daten und Analyseergebnisse zum Fallbeispiel Südafrika mit Leben gefüllt werden. Der Vergleich der einzelnen Studien und deren Ergebnisse, aufbauend auf einem kurzen Abriss der politischen Geschichte des Landes aus der Perspektive der Segregation, zeigen Schwächen und Probleme des Konsolidierungsprozesses in Südafrika. Die daran anschließende Fragestellung der Vergangenheitsbewältigung und ihrer Potenziale hinsichtlich der Konsolidierung der südafrikanischen Demokratie kann dadurch fundierter beantwortet werden. 3.1 Die Phasen der südafrikanischen Transformation 3.1.1 Die Liberalisierungsphase - Kolonialismus, Apartheid und Krise Um die nachfolgende Debatte um die südafrikanische Vergangenheitspolitik verstehen zu können und das politische System der Apartheid, aus dem das neue Südafrika hervorgegangen ist, kennen zu lernen, wird im Folgenden die südafrikanische Geschichte seit dem Beginn der Kolonisierung, konzentriert auf die Rassendivergenzen, skizziert. Das rassistisch-autoritäre Regime Innerhalb der Realtypen der autoritären Systeme befindet sich auch die Kategorie der rassistischautoritären Regime (vgl. Kap. 1.1). Zu denen auch die ‚alte’ Republik Südafrika seit 1948 zählte, da dort rassisch und ethnisch definierte Gruppen ihre Bürgerrechte nicht wahrnehmen konnten und von demokratischen Verfahren ausgeschlossen waren. Innerhalb der privilegierten rassisch definierten Gruppe der Weißen19 europäischer Abstammung wurde jedoch weitgehend nach demokratischen Regeln und Prozessen verfahren (vgl. Merkel 1999: 41-42). Diese demokratische Vorerfahrung eines Teils der Bevölkerung schafft nach Dahl (1971: 33-40) einerseits ein Potenzial für die Stärkung der jungen Demokratie und lässt auf eine Konsolidierung hoffen. Andererseits beeinträchtigt die rassisch 19 Entgegen den Bestrebungen des ‘Black Consciousness Movement’, die die Bezeichnung ‚Blacks’, d.h. Schwarze propagierte, um alle Nicht-Weißen zu beschreiben, hielten sich bis heute die durch die Apartheidpolitik geprägten Bezeichnungen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, wie Coloureds, d.h. Farbige, Indians, d.h. Inder, Blacks, d.h. Schwarzafrikaner, Whites, d.h. Weiße Afrikaner europäischer Herkunft, etc. Mit der Nutzung dieser Termini soll keine Respektlosigkeit oder rassistische Diskriminierung fortgeschrieben werden, jedoch ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit Südafrikas leider ohne die Bemühung dieser künstlichen Identitätskategorien nicht möglich (vgl. TRC-Bericht, a: 1,1). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 22 ____________________________________________________________________________________________________________________ fragmentierte Gesellschaft bis heute die Demokratie (vgl. Huntington 1991: 111-112). Dieser privilegierte Stand der Weißen in der Apartheidgesellschaft ist auf die koloniale Vorgeschichte des Landes zurückzuführen. Kolonialistische Eroberung und Unterdrückung Die ersten Siedler, die sich 1652 über die ‚Dutch East India Company’ auf dem Territorium des heutigen Südafrikas niederließen, gründeten eine Gesellschaft geprägt durch Agrarwirtschaft und den Besitz von Sklaven, hauptsächlich aus asiatischen Ländern. Die Beziehungen zu den einheimischen Khoikhoi wandelten sich im Jahre 1659 zum ersten Mal ins kriegerische, und durch ihren Sieg wurden die weißen Siedler selbstsicherer und zunehmend brutaler. Die Überlegenheit der Europäer war hauptsächlich begründet auf ihre Waffentechnik und ihre Taktik, die Rivalitäten zwischen den einheimischen Bevölkerungsgruppen auszunutzen. Dies war eine durchgehende Erfolgsstrategie bis ins 20. Jahrhundert. Im Jahr 1806 fiel die niederländische Kolonie endgültig in britische Hände, was die Siedler, die sich selbst als Afrikaaner oder Buren bezeichneten, dazu veranlasste, im Jahre 1835 die Kapkolonie in Richtung Nordosten zu verlassen. Doch konnten sie sich dem britischen Einflussbereich langfristig nicht entziehen. 1898 war die gesamte einheimische Bevölkerung des südlichen Afrikas, durch die Eroberung des Landes der ‚Venda’, besiegt. 1899 bis 1902 entfesselten die Briten den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Afrikaanern und hinterließen eine traumatisierte kollektive Identität. Das politischen System vereinheitlichte sich durch die britisch dominierte Gründung der ‚Union of South Africa’ im Jahre 1910. Der ‚Natives Land Act’ aus dem Jahre 1913 limitierte afrikanischen Landbesitz auf die Reservate, und mit diesem Gesetz begann eine ganze Reihe von ‚segregational laws’, die erst nach dem Ende der Apartheid abgeschafft wurden, deren Auswirkungen aber noch heute zu spüren sind (vgl. Thompson 1995: xv-xvii). Wann Südafrika wirklich seine Unabhängigkeit erreichte und von welchem Moment an von einem postkolonialen Status zu sprechen ist, liegt an der Argumentation des Betrachters. Die ‚Balfour Declaration’ von 1926 gab Südafrika zwar seine politische Unabhängigkeit vom britischen Mutterland, es blieb jedoch immer noch Mitglied des ‚Commonwealth of Nations’ (vgl. SAHO a). Die Afrikaaner hingegen sehen den nachkolonialen Status erst durch die Gründung der Republik und dem Austritt aus dem Commonwealth am 31. Mai 1961 erreicht (vgl. SAHO, b). Die schwarze Mehrheit der Südafrikaner fühlt sich wiederum erst durch den Systemwechsel Ende des 20. Jahrhunderts von den Kolonialherrschern befreit, da die neue Republik ihnen erstmals universelle Bürgerrechte garantiert und mit den Wahlen vom 29. April 1994 ebenfalls zu ersten Mal eine demokratisch gewählte Regierung das Land führte (vgl. SAHO, c). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 23 ____________________________________________________________________________________________________________________ Apartheid und rassistische Gesetze in Südafrika Von der Ankunft der ersten Siedler bis in die 1990er Jahre wurde Südafrika durch verschiedene Formen der Kolonialisierung kontrolliert. Die politischen Strukturen waren charakterisiert durch die Herrschaft einer Minderheit und die hierarchische Separation zwischen den Kolonialisten und den Kolonisierten. Seit die ‚National Party’ (NP) der Afrikaaner 1948 die Parlamentswahlen gewann, wurden die minimalen Repräsentationsmöglichkeiten der Nicht-Europäer im politischen System sukzessive eliminiert. Die Apartheidpolitik der Afrikaaner wurde genutzt, um die verbliebene multikulturelle Gesellschaft in der privaten wie der öffentlichen Sphäre durch den Umbau des südafrikanischen Gesetzapparates zu trennen. Die Apartheid verursachte eine beispiellose Veränderung innerhalb der ohnehin schon sehr durch kulturelle und hierarchische Gräben geteilten Gesellschaft (vgl. Pordzik 2000: 10-12). Die weiße Politik war begleitet von gesellschaftlich tiefgreifenden Gesetzen, die die Minderheitenregierung stützten und die Rassentrennung vorantrieben. Beispielsweise machte der ‚Population Registration Act’ (1950) den Weg frei für das System der rassischen Klassifikationen. Zwangsumsiedlungen fanden auf der gesetzlichen Grundlage des ‚Group Areas Act’ (1950) statt. Der ‚Natives Land Act’ aus dem Jahre 1913 sowie seine Novellierung aus dem Jahre 1936 erschufen die unabhängigen ‚Homelands’, auch ‚Bantustans’ genannt, die den Schwarzen 13% des südafrikanischen Landes zuwiesen (vgl. Meyns 2000: 36). Der ‚Bantu Homelands Constitution Act’ (1971) trennte die schwarze Mehrheit nicht nur räumlich, sondern auch politisch von der weißen Bevölkerung, da die Homelands eigene politische Systeme waren, die jedoch kein Staat außer Südafrikas ‚Weiße Nation’ anerkannte, auch aufgrund der Verurteilung durch die Vereinten Nationen (UN). ‚Townships’ wurden speziell für Migrationsarbeiter gegründet, um billige schwarze Arbeitskraft für das von weißen dominierte Wirtschaftssystem verfügbar zu machen (vgl. Meyns 2000: 87, vgl. Abb. 2).20 Die Rassendiskriminierung, die in der Apartheidpolitik kulminierte, hatte ihre Ursprünge einerseits im Streben nach Kapital, d.h. in der kapitalistischen Ausbeutung der südafrikanischen Ressourcen, insbesondere von Gold und Diamanten, wofür schwarze ArbeiterInnen verfügbar gemacht wurden. Andererseits ist sie auf das religiöse Denken der niederländischen Einwanderer zurückzuführen, die sich durch ihren calvinistischen Glauben als ein auserwähltes Volk verstanden, welches über die anderen Völker herrschen sollte.21 20 Schlechte Lebensbedingungen in den Homelands und Townships der Schwarzen lassen sich am besten durch die hohe Kindersterblichkeit, hauptsächlich verursacht durch Ernährungsmangel, veranschaulichen: 100 bis 110 Kinder von 1000 Lebendgeburten schwarzer Südafrikanerinnen starben 1974 im Vergleich zu 14,9 pro 1000 Lebendgeburten weißer Südafrikanerinnen im Jahr 1978 (vgl. Thompson 1995: 202-203). 21 Schon vor der Etablierung des Apartheidsystems wurden in Südafrika rassendiskriminierende Gesetze eingeführt: Der ‚Native Labour Regulation Act’ (1911) regelte das System der Wanderarbeit, und der ‚Mines and Work Act’ hinderte die Nicht-Weißen Arbeiter an der Ausübung qualifizierter Tätigkeiten im Bergbausektor. Der ‚Urban Areas Act’ schränkte das Wohnrecht von Schwarzen in Städten beträchtlich ein. Der ‚Immorality Act’ aus dem Jahre 1927 Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 24 ____________________________________________________________________________________________________________________ Widerstand und Liberalisierung Die Krise des Apartheidsystems und die beginnende Liberalisierung wurden durch nationale, regionale und internationale Faktoren bedingt, die schließlich zu Verhandlungen und zum Ende der Apartheid führten.22 Auf nationaler Ebene war der African National Congress (ANC) der mächtigste Gegenspieler der Apartheidregierung. Der ANC, schon im Jahre 1912 gegründet, setzte zuerst auf gewaltlosen Widerstand, dann später mittels seines militärischen Flügels ‚Umkhonto we Sizwe’ (MK) auf den bewaffneten Kampf und Sabotage, um dem Repressionsapparat gegen die schwarze Bevölkerungsmehrheit zu begegnen (vgl. Meyns 2000: 34-36). Mit der ‚Freedom Charter’ (1955) setzte der ANC der rassistischen Gesetzgebung einen Gesellschaftsentwurf entgegen, der sich auch auf das heutige Südafrika auswirkt und maßgeblich die neue Verfassung beeinflusst: We, the people of South Africa, declare [...] that only a democratic state, based on the will of the people, can secure to all their birthright without distinction of colour, race, sex or belief; [...] we pledge ourselves to strive together [...], until the democratic changes here set out have been won. The people shall govern! All national groups shall have equal rights! The people shall share in the country’s wealth! The land shall be shared among those who work it! All shall be equal before the law! All shall enjoy equal human rights! There shall be work and security! The doors of learning and of culture shall be opened! There shall be houses, security and comfort! There shall be peace and friendship! (SAHO e). Der Widerstand gegen die Apartheidgesetzgebung erreichte seinen Höhepunkt 1976 im Aufstand von Soweto, der gegen den ‚Bantu Education Act’ und dessen sprachpolitischer Absicht gerichtet war. Dieses Gesetz sollte das NP Prinzip des ‚separate development’ der Rassen weiter ausbauen. Am 16. Juni 1976 und in den darauffolgenden Wochen tötete der ‚South African Police Service’ (SAPS) über 1000 politisch organisierte Schüler und Studenten, die die Bildungspolitik verurteilten und Afrikaans als Sprache des Lehrens und Lernens boykottierten (vgl. Perry 2004: 108-115, SAHO f). Die nationale Situation war geprägt von einer Repressionspolitik, unterstützt von einer sog. ‚third force’, die in Geheimaktionen Gewaltakte und Zwietracht in die Townships brachte, und einem Erhalt des Systems durch die Nutzung von Notstandsgesetzen (1985/86). Der bewaffnete Kampf gegen die Apartheid hätte zwar das System niemals zu Fall gebracht, jedoch wurde vor allem nach dem Erlass einer Verfassungsreform 1984 die Gegenwehr aus den verschiedenen Teilen der Gesellschaft immer heftiger. Die durch die Reform entstandenen Freiräume wurden vor allem in den Townships durch die sogenannte ‚urban Blacks’ genutzt, um zivilgesellschaftliche Vereine und Gewerkschaften mit seinen Novellierungen (1950, 1957) sowie der ‚Prohibition of Mixed Marriages Act’ (1949) verbot Eheschließung und Geschlechtsverkehr zwischen den Rassen. 22 Die Transformationsforschung versucht auf verschiedenen Ebenen die Ursachen des Systemwechsels zu klären und bedient sich dabei Antworten die Strukturen oder Akteure betreffend. Auch nationale sozio-ökonomische sowie internationale Bedingungen werden angeführt. Jedoch kann nicht erklärt werden, „warum konkrete, leibhaftige Akteure, ihr Verhalten, ihre Einstellungen und ihr Handeln verändern, warum sie eine Krisensituation als solche wahrnehmen und darauf reagieren“ (Bock 2000: 13). Inwieweit öffentliche Themen der politischen Kommunikation das politische Handeln beeinflussen, ist noch ungeklärt. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 25 ____________________________________________________________________________________________________________________ zu gründen, wie beispielsweise den ‚Congress of South African Trade Unions’ (COSATU) im Jahre 1985 (vgl. Meyns 2000: 85-92). Der Apartheidstaat musste sich nicht nur im Inneren, sondern auch auf internationaler Ebene verstärktem Druck erwehren. Die UN erklärten in ihrer Resolution 2627 (XXV) vom 24. Oktober 1970 Apartheid als „a crime against the conscience and dignity of mankind“ (SAHO, f). Wirtschaftliche Sanktionen wurden in der westlichen Welt kontrovers debattiert und vor allem von den USA und Großbritannien sowie auch Deutschland unter den Vorzeichen des Kalten Krieges nur halbherzig durchgesetzt. In Südafrika wurden die Sanktionsmaßnahmen und Verurteilungen durch die UN und die westliche Welt als Erschütterung wirtschaftlicher und auch politischer Art wahrgenommen, so dass sich die südafrikanischen Weißen zunehmend auch von der christlich-westlichen Wertewelt international isoliert sahen. Das Ende des Kalten Krieges nahm der NP die Argumentationsgrundlage, nach der jede Opposition innerhalb Südafrikas, unterstützt vom kommunistischen Block, bekämpft werden muss, um ein sozialistisches System in Südafrika zu verhindern (vgl. Meyns 2000: 65-67). Nach dem Rückzug südafrikanischer sowie kubanischer Soldaten aus Angola, nach dem New Yorker Abkommen (22. Dezember 1988) und dem Wegfall sowjetischer Unterstützung bekräftigte der ANC in der Harare-Erklärung der ‚Organisation of African Unity’ (OAU) 1989 seine Absichten, mit der Apartheidregierung zu verhandeln (vgl. Meyns 2000: 85-92). F.W. de Klerk wurde an die Spitze der NP gewählt und machte den Weg frei für die Aufnahme von Gesprächen und die Erfüllung der Forderungen nach Freilassung der politischen Gefangenen, der Aufhebung des Banns auf politische Organisation sowie der Beendigung des Notstands und dem Rückzug der Truppen aus den Townships. Warum aber kamen schon 1986 Gesprächskontakte zwischen der Regierung und der Opposition auf, und warum näherte sich die politische Klasse der Afrikaaner langsam der Gegenseite an? [..] Mandela’s message of non-racialism and reconciliation dominated the early days of the transition. Few doubt that had a different message been broadcast by the ANC leadership a different outcome could easily have resulted” (Gibson 2004: 408) Trotz aller Rassengrenzen war das separierte Zusammenleben von Schwarzen und Weißen in einem politischen System weniger rassistischem als kapitalistischem Denken zu schulden. Im Verlauf der 1980er Jahre sahen auch viele Afrikaaner keinen Erfolg mehr in der Apartheid, die sich nur noch selbst am Leben erhielt aber keine wirtschaftliche Prosperität mehr kannte (vgl. Meyns 2000: 85-92; vgl. Wilson 2001, b: 6): The relative success of the process has been due to the fact that the divisions in South Africa were not as great as were commonly assumed. [...]. What explains the transition best is how the NP and the NP intellectuals came to the increasing realisation that the ANC did not represent only a black majority but represented a non-racial politics, that it was not going to be the case that the white minority was going to be replaced by Black majority rule, which is what NP intellectuals consistently and rigorously argued throughout the 70s Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 26 ____________________________________________________________________________________________________________________ and 80s. There came the dawning realisation that the ANC was actually committed to a non-racial democracy in which individual right would be protected. (Interview Rupert Taylor 28.08.2005: 6/31-7/14) So machte neben der o.g. nationalen und internationalen Situation, letztendlich die nicht-rassistische Politik des ANC die Verhandlungen um die Regierungsmacht in Südafrika möglich. Die heterogene Interessenlage der Akteure sollte jedoch nach der Liberalisierungsphase die Verhandlungen innerhalb der Demokratisierungsphase trotz des abflauenden Rassismus und der grundlegenden Verhandlungsbereitschaft von ANC und NP sich schwierig gestalten. 3.1.2 Die Demokratisierungsphase - die ‚negotiated revolution’ Zwischen dem 2. Februar 1990, als Präsident F.W. de Klerk den Bann gegen die oppositionellen Parteien aufhob, und den ersten freien Wahlen im April 1994 wurden viele Hürden durch Verhandlungen und Kompromissfindung zwischen allen südafrikanischen Parteien aus dem Weg geschafft. Diese selbstinduzierte Demokratisierungsphase wurde von den politischen Eliten, d.h. von der zivilen Führung des autoritären Regimes und der Führung der gesellschaftlichen Kräfte, als paktierter Übergang durchgeführt (vgl. Arenhövel 1998: 99-116; Meyns 2000: 89). Informelle Treffen mit der demokratischen Opposition im Ausland und spätere Gespräche über Verhandlungsbedingungen gingen späteren Unterzeichnungen diverser Zugeständnisse wie dem ‚National Peace Accord’, der beide Seiten zur Eindämmung der ausufernden politischen Gewalt im Lande verpflichtete, voraus. Die ‚Convention for a Democratic South Africa’ (CODESA), die im Dezember 1991 als All-ParteienKongress ins Leben gerufen worden war, scheiterte an Verfassungsfragen. Erst in einem ‚Multi Party Negotiation Forum’ ab März 1993 konnten sich die Verhandlungspartner auf ein Verhältniswahlsystem mit nationalem und Provinzparlamenten sowie zugehörigen Regierungen einigen. Weiterhin sollte eine Übergangsregierung, ein ‚Government of National Unity’ (GNU) nach den ersten Wahlen eingerichtet werden, das sich von den Prinzipien der Konkordanzdemokratie, Verhandlung, Kompromiss und Proporz leiten lassen würde (vgl. Schultze 2001: 259). Die Übergangsverfassung wurde am 18. November 1993 durch die All-Parteiengespräche ausgehandelt, am 22. Dezember 1993 durch das Parlament mit dem „Act No. 200 of 1993“ (SA Gov. Info, a) gebilligt und trat am 27. April 1994 in Kraft. Innerhalb von zwei Jahren wurde diese dann von einer endgültigen Verfassung abgelöst (vgl. Alence 2004: 81). Die ersten freien Wahlen vom April 1994 bescherten ein ideales Ergebnis für die Regierungsbildung, da der ANC zwar eindeutig gewann, jedoch keine 2/3-Mehrheit für die alleinige Verfassungsgebung bzw. -änderung erreichte. Die NP konnte aufgrund des Wahlergebnisses und den vereinbarten Konkordanzprinzipien das Amt des Vizepräsidenten besetzen, und die ‚Inkatha Freedom Party’ wurde als drittgrößte Kraft an der Regierungsbildung beteiligt. (vgl. Alence 2004: 81; vgl. Meyns 2000: 91). Das erste demokratisch gewählte Parlament nahm 1996 die neue Verfassung für Südafrika an, die dann zum 4. Februar 1997 in Kraft trat (vgl. SA Gov. Info, b). Die Phase Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 27 ____________________________________________________________________________________________________________________ der Konsolidierung der Demokratie begann jedoch schon vorher mit der Anerkennung der Interimsverfassung, die schon Teile eines umfassenderen Regel- und Normenkatalogs darstellte. (vgl. Barber 1999: 273-300; vgl. Merkel 1996: 41). Die Interimsverfassung stellt den entscheidenden Punkt in der Übergangsphase zwischen Demokratisierungs- und Konsolidierungsphase dar und ist ein weitaus bedeutenderer Schritt in der Einigung zwischen NP, ANC und den anderen Parteien als die endgültige Version. Es [HB, das südafrikanische ‚Wunder’ der Demokratisierung] erhielt mit der Einigung auf die Übergangsverfassung vom November 1993 sein Herzstück - noch bevor die demokratischen Gründungswahlen im April 1994 symbolisch den Beginn einer neuen Ära dokumentierten. (Kaußen 2005: 32-33) In der Interimsverfassung spiegeln sich die politischen Prämissen des Transformation wider. Dort wurde zum Beispiel die Einrichtung einer Wahrheitskommission festgelegt, die, aus Gründen der nationalen Einheit und der Existenz verschiedener Versionen der Geschichte Südafrikas bezüglich des Apartheidsystems, bisher Verborgenes durch Aussagen von südafrikanischen Bürgerinnen und Bürgern ans Tageslicht bringen sollte (vgl. Maloka 2004: 56-57; vgl. Wilson 2001, b: 8).23 Alence sieht den Erfolg innerhalb der südafrikanischen Demokratisierungsphase als das Ergebnis der intensiven Verhandlungen zwischen den Bewegungen und Parteien. Aus der Sackgasse der Apartheid - die sich durch eine ‚negative Stabilität’ auszeichnete, in der das weiße Regime alle Kräfte zum Selbsterhalt mobilisieren musste und sich die schwarze Opposition als nicht stark genug zu dessen Überwindung herausstellte - entwickelte sich über vier schwierige Verhandlungsjahre das südafrikanische ‚Wunder’ der allgemeinen Demokratisierung. (Kaußen 2005: 32) Diese Verhandlungen waren durch die global veränderte Situation nach dem Kalten Krieg möglich, ohne dass sich ausländische Mächte in die Verhandlungen einmischten (vgl. Alence 2004: 80-81). Das Erstarken demokratischer Institutionen seit 1994 spielte ebenfalls ein wichtige Rolle im Systemwechsel. Es war unter anderem auch der Erfolg der lokalen politischen Aktivitäten, die, wie beispielsweise die TRC, individuelle Versöhnung öffentlich verbreiteten. Dadurch wurde die Bevölkerung in den Prozess der Systemtransformation des Landes miteinbezogen (vgl. Alence 2004: 80-81). Das Erbe der Apartheid sowohl auf sozioökonomischer als auch auf politischer Ebene stellt eine gro- 23 Der Begriff der Wahrheit und Wahrheitsfindung im Zusammenhang mit der TRC und anderen Kommissionen dieser Art ist problematisch, da es so scheint, als ob eine bestimmte Wahrheit, eine bestimmte Version der Geschichte durch die Wahrheitskommission eingerichtet werden soll. Eine einzige Wahrheit über vergangene Ereignisse gibt es jedoch nicht. Durch Wahrnehmung der Einzelpersonen entstehen viele verschiedene Wahrheiten nebeneinander, was die Beschreibung einer kollektiven historischen Wahrheit als problematisch erscheinen lässt. Die TRC konnte jedoch in ihrem Verkauf bestimmte Lügen und Geheimnisse aufdecken und so eine Version der Wahrheit über vergangene Ereignisse anbieten, die auch von der breiten Masse der SüdafrikanerInnen akzeptiert wurde. Diese historische Wahrheit ist jedoch in einer liberalen Demokratie diskutierbar. „ It seems that we have to acknowledge that the truth that the TRC has uncovered is, at best, only a partial truth. And while half a loaf is definitely better than no bread at all, it maybe more valuable to see historical truth as a continually unfolding process- not something that is past but something that is still part of the present , still contested and still under construction.” (Cherry 2000: 143) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 28 ____________________________________________________________________________________________________________________ ße Herausforderungen für das neue System dar. Die Apartheid hinterlies in sozioökonomischer Sicht „zwei Welten in einem Land“ (Schmidt 2004:278). Die Lösung des Apartheidkonflikts in Südafrika auf dem Wege friedlicher Verfassungsverhandlungen konnten nur gelingen, weil die beiden Hauptkontrahenten [HB, NP und ANC] zum Kompromiss bereit waren. Darin liegt der Keim des Erfolgs, zugleich aber auch der Keim zukünftiger Widersprüche. Die Institutionen der Apartheid einschließlich der ‚Bantustane’, sind beseitigt worden, aber die über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen sozio-ökonomischer Ungleichheit [...] sind geblieben. (Meyns 2000: 92) Die Analyse dieser Zusammenhänge fallen jedoch in den Bereich der Konsolidierungsphase und werden im folgenden Kapitel behandelt. 3.2 Das neue Südafrika - Der Konsolidierungsprozess der Demokratie 3.2.1 Die politische Kultur Staatsbürgerliche Identität und die Präferenz für eine demokratische Staatsform machen eine demokratische politische Kultur aus und sind für den Stabilisierungsfaktor äußerst bedeutsam. Die Stärke der Legitimationsgrundlage der südafrikanischen Demokratie legte zwischen 1995 und 2000 zu, jedoch ist bei den meisten SüdafrikanerInnen die Zustimmung zur Demokratie stark von der Leistung der Regierungsinstitutionen abhängig. Aufgrund mangelnder Problemlösungskapazitäten in vielen Politikfeldern bleibt die Legitimation aus dieser Perspektive betrachtet gering. Das andererseits große Zugehörigkeitsgefühl zur südafrikanischen Nation ist aus der Geschichte der Apartheid heraus zu deuten, die eine gemeinsame Nation und Identität ablehnte (vgl. Heinrich 2004: 19, 79-81). Garcia-Rivero, Kotzé und du Toit untersuchten die Möglichkeiten der demokratischen Konsolidierung Südafrikas anhand der Indikatoren politische Toleranz und Vertrauen. Sie sehen die politische Kultur als entscheidend für die demokratische Konsolidierung an: Without tolerance of political opponents, there can be no free and fair elections. Without trust in institutions, the political participation of minorities becomes problematic. In addition, strong doses of political tolerance and trust become necessary for the development of a civil society strong enough to counteract the possible excesses of the state. (Garcia et al. 2002: 163) Die Autoren kritisieren die meisten anderen Studien zur demokratischen Konsolidierung, da diese sich zur sehr auf die politischen Faktoren - d.h. institutionelle Variablen - konzentrieren, die die Konsolidierung begünstigen. Wie der Systemwechsel in Ecuador und Bolivien im Jahre 2000 verdeutlichte, hängt laut Garcia et al. der Bestand einer Demokratie nicht von der Anzahl der durchgeführten Wahlen oder der Machtübergabe an die Opposition ab, sondern von Vorstellungen, Werten, Verhalten und Motivationen. „Consequently, democratic ideas and values need to be disseminated throughout the society to ensure that the regime will remain democratic, even in the face of important challenges such as economic crisis” (Garcia et al. 2002: 166). Eliten und Massen müssen sich auf der Ebene der sozialen Werte und der politischen Kultur zu demokratischen Regeln bekennen. Garcia et al. beziehen sich Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 29 ____________________________________________________________________________________________________________________ hauptsächlich auf die bahnbrechende Studie von Almond und Verba, die politische Kultur definieren als die individuellen psychologischen Einstellungen gegenüber dem politischen System und seiner verschiedenen Bereiche sowie die Einstellungen gegenüber der eigenen Rolle in diesem System. Ihrer Meinung nach benötigt Demokratie eine Bürgerkultur um Bestand haben zu können. Die meistgebrauchten Indikatoren zur Messung politischer Kultur - politische Toleranz und Vertrauen in die Regierung - werden daher genutzt, um die Bindungsstärke der südafrikanischen Bevölkerung zur Demokratie herauszufinden. Die von Garcia et al. genutzten Untersuchungsdaten, die zwischen 1994 und 1999 gewonnen wurden, weisen auf eine divergierende Haltung der Südafrikaner hin. Einerseits breitet sich zunehmend politische Toleranz unter den südafrikanischen Bürgern aus, andererseits schwindet jedoch das Vertrauen in die politischen Institutionen. Die entsprechenden Level der politischen Toleranz stiegen in jeder Bevölkerungsgruppe, und auch die politisch motivierten Morde nahmen zwischen 1994 (etwa 2000) und 1999 (keinen angezeigten Fall) beträchtlich ab. Vertrauen definieren Garcia et. al. als „the subjective possibility that a citizen is convinced that the political system or parts of it will be able to deliver the necessary preferred outcomes, even though that person does not participate in the production of the outcomes ” (Garcia et al. 2002: 172). Das Vertrauen der Bürger stieg nach Garcia et al. zwischen 1994 und 1995 an, um dann zwischen 1995 und 1998 wieder abzufallen. Zwischen 1998 und 1999 war wiederum ein Anstieg zu verzeichnen, der jedoch mit den Wahlversprechen in Verbindung gebracht werden kann. Der Vertrauensverlust der Bevölkerung in diesen Jahren ist auf die nicht ausreichenden Handlungen der Regierung im Bereitstellen politischer Güter zurückzuführen. Im Bereich der Anerkennung der eigenen Menschenrechtssituation gaben die Befragten die signifikant größte Unzufriedenheit mit der Regierungsleistung an. In den Bereichen Arbeit, Ausbildung und Einkommen herrscht ebenfalls Unzufriedenheit, die jedoch trotz wirtschaftlicher Rezession im entsprechenden Zeitraum geringfügiger wahrgenommen wird. Diesen Umfragewerten liegt ein korrektes und direktes Verständnis von Demokratie zugrunde. Die Performanz, d.h. das konkrete Verhalten und Handeln der Institutionen wird durch die BürgerInnen anhand der Bereitstellung von politischen Gütern gemessen. Die Bewertung der Leistungen der Institutionen beruht nicht auf einem Demokratieverständnis, das die Demokratie hauptsächlich als Lieferanten materialistischer Güter ansieht. Die Unzufriedenheit in diesen Bereichen spielt eine sekundäre Rolle, die Bereitstellung politischer Güter aber die Hauptrolle(vgl. Garcia et al. 2002: 169). South Africans base their trust on the performance of the government in the delivery of political goods. Thus, it is possible to conclude that the institutions seemingly responsible for democracy in South Africa are not consolidating properly in terms of trust. […] Consequently, if South African democracy is to consolidate, a stronger engagement of these institutions in the field of human rights protection is required. […] If trust in government keeps decreasing, especially among minorities, legitimacy will decline and this may lead to instability, withdrawal or extra-parliamentary mobilisation. (Garcia et al. 2002: 176-177) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 30 ____________________________________________________________________________________________________________________ 3.2.2 Politischer Wettbewerb und Pluralismus innerhalb der Gesellschaft? Die Konsolidierung einer Demokratie und die Erreichung oben genannter Ziele auf der Verhaltensebene sind durch die Begünstigung politischen Wettbewerbs und die Förderung von Pluralismus innerhalb der Gesellschaft zu erreichen. In Südafrika ist das Wahlverhalten nicht direkt durch Rasse oder Ethnizität bestimmt. In den Parlamentswahlen von 1994 und 1999 wirkte dieser Faktor nur indirekt über die sozio-ökonomische Situation und die Informationsnetzwerke der einzelnen Subkulturen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die fragmentierte Gesellschaft anhand des Wahlverhaltens ist nicht zu erkennen, da die Wählerschaft der einzelnen Parteien gemischtrassig ist und, soweit dies in der vom ANC dominierten Parteienlandschaft möglich ist, ein System politischer Konkurrenz vorherrscht. Einzig die Parteien, die ihre Wählerschaft aufgrund ethnischer Zugehörigkeit mobilisieren, wie beispielsweise die ‚Freedom Front Plus’ (VF Plus) oder die ‚Inkatha Freedom Party’ (IFP), bestärken ein Wahlverhalten entlang ethnischer Zugehörigkeit. Dies hat jedoch aufgrund der Marginalität dieser Parteien und der Perzeption von ANC und auch NP/NNP (New National Party) als alle Südafrikaner repräsentierend, keine nationale Bedeutung (vgl. Herzenberg 22.11.2005).24 Jedoch ist soziale Ungleichheit in Südafrika mit Ethnizität direkt verbunden. Armut ist ein fast ausschließliches Problem der schwarzen Bevölkerungsgruppe trotz dem Entstehen einer gemischtrassigen Mittelklasse. Da die Umverteilung durch den ANC bisher nicht stattfand und die soziale Ungleichheit daher Extremwerte erreicht, könnte das Erstarken populistischer Politiken zu einer Konsolidierungsgefahr werden (vgl. Heinrich 2001: 83-84). Die Umverteilungskräfte des ANC sind jedoch stark durch die internationalen Vorgaben der Wirtschaftsliberalisierung und den damit verbundenen Implikationen für die Sozialausgaben gebunden: The way in which domestic politics have been shaped by global forces and global economic policies that emanate from particularly America have been very constraining. What the ANC is capable of doing and the way in which economic policies have been formulated has very much been with one eye to the global environment. That is how the ANC is constrained in terms of what it can do to deliver at the grass roots. (Interview Rupert Taylor 29.08.2005: p.3/5-11) Zusätzlich sind die Beziehungen zwischen den Bevölkerungsgruppen mit großen Defiziten belastet. Mehr als die Hälfte aller SüdafrikanerInnen haben keinerlei soziale Kontakte über ihre eigene ras24 Die südafrikanische Parteienlandschaft besteht derzeit aus 16 verschiedenen Parteien, die im Parlament vertretend sind - wenn auch die meisten nur durch einige wenige Sitze - und zahlreichen mitunter sehr kleinen Parteien lokaler Ausrichtung. Die Parteienlandschaft ist wie auch das politische System noch nicht stabil, und so kam es auch dafür bezeichnend bei der NP zu einem Image- und Namenswechsel hin zur New National Party (NNP), die sich jedoch nach schweren Verlusten in den Parlamentswahlen 1999 zuerst mit der Democratic Party (DP) und der Federal Alliance (FA) zur Democratic Alliance (DA) zusammenschloss, um sich dann aber im August 2004 aufzulösen. Die meisten Repräsentanten der Partei gehören nun zum ANC, wie beispielsweise der ehemalige Parteivorsitzende Marthinus van Schalkwyk, der jetzt das Amt des ‚Minister of Environmental Affairs and Tourism’ inne hat (vgl. SouthAfrica.info, c). Weitere Informationen zu den am 19.12.2005 insgesamt 104 registrierten Parteien Südafrikas, sind der Website der ‚Independent Electoral Commission’ zu entnehmen unter http://www.elections.org.za/registered_parties.asp. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 31 ____________________________________________________________________________________________________________________ sisch definierte Gruppe hinaus. 40% aller SüdafrikanerInnen misstrauen Personen einer anderen Gruppe. Nur 16% der Weißen befürworten eine Heirat zwischen den Rassengruppen verglichen mit 53% der indischstämmigen SüdafrikanerInnen bzw. ebenfalls 53% der schwarzen SüdafrikanerInnen (vgl. Hooper-Box, 07.11.2004). Die Tendenz zum Rückzug in die rassisch definierte Bevölkerungsgruppe ist vor allem bei den Weißen bemerkbar, bedingt durch den veränderten politischen Diskurs in der Öffentlichkeit: As the political focus shifted from the "rainbow nation" to economic inequality in recent years, analysts have attributed the hostile racial attitudes of whites to their feeling marginalised by affirmative action and other initiatives aimed at making up for past disparities. (Hooper-Box, 07.11.2004) Das Vertrauen zwischen den Rassengruppen ist durch eine tief verwurzelte Sozialstruktur im neuen Südafrika nicht radikal herstellbar, soziale Intoleranz ist daher Alltag. Südafrika ist aber nicht entlang einer bestimmten Konfliktlinie gespalten, sondern es liegen „vielmehr mehrere sich überschneidende und dadurch weniger starke Cleavages [HB, innergesellschaftliche Konflikt- und Trennlinien] vor“ (Heinrich 2001: 59). Ethnische Identität und sozioökonomische Situation der jeweiligen Gruppe hängen dennoch stark voneinander ab, wobei der Zusammenhang von Armut und schwarzer Hautfarbe dabei am offensichtlichsten ist (vgl. Heinrich 2001: 55-60). Die südafrikanische Gesellschaft ist laut Rauch durch die Apartheidpolitik extrem ungleich, segregiert und moralisch zerstört. Die Reichweite des Gesetzes und des staatlichen Gewaltmonopols sind durch soziale Bindungen und Normen demnach sehr begrenzt. Die Politik kann solche gesellschaftlichen Strukturen nur sehr eingeschränkt beeinflussen. So ist nicht nur allein die Armut ein Grund für das Ausufern von Gewaltkriminalität. Auch die Auswirkungen der Apartheidvergangenheit, wie die Trennung von Wohn- und Arbeitsort bei der schwarzen Bevölkerung, die viele schwarze Kinder alleine aufwachsen ließ, und die gravierenden Existenz- und Zukunftsängste der Jugend bedingen die exzessive Gewalt, der Polizei und Justiz oft machtlos gegenüber stehen. Die Angst vor Kriminalität erzeugt große Sicherheitsbedürfnisse, als deren Folge wiederum räumliche Trennung zwischen den Menschen und Desintegration - verstärkt durch die immer noch extrem unterschiedlichen Einkommen und Grundstückspreise - entstehen. Das neue Südafrika hat eine unrühmliche Kultur der Gewalt als ‚Apartheid-hang-over’ beibehalten. Inkompetenz und quantitative Überforderung seitens der Behörden treffen mit antistaatsbürgerlichen Verhaltensweisen zusammen - was auf der institutionellen Seite ob der nötigen Transformation im Nach-Apartheid-Staat schwerlich anders zu erwarten, unter Aspekten der inneren Sicherheit jedoch bislang die größte Enttäuschung am Kap war. Die Kriminalitätsbekämpfung leidet zudem eklatant unter dem starken Wohlstandsgefälle, da die Schere zwischen allgemein sichtbarem und persönlich auf legalem Wege erreichbarem Wohlstand weit auseinander geht. (Kaußen 2005: 35) Da Südafrika eine sehr heterogene soziale Struktur aufweist, stellt sich die Frage, ob die fraktionalisierte Gesellschaft nicht problematisch für die demokratische Konsolidierung ist. Fish und Brooks Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 32 ____________________________________________________________________________________________________________________ beschäftigen sich mit dieser Debatte, da eine Reihe von Politikwissenschaftlern multikulturelle Gesellschaften im Bezug auf deren Demokratiepotential als benachteiligt ansehen (vgl. Fish/Brooks 2004: 154). In ethnisch geteilten Gesellschaften könne sich die Kompromissfindung schwierig gestalten, da politische Parteien sich eher nach ethnischen Identitäten orientieren. So entstehe leicht Gewalt zwischen den Bevölkerungsgruppen, die eine offene Gesellschaft untergraben. Eine Zerstreuung ethnischer Konflikte, durch Elitenverhandlungen während der Transformationsphase, könne die demokratische Konsolidierung später verhindern. Bei ihren Untersuchungen stellten Fish und Brooks jedoch für bestehende Entwicklungsgesellschaften, keinen Zusammenhang fest: „open politics is not tethered to social uniformity“ (Fish/Brooks 2004: 162).25 Soziale Homogenität ist demnach keine unbedingte Voraussetzung für Demokratie. Diversität wird oftmals als Vorwand für autoritäre Regierungsführung genutzt, jedoch, so konstatieren Fish und Brooks, „if a robust connection between social homogeneity and political openness does not exist in global perspective, and if a substantial number of the developing world’s relatively liberal democracies are decidedly multiethnic, then the number of plausible pretexts for despotism falls by one.” (Fish/Brooks 2004: 164) Die Untersuchung ist jedoch nur valide, da sie sich auf einen kurzfristigen Zeitraum bezieht und nichts über eine langfristige Konsolidierung der offenen Demokratien ausgesagt wird. Somit spielt die Heterogenität der Gesellschaft eine wesentliche Rolle im Ausbau der Demokratie und kann - muss aber nicht - der Konsolidierung im Wege stehen. 3.2.3 Partizipationsformen und Interessenrepräsentation Partizipationsformen und Interessenrepräsentationskanäle müssen in einer liberalen Demokratie geschaffen, offengehalten und unterstützt werden, um eine Konsolidierung der Demokratie auf der Verhaltensebene der Akteure zu erreichen. Die Beteiligung am politischen Prozess und die Identifikation mit Parteien und politischen Gruppen, welche das pluralistische System unterstützen, dienen der demokratischen Konsolidierung. Partizipationsformen und Interessenrepräsentation sind zwar laut Heinrich in Südafrika „dem demokratischen Kontext angepasst, aber Rasse und Ethnie beeinflussen dennoch den Parteienwettbewerb“ (Heinrich 2001: 69). Politische Intoleranz in Form von politischer Gewalt hat sich stark verringert, und Antisystem-Parteien spielen eigentlich keine Rolle 25 Laut Fish und Brooks sind 19 Länder von 107, die weniger als US$ 6000 Pro-Kopf-Einkommen aufweisen, im Freedom House Index (‚Freedom House’ ist eine US-amerikanische Nicht-Regierungsorganisation (NGO), die globale Indices erstellt für die Freiheit in einzelnen Staaten bezüglich Presserechten, Menschenrechten oder auch Religiöser Freiheit. Weitere Informationen unter: www.freedomhouse.org) zwischen 1998 und 2002 als frei gewertet. „They are exceptions to the generalization that open politics is a luxury that only the rich can afford“ (Fish/Brooks 2004: 162). Diese Länder sind geographisch, bezüglich ihrer religiösen Struktur und ihrer kolonialen Vergangenheit sehr unterschiedlich geprägt. Die durchschnittliche ethnische Fraktionalisierung in diesen heterogenen Gesellschaften der Dritten Welt ist gleich mit dem globalen Durchschnitt. Bezogen auf linguistische Diversität ist der Fraktionalisierungsgrad etwas höher, hinsichtlich religiöser Unterschiede mehr oder weniger gleich dem globalen Schnitt. Bezogen auf die relative Größe der populationsreichsten ethnischen Gruppe liegen diese Länder ebenfalls im Durchschnitt aller Länder der Welt. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 33 ____________________________________________________________________________________________________________________ mehr. Die demokratischen Parteien erfüllen ihre Interessenvermittlungsfunktion nur ungenügend. Beispielsweise rekrutiert der ANC sein Massenklientel aus den armen Bevölkerungsschichten, realisiert aber deren Ansprüche bislang nicht ausreichend (vgl. Heinrich 2001: 69). Rauch beschreibt einen weitgehend reibungslosen Ablauf der bisherigen Wahlen und das Zurückdrängen der Systemgegner vom politischen Parkett. Dies spricht für eine generelle Zustimmung zum demokratischen System. Erwartungen und Unzufriedenheit werden im Rahmen demokratischer Spielregeln diskutiert und verhandelt (vgl. Rauch 2004: 5-7). Im Bereich der Stabilisierung des demokratischen Systems und der Integration machte der ANC durch anfänglich überwältigende Wählerbindung aus dem linken Lager trotz eines neoliberalen Wirtschaftskurses erfolgreiche Politik. Jedoch beweisen die zunehmenden Austrittszahlen und die rückläufige Wahlbeteiligung bei der Jugend einen mittlerweile eintretenden Wählerschwund beim ANC. Trotzdem ist die Vormachtstellung des ANC, welcher mit einer 2/3-Mehrheit regiert, immer noch unangefochten und macht dadurch einen Regierungswechsel derzeit unvorstellbar. Damit ist die so bedeutsame demokratische Machtübergabe bzw. Machtverteilung auf die in Südafrika marginale parlamentarische, wie außerparlamentarische Opposition derzeit unmöglich (vgl. Rauch 2004: 6). Die größte Oppositionspartei, die ‚Democratic Alliance’ (DA), hat im Parlament nur 47 Sitze. Die DA spricht sich eindeutig für einen schlankeren Staat aus, der sich nicht durch affirmative Quoten wie bspw. das ‚Black Economic Empowerment’ (BEE) in die Wirtschaftsstrukturen einmischen soll. Der Vorteil der DA ist es, die rechten, fast ausschließlich weißen, Kräfte im Zentrum zu bündeln und von weiter rechts keine Konkurrenz fürchten zu müssen, analog zum ANC, der die linke Wählerschaft vereint (vgl. SouthAfrica.info, c; vgl. Kaußen 2005: 38). Die Interessenrepräsentation wird andererseits gestärkt durch die parlamentarischen Ausschüsse, die den außerparlamentarischen Interessenvertretern offen stehen und in die sie sich einbringen können. Der ‚National Economic Development and Labour Council’ (NEDLAC) als weiteres konsensorientiertes Gremium der Verhandlungsdemokratie schafft ebenfalls, die Möglichkeit die Repräsentanten aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft mit den Regierungsvertretern an einen Verhandlungstisch zu bringen: „[HB, Dieses Modell trägt] im neuen, noch nicht konsolidierten und ethnisch heterogenen Südafrika zur diversifizierten Interessenartikulation und zum gesellschaftlichen Ausgleich bei“ (Kaußen 2005: 35). Rod Alence sieht die größte Gefahr für ein instabiles System in einem dominanten EinParteien-Regime durch die Konkurrenzlosigkeit des ANC, was sich durch die Wahlen 2004 nur bestätigt hat: „Der ANC verfügt über eine stabile Zweidrittelmehrheit und stellt (seit 2004) in allen neun Provinzen den Regierungschef bzw. die -chefin - vier davon sind neuerdings Frauen“ (Kaußen 2005: 33). Eine ineffektive Interessenrepräsentation durch diese Dominanz in den nationalen und regionalen Parlamenten verhindert demokratische Willensbildungsprozesse. Der ANC als zentraler Akteur für die Konsolidierung auf der Verhaltensebene der Regierung stellt bei zunehmender Verschmel- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 34 ____________________________________________________________________________________________________________________ zung zwischen Staat und Partei die größte Gefahr für die Konsolidierung der südafrikanischen Demokratie dar. Durch seine Dominanz behindert er den politischen Wettbewerb und eine pluralistische Interessenvertretung (vgl. Heinrich 2001: 83-84). Kaußen beschreibt dies als ein Dilemma des neuen politischen Systems: Eine systemtheoretische Ambivalenz der jungen Demokratie besteht darin, dass der ANC zwar erster Garant der stabilen Ordnung ist, gleichzeitig jedoch eine Gefahr für die Konsolidierung pluralistischer Demokratie darstellt. Dieses Paradoxon ergibt sich aus seinem uneingeschränkten Machtstatus, der wegen des nötigen gesellschaftlichen Transformation einerseits erhaltenswert, aus anderer Perspektive wiederum gefährlich erscheint: Uneingeschränkte Macht verschafft nötige Handlungsfreiheit, auch gegenüber starken überkommenen Interessen (weißen wie schwarzen). Einparteienhegemonie birgt jedoch ein Langzeitproblem für die Demokratie , da ein Regierungswechsel nun mal zu ihrem Wesen gehört. (Kaußen 2005: 39) Auch innerhalb des ANC herrscht eine auf den Präsidenten Mbeki zentralisierte Kultur. Es existiert kein starker Pluralismus, sondern die Dominanz des Parteichefs, der auch die Kompetenzen der Regionalregierungen massiv untergräbt und schon mal die Ministerpräsidenten des Amtes abberuft und neu besetzt (vgl. Kaußen 2005: 36). Doch die Voraussetzungen für eine stabile Demokratie sind jedoch laut Alence durch die demokratischen Institutionen, wie Verfassung und Verfassungsgericht, mehr als gegeben: The country’s legacy of political polarization - rooted in deep socio-economic inequality, reinforced by a state founded on racial discrimination, and inflamed by a history of political violence - could hardly have provided a less promising foundation for a stable democracy. (Alence 2004: 79) Und auch Kaußen stimmt hier zu, dass ein bedeutendes Verfassungsgericht die Einhaltung der liberalen Verfassungsprinzipien überwacht, denen auch unter anderem die allgemeinen Menschenrechte und kulturellen Gruppenrechte hinsichtlich Sprache und Erziehung, Rechtsstaatlichkeit und Parteienpluralismus angehören (vgl. Kaußen 2005: 33). 3.2.4 Substantielle und prozedurale Legitimation der Regierungsinstitutionen Die Wahrung und Erhaltung von substantieller und prozeduraler Legitimation ist ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung der Demokratie. Die Beurteilung der Performanz des Staates gegenüber den Bürgern, das heißt gegenüber ihren Bedürfnissen und Rechten, ist Kriterium politischer Stabilität im Bereich prozeduraler Legitimation. Die staatlichen Institutionen sollen rechtsstaatliche Prinzipien und demokratische Prozesse und Maximen umsetzen und fördern. Die substantielle Legitimation, also die Problemlösungsfähigkeit des Staates vor allem in stark problembehafteten Bereichen ist ebenso ein wichtiger Faktor für die Erreichung politischer Stabilität (vgl. Heinrich 2001: 18-19). Prozedurale Legitimation Die prozedurale Legitimation der Regierungsinstitutionen bewertet Heinrich als gut. Die Regierungsinstitutionen beachten im Allgemeinen demokratische Regeln, jedoch untergraben die Beamten des Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 35 ____________________________________________________________________________________________________________________ Staatsapparates - vor allem innerhalb von Polizei - und Gefängnisverwaltung - grundlegende Menschenrechte (vgl. Heinrich 2001: 71-73). Die Verfassung gilt als eine der fortschrittlichsten und ist laut Heinrich eine international angesehene Grundlage für die Entwicklung eines demokratischen Rechtsstaats, in dem politische, soziale und wirtschaftliche Rechte verankert sind. Die Regierung zeigt jedoch Intoleranz gegen Kritik von Seiten der Presse; und auch aus den eigenen Reihen wird Kritik am Regierungskurs wenig beachtet.26 Die Minderheiten im Staat nehmen sich auch aufgrund der ‚affirmative action’ als nicht genug von der Regierung vertreten war. Die Minderheitenrechte der Weißen, Coloureds etc. wurden jedoch konkret nicht beschnitten, und die Regierung ist auf einen Inklusionskurs bedacht (vgl. Heinrich 2001: 70-71). Jedoch fehlt der Verfassung ein spezielles Vetorecht für Minderheiten, die zwar durch die ‚Bill of Rights’, als Kernstück der Verfassung, geschützt sind, jedoch Repräsentation in den Parlamenten nur über das Proporzsystem erlangen können (vgl. Alence 2004: 80-81). Hier sind die von Young angeführten Mechanismen zur Gruppenrepräsentation ein Mittel zur Wahrung der Minderheitenrechte (vgl. Young 1989: 251). Die substantielle Legitimation Die substantielle Legitimation, d.h. die Steuerungsfähigkeit des Staates in problembehafteten Politikfeldern, jedoch wird von Heinrich als mangelhaft angesehen. Das ‚state-builiding’ im Bereich der öffentlichen Verwaltung ist bislang nicht geglückt, und die Autoritätslücke, die sich durch schlechte Steuermoral, eingeschränkter Polizeiarbeit und mangelnder staatlicher Präsenz in den Townships und Homelands bemerkbar macht, wird durch die hohe Kriminalitätsrate nicht kleiner. Die staatliche Steuerungsfähigkeit ist ebenfalls auf dem Sektor der Regierungsperformanz und im Bereich der Arbeitslosenbekämpfung stark durch strikte Fiskalpolitik und ungünstige makroökonomische Rahmenbedingungen eingeschränkt. Vor allem die Bürger niedrigerer Schichten werden dadurch immer unzufriedener (vgl. Heinrich 2001: 73-76). Die Problemlösungskapazität der Regierung im Bereich der sozialen Sicherung und Gerechtigkeit ist nicht ausreichend. Die Analyse der beiden wichtigsten sozialen und ökonomischen Reformprogramme, dem ‚Reconstruction and Development Programme’ (RDP) und dem Programm ‚Growth, Employment and Redistribution’ (GEAR), zeigt, inwieweit die staatliche Wohlfahrtspolitik seit den ersten freien Wahlen 1994 mehr soziale Gerechtigkeit schaffen konnte. Dabei dienen die fünf Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit als Zielkategorien: die Abwesenheit von Armut, das Vorhandensein umfassender Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Inklusion in den Arbeitsmarkt, 26 Im Freedom House Index 2005 wird die Presse in Südafrika als ‚frei’ eingestuft, wobei das Land im globalen Vergleich von 194 Ländern den Platz 58 erreicht und den Wert 26, auf einer Skala von 1-100 zugeteilt bekommt. Bei einem Wert von >31 wäre Südafrika in die Kategorie ‚teilweise frei’ eingestuft worden (>61-100 = ‚nicht frei’), wie bspw. Italien auf Platz 77 mit einem Wert von 35 (vgl. Freedom House, a: 2005). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 36 ____________________________________________________________________________________________________________________ Existenz eines Systems sozialer Sicherung sowie Vermeidung von extremen Unterschieden in Einkommen und Lebensstandard (vgl. Schmidt 2004: 295). Die Regierung Mbeki bewegt sich durch eine Politik zwischen neoliberalistischen und sozialdemokratischen Tendenzen innerhalb dieses Fünfecks. Doch bedient der ANC mit seiner generellen Wirtschaftspolitik hauptsächlich die Interessen der Wohlhabenden und der (neuen) Mittelschicht. Früher oder später wird sich der ANC in Folge der paktierten Transformation in eine Erwartungskrise manövrieren, da die Massen keine unendliche Geduld bezüglich ihrer materiellen Bedürfnisbefriedigung haben werden. Die Investitionsfixiertheit der Regierung bei steigenden Arbeitslosenzahlen hat bisher nicht zu positiven Auswirkungen für die Unterschicht geführt, wohl aber zu einem steigenden BSP von durchschnittlich 3% jährlich seit 1994 (vgl. Kaußen 2005: 36-37). Die Armutsbekämpfung findet demnach durch eine massive Intervention im Bereich der Grundbedürfnisbefriedigung statt und versorgt aus quantitativer Sicht einerseits die Armen des Landes durch Schulspeisungsprogramme, neue Frischwasseranschlüsse, Stromversorgung, Billighäuser, den Bau von Kliniken und der Durchführung von Impfaktionen. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Verbesserungen lässt jedoch in den meisten Bereichen sehr zu wünschen übrig, da die geschaffenen Einrichtungen oftmals nur eine kurze Lebensdauer aufweisen oder die Menschen die hohen Preise für Strom oder Wasser nicht zahlen können. Im Sektor von Bildung und Ausbildung wurden beispielsweise durch, im globalen Vergleich, extrem hohe Staatsausgaben in Höhe eines Anteils von 7,6% des BIP im Jahr 2001 große quantitative Verbesserungen erreicht. Aufgrund von Rationalisierungsinvestitionen und der Schwankung von Rohstoffpreisen sind jedoch viele Arbeitsplätze verloren gegangen, und die Arbeitslosigkeit lag 2001 bei 29,5% (vgl. Schmidt 2004: 291). Das seit 1962 auf die Gesamtheit aller Beschäftigten im formalen Sektor ausgedehnte Sozialsystem besteht damals wie heute aus staatlichen Alterspensionen, Leistungen für Kinder, Familien und Behinderte und anderen Spezialleistungen. Die Einführung einer umfassenden Arbeitslosenversicherung ist geplant (vgl. Kap. 2.3.2), und auch eine universelle monatliche Sozialhilfe wird diskutiert (vgl. Schmidt 2004: 280, 291-291). Derzeit leben bis zu 50% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze von 2 US$ pro Tag, während auf die reichsten 10% der Bevölkerung Südafrikas, das 40% des gesamten BIP Subsahara-Afrikas aufbringt bei einem respektiven Bevölkerungsanteil von nur 7%, 51% des Gesamteinkommens entfallen. Somit liegt der Gini-Index für Südafrika im globalen Vergleich unter den fünf Staaten mit der höchsten Ungleichverteilung (vgl. Schmidt 2004: 278).27 Die Wohlfahrtspolitik der bisherigen Regierungen hat diese Disparitäten und Marginalisierung eines großen Teils der Bevölkerung laut Schmidt nicht bewältigt. Einzig eine schwarze Mittelklasse und die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft sind aus ökonomischer Sicht Gewinner 27 Der Ginikoeffizient hat einen Wert zwischen eins und null, je größer der Wert, desto ungleicher die Einkommensverteilung im Land. Der Koeffizient Südafrikas ist zwischen 1995 und 2001 von 0,60 auf 0,63 gestiegen (UN Development Programme 2003). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 37 ____________________________________________________________________________________________________________________ des südafrikanischen Systemwechsels, so dass „Südafrika noch sehr weit vom Idealtyp einer sozial gerechten Gesellschaft entfernt ist“ (Schmidt 2004: 291-294). Die politische Stabilität sieht Schmidt jedoch erstens aufgrund der massiven Infrastrukturinvestitionen, zweitens durch die großen Sympathien des ANC bei der Mehrheit der schwarzen Südafrikaner und drittens durch Projekte, wie die Propagierung der ‚ rainbow nation’, der ‚African renaissance’ oder die Kampagne ‚proudly South African’, die zum Nation-building auf der Ebene von Integration und Identität beitragen, noch nicht bedroht. Viertens stützen die Gewinner der südafrikanischen Systemtransformation, also die immer größer werdende Mittelklasse, die maßgeblich die Spielregeln der Demokratie mittragen muss, die anti-egalitären Politiken des ANC. Fünftens gibt es keine Alternative in der Parteienlandschaft, die für die hauptsächlich schwarzen Marginalisierten wählbar wäre. Doch der Rückzug ins Private, von der „res publica hin zu den res privatae“ (Merkel 1999: 116), wird durch die Herausbildung von sozialen Bewegungen, die die Marginalisierten mehr und mehr mobilisieren, gestoppt, und es entsteht langsam eine Alternativendebatte um sozialdemokratische Werte (vgl. CSS 2004; Schmidt 2004: 294). There are a range of new social movements that have arisen precisely because of the lack of delivery. At the moment they do not represent a fundamental threat to so-called democratic stability because the number of people involved are not yet that great […] organisationally not that powerful […] Anti-Privatisation Forum, Landless People’s Movement, Durban Social Forum, Soweto Electricity Crisis Committee. (Interview Rupert Taylor 28.09.2005: 2/33-3/2, 13-16) 28 Der südafrikanische Systemwechsel, von den politischen Akteuren als Kompromiss ausgehandelt, basiert bis heute auf einer Verhandlungs- und Kompromisskultur, deren Ziel es ist, die Inklusion möglichst aller relevanter Gruppen zu erreichen. Der ANC vermeidet radikale Politiken im für den Post-Apartheidstaat so zentralen Bereich der Wohlfahrtspolitik, was in den drei folgenden Punkten deutlich wird: Erstens durch die hohen Sozialausgaben, finanziert durch Haushaltsumschichtungen anstatt Umverteilung, zweitens durch die korporatistische und intransparente Kompromissfindung im Bereich der Arbeitsgesetzgebung bei den Verhandlungen zwischen Regierung, Unternehmens- und Arbeitervertretung und drittens durch die Aushandlung der Regierung der ‚affirmative action’, des BEE, mit der weißen Wirtschaftselite. Die Armutsreduzierung hat zwar Erfolge im Bereich der Grundbedürfnisbefriedigung gezeigt, jedoch die soziale Ungleichheit nicht signifikant verringert (vgl. Schmidt 2004: 295-296). Das RDP war ursprünglich vor der Wahl 1994 als ein Programm vom ANC, COSATU und der ‚South African Communist Party’ (SACP) - die auch heute bei Wahlen noch als eine sog. Dreiparteienallianz immer noch mit dem Anschein einer sozialen Bewegung auftritt - aufgelegt worden. Es sollte die überkommenen Wirtschaftsstrukturen in die Post-Apartheidzeit 28 Mehr über die ‚grass-roots’-Bewegungen unter: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4720023.stm (Landless People’s Movement), http://www.nu.ac.za/ccs/default.asp?3,28,10,1193 (Centre for Civil Society’ wie auch das ‘Durban Sohttp://www.apf.org.za (Anti-Privatisation Forum), cial Forum’), http://www.queensu.ca/msp/pages/In_The_News/2001/June/sec.htm (Soweto Electricity Crisis Committee). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 38 ____________________________________________________________________________________________________________________ mittels Wachstum durch Umverteilung überführen. Trotz dass das RDP kurz nach seiner Einführung vom Programm GEAR mit einer starken Ausrichtung auf die Reduzierung fiskalischer Defizite ersetzt wurde, konnte mit kleineren Budgets in den Bereichen der Wohnungsbereitstellung, der Wasserversorgung und des Gesundheitssystems Erfolge erzielt werden. Jedoch blieben die substantiellen Einkommensunterschiede, und die große Arbeitslosigkeit konnte nicht beseitigt werden. Die Judikative erfüllt aufgrund der großen Nähe zwischen der Exekutive und der Legislative eine partielle Ersatzfunktion für verantwortliche Regierungsführung. So favorisierte beispielsweise der ‚Supreme Court’ den durch die ‚Treatment Action Campaign’ (TAC) angestrebten Einsatz antiretroviraler Medikamente gegenüber der ANC-Politik. Die Konsolidierung der Demokratie wird laut Alence von der Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Probleme abhängen, unter denen die Bekämpfung der Aids-Pandemie, die Einkommensungleichheit, die Armut und die grassierende Kriminalität am drängendsten sind: „...democratic regimes are at least susceptible to breakdown where they are associated with improvement in material welfare that are widely distributed throughout society“ (Alence 2004: 90). Heinrich kommt zu dem Ergebnis, dass alle Indikatoren, die ein abruptes oder zeitlich nahes Ende der Demokratie beschreiben sich positiv entwickelt haben, und daher prognostiziert er eine langsame Erosion der Demokratie, da die Enttäuschung der Bürger über die negative Performanz der Institutionen und über den niedrigen Wirkungsgrad des Regierungshandelns im Bereich zentraler Problemlagen eher zunimmt (vgl. Heinrich 2001: 81-84). 3.2.5 Das Prinzip der horizontalen Verantwortlichkeit Dass ein System der horizontalen Verantwortlichkeit innerhalb der Regierung, der demokratischen Institutionen und der staatlichen Administration vorherrscht, ist Merkmal demokratischer Staatsformen. Nur so kann eine Stabilisierung des jungen demokratischen Systems erreicht werden. Die ‚übertragenene’ Macht und die daraus resultierenden Kompetenzen sind von einem verantwortungsvollen Verhalten zu tragen, das den Normen und Gesetzen des Rechtssystems folgt. Im Rahmen der horizontalen Verantwortlichkeit markieren Übergriffe von südafrikanischen Regierungsinstitutionen in rechtlich anderen Institutionen zugehörige Bereiche eine kleine Gefahr. Einzig die langfristige Erosion der Verfassungsnormen - forciert durch den ANC - ist bedenklich. Ein autoritärer Putsch durch die Regierung oder das Militär ist für Heinrich nicht denkbar (vgl. Heinrich 2001: 77). Dass die ehemaligen staatlichen Sicherheitsinstitutionen 1994 in den Elitenkompromiss eintraten, wirkt bis heute fort und ist ein beruhigendes Beispiel für den großen Pakt der Südafrikaner. Dadurch ist das staatliche Gewaltmonopol bislang unangefochten, was für die demokratische Konsolidierung ein essentieller Faktor ist. (Kaußen 2005: 34) Die Verfassungsmäßigkeit des Regierungshandelns wird durch das Verfassungsgericht, der Menschenrechtskommission, der Gleichstellungskommission und dem Ombudsman gewährleistet. Der Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 39 ____________________________________________________________________________________________________________________ schwachen parlamentarischen Opposition steht eine außerparlamentarische Zivilgesellschaft zur Seite, die aber die Machtfülle der Regierung nur respektiv wenig beschneiden kann (vgl. Heinrich 2001: 76-78). Korruption ist eine mögliche Barriere gegen die Entwicklung einer demokratischen Kultur. Obwohl der Ombudsmann, die Behörde für schwere Wirtschaftsvergehen und die Registrierungsstelle für das Vermögen der Parlamentarier und eine Anti-Korruptionssondereinheit unter Richter Heath die Korruption bekämpfen, untergräbt diese massiv die Rechtsstaatlichkeit, „indem sie für Intransparenz im politischen Entscheidungsprozess und Ungleichheit bezüglich der individuellen politischen Partizipation sorgt“ (Heinrich 2001: 77). Korrupte Beamtenstrukturen sind das klientelistische Erbe des Apartheidregimes. Nur wenige Eingaben von Seiten der Regierung kamen an die o.g. Ämter und Institutionen. Durch die nicht adressierten Problemlagen und Unzufriedenheiten könnten antidemokratische Bewegungen bei den Minderheiten und der Landbevölkerung Unterstützung finden, was von der Regierung mit autoritären Politiken beantwortet werden könnte. Die strukturellen Bedingungen können die Konsolidierung eines politischen Systems beeinflussen, jedoch sind die Akteure die Handelnden, die „Gelegenheitsstrukturen ausnutzen, oder eben nicht“ (Heinrich 2001: 8384). Bisher wahrt die Regierung jedoch rechtsstaatliche Prinzipien, und die demokratischen Strukturen verhindern bisher ein solches Szenario (vgl. Heinrich 2001: 83). Auch Rauch bestätigt eine weitere Zunahme der Korruption (vgl. Rauch 2004: 4-5). Staatsbeamten zeigen in weitreichenden Skandalen ihr oftmals minimales Verständnis von staatsbürgerlichem, solidarischem Verhalten: An estimated 15 000 civil servants are unlawfully getting social grants from the government. […] Leading the pack was KwaZulu-Natal, where not only were 3 674 provincial officials getting grants unlawfully, but a further civil servants employed by national government were benefiting similarly. […] Sikweyiya [HB, the social development minister] has previously warned social officials involved in any crimes that exploit the social grants system face arrest and prosecution […]. (Carter, 18.12.2005) Eine laut Alence in der frühen Phase der Transition angedachte Konkordanzdemokratie kam für Südafrikas geteilte Gesellschaft nicht zustande. Das Wahlsystem basiert allerdings auf proportionaler Repräsentation. Formal ist das politische System als parlamentarische Demokratie zu klassifizieren, da der Präsident aus den nationalen Parlamentswahlen hervorgeht. Jedoch hat der Präsident derzeit eine Fülle von Kompetenzen, nicht zuletzt durch die Zweidrittelmehrheit, erreicht durch freie und faire Wahlen, seiner Parteienallianz im Parlament, was zur Verschmelzung der Gewalten im System führte. Kaußen diagnostiziert hier eine „partiell defekte Demokratie“ und bezeichnet das System als „Superpräsidialismus“ (Kaußen 2005: 34). Diese Verschmelzung der Gewalten ist für die Demokratie eine Gefährdung und ein Übergriff auf eine staatliche Institution durch den ANC, jedoch durch die Wählenden legitimiert. Doch verschiedene Beispiele beweisen, dass die durch das Gesetz autorisierten Institutionen gegen illegales Handeln in der Regierung vorgehen können. Die National Prosecution Authority (NPA) konnte vor Gericht gegen das korrupte Verhalten des persönlichen Finanzberaters des Vizepräsidenten Jacob Zuma zu Felde ziehen und warf auch dem Vizepräsidenten im Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 40 ____________________________________________________________________________________________________________________ größten Skandal der jungen Demokratie Korruption vor, was die funktionierenden Systeme horizontaler Verantwortlichkeit nachweist. Zusammenfassung: Probleme demokratischer Konsolidierung in Südafrika Die Analysten der südafrikanischen Konsolidierung stellen ein breites Spektrum an Politikbereichen vor, die die Stabilität des südafrikanischen Systems gefährden. Allen Problemen voran ist die Dominanz des ANC zu nennen und die Alternativlosigkeit der Parteienlandschaft. Das derzeitige südafrikanische Ein-Parteien-System ist durch die Verschmelzung von Exekutive und Legislative gekennzeichnet und vereinigt auf der Seite des ANC eine große Machtfülle. Der ANC verteidigt seine Regierungspolitik vehement gegenüber der Presse. Hauptsächlich das Verfassungsgericht und die zusätzlichen Institutionen zur Wahrung bürgerlicher Rechte und Freiheiten stellen Kontrollorgane der Regierungspolitik dar. Inklusionsbestrebungen und eine vorherrschende Kompromisskultur sind zwar vorhanden, jedoch sind die Interessenrepräsentationskanäle ohne parlamentarische Opposition und nur mit einer langsam erstarkenden, außerparlamentarischen Opposition, das heißt den neuen sozialen Bewegungen, ungenügend. Der ANC hat den Vorteil der Beliebtheit bei der schwarzen Mehrheit der Bevölkerung durch die Zeit des Antiapartheidkampfes. Der Unzufriedenheit der Marginalisierten, entstehend durch hohe Arbeitslosigkeit und der immer noch unüberwindbar scheinenden Einkommensdisparitäten Armut, Gewaltkriminalität und der HIV/Aids Pandemie, wird nicht entschieden genug begegnet und macht so die jungen Nichtwähler und die vom ANC Verdrossenen empfänglich für populistische Politikversprechen. Derzeit sind keine aktiven Systemgegner innerhalb des politischen Spektrums vorhanden. Die Verbesserung der Infrastruktur kommt den von Armut betroffenen zugute. Doch die vielen Fälle von Korruption und Menschenrechtsverletzungen durch die Repräsentanten des Staates und eine missglückte Reform der öffentlichen Verwaltung lassen das Vertrauen in die politischen Institutionen sinken. Die politische Kultur ist vermehrt geprägt von politischer Toleranz und einer großen Legitimationsbasis für die südafrikanische Nation, u.a. erzeugt durch ‚nation-building projects’. Jedoch ist eine soziale Intoleranz zu verzeichnen, die die verschiedenen Bevölkerungsgruppen nebeneinander her leben lässt, wobei das Ziel der Versöhnung aber ein Mehr an Integration beinhaltet. Die soziale Heterogenität wird durch integrationspolitische Kampagnen als positiv dargestellt, und ihre Vorteile werden zum Nutzen aller Bürger verteidigt. So stellen sie grundsätzlich keine Gefahr für die demokratische Konsolidierung dar. Die Wende des ANC in der volkswirtschaftlichen Strategie wird von positiven makroökonomischen Daten getragen. Jedoch ist die Distributionskapazität des Staates sehr begrenzt und der Verlust an Arbeitsplätzen hoch. Die erfolgreiche ‚neue’ schwarze Mittelklasse profitiert von der Wirtschaftspolitik des ANC und dessen ‚affirmative action’ Programmen. Trotzdem schaffen die Mehrheit der Marginalisierten dadurch Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 41 ____________________________________________________________________________________________________________________ nicht den sozialen Aufstieg, und die Einkommensdisparitäten vergrößern sich vor allem innerhalb der schwarzen Bevölkerungsgruppe. Aufgrund dieser Probleme, die sich dem Prozess der demokratischen Konsolidierung entgegenstellen, läuft das politische System Südafrikas Gefahr, den Status einer liberalen Demokratie nicht zu erreichen. Südafrika hat seit dem Ende der Transformationsphase und den ersten demokratischen Wahlen weit mehr als nur die Kriterien einer elektoralen Demokratie erfüllt. Fehlende Legitimation und weiterhin bestehende Problemfelder können jedoch im Bereich staatlicher Steuerungsfähigkeit die Errungenschaften einer zum Teil liberalen und pluralistischen Gesellschaft leicht zunichte machen und demokratische von autoritären Strukturen abgelöst werden. Es ist daher notwendig, Lösungen aus den verschiedensten Politikfeldern zu suchen, die den Prozess der Konsolidierung weiterbringen. 4 Beschäftigung mit Vergangenheit in politischen Systemen nach Systemunrecht29 Die vorangegangene Darstellung der Systemtransformation in Südafrika versuchte, die gesellschaftlichen Subsysteme möglichst weitreichend zu berücksichtigen. Denn die Beschäftigung mit der Transformation von Systemen ist eine klassisch interdisziplinäre Themenstellung, weil nicht nur einzelne Subsysteme (etwa das politische, das ökonomische, soziokulturelle, etc.), sondern das jeweilige Gesamtsystem in der Vernetzung seiner Subsysteme betroffen ist. (Sandschneider 1995: 80) Die Vergangenheitspolitik als Teil der Systemwechselforschung sieht sich ebenfalls Anforderungen interdisziplinärer Art ausgesetzt. Eine holistische Beschäftigung mit der Vergangenheit muss ebenfalls auf allen Subsystemen des überkommenen autoritären Systems stattfinden. Inwieweit dieser Prozess in Südafrika fortgeschritten ist, welche Theorien zur Vergangenheitspolitik existieren und welche gemeinsamen Ziele Vergangenheitspolitik und demokratische Konsolidierung haben, wird in den nächsten Kapiteln diskutiert. In den nachfolgenden Abschnitten zur Beschäftigung mit Vergangenheitspolitik im Allgemein und der südafrikanischen im Besonderen wird zuerst auf die Erinnerungsfähigkeit des Menschen eingegangen, um dann die Notwendigkeit der Beschäftigung mit Vergangenheit im Rahmen eines demokratischen Systemwechsels und die Zusammenhänge zwischen Vergangenheitspolitik und Systemtransformation darzustellen. Daraufhin werden verschiedene Konzepte zur Analyse von Vergangenheitspolitik zusammengeführt und als Analyseraster auf das Fall29 Der Begriff des Systemunrechts bezieht sich auf die politik-, bzw. staatsgesteuerte Kriminalität, die nach dem Fall eines autoritären Systems, welches sich nach dem Recht des Folgesystems oder nach internationalem Recht kriminell verhalten hat, strafrechtlich geahndet und als Unrecht verurteilt werden soll. Im Falle Südafrikas wird jedoch das Unrecht des Systems stellvertretend durch Individualtaten geahndet, da die Justiz keine weitere Handhabe bietet. Eine Wahrheitskommission hätte jedoch außerhalb der rechtlichen auch die politische Möglichkeit ein Unrechtssystem politisch zu verurteilen, was jedoch durch die TRC nicht entschieden genug vorgenommen wurde, wie noch im Folgenden gezeigt werden wird (vgl. Eser/Arnold 2000: IX). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 42 ____________________________________________________________________________________________________________________ beispiel Südafrika angewandt. Die idealtypische Kategorienbildung dient dabei einzig und allein der Erstellung eines operationalisierbaren Analysemusters und verneint nicht die Interdependenz der Kategorien untereinander. 4.1 Erinnerung oder Vergessen? Grundsätzliches zur gegenwärtigen Vergangenheit Der Wechsel von einem politischen System zu einem anderen ist kein idealtypischer Schnitt, der das Alte vom Neuen abtrennt, sondern ein Prozess, der neben vielen schwer veränderbaren strukturellen und sozialen Altlasten u.a. auch die Erinnerung der Menschen an das alte System in das neue System als sozialpsychologische Dimension mitnimmt. „Politische und gesellschaftliche Strukturen sowie habituelle Gewohnheiten sind langlebig und hören mit dem Ende der ihnen korrespondierenden politischen Systeme keineswegs zu existieren auf“ (König 1998: 376). Die Erinnerung an das Vergangene ist für den Einzelnen wie für die Gesellschaft ein Prozess der subjektiven Auswahl und Deutung. Die Gesellschaft bietet dem Individuum eine sozial konstruierte, kollektive Vorstellung des Vergangenen an, die es , abhängig vom System, nicht völlig ablehnen kann.30 Diese Geschichtsdeutungsmacht verursacht, da sie im Kampf um Macht und Beeinflussung der sich identifizierenden Massen als Instrument genutzt werden kann, immer wieder Konflikte (vgl. Arenhövel 2000:11). Vergangenheit ist einerseits das Geschehene, das nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Andererseits ist Vergangenheit die konstruierte Vorstellung des Geschehenen, wobei eben der Vorgang der Konstruktion erlaubt, im Nachhinein auf das Vergangene durch Interpretation einzuwirken (vgl. Fritze 1996: 109-110). Die Bewertung des Vergangenen findet sowohl durch aktive Beschäftigung und Deutung als auch durch Verdrängen und Vergessen statt, da das Vergessen selbst nicht einem gänzlichen Tilgungsvorgang entspricht; vergangene Wirklichkeiten und Bilder von Wirklichkeiten werden gelagert, um in korrelativen Situationen wieder aktualisiert zu werden (vgl. Luhmann 1997; vgl. Arenhövel 2000: 16). Dennoch erreicht eine bewusste, teleologischen Beschäftigung mit Vergangenheit einen höheren Stellenwert als eine Politik des Vergessens, da letztere dem Kollektiv kein Deutungsmuster anbietet und somit das Geschehene in die Diffusität abgleiten lässt. Die Art des Umgangs eines Staates mit seiner Vergangenheit ist besonders in postautoritären Systemen von elementarer Bedeutung. Eine Politik des Verdrängens und Vergessens hält ein kollektives Gedächtnis aufrecht, das auch Schuld verdrängt und an alten Wertvorstellungen festhält. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hingegen, die Offenlegung von Verbrechen und ihre Verurteilung, kann verhindern, dass negative Tendenzen im Bewusstsein eines Volkes, dem Träger der Demokratie, fortleben. (Höchst 2003: 5) 30 Maurice Halbwachs hat in den 1920er Jahren den erinnernden Menschen innerhalb des sozialen Gefüges untersucht und widerlegt, dass das Gedächtnis die Geschichte perfekt widerspiegelt. Erinnerung ist geprägt durch Selektion, durch Deutung und Sinngebung mittels bewusster und unbewusster Verfahren sowie durch soziale Konstruktion (vgl. Halbwachs 1967) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 43 ____________________________________________________________________________________________________________________ 4.2 Der Begriff der Vergangenheitspolitik und seine realpolitischen Inhalte Um die Frage zu erörtern, was hinsichtlich der autoritären Vergangenheit einer Nation getan werden soll, ist im Voraus gleichsam eine Einschränkung durch die freie Wählbarkeit des Prozesses zur Beschäftigung mit Vergangenheit vorzunehmen: „Accountability processes are intimately interrelated with the type of transition. The more a transition entails the defeat of the old authoritarian elite and repressors, the wider is the scope for truth and justice policies” (Barahona de Brito et al. 2001: 11). Durch diese Vorbedingungen wird bezüglich des Umgangs mit der Vergangenheit nach einem Systemwechsel ein umfangreicher Maßnahmenkatalog geschaffen.31 Die Strukturen des vorangegangenen politischen Systems, ihr Grad und ihre Dauer an autoritärer Repression sowie die Art der Transformationsphase - der Übergangstyp - beeinflussen die Strategien der Beschäftigung mit Vergangenheit. Im Einzelnen werden daher auch verschiedene Termini genutzt, um die Art der entsprechenden Politiken treffend beschreiben zu können. Vergangenheitspolitik als neutraler Terminus bezieht sich dabei einerseits auf praktischpolitische Maßnahmen von Judikative, Exekutive und Legislative in Bezug auf die Hinterlassenschaften des überkommenen autoritären Systems, die nach Bock und Wolfrum aus drei Elementen bestehen: Das Element der Bestrafung, d.h. der Identifikation und der sich anschließenden strafrechtlichen Verfolgung nach nationalem und auch internationalem Recht, die Disqualifikation der Täter, d.h. die Einschränkung des zivilbürgerlichen Status der Täter, was beispielsweise im Verbot zur Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts münden kann, und der Restitution, d.h. der Wiedergutmachung und Entschädigung der Opfer. Andererseits bezieht sich die Vergangenheitspolitik auch auf diejenigen öffentlichsymbolischen Handlungen, die über die Interpretation von Vergangenheit versuchen, kollektive Identitäten zu prägen und das Geschichtsbewusstsein durch Rituale oder Diskurse unter der Zuhilfenahme von Medien öffentlich zu beeinflussen (vgl. Bock/Wolfrum 1999: 8-9). Dazu gehören auch die Handlungen bezüglich der Aufklärung der Gesellschaft, die durch die öffentliche Zugänglichkeit von Akten und Archiven, die Verankerung eines Diskurses um die belastete Vergangenheit im öffentlichen Raum und die Beschäftigung mit dem Vergangenen im pädagogischen und kulturellen Bereich erreicht werden kann (vgl. König 1998: 371-373). In Anlehnung an König ist der Begriff der Vergangenheitspolitik definiert als die Gesamtheit jener Handlungen und jenes Wissens [...], mit der sich die jeweiligen neuen demokratischen Systeme zu ihren nichtdemokratischen Vorgängerstaaten verhalten. Es geht dabei vor allem um die Frage, wie die neu etablierten Demokratien mit den strukturellen, personellen und mentalen Hinterlassenschaften 31 Die Maßnahmen reichen von „[...] Schlussstrichen und Amnestien über Disqualifizierungen, Strafverfahren und Lustrationen bis zu Wahrheitskommissionen“ (König 1998: 376). Die Begriffe Amnestie und Disqualifizierung, zu der die Lustration (ursprünglich altrömische Reinigungsrituale beschreibend) eine Subkategorie darstellt, werden im Zuge der Beschreibung von Instrumenten zur Reaktion auf Systemunrecht noch detaillierter definiert. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 44 ____________________________________________________________________________________________________________________ ihrer Vorgängerstaaten umgehen und wie sie sich in ihrer Selbstdefinition und in ihrer politischen Kultur zu ihrer jeweiligen belastenden Geschichte stellen. (König 1998: 375) Diese weitreichende Definition lässt ein ebenso weites vergangenheitspolitisches Feld entstehen, welches es ermöglicht, das Ausmaß vergangenheitsbezogener Politikinhalte zu verdeutlichen und ernsthafte Vergangenheitspolitik zu betreiben. In Abgrenzung zu diesem Begriff der Vergangenheitspolitik stehen die Termini der Vergangenheitsbewältigung (overcoming the past), der Beschäftigung mit Vergangenheit (dealing with the past), der Aufarbeitung der Vergangenheit (working through the past) und des Umgangs mit Vergangenheit (cope with the past), die alle eine bestimmte Bedeutung und Tiefe der Handlung mittragen, jedoch systematisch nicht mit aktiven Maßnahmen der Vergangenheitspolitik verschränkt werden können und daher der folgenden Analyse nicht dienlich sind.32 Ob großes Systemunrecht mit all seinen menschenverachtenden Auswirkungen durch rechtsstaatliche und administrative Verfahren ausreichend gesühnt, bestraft und für die Opfer befriedigend und gerecht bearbeitet werden kann, ist fraglich, da sich für die handelnden Politiker oft ein Dilemma zwischen der von Max Weber definierten ‚Gesinnungsethik’ und der ‚Verantwortungsethik’ ergibt (vgl. Weber 1993: 70-71). Dies gilt vor allem in paktierten Übergängen, die den alten Eliten eine Sicherung bestimmter Machtzentren zuweisen. Nach Weber kann ein verantwortlicher Politiker nicht immer nach seiner moralischen Gesinnung handeln, da er mögliche negative Konsequenzen schon vorab versuchen muss zu vermeiden, um seinem eigentlichen politischen Ziel, der Etablierung einer demokratischen Gesellschaft, nicht zu Schaden. Das verantwortungsethische Handeln des Politikers muss sich jedoch in einer veränderten Machtkonstellation im politischen System anpassen und dem gesinnungsethischen Standpunkt, der etwa die Einhaltung von völkerrechtlichen Prinzipien repräsentiert, annähern. Beispielsweise wird die Motivation von Menschenrechtsorganisationen häufig als rein gesinnungsethisch abgewertet. Jedoch sind diese als ‚moralisches Gewissen’ einer Gesellschaft notwendig, damit das Thema Vergangenheitsbewältigung nicht völlig von den ‚Sachzwängen’ beherrscht wird und sich Politiker nicht allzu bequem hinter dem Argument einer ‚Verantwortungsethik’ verschanzen können. (Nolte 1996: 15) Die Vergangenheitspolitik im rechtsstaatlichen Rahmen ist mit der Hoffnung verbunden, erfolgreicher zu sein als die blutige Revolution, die Rache nimmt an den Verursachern, da sie eine neues soziales Gefüge auf demokratischen und naturrechtlichen Prinzipien aufzubauen sucht, ohne im gleichen Atemzug diese zu verletzen (vgl. König 1998: 389-390). Jedoch ergibt sich in der Zeit des politischen Systemwechsels ein moralisches Dilemma: 32 So verwirft auch Jörg Arnold im Rahmen des Freiburger Forschungsprojekts „Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse“ die Begriffe Vergangenheitsbewältigung und aufarbeitung als untauglich aufgrund ihrer Ungenauigkeit (vgl. Arnold 2000: 11). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 45 ____________________________________________________________________________________________________________________ Auf der einen Seite stand der moralische Anspruch, dass Unrecht gesühnt werden muss und die Verantwortlichen bestraft werden sollen. Diese Forderung konnte in der Praxis mit dem Wert, welcher der Konsolidierung der Demokratie zugemessen wurde, kollidieren. (Nolte 2000: 297) Die Einrichtung von Wahrheitskommissionen bieten die Möglichkeit, das Dilemma zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, zwischen Forderungen nach Aufklärung, Menschenrechtswahrung und Gerechtigkeit für die Opfer einerseits und machtpolitischen Zwängen andererseits bis zu einem gewissen Grad zu kompensieren. Die vergangenheitspolitischen Defizite, ihre Institutionen und ihre Errungenschaften sind ein Spiegel demokratischer Konsolidierung, der wechselseitig hilft, beide Prozesse über die Zeit verändert voranzutreiben (vgl. Nolte 1996: 16; vgl. Arenhövel 2000: 166). 4.3. Konzept zur Analyse des Politikfeldes Vergangenheitspolitik Der Prozess der Beschäftigung mit Menschenrechtsverletzungen durch das politische System hat nach Nolte zwei Dimensionen: die Problematik des Umgangs mit Tätern und Opfern sowie deren Reintegration und die Interpretation von Vergangenheit durch das Kollektiv und den handelnden politischen Akteuren. Diese beiden Dimensionen werden im folgenden Abschnitt zum Aufbau eines Paradigmas zur Vergangenheitspolitik zentrale Bedeutung finden (vgl. Nolte 1996: 19). Mehrfach wurde schon versucht, ein Konzept zur Analyse von Vergangenheitspolitik zu entwickeln. So veröffentlichte auch Helmut Quaritsch einen Artikel mit dem vielversprechenden Titel „Theorie der Vergangenheitsbewältigung“ (Quaritsch 1992), der jedoch Vergangenheitspolitik anhand historischer Beispiele nachzeichnete und daraus Erkenntnisse zu verallgemeinern suchte, ohne dabei mehr als Hypothesen aufzustellen. Da durch diesen Artikel die Theorieproduktion angestoßen wurde, soll er auch in der vorliegenden Falldiskussion nicht unbeachtet bleiben (vgl. Bock 2000: 513, vgl. König 1998: 378). Erst König legte 1998 ein systematisches Konzept vor, das eine Dekodierung des Prozesses der Vergangenheitsbewältigung ermöglichen soll. Auch die Autoren Bock (2000) und Arenhövel (2000), Höchst (2003) und Eser / Arnold (2001) haben zur Theoriebildung der klassischen Forschung zur Vergangenheitsbewältigung beigetragen. Eser und Arnold unterscheiden in einem Vier-Säulenmodell zwischen normbezogenen, institutionenbezogenen, täter- und opferbezogenen Reaktion der Vergangenheitspolitik. König folgt der Differenzierung zwischen Zielen, Ebenen, Akteuren und Wegen. Um die Vergangenheitspolitik Südafrikas jedoch als realpolitisches Politikfeld bearbeiten zu können, wird im Folgenden ein Standardverfahren der Analyse öffentlichen Handelns von Prittwitz mit den klassischen Theorien von König und Eser / Arnold und König verknüpft, was eine Erleichterung der Aufschlüsselung des Analyseterrains bedeutet.(vgl. Prittwitz, 1994: 229-230). Daraus ergeben sich folgende Analysekategorien: 1. Akteure, akteursbezogene Analyseebenen und Ausgangssituation der Vergangenheitspolitik 2. Handlungsziele der Vergangenheitspolitik Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 46 ____________________________________________________________________________________________________________________ 3. Überblick vergangenheitspolitischer Handlungsfelder und Handlungsoptionen 4. Darstellung konkreter vergangenheitspolitischer Handlungen, zustande gekommene und ausgebliebenen Maßnahmen 5. Bedingungen, die wirkungsvolles Handeln erschweren bzw. erleichtern 6. Empfehlungen bezüglich der kommenden Vergangenheitspolitik33 Dieses Paradigma, welches stark akteurszentriert genutzt werden soll, wird durch die Ausführungen in den nächsten Kapiteln noch detaillierter dargestellt, jedoch vorab zum besseren Verständnis durch folgendes Schaubild graphisch dargestellt. Abb. 5: Ziele und Einflussfaktoren auf die Vergangenheitspolitik im Systemwechsel (Eser/Arnold 2001: 17) 4.3.1 Akteure, akteursbezogene Analyseebenen und Ausgangssituation der Vergangenheitspolitik Laut Prittwitz bestimmen die Akteure die Ausgangssituation und die Bedingungen eines erschwerten oder erleichterten Handelns innerhalb eines Politikfeldes (vgl. Prittwitz 1994: 229). Daher ist die Analyse von Vergangenheitspolitik auf das Verhalten der Akteure im und ihre Einstellungen zum politischen Prozess und dessen Zielen konzentriert. Einstellungen und Verhalten bilden zusammen die akteursbezogenen Analyseebenen (vgl. König 1998: 379). 33 Die Empfehlungen, die aus der Analyse der Vergangenheitspolitik Südafrikas gewonnen wurden, werden in Kapitel 6 mit den Empfehlungen zu den Handlungen bezüglich der demokratischen Konsolidierung ausgesprochen. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 47 ____________________________________________________________________________________________________________________ Die Ausgangssituation ist über die Analyse der Kräfteverhältnisse während der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphase zu bestimmen. Welcher politische Akteur bestimmt die Verhandlungen um das neue politische System, wer dominiert in Fragen von vergangenheitspolitischer Relevanz? Die politischen Akteure lassen sich in die weitgefasste Dichotomie von Opfern, die unter politisch motivierter Verfolgung gelitten, und Tätern, die zur Aufrechterhaltung des alten Systems beigetragen haben, unterteilen. (vgl. Bock 2000: 2, vgl. König 1998: 387-388). Da „Vergangenheitspolitik den interessensgeleiteten Umgang mit den als belastet eingestuften institutionellen, personellen und materiellen Hinterlassenschaften eines zu überwindenden oder überwundenen Systems im politischen Prozess“ (Bock 2000: 2) bezeichnet, ist diese Unterscheidung nicht weitreichend genug. Von zusätzlicher Aussagekraft sind die Positionen von Tätern und Opfern innerhalb des neuen Systems, bzw. die eher aktive oder passive Rolle der Täter (Nutznießer, Funktionäre oder Sicherheitskräfte) und Opfer (Kombatanten oder Zivilisten) im alten System. Die Position eines Akteurs innerhalb des politischen Systems bedingt dessen Partizipationskapazität am politischen Entscheidungsprozess (vgl. Kap. 1.1). Vertritt der Akteur im neuen System seine Interessen und Ziele innerhalb von Exekutive und Legislative oder außerhalb des Staatsapparates auf der Seite außerparlamentarischer Interessenvertretung oder durch Wirtschaftsmacht? Die wichtigsten Arenen des politischen Systems sind die Institutionen und Organisationen. Sie bestimmen durch ihre Beschaffenheit und die sie dominierenden Akteure, faktische Vergangenheitspolitik. Die staatlichen Institutionen lassen sich unter den Termini Legislative, Exekutive und Judikative subsumieren. Gerade die Judikative ist der Verantwortung ausgesetzt, sich selbst als Fundament einer ehemaligen Unrechtsordnung einer Lustration zu unterziehen und zu unterscheiden zwischen einer Gerechtigkeit, die aus den unveräußerlichen Naturrechten des Menschen kommt und jener, die dem positiven Recht und der Garantie von Rechtssicherheit entspringt.34 Vor allem der Verfassung und der ihr entspringenden Gesetze sowie der Regierung und deren Politiken muss in einer Analyse der Vergangenheitspolitik besondere Aufmerksamkeit gelten. Gesellschaftliche Institutionen und Organisationen, wie die traditionellen Verbände, die Kirchen, die Wissenschaft, Parteien und NGOs etc. prägen maßgeblich die politische Kultur mit und dienen als Interessenrepräsentationskanäle. Die Parteien als Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Legislative und Exekutive benötigen einen fruchtbaren Wettbewerb, der zu Vorteilen am Markt für Stimmen, Macht und Einfluss führen soll. Eine lebhafte Zivilgesellschaft schafft neben einer reichhaltigen Parteienlandschaft die Möglichkeit Täter und Opfer zu repräsentieren. Die Zivilgesellschaft 34 Das Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit beschrieben durch die Radbruch-Formel spannt sich zwischen den Begriffen der Legalität, Loyalität und Legitimität. Legal oder illegal ist, was zum Zeitpunkt einer Tat gesetzeskonform war. Loyalität bezieht sich auf die Gesetzestreue die dem Rechtsstaat zugrunde liegt aber auch dem Unrechtsystems als Fundament dient. Legitimität bezieht sich auf den Inhalt eines Gesetzes. Ein Gesetz kann als illegitim angesehen werden, trotz seines legalen Charakters, wenn es zwar positivem Recht entspricht aber dem Naturrecht, auf das die unveräußerlichen Menschenrechte aufgebaut sind, zuwider steht (vgl. Rosenbach 2005). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 48 ____________________________________________________________________________________________________________________ trägt maßgeblich die Verantwortung, einen Weg zu finden zwischen der freien Meinungsäußerung und den Grenzen der akzeptablen politischen Positionen v.a. im Hinblick auf das Unrecht im vorangegangenen autoritären Staat. Die politische Kultur sichtbar in öffentlichen Diskursen, Bewusstseinsund Willensbildungsprozessen setzt hier Standards der Auseinandersetzung, indem sie sich an den Prinzipien von Wahrheit, Gleichberechtigung und Verständigung orientiert und die Einstellungsebene der Bevölkerung repräsentiert. Diejenigen, die sich nicht an diese Bestimmungen halten und mit neu definierten Standards brechen, werden mit den Mitteln eines freien Meinungsmarktes durch die anderen Akteure in der politischen Öffentlichkeit sanktioniert. In ihrer Gesamtheit bezieht sich die politischen Kultur auf die Meinungen und Einstellungen der Bevölkerung zu den Geschehnissen das überkommene politische System betreffend. Die politischen Einstellungen der Gesamtbevölkerung werden dabei zwar durch den öffentlichen politischen Diskurs, welcher durch die Eliten geprägt wird, bestimmt, sind aber von diesem analytisch zu trennen. Der Konsolidierungsgrad einer Demokratie ist umso höher, je größer die Zustimmung zu den (vergangenheits-) politischen Institutionen in der Bevölkerung ist (vgl. König 1998: 379, 386-387). 4.3.2 Handlungsziele der Vergangenheitspolitik Eine negative Vergangenheitspolitik, die einem Schlussstrich, einem künstlichen Vergessensgebot gleichkommt, kann nicht Ziel der Vergangenheitspolitik eines demokratischen Staates sein. Eine oktroyierte Vergessenspolitik verletzt die bürgerlichen Freiheits- und Menschenrechte und wird dem dieser Arbeit vorangestellten Demokratiebegriff nicht gerecht (vgl. Kap.2.1.2). Eine positive Vergangenheitspolitik wird diesen Anforderungen durch die Verfolgung von drei fundamentalen Zielen gerecht:35 - Einerseits soll eine Wiederholung des Vergangenen unmöglich gemacht werden. Dieses erste Ziel bildet die Schnittstelle zwischen den Theorien zur Vergangenheitspolitik und den Theorien zu Demokratie und Konsolidierung, da die Vergangenheitspolitik eine Demokratie mit aufbauen soll, die Stabilität aufweist und eine Wiederholung des vorangegangenen Unrechts durch einen demokratischen und gleichzeitig vergangenheitspolitisch orientierten Rahmen unmöglich macht. 35 Eser und Arnold beschreiben hier neben den fundamentalen auch noch weitere Ziele der Vergagenheitspolitik, wie das Ziel der Aufklärung, welches nicht nur der Behebung eines beabsichtigten Informationsdefizits dient. Die Abschaffung von repressiven Staatsorganen sowie die öffentliche Zugänglichkeit von Akten, Archiven und weiteren durch die wissenschaftliche und strafrechtliche Beschäftigung mit der Vergangenheit u.a. durch Aufklärungsbehörden und Kommissionen gewonnenen Tatsachen soll ermöglicht werden (vgl. Eser/Arnold 2001:17). „Das unmittelbare Ziel [HB, der Aufklärung] besteht in der möglichst tiefgehenden Delegitimierung des alten System“ (König 1998: 385). Ein öffentlich geführter Diskurs um die Vergangenheit außerhalb der Institutionen ist notwendig, um das Bewusstsein der Menschen im Bezug auf das vorangegangene Unrechtssystem und dessen Auswirkungen zu wecken und Meinungsbildungsprozesse zuzulassen (vgl. Bock 2000: 14, König 1998: 379). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 49 ____________________________________________________________________________________________________________________ - Andererseits soll innerhalb dieses Rahmens eine Herstellung von historischer Gerechtigkeit durch rechtsstaatliche Mittel ein zweites, erklärtes Ziel der positiven Vergangenheitspolitik sein. Die Gerechtigkeit soll in allen Subsystemen des vorangegangenen politischen Systems hergestellt werden (vgl. Höchst 2003: 9). - Des Weiteren soll die Versöhnung von Tätern und Opfern erreicht werden, um Täter und Opfer wieder in die Mitte der Gesellschaft zu integrieren. Das dadurch entstehende demokratisch-positive Sozialkapital verstärkt die Kohäsionskräfte der Gesellschaft und trägt zur Konsolidierung der Demokratie auf Verhaltens- und Einstellungsebene bei (vgl. Kap. 2.1.2). 4.3.3 Überblick vergangenheitspolitischer Handlungsfelder und Handlungsoptionen Zur Erreichung der o.g. Ziele sind Handlungen in verschiedenen vergangenheitspolitischen Politikfeldern notwendig. Diese Handlungsfelder sind auf das Vier-Säulenmodell von Eser und Arnold zurückzuführen, welches zwischen normbezogenen, institutionenbezogenen, täter- und opferbezogenen Handlungsoptionen unterscheidet. Faktoren wie Elitenwechsel, Stabilität des politischen Systems, wirtschaftliche Ressourcen, Bevölkerungsmentalität, Einbindung in internationale Beziehungen etc. beeinflussen die vergangenheitspolitischen Handlungen (vgl. Eser/Arnold 2001: 10, bzw. Abb. 7). Normbezogene Handlungsoptionen Normenbezogene Handlungen, wie das Einsetzen einer neuen Strafgesetzgebung bzw. das Abschaffen von alten Gesetzen, sind bestimmt durch den politischen Prozess und schaffen den rechtlichen Rahmen für die institutionen-, täter- und opferbezogenen Handlungsoptionen. Sie beziehen sich in strafrechtlicher Hinsicht beispielsweise auf die Täter, in zivilrechtlicher Hinsicht z.B. auf die Opferentschädigung. Normbezogene Handlungen sollen auf juristischem Wege die Wahrung der grundlegenden bürgerlichen Rechte und Freiheiten garantieren und die institutionalisierten Regeln und Normen gegenüber dem alten politischen System abgrenzen (vgl. Eser/Arnold 2001: 10-11). Vergangenheitspolitische Handlungen im Bereich der Gesetzgebung unterliegen jedoch rechtlichen Einschränkungen. Das juristische Prinzip des Rückwirkungsverbots besagt, dass „nur das Verhalten bestraft wird, das rechtlich zum Tatzeitpunkt als bestrafungswürdig festgehalten war“ (Bock 2000: 17). Die Systemkriminalität schützt sich damit selbst vor der strafrechtlichen Ahndung durch den Gesetzescharakter des Unrechts. Jedoch kann durch eine Bestimmung der immerwährende Vorrang des gesicherten Rechts eingeschränkt werden, wenn die Gesetze „elementaren Geboten der Menschlichkeit widersprechen“ (König 1997: 447).36 Das Rückwirkungsverbot als Schutz vor staat36 So nutzten auch schon die Alliierten im Rahmen der Nürnberger Prozesse rückwirkend eingeführte Straftatbestände, die beispielsweise „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ahndeten (König 1997: 449). Nach völkerrechtlichen Bestimmungen existiert keine Verjährungsfrist bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit (vgl. Eser/Arnold 2001: 8) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 50 ____________________________________________________________________________________________________________________ licher Willkür und Garant von Rechtssicherheit darf nicht zur generellen Straffreiheit von staatlichen Machthabern ausufern, die sich durch politische Handlungen der Systemkriminalität schuldig gemacht haben (vgl. König 1997: 448-451). Institutionenbezogene Handlungsoptionen Institutionenbezogenes Handeln betrifft die vergangenheitspolitischen Institutionen in ihrem Bestand. Die Einsetzung einer Aufklärungsbehörde oder einer Wahrheitskommission sowie die Abschaffung von repressiven Staatsorganen wie beispielsweise die Geheimpolizei oder die Umstrukturierung des Militärs sind politische Entscheidungen, die sich zu einer positiven Vergangenheitspolitik bekennen. Durch solche Institutionen bzw. vergangenheitspolitische Handlungen soll es dem politischen System ermöglicht werden, o.g. vergangenheitspolitische Ziele zu erreichen. Das Handeln der Institutionen, beispielsweise die Verhöre im Amnestieprozess, ist analytisch von den institutionenbezogenen Handlungen zu trennen. Vergangenheitspolitische Handlungen können durch Institutionen vorgenommen werden, die eigens geschaffen wurden, um bestimmte Normen auszuführen und vergangenheitspolitische Ziele zu erreichen. Kommissionen oder öffentlich arbeitende, parlamentarische Ausschüsse zur Bearbeitung bestimmter vergangenheitspolitischer Problemfelder dienen der Anregung des Diskurses um Vergangenheit und können Übersicht und Transparenz zu dem jeweiligen Themenkomplex erzeugen. Dieses Institutionenhandeln bezieht sich jedoch immer auf die Täter bzw. die Opfer im Kontext des vergangenen Unrechtssystems. Täterbezogene Handlungsoptionen Die täterbezogenen Handlungsoptionen können im dichotomen, strafrechtlichen Modell der Instrumente Strafverzicht und Strafverfolgung dargestellt werden (vgl. Eser/Arnold 2001: 12, 17). „Der Strafprozess ist die wirksamste und schwerwiegendste auf friedliche Art in das System eingebundene Form der sozialen Ausgrenzung als kriminell angesehenen Verhaltens“ (Bock 2000: 16). Eine umfassende Strafverfolgung kann eine große Belastung für das sich konsolidierende System sein, abhängig vom jeweiligen Übergangstypus und der Art des Vorgängersystems und der Größe der Tätergruppe. Daher stellt sich die Frage, wann und mit welcher Intensität die Vergangenheitspolitik auf das neue demokratische System einwirken sollte (vgl. Arenhövel 2000: 26). Das Ziel der historischen Gerechtigkeit, im Zuge dessen die Forderung nach der Strafverfolgung von Tätern im öffentlichen Raum steht, beschwört ein moralisches Dilemma herauf. Die Verurteilung von Schuldigen, die oftmals noch viele Machtzentren besetzt halten, und die Sicherung des Friedens als Wahrung demokratischer Stabilität und Bedingung zu demokratischer Konsolidierung stehen sich hier gegenüber (vgl. Nolte 1996: 12-13). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 51 ____________________________________________________________________________________________________________________ Der Strafverzicht ist zu differenzieren zwischen dem umfassenden Strafverzicht, dem umgangssprachlichen ‚Schlussstrich’, der keine Strafverfolgung von kriminellen Handlungen innerhalb des vorangegangenen Systems nach sich zieht, und dem bedingten Strafverzicht.37 Letzterer sieht gegenüber den Tätern keine Bestrafung vor, wenn Bedingungen erfüllt sind (beispielsweise das umfassende Ablegen von Geständnissen), die der Aufklärung und Wahrheitsfindung dienen und die aktive Teilnahme an der Versöhnung von Täter und Opfer bekunden. Dem Aspekt der Reue wird dabei große Bedeutung beigemessen. Dieses sogenannte ‚Aussöhnungsmodell’ ist charakteristisch für den Versuch, Täter und Opfer durch eine Wahrheitskommission miteinander zu versöhnen. Die eingeschränkte Strafverfolgung bzw. der eingeschränkte Strafverzicht bilden die Schnittstelle zwischen den zugrundeliegenden Unterscheidungskategorien innerhalb des Modells. Die eingeschränkte Nutzung strafrechtlicher Reaktionen auf Systemunrecht bezieht sich meist auf nur bestimmte Taten oder einen bestimmten Täterkreis. Die umfassende Strafverfolgung ist eine Kategorie, die sich von der eingeschränkten Strafverfolgung durch die Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren abhebt und auch als erklärtes Ziel eine umfassende Täterbestrafung nach strafrechtlichen Vorgaben vorsieht.38 Neben der Strafverfolgung ist es ebenso wichtig, die Gesamtheit der Tätergruppe nicht zu marginalisieren, sondern sie durch den aufklärenden öffentlichen Diskurs zu neuer Akzeptanz des politischen Systems zu bewegen und sie so wieder in die Mitte der Gesellschaft zu integrieren. Die Disqualifizierung jedoch ist eine täterbezogene Reaktion auf Systemunrecht außerhalb des Strafrechts, die eine Exklusion der Tätergruppe forciert. Die ‚Reinigung’ vor allem des Staatsapparates von den Verflechtungen zum alten System und dessen Verfechtern steht hierbei im Vordergrund. Disqualifizierung ist die politisch motivierte Exklusion von Personen aus bestimmten beruflichen, politischen oder sozialen Positionen, die mit ihrem Verhalten oder ihrer Position im zu überwindenden System begründet wird. [...] Ein bestimmter Status, sei er finanzieller, politischer, sozialer oder beruflicher Art wird der betreffenden Person [...] abgesprochen. (Bock 2000: 18) Begriffe wie ‚Entnazifizierung’ und ‚Entkommunisierung’ sind Vorgänge der Lustration, bei denen eine Disqualifizierung bestimmter Personenkreise vorgenommen wird. Die Verfügung von Disqualifizierungen kann auf politischem Wege durch Entlassungen, Suspendierungen, dem Entzug bürgerlicher Rechte etc. vorgenommen werden. Gegenreaktionen bei der Gruppe der Disqualifizierten, wie die passive und aktive Ablehnung der neuen politischen Ordnung, können die Folge sein. Die disqualifizierte Gruppe verliert durch ein pauschalisiertes Verfahren mit oftmals unscharfen Indikatoren 37 Der Erlass einer Amnestie, eindeutig bestimmt durch den politischen Prozess, ist ein juristisches Instrument mit der Funktion, die Strafverfolgung von begangenen Taten aus definiertem Bereich, die nach geltendem Recht zur Verurteilung stünden, aufzuhalten (vgl. Bock 2000: 17). 38 Gemessen an der Anzahl der eingereichten Strafverfahren ist bisher eine umfassende Strafverfolgung nur in Deutschland praktiziert worden. Länder wie Guatemala, Polen und Argentinien, in denen ebenfalls Strafrechtsverfahren stattfanden, sind in die Kategorie bedingter Strafverfolgung einzuordnen (vgl. Eser/Arnold 2001: 6, 18). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 52 ____________________________________________________________________________________________________________________ wie Mitgliedschaft oder Status ihre Privilegien. Bei nicht-strafrechtlichen Disqualifizierungen muss hierzu kein individueller Schuldnachweis erbracht werden. Vielmehr fällt die Erbringung der Entlastungsbeweise entgegen dem Rechtsstaatsprinzip, wonach der Ankläger die Schuld beweisen muss, dem Beschuldigten zu (vgl. König 1998: 384). Opferbezogene Handlungsoptionen Die opferbezogenen Handlungsoptionen können in Form von ideeller, sozialer, juristischer, beruflicher oder finanziell-materieller Rehabilitierung vom neuen politischen System angestrengt werden. Dazu gehört auch die Option der Restitution, d.h. die Rückgabe von aus politischen Gründen entzogenen Vermögenswerten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Restitution die Gefahr mit sich bringt, dass eine „nochmalige Änderung der Eigentumsverhältnisse soziale und politische Konflikte heraufbeschwören könnte“ (Bock 2000: 20). Andererseits bestärkt ein Vermögensausgleich durch Restitution das neue System als Garanten für die Wahrung von Eigentum, kann sich aber in Form von Entschädigungszahlungen auch als extreme Belastung für den Staatshaushalt erweisen. Die Einrichtung effizienter bürokratischer Verfahren zur Feststellung der Berechtigung von Entschädigungszahlungen oder Eigentumsrückgaben, der Aufhebung von Unrechtsurteilen etc. sind unter Beachtung der Würde und Verletzbarkeit der Opfer von elementarer Bedeutung. Symbolische Handlungen, Mahnmale, Gedenktage, eine politisch geförderte Erinnerungskultur, die die Anerkennung der ehemaligen Oppositionellen fördert, sind weitere Optionen, durch die der Status der Opfer des Unrechtssystems gehoben werden kann. Da die Opfer „aus ihrem Leid Ansprüche auf Entschädigung, Befreiung oder einfach auf moralische Überlegenheit ableiten können“ (Adam 1998: 357), werden sie am ehesten noch die Erinnerung an die Vergangenheit aufrecht halten und stimulieren daher die aktive Gestaltung vergangenheitspolitisch ausgerichteter Politik. Aus dieser aktiven Beschäftigung heraus muss sich das Verhältnis zwischen Opfern, Überlebenden und Tätern sowohl auf rechtlichpolitischem Terrain, als auch in der Öffentlichkeit neu finden (vgl. König 1998: 385, vgl. Bock 2000: 20). 4.4 Vergangenheitspolitik innerhalb der Konsolidierungsforschung Petra Bock attestiert der Systemwechselforschung einen vergangenheitspolitisch blinden Fleck: Auf der Suche nach Anreizstrukturen und Komponenten der Transformation innerhalb von Systemwechseln wurden die politischen Auseinandersetzungen und Entscheidungen um das Erbe des überwundenen Systems noch nicht entdeckt. (Bock 2000: 12) Besonders durch das der klassischen Systemwechselforschung zugrundeliegende minimale Demokratieverständnis wird die Vergangenheitspolitik als unbedeutend für die Transformation angesehen. So wird in O’Donnell, Schmitter und Whiteheads Transitions from Authoritarian Rule auf die Ver- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 53 ____________________________________________________________________________________________________________________ gangenheitspolitik nur als ethisches Problem, welches sich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich darstellt, eingegangen. Grundsätzlich befürworten die Autoren zwar eine Vergangenheitspolitik und sprechen sich für die Strafverfolgung von Menschenrechtsvergehen aus, da diese für die ethischen Werte der zukünftigen Gesellschaft von elementarer Bedeutung sind. Die Stärkung der rechtsstaatlichen Ordnung und die Unterordnung des Militärs sowie seiner Geheimdienste, die meist für die Gräueltaten verantwortlich sind, sollen dabei durch strafrechtlich bezogene Vergangenheitspolitik direkt zum Systemwechsel beitragen. O’Donnell et. al. machen jedoch in ihrer Beschreibung keine genauen Angaben, die zu einem analytisch integrierenden Ansatz des Problems der Vergangenheitspolitik in der Systemwechselforschung führen würden. (vgl. Arenhövel 2000: 27, O’Donnell/Schmitter 1986: 28-32). Arenhövel vermutet, dass es einen Zusammenhang gibt einerseits zwischen der Art und Weise, wie sich eine Gesellschaft mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt, also den Diskursen der Selbstverständigung und der spezifischen Vergangenheitsrepräsentation, und andererseits dem Grad der demokratischen Konsolidierung, der letztlich davon bestimmt wird, welche Projekte die Bürgerinnen und Bürger von einem erwünschten politischen Zusammenleben und den zu realisierenden Institutionen und Werten haben. (Arenhövel 2000: 12-13) Für diese Institutionen und Werte wird schon innerhalb der Verfassung der Grundstein gelegt. Die Verfassung ist, da sie von den gesellschaftlichen Eliten, die durch die unmittelbare Vergangenheit geprägten wurden verfasst und oftmals auch angenommen wird, als eine Kodifizierung der Vergangenheit anzusehen. In paktierten Übergängen ist jedoch der Blick in die Zukunft für die abdankenden Eliten ebenfalls von Bedeutung für die Verfassungstexte (vgl. Arenhövel 2000: 26-33). Daher beeinflusst die Vergangenheitspolitik die Konsolidierungsphase des Systemwechsels schon zu deren Beginn. Auch auf der Ebene der politischen Kultur, der Einstellungs- und Verhaltensebene der Bevölkerung befindet sich eine Schnittstelle zwischen Vergangenheitspolitik und demokratischer Konsolidierung. Vergangenheitsbewältigung kann durch Aufklärung und rechtsstaatliche Entscheidungsmuster bezüglich Menschenrechts- und Systemunrechtsfragen die Legitimität der Institutionen innerhalb der Bürgerschaft erhöhen und so direkt zur Konsolidierung der Demokratie auf Einstellungsund Verhaltensebene beitragen (vgl. Höchst 2003: 24). Nach Nolte ist die Vergangenheitspolitik ein Teil der Politiken, die den Systemwechsel bestimmen. Somit bringt der Typ des Systemwechsels auch Rahmenbedingungen für die Art und Weise der Vergangenheitspolitik mit sich und spiegelt den Demokratisierungsgrad wider. Für Nolte ist „die Aufarbeitung der Vergangenheit auch eine Auseinandersetzung zwischen Wertvorstellungen in der Gegenwart“ (Nolte 1996: 20). Daher sieht Nolte drei Bezüge zwischen Vergangenheitspolitik und dem politischen System in der Nachfolge auf ein Unrechtssystem: - Der Umgang mit den Tätern ist ein Indikator für die Macht- bzw. Kräftekonstellationen in der Gesellschaft und für die Stärke überkommener autoritärer Strukturen. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 54 ____________________________________________________________________________________________________________________ - Die Amnestie der Täter bringt eine Verantwortung der Gesellschaft für die Opfer mit sich. Straflosigkeit oder auch das Fehlen von Aussöhnung und Reueverhalten ist traumatisch für die Opfer. Die Art und Weise, wie die Vergangenheit aufgearbeitet wird, hat neben materiellen, medizinischen und psychotherapeutischen Maßnahmen entscheidende Auswirkungen auf die Reintegration der Opfer. - Die Interpretation der Vergangenheit ist von den moralischen Bewertungsmaßstäben von Individuen und Gesellschaft abhängig. Die Bewertung der Vergangenheit und die Art und Weise der Erinnerung ist somit aussagekräftig über die politisch-moralische Befindlichkeit der betreffenden Gesellschaft. (vgl. Nolte 1996: 19) Das Ausmaß, indem die Ziele der Vergangenheitspolitik, auf den norm-, täter-, opfer- und institutionenbezogenen Dimensionen erreicht werden, weisen auf die Stärke des Rechtssystems, auf die ausgeglichenen Interessenrepräsentation, die Inklusionsfähigkeit und auf viele weitere Indikatoren einer konsolidierten Demokratie hin (vgl. Nolte 1996: 20, vgl. Höchst 2003: 24-25). Die Herausbildung einer kollektiven Erinnerung, der Kampf um ein nationales Geschichtsbild, ist aber kein Prozess, der nach einem idealen Schnittmuster verlaufen kann, um dann die erfolgreiche Konsolidierung einer Demokratie zu gewährleisten. „Vielmehr sind es die vielfältigen gesellschaftlichen Konflikte um die eigene Vergangenheit [...], die einen demokratischen demos entstehen lassen.“ (Arenhövel 2000: 13) Arenhövel sieht hierbei allein in der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, quasi in einer kollektiven Selbstreflexion, die Möglichkeit, die Bürger auf der Verhaltens- und der Einstellungsebene zur Verinnerlichung und Einhaltung demokratischer Spielregeln zu bewegen. Laut ihm ist aber „ein Zusammenhang zwischen den Arten der Vergangenheitsauseinandersetzung und dem Demokratisierungsmodus und Konsolidierungsgrad jedoch bisher noch nicht systematisch hergestellt worden“ (Arenhövel 2000: 28). Zusammenfassung Die Beschäftigung mit der autoritären Vergangenheit eines politischen Systems ist zur Herausbildung einer demokratischen politischen Kultur unerlässlich. Eine Bewertung des Vergangenen ist unvermeidlich, da ein Tilgungsvorgang der kollektiven Geschichte unmöglich ist. So ist eine aktive Beschäftigung mit der Geschichte dem Vergessen und Verdrängen vorzuziehen, um Deutungsmuster des Geschehenen anzubieten und eine diffuse Vorstellung der Vergangenheit und Mythenbildung zu vermeiden. Vergangenheitspolitik ist bestimmt durch den Übergangstypus des jeweiligen Systemwechselprozesses, welcher durch die Machtverhältnisse zwischen ‚neuer’ und ‚alter’ Elite, der Art und Dauer des vorangegangenen Systems und vieler weiterer Faktoren beeinflusst ist. Die Vergangenheitspolitik beschreibt praktisch-politische Maßnahmen der Judikative, Exekutive und Legislati- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 55 ____________________________________________________________________________________________________________________ ve, die unmittelbar das vordemokratische System betreffen, und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Bestrafung i.w.S. der Personen, die der Tätergruppe zugerechnet werden, und der Beeinflussung des Diskurses um Vergangenheit durch öffentlich-symbolische Handlungen und Aufklärung. Vergangenheitspolitik ist ein Politikfeld, welches durch die Skizzierung der Ausgangssituation, die Formulierung von Handlungsoptionen, die Darstellung der zustande gekommenen und ausgebliebenen Maßnahmen, die Nennung von Handlungszielen und die Analyse der Bedingungen, die ein Handeln erschwert oder erleichtert haben, erschlossen werden kann. Daraus können abschließend Empfehlungen für die politische Fortführung abgeleitet werden. Mit Bezug auf klassische Kategorien der Vergangenheitspolitik eignet sich zur Untersuchung der Vergangenheitspolitik Südafrikas folgendes Analysemuster: 1. Akteure, akteursbezogene Analyseebenen und Ausgangssituation der Vergangenheitspolitik, 2. Ermittelung der Handlungsziele der respektiven Vergangenheitspolitik, 3. Vergangenheitspolitische Handlungsfelder und Handlungsoptionen (normenbezogenes, institutionenbezogenes , täterbezogenes und opferbezogenes Handeln), 4. Erstellung einer Bilanz vergangenheitspolitischer Handlungen und eine darauffolgende Darstellung der zustande gekommen und ausgebliebenen Maßnahmen, 5. Empfehlungen bezüglich der kommenden Vergangenheitspolitik. Das Unmöglichmachen der Wiederholung des Vergangenen ist nicht nur wichtigstes Ziel der demokratischen Konsolidierung, sondern auch der Vergangenheitspolitik. Die Herstellung von historischer Gerechtigkeit durch rechtsstaatliche Mittel und die Versöhnung von Opfern und Tätern und ihre Reintegration in die Mitte der Gesellschaft sind ebenfalls Teilziele der Vergangenheitspolitik. Durch Versöhnung entsteht Sozialkapital, welches die Kohäsionskräfte der Gesellschaft stärkt und zur Konsolidierung der Gesellschaft auf Verhaltens- und Einstellungsebene beiträgt. Die politischen Akteure bestimmen durch ihr Verhalten und ihre Einstellungen die Ausgangssituation für das Politikfeld Vergangenheitspolitik. Die Machtkonstellationen der politikbestimmenden Kräfte legen in der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphase die spätere Vergangenheitspolitik weitreichend fest. Die einfache Akteursdichotomie von Tätern und Opfern ist jedoch für die Analyse der Vergangenheitspolitik im Verlauf der Konsolidierungsphase nicht weitreichend genug. So wird die Akteurskategorie durch die Zuschreibung von aktivem oder passivem Status im alten System und einen die Politik mehr oder weniger beeinflussenden Status im neuen System erweitert. Die Arenen, in denen die Akteure reagieren, sind die Institutionen des politischen Systems wie die Legislative, die Exekutive und die Judikative, die Verbände und die Wissenschaft, die Medien und der öffentliche Diskurs. Das Feld vergangenheitspolitischer Handlungsmöglichkeiten ist unterteilt in normbezogene, täterbezogene, Institutionen- und opferbezogene Optionen. Täterbezogene Handlungsoptionen kreisen um die Frage der Strafverfolgung und der Reintegration und Einstellungsänderung. Opferbezogene Handlungsmöglichkeiten beziehen sich auf die Ausformungen von Rehabilitierung im ideellen, Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 56 ____________________________________________________________________________________________________________________ sozialen, juristischen, beruflichen und finanziell-materiellen Bereich und die Wiedergutmachung durch Rückgabe des Genommenen. Die Abschaffung von Gesetzen, die beispielsweise zum Erhalt des autoritären Regimes beitrugen oder Menschenrechte verletzten, die Gesetzgebungen zur Lustration des Staatsapparates etc. sind normbezogene Handlungen, die vergangenheitspolitisch eine Rolle spielen. Letztendlich sind die institutionengebundenen Handlungsmöglichkeiten zu nennen, die sich um Aufklärung bemühen sollen und Transparenz und Klärung durch die Einrichtung von Kommissionen und ähnlichen Körperschaften in die einzelnen Problemfelder der Vergangenheitspolitik bringen können. Die Systemwechselforschung hat einen blinden Fleck bezüglich vergangenheitspolitischer Fragestellungen und der Einbindung der Vergangenheitspolitik in die Prozesse demokratischer Konsolidierung. Doch allein der Verfassungsgebungsprozess macht deutlich, wie stark das neue, demokratische System durch vergangenheitspolitische Merkmale geprägt wird. Auch die politische Kultur und die Einstellung der Bevölkerung zu demokratischen Institutionen wird durch Vergangenheitspolitik maßgeblich geprägt. Die Vergangenheitspolitik eines politischen Systems spiegelt die demokratische Konsolidierung wider. Die Situation von Tätern und Opfern im neuen System ist symptomatisch für die Qualität der Demokratie, und die Interpretation der Vergangenheit weist die Charakteristika der politisch-moralischen Befindlichkeit der Gesellschaftsmitglieder auf. Die Reichweite von Strafverfolgungen, der Gerechtwerdung von Menschenrechtsgrundsätzen, also das Ausmaß, indem die Ziele der Vergangenheitspolitik auf den norm-, täter-, opfer- und institutionenbezogenen Dimensionen erreicht werden, weisen auf die Stärke des Rechtssystems, auf die ausgeglichenen Interessenrepräsentation, die Inklusionsfähigkeit und auf viele weitere Indikatoren einer konsolidierten Demokratie hin. Das Dilemma zwischen gesinnungs- und verantwortungsethischer Einstellung und Verhalten, dem sich die Akteure im neuen politischen System gegenüber sehen, kann durch die Einrichtung von verfassungsbestimmten Institutionen aufgelöst werden. Somit kann Vergangenheitspolitik durch die Verfolgung ihrer Ziele einen Beitrag zur demokratischen Konsolidierung leisten und einer Erosion bzw. einem Rückfall in ein autoritäres System entgegensteuern. 5 Politikfeldanalyse der südafrikanischen Vergangenheitspolitik Die folgende Politikfeldanalyse wird sich mit den Voraussetzungen, Inhalten und Folgen der südafrikanischen Vergangenheitspolitik beschäftigen. Ein Problem der Darstellung der südafrikanischen Vergangenheitspolitik beruht auf der oftmals vorgenommenen Gleichstellung des gesamten Prozesses der Beschäftigung mit Vergangenheit und der Arbeit der TRC. Jedoch ist der Vergangenheitspolitik ein weiterer Handlungsrahmen gegeben, was vor allem durch den Einbezug der ‚Commission on the Restitution of Land Rights’ (CRLR) noch ausführlicher erläutert werden wird. Die durch die Politikfeldanalyse gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 6 in den Kontext der demokratischen Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 57 ____________________________________________________________________________________________________________________ Konsolidierung eingearbeitet, um ihre Bedeutung für diesen Prozess herauszuarbeiten und um Empfehlungen für eine zukünftige Vergangenheitspolitik zu geben. 5.1 Akteure, akteursbezogene Analyseebenen und Ausgangssituation der südafrikanischen Vergangenheitspolitik Das Apartheidsystem wurde von der großen Mehrheit der weißen Bevölkerung seit 1948 elektoral und moralisch unterstützt. Die Weißen sahen, bis auf eine liberale Minderheit, die Menschenrechtsverletzungen des Staates gegenüber den aufständischen Schwarzen als legitimes Mittel an, den Kommunismus und Terrorismus zu bekämpfen. „Folter, willkürliche Inhaftierungen und der ausgiebige Schusswaffeneinsatz der südafrikanischen Sicherheitskräfte in den Townships schadeten der Akzeptanz der repressiven Regierungspolitik kaum“ (Theissen 2002: 68). Auch auf Seiten der Schwarzen herrschte ein Klima der Aggression vor. Gewalt gegen Verräter wurde bei fast der Hälfte der Schwarzen befürwortet, und der bewaffnete Kampf gegen die Apartheid war bei den meisten als legitim angesehen (vgl. Theissen 2002: 68). Der südafrikanische Transformationsprozess wurde durch Akteure des Landes selbst induziert. Der Übergang vom autoritären hin zum demokratischen System kann als paktiert bezeichnet werden, da die politischen Eliten, die zivile Führung des Apartheidregimes und die Führung der demokratisierenden Kräfte der Gesellschaft den Wechsel aushandelten (vgl. Kap 3.1.2). Aufgrund dessen, dass die ehemaligen und die neuen Machthaber an den Entscheidungsfindungen zur Vergangenheitspolitik des neuen Staates beteiligt sind, entstehen Grenzen für die Strafverfolgung, Rehabilitierung und alle weiteren Parameter der Vergangenheitspolitik: „[...] the room for manoeuvre of postwar regimes is often serverely limited, as the boundaries of justice have been set at an earlier stage in the transition.“ (Wilson 2001, a: 190) Die Ausgangssituation, aus der die südafrikanische Vergangenheitspolitik entstand, wird von Heribert Adam als „gekaufte Revolution“ (Adam 1998: 351) bezeichnet, die aus einer „anhaltenden Pattsituation“ (Adam 1998: 353) heraus entstand. Die Funktionäre des Apartheidregimes, die noch in den 80er Jahren als halsstarrig beschrieben und durch ihren kollektiven Willen zur Dominanz vor allem im politischen Raum charakterisiert wurden, ordneten sich und ihre ethnische Minderheit aufgrund finanzieller Garantien und erheblicher Kompensationszahlungen einem Mehrheitssystem unter. Die Prämisse des Kompromisses war es, viele Kompromisslose auf die Gehaltslisten des öffentlichen Dienstes zu setzen, Abfindungen für hohe Beamte und Polizeigeneräle zu zahlen sowie deren leichtes Unterkommen im privatwirtschaftlichen Sektor ohne finanzielle Einbußen zu ermöglichen. Weil die Vormachtstellung der alten (weißen) Eliten in vielen Gesellschaftsbereichen bislang weitgehend unangetastet blieb, ist es berechtigt von einer ‚narrow transition’ zu sprechen, die eben ‚nur’ die politischen Machtverhältnisse änderte. Neu ist allerdings eine wachsende schwarze Ober- und Mittelschicht, [...] Es Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 58 ____________________________________________________________________________________________________________________ herrscht eine liberale Marktwirtschaft mit Garantie von Privatbesitz, was die ANC-Allianz [...] bis 1994 stets anzugreifen propagiert hatte. (Kaußen 2005: 33) Der Pakt zwischen den Eliten bedingt einen Kampf im Post-Apartheid Südafrika um die politische Legitimität, die Gerechtigkeit und um den moralischen Sieg. Aktivisten fühlen sich ungerecht behandelt, wenn einstige Funktionäre im Regime weiterhin privilegierte Positionen in Privatwirtschaft und auch im Staat innehaben, wobei letztere ihr damaliges Handeln im Staatsapparat weiterhin als gerechtfertigt ansehen, da das damals gültige Recht auf ihrer Seite war.39 Die Gruppe der Täter ist im Kontext südafrikanischer Vergangenheitspolitik per definitionem die Gruppe derer, die eine politische Tat im Rahmen des Systemunrechts nachweislich begangen haben. Darüber hinaus „profitierten alle Weißen von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, unabhängig von ihrem Verdienst oder Klasse“ (Adam 1998: 358), da sie Vergünstigungen durch ihren Status, ihre Lebensqualität, die Möglichkeiten zur Ausbildung und allgemeiner ökonomischer Vorteile nutzten, freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder unbewusst. Diese Gruppe gehört nicht zum Kreis der Täter, aber zum Kreis der Nutznießer der Apartheid, die sich im Rahmen einer kollektiven Schuldfrage konstituiert (vgl. Adam 1998: 359). Die Nutznießer der Apartheid, allen voran die Privatwirtschaft, sowie die Institutionen und Organisationen, die als Mittäter das Apartheidsystem unterstützten, wurden neben den individuellen Tätern und Opfern marginalisiert. Die politischen Parteien, Kirchen usw. wurden zwar bei sog. ‚Special Hearings’ (vgl. doj & cd, d) zu ihrer Position im System befragt, und zwar übernahmen diese auch alle die kollektive Verantwortung, jedoch lehnten sie die Mitwisserschaft um die Taten des Apartheidsystems ignorierend ab und zeigten somit laut Adam den fehlenden politischen Willen, die Kollaboration mit dem System zu verhindern. Sie gestanden sich reflektierend nicht ein, „Grundsätze der natürlichen Gerechtigkeit verletzt zu haben“ (Adam 1998: 359). Die demokratische Opposition, angeführt durch den ANC als größter Vereinigung, bekämpfte mit friedlichen Mitteln aber auch mit Gewalt den Apartheidstaat und seine politischen Vertreter und Befürworter, allen voran die NP, bis zu dem Zeitpunkt, als die politischen Verhandlungen die Politik auf der Straße ablösten. Der Kompromiss, den die beiden Parteien schmiedeten, ließ viele vormals oppositionelle Gruppen und ihre Interessen außen vor. Viele NGOs wurden durch heimkehrende Exilanten marginalisiert, die United Democratic Front (UDF) ging im ANC auf, und auch die 39 Die Aushandlung der Interimsverfassung war gekennzeichnet durch sich gegenüberstehende Extrempositionen und das Aushandeln verschiedener Sektionen. Der sogenannte ‚sunset-clause’ ermöglichte es, die Sicherheitskräfte und die extreme Rechte zur Teilnahme an den Wahlen im darauffolgenden Frühjahr zu bewegen. Dafür wurden Arbeitsplatzgarantien für öffentliche Bedienstete, Polizeibeamte und Armeeangehörige für die nächsten fünf Jahre gewährt. „It is a widely held view, by serious commentators, that without this specific compromise, there would have been no settlement, no interim constitution, no elections, no democracy and a possible continuation of the conflicts of the past.” (de Lange 2000: 22) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 59 ____________________________________________________________________________________________________________________ Gruppen der Antiapartheidbewegung in den Kirchen, an den Universitäten und die regimekritische Presse wurden nicht bei den Verhandlungen berücksichtigt (vgl. Adam 1998: 352). Die Gruppe der Opfer ist im südafrikanischen Kontext grundlegend zweigeteilt. Die erste Gruppe sind die etwa 22.000 Opfer, die durch ihre Teilnahme am TRC-Prozess den Status als offizielle Opfer anerkannt bekamen (vgl. Ball/Chapman 2001: 29). Die andere weitaus größere Gruppe, die jedoch nur schwer zu definieren ist, sind die Millionen, die unter der Repression des Apartheidsystems in welcher Form auch immer gelitten haben, vor allem durch Zwangsumsiedlungen in Zwischenlager, geschlossene Siedlungen, ‚Townships’ und ‚Eingeborenen Reservate’ in der Peripherie. Diesen Umsiedlungsmaßnahmen mussten sich während der Apartheid etwa 3,5 Millionen Menschen beugen. Aufgrund des Ausbaus der weißen Vormacht durch Kapitalakkumulation mussten sie die Zerstörung von sozialen Einheiten ertragen (vgl. Walker 2000: 2).40 Im ländlichen Bereich nahmen die weißen Siedler seit Anfang des 20. Jahrhunderts etwa 90% des südafrikanischen Landes in Besitz und enteigneten dabei die große Mehrheit der ansässigen Bevölkerung, welche in Reservate in den verbleibenden Landesteilen überführt wurde, ermöglicht durch den ‚Natives Land Act of 1913’. Landwirtschaft in Apartheid-Südafrika war gekennzeichnet von kommerzieller Landwirtschaft durch weiße Farmer und Subsistenzwirtschaft durch schwarze Farmer und Schwarze, die als billige Arbeitskräfte auf weißen Farmen arbeiteten und lebten. Die große Entlassungswelle im Agrarsektor in den 1980er Jahren machte viele Saison- und sonstige Farmarbeiter obdach- und arbeitslos (vgl. Ntsebeza 2004: 197-198). Die bestimmenden Akteure Opfer und Täter des Politikfeldes Vergangenheitspolitik sind jedoch auch nach dem Ende der Apartheid nicht begrenzt. Erstens nehmen sie weiterhin zahlenmäßig zu, da das Phänomen der politischen Gewalt beispielsweise zwischen ANC und IFP in der Provinz KwaZulu-Natal (KZN) seit dem Ende der Apartheid nicht verschwunden ist (vgl. Jasson da Costa 28.03.2005). Seit 1984 forderten politische Auseinandersetzungen das Leben von etwa 20.000 Personen (vgl. Taylor 2001: 5). Zweitens nehmen die Täter und Opfer über die Zeit und den Verlauf des Systemwechselprozesses neue Rollen ein. Standen sich zu Anfang noch Opfer und Täter gegenüber, so verschieben sich in einem paktierten Übergang die Verhältnisse innerhalb des Machtgefüges des politischen Systems. Ein bestimmter Personenkreis aus der oppositionellen Bewegung verhandelt mit den alten Eliten, wird selbst zur Elite und spaltet sich so von der Masse der Opfer, die aus minder privilegierten Positionen heraus argumentiert, hierarchisch ab. Die neue Elite verändert dabei ihre vergangenheitspolitische Argumentationsstruktur und favorisiert gleich den Tätern nun den ‚Blick in die Zukunft’ (vgl. Nolte 1996: 21, vgl. Interview Ewoud Plate 06.06.2005). Frank Chikane, ein ehe- 40 Auch die TRC bezeichnet alle Südafrikaner als Opfer der Apartheid und beschränkt sich daher folglich nur auf sogenannte ‚window cases’, um den Rahmen ihrer Arbeit , d.h. ihr Mandat nicht zu überschreiten (vgl. Interview Frank Chikane 30.08.2005: 3/19-22). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 60 ____________________________________________________________________________________________________________________ maliger Oppositioneller und selbst Opfer eines Giftanschlages, heute ‚Director General of the President’s Office’, möchte den Blick der Menschen in die Zukunft gerichtet wissen: We also do not want a victim mentality. We are not going to keep this story about being a victim forever in the society. We don’t believe it helps the society. We want to get out of the victim mentality, change this country make it what we wanted it to be. We did not struggle to keep a culture of victims. We struggled to get rid of this victimisation. And once you’ve got rid of it, you work into the future rather than thinking about victim all the time. We tell our people, in my congregation, do not present yourself as a victim. You can not be a victim forever. You do something now that apartheid is gone, use the opportunities to change your life. (Interview Frank Chikane 30.08.2005: 9/6-13) Jedoch ist es vielen Opfer nicht möglich selbst aktiv zu werden. Beispielsweise die Verwandten und Freunde von Verschwundenen können den Blick nicht nach vorne richten, solange die Wahrheit über den Verbleib des vermissten Menschen nicht eindeutig belegt wurde, wozu nur die staatlichen, investigativ arbeitenden Behörden fähig sind (vgl. HOM, a). Das Verhalten der entscheidungskompetenten Akteuren gestaltet sich nach Max Weber in Verantwortungs- und Gesinnungsethik (vgl. Kap 4.2, vgl. Weber 1993: 70-71). So beschreibt auch Benomar (1993) dieses Verhalten der Politiker in post-autoritären politischen Systeme wie folgt: A common formulation of post-conflict human rights imperatives is that the new regimes are torn between a ‚political logic’, which gives priority to the consolidation of democratic stability, and an ‚ethical logic’, which urges prosecutions for all offenders. (Benomar 1993, h. zit. n. Wilson 2001, a: 190) Nicht nur die Strafverfolgung, sondern jegliche vergangenheitspolitische Handlung wird durch dieses Dilemma begleitet. Wie lange dieses Dilemma anhält und ob demokratische Stabilität und vergangenheitspolitische Handlungen sich grundsätzlich entgegenstehen, gilt es im Weiteren zu klären. 5.2 Handlungsziele der südafrikanischen Vergangenheitspolitik Die Handlungsziele der südafrikanischen Vergangenheitspolitik stehen in Abhängigkeit zur bisher geschilderten Ausgangssituation. Die Ziele der südafrikanischen Vergangenheitspolitik werden zum Teil durch die Aufgaben, die die TRC zu bewältigen hatte, klar: - Erstens strebte die TRC die Wahrheitsfindung über grobe Menschenrechtsverletzungen durch investigative Recherche und Geständnisse der Täter an. - Zweitens war die TRC eine Plattform für die heilsame Darstellung des Leids der Opfer. Das Anbieten der Möglichkeit der narrativen Aussage, Beratung und Beistand für die Opfer und deren Hinterbliebene war ebenso Aufgabe der TRC wie dem Anhörungsrecht der Täter nachzugeben. - Drittens kommt der Opferentschädigung durch Renten, einmaligen Reparationszahlungen und symbolische Anerkennung eine große Bedeutung zu. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 61 ____________________________________________________________________________________________________________________ - Viertens ist die nationale Einheit durch Versöhnung oberstes Ziel der Vergangenheitspolitik. Koexistenz als Mindestmaß friedlichen Zusammenlebens, Heilung und Versöhnung auch durch das Verständnis gegenüber den Tätern wurde angestrebt. Adam beschreibt die Versöhnung der ethnisch geteilten Gesellschaft als notwendiges Handlungsziel, um Rache zu verhindern und den Frieden im Land integrativ herzustellen. Die Aufklärung der Gesellschaft über ihre Vergangenheit legt eine neue moralische Grundlage und ist ein stückweit Entschädigung für die „Millionen von Opfer der rassistischen Gesetze“ (Adam 1998:353). Gerade die Schwere der Menschenrechtsverletzungen, legitimiert durch die Apartheid, machen eine politische Beschäftigung mit Vergangenheit notwendig und einen Schlussstrich unmöglich, wenn nicht die „Verfestigung undemokratischer Strukturen in den neuen Staatsparteien und in der Administration“ (Marx 2004: 108) in Kauf genommen werden soll.41 Der fünfte Band des TRC-Berichts, ein Zwischenbericht, gibt im Gegensatz zum Abschlussbericht relativ weitgefasste politische Richtungsweisungen. Unter anderem können jedoch folgende Punkte als weitere Ziele einer Vergangenheitspolitik in Südafrika gelten, die nach dem Ende der TRC anzuvisieren sind und auch zum Teil, deren eng begrenztes Mandat erkennend, diese weitblickend überschreiten (vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 5/Sec. 5/ Chap. 8, vgl. Huber/Umbreit 2000: 281): - Schaffung einer Kultur der Menschenrechte - strafrechtliche Verfolgung von Tätern, die nicht unter die Amnestieregelung fallen - Reintegration und Rehabilitation von Tätern und Opfern - Schaffung einer sozialen Marktwirtschaft - Reform des Justizsystems - Schaffung eines für jedermann zugänglichen Gesundheitssystems Die Empfehlungen des TRC-Abschlussberichts vom April 2003 beinhaltet folgende Punkte einer konkreter formulierten zukünftigen Politik. (vgl. TRC-Bericht, b: Vol.6/sec. 5/ chap.7): - Einrichtung eines Sekretariats, das die Implementierung der Empfehlungen der TRC überwacht 41 Politische Instrumente der Auseinandersetzung mit Vergangenheit sind seit dem Prozess der deutschen Vergangenheitspolitik nach dem 2. Weltkrieg bekannt. Deutschland gilt durch seine vorbildliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nazi-Regimes „als Paradebeispiel für den geglückten Umgang mit der eigenen Vergangenheit. In den Versuchen einer materiellen Entschädigung sehen manche sogar den Beginn einer globalen Moral der Wiedergutmachung“ (Zimmerer 2004: 10). So konnte Deutschland trotz seiner schlechten Ausgangsvoraussetzungen und den noch vielerorts vorherrschenden undemokratischen Strukturen die positive Entwicklung einer konstruktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit abringen. Für das Beispiel Südafrika können die area-Vergleiche mit Zimbabwe und Namibias Vergangenheitspolitik und deren Auswirkungen auf die demokratischen Strukturen aufzeigen, welcher Preis gezahlt werden muss, wenn der zuerst leichter erscheinende Weg des Vergessens gegangen wird (vgl. Marx 2004: 108). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 62 ____________________________________________________________________________________________________________________ - Einrichtung eines ‚Reparation Trust Funds’, der das Budget für die Opferreparationen verwaltet - Erhebung einer einmaligen Vermögenssteuer für die südafrikanische Industrie und Privatwirtschaft - Empfehlung, dass alle Nutznießer einen Beitrag zum ‚Reparation Fund’ leisten sollen - Das jährliche Berichten aller Ministerien zu opferbezogenen Ausgaben und zu den Opfersituationen für die Dauer von 6 Jahren - Spezielle Abmachungen sollen getroffen werden, um allen Personen, die aufgrund des Freiheitskampfes ihre Ausbildung im sekundären und tertiären Bereich abgebrochen haben, wieder aufnehmen zu können. - Bildung eines Teams, das sich um Exhumierungen und die Fälle von Verschwundenen kümmert, sowie die Abhaltung einer Konferenz zum Gedenken an die, die nicht zurückgekehrt sind - Die im Internet frei zugängige Bereitstellung und Archivierung der Daten, die die TRC gesammelt hat, um Recherche und Analyse zu ermöglichen - Einrichtung einer Website der TRC im Rahmen des Justizministeriums - Verteilung einer Populärversion des TRC-Berichtes, erstellt durch die TRC. Die Empfehlung an die Regierung, die Politik der geschlossenen List zu überdenken und weiteren Opfern den Zugang zu Reparationen zu ermöglichen Neben der vergangenheitspolitischen Institution der TRC kümmert sich die CRLR um die Ungerechtigkeiten entlang der Unterschiede zwischen Rassen und Klassen, im Bereich von Landbesitz und rassistisch bedingten Landenteignungen (vgl. Ntsebeza 2004: 197-198). Die Mission der CRLR ist es: - “to promote equity for victims of dispossession by the state, particularly the landless and the rural poor, - to facilitate development initiatives by bringing together all stake-holders relevant to land claims, - to promote reconciliation through the restitution process, - to contribute towards an equitable redistribution of land rights” (Department of Land Affairs, a)42 42 Die internationale Presse beschäftigt sich immer wieder mit den Morden und Angriffen auf weiße Farmen in Südafrika, hinter denen rassistische Motive vermutet wurden. Eine spezielle Untersuchungskommission fand heraus, dass etwa 2% aller Angriffe aus politischen Motiven heraus erfolgen, 3% wurden von ehemaligen, verärgerten Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 63 ____________________________________________________________________________________________________________________ Inwieweit die genannten allgemeinen und speziell für den Fall Südafrika geltenden Ziele erreicht wurden, wird in der folgenden Handlungsanalyse deutlich werden. 5.3 Vergangenheitspolitische Handlungen in Südafrika: Zustande gekommene und ausgebliebenen Maßnahmen Im Folgenden wird analysiert, welche Handlungsoptionen die Akteure nutzen. Welche Instrumente kommen zum Einsatz um vergangenheitspolitische Ziele umzusetzen. Die Einstellungsebene der südafrikanischen Bevölkerung zu vergangenheitspolitischen Prozess wird ebenfalls berücksichtigt. 5.3.1 Normbezogene Handlungen Zustande gekommene Maßnahmen Anzeichen der Aufhebung der strikten Trennung der Rassen sind schon in der Liberalisierungsphase zu bemerken. Die Einführung des Dreikammersystems und den damit verbundenen Zugeständnissen an die Coloureds und Indians im Rahmen der ‚totalen nationalen Strategie’ P.W.Bothas sind ein erstes Beispiel dafür.43 Die weitere Liberalisierung des Systems ist aber erst durch die auf die ‚nationale Strategie’ folgenden massiven Proteste zuerst im In- und dann auch im Ausland erfolgt. Die Unterzeichnung des New Yorker Abkommens im Dezember 1988, das die Unabhängigkeit Namibias einleitete und den Rückzug der südafrikanischen Truppen aus Angola garantierte, ist Zeichen der Schwächung der Apartheidpolitik. Gleichzeitig wurden durch Vertreter der weißen Zivilgesellschaft des liberalen, weißen Politikflügels sowie der Privatwirtschaft informelle Gespräche mit dem ANC geführt. Im Verlauf des Jahres 1989 setzte sich F.W. de Klerk innerhalb der NP gegen Botha durch und leitete somit eine Rückwendung zum Parlamentarismus ein, welcher durch die Notstandsregelungen sehr gelitten hatte (vgl. Meyns 2000: 85-89). Die politische Wende seit der Amtsübernahme von F.W. de Klerk führte zu Änderungen im Normenkatalog der Apartheid und kennzeichnet den Beginn der Demokratisierungsphase des Systemwechselprozesses, indem beispielsweise der ANC als gebannte politische Partei wieder erlaubt und die Aufhebung von Apartheidgesetzen - wie den Farmarbeitern ausgeführt. Die Angriffe stehen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Kriminalität aus dem Hochsicherheitszonen vieler Vorstadtsiedlungen heraus auf vielversprechendere Ziele und sind vor dem Hintergrund der hohen Gesamtkriminalität zu sehen. Etwa 90% aller Farmattacken sind einfache kriminelle Raubüberfälle, begangen von meist jugendlichen, arbeitslosen Schwarzen ohne Bildung, die jedoch sehr brutal vorgehen, so dass etwa 1/8 aller Überfälle tödlich für das Opfer enden, wobei die Mordzahlen seit Beginn der 1990er Jahre zurückgehen (vgl. Terreblanche 26.09.2003). 43 Botha versuchte seit seinem Amtsantritt 1978 auf die veränderte Position Südafrikas in der Region mit einer ‚totalen nationalen Strategie’ zu reagieren, die durch eine verstärkte Militarisierung der Gesellschaft eine Abwehr des Weltkommunismus zum Ziel hatte. Südafrika baute seinen hegemonialen Anspruch in der Region aus und versuchte bei gleichzeitigen Bestrebungen nach wirtschaftlicher Zusammenarbeit die Nachbarstaaten politisch zu destabilisieren, um deren Unterstützung der schwarzen Opposition zu mindern. Durch diese Strategie und auch das Dreikammersystem als Zugeständnis sollte die Macht der weißen Minderheit bestärkt und die Separiertheit bestätigt werden (vgl. Meyns 2000: 61-66). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 64 ____________________________________________________________________________________________________________________ ‚Land Act, den ‚Group Areas Act’ etc. - vorgenommen wurde (vgl. Huber/Umbreit 2000: 273, vgl. O’Donnell/Schmitter 1986: 9).44 Die Verabschiedung der Interimsverfassung vom 18.11.1993 bedeutete den Übergang der Demokratisierungsphase zur Konsolidierungsphase des Systemwechselprozesses (SA Gov. Info, a, vgl. Kap. 3.2). The adoption of the interim constitution was a revolutionary break with the past. It is the legal foundation upon which all legality rests. It is a decisive break with Westminster-type parliament sovereignty, ushering in a constitutional state (Rechtstaat), where the constitution is supreme and committed to observing human rights and the rule of law. (de Lange 2000: 21) Die Interimsverfassung war der Friedensvertrag zwischen zwei unbesiegten Kontrahenten und daher ein Kompromiss. Auf diesem Fundament aufbauend einigten sich die politischen Parteien innerhalb des von 1994 bis 1999 geltenden Konkordanzsystems, des GNU, auf die endgültige Version der Verfassung 1996. Zweifellos hat Südafrika mit der Verabschiedung der neuen Verfassung [...] wichtige Schritte auf dem Weg der demokratischen Konsolidierung gemacht. Die Bereitschaft zu Kompromissen, die vor allem in der Verfassungsdiskussion deutlich geworden ist, ist ein zentrales Moment der demokratischen Kultur. (Meyns 2000: 210) Die südafrikanische Verfassung selbst konstituiert sich zu einem großen Teil aus der Erinnerung des Vergangenen heraus und steht als eine Garantie für die Unwiederholbarkeit des Geschehenen. Dadurch ist ihr Charakter zukunftsorientiert und beruht auf der Einsicht, die Fehler der Vergangenheit zukünftig zu vermeiden. Das Potential der Verfassung mit der Vergangenheit positiv umzugehen darf nicht unterschätzt werden, aber das höchste Gut eines Landes ist nur ein Dokument [...] Die nützlichste Form an die Verbrechen in Südafrikas Geschichte zu erinnern, ist die Gegenwart zu verändern. Wir brauchen ein Konzept für den Umgang mit der Vergangenheit [...]. (Macdonald 2002: 63) Verschiedene Gesetze, wie der PNURA aus dem Jahre 1995, der die gesetzliche Basis für die Einrichtung, Aufgaben und Strukturen der TRC darstellt, der ‚Restitution of Land Rights Act 22 of 1994’, der die Grundlage für die Einrichtung der CRLR bildet und das zugehörige Programm zur Landreform des ‚Department of Land Affairs’ (vgl. Ntsebeza 2004: 200, Department of Land Affairs, a) sowie der ‚National Heritage Resources Act 25 of 1999’ (vgl. Fox 2004: 266, SA Gov. Info, d), der die Erbauung nationaler Symbole der Versöhnung und des Gedenkens vorantreiben sollte, waren zur Adressierung von in der Vergangenheit geschehenem Unrecht erlassen worden. Weiterhin ist der ‚Promotion of Access to Information Act 2 of 2000’ (SA Gov. Info, f) ein Meilenstein in der südafrikanischen Vergangenheitspolitik, der die Transparenz der staatlichen Einrichtungen und auch 44 Eine Aufstellung der wichtigsten Gesetze zur Durchsetzung der Apartheidpolitik wurde durch Pádraic Quirk und Colin Knox vorgenommen (vgl. Knox/Quirk 2000: 146). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 65 ____________________________________________________________________________________________________________________ privater Unternehmen in Abgrenzung zu einer Kultur des Schweigens während der Apartheid fördert und dessen Beispiel mittlerweile andere westliche und lateinamerikanische Länder gefolgt sind. South Africa's Constitution gives every person the right of access to information, held by a public or private body, that is required for the exercise or protection of any right. The Promotion of Access to Information Act of 2000 gives effect to this right; now the SAHRC is helping to make the right a reality. […] The Act represented a landmark in South African history, addressing for the first time the pre-1994 culture of secrecy in state and private institutions, seeking instead to foster a culture of transparency and accountability in South Africa. The Act also acknowledged the need to educate South Africans on their rights, to enable them to participate in decision-making that affects their lives. (Tshivhidzo 07.03.2005) Ein weiteres normbezogenes Instrument der Vergangenheitspolitik ist die ‚South African Law Reform Commission’ (SALRC). Diese wurde durch den ‚South African Law Commission Act 19 of 1973’ gegründet, mit dem ‚Judicial Matters Amendment Act of 2002’ erneuert und hat zur Aufgabe, die Gesetzesnetze zu analysieren, Befunde zur öffentlichen Ausschreibung zu stellen und als Gesetzesvorschläge einzugeben, um das südafrikanische Recht zu harmonisieren und zu erneuern (vgl. doj & cd, e). Die Reform der Pachtrechte werden durch den ‚Land Reform (Labour Tenants) Act of 1996’ und durch den ‚Extension of Security of Tenure Act of 1997’ geregelt. Beiden Gesetzen geht es hauptsächlich darum, die Sicherheit der Schwarzen in den ehemals nur für Weiße bestimmten kommerziellen Farmgebieten zu gewährleisten. Das erstgenannte Gesetz soll es ermöglichen, die existierenden oder historischen Nutzungsrechte der auf den Farmen lebenden Arbeiter in Besitz umzuwandeln. Das zweitgenannte Gesetz schützt die Pachtrechte der Farmarbeiter und Bewohner kommerzieller Farmen durch die Errichtung eines gesetzlichen Rahmens für Vertreibungen. Der ‚Interim Protection of Informal Land Rights Act of 1996’ wurde erlassen, um die Menschen mit unsicheren Landrechten vor Vertreibung und dem Verlust ihrer Existenzrechte zu schützen, und um Maßnahmen für Langzeitpachtverträge zu erarbeiten. Dieser wurde bisher nur alljährlich verlängert (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap. 2/ 36-39). Diese Gesetze bildeten fortan das Fundament für das von Macdonald geforderte vergangenheitspolitische Konzept im Post-Apartheid Südafrika.45 Ausgebliebene Maßnahmen Seit dem Ende der Arbeit der TRC ist jedoch ein Rückgang im Bereich vergangenheitspolitischer Gesetzgebung zu verzeichnen. Die TRC gab zwar Empfehlungen, die sich auf der TRC nachfolgende Instrumente beziehen, die über das Mandat der TRC hinaus auch das ‚unfinished Business’ im vergangenheitspolitischen Bereich in Angriff nehmen sollen. Jedoch wurden bis dato keine Gesetze erlassen, die die vergangenheitspolitische Arbeit ausreichend weiterführen. Ian Liebenberg empfiehlt 45 Durch die irreführenden Darstellungen vieler Wissenschaftler und Analysen, die sich bei ihrer Beschäftigung mit südafrikanischer Vergangenheitspolitik nur auf die TRC beziehen, werden weitere vergangenheitspolitische Instrumente wie die CRLR oder die o.g. Gesetze marginalisiert (vgl. Interview Ian Liebenberg 23.08.2005: 1/23-27). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 66 ____________________________________________________________________________________________________________________ aus Gründen des Monitoring und der Evaluation heraus beispielsweise die Einführung einer umfassenden ‚reparation and reconciliation policy’. Die Überschaubarkeit und Überprüfbarkeit des staatlichen Handelns bezüglich der Empfehlungen der TRC ist derzeit nicht gewährleistet aufgrund des Fehlens eines solch klar zielgerichteten Politikfeldes. Die Intransparenz führt bei den zivilgesellschaftlichen Akteuren und den Opfern zu Frustration, Verwirrung und einer skeptischen Grundhaltung gegenüber dem Regierungshandeln. (vgl. Interview Ian Liebenberg 23.08.2005: S. 14/L. 7-29). […] the truth and reconciliation process is something that includes the TRC but it goes wider. It also asks about: Did we have policies or just an exercise on a Truth and Reconciliation Commission. We had such an exercise, is it not time now to look at gaps between policy-making and effective restoration and victim compensation, rather than just having a commission with a broad suggestion at the end? There are the recommendations in the last chapters of the TRC report and they do not imply policy or policy-making, which is a weakness or in other words there is a policy gap. (Interview Ian Liebenberg 23.08.2005: 1/23-33) Die Empfehlungen der TRC stützen sich zwar auf internationale Rechtsnormen und verankern ihre Argumentation in der südafrikanischen Verfassung, es fehlt jedoch an konkreten Gesetzen und Implementierungsplänen, die in der post-TRC-Ära weiterhin die Vergangenheitspolitik antreiben. Zwar wurden beispielsweise die Richtlinien über den Umgang mit der anstehenden Strafverfolgung der Täter, die es versäumten, Amnestie zu beantragen, im November 2005 als Gesetzesvorschlag veröffentlicht. Ein Gesetz, welches den Regularien der PNURA und den Empfehlungen der TRC entspricht, ist jedoch nicht abzusehen (vgl. Kap. 5.3.3). 5.3.2 Institutionenbezogene Handlungen Zustande gekommene Maßnahmen Der ANC schuf 1993, sieben Monate vor der ersten freien Wahl in Südafrika, die ‚Motsuenyane Commission’, die Angelegenheiten von Menschenrechtsverbrechen in den ANC-Exilcamps auf Antrag des ‚National Executive Council’ des ANC untersuchte. Taten wurden untersucht und die Täter benannt, doch darüber hinaus war die Kommission ein Ereignis, welches in der Geschichte seines gleichen sucht: „[...] it marked the first time that a liberation movement had engaged an independent commission to investigate its own past of human rights abuses“ (de Lange 2000: 20). Der Bericht und die Einrichtung der ‚Motsuenyane Commission’ zeigten, dass der ANC sich für Verantwortungsbewusstsein gegenüber der eigenen Geschichte, gegen ein Klima der Straffreiheit und für die Option einer Wahrheitskommission im neuen Südafrika aussprach (vgl. de Lange 2000: 20). Die Forderung auch von Seiten der Zivilgesellschaft nach der Einsetzung von Aufklärungsbehörden, die Fakten über die Vergangenheit zusammentragen, um zur Wahrheitsfindung und Wissenserweiterung über die Vergangenheit im Rahmen von Systemunrecht beizutragen, wurde dann auf Seiten des Staa- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 67 ____________________________________________________________________________________________________________________ tes durch die Einrichtung der TRC in Angriff genommen. 46 Doch nicht nur die TRC, sondern auch die CRLR als weiteres vergangenheitspolitisches Instrument wurde mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet.47 Die Einrichtung der TRC lieferte die Kategorisierung von rechtschaffenden Siegern und den moralischen Verlierern.48 Die Entscheidung des Parlaments, dass eine öffentliche Beschäftigung mit der Vergangenheit stattfinden werde, kam erst durch den Druck der Zivilgesellschaft und durch „die moralische Lücke der gekauften Revolution“ (Adam 1998: 352) zustande. Diese zwang die Politiker dazu, sich für eine Untersuchung der Vergangenheit auszusprechen, um ihr Gesicht zu wahren (vgl. Adam 1998: 351-352). Den Forderungen nach justizieller Gerechtigkeit einerseits und einer Generalamnestie andererseits wurde durch den Kompromiss der TRC und ihres Mottos ‚Amnestie gegen Wahrheit’, Tätern wie Opfern versucht, genüge zu tun (vgl. Marx 2004: 109). Die von Dumisa Ntsebeza geführte ‚Special Investigation Unit’ überprüfte die Angaben der Täter auf Vollständigkeit der Aussage und den Wahrheitsgehalt der Opferaussagen, deren Qualifizierung als offiziell anerkannte Opfer der Apartheid notwendig war (vgl. Huber/Umbreit 2000: 275276). Sie arbeitete den drei Hauptgremien der TRC, dem ‚Amnesty Committee’, dem ‚Human Rights Violations Committee’ und dem ‚Reparation and Rehabilitation Committee’ zu. Die Dreiteilung spiegelt gleichzeitig auch die Fokussierung der TRC auf die in Kapitel 5.2 genannten Aufgaben wider (vgl. Boraine 2000: 85). Der PNURA legt fest, dass die grundlegende Aufgabe der Kommission „die Aufarbeitung politisch motivierter Straftaten während der Zeit vom 1. März 1960 bis 30.September 1994 [HB, Änderung des falschen Datums durch den Verfasser]“ (Huber/Umbreit 2000: 275) vornehmen soll.49 Die rechtlichen Kompetenzen der TRC reichten von den Möglichkeiten, Zwangsvorladung zu erlassen und die Herausgabe und Beschaffung von Beweismaterial voranzutreiben, bis hin zur Befugnis, über Amnestieanträge zu befinden (vgl. Huber/Umbreit 2000: 277-278). Die TRC wurde als 46 Die Interimverfassung von 1993 sah schon die Errichtung dieser beiden Kommissionen vor, um die Vergangenheitspolitik in eine institutionelle Form zu gießen (vgl. Parliamentary Monitoring Group, a). Wahrheitskommissionen wie die TRC sind Instrumente eines ‚restorative justice’ Ansatzes. Den Opfern und den Tätern sollen in einem wiederherstellenden Prozess der Stärkung und Einhaltung der Menschenrechte diejenigen materiellen und ideellen Güter wiedergegeben werden, die ihnen durch das vorangegangene autoritäre System genommen wurden (vgl. Villa-Vincencio, Charles 2000: 68). 47 Die Verfassung sieht in Kapitel 9 neben der TRC und der CRLR noch weitere Institutionen zum Schutze der Demokratie im Land vor, die jedoch keinen direkten Bezug zu vergangenem Systemunrecht haben, daher nicht über Fälle urteilen können, die sich vor 1994 ereignet haben - dies ist nur über die o.g. Gesetze möglich - und somit für die vergangenheitspolitischen Handlungen nur indirekt relevant sind. (vgl. Parliamentary Monitoring Group, a). 48 Die TRC war im Vergleich zu anderen Kommissionen dieser Art mit einem großen Budget ausgestattet. Etwa 28 Millionen US-Dollar kamen aus dem Finanzministerium, wobei noch etwa 5 Millionen US-Dollar von ausländischen Spendern bereitgestellt wurden. In der Hochzeit der Arbeit beschäftigte die TRC mehr als 400 Personen (vgl. Ball/Chapman 2001: 16-17). 49 Das Mandat der TRC beruft sich wie oben genannt auf den PNURA und die Verfassung, die in ‚schedule 6 - transitional arrangments’ unter Sektion 22 festlegt, dass eine Periode von 34 Jahren, d.h. bis zum 11. Mai 1994 die Zeitspanne darstellt, innerhalb die TRC ihre Untersuchungen anstellt bzw. Amnestien für politische Straftaten vergibt (vgl. SA Gov. Info, b; vgl. Mgxashe 2000: 212). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 68 ____________________________________________________________________________________________________________________ parlamentarisches Gremium angelegt und die Kommissionsmitglieder durch das ‚Cabinet of National Unity’ in Beratung mit Präsident Nelson Mandela in einem transparenten Prozess bestimmt. Ausgenommen davon war die Besetzung des täterfokussierten Amnestiekomitees, dessen Kommissare durch einen intransparenten Prozess durch den Präsidenten selbst bestimmt wurden (vgl. Mamdani 1998: 38).50 Die Untersuchung schwerer Menschenrechtsverbrechen, die Gewährung einer bedingten Amnestie und der öffentliche Charakter sind die drei Punkte, die die TRC am meisten prägten und vor anderen Institutionen dieser Arte auszeichnen (vgl. Huber/Umbreit 2000: 279-281). Die TRC brachte durch ihre Anhörungen von Tätern und Opfern sowie die anschließenden Überprüfungen durch die ‚Special Investigation Unit’ eine Fülle politischer Straftaten ans Licht, in die die Regierungen der Apartheid-Ära mehr oder weniger involviert waren. Diese geschahen im Rahmen von Zwangsumsiedlungen und Deportationen Millionen südafrikanischer Bürger, Massakern durch Polizeiübergriffe bei Streiks und Demonstrationen, politische Morde und Attentate im In- und Ausland, das Verschwindenlassen von Personen, Todesstrafen ohne Gerichtsverfahren, der Einsatz von chemischen und biologischen Kampfstoffen und Lebensmittelgiften sowie Menschenversuche. Verschiedene politische Straftaten wie Deportationen waren durch die Apartheidgesetzgebung legitimiert (vgl. Huber/Umbreit 2000: 274).51 Die TRC schaffte es durch diese Offenlegung der Geschichte, dass unter den SüdafrikanerInnen im Allgemeinen und unter den weißen SüdafrikanerInnen im Besonderen weitestgehend keine Leugnung der Apartheidverbrechen stattfindet (vgl. Theissen 2002: 73). Durch die Verbreitung von Wahrheiten ändert sich die südafrikanische Geschichtsschreibung und verschiebt den Fokus in ein reflektierendes Post-Apartheid Zeitalter. Die verschiedenen Perspektiven auf Vergangenheit und daraus entstandenen Identitäten rücken somit etwas näher zusammen. Durch den TRC-Prozess wurde eine kollektive Erinnerung produziert, und dieser Vorgang führte laut Gibson auch zur Versöhnung. Je mehr die Personen die durch die TRC produzierte Version von Geschichte akzeptieren, desto eher können sich diese auch mit anderen Gruppen der Bevölkerung versöhnen. Eine einzige und universelle Version von Geschichte ist aber kein Ziel, das erreichbar und erreichenswert wäre (vgl. Gibson 2004: 409, vgl. 4.1, Adam 1998: 356-357). Des Weiteren konnte die TRC durch ihren aufklärenden Charakter, durch die Aufarbeitung vieler Fälle von Menschen50 Generell spiegelte sich in der Besetzung der Kommissionsposten die zeitgenössischen politischen Machtverhältnisse im Land wider, jedoch wurde die TRC durch ihren öffentlichen und unparteiischen Charakter, der aus dem PNURA hervorgeht, geprägt. Das 17-köpfige Gremium der Kommissare bestand aus Personen der verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche und Berufsgruppen Südafrikas: vier mit einem religiösen Hintergrund, fünf aus dem Bereich Medizin und Psychologie, sieben aus dem juristischen Bereich, drei Politiker und drei aus der Arbeit der NGOs (vgl. Ball/Chapman 2001: 18). 51 Die staatlichen Sicherheitskräfte konnten oft durch die Umstände von Notwehr, Notstand und Provokation bei Verhandlungen um Morde, Körperverletzungen und Totschlag freigesprochen werden. Zusätzlich bot die Gesetzgebung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, zur Unterrückung von Terrorismus und die Notstandsverordnungen den Sicherheitskräften Schutz vor Strafverfolgung (vgl. Huber/Umbreit 2000: 274). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 69 ____________________________________________________________________________________________________________________ rechtsverletzungen und durch das Sammeln von Beweisen und Zeugenaussagen eine Grundlage schaffen, um Apartheid und auch die Opposition moralisch zu beurteilen, und um die Vergangenheit noch weiter zu erforschen und noch mehr Wahrheiten zuzulassen (vgl. Sonis et. al. 2002: 33). Durch die TRC als vergangenheitspolitisches Instrument und der Verbreitung ihrer Arbeit in der Bevölkerung durch die Massenmedien wurde eine Kultur der Menschenrechte und das Bekenntnis zum Rechtsstaat gefördert (Gibson 2004: 236). If it [HB, the TRC] failed satisfactorily to sort through the wilderness of data presented to it, and itself to provide a morally defensible guide in future conflicts, it did provide a wealth of material on which such judgement can be made. Its work has shone a light into the dark recesses of apartheid which will illuminate our future debates and provide a rich source of material for the study of the infamy of apartheid. (Asmal et. al. 2000 : 98) Die Selbstkritik der TRC an der eigenen Arbeit brachte ihr hohe Sympathiewerte ein und schuf weiteres Vertrauen in das erarbeitete Informationsmaterial. Grundsätzlich hatte die TRC gegenüber allen anderen staatlichen Institutionen die höchsten Vertrauenswerte. Vor allem die Schwarzen haben ein Missverhältnis zu den Institutionen Polizei, dem politischen System, den örtlichen Gerichten und dem Rechtssystem. Diese Wahrnehmung auf die Institutionen, welche die Ahndung vergangener Menschenrechtsverbrechen in einem reinen strafrechtsverfahren hätten aufklären müssen, wenn auf eine Sonderkommission verzichtet worden wäre, verdeutlicht die Notwendigkeit der TRC (vgl. Theissen 2002: 71-72).52 Dieser Vertrauensvorteil machte es möglich, zum ‚nation-building’ einen wichtigen Beitrag zu leisten (vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 5/chap. 9/Sec. 109-135):53 The TRC makes all of this self-examination palatable because it places the report and the entire TRC process squarely in the centre of a larger program of nation-building and reconciliation. This contextualisation helps to provide a common language with which difficult issues of racism, abuse, violence, and reconciliation can be understood and discussed. […] it provides a foundation for the ongoing discussion of reconstruction. (Daly 2003: 397) Die gesamtgesellschaftlich hohe Akzeptanz der TRC wurde hauptsächlich durch die Unterstützung der Schwarzen begründet. Im Verlauf von fünf Jahren zwischen 1995 und 2000 steigerte sich die Anhängerschaft der Kommission von etwa 50% auf ca. 2/3. Wurde die TRC von den meisten Weißen unter der Forderung einer Generalamnestie zu Beginn noch kategorisch abgelehnt, so veränderte sich die Einstellung hinsichtlich der Kommission und ihrer Darstellung der südafrikanischen Geschichte über die Jahre grundlegend: Von der Unterstützung der staatlichen Repressionspolitik in den achtziger Jahren möchten die meisten weißen Südafrikaner heute nichts mehr wissen und die Apartheid wird mittlerweile auch von den meisten weißen Südafrikanern als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft. (Theissen 2002: 69-77) 52 Das Misstrauen in die Institutionen, die Recht sprechen und es durchsetzen, ist durch die hohe Kriminalitätsrate zu erklären, die auf ein Versagen der o.g. Institutionen bei der Verbrechensbekämpfung hinweist. 53 Die nationale Identität ist in Südafrika stark ausgeprägt, da sich viele Südafrikaner weniger über die Religion wie in anderen afrikanischen Ländern - als über die Nationalität definieren (vgl. Monare 16.09.2005). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 70 ____________________________________________________________________________________________________________________ Die TRC war eine Plattform für das öffentliche Eingestehen von Schuld und der Möglichkeit zu entschuldigen. Die Verbreitung der Arbeit der TRC durch die südafrikanischen Medien, beispielsweise durch die wöchentliche Sendung der ‚South African Broadcasting Corporation’ (SABC) ‚Special Report’ (vgl. Department of Communications, a) trugen zur Aufklärung der Bevölkerung bei und verhinderten zum einen die Leugnung der begangenen Unrechtstaten durch individuelle Täter und durch das Kollektiv der Apartheidunterstützenden und machten zum anderen der Öffentlichkeit das volle Ausmaß des kriminellen Charakters des Systems deutlich (vgl. doj & cd, c). Das Interesse an der Arbeit der Kommission war bei allen Bevölkerungsgruppen sehr hoch, und in den ersten Monaten verfolgten mehr Menschen diese Sendung als die abendlichen TV-Nachrichten; etwa 1,1 bis 1,3 Millionen (vgl. Theissen 2002: 71).54 Theissen bewertet unter anderem die TRC als erfolgreich im Bereich der Konfliktschlichtung, was eine friedliche Koexistenz der Bevölkerungsgruppen ermöglichte. Die diskriminierten Bevölkerungsgruppen erfuhren durch die TRC eine gewisse Befriedigung ihres Strebens nach Gerechtigkeit. Das Gewaltmonopol des Staates wurde hier nicht in Frage gestellt, und Täter, Opfer und Zeugen blieben generell unversehrt. Die Amnestiegewährung gegen ein vollständiges Geständnis wurde, obwohl gegen die Gerechtigkeitsvorstellungen der meisten SüdafrikanerInnen verstoßend, weithin akzeptiert (vgl. Theissen 2002: 76). Auch konnte die vergangenheitspolitische Arbeit der TRC eine Verbesserung im Bereich des friedlichen Zusammenlebens erreichen, da die Anzahl der politischen Morde auf nationaler Ebene stark zurückgegangen ist. Die Popularität der TRC und ihres Vorsitzenden Desmond Tutu, die Nutzung von neuen nationalen Symbolen und der charismatischen Figur des Ex-Präsidenten Nelson Mandela, trugen - wie beim ‚Rugby World Cup’ zu sehen war - ebenfalls zur friedlichen Koexistenz bei (vgl. Brandon Hamber h. zit. nach Knox/Quirck 2001: 185186).55 Eine weitere zustande gekommene vergangenheitspolitische Maßnahme ist die Einrichtung der CRLR am 1. März 1995. Sie hat zum Ziel, Personen und Kommunen, die nach dem 19. Juni 1913 als Resultat rassistischer Gesetzgebung enteignet wurden, ihren Besitz zurückzugeben oder sie zumindest gerecht und gleichwertig zu entschädigen. Alle Klagen, die bis zum 31. Dezember 1998 eingereicht wurden, werden berücksichtigt (Department of Land Affairs, a). Die CRLR, errichtet unter 54 Die weißen SüdafrikanerInnen meinten noch vor der breiten öffentlichen Wahrnehmung des TRC-Prozesses, dass die Apartheid eine schlecht ausgeführte gute Idee gewesen sei (44%) und dass die Menschenrechtsverletzungen vom Ausland übertrieben würden (55%). Im Jahr 2001 hingegen waren schon 79% der Weißen Bevölkerung der Ansicht, dass die Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei, was auch 95% der Schwarzen dachten, was eine Annäherung der ethnischen Gruppen in der Meinung über die Vergangenheit bedeutet (vgl. Theissen 2002: 73). 55 Rugby wurde in der Apartheid als Sport der Weißen, vor allem der Afrikaaner angesehen, sowie in Südafrika Fußball eine Domäne der Schwarzen war. Der ‚Rugby World Cup’ 1995 produzierte eine Szene der Versöhnung im sportbegeisterten Südafrika, da das südafrikanische Team gewann und der damalige Präsident Nelson Mandela, mit einem Rugby-Trikot bekleidet, dem Kapitän den Pokal überreichte. Dies stellte eine Geste des Miteinanders dar, ein symbolisches Bild für das neue Südafrika und ein Erfolg für die integrative Kraft der neuen Nation. (vgl. SouthAfrica.info, b). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 71 ____________________________________________________________________________________________________________________ dem ‚Department of Land Affairs’, ist zusammen mit dem ‚Land Claims Court’ die zuständige Behörde für die Fälle von gerichtlicher Rückforderung von enteignetem Land. Der Prozess der Rückgabe von Landbesitz begann durch den respektiven Passus in der Interimsverfassung von 1993, durch den die SüdafrikanerInnen Land, welches unter rassistischer Gesetzgebung von ihnen genommen wurde, zurückfordern können. Die Schaffung der oben genannten Kommission und des speziellen Gerichtshofes wurden ebenfalls in der Interimsverfassung geregelt. Der ‚Restitution of Land Rights Act 22 of 1994’ regelt im Falle einer gerichtlichen Rückforderung die genauere Verfahrensweise durch den ‚Land Claims Court of South Africa’ (vgl. Land Claims Court of South Africa, a). Ausgebliebene Maßnahmen Die TRC erntete nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Sonis et. al. kritisieren die TRC im Bezug auf deren Förderung von Vergebung als politische Kategorie in einer Post-Konflikt- Gesellschaft. Die Opfer sehen den Versöhnungsprozess, den die TRC als Vermittler von Tätern und Opfern anstieß und begleitete, als höchst ambivalent. Opfer beschreiben die Interaktion mit der TRC sowohl als hinderlich im Prozess der Vergebung als auch als vergebungsförderndes Element. Die Forschung zur Förderung von Vergebung durch die Opfer für die Täter und ihre Taten ist jedoch noch stark unterentwickelt, und die TRC ist wiederum Ausgangspunkt für viele Studien, um diese Frage weiter zu verfolgen. Doch obwohl die TRC bei den Opfern aufgrund des psychischen und gesellschaftlichen Drucks, der auf ihnen in der Situation von Anhörung, Medienpräsenz, Versöhnungsdiskurs etc. lastete, teilweise auch als Hindernis für Vergebung gesehen wird, bestätigen die meisten ihre Erfahrungen mit der TRC als positiv und bereuen ihren Schritt nicht, am TRC-Prozess teilgenommen zu haben (vgl. Sonis et. al. 2002: 32-33). Bezüglich der Gleichbehandlung von Täter und Opfer durch die TRC wurde die Einstellung der Bevölkerung zum TRC-Prozess bereits während des laufenden Mandats getrübt: Although it took longer for the amnesty committee to process the applications, in the end, the amnesty applicants - the perpetrators of gross human rights abuses - received the relief they sought more promptly and more completely than their victims, In the end the perpetrators have walked away from the process, while the victims are still waiting for reparations. (Daly 2003: 388) Erst im November 2005 wurde ein Gesetzesvorschlag auf den Weg gebracht, wie mit den weiteren Tätern, die nicht vor der TRC erschienen und keinen Amnestieantrag einreichten, verfahren werden soll (vgl. Kap 5.3.3). Die unzureichende Reparations- und Entschädigungspolitik der ANCRegierung zeigt, dass die Vergangenheitspolitik weit über die TRC hinausgehen muss. Jedoch ist hier wiederum die Implementierungskontrolle aufgrund eines fehlenden Kontrollorgans, empfohlen im TRC-Bericht, gänzlich unzureichend (vgl. TRC-Bericht, b: Vol.6/sec. 5/ chap. 7). Die Vergangenheitspolitik Südafrikas wurde nach dem Ende der TRC nur noch in wenigen Bereichen aktiv ges- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 72 ____________________________________________________________________________________________________________________ taltet und ist dem ‚unfinished business’, das die TRC in ihrem Bericht nennt, erlegen (vgl. KSG, d). Die Vertreter der Zivilgesellschaft beharren daher auf der Schaffung einer gesetzlich verankerten Institution mit mehr Handlungskompetenz, die Rückbesinnung auf die Empfehlungen der TRC nach einem ‚National Director of Rehabilitation and Reparation’ und der Einrichtung einer Abteilung, die die nicht erledigten Aufgaben der TRC weiterführt: In other countries you have had other secondary structures which were meant to be implementing structures that have been set up, particularly in Latin America, in places like East-Timor, etc. where there is a structure that can actually carry after reparations. In other countries there have also been situations of different bodies who can actually take on the reparations. In South Africa the failure to set up a task team or a desk has been hugely problematic and that is something that needs attention. (Interview Yasmin Sooka 28.08.2005: 5/20-25) Der ‚President’s Fund’ als bloße monetäre Distributionseinheit im Rahmen des Justizministeriums ist kein geeignetes Instrumentarium, um die Vergangenheitspolitik in diesem Sinne ganzheitlich und für die Opfer sichtbar anzupacken, die noch weiteren Bedarf an politischer Aufmerksamkeit haben. Um diese Aufgaben, die die Institution der TRC nicht ausreichend bewältigen konnte, anzupacken, fehlt eine geeignete Institution, die es ermöglicht, das nationale Projekt der Integration und Versöhnung sowie Partizipation und Distribution auf der Basis vergangenheitspolitischer Ansätze zu verwirklichen. So sehen sich die Opfer der Apartheid im post-TRC-Zeitalter allein gelassen: „ Now that the TRC has formally shut down, the victims are left with their own meager resources and without any significant institutional support” (Daly 2003: 386). Ein weiterer Kritikpunkt an der Arbeit der TRC ist die Zugänglichkeit der vergangenheitspolitisch relevanten Archive für wissenschaftliche und journalistische Recherchen und die Möglichkeiten auch für die Marginalisierten im Land den vollständigen Bericht der TRC zu lesen. We tried to address it [HB, the archives and the public accessibility of the reports and other files as a weak point of the TRC] in the final report of the TRC basically saying that there needed to be some kind of dialogue on the issue because the TRC left this point unfinished or not dealt with in its first report.[…] I think these public records should be widely accessible to all and it is problematic that the issue has been so difficult for people to get access to the documents. Of course […] when people apply for access to their own records this is not a difficult issue, but it is when researchers or historians want to have a look at other documentation, this is were the problem kicks in. […] we need to have the governments archives to be made really accessible but it is going to need a lot of public support and focus to have this issue on the table. (Interview Yasmin Sooka 29.08.2005: 2/10-23) Der komplette Bericht der TRC ist nicht frei im Internet oder als kostenlose Buchversion verfügbar, sondern wird von einem südafrikanischen Verlag vertrieben. Der Kaufbetrag selbst wird aus Zwecken des Profits erhoben und kommt nicht, wie die TRC empfiehlt, dem ‚President’s Fund’, aus dem die Reparationen für die Opfer der Apartheid bezahlt werden, zugute (vgl. doj & cd, f, vgl. TRCBericht, a: Vol. 5/Chap. 8/ Sec. 20). Vor allem die Marginalisierten und die als Zeugen aufgetretenen Opfer, die heute meist noch immer unter großer Armut und Arbeitslosigkeit leiden, sollten freien Zugang zu dem Bericht der TRC haben. Nur so kann in der Bevölkerung Klarheit über die TRC, ihre Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 73 ____________________________________________________________________________________________________________________ Errungenschaften und ihre Fehler geschaffen werden, ohne die Wahrheitsfindung und die Aufgabe der Versöhnung der Mythenbildung zu überlassen. Fehlende Informationsflüsse führen zur Exklusion bestimmter Bevölkerungsteile aus der öffentlichen Debatte. Der Bericht der TRC ist auch und gerade im post-TRC-Zeitalter von großem Wert für die öffentliche Debatte, weshalb ihm eine höhere Bedeutung beigemessen werden sollte: The purpose of a report is not to have the final word, but to open the debate and create a space in which important social issues can be discussed. In this sense reports are ideal tools for democratic deliberation because they present information but do not dictate the uses to which such information is put. That is entrusted to the polity. People can use information for educational purposes […], for litigation purposes, as the basis for discussion in workplaces, or for town meetings and workshops. State, local or federal officials can use it for policymaking. People can construct television shows, […] and art based on information contained in the report. A report is effective insofar as it promotes discussion, identifies the common ground, and provides linguistic and psychological frameworks to help people deal with the contested ground. (Daly 2003: 402-403) Ursprünglich sollte der Bericht auch durch Populärversionen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, die jedoch bis heute nicht auf der Homepage der TRC erhältlich sind (vgl. Chapman/Ball 2001: 36, vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 5/Chap. 8/Sec. 21).56 5.3.3 Handlungen bezüglich der Tätergruppe Zustande gekommene Maßnahmen Die südafrikanische Variante der täterbezogenen, strafrechtlichen Verfolgung nimmt im internationalen Vergleich eine Sonderstellung ein (vgl. Kap. 4.3.3). Das täterbezogene Instrument des neuen politischen Systems auf das Systemunrecht des Apartheidstaates war die Amnestie, ein ausgehandelter Kompromiss mit dem beide Lager der politische einflussreichen Akteure der Übergangszeit zufrieden waren und die einerseits Aufklärung, andererseits die Möglichkeit der Straflosigkeit und damit des friedlichen Machtwechsels in sich vereinte (vgl. Adam 1998: 354).57 Der Strafverzicht unter der Bedingung des vollständigen Geständnisses ist die südafrikanische Variante, nach Systemunrecht mit der Vergangenheit und den Tätern umzugehen.58 Dies ist eine Methode die der Herstellung individueller Gerechtigkeit durch Strafverfolgung, die ohnehin durch die schwierige Beweislage eine fragwürdige Option gewesen wäre, eine geringere Bewertung beimisst als der Wahrung des Friedens in 56 Die Populärversion des TRC-Berichts ist auf deutsch in Kooperation mit Südwind und Brandes & Apsel Verlag im Jahr 2000 erschienen. In Südafrika jedoch ist keine Version des Buches erhältlich, weder auf der Website von Palgrave Macmillan, noch auf der Site der TRC im Rahmen der Website des ‚Department of Justice and Constitutional Development’ (vgl. Werkstatt Ökonomie 2000). 57 Das Amnestiekomitee war befugt rechtskräftige Amnestien aussprechen. Ein Gerichtsurteil des ‚Supreme Court’ vom 25. Juli 1996 bestätigte, dass die Gewährung von Amnestie mit der Verfassung übereinstimmt, da die Wahrheit sonst nicht ans Licht und die Verfassung selbst möglicherweise nicht zustande gekommen wäre (vgl. doj & cd, b). 58 Die christliche Vorstellung einer Vergebung der Sünden durch Reue und die afrikanische Ethik des ‚ubuntu’, welche dem Motto folgt, dass ein Mensch nur eine Mensch ist durch die Einwirkung anderer Menschen, waren prägend für den narrativen Diskurs um die TRC. ‚Ubuntu’ betont Menschlichkeit und Empathie gegenüber allen anderen Menschen, aufgrund der komplementären Vernetzung der Menschen untereinander (vgl. Kap 2.1.2). Die Philosophie des ‚ubuntu’ ist nicht nur für die TRC und deren vergangenheitspolitisches Anliegen, sondern für die ganze Nation und ihre Befriedung und Integration von prinzipiell fundamentaler Bedeutung (vgl. „ubuntu“). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 74 ____________________________________________________________________________________________________________________ der neuen Gesellschaft. Die Tätergruppe wurde zur Entwicklung des Landes und für die Erreichung wirtschaftlichen Wachstums benötigt. Daher muss mindestens ein friedliches Nebeneinander garantiert werden (vgl. Adam 1998: 355). Das Amnestiekomitee war berechtigt, einen vollständigen Straferlass auszusprechen. Eine Strafverfolgung der Täter vor internationalen Gerichten ist aufgrund des intern ausgehandelten Systemwechsels und der dadurch erfolgten nationalen Beschäftigung mit Vergangenheit keine Option mehr.59 Die TRC berichtet: The definition of apartheid as a crime against humanity has given rise to a concern that persons who are seen to have been responsible for apartheid policies and practices might become liable to international prosecutions. The Commission believes that international recognition should be given to the fact that the Promotion of National Unity and Reconciliation Act, and the processes of this Commission itself, have sought to deal appropriately with the matter of responsibility for such policies. (TRC-Bericht, a: Vol. 5/Chap. 8/ Sec. 114) Die TRC war auf einen juristischen Rahmen beschränkt, der sich hauptsächlich auf die Untaten einzelner Personen konzentrierte, um dann diesen Personen Amnestie zu gewähren oder sie zu einem Gerichtsverfahren weiter zu leiten. Einem individuellen Amnestieantrag wurde nur dann stattgegeben, wenn das Komitee eine Straftat als politisch einstufte. Eine Person, deren Amnestieantrag abgelehnt wurde, unterliegt danach vollständig der strafrechtlichen Verfolgung der südafrikanischen Justiz und kann bis zum ‚Supreme Court’ seine Rechte verteidigen (vgl. Lang 2005: 336-354). Ob die SüdafrikanerInnen die Amnestieentscheidungen für fair halten untersuchte Gibson im Jahre 2000/2001. Das ‚story-telling’ ist dabei ein entscheidender Faktor, der die Wahrnehmung der Fairness des Verfahrens steigen lässt, wenn im Prozedere die Opfer die Möglichkeit erhalten, ihre Geschichte zu erzählen beziehungsweise öffentlich zu machen. Des Weiteren wird eine Amnestie eher für fair gehalten, wenn der Täter sich entschuldigt. Ebenso sind die Meinungen gegenüber der Amnestie positiver, wenn die Opfer Entschädigung, in diesem Falle von Staat, erhalten (vgl. Gibson 2002: 550). Aufgrund der wenigen Reuebezeugungen aus den Reihen der Tätergruppe und den niedrig ausgefallenen Reparationszahlungen ist zu vermuten, dass die Amnestieentscheidungen bei einem Großteil der Bevölkerung als unfair angesehen wird. 59 Amnestieangebote für Täter in Zeiten des sozialen Wandels werden von nationalen Gerichten legitimiert, von internationalen Gerichten aber, als Unterminierung internationalen Strafrechts, verurteilt. Die internationale Jurisprudenz argumentiert, dass die Vergabe von Amnestien vielleicht eine kurzfristige soziale Stabilität garantiere, jedoch langfristig die Anstrengungen eine stabile Demokratie und einen Rechtsstaat aufzubauen untergraben. Also, je schwerer und häufiger die Menschenrechtsverletzungen und die Instabilität des Systems, desto eher ist auf Amnestie zu hoffen und desto weniger mit Strafverfolgung zu rechnen. Jedoch verletzt die Amnestie die nach internationalem Recht anerkannten fundamentalen Rechte der Opfer, z.B. das Recht auf einen fairen Prozess, das Recht auf juristischen Beistand, das Recht auf Gerechtigkeit. In Südafrika wurde dem zum Trotz die Amnestie durch einen parlamentarisch-demokratischen Prozess als vom Staatsvolk legitimiert eingesetzt. Durch die Komponente der Erweiterung des Wissens um die Vergangenheit - Amnestie gegen Wahrheit - wurde das Maß an Gerechtigkeit gesteigert, jedoch auf Kosten der Opfer. Individuelle Täter werden jedoch in einem Prozess der Wissenserweiterung um die Vergangenheit zur Verantwortung gezogen oder, wenn dieser nicht ausreichend war, dem Strafprozess zugeführt, was wiederum die Gerechtigkeit bestärkt. Dadurch kann der südafrikanische Amnestieprozess bei stringenter Durchführung die Bedenken des internationalen Rechts vielleicht nicht ausräumen aber doch abschwächen (vgl. Slye 2000: 176-177). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 75 ____________________________________________________________________________________________________________________ Ausgebliebene Maßnahmen Insgesamt gingen 7116 Amnestieanträge bei der TRC ein. Davon wurden jedoch 4775 Anträge abgelehnt, da sie nicht Anträge im Sinne der PNURA waren. Von den 2341 angenommenen Anträge wurden 1769, etwa 75%, gewährt und 442 abgelehnt . Daher ist zu sehen, dass das Amnestiekomitee bei der Gewährung im Sinne des PNURA sehr großzügig war. Die meisten Anträge wurden von der zahlenmäßig größten Bevölkerungsgruppe, den Anhängern des ANC gestellt, dann folgen die Mitglieder der Sicherheitskräfte, wobei die Mehrzahl der Anträge von Mitgliedern der südafrikanischen Polizei gestellt wurden, die sich durch das Gerichtsverfahren gegen Polizeioberst Eugene de Kock gewissermaßen gezwungen sahen, ebenfalls einen Amnestieantrag zu stellen, während die meisten Soldaten sich weigerten, vor die TRC zu treten (vgl. Lang 2005: 336-337, 341, 352-354). Auch ranghohen Militärs und Apartheidpolitiker beteuerten - wie hier Chief Buthelezi - ihre Unwissenheit über die schweren Menschenrechtsvergehen: On no occasion has the IFP’s leadership ever made any decision anywhere at any time to use violence for political purposes. I have always abhorred violence now and will die abhorring violence. I personally have never made any decision to employ violence anywhere for any purpose whatsoever. (TRC-Bericht, a: Vol.5/Chap. 7/Sec.20) So übernahm auch F.W. de Klerk, als Repräsentant der NP, durch seine Aussage vor der TRC keine Verantwortung für die Auswüchse der durch die NP initiierten Apartheidpolitik. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Eugene de Kock schreibt: Yet the person who sticks most of all in my throat is former State President FW de Klerk. Not because I can prove, without a shadow of doubt, that he ordered the death of X or cross-border raid Y. Not even because of the holier than thou attitude that is discernible in the evidence he gave before the [Commission] on behalf of the National Party. It is because, in that evidence, he simply did not have the courage to declare: "yes we at the top levels condoned what was done on our behalf by the security forces. What’s more, we instructed that it should be implemented. Or – if we did not actually give instructions we turned a blind eye. We didn’t move heaven and earth to stop the ghastliness. Therefore let the foot soldiers be excused. (Eugene de Kock: ‘A long nights work’. Hier zit. nach TRC-Bericht, a: Vol.5/Chap.1/Sec. 19) Von Seiten der Repräsentanten des Apartheidsystems, zu dessen Verteidigung die grausamen Verbrechen verübt wurden, wurde keinerlei Schuldeingeständnis getätigt. Diese Reuelosigkeit hat fatale Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Apartheid in der Bevölkerung. Die TRC hat durch ihre Fokussierung auf Einzeltäter eine Marginalisierung der systemischen Komponente der Apartheid erreicht, da ca. 40% der Schwarzen und Weißen die Apartheidverbrechen als individuelle und nicht als staatliche Taten ansehen (vgl. Theissen 2002: 77). Die systemische Komponente der Apartheidverbrechen bleibt im vergangenheitspolitischen Diskurs marginal, da anstelle des juristisch nicht zu fassenden Systems keine (juristische) Person die Verantwortung für das Systemunrecht übernommen hätte. (vgl. Adam 1998: 361, vgl. Kap. 2.3.2). Die Vergangenheitspolitik des Staates wird, wenn es um das Thema Wahrheitsfindung geht, bei nur 74% der Schwarzen bzw. 32% der Weißen unter- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 76 ____________________________________________________________________________________________________________________ stützt. Die wichtigsten Herausforderungen und Problemstellungen für die schwarze Mehrheit sind Arbeitslosigkeit (96%), Armut (95%) und AIDS (94%). Die Vergangenheitspolitik hat es versäumt, die Ursachen dieser Problembereiche klar darzustellen und vergangenes Systemunrecht damit in Verbindung zu bringen. Arbeitslosigkeit, Armut und AIDS sind zwar multikausal bedingt, jedoch ist das System der Apartheid durch schlechte Ausbildungsmöglichkeiten, ungerechte Lohnzahlungen, Umsiedlungsprojekte in ländlich-marginale Gebiete, und Migrationsarbeit etc. der bedeutendste Faktor für die Entstehung dieser gegenwärtigen Probleme (vgl. Theissen 2002: 77). Das Systemunrecht der Apartheid wird zwar im Bericht der TRC erwähnt (vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 1 Appendix to Chap.4), jedoch beschäftigt sich die Analyse der TRC, abgesehen von den ‚Special Hearings’, nur wenig mit der systemischen Komponente. Es wurden schwere Menschenrechtsverletzungen wie Tötung, Entführung, Folter und die grobe Misshandlung einer Person untersucht (vgl. Knox/Quirck 2000: 179). Der Versuch, die Verabredung, Beihilfe oder Verleitung, Anstiftung, Befehl oder die sonstige Herbeiführung der genannten schweren Menschenrechtsverletzungen sowie die Täterschaft sind nach Kapitel 1 (1) (ix) PNURA (vgl. SA Gov. Info, c) Inhalt des Verbrechens.60 Die systemische Komponente besteht in der Etablierung eines von Weißen dominierten politischen Systems und der systemischen Ausbeutung der schwarzen Bevölkerung Südafrikas durch einen rassistischen Kapitalismus. Aufgrund diese Mangels ist der TRC-Prozess eher ein rechtliches als ein politisches Verfahren (vgl. Terreblanche 2003: 275-276). This [...] fell far short of the ANC’s position which regarded the apartheid state itself as a ‘crime against humanity’. It also precluded from investigation key human rights violations such as the forced removals, land confiscation, the pass laws and the concept of apartheid itself. (Knox/Quirck 2000: 179) Die TRC konnte die Gruppe der Weißen nicht genug in ihren Prozess integrieren. Ein Kernpunkt ihrer Arbeit war es, die Apartheid und alle die Untaten, die in ihrem Namen getan wurden, zu verurteilen. Die TRC wurde jedoch von den Weißen nicht als Plattform für Reuebezeugungen und Versöhnung genutzt, was am fehlenden Engagement im TRC-Prozess zu sehen war. Dies rief eine große Enttäuschungshaltung bei den Nicht-Weißen hervor und hinterließ tiefe Vorbehalte (vgl. Brandon Hamber, hier zit. nach Knox/Quirck 2001: 185-186). Die Schaffung der Wahrheitskommission und deren Anhörungen und Urteile machten es zwar möglich „die moralischen Sieger und Verlierer der 60 Die Definition von groben Menschenrechtsverletzungen, festgelegt im PNURA, wird von Marx als rechtlich und politisch problematisch gewertet. Die rechtliche Grundlage der Definition war weder durch nationale noch durch international geltende Gesetze gewährleistet. Der Gesetzeskatalog der Apartheid blieb aufgrund der notwendigen Kontinuität der Gesetzesherrschaft weiterhin gültig, bis eine Gesetzesnovellierung oder eine Verfassungswidrigkeit durch das Verfassungsgericht erklärt wurde und wird (de Lange 2000: 19). Daher definierte das Parlament 1994 als grobe Menschenrechtsverletzung all die in Zukunft zu verhindernden Tatbestände, sprach sich aber in der Formulierung „servere ill-treatment of any person“ (SA Gov. Info, c: Chap.1/ 1/ ix) sehr allgemeingültig aus, so dass beispielsweise das Thema Vergewaltigung in der TRC zwar angesprochen wurde, aber, aufgrund der Scham der hauptsächlich weiblichen Opfer, der expliziten Nennung im Gesetzestext und fehlender respektiver Mechanismen zur Einbeziehung der vergewaltigten Opfer marginalisiert wurde (vgl. Marx 2004: 113-114). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 77 ____________________________________________________________________________________________________________________ ausgehandelten Revolution öffentlich auszuweisen“ (Adam 1998: 352), jedoch gab es nur wenige Zeichen der Reue, die jedoch für eine formelle Amnestie nicht erforderlich waren, wohl aber für eine Versöhnung unerlässlich gewesen wären (vgl. Adam 1998: 356, vgl. doj & cd, a). Der Heilungs- und Rehabilitierungsprozess der Täter auch im Interesse der Opfer ist daher voranzutreiben. Die TRC arbeitete zwar opferzentriert, jedoch ist für sie die Reintegration der Täter in die Mitte der Gesellschaft von ebenso großer Bedeutung wie die der Opfer (vgl. Villa-Vincencio 2000: 75-76). Gleichzeitig zur Integration der Täter darf jedoch die Akzeptanz des Amnestiemodells und der TRC im Nachhinein durch eine ausbleibende Strafverfolgung nicht geschmälert werden. Da 58% aller SüdafrikanerInnen die Strafverfolgung der Personen erwarten, die keinen Amnestieantrag stellten oder deren Anträge durch die TRC abgelehnt wurden, es jedoch bisher keine weiteren Strafgerichtsverfahren gab, ist dies aber zu befürchten (vgl. Theissen 2002: 73). Die eigens unter der Aufsicht der NPA geschaffene Abteilung zur weiteren strafrechtlichen Verfolgung der Täter, die durch die TRC beschuldigt wurden, ist aufgrund mangelnder Ressourcen stark beeinträchtigt und konnte bisher keine weitere Strafverfolgung vornehmen. Dies ist als ‚unfinished business’ der Vergangenheitspolitik Südafrikas einzustufen. (vgl. Huber/Umbreit 2000: 276): Der Umgang mit den Straftätern, deren Amnestieantrag abgelehnt worden war, bzw. die nie einen solchen gestellt hatten, ist empirisch nicht belegt. Nach Angaben des Büros des NDPP gibt es kein statistisches quantitatives Material betreffend die polizeilichen Ermittlungstätigkeiten, die Entscheidungen zur Strafverfolgung, die gerichtlichen Verfahren und Verurteilungen. [...] Es hat nur wenige Strafverfahren wegen Apartheidkriminalität im weiteren Sinne gegeben. (Lang 2005: 343) Diese Situation ist auch durch internationale Menschenrechtsorganisationen belegt, die sich für eine Förderung des Strafverfolgungsprozesses in der Nachfolgezeit der TRC aussprechen: […] the government should strengthen the capacity and resources of the special prosecution unit in the NDPP’s [HB, National Director of Public Prosecution] office. Failure to do so will not only allow those who were responsible for past human rights abuses and refused to co-operate with the TRC process to escape punishment, but will also harm the prospects of preventing a repetition of the kinds of human rights abuses the TRC had helped to expose. (AI & HRW 13.02.2003) Der Fall um das Attentat auf den ehemaligen Oppositionsführer Frank Chikane, der auf Eis gelegt wurde, da keine einheitlichen Richtlinien bestanden, wie mit den Tätern umzugehen sei, brachte jedoch 2004 neuen Schwung in das Strafverfolgungsverfahren, (vgl. Naidu, Edwin 2005, vgl. Interview mit Frank Chikane 30.08.2005: 4/29-5/22). So kam es im November 2005 zu einem entsprechenden Gesetzentwurf, der jedoch aufgrund fehlender Transparenz bei der Erstellung und im Verfahren der Strafverfolgung negativ in Erscheinung trat. Die Ängste innerhalb der Zivilgesellschaft, dass der ANC per Gesetz eine Pauschalamnestie durch die Hintertür einführt, sind groß (vgl. Interview mit Yasmin Sooka 29.08.2005: 1/26-2/6). Alex Boraine sieht darin die Untergrabung des südafrikanischen Strafrechts. Die TRC war, so Boraine "very clear in its original recommendation, namely Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 78 ____________________________________________________________________________________________________________________ that those who did not apply for amnesty, or applied and were refused, should be considered for prosecution. […] The TRC has consistently opposed a general amnesty and believes that to declare further amnesties at this stage would undermine our criminal justice system.” (h. zit. n. Terreblanche 27.11.2005). Die Glaubwürdigkeit der TRC und ihrer rechtsstaatlichen Verbindlichkeit steht auf dem Spiel. Eine Amnestie durch die Hintertür, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, würde der ‚closed-list policy’ der TRC ein Ende setzen und Opfer sowie Täter mit zweierlei Maß bemessen. Während die Täter, die sich nicht der TRC stellten durch ein solches Verfahren belohnt würden, würden die zahlreichen Opfer, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht am TRC-Prozess beteiligten, benachteiligt. Die Öffnung der Liste der offiziell anerkannten Opfer und die ihnen damit zustehenden Reparationszahlungen wäre die Folge, die jedoch in Regierungskreisen keinerlei Beachtung findet (vgl. Interview Frank Chikane 30.08.2005: 2/4-17, 2/33-3/8). Die fünf großen Fehler, die die TRC selbstkritisch anmerkt, begangen zu haben, sind folgende: Erstens hätten der Ausbruch der Gewalt Anfang der 1990er Jahre und das chemische und biologische Waffenprogramm besser untersucht werden müssen. Zweitens wurden die Verwaltungsstrukturen und Regierungsbehörden der schwarzen Kommunen nicht intensiv genug analysiert. Drittens wurde den ausufernden Gewalttaten der staatlichen Sicherheitskräfte in ‚Venda’, ‚Lebowa’ und ‚Bophuthatswana’ nicht genug Aufmerksamkeit zu Teil, und viertens waren die Untersuchungskapazitäten der TRC beschränkt, so dass nicht alle Fälle von Menschenrechtsverletzungen untersucht werden konnten. Fünftens ist der Umgang und die Beschäftigung mit bestimmten Schlüsselfiguren des Konflikts nicht adäquat und intensiv genug gewesen. Insbesondere wird Chief Mangosuthu Buthelezi (IFP) erwähnt. (vgl. Huber/Umbreit 2000: 279-281, vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 5/chap. 9/Sec. 109-135). Die IFP boykottierte die TRC insgesamt aufgrund der damals noch offenen und gewalttätigen Feindschaft zum ANC, als dessen Ziehkind sie die Kommission sahen. Buthelezi erschien trotz Einladung nicht vor der Kommission, und von einer Zwangsmaßnahme sah die TRC ab, da diese die anhaltende Gewalt in KZN noch angeheizt hätte (vgl. Adam 1998: 361,vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 5/Chap.6/Sec. 55). […] because of political expediency or the pragmatics of the transition that the extend to which leading political figures and political activists were involved in political violence […] they were not fully investigated by the legal system, by the police or by the national justice system.[…] often it was more politically pragmatic not to engage in serious prosecution or fully prosecuting people who had been caught in violence because of the political fall out that would result. (Interview Rupert Taylor 28.08.2005: 3/25-4/14) Seit 1994, also über das Mandat der TRC hinaus, wurden etwa 2.000 Menschen in KZN aus politischen Gründen ermordet. Seit 1999 regiert zwar in der Provinz eine Koalition aus IFP und ANC, und seit Mitte 1996 ist der politische Konflikt offiziell beigelegt, trotzdem ereignen sich immer wieder Massaker, Attentate und andere gewalttätige Ereignisse mit politischem Hintergrund, oftmals ausge- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 79 ____________________________________________________________________________________________________________________ führt von ehemaligen Paramilitärs, die alle einem systemischen Problem unterzuordnen sind, das heute wie damals den Rechtsstaat und dessen Ordnungshüter impliziert (vgl. Taylor 2001: 5). […] the legal system was perverted by political agendas both in apartheid years and in the transition years so that even now a huge number of people do not trust the police because the police has seen to be implicated in the violence of the past particularly in KZN. […] because of the political violence the records of political violence was never fully addressed and this is still a failure of the TRC until today that the extend to which people were fully implicated the extend to which they were not fully called to account has undermined the respect for the rule of the law. People do not think the law has been applied universally in a fair manner in the past and the problems of the past continued to influence the present particularly in areas like KZN where you had a long standing political conflict, where policing has been highly politicised. (Interview Rupert Taylor 28.08.2005: 3/25-4/14) Die politische Motivation wird von den Medien und den Behörden jedoch verneint oder heruntergespielt (vgl. Taylor 2001: 5). Post-apartheid political violence has been over-determined by, and fuelled by, a failure to confront past wartime divisions and their legacy. Cases of violence can be directly traced back to , and are contaminated by, and interconnected through the ‘unofficial war’ between Inkatha and the ANC. In fact, the spiral of the war between Inkatha and the ANC has spawned complex networks of complicity that stretch from the lowest forms of organized crime to the highest echelons of the state. (Taylor 2001: 6) Seit den 1980er Jahren wurde die Provinz durch die Antipathien zwischen ANC und IFP militarisiert. Die IFP wurde durch die staatlichen Sicherheitskräfte der Apartheid ausgebildet und mit Waffen versorgt. Doch nicht nur die bewaffneten Flügel der Parteien, sondern auch Volksmilizen, wie die ‚Self Protection Units’ (SPUs) - zu IFP gehörig - und die ‚Self Defence Units’ (SDUs) - dem ANC anhängend - wurden militärisch ausgerüstet, trotz der nationalen Friedensgespräche zwischen NP und ANC, und operierten inoffiziell noch über das Jahr 1994 hinaus (vgl. Gear 2002: 27-29). In fact, the TRC’s emphasis on reconciliation and the individual experiences of perpetrators (state agents) and victims (political activists) deflected focus from […] the systemic nature of political violence in KZN and the need for effective prosecutions. (Taylor 2001: 27) Seit der Veröffentlichung des TRC-Berichts und dem Abstreiten von Verantwortung der politischen Führer von IFP, NP und ANC, von inoffizielle Operationen und Kampfhandlungen gewusst zu haben, gab es keine Untersuchungen und Lösungsvorschläge von Seiten der Strafverfolgungsbehörden zum Umgang mit der politischen Gewalt in KZN, sondern nur die Darstellung von einzelnen Taten und sogenannten ‚political violence flashpoints’, um die Problematik herunterzuspielen, Verantwortung von sich zu weisen: A better understanding of the systemic causes of political violence and a stronger level of political will would have led to many lives being saved. A failure to confront the ‘unofficial’ war […] - in terms of asserting political authority or through the Truth and Reconciliation Commission - has worked to drive political violence and to push it into new forms , with lethal effect. A basic human right is that people must be able to live their lives without undue threat or the likelihood of violent death or injury: in KZN the post-apartheid state has patently failed to protect its citizens. Justice has been denied. (Taylor 2001: 28) Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 80 ____________________________________________________________________________________________________________________ Die Vergangenheitspolitik ist hier noch lange durch die Versäumnisse der TRC und einem nachfolgenden ‚policy-gap’ nicht am Ende, um ein Mehr an Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Wie Gibson beschreibt ist die politische Kultur und die persönliche Einstellung gegenüber dem Rechtsstaat ausschlaggebend für eine Kultur der Menschenrechte: “Without a culture that rejects the sublimation of law to other more pressing objectives, a Rechtsstaat cannot effectively function” (Gibson 2004: 230). Eine spezielle Untersuchungseinheit, die sich um die Gewalt, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart herüberreicht, investigativ bemüht einzurichten, wäre die logische Konsequenz, um der Konsolidierung der Demokratie Vorschub zu leisten. „South Africa should not place itself above international law - which places an obligation to investigate, prosecute, and punish all serious human rights violations” (Taylor 2001: 29) Neben der bedingten Strafverfolgung der Täter ist auch das täterbezogene Instrument der Disqualifizierung in einem post-autoritären Staat möglich und wird durch politische Entscheidungen eingesetzt, um den öffentlichen Dienst einer Lustration zu unterziehen (vgl. Adam 1998: 353). Die TRC wertete jedoch die Option der Lustration als unangebracht für den südafrikanischen Kontext (vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 5/Chap. 8/ Sec. 19). 5.3.4 Handlungen bezüglich der Opfergruppe Zustande gekommene Maßnahmen Neben der allgemeinen Aufgabe der TRC, für eine öffentliche Aussprache des erfahrenen Leids der Opfer zu sorgen, hatte das ‚Reparation and Rehabilitation Committee’ nach Kapitel 4 (f) PNURA die Aufgabe, die von den Opfern erlittenen Schäden festzustellen und Maßnahmen zu nennen, die bei der Gesetzesformulierung dem Ziel der Wiedergutmachung durch jegliche Form materieller und immaterieller auch freiwilliger Kompensation, Restitution, Rehabilitation oder Anerkennung dienen (vgl. Huber/Umbreit 2000: 276): […] make recommendations to the President with regard to - (i) the policy which should be followed or measures which should be taken with regard to the granting of reparation to victims or the taking of other measures aimed at rehabilitating and restoring the human and civil dignity of victims; (ii) measures which should be taken to grant urgent interim reparation to victims. (SA Gov. Info, c) Symbolische Wiedergutmachungen wie Gedenktage, Denkmäler und Plätze der Erinnerung sind laut TRC-Bericht ebenfalls einzurichten. Mit der Eröffnung des ‚Freedom Park’ im Rahmen des ‚National Heritage Resources Act 25 of 1999’ und der Einrichtung des ‚Reconciliation Day’ und anderer Feiertage, wurde zur Erfüllung dieser Aufgabe ein großer Beitrag geleistet (vgl. Fox 2004: 266). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 81 ____________________________________________________________________________________________________________________ Die Ansprüche der (offiziellen) Opfer auf finanzielle Entschädigung werden durch die Reparationsempfehlungen der TRC untermauert, die sich auf Leitlinien im internationalen Recht stützen.61 Die TRC empfahl eine jährliche Zahlung in Höhe von R21.000 bis 23.000 - derzeit etwa 2.750 € - je nach Fall, über einen Zeitraum von sechs Jahren als symbolische Wiedergutmachung, was etwa 0,25% des Staatshaushalts ausmachen würde. Die Regierung sagte erst am 15. April 2003, nach der Veröffentlichung des abschließenden Berichts des Amnestiekomitees, eine Einmalzahlung von R30.000 - etwa 3.750 € - dieser Opfergruppe zu, sowie die einmalige Sofortauszahlung von R2.000 ‚Urgent Interim Reparation’ für etwa 19.000 der oben genannten Opfergruppe (vgl. Mbeki 2003: 22, vgl. Burton 2004: 37). Die TRC beschreibt in ihrem Bericht einen inhaltlich ausgearbeiteten Entwicklungsverlauf einer ‚Reparation and Rehabilitation Policy’. Da die Regierung noch keine Institution geschaffen hatte, übernahm das ‚Reparation and Rehabilitation Committee’ die vorläufige Organisation der ‚urgent interim reparation’ (vgl. TRC-Bericht, a: Vol.5/Chap.1/Sec.58-60). Eine Klage der ‚Khulumani Support Group’ (KSG) unter dem Alien Tort Claims Act 28, U.S.C. §1350 vor einem US-Amerikanischen Gericht gegen 23 von der Apartheid profitierende Wirtschaftsunternehmen, beweist, dass die Opferentschädigung von Seiten der Regierung nicht entschieden genug angegangen wurde. Die nationalen und internationalen Konzerne unterstützten auf wirtschaftlicher Basis das Apartheidregime, trotz der Verurteilungen der Apartheidpolitik durch die UN als Verstoß gegen internationales Recht und die internationale Moral (vgl. KSG, b, vgl. SAHO, f). Die südafrikanische Wirtschaft richtete um ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, einen freiwilligen Spendenfond - den ‚Business Trust’ ein - mit dessen finanziellem Budget von R800 Millionen Rand - etwa 100 Millionen € - der Aufbau von Infrastruktur i.w.S. in den Kommunen gefördert werden soll (vgl. Terreblanche 10.08.2003). Khulumani et al. klagte jedoch trotzdem gegen die Konzerne, die im Verdacht stehen, die Apartheid unterstützt zu haben, was jedoch durch die ANCRegierung Südafrikas aufgrund der Befürchtungen von Investitionseinbrüchen strikt abgelehnt wird. Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und ehemaliger Vizepräsident der Weltbank, sprach sich jedoch für die Klage aus: Those who helped support that system, and who contributed to human rights abuses, should be held accountable. Holding them accountable would contribute to confidence in the market system, creating a more favourable business climate. If anything, it would thereby contribute to South Africa's growth and development [… Apartheid is a matter of the past, though its consequences live on. (Stieglitz 2003, h. zit. n. Terreblanche 10.08.2003) 61 Eine Resolution, Deklaration oder Konvention der UN zur rechtlichen Verpflichtung der Staaten auf die Bereitstellung von Reparationen und Rehabilitationsmechanismen für Opfern durch Systemunrecht besteht derzeit nicht, jedoch machen sich Menschenrechtsorganisationen und auch die UN stark für die Annahme der ‚Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparations for the Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law’. Auch der 24. Bericht des ‚Special Rapporteurs’ der International Law Commission zeigt, dass sich der Staat verantwortlich in Reparationsangelegenheiten zeigen muss (vgl. UNILC, a; vgl. Redress, a). Die TRC nimmt in ihrem Bericht in Band 5 Kapitel 1 ausführlich Bezug auf die international anerkannten Rechte auf Reparationen (vgl. TRC-Bericht, a). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 82 ____________________________________________________________________________________________________________________ Der Abschlußbericht der TRC und einige ehemalige Kommissare und Kommissarinnen sowie der ehemalige Vorsitzenden der TRC befürwortet die Klage ebenfalls (vgl. KSG, c, vgl. Wanneburg/Chege 2003; vgl. CMHT, a).62 The TRC has been widely praised as South Africa’s special way of facilitating transition. It has been fairly successful in exposing much of what happened, and in using the amnesty mechanism to deal with some of the perpetrators. But it will be seen to have failed if thousands of people continue to have a sense of grievance and injustice. The government and all South Africans should take serious note of the need to work towards reconciliation through creating better lives for all. (Burton 2004: 43) Hinsichtlich der Untersuchung von Verschwundenenfällen zeigt sich ein ambivalentes Bild. Ein spezielles Untersuchungsteam innerhalb der Institution der ‚Priority Crimes Litigation Unit’ der NPA wurde 2004 ohne ausreichendes Budget geschaffen. Die Fälle der verschwundenen Personen, die durch die direkte Arbeit der TRC nicht aufgeklärt und auch gefunden werden konnten, werden damit, den Empfehlungen der TRC nach, untersucht. Jedoch ist auch diese Einheit nicht vom einem politischen Willen des ANC geprägt, Licht in das Dunkel der Fälle der Entführten, Verschwundenen und Getöteten zu bringen. Madeleine Fullard, die im August 2005 einzige Beschäftigte im TaskTeam zur Untersuchung der Fälle vermisster Personen im Rahmen der TRC-Empfehlungen berichtet: […] from last year July I started full-time with this unit spearheading investigations into missing persons. And now we have this missing persons task team set off. […] In that same speech of President Mbeki, he says about the TRC recommendation that the NPA should […] set up a task team to investigate cases on missing people that have not been resolved. Our unit […] just started as we are the unit that is supposed to be dealing with TRC matters […]. Technically we have a missing persons task team although at the moment it is just me but soon there will be others. […] it has been a process of trying to fundraise and get public support for it and government support for it. Technically, there is government support but […] it could not just fall from the sky, so we did some exhumations in March some with which we got a lot of publicity and that then opened the road and people can see: It is possible. Something is happening. They can support the funding, now […] we have got funding promised from the ‘Foundation for Human Rights’ and also the ‘Department of Justice’ is going to be putting some extra money in and then also even the NPA allocated money for this work. Now we have sufficient money to appoint people during the next month […]. I imagine for maybe two years doing some work tracing missing people […] see how many we can find. See how many we can exhume. […] but to be honest, it was really just our personal initiative. Myself and another colleague. It was not like that, that government said: NPA, implement this resolution. Just that we knew that the resolution was there when Mbeki had said, yes, the NPA should do it. So, we started and then any people were saying: What are you doing? And then we said: Mbeki said we must do it. And so we just began. (Interview Madeleine Fullard 24.08.2005: 1/20-2/14) Derzeit werden etwa noch 475 Personen vermisst, die durch die TRC namentlich erwähnt wurden. Die meisten verschwundenen Personen wurden in den 1980er Jahren entführt, und die meisten Angehörigen warten seitdem auf ein Lebens- oder Todeszeichen der entführten Person, was sie in einer Art Schwebezustand der Ungewissheit hält und unter enormem psychischen Druck stehen lässt. Be62 KSG ist eine NGO, die von Opfern politisch motivierter, schwerer Menschenrechtsverletzungen durch das Unrechtssystem der Apartheid, gegründet wurde. Die Mitglieder wurden unterstützt bei der Erfüllung der Anforderungen durch die TRC Anhörungen. Heute beschäftigt sich KSG als der größte südafrikanische Apartheidopferverband hauptsächlich mit dem ‚unfinished business’ des Prozesses der Beschäftigung mit Vergangenheit in Südafrika (vgl. KSG, a). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 83 ____________________________________________________________________________________________________________________ denkt man die Menschen, die wegen eines Verschwundenen keine Eingabe bei der TRC machten oder machen konnten aber zurückgewiesen wurden, ist es auch nach Angaben der KSG vorstellbar, wie viele Angehörige mehr das psychische Leid ertragen müssen (vgl. KSG, f, vgl. Mashego 15.03.2005). Bezüglich der legalisierten Enteignung mittels rassistischer Apartheidgesetze wurde das opferbezogene Reformprogramm des ‘Department of Land Affairs’ ins Leben gerufen. Es bezieht sich neben der Reform der Pachtrechte (vgl. Kap. 5.3.1) auf die Entschädigung der Opfer sowie die Umverteilung von Land. Die Entschädigung bezieht sich hauptsächlich auf die historischen Ungerechtigkeiten. Von 68.878 Klagen bis zum Jahr 2001 bezogen sich 72% auf städtische Gebiete, die unter dem ‚Group Areas Act’ zwangsenteignet wurden. 28% bezogen sich auf Gebiete im ländlichen Bereich, die jedoch 90% der Personen aufgrund von Kollektivklagen ausmachten. Ende Januar 2002 waren 42,7% aller Klagen am ‚Land Claims Court of South Africa’ abgeurteilt (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap. 2/ 36-39). Die Umverteilung des Landes erfolgte ab 1994 nach dem marktorientierten ‚willing buyer willing seller’-Ansatz, der durch die Nachfrage reguliert wird. Dieser Ansatz wurde gekoppelt mit einem Subventionsprogramm der Regierung, das jedem willigen Käufer einen Maximalbetrag von R16.000 zusagte, wenn dessen Haushalt weniger als R1.500 pro Monat zur Verfügung hatte. Das aufgrund der Ineffizienz des Ansatzes neu aufgelegte ‚Land Redistribution for Agricultural Development Programme’ setzt dem 30%-Ziel ein Zeitlimit von 15 Jahren ab 2000 an die Seite und gibt den schwarzen BürgerInnen individuell die Möglichkeit, eine Subvention von bis zu R100.000 nicht nur für den Kauf, sondern auch für die Erneuerung und für Infrastrukturinvestitionen im Agrarsektor zu erhalten. (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap. 2/ 36-39, SAPA, a: 31.10.2005). Ausgebliebene Maßnahmen Bezüglich der Entschädigung und der Umverteilung von Land wurde seit dem Ende der Apartheid wenig erreicht. Die bis zum Jahre 2002 behandelten Klagen am ‚Land Claims Court’ betrafen nur 0,33% des südafrikanischen Landes, da es sich fast ausschließlich nur um städtische Gebiete handelte (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap. 2/ 36-39). Die Entstehung des ‚Landless People’s Movement’ (LPM) und die Nachrichten über Zwangsenteignungen im Nachbarland Zimbabwe setzten die Politik um die Landrückgabe zwar in Bewegung, da der Staat die Reform seiner Programme vorantrieb, jedoch begegneter er mit übertriebener, teils menschenrechtsverletzender Polizeigewalt auf der Straße den Forderungen und Demonstrationen des LPM. Die anderen politischen Akteure wie SACP und COSATU jedoch drängen die Regierung auf eine schnellere Abwicklung des Prozesses und eine effektivere Umwandlung der Implementierung des Programms zur Landreform. Des Weiteren wird Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 84 ____________________________________________________________________________________________________________________ auch der ‚willing-seller-willing-buyer’ Prozess als zu langwierig in Frage gestellt und der Ruf nach einem Sozialpakt zwischen den kommerziellen weißen Farmern und den Armen aus ländlichen Regionen immer lauter. Durch den ‚willing buyer willing seller’-Ansatz wurden bis zum Jahr 2000 821.134ha Land auf 53.950 Haushalte umverteilt, was etwa 1% des gesamten landwirtschaftlich nutzbaren Landes ausmacht, wobei im RDP 30% anvisiert waren (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap. 2/ 36-39). Die weißen Farmer erkennen die Notwendigkeit einer Landreform: Für 75% ist diese unvermeidlich, und 54 % sind willens, ihr Land oder Teile ihres Landes zu verkaufen, um den Prozess zu beschleunigen (vgl. Greenberg 2004: 31-32). Der Prozess um die Vergangenheit kommt hier, wenn auch schleppend, in eine neue Phase und wird von den meisten beteiligten Akteuren auch als notwendig anzugehen angesehen. 63 Ntsebeza plädiert für die Teilnahme der Privatwirtschaft, einschließlich der kommerziellen Landwirtschaft, am Heilungsprozess des Landes. Die Farmer sollten nach dem Vorbild des ‚Business Trust’ freiwillig einen Teil ihres Landes, der wenig genutzt oder gar bracht liegt, abgeben. Diese Land solle dann speziell solchen SüdafrikanerInnen zur Verfügung gestellt werden, die dort Subsistenzwirtschaft betreiben und das Land als ruralen Lebensraum nutzen (vgl. Ntsebeza 2004: 208). Diese sind laut Marjorie Jobson, Vorstandsmitglied im ‚Land Access Movement’ durch ihre Kenntnisse im Bereich der Landwirtschaft bestens mit den Gegebenheiten des Landbaus vertraut, haben jedoch durch die vielschichtige Diskriminierung und die Vertreibung von ihrem Land das Selbstvertrauen verloren, welches es gelte wieder herzustellen: If you are talking about unfinished business you have to look at all the deliberate ways in which people were disempowered. […] if you talk to victims, they do not understand those processes themselves. […] communities who were forcibly removed from there land […] They do not see, they do not interpret, they know that they used to be successful farmers. Black farmers were far more successful than white farmers. […] the way the agricultural sector […] was set up was through the poor white communities who ended up trying to survive of the land and they were supported and helped […] by the successful black farmers who were then dispossessed. […] They had much more knowledge about how to be sustainable on the land. It was generations that were disempowered and that does something to the dignity of people. It is so denigrating. I know sitting in meetings with the members of the ‘Land Access Movement’. They think they know nothing. They knew more and had indigenous knowledge way beyond the white settlers. But they will now be quiet. That is another thing that happens to victims. They will rather defer to other people who may think have more knowledge than they have. They do not realise how highly valuable their knowledge is. (…) what happens when you then apart from all the dispossessions … they did also violate people with torture with rape with indiscriminate shooting, with locking people up for an indefinite period in solitary confinement. That is yet another level of victimisation. You see the unfinished business is so layered […]. (Interview Marjorie Jobson 17.08.2005: 1/11-2/7) 63 Die Notwendigkeit wird auch durch den ersten Enteignungsprozess am ‚Land Claims Court of South Africa’ deutlich (vgl. Bitala 26.09.2005: 10) Falls das Gericht für den Kläger entscheidet, wird dies der erste Fall eines Zwangsverkaufs in Südafrika sein, der durch den ‚Land Claims Court’ entschieden wird und nicht durch die verschiedenen Instanzen des Landrückgabeprozesses noch des ‚willing-seller-willing-buyer’ Prozesses anderweitig gelöst werden konnte (vgl. Peete 23.09.2005). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 85 ____________________________________________________________________________________________________________________ Die Würde und Wiederherstellung des Selbstvertrauens der Opfer von Enteignungen muss jedoch mit zivilgesellschaftlicher Anstrengung erfolgen. Die CRLR kann durch die Rückgabe des eigenen Lands dafür eine Basis bereiten. The one critical role that white commercial farmers can play if they are serious about reconciliation and reconstruction in South Africa is to donate land and make it available to blacks whose livelihood is dependent on land-based activities. This would apply particularly to the poor, including former and existing farm dwellers, those living in the overcrowded rural areas, the former Bantustans and the urban poor. (Ntsebeza 2004: 205) Der Vorschlag Ntsebezas basiert auf der Annahme, dass auch die weißen Farmer bereit zu solchen Schenkungen sind. Eine entsprechende Kampagne der Regierung und die veränderte Haltung gegenüber dem neuen südafrikanischen Staat gerade in der Gruppe der Afrikaaner, könnte dies als eine greifbare Option erscheinen lassen.64 Über den Rahmen der TRC hinaus gibt es auch nach Villa-Vincencio noch weiteren Handlungsbedarf im Politikfeld der Vergangenheitspolitik. Er erachtet es als notwendig, die Erweiterung der Arbeit mit den traumatisierten Opfern auf nationaler Ebene voranzutreiben, um ihren Heilungsprozess und ihre Integration zu beschleunigen (vgl. Villa-Vincencio 2000: 75-76).65 Das Vorantreiben und Einhalten von Menschenrechten und demokratischen Prinzipien ist ebenso von elementarer Bedeutung, um denen, die durch die Vergangenheit traumatisiert sind, die Möglichkeit zu geben, für ihre Rechte im öffentlichen Raum einzutreten. Die Partizipationskraft der durch die Apartheid geschädigten BürgerInnen ist notwendigerweise auszuweiten, um die Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne der Verfassung voranzutreiben. Dies kann nur durch Heilung der Traumatisierten und der Umsetzung sozioökonomischer Rechte geschehen. The participation of traumatised people in their own healing and in finding solutions for the nation’s problems is a key ingredient to social transformation. The affirmation of socio-economic rights in the Bill of Rights [HB, as part of the constitution] and recommendations on reparation by the TRC are insufficient in themselves. The participation of those victimised by the past in claiming these rights is crucial. This requires a political system within which free speech, the right to organise and open, critical debate is guaranteed. (Villa-Vincencio 2000: 75-76) Die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich ist eine Aufgabe, die die TRC nur erörterte vor allem durch die ‚Business Hearings’ am 11./12. und 13. November 1997 - , die jedoch weiteren Handlungsbedarf benötigt, um die Opfer der wirtschaftlichen Ausbeutung durch das Apartheidregime zu entschädigen (vgl. Villa-Vincencio 2000: 75-76). Gemäß des Abschlussberichts der TRC, 64 Die Marktforschungsgruppe ‚African Response’ belegt den radikalsten Wechsel in der Einstellung gegenüber den staatlichen Institutionen und politischen Führern bei den Afrikaanern, die traditionell den Landwirtschaftssektor beherrschen. Immer mehr von ihnen unterstützen die ‚affirmative action’-Programme des Staates und sprechen sich für die Gleichheit unter den Rassen aus, wobei die optimistische Jugend großen Einfluss auf die ältere Generation zeigte (vgl. African Response, a). 65 In diesem Bereich dominiert das Netzwerk ‚Themab Lesizwe’, das verschiedene NGOs, die sich im Bereich der Traumaarbeit engagieren, unter einem Dach vereint (vgl. Themba Lesizwe 2005). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 86 ____________________________________________________________________________________________________________________ wo eine engagiertere Rolle der Privatwirtschaft gefordert wird, wird das Budget des ‚Business Trust’ als dürftig deklariert (vgl. Terreblanche 10.08.2003). Die Regierung distanziert sich jedoch von der Möglichkeit, die Privatwirtschaft per Gesetz mittels finanzieller Verpflichtungen oder Steuern in den Wiederaufbau des Landes mit einzubinden: South African President Thabo Mbeki said on Tuesday his government would make a one-off payment to thousands of victims of apartheid, but he rejected calls to impose a wealth tax on big business. He also distanced the government from a slew of class-action lawsuits filed in American courts seeking billions of dollars in damages from local and foreign companies accused of benefiting from nearly 50 years of whiteminority rule. […] The payment total of R571,5-million [HB, als Reparationszahlungen für die Opfer] is far below the R3-billion recommended by the TRC. Mbeki rejected a TRC recommendation to levy a wealth tax on South African business to help pay for reparations. (Wanneburg/Chege 15.04.2003) Die Reaktionen auf die 2003 von der Regierung in Aussicht gestellten Reparationszahlungen riefen Verärgerung und Enttäuschung bei den Opfern hervor: Now the long silence had eaten away at positive feelings towards the TRC process. During that period [HB, zwischen 1997 und 2003, als keine Zusagen bezüglich Reparationen durch die Regierung gemacht wurden], too, unemployment and poverty had worsened and people’s faith in a transformation that would improve their living conditions had been eroded (Burton 2004: 41) Die TRC riet ebenfalls zu zusätzlichen Entschädigungszahlungen durch die privatwirtschaftlichen Banken, Firmen und halbstaatlichen Unternehmen (vgl. Adam 1998: 359; Burton 2004 37-43). Während des ‚Special Hearings’ zum Sektor der Privatwirtschaft am 11.11.1997 forderte Sampie Terreblanche eine Vermögenssteuer für die Nutznießer der Apartheid, als Ausgleich für die systemische Ungerechtigkeit: […] the stability of the new South Africa can be at stake if we fail to find a satisfactory of solution of inequality. A satisfactory degree of systemic justice can perhaps be attained by imposing a wealth tax of say 0,5% annually for 10 or 20 years on all persons with net assets of more than R2 million and to use the yield of this levy for the upliftment of say the lower 40%. A levy on wealth for redistributive purposes is preferable above any form of taxation. Such a taxation would be levied on wealth accumulated during the apartheid century.” (doj & cd, d) Im Rahmen der Veröffentlichung des Abschlussberichtes der TRC 2003 wies jedoch Mbeki die nochmals gestellte Forderung der Kommission nach einer Vermögenssteuer eindeutig zurück (vgl. Wanneburg/Chege 15.04.2003, Burton 2004: 41), obwohl mehr als 2/3 der Schwarzen bezüglich der Entschädigungszahlungen der Meinung sind, dass die Opfer durch die Regierung, die von der Apartheid profitierenden Unternehmen und die weißen Nutznießer generell durch Reparationen entschädigt werden sollten. Auch sind etwa die Hälfte aller Weißen für die finanzielle Entschädigung, weisen jedoch eine Eigenbeteiligung von sich (vgl. Theissen 2002: 73). Im Februar 2004 entschied sich die Regierung in einem Zwei-Phasen-Programm für die Regelung der Reparationsempfehlungen der TRC. Der ‚President’s Fund’, im ‚Department of Justice and Constitutional Development’ übernahm die einmaligen und individuellen Reparationszahlungen, Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 87 ____________________________________________________________________________________________________________________ wobei bis zum 12.02.2004 11.735 Personen entschädigt wurden und noch weitere 3.739 Personen entsprechende Ansprüche hatten.66 Die zweite Phase des Programms wird sich den weiteren Empfehlungen der TRC zuwenden: „Phase two of the regulations will deal with programmes that will provide for medical benefits, education assistance, housing, and other social benefits, as well as symbols and monuments” (SA Gov. Info, e). Jedoch ist bis heute die weiterführende Phase nicht eingeleitet worden, da Regierungsvertreter die genannten Politikfelder als schon durch nicht speziell auf Vergangenheitspolitik ausgerichtete Bereiche abgedeckt sehen.67 Es existiert kein staatliches Krankenversicherungssystem in Südafrika. Das staatliche Gesundheitswesen stellt zwar kostenfreie Versorgung aller Kinder unter sechs Jahren in allen staatlichen Kliniken zur Verfügung. Arbeitslose müssen jedoch einen Betrag von R39 - etwa 5€ - für eine medizinische Untersuchung zahlen. In vielen ‚public clinics’ und sogenannten ‚community health care centres’ ist die medizinische Grundversorgung kostenfrei, der Standard der Kliniken und Praxen schwankt jedoch sehr zwischen den einzelnen Regionen des Landes (vgl. SouthAfrica.info, a). In Südafrika gaben über die Jahre 1996, 1998 und 2000 weniger als 20% aller Menschen an, privat krankenversichert zu sein. Die schwarze Bevölkerungsgruppe lag dabei wie erwartet am niedrigsten mit unter 10%. Von zehn Weißen sind jedoch sieben krankenversichert (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap.2/30). Das Sozialversicherungssystem Südafrikas versorgt 5,5 Millionen BürgerInnen bei einer Gesamtpopulation von ca. 41 Millionen Menschen. Jedoch leben etwa 45% aller SüdafrikanerInnen unter der Armutsgrenze von 2 US$ am Tag. 75% der bedürftigen Kinder bekommen nicht den ‚Child Support Grant’, der ihnen bis zum siebten Lebensjahr zustehen würde. Die Arbeitslosenversicherung ist nur erhältlich, wenn die Person schon einmal in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis stand und auch dann nur für eine begrenzte Dauer. „Only women over 60 and men over 65 qualify for the pension scheme and Disability grants are very difficult to secure both because of complicated registration process and because of the difficulty disabled people have in getting to the payment and registration points” (Democratic Alliance, a). 1998 bekamen 2.5 Millionen Menschen die Alterspension bzw. den ‚Disability grant’ mit durchschnittlich etwa 49US$ im Monat. So wirbt die DA für die Einführung eines ‚Basic Income Grant’, um die Lücke zu schließen, die zwischen der Anzahl der Empfänger staatlicher Hilfe und den Bedürftigenzahlen klafft (Democratic Alliance, a). 66 Die Summe der Anzahl der Personen beider Gruppen ergibt eine Zahl von 15.474 Reparationsberechtigter, die weit unter der Zahl von 22.000 liegt, die noch in der Präsidentenrede vom 15. April 2003 im Parlament und im TRC-Bericht genannt wurde (vgl. Mbeki 2003: 22; TRC-Bericht, a: Vol.5/Chap.1). Eine Erklärung konnte hierfür nicht gefunden werden. 67 Wie sehr sich in den Bereichen Bildung, sozialer Wohnungsbau, Gesundheits- und Sozialversicherungssystem seit 1994 die Lage für die marginalisierte Unterklasse verändert hat ist im ‚Human Development Report’ 2003 des ‚United Nations Development Programme’ (UNDP) nachzulesen (vgl. UNDP/NHDR, a). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 88 ____________________________________________________________________________________________________________________ Um den Marginalisierten der Gesellschaft zu helfen, plädieren Organisationen der Zivilgesellschaft für die Einrichtung eines ‚Basic Income Grant’ (BIG), einer staatlichen Sozialhilfe, die den südafrikanischen Bürgerinnen und Bürgern unterhalb einer gewissen Einkommensgrenze einen monatliches Grundeinkommen zuweist. Der BIG könnte einerseits eine logische Fortführung der Unterstützung für die offiziell anerkannten Opfer sein und andererseits einen Ausgleich für alle die Opfer der Apartheid darstellen, die durch Systemverbrechen zwar geschädigt aber nicht durch die Regierung entschädigt werden. 68 Die ‚South African NGO Coalition’ (SANGOCO) betonte den Zusammenhang zwischen Systemgewalt und Armut, indem sie die durch die TRC genährten Hoffnungen auf Wiedergutmachung und eine Verbesserung der Lebensqualität, die schon in der ANC ‚Freedom Charter’ Manifestation findet, in eine außerordentliche Anhörung zum Thema Armut münden ließ, die jedoch den Charakter der TRC nicht veränderte: […] in 1996 or 1997 there was the NGO coalition that did poverty hearings that ran simultaneously to the TRC. They realised there was a gap and people were never going to be able to talk about poverty within the TRC hearings. There was some feeling that there do not needed to be hearings just on poverty and they just tried and make that an issue. […] The TRC has also raised expectations simultaneously […] the formula was in those public hearings that they tell their story and then the commissioner asks: What do you want? And then they say something and the commissioner says: Okay, we do and try our best to get that for you. (Interview Polly Dewhirst 03.08.2005: 7/8-18) Terreblanche sieht eine Gefahr für die Stabilität des demokratischen Südafrika, wenn die Ungleichheit nicht durch Umverteilung behoben wird. Verschiedene Organisationen der Zivilgesellschaft forderten eine weiterführende Beschäftigung mit den Opfern der Apartheid durch den Staat. Nicht nur, dass viele Opfer aus den verschiedensten Gründen nicht in den Prozess der TRC eingebunden waren, sei es durch Verweigerung, aus Angst, durch politischen Druck oder aus fehlerhafter und defizitärer Information, eine große Zahl an Südafrikanern litt unter der Apartheid auf unterschiedlichste Art und Weise, die jedoch nicht immer unter das Mandat der TRC fallen (vgl. Burton 2004: 42). KSG tritt dafür ein, dass spezielle Maßnahmen für die südafrikanischen BürgerInnen getroffen werden, die durch politische Taten im Rahmen der Apartheid Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen wurden, so dass diese ebenfalls die große Bandbreite an Möglichkeiten im post-Apartheid Südafrika nutzen können. Das ‚unfinished business’ der südafrikanischen Vergangenheitspolitik steht jedoch diesem Ziel entgegen. KSG steht auf dem Standpunkt, „[HB, that] government failed to wholeheartedly embrace the recommendations of the truth and reconciliation commission” (KSG, d). KSG ist der Meinung, dass die Forderungen nach Verantwortung mit der Zeit nicht nachlassen werden, obwohl die Regierung nicht auf Anfragen und Projektvorschläge der NGO reagiert. Die Reparationen für Gemeinden und Kommunen, die Schaffung von Richtlinien für die Strafverfol68 Pieter le Roux breitet im Rahmen des Analyseprojekts ‚BIG Financing Reference Group’ seine Theorie zur Einführung eines solchen Grundeinkommens aus, deren größtes Umsetzungsproblem die fehlende Infrastruktur in Südafrika sei, was eine sehr hohe finanzielle Belastung des Projekt im voraus bedeute (vgl. BIG, a). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 89 ____________________________________________________________________________________________________________________ gung von Tätern und das Recht der Opfer auf Entschädigungsklagen wurde bisher durch die südafrikanische Regierung gar nicht erst vorgenommen oder unterminiert (vgl. KSG, d). So beurteilt auch Hamber den Prozess der Versöhnung durch vergangenheitspolitische Maßnahmen im Bereich der Entschädigungen und Wiedergutmachungen als negativ (hier zitiert nach Knox/Quirck 2001: 185186): Entschädigungen und Wiedergutmachungen wurden zuerst enthusiastisch durch die Gründung des ‚Reparation and Rehabilitation Committees’ innerhalb der TRC erwartet, doch die fehlende Zuführung generierte bei den Opfern Enttäuschung. „The final and most fundamental component of reconciliation related to the social, economic and political reconstructing of South African society. In this respect, the TRC remains marginal to the overall advancement of such a task” (Knox/Quirck 2001: 186). Die problembehafteten Integrationsbemühungen der Regierung können exemplarisch an den Maßnahmen für die ehemaligen Mitglieder der paramilitärischen Organisationen - der SDUs und der SPUs - dargestellt werden. Diese Volksmilizen hatten 1994 etwa 10.000 Mitglieder, von denen 2.000 SPU Mitglieder in die ‚South African National Defence Force’ (SANDF) integriert wurden und 1.000 SPU Mitglieder in die Polizei aufgenommen wurden. SDU Mitglieder wurden nach der politischen Wende als Mitglieder des MK in die Armee mit aufgenommen. Tausende der Kämpfer aus den Reihen der Volksmilizen ließ die Regierung jedoch nach einem ineffizienten Demobilisierungsprozess ohne Perspektive. Viele von ihnen sind heute involviert in weitere Operationen politischer wie auch krimineller Gewalt in der Provinz KZN (vgl. Gear 2002: 27-29). [..] Many of those of the former liberation armies especially, but not only, are unemployed and the most vulnerable [...]: vulnerable in relation to becoming involved in violence. There is this assumption that excombatants who do not have work are more likely to become involved in crime. [..] and are especially economically vulnerable. [...] A "Special Pension" was established via the Special Pensions Act whereby they're supposed to get a pension, but there have been considerable problems with that [...] because you only qualified if you were over a certain age at the certain time, so there was an age restriction. You had to be over thirty-five. But because of the nature of the liberation army (which involved many - even mainly - youth) lots of people were very much younger and so have not been able to qualify. (Interview Sasha Gear 12.08.2005: 1/11-2/2) Die Personen, die nicht in die Armee integriert wurden oder keine Rente bekamen, wurden ohne Ehre in das zivile Leben nach unzureichender Demobilisierung entlassen und durch eine unzureichende Entschädigung kompensiert. Das sogenannte ‚Service Corps’ sollte den Ex-Kombatanten helfen, sich in die Gesellschaft wieder zu integrieren. Es wurde jedoch im Nachhinein als ineffektiv beurteilt. Eine Evaluation und eine Analyse der Reichweite des Programms wurde bis dato noch nicht unternommen. Somit ist die Empfehlung der TRC, ehemaligen Freiheitskämpfern eine adäquate Ausbildung zukommen zu lassen, schon früh gescheitert. Im Vergleich zum Demobilisierungsprogramm fallen die ehemaligen SADF Soldaten, die die Armee verlassen, unter die Regularien des ‚Voluntary Serverance Package’ (VSP), das wiederum als Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 90 ____________________________________________________________________________________________________________________ ungerecht und geradezu generös angesehen wird (vgl. Gear 2002: 27-29). Die Ex-Kämpfer, die sich wieder in die Gesellschaft integrieren müssen, sind oftmals in der Zivilgesellschaft stigmatisiert und gelten dort als zu Gewalt tendierende Personen. Auch die ehemaligen SADF Mitglieder haben Schwierigkeiten, sich nach ihrer Tätigkeit wieder in das normale Leben außerhalb des Militärs einzugliedern, was signifikant hohe Scheidungsraten beweisen. Psychologische Betreuung für die ehemaligen Befreiungskämpfer ist fast nicht vorhanden: „Although there are a small number of NGObased initiatives in different parts of the country that are attempting to cater for the psychological needs of ex-combatants, these are too few, over-stretched and under-resourced” (Gear 2002: 105). Das Ergebnis dieser Politik ohne Integrationsverantwortung und die fehlende Beschäftigung mit vergangenem Unrecht ist dass Hunderte Menschen in KZN im Post-Apartheid Staat ihr Leben verloren und dass Tausende Ex-Kombatanten, deren Rolle in der Vergangenheit nicht beachtet oder gewürdigt wurde, heute keine Zukunft mehr sehen. Etwa 10% aller demobilisierten Ex-Kombatanten sind derzeit inhaftiert. Die TRC befasst sich zwar in chronologischer Auflistung mit der politischen Gewalt in KZN (vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 3/Chap. 3), jedoch bietet sie keinen Ansatz für die Lösung dieses im System der Apartheid begründete Problem der politischen Gewalt in KZN (vgl. Taylor 2001: 22-29: 5.4 Erschwerende Bedingungen vergangenheitspolitischen Handelns in Südafrika Erschwerende, normbezogene Bedingungen Für die normengestützte Vergangenheitspolitik erweist sich die Ausgangssituation des Prozesses als Bedingung, die den Prozess der Beschäftigung mit Vergangenheit einschränkt. Die beiden unabhängigen Kommissionen TRC und CRLR waren beziehungsweise sind durch die in Kapitel 5.3.1 genannten Gesetzesgrundlagen eindeutig in ihrem Mandat beschränkt. „A time frame to short and a mandate to narrow“ (Terreblanche 2003: 275). Damit kritisiert Terreblanche den PNURA, der den Untersuchungszeitraum der TRC nicht auf die komplette Regierungszeit der NP ausdehnt, die systemische Unterdrückung und Ausbeutung während der Kolonialzeit ausblendet und nur schwerer Menschenrechtsverletzungen wie Tötung, Entführung, Folter oder die grobe Misshandlung einer Person untersucht- entgegen der damaligen Position des ANC - (vgl. Knox/ Quirck 2000: 179), nicht aber die Möglichkeit bot, das System Apartheid an sich zu untersuchen und zu verurteilen. Die Ausgangssituation der „gekauften Revolution“ (Adam 1998: 352), der Übergangstyp der paktierten Transformation, die Kompromissfindung bei der Formulierung des Gesetzes zwischen ANC und NP, bedingen diese vergangenheitspolitischen Einschränkungen und bilden die Grundlage für das Mandat der TRC. Der Handlungsrahmen hält sich auch im Hinblick auf die Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an das Rückwirkungsverbots (vgl. Kap 4.3.1, vgl. Rosenbach 2005). Der Ge- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 91 ____________________________________________________________________________________________________________________ setzeskatalog der Apartheid wird nicht rückwirkend in Frage gestellt (vgl. Lang 2005: 214). Die Täter und Verursacher waren bestrebt, die Kompetenzen und den Handlungsrahmen der TRC zu begrenzen, um nach einer kurzen Zeit des Übergangs und der durch eine Wahrheitskommission ausgelösten Unsicherheit für sich selbst, so bald als möglich wieder politische Stabilität in ihrem Sinne einkehren zu lassen.69 Zu diesem Zweck wurde der zeitliche Untersuchungsrahmen, die Dauer des Untersuchungsprozesses und der Untersuchungsgegenstand begrenzt. The period the TRC was assigned to investigate was 1 March 1960 through the elections in 1994, but certainly not the full sweep of apartheid history. […] Because the mandate of the TRC was restricted to gross human rights abuses, it did not assess the impact of the institutionalized racism of the apartheid system that argueably had a far more profound and abusive impact on the population. Forced removals alone accounted for many more deaths than direct state violence. (Ball/Chapman 2001: 13) Erschwerende, institutionenbezogene Bedingungen Die Versöhnung wurde in Südafrika aufgrund der Vernachlässigung der Herstellung individueller Gerechtigkeit zugunsten der Aufdeckung der Wahrheit mittels Amnestien nicht erreicht (vgl. Adam 1998: 354). „Die Architekten der TRC räumen [...] bereitwillig ein, die Gerechtigkeit der Wahrheit zu opfern. In der dadurch entstehenden Konkurrenz beider Ziele zeigt sich der grundsätzliche Zwiespalt der südafrikanischen Kommission“ (Adam 1998: 355). Die schrecklichen Darstellungen der Opfer, die Berichte der Medien über die Grausamkeiten im Rahmen von ‚third force operations’70 und die schwerwiegende Beweislast gegen die NP und die Repräsentanten der Apartheid prägten den Diskurs der Zeit während der TRC Verhandlungen. Die geringe Beteiligung der Weißen und die grausame Wahrheit konnten in diesem Fall zuerst einmal nicht einend wirken (vgl. Adam 1998: 360). Die Besetzung der leitenden Positionen wirkte sich ebenfalls erschwerend auf die Arbeit der TRC aus. Das Amnestiekomitee zeichnete sich mit professionellen Juristen durch Fachkompetenz aus, während im Menschenrechtskomitee die Vertreter von NGOs und Kirchen die Mehrzahl des Personals stellten. Kein „einziger professioneller Historiker nahm an diesem gigantischen Unternehmen einer Oral-History Forschung teil [...], um vorbereitende Recherchearbeit zu leisten“ (Marx 2004 : 110). Anschuldigungen bezüglich der Parteilichkeit der Kommissare und der TRC als Ganzes 69 F.W. de Klerk sprach sich noch zu Beginn der Verhandlungen um eine Vergangenheitspolitik für eine Generalamnestie für alle Bediensteten und Funktionäre des Apartheidstaates aus. Die Informationen über Putschgerüchte durch Kräfte innerhalb der Armee und Polizei motivierten ihn dazu, für eine Schlussstrichpolitik zu plädieren, um diese Kräfte besser berechnen zu können (vgl. Marx 2004: 109). Innerhalb des Mandats der TRC war jedoch auch durch die enge Auslegungsweise der Kommissare kein Platz zur intensiven Untersuchung der systemischen Gewalt (vgl. Ball/Chapman 2001: 14). 70 Politisch motivierte Morde und schwere Menschenrechtsverletzungen, ausgeführt durch eine ‚third force’‚ in verdeckten Operationen gegen Zivilisten oder paramilitärische Oppositionelle und Partisanen verbotener Organisationen, direkt oder indirekt genehmigt durch die politischen und militärischen Verantwortungsträger des Apartheidsystems, waren gewaltsames Mittel um den immer stärker werdenden Druck der Befreiungsbewegungen zu begegnen (vgl. Huber/Umbreit 2000: 274). Eine ausführliche wissenschaftliche Bearbeitung dieser Thematik ist in Schutte, Liebenberg und Minnaars Werk The hidden hand zu finden. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 92 ____________________________________________________________________________________________________________________ wurden durch oppositionelle Parteien geäußert und verdienen aufgrund der wenigen Vorladungen für ANC-Führer und dem Mangel an Beweismittelsuche für Menschenrechtsverletzungen durch den ANC Beachtung. Neben dem oben erwähnten Zielkonflikt ist auch der fehlende politische Wille der ANCRegierung eine erschwerende Bedingung für institutionebezogenes Handeln. Aufgrund der tendenziell negativen Grundhaltung der Mbeki-Regierung bezüglich der TRC ist daher kein substantieller Fortschritt im Bereich der Vergangenheitspolitik zu erwarten: When the commission closed its doors and submitted the last volumes of its report in March 2003, the government had not paid a single final reparations grant. This failure maybe attributable to the resistance of the government of Thabo Mbeki, who has never been sympathetic to the TRC. (Daly 2003: 384) Die Antipathie gegen die Arbeit der TRC wird ebenfalls deutlich in dem Versuch des ANC, die Veröffentlichung des vorläufigen Abschlussberichts 1998 auf juristischem Wege zu stoppen. Der ANC war mit dem Urteil der TRC, dass im Kampf gegen die Apartheid der ANC schwere Menschenrechtsverletzungen verübte, nicht einverstanden. Die Klage wurde jedoch abgewiesen und der Bericht unverzögert veröffentlicht (vgl. Scott 2000: 112). Gleichsam stellte sich die Regierung gegen die vergangenheitspolitische Klage der KSG. Der ehemalige Justizminister Penuell Maduna (ANC) versuchte in einer eidesstattlichen Erklärung das Gerichtsverfahren zu beeinflussen, indem er erklärte, die Souveränität des Staates Südafrika könne durch das Verfahren unterminiert werden und die Klage einen nachteiligen Effekt auf ausländische Investitionen haben. Später berichtete Manduna selbst, dass große Firmen versprachen, die Kommunen und Gemeinden zu unterstützen, wenn die Regierung bereit sei, ihnen bei der Aufhaltung der Klage zu helfen. (vgl. KSG, e, vgl. Terreblanche 10.08.2003). Einen jährlichen Bericht der Ministerien zur Lage der Apartheidopfer im Land gab es - entgegen der TRC-Empfehlung - bisher nicht, und der politischer Wille zur Durchsetzung der Reparationenpolitik und der strafrechtlichen Verfolgung aller noch nicht zur Verantwortung gezogenen Täter ist nicht zu erkennen.71 Nach dem Ende des TRC-Prozesses gibt es nur ungenügende Reaktionen auf die TRC-Empfehlungen, und die Implementierung einer transparenten, vom politischen Willen der Regierung gestärkten Vergangenheitspolitik geleitet durch eine vergangenheitspolitische Institution ist nicht abzusehen. Erschwerende, täterbezogene Bedingungen Eine Lustration war auf den südafrikanischen Systemwechsel nicht anwendbar. Das segregierte südafrikanische Bildungssystem, welches vor allem den Schwarzen eine minderwertigen Ausbildung 71 Das Mandat der TRC zeugt schon von diesem Dilemma: Einerseits war die TRC berechtigt Amnestien auszusprechen aber andererseits war sie nur dazu ermächtigt Handlungsempfehlungen für eine Reparationspolitik zu geben (vgl. Marx 2004: 110). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 93 ____________________________________________________________________________________________________________________ gab, hatte nicht die Möglichkeiten geschaffen, ausreichend qualifizierte Nachfolger in die staatlichen Institutionen zu bringen. Im Ausland ausgebildete Exilanten konnten die Lücken ebenfalls nicht füllen, und so blieben viele Personen, die das Apartheidregime befürwortet und mitgetragen hatten auf ihren privilegierten und mitunter einflussreichen Positionen (vgl. Adam 1998: 353). Die Hürden täterbezogenen Handelns beziehen sich auch auf die mangelhafte Durchsetzung der TRC bezüglich der Vorladungen von Tätern. Die TRC konnte die Weißen nicht ausreichend in den Wahrheitsfindungsund Versöhnungsprozess integrieren (vgl. Brandon Hamber hier zitiert nach Knox/Quirck 2001: 185186). Nach dem Ende der TRC ist wiederum der fehlende politische Wille eine erschwerende Bedingung, der eine adäquate Strafverfolgung nach der Beendigung des Amnestieprozesses nicht zulässt. Die Opfer werden hierbei „durch eben jene Amnestie traumatisiert“ (Adam 1998: 355), und den berechtigten Ansprüchen dieser Minderheit wird aus Angst vor Entschädigungsklagen, die trotzdem mittlerweile auf internationalem Parkett ausgefochten werden, nicht ausreichend stattgegeben.72 Erschwerende, opferbezogene Bedingungen Innerhalb des südafrikanischen Diskurses um Reparationszahlungen nehmen die Akteure sehr unterschiedliche Positionen ein. Die Entscheidung Mbekis für die ‚verantwortungsethische’ Politikvariante, die durch die gleichzeitige Auszahlung von einer einmaligen Reparationszahlung an die Opfer ‚gesinnungsethisch’, hinsichtlich der Interessen der Opfer, abgemildert wird, spiegelt die Problematik des paktierten Übergangs, innerhalb einer durch GEAR bestimmten neoliberalen Wirtschaftspolitik wider, die jedoch nach Stieglitz keine Investitionsrückgänge fürchten müsste (vgl. Stieglitz 2003, hier zitiert nach Terreblanche 10.08.2003). Der Wandel der wirtschaftpolitischen Ausrichtung der ANC Politik bedeutet für die Erreichung der opferbezogenen Ziele weitere Herausforderungen. Das RDP, als eine vergangenheitspolitische Strategie des ANC vor der Wahl 1994, nannte die Apartheid-Vergangenheit als Auslöser der fraktionierten, deformierten und gespaltenen Gesellschaft. Zur Förderung von zivilgesellschaftlichen Projekten und der Erreichung der Versöhnung und Integration durch Umverteilung und der Handlung gegen die größten Probleme der Gesellschaft - Gewalt, fehlender Wohnraum, inadäquates Bildungs- und Gesundheitswesen, dem Fehlen von demokratischen Prinzipien und der schwachen Wirtschaft - sollte das RDP eingesetzt werden. Im März 1996 wurde das RDP durch GEAR ersetzt. GEAR verbesserte zwar die wirtschaftlichen Daten Südafrikas, doch ohne bisher einen stimulierenden trickle-down-Effekt für die Integration der ‚Second Economy’, die informelle Ökonomie der Armen und für die steigende Zahl an Arbeitslosen, zu erzeugen. (vgl. Knox/Quirck 2001: 186-187) 72 Der Prozess um das Einklagen von Entschädigungen wird sehr gut am Beispiel der KSG sichtbar und in Kapitel 5.3.4 noch näher beschrieben. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 94 ____________________________________________________________________________________________________________________ Aufgrund der Zwänge der globalisierten Wirtschaft und der immer noch bestehenden weißen Vorherrschaft im südafrikanischen Sektor der Privatwirtschaft handelt die ANC-Regierung im Fall der Einbindung von Wirtschaftsunternehmen in die Reparationenfrage nur auf deren freiwilliger Zustimmung. Die Privatwirtschaft und auch die Gewerkschaften stellen sich gegen eine Übernahme von Verantwortung der Apartheidverbrechen und üben indirekt über die Medien Druck auf die Politiker, ihren wirtschaftsfreundlichen Kurs zu halten: South African business had lobbied against the wealth tax proposed by Nobel Laureate Archbishop Desmond Tutu last month when the final report of the commission he headed was handed to Mbeki. South Africa's Chamber of Mines, which represents the country's biggest mining companies, said Mbeki's speech would help restore investor confidence in the country. (Wanneburg/Chege 2003) Zusätzlich entsteht eine Intransparenz im vergangenheitspolitischen Diskurs um Reparationen und die ausgleichende historische Gerechtigkeit durch die fehlende Dokumentation des privatwirtschaftlichen Engagements auf staatlicher Seite (vgl. Interview Frank Chikane 30.08.2005: 8/1-12). Daly sieht zwar die Situation um Reparationen als vom Transformationstypus abhängig, wenn er schreibt, dass „in whatever form, the success of reparations claims depends on a political climate that is supportive of, and not resistant to, them. In South Africa, the context of the negotiated revolution provided that climate” (Daly 2003: 406-407). Jedoch hat sich das politische Klima seit damals gedreht, und die heutige ANC-Regierung steht trotz ihrer Machtfülle den Forderungen der Opfer immer noch zurückhaltend gegenüber, was die Kommissare der TRC so wohl nicht vorausgesehen hatten (vgl. Daly 2003: 386). Obwohl Reparationen generell als wichtiger Faktor für die Einheit des Landes angesehen werden: „[R]eparations are instrumentally valuable and necessary to promote national unity and reconciliation, the primary goals of post-apartheid South Africa.” (Daly 2003: 383). Die Vormachtstellung des ANC in der Parteienlandschaft und die daraus folgende schwierige Interessenrepräsentationslage im politischen System Südafrikas (Vgl Kap 3.2.3) machen es den Opfern schwer, ihre Interessen durchzusetzen. Viele Forderungen der KSG verhallen ungehört (vgl. KSG, d), und es fehlt den Opferverbänden an politischer Unterstützung, um ihre Interessen im öffentlichen Raum und im Parlament zu vertreten.73 Im Bereich der Landreform bereitet der ineffiziente Verwaltungsapparat und das minimale Budget Schwierigkeiten bei der Lösung vergangenheitspolitischer Angelegenheiten. Aufgrund des aber immer noch sehr langsam vorangehenden administrativen Prozesses der CRLR und den anderen involvierten Institutionen entstehen Spannungen zwischen den Landbesitzern und den Klägern, die sich beide eine schnelle rechtsstaatlichen Beilegung der Fälle wünschen, um Streitigkeiten zu vermeiden (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap. 2/ 36-39; SAPA, a: 31.10.2005). 73 Die Partei, die ihre Belange traditionell unterstützen würde, wäre der ANC. Dieser ist jedoch aufgrund seiner veränderten Rollen nicht dazu bereit. Trotzdem halten die Mitglieder von KSG mit ‚Viva ANC’ aufgrund des Befreierbonusses dem ANC die Treue. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 95 ____________________________________________________________________________________________________________________ The greatest challenge to reconciliation and reconstruction in South Africa is how to end vast racial inequality, of which land is a visible example. [... No political stability, democracy or peace are imaginable as long as the bulk of the land is in the hands of whites. […] Under these circumstances a market-based land reform programme, including the willing-seller-willing-buyer approach […] hardly seems appropriate. (Ntsebeza 2004: 205) Die Kosten für die Entschädigungszahlungen werden insgesamt auf eine Höhe von R31 Milliarden geschätzt, wobei durch das derzeitige Budget die restlichen Klagen erst in 150 Jahren beigelegt sein werden (vgl. UNDP/NHDR, a: Chap. 2/ 36-39). Die ineffiziente Verwaltung ist nicht nur im Bereich der Landreform ein Hindernis zur Integration der Apartheidopfer. Die immer noch nicht vorgenommene Tilgung von Strafregistereinträgen ehemaliger (unschuldiger) Gefangener ist ein weiteres Zeichen für erschwerte Bedingungen bezüglich der Opferintegration. Viele gelten noch heute vorbestraft, was die Arbeitssuche erschwert und Auslandsreisen oftmals unmöglich macht. Nur durch ein Geständnis eines (nicht) begangenen Vergehens innerhalb einer illegitimen Rechtsordnung und ein darauf folgendes ‚presidential pardon’ kann derzeit eine Entlastung folgen. Viele SüdafrikanerInnen können jedoch diesen Kompromiss nicht mit ihren Gewissen vereinbaren (vgl. KSG, g). Zusammenfassung Der Übergang vom autoritären hin zum demokratischen System kann als paktiert bezeichnet werden, da die politischen Eliten, also die zivile Führung des Apartheidregimes und die Führung der demokratisierenden Kräfte der Gesellschaft, den Wechsel aushandelten. Die Ausgangssituation für die vergangenheitspolitischen Bemühungen ist daher kein radikaler Umbruch, sondern ein kompromissbestimmter Übergang, welcher Limitierungen für die Strafverfolgung der Täter und die Rehabilitierung der Opfer mit sich bringt, die sich auch in der Beschaffenheit der vergangenheitspolitischen Institutionen ausprägen. Die Täter und Nutznießer des alten Systems weisen daher oftmals in ihrem Verhalten und ihren Einstellungen Ignoranz gegenüber der geschehenen Ungerechtigkeit auf und zeigen wenig kollektive Verantwortung. Die TRC bot jedoch den Opfern wie auch den Tätern eine Plattform, den weiteren Umgang mit Vergangenheit auszuhandeln. Die Opfergruppe spaltet sich durch die Arbeit der TRC in offiziell anerkannte und inoffizielle Opfer, die auch auf verschiedenste Weise unter dem Apartheidsystem gelitten haben. Für diese inoffizielle Opfergruppe wie auch für die Gruppe der Nutznießer des Systems erweist sich der bisherige vergangenheitspolitische Handlungsrahmen als zu gering. Die Machtverhältnisse zwischen Opfern und Tätern verschieben sich über die Zeit und den Verlauf des Konsolidierungsprozesses, so dass sich privilegierte Opfer als politische Funktionäre heute einer verantwortungsethischen Politik befleißigen, die die Interessen der Opferverbände wenig berücksichtigt. In der Phase der demokratischen Konsolidierung sollte jedoch durch den politischen Willen der Regierung der ausgehandelte Kompromiss aus der Zeit der Transformation zugunsten rechtsstaatlicher Prinzipien und der Opferinteressen verschoben werden. Die Aufklä- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 96 ____________________________________________________________________________________________________________________ rung über das Vergangene dient dem neuen politischen System als moralische Grundlage für den Aufbau eines Rechtsstaats. Die Verhandlungen über die Verfassung ergaben einen Kompromiss, der sich für die Wahrheitsfindung über grobe Menschenrechtsverletzungen aussprach, dadurch jedoch die Gerechtigkeit vernachlässigte. Die Amnestie wurde gegen ein komplettes Geständnis eingetauscht. Die TRC diente als mediale Plattform für die Leidenserzählungen der Opfer und die Anhörung der Täter. Symbolische und materielle Entschädigung der Opfer wurde als Ziel südafrikanischer Vergangenheitspolitik genannt. In einem neuen Südafrika sollte die nationale Einheit durch Versöhnung durch die Vergangenheitspolitik erreicht werden. Jedoch ergab sich dadurch auch der Zwiespalt der TRC, die nicht beide Ziele Wahrheit und Versöhnung gleichermaßen verwirklichen konnte und die Gerechtigkeit mit dem Ziel der Versöhnung im Gefolge der Wahrheitsfindung mittels Amnestie teilweise opferte. Der südafrikanische Amnestieprozess ist jedoch durch seine bisherige mangelhaft stringente Durchführung in der post-TRC-Ära eine Verletzung der rechtsstaatlichen Norm der Gleichheit vor dem Gesetz. Die Empfehlungen, die die TRC nach dem Ende ihrer Arbeit an die Regierung zur Durchführung weitergab, wurden bisher nur unzureichend umgesetzt. Die strafrechtliche Verfolgung von Tätern, die nicht unter die Amnestieregelung fallen, die ausreichende finanzielle Wiedergutmachung, die Reintegration und Rehabilitation von Opfern und Tätern, die Schaffung einer sozialen Marktwirtschaft und die Errichtung eines für alle zugänglichen Gesundheitssystems wurden bisher gar nicht oder nur ansatzweise verwirklicht. Ein Zentralorgan, das die Implementierung der TRCEmpfehlungen überwacht, fehlt gänzlich, und die Nutznießer der Apartheid werden nicht zur finanziellen Unterstützung der offiziellen und inoffiziellen Opfer verpflichtet. Das Programm zur Suche nach den Verschwundenen wurde erst kürzlich durch die Eigeninitiative der NPA-Mitarbeiter ins Leben gerufen. Weder das Programm zur Aus- und Weiterbildung von Ex-Kombatanten, noch die Politik der geschlossenen Liste wurden überdacht. Eine Populärversion des TRC-Berichts ist zwar entstanden, jedoch nie flächendeckend im Volk verteilt worden, und in die Archivierung, Bereitstellung und Zugänglichkeit von Dokumenten zur Apartheidvergangenheit ist nur wenig investiert worden. Diese Mängel bei der Verbreitung der Wahrheit und der Aufklärung der Bevölkerung führen zur Exklusion eines schon marginalisierten Teils der Bevölkerung, der sich so nicht in den vergangenheitspolitischen Diskurs einmischen kann und, obwohl betroffen, nicht ausreichend Interessenrepräsentation erhält. Die Regierung scheint nach dem Ende der TRC die Vergangenheitspolitik zu marginalisieren. Doch gerade nachdem die Demokratie in Südafrika seit über zehn Jahren besteht, sollte es möglich sein, aus dem Schatten des Kompromisses herauszutreten und weitere Schritte auf dem Weg der Beschäftigung mit Vergangenheit zu gehen. Die Einstellung der Bevölkerung und das Verhalten der Akteure im Rahmen der vergangenheitspolitischen Handlungsfelder zeigen, dass die Interimsverfassung aus dem Jahre 1993 den Be- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 97 ____________________________________________________________________________________________________________________ ginn der Konsolidierung der südafrikanischen Demokratie markiert. Die Interimsverfassung konstituiert sich aus den Geschehnissen der Vergangenheit heraus und ist Garant für die Unwiederholbarkeit des Vergangenen. Viele Gesetze, die die Rassensegregation manifestierten und demokratische Bewegungen unterdrückten, wurden schon in der Phase der Demokratisierung abgeschafft. Die Verfassung ist die Basis für weitere Gesetze, die die Vergangenheitspolitik des Landes betreffen, so unter anderem auch der PNURA oder der ‚Restitution of Land Rights Act’, die beide vergangenheitspolitische Kommissionen ins Leben riefen. Die TRC ist jedoch durch ihre gesetzliche Grundlage an ein eng begrenztes Zeitfenster gebunden gewesen und war aufgrund der Einhaltung des Rückwirkungsgebots nur auf der Suche nach individueller Schuld. So entstand nicht die Möglichkeit, das Apartheidsystem als solches durch weitere politische Maßnahmen zu verurteilen. Das derzeitige ZweiPhasen-Programm der Regierung zur Adressierung der offenen Empfehlungen des TRC-Berichts fußt nicht, wie die Errichtung der TRC selbst, auf einem gesetzlichen Fundament und ist daher auch bisher seiner Implementierung schuldig geblieben. Eine transparente und institutionalisierte Vergangenheitspolitik, geführt durch ein Zentralorgan und mittels eines mit Kompetenzen ausgestatteten Amtes, ist in Südafrika nicht vorhanden, und die Regierung scheint auch nicht willens, sich einer grundlegenden und weiterführenden Vergangenheitspolitik zu widmen. Nach dem Ende der TRC nutzt sie diese als Verweis des schon bewältigten und nicht als Basis für die Weiterführung des Prozesses. Die Umwandlung des vergangenheitspolitisch ausgerichteten RDP 1996 in das GEAR Programm hat die Lebensumstände für die offiziellen und inoffiziellen Opfer der Apartheid bisher nicht verbessert und zeigt, dass die Regierung zu sehr an verantwortungsethische und globalwirtschaftliche Grundsätze gebunden ist, als dass sie die Distributionsaufgaben des neuen politischen Systems lösen wolle. Die TRC als vergangenheitspolitische Institution hat im internationalen Vergleich weitreichende Kompetenzen und das bisher höchste Budget. Das Medieninteresse, national wie international, war sehr hoch, und so konnte die TRC ihrem Auftrag der Aufklärung um die Vergangenheit generell gerecht werden, wozu auch der umfassende Abschlussbericht maßgeblich beitrug. Über den Rahmen der TRC hinaus gibt es noch weiteren vergangenheitspolitischen Bedarf. Erstens ist die Erweiterung der Arbeit mit den traumatisierten Opfern auf nationaler Ebene notwendig, um ihren Heilungsprozess voranzutreiben. Zweitens ist der Heilungs- und Rehabilitierungsprozess der Täter auch im Interesse der Opfer voranzutreiben. Drittens ist die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich eine Aufgabe, die die TRC nur erörterte, die jedoch weiteren Handlungsbedarf benötigt, um die Opfer der wirtschaftlichen Ausbeutung durch das Apartheidregime zu entschädigen. Vierter und letzter Punkt ist das Vorantreiben und Einhalten von Menschenrechten und demokratischen Prinzipien, um denen, die durch die Vergangenheit traumatisierten sind, die Möglichkeit zu geben, für ihre Rechte im öffentlichen Raum einzutreten. Die Partizipationskraft der durch die Apartheid geschädig- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 98 ____________________________________________________________________________________________________________________ ten BürgerInnen muss notwendigerweise ausgeweitet werden, um die Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne der Verfassung voranzutreiben. Dies kann nur durch Heilung der Traumatisierten und durch Umsetzung sozio-ökonomischer Rechte geschehen. Die Selbstkritik der Kommissare an der TRC und ihrer Arbeit hat das Vertrauen in die Institution im Nachhinein nochmals gestärkt. Die TRC wird in der Bevölkerungsmeinung als gerechtigkeitsschaffend und friedensstiftend angesehen. Die TRC wurde in der schwarzen wie auch in der weißen Bevölkerungsgruppe über die Jahre hinweg immer positiver aufgenommen. Der vergangenheitspolitische Diskurs bewog die weißen SüdafrikanerInnen zu einem radikalen Sinneswandel hinsichtlich der Bewertung der Apartheid, und eine Leugnung der Verbrechen findet gemeinhin nicht statt, obwohl die Weißen im Rahmen der TRC die Greuel der Apartheid nach Meinung der schwarzen MitbürgerInnen zu wenig verurteilten. Trotzdem ist die TRC unter den Schwarzen die am höchsten angesehene staatliche Institution, und die kollektive Erinnerung, die die TRC produzierte, wurde von vielen BürgerInnen akzeptiert. Die Sicht der Opfer, die am Prozess selbst teilgenommen haben, erklärt jedoch viele Punkte, die einer Versöhnung mit den Tätern im Weg stehen. Die Enttäuschung über die ungenügenden Reparationszahlungen und die mangelnde Bereitschaft der Nutznießer ausgleichend zu unterstützen, ist jedoch bei der Gruppe der Opfer groß, nachdem die TRC Erwartungen geweckt hatte. Die CRLR, der ‚Land Claims Court’, und das ‚Department of Land Affairs’ bilden ein institutionelles Netz, das zwischen den Parteien vermittelt, Entschädigungszahlungen und Kredite anbietet und gerichtlich die Auseinandersetzungen klärt. Im Bereich der Landreformpolitik ist Südafrika weit besser institutionell ausgestattet als im Bereich der Entschädigung bei Menschenrechtsverletzungen und in den vielen anderen Bereichen der Vergangenheitspolitik. Jedoch gibt es trotz Implementierungsplänen und weitreichenden Kompetenzen der zuständigen Behörden bei der Landreform erhebliche Mängel. Das Budget ist zu niedrig, um ein Ende des Programms überhaupt absehen zu können. Das bisher zurückgegebene Land ist meist urbanes Gelände, und daher ist der flächenmäßige Anteil an dem zurückzugebenden Land verschwindend gering. Die Reform der Pachtrechte sollte den Landlosen durch historische Nutzungsrechte zu Land verhelfen und den Pächtern mehr Sicherheit bieten, was jedoch oft an fehlendem Urkundenmaterial beziehungsweise Vertragspapieren scheiterte. Nur die Werbung der Regierung für die Einsicht der weißen Großgrundbesitzer, dass Schenkungen in diesem Fall sozialen Frieden bringen, würde hier einen weiteren Schritt machen und vor weitreichenden Zwangsverkäufen bewahren. Das bisher zur Umverteilung des Landes genutzte ‚willing-seller-willing-buyer’-Konzept führt bei weitem nicht zur adäquaten Umverteilung des Landes. Die Entstehung sozialer Bewegungen, die für die Interessen der Landlosen eintreten, sind Ausdruck des unzureichenden Prozesses der Landumverteilung. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 99 ____________________________________________________________________________________________________________________ Die Tätergruppe konnte nach dem Prinzip der geschlossenen Liste von einem Modell des Strafverzichts unter der Bedingung eines vollständigen Geständnisses Gebrauch machen. Die Amnestie traumatisiert zwar die Opfer und verletzt deren Vorstellungen von Gerechtigkeit, jedoch wurden die Täter nur im Tausch gegen die Wahrheit freigesprochen, und ihre Expertise konnte zum wirtschaftlichen Aufbau genutzt werden. Eine Lustration wird im Rahmen der paktierten Transformation nicht vorgenommen. Die Gruppe der Täter, die vor der TRC erschien, ist jedoch nicht die Gesamtgruppe, zu der die Nutznießer ebenso zu zählen sind wie die vielen Sicherheitskräfte und Funktionäre, die das Amnestieverfahren ablehnten. Die Gesamtgruppe wird nicht erfasst, da das Mandat der TRC einen zeitlich zu engen Rahmen steckte und die systemische Komponente der Apartheid im Prozess der TRC nicht ausreichend behandelt, sondern nur individuelles Vergehen juristisch verhandelt wird. Die Errichtung der CRLR und deren Mandat beweisen jedoch, dass die systemische Komponente der Apartheid, hier die rassistisch motivierte Zwangsenteignung fast des gesamten schwarzen Landes, im Bereich der industriellen Agrarwirtschaft bestand und dass eine Entschädigung und Umverteilung, wenn in diesem Bereich, so auch in anderen Bereichen möglich wäre. Das ‚Reparation and Rehabilitation Committee’ der TRC hatte die Kompetenz, der Regierung Empfehlungen an die Hand zu geben, wie in der weiteren Opferpolitik zu verfahren sei. Die Empfehlungen hinsichtlich der finanziellen Reparationspolitik wurden jedoch von der MbekiRegierung untergraben. Auch die Privatwirtschaft hielt sich mit freiwilligen Spendengeldern zurück und eine von der TRC geforderte Vermögenssteuer, um die Nutznießer der Apartheid in den TäterOpfer-Ausgleich mit einzubinden, wurde nicht verwirklicht. Der BIG könnte hier zumindest von staatlicher Seite Abhilfe schaffen. Viele Opfer haben nur einen inoffiziellen Status und wurden in den TRC-Prozess, der einer Politik der geschlossenen Liste folgte, nicht eingebunden. KSG versuchen die zivilgesellschaftliche Verantwortung für die Opfergruppe zu übernehmen, deren Interessen zu bündeln und in das politische System einzubringen, werden jedoch weitgehend durch die Regierung ignoriert, und die finanzielle Entschädigung wird im öffentlichen Raum eher als negativ und bereichernd gewertet. Die GEAR-Strategie steht mit ihrem Ringen um ausländische Investitionen nicht der Klage von KSG entgegen, da ein Beweis für Rechtsstaatlichkeit Südafrika als Investitionsstandort nur attraktiver machen würde und eine Wiedergutmachungszahlung der apartheidfreundlichen Privatwirtschaft zu historischer Gerechtigkeit verhelfen könnte. Hinsichtlich der Untersuchung von Verschwundenenfällen zeigt sich ebenfalls ein ambivalentes Bild. Die Einrichtung eines ‚task-teams’ der NPA und dessen ausreichende Finanzierung erfolgte 2004 jedoch nur aufgrund persönlichen Engagements. Der politische Wille der ANCRegierung ist auch in diesem Bereich recht wenig vorhanden. So kann die Gruppe der Opfer nur durch starkes zivilgesellschaftliches Engagement in der Ära nach der TRC ihre Ziele erreichen und die Vergangenheitspolitik innerhalb des politischen Systems an Priorität zugewinnen lassen. Die Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 100 ____________________________________________________________________________________________________________________ TRC bildet mit ihren Empfehlungen und Analysen die Basis für vergangenheitspolitische Handlungen im Bereich der Opfergruppe. 6. Die Rolle der südafrikanischen Vergangenheitspolitik innerhalb des demokratischen Konsolidierungsprozesses - Empfehlungen zum ‚unfinished business’ Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt werden konnte, ist die südafrikanische Vergangenheitspolitik aus einem Kompromiss der dominierenden Akteure der Transformationsphase heraus entstanden. Bereits dadurch wurde Vergangenheitspolitik in ihrer Reichweite limitiert. Dieses Limit, das heißt die Interessen der Privatwirtschaft und eine verantwortungsethische Haltung der Regierung sowie fehlender politischer Wille, stellt in vielen vergangenheitspolitischen Problemfeldern ein‚unfinished business’ dar und lässt eine Vielzahl ungelöster Angelegenheiten entstehen. Inwieweit die Vergangenheitspolitik damit auch die demokratische Konsolidierung Südafrikas beeinflusst, sich positiv auf diese auswirkt oder ihr entgegensteht, wird im folgenden Kapitel erörtert. Dabei werden die Ergebnisse der Politikfeldanalyse der südafrikanischen Vergangenheitspolitik in die Kategorien der Analyse der demokratischen Konsolidierung des Landes eingearbeitet. Für welche Problemkreise demokratischer Stabilität die Vergangenheitspolitik Lösungen anbietet, und wo umgekehrt die Vergangenheitspolitik Südafrikas noch mehr zur Konsolidierung beitragen könnte, wird hierbei deutlich werden. 74 6.1 Vergangenheitspolitik und ihre Auswirkungen auf die politische Kultur Die TRC war neben der Verfassungsgebung das wichtigste Element der Nationenbildung Südafrikas und beeinflusste die Zukunft des Landes maßgeblich: „The two major events in the history of the country at that time were the drafting of the constitution and of course the work of the TRC” (Interview Yasmin Sooka 29.08.2005: 1/11-17). So ist es auch auf die TRC zurückzuführen, dass die Legitimationsgrundlage der Demokratie in den Jahren 1995 bis 2000 stetig anwuchs. Die TRC propagierte Versöhnung und Vergebung und die Anerkennung aller SüdafrikanerInnen und ihrer Rechte. Über die mediale Vermittlung, die in Südafrika den TRC-Prozess einem breiten Publikum zugänglich machte, stieg das Zugehörigkeitsgefühl in der südafrikanischen Nation (vgl. Theissen 2002: 71). Auch die Weißen begannen durch die Arbeit der TRC sich von der menschenverachtenden Apartheidpolitik zu distanzieren. Die TRC konnte dort durch ihr Aufklärungsmandat ein Umdenken bewirken, das die Sensibilisierung für die Einhaltung der Menschenrechte in der Bevölkerung stärkte (vgl. Heinrich 2001: 79-81, vgl. Theissen 2002: 69-77). Die demokratischen Werte müssen in einer 74 Die aus der Analyse gewonnenen Folgerungen und Empfehlungen werden hier im Rahmen der Beantwortung der Gesamtthese der Arbeit genannt, da die südafrikanische Vergangenheitspolitik aus der Perspektive der vorliegenden Arbeit nur im Bezug auf den gesamten Systemwechselprozesse zu verstehen ist. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 101 ____________________________________________________________________________________________________________________ Demokratie Bestand haben trotz ökonomischer Krisen. Trotz der sozialen Ungerechtigkeit herrscht in Südafrika eine relative große politische Toleranz. Die afrikanische Philosophie des ‚ubuntu’ und der Versöhnungsdiskurs, die Möglichkeit für Täter und Opfer öffentlich angehört zu werden, schufen ein Klima für rechtsstaatliche Prinzipien, vertrieben intolerante Parteien weitgehend aus dem politischen Leben des Landes und schufen einen Nährboden für institutionelles Vertrauen (vgl. Heinrich 2001: 69). Speziell die TRC erzielte höchste Vertrauenswerte in der Gesamtbevölkerung allen voran bei den Schwarzen und konnte so die Vertrauensbasis gegenüber den demokratischen Institutionen ausweiten (vgl. Theissen 2002: 71-72; vgl. Heinrich 2001:69-76). Die Vergangenheitspolitik, die zur staatsbürgerlichen Identitäts- und Nationenbildung einen wichtigen Beitrag geleistet hat, ist jedoch als Projekt bisher unvollendet geblieben, was die soziale Trennung beweist. Jedoch gibt die vermehrte Identifikation mit dem Staat Anlass zu einer positiven Prognose. 6.1 Politischer Wettbewerb, Pluralismus und Vergangenheitspolitik Da das Wahlverhalten der SüdafrikanerInnen weniger durch Ethnizität und Rasse bestimmt ist, zeigt sich politische Toleranz und wenig politische Fragmentierung anhand der Kategorien Rasse und Klasse. Da jedoch soziale Ungleichheit stark mit Ethnizität in Verbindung steht, ist die Demokratie anfällig für populistische Politiken und benötigt daher eine ausreichende Bewältigung der Distributionsaufgaben (vgl. Heinrich 2001: 56, vgl. Sandschneider 1995: 121). Die TRC konnte aufgrund ihres limitierten Mandats nur Empfehlungen zur Beseitigung der sozioökonomischen Ungleichheit geben. Die vergangenheitspolitische Institution und auch die vergangenheitspolitisch orientierte Zivilgesellschaft fordern einen konsequenteren vergangenheitsbezogenen Ausgleich, der sich in einer ‚wealth tax’, in der Anklage apartheidfreundlicher Privatunternehmen, in der Zahlung von Reparationen, in der Schaffung einer sozialen Marktwirtschaft und in der Bereitstellung eines adäquaten Gesundheitssystems niederschlagen soll. Einzig das Mandat der CRLR ist umverteilend ausgerichtet und macht es trotz stark begrenztem Budget und widriger Umstände möglich, die notwenige Redistribution von Agrarland vorzunehmen. Zumindest dort trägt die Vergangenheitspolitik, wenn auch nicht zufrieden stellend, zu einem sozioökonomischen Ausgleich bei, der auch die politische Toleranz und das gegenseitige politische Verständnis zwischen Landlosen bzw. WanderarbeiterInnen und industriellen LandwirtInnen mediatorisch fördert. Trotzdem gehört der Bereich der sozialen Ungleichheit zu dem am weitesten unterentwickelten Feld vergangenheitspolitischer Politik. (vgl. TRC-Bericht, a: Vol. 5/Sec. 5/ Chap. 8; vgl. Huber/Umbreit 2000: 281). Die Beziehungen zwischen den Bevölkerungsgruppen Südafrikas ist durch eine friedliche Koexistenz gekennzeichnet. Die TRC konnte durch ihre Offenheit im Umgang mit den geschehenen Gewalttaten auch die militante weiße Rechte zum Schweigen bringen und ihr die Unterstützung im Volk entziehen (vgl. Interview Polly Dewhirst 03.08.200514/31-15/4). Teilweise trugen die Darstel- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 102 ____________________________________________________________________________________________________________________ lung der TRC jedoch auch zu einer weiteren Fragmentierung der Gesellschaft Südafrikas bei. Die TRC kreierte durch ihre Darstellungen ein stereotypes Bild der Weißen, die die unbedingte Wehrpflicht favorisierten. Weiße Wehrpflichtige und professionelle Soldaten nannte die TRC in einem Atemzug mit den ‚third force’ Spezialeinheiten, so dass die Verweigerer wenig beachtet und die jungen weißen Männer weniger als Systemopfer denn als Täter gesehen werden (vgl. Ian Liebenberg 23.08.2005: 10/13-19). Die sogenannten ‚window-cases entwarfen ebenfalls ein Bild des stereotypen Weißen, was die soziale Interaktion zwischen den Rassengruppen erst erschwerte. Durch die Offenheit des Diskurses und den Aufklärungscharakter wurde aber eine ‚tabula rasa’ geschaffen, die jetzt wieder neu besetzt werden kann. Die TRC-Website mit Bekundungen vieler weißer SüdafrikanerInnen, die in einem Forum ihre Abscheu gegenüber der Apartheid und ihren Missetaten äußern, bietet hier wiederum eine solche Plattform der Versöhnung (vgl. doj & cd , a). Die sozialen Interaktionen konnten durch die TRC nicht sonderlich beflügelt werden. Die Versöhnung wurde der Wahrheit geopfert, und da die Öffentlichkeit wenig Reue bei der Tätergruppe vernahm und die Vergebung der Opfer gegenüber den Tätern weitgehend ausblieb (vgl. Sonis et. al. 2002: 32-33), ist die soziale Intoleranz durch die vergangenheitspolitischen Versöhnungsbemühungen der TRC nicht flächendeckend beseitigt worden (vgl. Rauch 2004: 4-7). 6.2 Die Auswirkungen der Vergangenheitspolitik auf Partizipationsformen und Interessenrepräsentation Die Teilnahme am politischen Leben, die individuelle Interessenvertretung und das politische Engagement werden durch politische Intoleranz unterminiert und gefährdet. Die politisch motivierte Gewalt nahm seit dem Ende der Apartheid stetig ab. Weder auf dem Land noch in den Städten ist die hohe Kriminalitätsrate mit Rassismus oder politischer Intoleranz in Verbindung zu bringen (vgl. Terreblanche 26.09.2003). Die Ebenen, auf denen politische Gewalt nicht von der TRC geächtet wurde, vornehmlich in KZN, sind bis heute noch unbefriedet und im Gegensatz zum restlichen Südafrika immer noch von politischen Gewalttaten geprägt. Das ‚unfinished business’ und der mangelnde politische Wille, die Probleme der Gegenwart in KZN mit den Lasten der Vergangenheit in Verbindung zu bringen und politisch motivierte Taten dort strafrechtlich zu verfolgen, erweisen sich hier als schwerwiegende vergangenheitspolitische Verfehlungen. Eine institutionalisierte Lösung zur transparenten Bearbeitung der Probleme von Ex-Kombatanten und der politisch motivierten Gewalt ist notwendig, um den Menschen in KZN ihre Bürgerrechte und Sicherheit von Leben und Eigentum weitestgehend garantieren zu können (vgl. Taylor 2001: 29). Südafrika besitzt ein pluralistisches Parteinsystem, wobei derzeit 16 Parteien die BürgerInnen im Nationalparlament vertreten (vgl. SouthAfrica.info, c). Die Wahlen verlaufen ohne gegen demokratische Prinzipien zu verstoßen, und Antisystemparteien gibt es nicht mehr. Die Wahlbeteiligung Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 103 ____________________________________________________________________________________________________________________ bei der Jugend und insgesamt geht seit 1994 merklich zurück (vgl. Rauch 2004: 6, Heinrich 2001: 65). Die nationale und regionale Dominanz des ANC, der derzeit eine 2/3-Merhheit im Parlament inne hat, steht einem wirklichen Wettbewerb um die Regierungsmacht faktischen entgegen. Die inner- und außerparlamentarische Opposition ist machtlos an den Rand gedrängt und die Interessenrepräsentationkanäle laufen auf den ANC zu (vgl. Alence 2004: 79). Die Vergangenheitspolitik als Teil einer pluralistischen Interessenvertretung wird hauptsächlich in den zivilgesellschaftlichen Organisationen erarbeitet und gefordert. Auch die TRC drängt durch ihre Empfehlungen und den Abschlussbericht auf eine transparente Vergangenheitspolitik, geleitet durch ein separates Amt innerhalb der Regierung, die das begonnene Projekt weiterführt (vgl. TRC-Bericht, b: Vol.6/sec. 5/ chap.7). Doch schon die versuchte Verhinderung des Berichts der TRC durch Präsident Mbeki (vgl. Scott 2000: 112), war ein erstes Zeichen für den politischen Widerwillen der Regierung, tiefgreifende Vergangenheitspolitik zu betreiben. Nach dem Ende der TRC ist die Plattform für den vergangenheitspolitischen Diskurs verschwunden. Die Medien tragen jetzt die Verantwortung, vergangenheitspolitische Themen zu benennen und zu diskutieren. Die Herausforderung liegt darin, die Aufklärungsarbeit bezüglich der Vergangenheit nicht ruhen zu lassen und nur durch einen Blick zurück den Blick nach vorne zu wagen. 6.3 Vergangenheitspolitik und ihre Auswirkungen auf die substantielle und prozedurale Legitimation der Regierungsinstitutionen Die Leistung der Regierung und der staatlichen Behörden ist in vielen Bereichen, die sich direkt auf die substantielle Legitimation der Regierungsinstitutionen von Seiten der Bürger auswirken, ungenügend. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und Kriminalität im Land sind die BürgerInnen nicht mit der staatlichen Problemlösungskapazität zufrieden. Arbeitslosigkeit beispielsweise im Agrarsektor ist direkt auf die Apartheidvergangenheit zurückzuführen. Die CRLR ist ein vergangenheitspolitisches Mittel zur Schaffung von Arbeit und Versorgung von Landlosen und Enteigneten in der Landwirtschaft, das immer stärker in den Mittelpunkt rückt: If you look at where things are standing today and the way land has really emerged as the burning issue in our country, the work of the land commission has suddenly become one which is under scrutiny and that is appropriate now as we are moving to this spheres what are we going to do about this questions the land commission is beginning to assume its proper importance. (Interview Yasmin Sooka 28.08.2005: 1/12-17) Die Landreform ist jedoch eindeutig nicht ausreichend, um der Massenarbeitslosigkeit und Armut im Land zu begegnen. Das ANC-Programm hat noch nicht ausreichend zu einem von allen Seiten gewollten Wandel beigetragen: Auch wenn es aus wirtschaftlichen und Stabilitätsgründen keine einfache Lösung für das kolonial vererbte Problem des Landbesitzes in den Händen weniger Weißer und der Landlosigkeit vieler Schwarzer zu geben Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 104 ____________________________________________________________________________________________________________________ scheint, ist weitgehend unstrittig, dass die rechtsstaatlich ausgerichtete Landreform nach dem Prinzip ‚willing buyer willing seller’ noch nicht genug zur Transformation beigetragen hat. (Kaußen 2005: 39) Die hohe Arbeitslosigkeit und der Mangel an Grund und Boden bei marginalisierten ländlichen Bevölkerungsschichten bereitet einerseits den Boden für vergangenheitspolitischen Aktivismus, andererseits auch für kriminelle Übergriffe aus Gründen der Armut und Verwahrlosung. Die Kriminalitätsrate in Südafrika ist einerseits aus der sozialen Ungleichheit heraus, andererseits durch das System der Apartheid zu erklären, welches durch die TRC und den vergangenheitspolitischen Diskurs bisher zuwenig Beachtung fand (vgl. Terreblanche 26.09.2003). Die TRC konnte aufgrund ihres Mandats nur Vorschläge erarbeiten, wie diesen Gesellschaftsproblemen zu begegnen ist, die jedoch wie im Falle von Umverteilung durch Steuern oder der Schaffung eines flächendeckenden Gesundheits- und Sozialversicherungssystems bisher ungehört verhallten. Jedoch berufen sich viele Stimmen aus der Zivilgesellschaft auf die angesehenen Kommissare und die Empfehlungen der TRC, um Forderungen deutlich zu machen. Auch hier ist die Vergangenheitspolitik eine Basis zur Weiterführung von Diskussionen um Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit, die aus der Apartheid in das neue Südafrika hinüberreichen.75 Die prozedurale Legitimation der Regierungsinstitutionen ist besonders durch Menschenrechtsverletzungen und die Verweigerung staatsbürgerlicher Rechte beeinträchtigt. Gerade die Menschenrechtsverletzungen gegenüber Ex-Kombatanten in der Armee lassen hier einen Rückzugsbereich der alten Militäreliten vermuten, der durch mangelnde vergangenheitspolitische Maßnahmen entstanden ist. Ebenso machen die Menschenrechtsverletzungen durch Staatsbeamte in Behörden und Gefängnissen deutlich, dass eine Lustration oder zumindest eine Entideologisierung notwendig gewesen wäre, die jedoch durch den vergangenheitspolitischen Kompromiss nicht zu rechtfertigen war. Das rechtsstaatliche Prinzip, auf dem die TRC basierte und das sie förderte, wird im Nachhinein durch die Untätigkeit des Staates – zum Beispiel durch die fehlende Strafverfolgung von Tätern, die den Amnestieprozess gemieden haben - untergraben. In einem Staat, in dem selbst Menschenrechtsverletzungen nicht geahndet werden, entstehen weitere Menschenrechtsverletzungen aus einem Klima des Sanktionsmangels heraus. 75 Die Empfehlungen der TRC, zum Beispiel für ehemalige FreiheitskämpferInnen die Möglichkeit zu schaffen Bildungsabschlüsse zu erwerben, verhallt ungehört. Die Ausbildung, die die Ex-Kombatanten durch das ‚Service Corps’ erhielten, war meist zu oberflächlich, so dass die Jobsuche für solche Personen und die Reintegration in die Gesellschaft oftmals erfolglos blieb. Das RDP zur Umverteilung wurde durch eine marktorientiertes Programm GEAR ersetzt und missachtet dabei die Apartheidvergangenheit, die durch Zwangsumsiedlungen, diskriminierende Bildungsmöglichkeiten eine Ungleichheit der Chancen geschaffen hat, die nur durch Umverteilung innerhalb eines Sozialsystems behoben werden könnten. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 105 ____________________________________________________________________________________________________________________ 6.4 Vergangenheitspolitische Auswirkungen auf die horizontale Verantwortlichkeit Die Autokratisierung Südafrikas durch die Machtfülle des Präsidenten in Regierung, Parlament und Partei sowie auf föderaler Ebene schwächt das demokratische System. Die Verfassungsinstitutionen sind jedoch unabhängig, und es gibt generell keine verfassungswidrigen Übergriffe auf Regierungsinstitutionen (vgl. Heinrich 2001: 77). Korruption ist dagegen ein weitverbreitetes Delikt bei den Angestellten des öffentlichen Dienstes. Gerade in der Provinz KZN fehlt eine investigative Analyse vergangenen Unrechts und eine Untermauerung rechtsstaatlicher Prinzipien, um Korruption und Vorteilnahme zu mindern. Die TRC hat zur Schaffung eines rechtsstaatlichen Klimas beigetragen. Die Vorwürfe, die die TRC dem ANC aufgrund dessen Menschenrechtsverletzungen während der Zeit des Freiheitskampfes machte, bescheinigen der TRC einen Status der Unabhängigkeit. So haben sich die Prinzipien universeller Menschenrechte und somit auch die universelle Bestrafung derer, die diese missachten, im politischen System etabliert. Zudem ist die Verfassung, als ein auf den Erfahrungen der Vergangenheit aufgebauter Normenkatalog, Wächter über die Verantwortlichkeit innerhalb der Regierungsinstitutionen und vertritt (durch das Verfassungsgericht) das Ziel der Vergangenheitspolitik und der demokratischen Konsolidierung gleichermaßen: das ‚Nie wieder’, also die Unmöglichkeit der Wiederholung des Geschehenen. Dies schließt einen Rückfall in autoritäre Strukturen mit ein. Zusammenfassung: Die Ziele von Vergangenheitspolitik und demokratischer Konsolidierung - Wegbereiter oder Hindernisse? Die Verhinderung des Rückfalls in autoritäre Strukturen durch die Kapazitätserweiterung in den Bereichen Distribution, Partizipation/Integration, internationale Anpassung und die Etablierung eines umfassenden Rechtsstaatssystems sind die Ziele demokratischer Konsolidierung. Die Versöhnung von Tätern und Opfern und deren Integration in die Gesellschaft, die Herstellung historischer Gerechtigkeit und die Unmöglichmachung der Wiederholung des Vergangenen sind die Ziele der Vergangenheitspolitik, die sich bei deren konsequenter Verfolgung positiv auf die Stabilisierung eines demokratischen politischen Systems auswirken. Die Problemfelder, die sich im Prozess der demokratischen Konsolidierung Südafrikas ergeben, konnten durch Vergangenheitspolitik abgemildert werden. Individuelle Menschenrechtsverstöße, die während der Zeit der Apartheid begangen wurden, sind durch die TRC geächtet worden. Damit wurde ein Zeichen gesetzt und demonstriert, dass in der neuen demokratischen Ordnung die Menschenrechte nicht nur verteidigt werden, sondern auch einklagbar sind. Eine Kultur der Menschenrechte wurde begonnen, die jedoch zu ihrem Erhalt fortwährender Anstrengung bedarf (vgl. Theissen 2002: 65). Die weitere Verfolgung vergangenheitspoliti- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 106 ____________________________________________________________________________________________________________________ scher Ziele auf der Grundlage der Bekämpfung des ‚unfinished business’ kann der südafrikanischen Demokratie den Weg zu einer liberalen Demokratie ebnen helfen. Die demokratische Konsolidierung ist ein Prozess, dessen Schwerpunkte sich im zeitlichen Verlauf verlagern können und sollen (vgl. Nolte 1996: 22). Während der Phase von Liberalisierung und Demokratisierung, in der die Eliten eine neue Gesellschaftsordnung aushandelten, war ein ungünstiger Zeitpunkt, den moralischen Forderungen der Opfer zu weiten Raum zu geben, um die Integrationskraft der Gesellschaft nicht zu gefährden (vgl. Benomar 1993, hier zitiert nach Wilson 2001, a: 190). In einer späteren Phase der demokratischen Konsolidierung besteht jedoch die Möglichkeit, das Augenmerk wieder pendelartig auf die Beachtung der Interessen der Marginalisierten zurückzuführen, um die Aufgaben des Staates im Bereich der Distribution, Integration und Partizipation nicht zu vernachlässigen und um eine weitere Stabilisierung des Systems voranzutreiben (vgl. Interview Ian Liebenberg. 28.08.2005: 11/25-12/6). Die Traumatisierten - unbedeutend welcher Bevölkerungsgruppe sie angehören, ob weiße Wehrpflichtige oder zivile schwarze Opfer - bedürfen aufgrund ihres anhaltenden Leids erweiterte vergangenheitspolitische Maßnahmen. Somit steht die Forderung nach einer dem Stand des Konsolidierungsprozesses angepassten Vergangenheitspolitik im Raum, da ein immerwährender Bezug auf die Zwänge der Ausgangssituation des Prozesses keine Fortschritte bringt (vgl. Interview Ian Liebenberg. 28.08.2005: 11/25-12/6). Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 107 ____________________________________________________________________________________________________________________ Schlussbetrachtung Durch die Verlagerung des Fokus der Systemwechselforschung auf die Phase der demokratischen Konsolidierung ist die Vergangenheitspolitik mittlerweile von größerer Bedeutung für die Systemwechselforschung. Die Analyse der Vergangenheitspolitik innerhalb des demokratischen Konsolidierungsprozesses hat gezeigt, dass die südafrikanische Vergangenheitspolitik sich trotz ihrer beschnittenen Reichweite bisher positiv auf die demokratische Konsolidierung auswirkte. Somit ist auch das Fallbeispiel Südafrika tauglich, um eine Beziehung zwischen Vergangenheitspolitik und demokratischer Konsolidierung in einem höheren Maß als bisher angenommen nachzuweisen. Für die Beschaffenheit vergangenheitspolitischer Institutionen und Normen sowie deren Auswirkungen auf das politische System ist es ausschlaggebend, ob eine positive oder negative Vergangenheitspolitik in der Phase der Transformation ausgehandelt wird. Die Unmöglichmachung der Wiederholung des Vergangenen, die Herstellung von historischer Gerechtigkeit durch rechtsstaatliche Mittel, die Versöhnung von Opfern und Tätern und ihre Reintegration in die Mitte der Gesellschaft sind Teilziele von Vergangenheitspolitik wie auch von demokratischer Konsolidierung. Allein der Verfassungsgebungsprozess macht deutlich, wie stark das neue demokratische System durch vergangenheitspolitische Merkmale geprägt wird. Auch die politische Kultur und die Einstellung der Bevölkerung zu demokratischen Institutionen wird durch Vergangenheitspolitik beeinflusst. Denn eine positive Vergangenheitspolitik bestärkt das Herausbilden einer demokratischen politischen Kultur durch den öffentlichen Diskurs um die Bewertung der Vergangenheit. Der südafrikanische Systemwechsel war kein Wunder, sondern basierte auf der demokratischen und anti-rassistischen Grundhaltung des ANC und dem Kalkül der NP, das wirtschaftlich und machtpolitisch Beste aus der Liberalisierungs- und Demokratisierungsphase für die eigene Klientel herauszuholen. Der paktierte Übergang in der Transformationsphase des südafrikanischen Systemwechsels schaffte die Grundlagen für eine friedliche Koexistenz der Bevölkerungsgruppen Südafrikas. Er beinhaltete jedoch gleichzeitig den vergangenheitspolitischen Kompromiss, der die Vergangenheitspolitik begrenzte und die Weiterentwicklung des Prozesses derzeit lähmt. Seit der Verabschiedung der Interimsverfassung 1993 ist Südafrika auf dem Weg zu einer liberalen Demokratie maximalistischer Prägung, und die Regierung selbst steht diesem Ziel dabei im Weg. Beide Dilemmata südafrikanischer Politik verlangen ein Umdenken bei Eliten und Massen, hinsichtlich oppositioneller Parteien und demokratischer Bewegungen, um das Projekt Südafrika voranzutreiben. Das durch den ANC geprägte Ein-Parteien-System und die dadurch fehlenden Interessenrepräsentationskanäle stellen gleichzeitig für die Vergangenheitspolitik und die demokratische Konsolidierung eine Hürde dar. Die immer größer werdende Unzufriedenheit der marginalisierten Schichten, verursacht durch hohe Arbeitslosigkeit, die schleppende Landreform, andauernde Armut, geringe Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 108 ____________________________________________________________________________________________________________________ Reparationszahlungen, Gewaltkriminalität und AIDS, bewirken eine schwindende substantielle Legitimation der staatlichen Institutionen. Korruption und Menschenrechtsverletzungen durch die Repräsentanten des Staates und eine missglückte Reform der öffentlichen Verwaltung lassen das Vertrauen in die politischen Institutionen weiter sinken. Aufgrund dieser Probleme, die sich dem Prozess der demokratischen Konsolidierung entgegenstellen, läuft das politische System Südafrikas Gefahr, den Status einer liberalen Demokratie nicht zu erreichen. Südafrika hat seit dem Ende der Transformationsphase und den ersten demokratischen Wahlen weit mehr als nur die Kriterien einer elektoralen Demokratie erfüllt. Fehlende Legitimation und weiterhin bestehende Problemfelder können jedoch im Bereich staatlicher Steuerungsfähigkeit die Errungenschaften einer zum Teil liberalen und pluralistischen Gesellschaft leicht zunichte machen und demokratische von autoritären Strukturen ablösen. Es ist daher notwendig, Lösungen aus den verschiedensten Politikfeldern zu suchen, die den Prozess der Konsolidierung weiterbringen. Die Vergangenheitspolitik eines politischen Systems spiegelt die demokratische Konsolidierung wider. Die Situation von Tätern und Opfern im neuen System ist symptomatisch für die Qualität der Demokratie. Die Reichweite von Strafverfolgung und Menschenrechtsgrundsätzen und das Ausmaß, indem die Ziele der Vergangenheitspolitik auf den norm-, täter-, opfer- und institutionenbezogenen Dimensionen erreicht werden, weisen auf die Stärke des Rechtssystems, auf die ausgeglichenen Interessenrepräsentation, die Inklusionsfähigkeit und auf viele weitere Indikatoren einer konsolidierten Demokratie hin. So verbindet sich die mangelnde Strafverfolgung mit der Unterminierung des Rechtsstaats. Der südafrikanische Amnestieprozess ist durch seine bisher mangelhafte Durchführung in der post-TRC-Ära eine Verletzung der rechtsstaatlichen Norm der Gleichheit vor dem Gesetz. Die seit dem Ende der TRC nachlassende Intensität vergangenheitsbezogener Politik spiegelt auch gleichsam eine Erosion demokratischer Werte wider. Das ‚unfinished business’ der Vergangenheitspolitik hat das Potential, die demokratische Konsolidierung weiter voranzutreiben. Einzig der politische Wille der Regierung und die demokratische Opposition fehlen, um den ausgehandelten Kompromiss aus der Zeit der Transformation zugunsten rechtsstaatlicher Prinzipien und der Opferinteressen zu verschieben. Südafrikanische Vergangenheitspolitik ist mehr als die bisherigen Maßnahmen. Societies rework the past in a wider cultural arena, both during the transitions and after official transitional policies have been implemented and even forgotten […] it also covers unofficial social initiatives and the wider politics of memory, transcending official efforts and extending beyond the initial transitional period. (Barahona de Brito et al. 2001: 1-2) Für die inoffizielle Opfergruppe wie auch für die Gruppe der Nutznießer des Systems erweist sich der bisherige vergangenheitspolitische Handlungsrahmen als zu gering. Jedoch mobilisieren vergan- Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 109 ____________________________________________________________________________________________________________________ genheitspolitische Belange die Zivilgesellschaft und lassen eine außerparlamentarische Opposition entstehen, die der demokratiegefährdenden Dominanz der ANC-Regierung, immer stärker begegnet. Jedoch werden nach der Einschätzung von Rupert Taylor in absehbarer Zeit keine weiterführenden vergangenheitspolitischen Maßnahme implementiert werden (vgl. Interview Rupert Taylor 29.08.2005: 12/16-13/5). Das Dilemma zwischen gesinnungs- und verantwortungsethischer Einstellung und Verhalten, dem sich die Akteure im neuen politischen System gegenüber sehen, kann jedoch nur durch die Einrichtung einer weiteren vergangenheitspolitischen Institutionen aufgelöst werden, die das Abarbeiten des ‚unfinished business’ überwacht. So sind derzeit die Vergangenheitspolitik und das Projekt der Erweiterung der demokratischen Konsolidierung in die Hände der Zivilgesellschaft gelegt. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 110 ____________________________________________________________________________________________________________________ Literaturverzeichnis Adam, Heribert. 1998. “Widersprüche der Befreiung: Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung in Südafrika.“ König, Helmut / Kohlstruck, Michael / Wüll, Andreas. Hsg. Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Sonderheft. Vol. 18. Opladen / Wiesbanden: Westdeutscher Verlag GmbH. 350-367. African Response. 2005. Press Release - The evolving South African Consumer. 07.12.2005. http://www.africanresponse.co.za/The%20Evolving%20South%20African%20Consumer.pdf. AI & HRW (Amnesty International and Human Rights Watch), a. 13.02.2003. Truth and Justice: Unfinished Business in South Africa. 02.12.2005. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR530012003?open&of=ENG-ZAF. Alence, Rod. 2004. South Africa after Apartheid: The first Decade. Journal of Democracy. Vol. 15, No. 3.78-92. Almond, Gabriel A. 1979. “Politische Systeme und politischer Wandel“. Hsg. Zapf, Wolfgang. Theorien des sozialen Wandels. 4. Auflg. Königstein. 211-227. Arenhövel, Mark. 1998. Transition und Konsolidierung in Spanien und Chile. Strategien der Demokratisierung. Gießen: Focus Verlag. Arenhövel, Mark. 2000. Demokratie und Erinnerung. Der Blick zurück auf Diktatur und Menschenrechtsverbrechen. Frankfurt / New York: Campus Verlag. Arenhövel, Mark. 2002. “Transitology revisited: Vorsichtige Schlußfolgerungen aus den erfolgreichen Demokratisierungsprozessen in Südeuropa“. Bendel, Petra / Croissant, Aurel / Rüb, Friedbert W. Hsg. Zwischen Demokratie und Diktatur. Zur Konzeption und Empirie demokratischer Grauzonen. Opladen: Leske und Budrich. Arnold, Jörg. 2000. „Einführungsvortrag: Modelle Strafrechtlicher Reaktionen auf Systemunrecht“. Eser, Albin / Arnold, Jörg. Hsg. Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse. Freiburg. i. Brsg.: edition iuscrim Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. 11-18. Asmal, Kader / Asmal, Louise / Roberts, Ronald Suresh. 2000. “When the assassin cries foul: the modern just war doctrine.” Villa-Vincencio, Charles / Verwoerd, Wilhelm. Hsg. Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town: University of Cape Town Press. 86-98. Ball, Patrick / Chapman, Audrey. 2001. The Truth of Truth Commissions: Comparative lessons from Haiti, South Africa, and Guatemala. Human Rights Quarterly. Vol 23. No. 1. 1-43. Barahona de Brito, Alexandra / González-Enríquez, Carmen / Aguilar, Paloma. 2001. The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratising Societies. Oxford Studies in Democratization. Ser. Oxford: Oxford University Press. Barber, James. 1999. South Africa in the twentieth century. A political history in search of a nation state. History of the contemporary world. Ser. Oxford: Blackwell Publishers. Bell, Terry. 2001. Unfinished Business. South Africa, Apartheid & Truth. Observatory, Südafrika: RedWorks. Bendel, Petra / Croissant, Aurel / Rüb, Friedbert W. 2002. Zwischen Demokratie und Diktatur. Zur Konzeption und Empirie demokratischer Grauzonen. Opladen: Leske und Budrich. Benomar, Jamal. 1993. Confronting the Past: Justice after Transitions. Journal of Democracy. Vol. 4. No. 1. 3-14. Beyme, Klaus von / Nohlen, Dieter. 1995. „Systemwechsel“. Hsg. Nohlen, Dieter / Schultze, Rainer-Olaf: Lexikon der Politik. Bd. 1. Politische Theorien. München: C.H. Beck. 636-649. Beyme, Klaus von / Nohlen, Dieter. 1998. „Systemwechsel“. Hsg. Nohlen, Dieter. Wörterbuch Staat und Politik. (Neuausgabe 1995) Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. 765-776. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 111 ____________________________________________________________________________________________________________________ Beyme, Klaus von / Offe, Claus. 1996. Hsg. Politische Theorien in der Ära der Transformation. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft. Vol. 26. 1995. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH. BIG ‘Basic Income Grant’, a. 2004. BIG Financing Reference Group 2004. ‚Breaking the poverty trap’: Financing a Basic Income Grant in South Africa. 20.02.2006. www.polity.org.za/pdf/BIG.pdf. Bitala, Michael. 26.09.2005. Die Vergangenheit holt die Farmer ein. Auch in Südafrika werden weiße Landwirte zwangsenteignet. Süddeutsche Zeitung. No. 222. 10. Bock, Petra. 2000. Vergangenheitspolitik im Systemwechsel: die Politik der Aufklärung, Strafverfolgung, Disqualifizierung und Wiedergutmachung im letzten Jahr der DDR. Berlin: Logos-Verlag. Bock, Petra / Wolfrum, Edgar. 1999. Umkämpfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Boraine, Alex. 2000. A country unmasked. Cape Town : Oxford University Press. Burton, Mary. 2004. „Reparations - It is still not too late”. Doxtader, Erik / Villa-Vincencio, Charles. Hsg. To Repair the Irreparable. Claremont, South Africa: David Philip Publishers. 29-43. Calland, Richard / Graham, Paul. 2005. “Debate and Democracy. Why measure democracy in South Africa?” Hsg. Calland, Richard / Graham, Paul: Democracy in the time of Mbeki: IDASA’s democracy index. Cape Town. Cape Town: Institute for Democracy in South Africa. Carter, Chiara. 18.12.2005. State to crack down on welfare crooks. The Sunday Independent. 2. 18.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=6&art_id=vn20051218082152964C175991. Centre for Civil Society (CSS) / School of Development Studies, University of KwaZulu-Natal. 2004. Globalisation, Marginalisation & New Social Movements in Post-Apartheid South Africa. 23.10.2005. http://www.nu.ac.za/ccs/default.asp?5,56. Cherry, Janet. 2000. “Historical truth: Something to fight for.” Villa-Vincencio, Charles / Verwoerd, Wilhelm. Hsg. Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town: University of Cape Town Press.134-143. CMHT (Cohen, Milstein, Hausfeldt & Toll, P.L.L.C.), a. Homepage: Apartheid litigation. 12.12.2005. http://www.cmht.com/cases_apartheid.php. Dahl, Robert Alan. 1971. Polyarchy. New Haven/London: Yale University Press. Daly, Erin. 2003. Reparations in South Africa: A cautionary tale. The University of Memphis Law Review. Vol. 33. No. 2. 367-407. De Lange. Johnny. 2000. The historical context, legal origins and philosophical foundation of the South African Truth and Reconciliation Commission. Villa-Vincencio, Charles / Verwoerd, Wilhelm. Hsg. Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town: University of Cape Town Press. 14-31. Democratic Alliance (DA), a. 2002. Waging war on poverty. The DA policy on the Basic Income Grant. 07.12.2005. http://www.da.org.za/da/site/Eng/campaigns/big.asp. Department of Communications, a. 22.10.1997. Press Release: SABC Funding. 30.11.2005. Rights. 24.11.2005. http://www.doc.gov.za/docs/Press_releases/1997/pr971022.html. Department of Land Affairs, a. Commission on the Restitution of Land http://land.pwv.gov.za/restitution/BACKGROU.RES.htm. doj & cd (Department of Justice and Constitutional Development Republic South Africa), a. The Truth and Reconciliation Commission Home Page: Register of Reconciliation. 28.11.2005. http://www.doj.gov.za/trc/ror/index.htm Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 112 ____________________________________________________________________________________________________________________ doj & cd (Department of Justice and Constitutional Development Republic South Africa), b. The Truth and Reconciliation Commission Home Page: Constitutional Court of South Africa Case CCT 17/96. 28.11.2005. http://www.doj.gov.za/trc/legal/index.htm doj & cd (Department of Justice and Constitutional Development Republic South Africa), c. The Truth and Reconciliation Commission Home Page: TRC Press releases and SAPA News Reports. 28.11.2005. http://www.doj.gov.za/trc/media/index.htm doj & cd (Department of Justice and Constitutional Development Republic South Africa), d. The Truth and Reconciliation Commission Home Page: Special Hearings Transcripts. 28.11.2005. http://www.doj.gov.za/trc/special/index.htm. doj & cd (Department of Justice and Constitutional Development Republic South Africa), e. The South African Law Reform Commission. 05.12.2005. http://www.doj.gov.za/salrc/index.htm. doj & cd (Department of Justice and Constitutional Development Republic South Africa), f. The TRC report. 05.12.2005. http://www.doj.gov.za/trc/report/index.htm. Eser, Albin / Arnold, Jörg. 2000. „Geleitwort zum Gesamtprojekt“. Eser, Albin / Arnold, Jörg. Hsg. Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse. Freiburg. i. Brsg.: edition iuscrim Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Strafrecht. IX-XVIII. Eser, Albin / Arnold, Jörg / Kreicker, Helmut. 2001. „Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse. Ein Projektbericht“. Eser, Albin / Albrecht, Hans-Jörg. Hsg. forschung aktuell. Ser. No. 6. Freiburg. i. Brsg.: edition iuscrim Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. Fish, Steven M. / Brooks, Robin S. 2004. Does diversity hurt democracy? Journal of Democracy. Vol. 15, No. 1. 154-166. Foweraker, Joe. 2001. „Transformation, Transition, Consolidation: Democratization in Latin America“. Hsg. Nash, Kate / Scott, Alan. The Blackwell Companion to political sociology. Oxford, England: Blackwell Publishing Ltd. 355-365. Fox, Revel. 2004. „Building Sites of Repair: Freedom Park and its Objectives.” Doxtader, Erik / Villa-Vincencio, Charles. Hsg. To Repair the Irreparable. Claremont, South Africa: David Philip Publishers. 265-270. Freedom House, a. 2005. Freedom of the Press 2005. Press Freedom Rankings by Region. 08.12.2005. http://www.freedomhouse.org/research/pressurvey/regionaltables2005.pdf. Fritze, Lothar. 1996. Vergangenheitsbewältigung als Interpretationsgeschäft. Über die Umkehrung von Begründungspflichten und Rechtfertigungslasten. Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. No. 1. 109-123. Garcia-Rivero, Carlos / Kotzé, Hennie / du Toit, Pierre. 2002. Political culture and democracy : The Soth African case. Politikon. Vol. 29. No. 2. 163-181. Gear, Sasha. 2002. Wishing us away: Challenges facing ex-Combatants in the ‘new’ South Africa. Violence & Transition Series. Ser. Vol. 8. Johannesburg: CSVR. Gibson, James L. 2002. Truth, Justice and Reconciliation : Judging the Fairness of Amnesty in South Africa. American Journal of Political Science. Vol. 46. No. 3. 540-556. Gibson, JamesL. 2004. Overcoming Apartheid. Cape Town: Human Sciences Research Council Press. Giliomee, Hermann. 1995. Democratization in South Africa. Political Science Quarterly. Vol. 110. No. 1. 83-104. Greenberg, Stephen. 2004. The Landless People’s Movement and the Failure of Post-Apartheid Land Reform. Centre for Civil Society / School of Development Studies, University KwaZulu-Natal. Hsg. Globalisation, Marginalisation & and New Social Movements in Post-Apartheid South Africa. Ser. Durban: School of Development Studies. 16.12.2005. http://www.nu.ac.za/ccs/files/Greenberg%20LPM%20RR.pdf. Halbwachs, Maurice. 1967. Das kollektive Gedächtnis. Mit einem Geleitwort von H. Maus. Stuttgart: . Heinrich, Volkhart. 2001. Demokratische Konsolidierung in Südafrika. Die Rolle der NGOs. Hamburg: Institut für Afrikakunde. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 113 ____________________________________________________________________________________________________________________ Herzenberg, Collette. Sources of Partisan Identification in South Africa. Draft Doctorat Proposal. 22.11.2005. http://web.uct.ac.za/depts/politics/depnews/ProposalPresentations/herzenberg%20proposal.htm#refs. Höchst, Claudia. 2003. Vergangenheitsbewältigung und ihre Rolle im Demokratisierungsprozess postautoritärer Systeme. Der Fall Chile. Arbeitshefte des Lateinamerika-Zentrums. Vol. 81. Münster: Westfälische-Wilhelms-Universität. HOM (Humanist Committee on Human Rights), a. Overview on Disappearances: How does it affect people?. 04.12.2005. http://www.hom.nl/english/disappearances_overview.php. Hooper-Box, Caroline. 07.11.2004. Colours don’t run in the rainbow nation. The Sunday Independent. 2. 14.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20041107103952792C932332. Huber, Barbara / Umbreit, Dirk. 2000. „Südafrika“. Eser, Albin / Arnold, Jörg. Hsg. Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse. Freiburg. i. Brsg.: edition iuscrim Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. 273-281. Huntington, Samuel P. 1991. The third wave: Democratization in the late twentieth century. Norman: University of Oklahoma Press. Jasson da Costa, Wendy. 28.03.2005. Political murders in KZN ‘well-orchestrated’. Independent Online. 14.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=qw1111992481439B251. Kaußen, Stephan. 2005. Südafrikas gelungener Wandel. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ). No. 4/2005. 32-39. Knox,Colin / Quirk, Pádraic. 2000. „Peace building in Northern Ireland, Israel and South Africa. Transition, Transformation and Reconciliation”. Dunn, Seamus / Morgan, Valerie. Hsg. Ethnic and Intercommunity Conflict Series. Ser. London: Macmillan Press Ltd. König, Helmut. 1997. Juristische Feinheiten auf politischem Glatteis: Vergangenheitsbewältigung und Rückwirkungsgebot. Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. No. 4. 445-451. König, Helmut. 1998. Von der Diktatur zur Demokratie oder Was ist Vergangenheitsbewältigung. Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Sonderheft. No. 18. 371-392. Kruse, Jan / Helfferich, Cornelia. 2005. Reader zum Workshop Qualitative Interviewforschung. 07.07. - 09.07.2005. Freiburg i. Brsg.: EFH Freiburg. KSG (Khulumani Support Group), a. 15.12.2004. Khulumani Background. 30.11.2005. http://www.khulumani.net/content/view/25/16/. KSG (Khulumani Support Group), b. 15.12.2004. KSG lawsuit - full complaint: The United Nations and other Organizations put Corporations and the World on Notice. 30.11.2005. http://www.khulumani.net/content/view/54/32/ bzw. www.cmht.com/pdfs/apartheid-cmpl.PDF. KSG (Khulumani Support Group), c. 15.12.2004. KSG lawsuit - full complaint: jurisdiction and venue. 30.11.2005. http://www.khulumani.net/content/view/39/32/ bzw. www.cmht.com/pdfs/apartheid-cmpl.PDF. KSG (Khulumani Support Group), d. 21.11.2005. Khulumani East Rand Protest focuses on TRC ‘unfinished business’. 12.12.2005. http://www.khulumani.net/content/view/590/17/. KSG (Khulumani Support Group), e. 07.08.2003. Why did the former Minister of Justice, Penuell Maduna, submit an affidavit to the court? 12.12.2005. http://www.khulumani.net/content/view/35/33/. KSG (Khulumani Support Group), f. 29.08.2005. Vlaakplaas Commemoration International Day of the Disappeared: August 30, 2005. 19.12.2005. http://www.khulumani.net/content/view/564/0/. KSG (Khulumani Support Group), g. 06.02.2006. Passing of Bra Duma Kumalo. 20.02.2006. http://www.khulumani.net/content/view/595/17/. Lang, Bettina. 2005. “Strafrechtsbezogene Vergangenheitspolitik. Politischer Wille und Strafrechtsrealität im Spannungsverhältnis am Beispiel von Deutschland und Südafrika.“ Albrecht, Hans-Jörg / Kaiser, Günther Hsg. Schriftenreihe Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 114 ____________________________________________________________________________________________________________________ des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht Reihe K: Kriminologische Forschungsberichte. Ser. Vol. K 122. Freiburg im Breisgau: edition iuscrim. Linz, Juan / Stepan, Alfred. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation - Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Lipset, Seymour Martin. 1960. Political Man. London. Luhmann, Niklas. 1997. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: . Macdonald, Helen. 2002. Die gespaltene Erinnerung Südafrikas. Knigge, Volkhard. Hsg. Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. München: Beck. 57-74. Maloka, Eddy. 2004. “The fruits of freedom”. Institute for Justice and Reconciliation / South African History Project. Hsg Turning points in history. Ser. Vol. 6. Johannesburg: STE Publishers. 52-64. 04.11.2005. http://www.sahistory.org.za/pages/chronology/turningpoints/bk6/chapter4.htm. Mamdani Mahmood. 1998.A Diminished Truth. Siyaya! Magazin. Spring Vol. 3. 38-40. Marx, Christoph. 2004. “Von der Versöhnung zur Entsorgung?“. Zimmerer, Jürgen. Hsg. Verschweigen - Erinnern - Bewältigen. Vergangenheitspolitik nach 1945 in globaler Perspektive. Comparativ. Ser. Jg. 14. No. 5/6. Leipzig: Leipziger Universitäts Verlag. Mashego, Mojalefa. 15.03.2005. Exhumed bodies will soon be identified. The Star. 3. 19.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20050315082329271C352058. Mbeki, Thabo. 2003. „Statement to the National Houses of Parliament and the Nation at the tabling of the Report of the Truth and Reconciliation Commission”. Doxtader, Erik / Villa-Vincencio, Charles. Hsg. 2004. To Repair the Irreparable. Claremont, South Africa: David Philip Publishers. 15-28. Merkel, Wolfgang. 1996. „Theorien der Transformation: Die demokratische Konsolidierung postautoritärer Gesellschaften.“ Beyme, Klaus von / Offe, Claus. Hsg. Politische Theorien in der Ära der Transformation. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft. Bd. 26. 1995. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH. 30-58. Merkel, Wofgang. 1999. Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. Opladen: Leske und Budrich. Merkel, Wolfgang. 2000. „Transformationstheorien“. Holtmann, Everhard. Politik-Lexikon. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH. 691-994. Meyns, Peter. 2000. „Konflikt und Entwicklung im südlichen Afrika“. Alemann, Ulrich / Czada, Roland / Simonis, Georg. Grundwissen Politik. Ser. Vol. 27. Opladen: Leske und Budrich. Mgxashe, Mxolisi. 2000. “Reconciliation: a call to action”. Villa-Vincencio, Charles / Verwoerd, Wilhelm. Hsg. Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town: University of Cape Town Press. 210-218. Monare, Moshoeshoe. 16.09.2005. SA voters are happy with democracy - poll. Cape Times. 06.02.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20050916073141561C684415. Naidu, Edwin. 03.07.2005. No general amnesty for apartheid crimes. Sunday Independent. 02.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20050703093850971C292910. Nohlen, Dieter. 2001. „Demokratisierung“. Hsg. Nohlen, Dieter. Kleines Lexikon der Politik. München: C.H. Beck. 54-55. Nolte, Detlef. 1996. „Wahrheit und Gerechtigkeit oder Vergessen? Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika.“ Nolte, Detlef. Hsg. Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika. Schriftenreihe des Instituts für Iberoamerika-Kunde, Hamburg. Ser. Vol. 44. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 115 ____________________________________________________________________________________________________________________ Nolte, Detlef. 2000. “Verantwortungsethik versus Gesinnugsethik: Menschenrechtsverletzungen und Demokratisierung in Südamerika“. Fischer, Thomas / Krennerich, Michael. Hsg. Politische Gewalt in Lateinamerika. LateinamerikaStudien. Ser. Vol. 41. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag. 291-309. Ntsebeza, Lungisile. 2004. „Reconciliation, Reparation and Reconstruction in Post-1994 South Africa: What Role for Land?.” Doxtader, Erik / Villa-Vincencio, Charles. Hsg. To Repair the Irreparable. Claremont, South Africa: David Philip Publishers. 197-210. Offe, Claus. 1994. Der Tunnel am Ende des Lichts. Frankfurt am Main. O’Donnell, Guillermo / Schmitter, Philippe C. 1986. Transitions from Authoritarian Rule Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press. O’Donnell, Guillermo / Schmitter, Philippe / Whitehead, Laurence. Hsg. 1986. Transitions from Authoritarian Rule. Prospects for Democracy. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press. Parliamentary Monitoring Group, a. State Institutions which support Constitutional Democracy. 21.11.2005. http://www.pmg.org.za/parlinfo/sectiona3.htm#3.8%20Temporary%20commissions. Perry, Timothy. 2004. Language rights, ethnic politics. A critique of the Pan South African Language Board. PRAESA Occasional Papers. Ser. 12. Cape Town: PRAESA. Peete, Fana 23.09.2005. Farmer faces expropriation in North West. The Mercury. 2. 14.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20050923070614978C107135. Plasser, Fritz / Ulram, Peter A. / Waldrauch, Harald. 1997. Politischer Kulturwandel in Ost-Mitteleuropa. Opladen: Leske und Budrich. Pordzik, Ralph. 2000. Die moderne englischsprachige Lyrik in Südafrika 1950-1980. Anglistische Forschungen. Ser. Vol. 291. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter. Pridham, Geoffrey. 1995. “The international Context of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective.” Gunther, Richard /Diamandouros, Nikifouros / Puhle, Hans-Jürgen. Hsg. The Politics of Democratic Consolidation. Southern Europe in Comparative Perspective. Baltimore. 166-203. Prittwitz, Volker von. 1994. Politikanalyse. Opladen: Leske und Budrich. Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Camebridge: Camebridge University Press. Putnam, Robert / Goss, Kristin A. 2001. “Einleitung”. Putnam, Robert D. Hsg. Gesellschaft und Gemeinsinn. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. 15-43. Quaritsch, Helmut. 1992. Theorie der Vergangenheitsbewältigung. Der Staat. Vol. 31. No. 1 / 4. 519-551. Rauch, Theo. 2004. Alle enttäuscht - Gratwanderung geglückt? 10 Jahre Demokratie in Südafrika. Querbrief. Zeitschrift des Weltfriedensdienstes e.V. No. 1, 2004. 4-8. Redress. Seeking Reparation for torture survivors, a. What is reparation? 30.11.2005. Bildungsserver. 16.11.2005. http://www.redress.org/what_is_reparation.html. Rosenbach, Manfred. 2005. Legalität, Legitimität, Loyalität. Berliner http://bebis.cidsnet.de/weiterbildung/sps/allgemein/bausteine/rechtsstaat/legalegi.htm Ross, Robert. 1999. A concise history of South Africa. Cambridge: Cambridge University Press. Rüb, Friedbert. 1996. „Die Herausbildung politischer Institutionen in Demokratisierungsprozessen“. Merkel. Wolfgang. Hsg. Systemwechsel 1. Theorien, Ansätze und Konzepte der Transitionsforschung. Opladen: Leske und Budrich. 111137. SA Gov. Info (South African Government Information), a. Constitution of the Republic of South Africa Act 200 of 1993. 21.11.2005. http://www.info.gov.za/documents/constitution/93cons.htm. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 116 ____________________________________________________________________________________________________________________ SA Gov. Info (South African Government Information), b. Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996. 21.11.2005. http://www.info.gov.za/documents/constitution/index.htm SA Gov. Info (South African Government Information), c. Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995. 21.11.2005. http://www.info.gov.za/acts/1995/a34-95.pdf SA Gov. Info (South African Government Information), d. National Heritage Resources Act 25 of 1999. 21.11.2005. http://www.info.gov.za/documents/acts/1999.htm. SA Gov. Info (South African Government Information), e. Justice System: Other legal role-players and structures. 05.12.2005. http://www.info.gov.za/aboutgovt/justice/structures.htm#trc. SA Gov. Info (South African Government Information), f. Promotion of Access to Information Act 2 of 2000. 29.12.2005. http://info.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf. SAHO (South Africa History Online), a. 19 November 1926 - The Balfour Declaration is accepted. 13.06.2005. http://www.sahistory.org.za/pages/chronology/thisday/1926-11-19.htm SAHO (South Africa History Online), b. South Africa 1948-1976. 13.06.2005. http://www.sahistory.org.za/pages/specialprojects/1948-1976/becoming-a-republic.htm SAHO (South Africa History Online), c. Chronology-Independence of African colonies. 13.06.2005. http://www.sahistory.org.za/pages/chronology/special-chrono/colonial-independence2.htm SAHO (South African History Online), e. Celebrating 50 years of the Freedom Charter. 26th June 1955-2005. Guidebook for schools. 04.11.2005. http://www.sahistory.org.za/pages/specialprojects/june26/graphics/Freedom%20Charter-reduced.pdf SAHO (South African History Online), f. Chronology of the United Nations and Apartheid. 04.11.2005. http://www.sahistory.org.za/pages/chronology/special-chrono/un-apartheid.html Sandschneider, Eberhard. 1995. Stabilität und Transformation politischer Systeme. Stand und Perspektiven politikwissenschaftlicher Transformationsforschung. Opladen: Leske und Budrich. SAPA (South African Press Association), a. 31.10.2005. Slow farm land claims sparks tensions. 07.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=qw1130745420543B245. Schedler, Andreas. 1998. What is democratic consolidation? Journal of Democracy. Vol. 9. No. 2. 91-107. Schmidt, Manfred. 2000. Demokratietheorien. Eine Einführung. 3. Auflg. Opladen: Leske und Budrich. Schmidt, Siegmar. 2004. „Wohlfahrtspolitik in Südafrika nach dem Ende der Apartheid.“ Croissant, Aurel / Erdmann, Gero / Rüb, Friedbert W. Hsg. Wohlfahrtsstaatliche Politik in jungen Demokratien. Wiesbaden: VS Verlag. Schultze, Rainer-Olaf. 2001. „Konkordanzdemokratie“. Hsg. Nohlen, Dieter. Kleines Lexikon der Politik. München: C.H. Beck. 259-260. Schumpeter, Joseph A. 1950. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. 4. Auflg. München Schutte, Charl / Liebenberg, Ian / Minnaar, Anthony. 1998. The hidden hand. Covert operations in South Africa. Pretoria: HSRC Publishers. Scott, Colleen. 2000. “Combating myth and building reality”. Villa-Vincencio, Charles / Verwoerd, Wilhelm. Hsg. Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town: University of Cape Town Press. Slye. Ronald. 2000. “Justice and Amnesty”. Villa-Vincencio, Charles / Verwoerd, Wilhelm. Hsg. Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town: University of Cape Town Press. 174-183. Sonis, Jeffrey / van der Merwe, Hugo / Adonis, Cyril / Backer, David / Masitha, Hlaha. 2002. Forgiveness among Victims of Political Violence: Evidence from South Africa and its Truth and Reconciliation Commission Process. Chicago, Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 117 ____________________________________________________________________________________________________________________ IL: unpublished paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association. 23.08.2002. (Please do not cite nor quote without the authors permission). SouthAfrica.info, a. Public Services / Advice for Citizens / Health. 06.12.2005. http://www.safrica.info/public_services/citizens/health/healthfaq.htm#cover. SouthAfrica.info, c. South Africa’s Political Parties. 19.12.2005. http://www.safrica.info/ess_info/sa_glance/constitution/polparties.htm. Taylor, Charles. 1998. The Dynamics of Democratic Exclusion. Journal of Democracy. Vol. 9, No. 4. 143-156. Taylor, Rupert. 2001. Justice Denied: Political Violence in KwaZulu-Natal after 1994. Violence and Transition Series. Ser. Vol. 6. Johannesburg: Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR). Terreblanche, Christelle. 08.04.2003. DA slams TRC reparations proposal. The Mercury. p. 2. 30.11.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20030408053435711C782607 Terreblanche, Christelle. 10.08.2003. Nobel laureate endorses apartheid reparations. The Sunday Independent. 12.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=ct20030810102700909P200548. Terreblanche, Christelle. 26.09.2003. ‚Farmers vulnerable because of poor security’. The Star. 6. 15.12.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20030926035548316C111692. Terreblanche, Christelle. 27.11.2005. ‚Back door’ amnesty plan revealed. The Sunday Independent. 06.02.2006. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=vn20051127070029402C565763. Terreblanche, Sampie. 2003. A history of inequality in South Africa. Pietermaritzburg: University of Natal Press. Theissen, Gunnar. 2002. Mehrere Wahrheiten: Die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission im Spiegelbild von Meinungsumfragen. WeltTrends. Vol. 37. 65-80. Themba Lesizwe. 2005. Homepage. 04.12.2005. http://www.thembalesizwe.co.za. Thompson, Leonard. 1995. A history of South Africa. New Haven: Yale University Press. TRC-Bericht (Truth and Reconciliation Commission), a. Vol. 1-5 / 1998, Vol. 6 / 2003. South Africa: Contested Transitions. 30.06.2005. http://www.stanford.edu/class/history48q/Documents/. TRC-Bericht (Truth and Reconciliation Commission), b. Vol. 7 / 2002. The Truth and Reconciliation Commission Home Page: The TRC Report. 28.11.2005. http://www.doj.gov.za/trc/report.htm. “ubuntu”. Wikipedia. The Free Encyclopedia. 04.12.2005. http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_%28ideology%29. Tshivhidzo, Edwin. 07.03.2005 Access to information guide. 29.12.2005. http://www.southafrica.info/public_services/citizens/your_rights/information-030305.htm. UNDP / NHDR (United Nations Development Programme / National Human Development Report), a. 2003. South Africa Human Development Report 2003. 21.10.2005. http://www.undp.org.za/NHDR2003.htm. UNILC (United Nations International Law Commission), a. State responsibility. 30.11.2005. http://www.un.org/law/ilc/guide/gfra.htm. Van Vuuren, Willem. 1995. Transition Politics and the Prospects of Democratic Consolidation in South Africa. Politikon. Vol 22, No. 1. 5-23. Varwick, Johannes. 2000. „Systemwechsel/Transformation“. Hsg. Woyke, Wichard. Handwörterbuch Internationale Politik. Bonn: Leske und Budrich. 397-407. Villa-Vincencio, Charles. 2000. “Restorative Justice: dealing with the past differently”. Villa-Vincencio, Charles / Verwoerd, Wilhelm. Hsg. Looking back reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town: University of Cape Town Press. 68-76. Walker, Cherryl. 2000. Relocating restitution. Transformation. Vol. 44. 1-16. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 118 ____________________________________________________________________________________________________________________ Wanneburg, Gershwin / Chege, Wambui. 15.04.2003. Apartheid Victims will get R30 000 Payout. Reuters. 28.11.2005. http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=13&art_id=qw1050431222178B216 Weber, Max. 1993. Politik als Beruf. Stuttgart: Reclam. Werkstatt Ökonomie. 2000. Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika. 07.12.2005. www.woek.de/kasa/pdf/artikel/kneifel_das_schweigen_gebrochen_rezension_feb_2000.pdf. Wilson, Richard A. 2001, a. “Justice and Legitimacy in the South African Transition”. Barahona de Brito, Alexandra / González-Enríquez, Carmen / Aguilar, Paloma. The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratising Societies. Oxford Studies in Democratization. Ser. Oxford: Oxford University Press. 190-217. Wilson, Richard A. 2001, b. The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa. Cambridge: Cambridge University Press. Young, Iris Marion. 1989. Polity and Group Difference: A critique of the Ideal of Universal Citizenship. Ethics. Vol. 99. No. 2. 250-274. Zimmerer, Jürgen: Vergangenheitspolitik nach1945 in globaler Perspektive. Einleitung. Zimmerer, Jürgen. Hsg. Verschweigen - Erinnern - Bewältigen. Vergangenheitspolitik nach 1945 in globaler Perspektive. Comparativ. Ser. Jg. 14. No. 5/6. Leipzig: Leipziger Universitäts Verlag. Vergangenheitspolitik im Rahmen demokratischer Konsolidierung - Das ‚unfinished business’ des südafrikanischen Systemwechsels 119 ____________________________________________________________________________________________________________________ Appendix: Liste der interviewten Expertinnen Experten - Ewoud Plate, Koordinator des Projekts ‘Linking Solidarity’ des ‚Humanist Committee on Human Rights’ (HOM) zur globalen Vernetzung von Verschwundenenverbänden, Utrecht, Niederlande. Interview vom 06.06.2005. - Polly Dewhirst, ehemalige Koordinatorin für das ‚Human Rights Documentation Project’ der TRC und derzeitige wissenschatliche Mitarbeiterin im ‚Transition and Reconciliation Programme’ des ‚Centre for the Study of Violence and Reconciliation’ (CSVR), Johannesburg, Südafrika. Interview vom 03.08.2005. - Sasha Gear, ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin im ‚Violence in Transition Project’ des CSVR, jetzt in dessen ‚Criminal Justice Programme’. Interview vom 12.08.2005. - Marjorie Jobson, Kommissarin der ‚Commission for the Promotion and Protection of Cultural, Religious and Linguistic Communities’ und Vorstandsmitglied der KSG und des ‚Land Access Movements’. Interview vom 17.08.2005. - Rupert Taylor, Professor für Politikwissenschaft and der ‚University of the Witwatersrand’, Johannesburg, Südafrika. Interview vom 22. 08. und 29.08.2005. - Ian Liebenberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter des ‚Centre of International Political Studies’ der Universität Pretoria und des ‚Department of Sociology’ der Universität Südafrika (UNISA). Interview vom 23.08.2005. - Madeleine Fullard, Leiterin des ‚Missing Person’s Task Team’ der NPA und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin der TRC. Interview vom 24.08.2005. - Yasmin Sooka, ehemalige Kommissarin des ‚Reparation and Rehabilitation Committee’ der TRC und derzeitige Direktorin der ‚Foundation for Human Rights’ Südafrika. Interview vom 29.08.2005. - Rev Frank Chikane, ehemaliger Generalsekretär des ‘South African Council of Churches’ (SACC) und derzeit ‚Director-General of the President’s Office’ in Thabo Mbeki’s Regierung. Interview vom 30.08.2005.