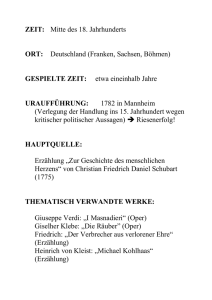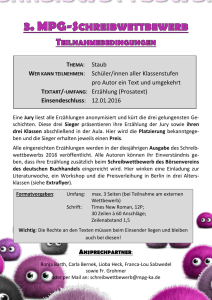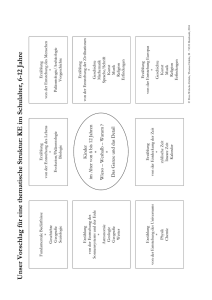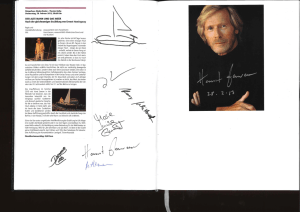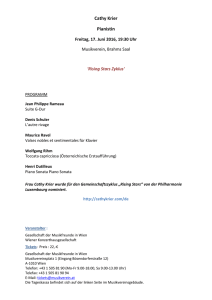Fabulierkunst der Töne
Werbung
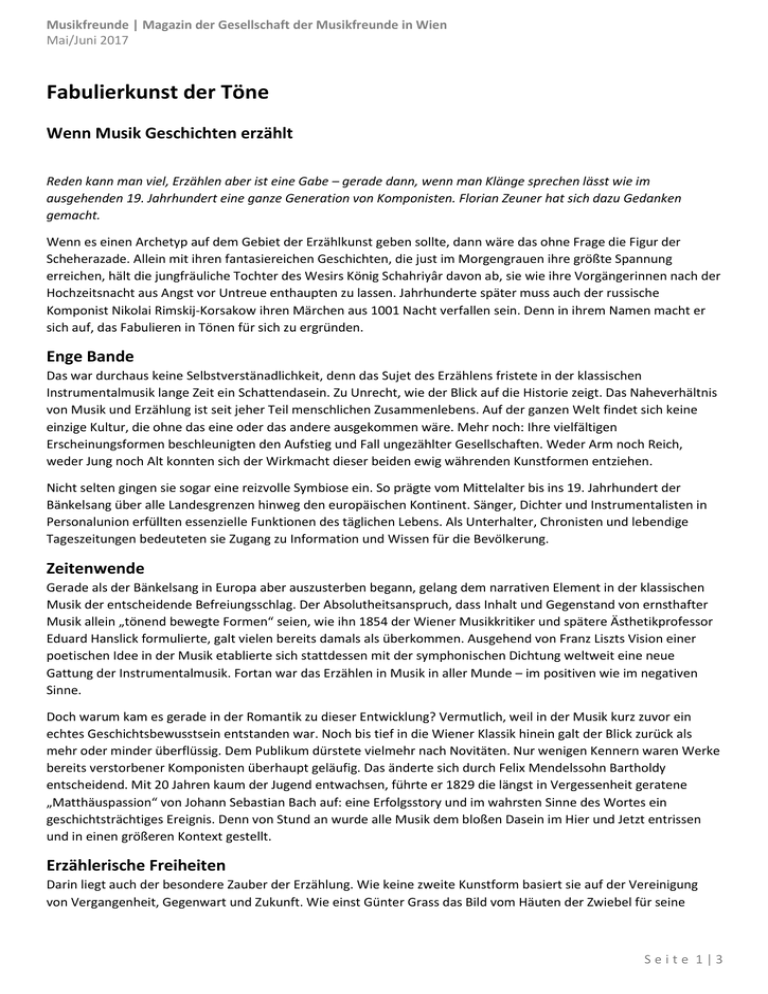
Musikfreunde | Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Mai/Juni 2017 Fabulierkunst der Töne Wenn Musik Geschichten erzählt Reden kann man viel, Erzählen aber ist eine Gabe – gerade dann, wenn man Klänge sprechen lässt wie im ausgehenden 19. Jahrhundert eine ganze Generation von Komponisten. Florian Zeuner hat sich dazu Gedanken gemacht. Wenn es einen Archetyp auf dem Gebiet der Erzählkunst geben sollte, dann wäre das ohne Frage die Figur der Scheherazade. Allein mit ihren fantasiereichen Geschichten, die just im Morgengrauen ihre größte Spannung erreichen, hält die jungfräuliche Tochter des Wesirs König Schahriyâr davon ab, sie wie ihre Vorgängerinnen nach der Hochzeitsnacht aus Angst vor Untreue enthaupten zu lassen. Jahrhunderte später muss auch der russische Komponist Nikolai Rimskij-Korsakow ihren Märchen aus 1001 Nacht verfallen sein. Denn in ihrem Namen macht er sich auf, das Fabulieren in Tönen für sich zu ergründen. Enge Bande Das war durchaus keine Selbstverstänadlichkeit, denn das Sujet des Erzählens fristete in der klassischen Instrumentalmusik lange Zeit ein Schattendasein. Zu Unrecht, wie der Blick auf die Historie zeigt. Das Naheverhältnis von Musik und Erzählung ist seit jeher Teil menschlichen Zusammenlebens. Auf der ganzen Welt findet sich keine einzige Kultur, die ohne das eine oder das andere ausgekommen wäre. Mehr noch: Ihre vielfältigen Erscheinungsformen beschleunigten den Aufstieg und Fall ungezählter Gesellschaften. Weder Arm noch Reich, weder Jung noch Alt konnten sich der Wirkmacht dieser beiden ewig währenden Kunstformen entziehen. Nicht selten gingen sie sogar eine reizvolle Symbiose ein. So prägte vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert der Bänkelsang über alle Landesgrenzen hinweg den europäischen Kontinent. Sänger, Dichter und Instrumentalisten in Personalunion erfüllten essenzielle Funktionen des täglichen Lebens. Als Unterhalter, Chronisten und lebendige Tageszeitungen bedeuteten sie Zugang zu Information und Wissen für die Bevölkerung. Zeitenwende Gerade als der Bänkelsang in Europa aber auszusterben begann, gelang dem narrativen Element in der klassischen Musik der entscheidende Befreiungsschlag. Der Absolutheitsanspruch, dass Inhalt und Gegenstand von ernsthafter Musik allein „tönend bewegte Formen“ seien, wie ihn 1854 der Wiener Musikkritiker und spätere Ästhetikprofessor Eduard Hanslick formulierte, galt vielen bereits damals als überkommen. Ausgehend von Franz Liszts Vision einer poetischen Idee in der Musik etablierte sich stattdessen mit der symphonischen Dichtung weltweit eine neue Gattung der Instrumentalmusik. Fortan war das Erzählen in Musik in aller Munde – im positiven wie im negativen Sinne. Doch warum kam es gerade in der Romantik zu dieser Entwicklung? Vermutlich, weil in der Musik kurz zuvor ein echtes Geschichtsbewusstsein entstanden war. Noch bis tief in die Wiener Klassik hinein galt der Blick zurück als mehr oder minder überflüssig. Dem Publikum dürstete vielmehr nach Novitäten. Nur wenigen Kennern waren Werke bereits verstorbener Komponisten überhaupt geläufig. Das änderte sich durch Felix Mendelssohn Bartholdy entscheidend. Mit 20 Jahren kaum der Jugend entwachsen, führte er 1829 die längst in Vergessenheit geratene „Matthäuspassion“ von Johann Sebastian Bach auf: eine Erfolgsstory und im wahrsten Sinne des Wortes ein geschichtsträchtiges Ereignis. Denn von Stund an wurde alle Musik dem bloßen Dasein im Hier und Jetzt entrissen und in einen größeren Kontext gestellt. Erzählerische Freiheiten Darin liegt auch der besondere Zauber der Erzählung. Wie keine zweite Kunstform basiert sie auf der Vereinigung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie einst Günter Grass das Bild vom Häuten der Zwiebel für seine Seite 1|3 Musikfreunde | Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Mai/Juni 2017 Autobiographie wählte, so ist es das Geschichtete einer Geschichte, das ihre Faszination ausmacht. Jede Erzählung fußt auf einer anderen Erzählung, und jede Erzählung wird eines Tages die Basis für eine neue sein. Es gibt kaum Formalien, die sie fesseln. Ob mündlich oder schriftlich, lang oder kurz, fiktiv oder faktentreu, spontan improvisiert oder publiziert, all das spielt keine Rolle, wenn es darum geht zu beurteilen, was eine Erzählung ausmacht. Entscheidend ist vielmehr ihre radikale Subjektivität. Denn erst durch den Akt individuellen Formulierens geht das Erzählen über eine allgemeine Informationsweitergabe hinaus. Musik für Bilder? Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts wider. Da wären zum Beispiel die „Bilder einer Ausstellung“ zu nennen. Anders als der Titel vielleicht glauben macht, handelt es sich hierbei um weit mehr als reine Klangmalerei oder bloße Programmmusik. Die Inspiration zu seiner Komposition überkam Modest Mussorgskij 1874 bei einer Gedächtnisausstellung zu Ehren des im Jahr zuvor verstorbenen Malers und Architekten Viktor Hartmann. Die beiden Künstler hatte eine enge Freundschaft verbunden, die durch das plötzliche Ableben des 39-Jährigen jäh beendet wurde. Für Mussorgskij dürfte der Blick auf die Motive daher weit mehr ausgelöst haben, als der vordergründige Inhalt vermuten lässt. Und so flossen in die vielfältigen Geschichten der in Töne gesetzten Gemälde fast zwangsläufig auch zahlreiche persönliche Anekdoten und Erinnerungen mit ein. Eine ganz eigene Erzählung brach sich Bahn. Ringen um Fassungen Ursprünglich schrieb Mussorgskij seine „Bilder einer Ausstellung“ als Klavierzyklus, doch am geläufigsten ist uns heute nicht sein Original, sondern die Orchesterfassung. Oder besser gesagt eine der vielen, nämlich die von Maurice Ravel aus dem Jahr 1922. Bereits vor ihm hatten sich Komponistenkollegen an Bearbeitungen versucht, und auch danach blieb die farbenreiche Musik für Tonsetzer von Leopold Stokowski bis Vladimir Ashkenazy ein Faszinosum. Doch gerade diese Vielfalt der Erzählungen bleibt dem Publikum für gewöhnlich vorenthalten, obwohl das Werk zu den meistgespielten auf der Konzertbühne überhaupt zählt. Ganz zu schweigen von den Grenzen sprengenden Bearbeitungen für kleinere Besetzungen. Dabei muss gar nicht bis zur kühnen Adaption des britischen Prog-RockTrios Emerson, Lake and Palmer gegangen werden. Bereits die Bearbeitung für Klavier, Violine, Viola und Violoncello, die das Fauré Quartett im Musikverein präsentiert, bringt auf bezaubernd leichte Weise ungehörte Facetten des wohl berühmtesten Museumsbesuchs der Musikgeschichte zum Klingen. Der Kuss der Muse Einer der nach ersten Versuchen von einer Bearbeitung der „Bilder einer Ausstellung“ absah, war Nikolai RimskijKorsakow. Eigentlich erstaunlich, schließlich orchestrierte der gute Freund Mussorgskijs zahlreiche seiner Werke und war ihm auch sonst ein wichtiger Berater. Vielleicht hatte zu diesem Zeitpunkt Scheherazade bereits zu stark von ihm Besitz ergriffen. Wie lange die Idee einer Vertonung durch seinen Kopf geisterte, wissen wir nicht. Doch dass RimskijKorsakow schon weit vor der Komposition seiner „Symphonischen Suite nach 1001 Nacht“ im Jahr 1888 eine regelrechte Passion für den Stoff entwickelt hatte, ist durch eigene Aussagen belegt. Nacht für Nacht, so möchte man es sich vorstellen, besuchte ihn die berühmte Märchenerzählerin, bis er endlich damit begann, sein späteres Opus Magnum zu schreiben. Die damals in Russland verbreitete Orientmode muss ihr Übriges dazu beigetragen haben, eine musikalische Annäherung zu wagen. Die unendliche Geschichte Orientalismen sucht man in der Musik allerdings vergeblich. Und auch sonst geht Rimskij-Korsakow in seiner Komposition sehr frei mit der literarischen Vorlage um. In seiner Vorstellung müssen die Märchen zu einem ganz individuellen Kaleidoskop verschwommen sein. Denn die allzu konkrete Verquickung bestimmter Tonfolgen mit einzelnen Episoden oder Charakteren seitens des Publikums lösten bei ihm solches Unbehagen aus, dass er selbst die vagen Quellenverweise in den Satzbezeichnungen noch vor Veröffentlichung der Partitur wieder zurückzog. Eine Maßnahme, die wenig später auch Richard Strauss in seinen Tondichtungen zuweilen zupasskam. Seite 2|3 Musikfreunde | Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Mai/Juni 2017 Hierbei offenbart sich ein Phänomen, das gerade beim Erzählen in Musik besonders zum Tragen kommt. Im Gegensatz zu Michelangelos David sind Klänge keineswegs in Stein gemeißelt. Töne erweisen sich auch als weitaus flexibler als Worte und eröffnen so einen schier endlosen Horizont an Lesarten und Deutungsmöglichkeiten. Bei jedem Konzert wird daher wieder neu erzählt. Von einem anderen Orchester, einem anderen Dirigenten und vor einem anderen Publikum. Und nie geht die Geschichte gleich aus. Florian Zeuner MMag. Florian Zeuner ist Musikwissenschaftler sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaftler. Beruflich widmet er sich den vielfältigen Formen der Konzertdramaturgie. Seite 3|3