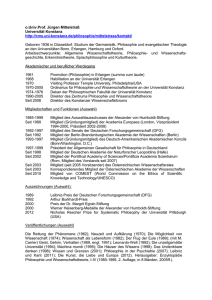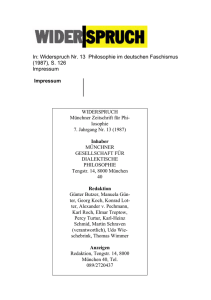Skriptum
Werbung

Theologische Kurse der ED Wien PD Dr. Hans Gerald Hödl Christliche Philosophie. Ergänzungen zum Skriptum. 1. Was ist Philosophie? 1.1. Vorbemerkung In diesem Kurs werden Sie in philosophisches Denken eingeführt. Es geht dabei weniger darum, die ganze Bandbreite der Philosophie kennen zu lernen (was in einem Semester nicht geschehen kann), sondern in grundlegende Fragestellungen einzuführen. Der Kurs ist so aufgebaut, dass vor allem in die Geschichte der abendländischen Religionsphilosophie, bes. philosophische Gotteslehre, eingeführt wird. Wichtig ist es dabei, Argumentationen zu verstehen, d.h. sie nachvollziehen zu können. Das ist in der Regel nicht einfach; manches von dem, was Sie am Anfang des Kurses hören, erschließt sich in seiner Bedeutung erst am Ende des Kurses. Wenn es ein Trost ist: auch der akademisch ausgebildeten PhilosophIn geht es nicht besser. Oft gelangt er/sie erst Jahre nach erfolgreich abgelegter Prüfung über ein Sachgebiet zu einem angemessenen Verständnis. Weiters ist es ein Unterschied, ob Sie einen Gedankengang verstanden haben oder ob Sie ihn in eigenen Worten wiedergeben können. Lassen Sie sich aber nicht entmutigen und vor allem: haben Sie den Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen resp. fragen Sie, wenn Sie irgend etwas (und sei es nur ein Wort) nicht verstehen, nach. Der Vortragende muss die Wörter, die er gebraucht, erläutern können. Das ist schließlich sein Job. 1.2. Wort- und Sachdefinition Man unterscheidet hinsichtlich der Definition eines Gegenstandes traditionell zwischen einer Sach- und einer Wortdefinition. Die Wortdefinition sucht den ursprünglichen Sinn des Wortes etymologisch zu erläutern. Im Falle von „Philosophie“ ist das einfach: das Wort „Philosophie“ stammt aus der altgriechischen Sprache und bedeutet der Wortdefinition nach soviel wie „Liebe zur Weisheit“. Das bedeutet, dass der Philosoph/die Philosophin nach Weisheit sucht, dass dies eine grundlegende Lebenseinstellung bedeutet und dass, wie es bei antiken Philosophenschulen der Fall war, die Weisheit als dasjenige erkannt wird, das im Leben erstrebenswert ist, dasjenige, worauf (etwa statt Reichtum, sinnliche Genüsse usw.) man im Leben baut. Dies verdeutlicht die Anekdote vom Schiffbruch des Philosophen, auf die der Spruch „sapiens omnia sua secum portat“ (der Weise trägt alles Seine mit sich) zurück geht. Demnach kann der Philosoph, der aus einem Schiffbruch errettet wird, sofort wieder – ohne Verlust an Gütern – sein gewohntes Leben fortführen, denn sein ganzer Besitz besteht eben in der Weisheit. Die Sachdefinition, also die Bestimmung des Gegenstandes der Philosophie von der darin verhandelten Sache her, ist in der Geschichte des philosophischen Denkens auf sehr unterschiedliche Weise getroffen worden. In der Regel gibt eine Sachdefinition die Gattung an und den „spezifischen Unterschied“ (differentia specifica); etwa: „Logik ist diejenige Wissenschaft, die sich mit dem richtigen Schlußfolgern Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 1 beschäftigt“. Man kann auch hier wiederum zwei grundlegende Verfahrensweisen angeben: man gibt eine sachliche Definition aus einem bestimmten Verständnis dessen heraus, was Philosophie ist. Das entspricht in der Regel der Stellungnahme für eine bestimmte philosophische Tradition. Oder man gibt eine geschichtliche Erklärung über die Entwicklung des Philosophiebegriffes. Das kommt einer Einführung in die Geschichte der Philosophie gleich, die man nur in einem mehrsemestrigen Kurs geben könnte. Die folgenden Bemerkungen gehen zunächst auf den Ursprung der Philosophie in Griechenland ein und sodann auf einige historisch bedeutsame Bestimmungen dessen, was Philosophie ist. 1.3. Philosophie & Theologie Warum nun wird im Rahmen der „Theologischen Kurse“ eine Einführung in die Philosophie angeboten? Darauf kann man mehrere Antworten geben: • In der Spätantike hat das entstehende Christentum verschiedene philosophische Lehren vorgefunden, die, wie die christliche Religion, eine Aussage über den Gesamtzusammenhang der Welt resp. eine „Anleitung zum richtigen Leben“ angeboten haben. Einerseits haben sich die frühen Kirchenlehrer davon abgegrenzt, andererseits auch Vieles aufgenommen. • Die klassische Theologie des Abendlandes ruht auf philosophischen Voraussetzung. Theologie ist der Versuch, den Glauben rational zu durchdringen und darzulegen. Dazu ist in der Geschichte der Theologie stets auf Philosophie zurückgegriffen worden, etwa in der Hochscholastik auf die Schriften von Aristoteles. • Neben dem, was uns die Offenbarung über Gott sagt, gibt es auch (mehrere) Traditionen der „philosophischen Theologie“ (nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam und im Judentum, und philosophische Schulen gibt es nicht nur innerhalb der monotheistischen Religionen, sondern etwa auch in den Hindu-Religionen oder im Buddhismus). Es handelt sich also darum, ob man etwas und was man von Gott mit der „natürlichen Vernunft“ erkennen und sagen kann. Die katholische Kirche lehrt ausdrücklich, dass man das Dasein Gottes mit der natürlichen Vernunft erkennen kann. • Man kann zwischen Einzel- und Universalwissenschaften unterscheiden. Eine Wissenschaft ist dann etabliert, wenn sie ihren Gegenstand gefunden hat und die Methodik, mit der jener Gegenstand untersucht wird. Soziologie etwa untersucht das Gemeinschaftsleben (resp. die Formen dessselben) der Menschen (die menschlichen Sozietäten) und bedient sich dazu der Methoden der quantitativen und der qualitativen Sozialforschung. Der Gegenstand der Theologie und der Philosophie ist aber nicht ein Ausschnitt der Wirklichkeit, sondern das Ganze des Daseins hinsichtlich seines letzten Grundes. Sie sind beide Universalwissenschaften, die Aussagen über das Ganze der Welt machen. Woher kommt die Welt? Hat das menschliche Dasein ein Bedeutung über die unmittelbaren Lebensvollzüge hinaus? Gibt es ein Ziel der Welt? Theologie sucht diese und ähnliche Fragen aus der Offenbarung (unter Berufung auf eine letzte 2Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte Autorität) zu beantworten. Die Philosophie will die Antwort „rein aus der Kraft der Vernunft“, ohne Autoritätsargumente geben. • Philosophie und Theologie gehen also über das „Innerweltliche“ hinaus. Sie stellen Fragen, die über unsere alltäglichen Beschäftigungen hinausgehend auf das Ganze des Daseins zielen. Sie transzendieren also unsere Lebenswelt. 1.4. Exkurs. Zum Begriff der Transzendenz In der Alltagssprache werden die Worte „transzendent“ und „transzendental“ oft synonym (gleiches bedeutend) gebraucht. In der Philosophie wird terminologisch zwischen den beiden Worten unterschieden. Dabei ist die Bedeutung auch in unterschiedlichen philosophischen Traditionen verschieden: „Transzendent“ bezeichnet den Gegensatz zu „immanent“. IMMANENT ist dasjenige, was sich in unserer unmittelbaren Erfahrungswelt abspielt. TRANSZENDENT ist dasjenige, was darüber hinaus liegt. Das muss nicht gleich eine „jenseitige Welt“ sein. Der Religionssoziologie Thomas Luckmann etwa unterscheidet (auf der Grundlage des Transzendenzbegriffes der sog. phänomenologischen Philosophie) zwischen drei Formen der Transzendenz. • „Kleine Transzendenz“: Menschen können sich aus dem unmittelbaren „Bewusstseinstrom“ „ausklinken“ und auf räumlich oder zeitlich nicht Gegenwärtiges beziehen. Darauf beruht unser Gedächtnis, unsere Fähigkeit, voraus zu planen usw. • „Mittlere Transzendenz“: wir können unsere mentale Einstellung aber auch aus unseren unmittelbaren Beschäftigungen abziehen, um uns auf einen anderen Menschen zu beziehen, dessen Sorgen und Nöte, Freuden, Wünsche usw. verstehen und teilen, also am Leben eines anderen Menschen „teilnehmen“. • „Große Transzendenz“: darunter versteht Luckmann die letzten Fragen des Menschen, wie nach dem Woher und Wohin der Welt, die Fähigkeit, das Ganze hinsichtlich seines letzten Grundes in Frage zu stellen. Dies ist die klassische Domäne der Religionen, aber auch der Philosophie. Der Begriff „transzendental“ beruht auf dieser Grundbedeutung des „Transzendierens“ (über etwas hianusgehen), bezeichnet aber einen bestimmten Sinn dieses „Überschreitens“. In der scholastischen Philosophie ist damit der Hinblick auf das Seiende als Seiendes gemeint. Die allgemeinste Bestimmung von allem, was ist, ist eben, dass es ist. Darin kommen alle Gegenstände der innerweltlichen Erfahrung überein (die genauere Bestimmung dieser Sachlage ist eine der grundlegenden Fragen der Philosophiegeschichte). Nun kann man sich fragen, was denn über ein Seiendes ausgesagt werden kann, nur hinsichtlich seines Seins. Damit überschreitet man die einzelnen Bestimmungen auf ein Allgemeines hin. Die Transzendentalien in der scholastischen Philosophie sind dann etwa das Eine, Gute, das Wahre, das Schöne: insofern es ist, so, wie es von seinem Ursprung her gedacht ist, ist jedes Seiende gut, wahr, schön, eines usw. Dies beruht wiederum auf Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 3 Grundlehren der klassischen griechischen Philosophie, die wir in diesem Kurs in Grundzügen kennen lernen. Immanuel Kant benutzt den Ausdruck „transzendental“ für eine bestimmte Art der philosophischen Fragestellung resp. Erkenntnis. Wir werden das noch genauer betrachten. Jedenfalls unterscheidet Kant zwischen der Erkenntnis von Gegenständen und der Erkenntnis dessen, was Gegenstandserkenntnis erst ermöglicht, also einer Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Erkennens. Letzteres nennt er eine „transzendentale“ Untersuchung, deren Gegenstand nicht die Objekte unserer Erfahrungswelt, sondern, so Kant „die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis“ sind. 2. Antike grieschische Philosophie 2.1. Die „Vorsokratiker“ In der langen Tradition des philosophischen Denkens gelten gemeinhin als die ersten Philosophen die sogenannten „Vorsokratiker“, die frühen griechischen Denker, etwa Thales von Milet (um 600 v. Chr.), Anaximander (ca. 611-546), Anaximenes (gilt als Schüler des Anaximander), die Pythagoreer (Pythagoras v. Samos *570/60) Parmenides (ca. 500 v. chr., Gründer der. sog. „elatischen Schule“, der „Eleaten“, von dem Ort Elea in Unteritalien) und Heraklit v. Ephesus (um 470 v. Chr.). Als die grundlegende Fragestellung der frühen griechischen Denker begreift man die Frage nach der „arché“ (nach dem Anfang als Eröffnung eines Ganzen; somit auch Herrschaft, als Prinzip - man kann im Deutschen den so verstandenen „Anfang“ vom „Beginn“ als dem ersten Moment in einer Abfolge terminologisch unterscheiden). • Thales findet die arché im Wasser, das er als den Ursprung von allem bestimmt; die bestimmende Frage für ihn ist das Woher?, das Entstehen. • Anaximander sieht die arché im apeiron: „das Unbegrenzte“: „Von woraus aber das Seiende das Entstehen hat, ebendorthin geschieht auch sein Vergehen“; Er fragt somit nach dem Woher und Wohin, nach Entstehen und Vergehen. • Für Anaximenes ist das bleibende Element die Luft: „wie unsere Seele (psyche), welche Luft ist, uns zusammenhält, so umgreifen Hauch und Luft (pneuma und aer) die ganze Welt (Kosmos). Seine Frage geht auf das Worin von Entstehen und Vergehen. • Parmenides entfaltet in seinem berühmten Lehrgedicht die Lehre von den drei Wegen des Erkennens: 1. Sein ist und Nichtsein ist nicht (was ist, zeigt sich dem Menschen). 2. Es gibt kein Sein (alles ist vergänglich, im Grunde ist Nichts: Skeptizismus) 3. Sein und Nichtsein ist dasselbe und nicht dasselbe (alltägliche Haltung der meisten Menschen: a) Leben und Tod unterschieden; b) ans eigene Sein klammern, Vergänglichkeit beklagen) Im Ausgang von dieser „elatischen Seinslehre“, die von der Betonung des „Seins“ her Werden als „Nichtsein“ auffasst, Sein und Werden also strikt entgegensetzt und von daher Entstehen, Vergehen und 4Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte Bewegung als bloße Täuschung, als nicht-seiend ansieht, formuliert Zenon von Elea seine berühmten Paradoxien, die die Bewegung leugnen: Achill und die Schildkröte: „Das Langsamste wird in seinem Lauf nie vom schnellsten eingeholt werden. Denn es ist notwendig, dass das Verfolgende vorher dort ankommt, wo das Fliehende eben weggegangen ist, so dass notwendig das Langsamste immer wieder einen gewissen Vorsprung hat.“ Der Pfeil: „... dass der sich bewegende Pfeil still steht ... folgt aus der Annahme, die Zeit bestehe aus „Jetzten“ [in denen jeweils der Pfeil ruht]...“ • Im Gegensatz zu den Eleaten betont Heraklit v. Ephesus den Werdecharakter, das Veränderliche allen Seins: „alles fließt“, die Differenz wird betont, so in der Beobachtung, das die Identität von Seienden streng genommen nur im Wandel besteht: „In die gleichen Ströme steigen wir und steigen wir nicht; wir sind es und sind es nicht“. Ebenso das oft mißverständlich zitierte Wort, dass der Kampf (oder: Krieg: polemos), der Vater aller Dinge sei, die eben in ständig wechselnden Relationen bestehen. Oberflächlich betrachtet herrscht hier ein kontradikatorischer Gegensatz zu Parmenides, der die Einheit des Seins betont. Aber man muß sehen, dass bei Heraklit gerade auch die Einheit im Aufgehen und Untergehen betont wird. • Für die Pythagoreer, über die wenig historisch Gesichertes bekannt ist, bildet die Zahl, die sie als Wesenheit hypostasieren, nachdem sie die Beobachtung gemacht haben, dass sich alle Verhältnisse als Zahlenverhältnisse auffassen lassen, sowohl das Urbild aller Dinge, als auch das letzte Element allen Seins. Zu den Pythagoreern vgl. auch unten, ** Heute beschränkt man allerdings philosophisches Denken nicht mehr auf das Abendland allein. Man spricht von indischer oder chinesischer Philosophie, es gibt eine Diskussion darum, ob afrikanische Weisheitslehren als Philosophie bezeichnet werden, auch ein direkter altägyptischer Einfluß auf die Anfänge der Philosophie wird diskutiert. Jedenfalls ist die griechische Philosophie nicht ohne ihr Verhältnis zum griechischen Mythos (Homer: Ilias, Odyssee; Hesiod: „Theogonie“, 8. Jahrhundert v. Chr.) zu denken, in denen Vorstellungen vom Werden der Welt (Kosmologie) und der Götter („Theogonie“) ausgedrückt sind. Im 7./6. Jahrhundert, in der sogenannten „Orphik“ findet sich eine Hinwendung zur Frage nach dem Schicksal der Seele des Menschen nach dem Tod. Die Idee einer vom Körper abtrennbaren Seele, in der platonischen Philosophie von zentraler Bedeutung, kommt erst in dieser Zeit auf (bei Homer ist das Schicksal der Menschen nach dem Tod das Leben in einer Schattenwelt; vgl. Odyssee: Schilderung von Odysseus` Abstieg in die Unterwelt). 2.2. Grundprobleme philosophischen Denkens In den Fragestellungen der frühen griechischen Philosophen zeigen sich aber bereits die Grundprobleme und die Eigenart philosophischen Denkens. Es wird nach dem gefragt, was eigentlich ist , nach dem, was Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 5 das, was ist – das Seiende – bloß daraufhin betrachtet, dass es ist, ist – es wird nach dem Sein des Seienden gefragt, nach dem Seienden in seinem Sein. Wie kann es erkannt werden, welche Erkenntnis verbürgt Gewißheit, was ist von daher der richtige Lebensentwurf, die richtige Art zu leben: wie können wir entsprechend demjenigen, was ist, oder entsprechend der Art, in der wir Sein erfahren, unser Leben gestalten? • Kant hat diese Fragen später als die vier Fragen zusammengefaßt: was kann ich wissen? / was soll ich tun? / was darf ich hoffen? / Was ist der Mensch? Lt. Kant ist also der letzte Bezugspunkt der Mensch in seinem Sein, als dasjenige Wesen, dem das Seiende in seinem Sein zur Frage wird. Mit Heidegger kann man den Menschen als das Wesen bezeichnen, dem es in seinem Sein um sein Sein selbst geht • In der Philosophie geht es also um das Sein des Ganze, um das Ganze des Seines, aber auch um die letzten Fragen der menschlichen Existenz. Die Wege des Erkennens bei Parmenides sind nicht bloß Wege des theoretischen Erkennens, die mit meinem Leben nichts zu tun haben, sondern Wege im Sinne einer existentiellen Entscheidung. Der Philosoph stellt aber auch Fragen, die sich von der alltäglichen Einstellung den Dingen gegenüber scharf abheben. Die Frage, die auf das Ganze geht, bringt auch radikalen Zweifel mit sich. • Die alte Definition der Philosophie, sie sei „rationem reddere“, Rechenschaft ablegen, geht darauf, dass man, anders als zumeist im alltäglichen Leben, man begründen kann, warum man handelt, wie man handelt, und diese Begründung geht auch mit einer radikalen Infragestellung des normalen Meinens und Dafürhaltens einher.. • Den radikalen Zweifel kann ich nun einerseits als strategisches Mittel einsetzen, um das, was ihm standhält, das was Begründbarkeit liefert, zu erreichen. darin liegt aber ein sozusagen optimistischer Glaube an die Kraft der Vernunft, an ihre Abbildungsfunktion, das mit ihr die Dinge, so wie sie sind, erkannt werden, die rationalistische Einstellung. Der radikale Zweifel kann aber auch die vorrationalen, „unvernünftigen“ Bedingungen der Vernunft aufdecken, die sich stets schon in einem sprachlich, kulturell, biologisch, durch die sinnliche Organisation des Menschen bedingten und geprägten Raum entwickelt, solcherart auf „vorrationalen“ Bedingungen aufruht. • Die radikale Frage:, die die Philosophie stellt, ist auch als die Frage: „Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“ bezeichnet worden (prominent bei Friedrich W. J. Schelling und Martin Heidegger). • Positiv gewendet kann man darin den Ursprung der Philosophie aus dem Staunen erblicken: das „Wunder des Seins“ wird in den Blick genommen. • Es stellt sich dann freilich die Frage, worin alle diese Definitionen übereinstimmen? Es wird nach dem Grund gefragt, der anfänglich alles bestimmt, und es wird nicht nach einem einzelnen Bereich gefragt, sondern das Ganze des (menschlichen) Seins wird in Frage gestellt. Wie zeigt sich dem Menschen das 6Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte „Sein“? Philosophie ist also eine Universalwissenschaft. (woe oben bereits ausgeführt). Sie fragt nach dem Ganzen hinsichtlich seines letzten Grundes (eine Antwort auf dies Frage beanspruchen auch die Religionen zu geben, aber nicht aus kritischer Reflexion, sondern aus autoritativ vermittelter Einsicht („Glaube“, „Überlieferung“, „Erleuchtung“, „Offenbarung“). • Wichtig für die antiken Philosophenschulen ist auch, dass es sich nicht nur um ein theoretisches Wissen, sondern um Anleitung zum richtigen Leben handelt. Vgl. die Anekdote vom „Schiffbruch des Philosophen“ – der Philosoph ist für die Wechselfälle des Lebens gerüstet, denn er hat alles, was er braucht – sein Wissen – bei sich. Wenn er also aus dem Schiffbruch nur sein nacktes Leben rettet, hat er nichts von seinem Hab und Gut verloren. Dies wird in dem Merksatz: sapiens omnia sua secum portat ausgedrückt. 2.3. Klassische griechische Philosophie. 2.3.1. Allgemeine Würdigung, Kontext innerhalb der antiken Philosophiegeschichte In der antiken griechischen Philosophie gab es eine große Menge an verschiedenen Strömungen: etwa die antiken Materialisten (Epikur, Demokrit, Lukrez), die Sophisten (etwa Protagoras, Gorgias u.a), die Stoa (die auf Zenon von Kition zurückgeht), die Kyniker, die Skeptiker (sehr verschiedene Schulen). Sie haben viele der klassischen Problemstellungen der Philosophie ausgearbeitet, kontrovers diskutiert und bedeutende Beiträge zu den einzelnen philosphischen Disziplinen geleistet. In diesem Kurs wird Ihnen eine Einführung in die sogenannte klassische athenische Philosophie (Sokrates, Platon, Aristoteles) gegeben. Während wir über manche griechische Philosophenschulen nur sehr ungenügend aus Darstellungen etwa in den Werken Ciceros, beim spätantiken Philosophiegeschichtsschreiber Diogenes Laertius oder über Zitate in der Literatur der Kirchenväter infomiert sind, sind uns die Werke von Platon und Aristoteles sehr gut und umfassend überliefert. Die Einteilung der Philosophie von Aristoteles hat bis heute die klassischen Disziplinen der Philosophie bestimmt. Deshalb wird über die Einteilung der philosophischen Disziplinen auch bei der Behandlung der Grundzüge von Aristoteles‘ Philosophie gesprochen. Weiters sind sie für die Ausbildung der abendländischen Religionsphilosophie von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Sie waren Theisten und schufen die gedanklichen und methodischen Grundlagen für die philosophische wie theologische Gotteslehre des Abendlands. Insbesondere stellten sie in der Lehre von den (metaphysischen) Eigenschaften der Gottheit die Kriterien für wahre Göttlichkeit auf: Einheit, Gutsein, Unveränderlichkeit, Ewigkeit etc. - Gegenüber der griechischen Volksreligion und ihren literarischen Ausprägungen bei Homer, Hesiod und den Tragikern verhielten sie sich kritisch. Insbesondere Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 7 wurden der naive physische Anthropomorphismus [„Menschengestaltigkeit“: aus anthropos (Mensch) und morphé (Form)] der griechischen Götter und deren Unmoral seit Xenophanes entschieden verworfen. Als Ihre Vorläufer kann man ansehen: • Xenophanes (~570 - ~470), der früher zu der sogenannten Schule der eleatischen Philosophen gerechnet worden ist, was man heute nicht mehr tut. Man kann ihn als frühen Vertreter des sogenannten „Anthropomorphismusargumentes“ in der Religionskritik ansehen, da er gelehrt hat, dass nicht die Götter die Menschen geschaffen hätten, sondern die Menschen die Götter. So lautete eines der von ihm überlieferten Fragmente: „Doch wenn die Ochsen [und Rosse] und Löwen Hände hätten oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse roßähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden, wie [jede Art] gerade selbst das Aussehen hätte“ • Parmenides von Elea (um 500; s.a.o.), der Gründer der sogen. „eleatischen Schule“, der eine monistische Seinslehre vertritt, derzufolge die Welt der Veränderung Schein ist und in Wirklichkeit nur das Eine (das „Sein“) existiert. Er greift den Polytheismus an. Die platonische Ideenlehre kann als ein Versuch, die Probleme, die seine Lehre von der Einheit des Seins aufwirft, zu lösen. • Anaxagoras (499-428), der als Weltgrund den nous, einen unpersönlichen Geist, dachte. Er wurde der „asebeia“ (Unfrömmigkeit) angeklagt. Die Pythagoreer: • Die griechische Philosophenschule der Pythagoreer geht auf Pythagoras von Samos zurück, der um 530 v. Chr. in Kalabrien eine Philosophenschule gegründet hatte. Das pythagoreische System geht aber erst auf die Schüler des Pythagoras, wie Metapont oder Philolaos von Kroton um 470 zurück. Die Wirkungsgeschichte des legendenumwobenen Begründers des pythagoreischen Denkens von Antike bis zur Renaissance steht in einem Mißverhältnis zu dem wenigen, was sich historisch gesichert über ihn sagen läßt. Es gibt Philosophiehistoriker, die meinen, dass die wahre Lehre des Pythagoras nicht rekonstruierbar sei, dieser aber hat im Abendland bis zur Wiederentdeckung des Aristoteles im Hochmittelalter als der bedeutendste griechische Philosoph neben Platon gegolten. Nach Diogenes Laertius hat er sogar den Namen „Philosophie“ geprägt. • Besonders in der gnostisch-esoterischen Tradition des westlichen Denkens hat der Pythagoreismus seine Spuren hinterlassen. Er wurde zu der in dieser Tradition postulierten philosophia perennis gerechnet, Pythagoras galt neben Hermes Trismegistos, Moses und Platon als einer der großen Eingeweihten in die Geheimnisse des Universums. • Die Pythagoreer gingen von einer apriorischen Erkenntnistheorie aus. Das heißt, die als unsterblich gedachte Seele bringt bereits die Prinzipien der Erkenntnis der Welt mit. Damit gaben sie der Mathematik und dem reinen Denken den Vorzug vor der Empirie. Dazu kam ein religiöser Charakter 8Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte der Philosophenschule, die wie eine Art Orden organisiert war, in dem neben wissenschaftlichen und politischen Interessen auch der religiösen Vervollkommnung der Mitglieder, mit dem Ziel, zu einem ausgeglichenen Verhältnis des Individuums zum Kosmos zu gelangen, Raum gegeben wurde. Über die sogenannte Orphik, den religiösen Lehren im Umkreis der mythischen Gestalt des Orpheus, dürfte ihnen die wohl aus dem Osten stammende Seelenwanderungslehre übermittelt worden sein. Die Lehren der Pythagoreer sind nämlich nur als Fragmente oder aus Darstellungen in den Schriften anderer Philosophen, etwa Plato und Aristoteles, überliefert oder in philosophiegeschichtlichen Darstellungen wie bei Diogenes Laertius, dem spätantiken Kompilator philosophiegeschichtlicher Werke („De vitis, dogmatibus et apophtegmatibus eorum qui in philosophia claruerunt“ 3. Jh. n. Chr). Der systematischphilosophische Gehalt des Wiedergeburtsgedankens und dessen religiöse Bedeutsamkeit, wie er in den Standarddarstellungen des Pythagoreismus erläutert wird, die die enge Verbundenheit dieser Lehre mit der Vorstellung einer Läuterung betonen, wird von manchen Autoren in Zweifel gezogen. So hat etwa Erwin Rohde in seiner heute noch als Standardwerk geltenden Studie zum Seelenbegriff im antiken Griechenland „Psyche“ die pythagoreische Seelenlehre als Wiedergabe „alter volkstümlicher Psychologie, in der Steigerung und umgestaltenden Ausführung, die sie durch die Theologen und Reinigungspriester, zuletzt durch die Orphiker erfahren hatte“, bezeichnet. • Die pythagoreische Seelenlehre ist aber, wie die pythagoreische Elementenlehre, für die platonische Philosophie bedeutsam geworden, deren Einfluß auf das abendländische Denken kaum überschätzt werden kann.. • Neben der Seelenlehre ist die Mathematik als alles ordnendes Gesetz des Kosmos die zentrale Obsession pythagoreischen Denkens. Die Zahl wird als Grundlage des Universums angesehen. Man spricht gemeinhin von pythagoreischer Zahlenmystik, die auf den Zahlenanalysen der Pythagoreer aufbaut. Einerseits beschäftigten sie sich mit der graphischen Darstellung von Zahlenreihen, die die geometrischen Figuren aus sich hervorgehen lassen: Reihen von natürlichen Zahlen ergeben demnach Dreiecke. • Besondere Faszination übte das gleichseitige Dreieck auf die Pythagoreer aus, das sich mit dieser Methode als Summe der harmonischen Bruchzahlen 1,2,3,4, darstellen ließ. Die Pythagoreer hatten nämlich entdeckt, dass sich die Intervalle als Zahlenverhältnisse darstellen ließen; teilt man eine Saite im Verhältnis 1:2, erhält man eine Oktave (diapason), bei 2:3 eine Quint (diapente) und bei 3:4 eine Quart (diatessaron). Die Musik spielte für die Pythagoreer auch eine bedeutende Rolle in der Läuterung der Seele – katharsis –, es wurde ihr also eine reinigende Funktion zugesprochen. Die Proportionen, die die Pythagoreer aus Ihren arithmetischen und geometrischen Analysen errechneten, spielten in der griechischen Baukunst und in der bildenden Kunst eine große Rolle. Besonders bedeutsam war der goldene Schnitt, das Verhältnis von 1: 0,618. Weiters geht das Quadrivium, ein Teil der septem artes Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 9 liberales, des Bildungssystems bis ins Mittelalter, auf die Pythagoreer zurück. Das Trivium bestand aus Logik, Grammatik und Rhetorik, das Quadrivium aus Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie. Dem pythagoreischen Weltbild zufolge hatte der Kosmos die Form von Sphären, die um ein Zentrum göttlichen Feuers angeordnet sind. Die Planeten (und ganz aussen die Fixsternsphäre) kreisen auf vollkommenen Bahnen um dieses Zentrum, und die Verhältnisse dieser Bahnen entsprechen wiederum musikalischen Proportionen, woher der Ausdruck „Sphärenmusik“ stammt. Diese Konzeption war noch von Einfluß auf Kepler und Newton. 2.3.2. Platons Ideenlehre Platon (427-347) war Schüler des Sokrates. Er wandte sich gegen die Sophisten und Rhetorik. Die Ideenlehre gehört der dritten Periode von Platos Werk an. Gründer der „Akademie“ in Athen (etwa 387; der Name stammt vom Heros Akademos, dem das Grundstück geweiht war, auf dem diese, noch unseren höheren Schulen den Namen gebende Schule gegründet wurde). Sokrates, Plato, Aristoteles sind die drei großen Gestalten der klassischen athenischen Philosophie, die eine Reaktion gegen Skeptizismus, Sophismus und Materialismus (Demokrit, Epikur: „Atomismus“) darstellt. Sokrates, der selbst nichts geschrieben hat, ist uns bekannt aus den platonischen Dialogen (Platos Werke haben immer die Gestalt eines Dialoges, einer Unterredung. Die Argumentation wird nicht in einer diskursiven Abhandlung dargelegt, sondern in der Form von Gesprächen, in denen eine „dialektische“ Entwicklung des Gedankens vorgetragen wird). Man spricht mitunter auch vom „platonischen Sokrates“, und setzt diesen dem Sokratesbild, das uns die zweite Hauptquelle über Sokrates bietet, entgegen. Dies sind die „Memorabilia Socratis“ (Erinnerungen an Sokrates) des griechischen Geschichtsschreibers Xenophon. Bei genauerer Lektüre wird man freilich feststellen, dass sich eine einheitliche Lehre aus den verschiedenen Dialogen Platons, die man in frühe, mittlere und späte einteilen kann, nicht unbedingt einfach erheben läßt, und dass Platon selbst die Einwände, die man gegen die Ideenlehre erheben kann, durchaus bewußt thematisiert hat (etwa im Dialog „Parmenides“). Das Wort „Idee“ stammt von dem Verb „idein“, „sehen“ und meint: das Geschaute. Um zu verstehen, worauf Plato mit dieser Konzeption eine Antwort findet, was durch die „Ideenlehre“ also erklärt werden soll, gehe man von der Frage aus, was in der Erkenntnis erkannt wird, was der Erkenntnis zugrundeliegt, woran ich einen Maßstab habe, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden? Die Antwort Platos liegt darin, dass die Einzeldinge, die wir gewissen Gattungen zuordnen, (Hund, Pferd, Tisch) alle eine zugrundeliegende Idee verwirklichen. Von diesen Ideen erzählt er in einer Art mythologischem Bericht, dass sie im Ideen–Himmel existierten, in einer hierarchischen Hinordnung auf eine höchste Idee, die idea idearum (Idee der Ideen), zu der sie im gleichen Verhältnis stehen wie die Einzeldinge zur Idee der Art, die Art zur Gattung usw. Die Menschen können diese Ideen nun deshalb erkennen, weil die Seele von gleicher Beschaffenheit ist wie diese, Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 10 es besteht eine Korrespondenz zwischen der Seele und den Ideen. Die Ideen sind nun das An–Sich—Seiende, die Materie, in der die Ideen verwirklicht werden, sind weniger „seiend“ (me on). Die menschliche Seele ist eine im Gefängnis des Körpers gefangene (soma-sema-Schema: soma: Leib; sema: Kerker). Die Seele, das Geistige im Menschen, hat früher einmal im Ideenhimmel existiert und dort die Ideen selbst angeschaut. Durch die Inkarnation der Seelen in einem Leib sind sie in die materielle Welt eingetreten, in der sie nur mehr Abbilder der Ideen, nicht mehr diese selbst, erkennen können. In der „Politeia“ („Der Staat“) hat Platon die Grundprinzipien der Ideenlehre in drei Gleichnissen, dem Sonnengleichnis, dem Liniengleichnis und dem Höhlengleichnis, verdeutlicht. (a) Das Sonnengleichnis: hier wird von der Anteilnahme (gr.: methexis) ausgegangen: das viele Einzelne hat an der einen Idee Anteil: das jeweils „Gute“, „Schöne“ usw. an dem Guten, Schönen, also das vielfältige Einzelne an dem Einen. Diese Identität in der Vielfalt ist die Idee. So wird etwa in der Aussage: „Sokrates ist ein Mensch“ das Anteilhaben des Sokrates am Menschsein ausgesagt und nicht die Identität von „Sokrates“ und „Mensch“. Der Ort der Methexis ist sozusagen die „Kopula“, die Seinsaussage, die das Subjekt (von dem etwas ausgesagt wird) mit dem Objekt (das von ihm ausgesagt, ob-jiziert wird) verbindet. Im Gleichnis verdeutlicht er dies am Gesichtssinn und der Sonne: nicht der erstere ist der Grund dafür, dass Dinge sichtbar sind, sondern letztere. Es wird zwar im Erkennen immer etwas als etwas erkannt. z.B. der Mensch als Mensch, was voraussetzt, das man weiß, was das ist, ein Mensch (die Idee kennt). Dass aber überhaupt etwas erkannt werden kann, setzt eine höchste Idee voraus, die Grundlage (Ursache) für die Erkennbarkeit ist wie die Sonne für die Sichtbarkeit. Wie also die Sonne ermöglicht, dass etwas gesehen werden kann, ermöglicht die oberste Idee, die Idee des Guten, die Erkenntnis der Ideen. Diese ist den anderen Ideen also auch nicht gleich, sondern liegt über deren Bereich (den Bereich des Seienden) hinaus. (b) Das Liniengleichnis: Im Liniengleichnis teilt Platon das in der Welt Erkennbare in den der Sinneswahrnehmung zugänglichen Bereich und den dem Denken zugänglichen Bereich, jeweils durch eine Linie (A, B) symbolisiert; diese teilt er wiederum in je zwei Bereiche (a1/a2; b1/b2) ein, durch eine Teilung der Linie symbolisiert. Diese Linien stehen in einem bestimmten proportionalen Verhältnis zueinander (die Buchstaben nicht bei Plato): A a1 : : a2 B b1 : b2 ------------------------ : ------------------------ : ------------------------ : -----------------------a1 verhält sich zu a2, wie b1 zu b2, und beides sich zueinander so wie A:B In diesem Verhältnis stehen das Sichtbare (A) zum Denkbaren (B), resp. Bilder zu Dingen, Zahlen zu Ideen. Wie sich Bilder zu Zahlen verhalten, so Dinge zu Ideen. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 11 Sichtbares (Horaton) Bilder Dinge Vermutung (Eikasia) Meinung (Pistis) Denkbares (Noeton) Zahlen Ideen Verstand (Dianoia) Vernunft (Noesis) Den verschiedenen Gegenstandsbereichen entsprechen nun verschiedene Stufen des Erkennens oder Erfahrungsmöglichkeiten in der Seele, (pathemata en te psyche): Vermutung, Meinung, Verstand, Vernunft. Diese stehen in dem gleichen Verhältnissen zueinander wie die ihnen zugeordneten Bereiche des Erkennbaren. (c) Höhlengleichnis: den Weg zur wahren Erkenntnis zeichnet Platon in seinem berühmten Höhlengleichnis nach, in dem er die Menschen als „Gefangene“ in einer Höhle darstellt. Das ist die normale Situation des Menschen. Gefesselt sitzen sie in der Höhle und können nur auf eine vor ihnen liegende Wand blicken, da die Fesseln weitere Bewegung unmöglich machen. Von weit entfernt gibt es einen Lichteinfall in die Höhle, der es erlaubt, diese Wand auszunehmen. Hinter den Gefesselten ist eine Mauer, an der Gegenstände hin und her getragen werden. Die Menschen sehen nun nicht diese Gegenstände selbst, sondern nur deren Schatten, die an die vor ihnen liegende Wand geworfen werden. Der Aufsteig zur wahren Erkenntnis, zur Erkenntnis der Ideen wird verglichen mit einer Befreiung von diesen Fesseln, einem Verlassen der Höhle und dem allmählichen Erkennen, dass die Sonne es ist, die die Jahreszeiten gibt und Ursache all dessen ist, was man sieht, selbst von dem, was die Gefangenen in der Höhle sehen. Das wäre aber ein mühsamer Prozeß, zunächst würde der Gefangene die in der Höhle gesehenen Schatten für realer halten als die Dinge, deren Schatten sie sind, im Freien müßte er sich erst langsam an das Sonnenlicht gewöhnen usw. Würde er in die Höhle zurückkehren, um die Gefangenen zu befreien, würden diese das nicht wollen, sondern versuchen, ihn zu töten. Das Anliegen des Gleichnisses: Erziehung/Paidea. Der Mensch soll von Grund auf gewandelt werden. In der Lehrveranstaltung wurde das mit der folgenden graphischen Darstellung erläutert, an der die metaphorische (gleichnishafte) Darstellung der Verhältnisse der Stufen der Erkenntnis zueinander deutlich ablesbar ist: Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 12 Platon unterscheidet in seiner Tugendlehre zwischen verschiedenen Seelenteilen, die er mit Tugenden und mit Aufgaben im Staat verbindet: Begehrend (epithymetikon) Besonnenheit (sophrosyne) „Nährstand“ mutartig (thymoeides) Tapferkeit (andreia) „Wehrstand“ Vernünftig (logistikos) Weisheit (sophia) „Lehrstand“ (Bauern, Handwerker) (Soldaten) Der Philosoph Als Herrscher Die übergreifende Tugend ist diejenige der Gerechtigkeit, damit sind die später so genannten vier „Kardinaltugenden“ benannt (von „cardina“, Türangel). 2.3.3. Grundbegriffe der Metaphysik des Aristoteles Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 13 Aristoteles ist um 384 in Stageira geboren (der „Stagirite“ ), Erzieher von Alexander dem Großen. Unterrichtet im Lykeion, einem außerhalb der Stadt gelegenen Bezirk Athens; daher „lyceum, lycée). Seine Schule ist als diejenige der Peripatetiker (vom Umhergehen, der Art, in der Aristoteles unterrichtet hat) bekannt. Aristoteles hat eine Vielzahl von Schriften verfaßt. Er teilt die Philosophie nach den grundlegenden Weltverhältnissen (theoretisch, handelnd, schaffend) des Menschen ein, in eine theoretische, eine praktische und poietische. Für unsere Zwecke ist v.a. die theoretische Philosophie von Bedeutung. a) theoretische Philosophie • Einführung in die Philosophie: das Organon (Instrument), die logischen Schriften, besteht aus den Büchern: • Über die Kategorien (die Lehre von den Gattungsbegriffen) • Peri hermeneias (über die Auslegung): die Lehre von Urteil und Satz • Die erste Analytik: über die Schlüsse in formaler Hinsicht • Die zweite Analytik: wie ist Wissenschaft möglich (Wissenschaftstheorie) • Die Topik: über Wahrscheinlichkeitsschlüsse • Sophistische Widerlegungen: über die Fangschlüsse der Sophisten Anm: Aristoteles kann als der eigentliche Begründer der Logik gelten, die bis ins 19. Jahrhundert auf den von ihm gelegten Grund gebaut wurde. Erst in der zweiten Hälfte des 19., Jhdts. und schließlich im 20 Jhtd. ging die Logik durch erfolgreiche Mathematisierung (Frege, Boole, Peirce, Russell, Whitehead, Wittgenstein,) wesentlich über das aristotelische Gerüst hinaus. Heute teilt man die Logik in Aussagenlogik (als Aussage wird eine einfache Tatsachenbehauptung aufgefaßt, der man zwei „Wahrheitswerte“ zuordnen kann), Prädikatenlogik (die Prädikate: Alle/mindestens ein: das Gebiet der Schlüsse, das früher von der sog. Syllogistik behandelt wurde und in die Modallogik ein (Modalitäten: Notwendig, Zufällig, Möglich, Wirklich). • Erste Philosophie: Metaphysik (später so genannt: die nach den Büchern der Physik eingeordneten Bücher; der Name stammt von Andronikos von Rhodos). Darunter ist die Lehre vom Seienden als Seiendem, resp. vom Sein, zu verstehen; Aristoteles lehnt die bisherigen Lehren vom Seienden ab • Die Auffassung des Parmenides, wonach das Seiende einfach ist, das Sein als Absolut-Eines gedacht wird, leugnet nach Aristoteles die Unterschiede, womit gerade das, was am deutlichsten das Wesen des Seins ausmacht, geleugnet werde. • Die gegenteilige Auffassung des Heraklit, der Werden und Vergehen als Grundcharakteristikum des Seienden ansehe, übersieht nach Aristoteles, dass der Begriff des Werdens den der Ruhe, der Begriff der Bewegung den des Unbewegten voraussetze. Schließlich sei Logik ohne den Begriff der Identität Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 14 unmöglich. • Gegen die Atomistik, die alles auf letzte unteilbare Stoffe (ein letztes Unteilbares) zurückführt, wendet er ein, dass (a) Atome etwas Ausgedehntes sind und alles Ausgedehnte weiter teilbar ist, (b) wenn Sein das unendlich Vielfache ist, die Grundstoffe unendlich vielfach seien und es damit keine Wissenschaft, keine faßbaren Qualitäten oder Modalitäten gäbe, (c) da die vielen Urstoffe zugleich die letzte Ursache sein sollen, wären sie letztlich eine identische Einheit. • Gegen die platonische Ideenlehre wendet er ein, dass (a) das Allgemeine kein An-Sich-Seiendes ist, (b) Die Teilhabe ein Bild sei, mit dieser Vorstellung ließe sich das Entstehen nicht erklären (dass das Einzelne an der Idee teilhat); die Forschung gehe von der Empirie aus, nicht vom Begriff, die Ideenlehre gehe somit vom Ende aus. Grundbegriffe von Aristoteles` Lehre vom Seienden: Sein wird nach Aristoteles vielfach ausgesagt, und zwar weder homonym noch synonym noch paronym, sondern analog (immer in bezug auf eines und eine einzige Natur): • homonym: zwei unterschiedliche, miteinander nicht übereinstimmende Dinge, die gleich benannt werden, etwa Ball/Ball, oder van (ungarisch: er/sie ist, es gibt; spanisch: sie gehen) • synonym: zwei Wörter, die dasselbe bedeuten: springen/hüpfen • paronym: ein Wort, das von einem anderen oder von der gleichen Wurzel abgeleitet wird: gerecht/Gerechtigkeit • analog: nach dem gleichen logos, d.h. die Bedeutung ist weder synonym (ident) noch homonym (gänzlich unterschieden), noch eine Ableitung von einem Zugrundeliegenden, sondern in der Übereinstimmung liegt auch eine Differenz (die berühmte Definition der Analogie, die das IV Laterankonzil 1215 in Hinsicht auf unsere „analoge“ Erkenntnis Gottes aufgestellt hat, lautet: bei größerer Ähnlichkeit auch größere Unähnlichkeit, d.h., je mehr wir von Gott wissen, umso mehr wissen wir, dass wir ihn nicht adäquat erkennen). Aristoteles geht von der Struktur der Aussage aus. Wenn wir eine Aussage machen, sagen wir immer etwas über etwas aus. Demzufolge unterscheidet er in der Katgeorienschrift zunächst zwischen dem, worüber etwas ausgesagt wird, und dem, was von etwas ausgesagt wird. Das, worüber etwas ausgesagt wird, nennt er das „Zugrundeliegende“ (Hypokeimenon, Subjekt), etwa „Pferd“ im Satz: „Das Pferd ist ein Säugetier“ oder „Dieses Pferd ist braun“. Das , was über das hypokeimenon (Zugrundeliegende, Substanz) ausgesagt wird, nennt er das Hinzutretende (symbebekos, Prädikat, Akzidens). In unserem Beispiel wären das die Ausdrücke „Säugetier“ oder „braun“. Wir sehen, das sind zwei unterschiedliche Arten, etwas auszusagen, im ersten Fall ein Gattungsbegriff, im zweiten Fall eine Eigenschaft. Aristoteles zufolge unterscheiden sich diese beiden Arten des Hinzutretenden oder des von etwas Ausgesagtem dadurch, dass es sich bei einer Eigenschaft um etwas handelt, was an oder in einem Zugrundeliegenden ist, Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 15 beim Gattungsbegriff jedoch um etwas, das nicht an/in dem Zugrundeliegenden ist. Eine Eigenschaft kann ja nicht absolut bestehen, sondern braucht immer einen Träger: wie etwa eine Farbe an sich nicht existiert, sondern nur farbige Gegenstände oder Eigenschaften wie Klugheit und Stärke nur an Lebewesen, die klug oder stark sind. Gattungsbegriffe sagen wir nun auch von Einzelwesen oder von ihren Unterarten aus, wir finden aber etwa nicht so etwas wie die „Pferdigkeit“, die an einem Pferd so wäre wie etwa die Eigenschaften „braun, flink, stark“ usw. Aristoteles zufolge existiert die Gattung nur in ihren einzelnen Exemplaren, nicht unabhängig von diesen, womit er den platonischen Ideenrealismus ablehnt. Gegen die sogenannten Nominalisten, die die Gattungsbegriffe für reine menschliche Konstruktionen halten, denen nichts in der Welt entspricht, wendet Aristoteles aber ein, dass die Gattungen wirklich existieren. Platon meint also, dass die Universalbegriffe vor den Dingen, unabhängig von ihnen, existieren (universalia ante rem) Den Nominalisten zufolge legen wir die Gattungsbegriffe den dingen bloß bei, sie entstehen also nach den Dingen in der Welt (universalia post rem) Der Standpunkt des Aristoteles könnte so umschrieben werden, dass die Universalbegriffe immer nur in den Individuen der Gattung verwirklicht sind (aber nicht so, dass sie „etwas“ an ihnen wären: universalia in re) Das, was nicht in einem Zugrundeliegenden ist, ist somit entweder das Zugrundeliegende selbst oder die Gattung. Das Zugrundeliegende selbst ist die sogenannte erste Substanz. Aristoteles geht also davon aus, dass jedes Ding in der Welt aus einer „ersten Substanz“ besteht, an der sich die Eigenschaften befinden, und dass diese „individuellen“ Substanzen eine „zweite Substanz“, ihre jeweilige Gattung, verwirklichen. Er unterscheidet also zunächst grundlegend Die Substanz (das, an dem etwas ist) von den Eigenschaften, die an ihm sind. Was man von etwas aussagt, nennt Aristoteles die Kategorien. Die erste Kategorie ist die Substanz, als weitere 9 Kategorien, die von der Substanz ausgesagt werden, nennt er: Qualität, Quantität, Relation, Ort, Zeit, Lage, Haben, Tun, Erleiden In der Metaphysik unterscheidet er folgende vier Hinsichten, in denen wir vom „Seinenden“ sprechen: • Seiendes im Sinne des Zufälligen, des Hinzutretenden • Seiendes im Sinne der Formen der Aussagen (etwas über etwas sagen: die Kategorien) • Seiend im Sinne von zutreffend/nicht zutreffend, wahr/falsch • Seiend im Sinne von Möglichkeit und Wirklichkeit, dynamis und energeia Das dem Begriff, der Erkenntnis und der Zeit nach erste ist dabei die ousia, das Wesen, die 1te Kategorie; sie kann in einem vierfachen Sinn aufgefaßt werden: 1. Die Essenz : to ti en enai: das was es war, zu sein (essentia seit Cicero, bei Thomas: quod quid erat esse) 2. Das Allgemeine: Katholou, das Universale Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 16 3. Gattung (genos) 4. Das Zugrundeliegende (hypokeimenon, subjectum) • Die arché, das Prinzip fasst Aristoteles im Gegensatz zu seinen Vorgängern vierfach auf. indem er 4 Ursachen unterscheidet: 1. Den Stoff (hyle, hypokeimenon; lat.: causa materialis; Materialursache); jedes Ding oder Lebewesen besteht aus bestimmten Elementen. 2. Der Form (eidos; Paradigma; Vorbild; lat.: causa formalis; Formalursache); wodurch eine Sache als die bestimmt ist, die sie ist, z.B. als Stuhl und nicht als Tisch. 3. Der Anfang/der Anlaß von Bewegung und Ruhe; (lat.: causa efficiens; Wirkursache). 4. Die Vollendung, das telos, das Weswegen, Woraufhin; (lat.: causa finalis; Zielursache). Gibt den Zweck des Geschehens an: Der Spaziergang um der Gesundheit willen, das Haus zum Wohnen etc. Stoff und Form stehen nun in der Beziehung des Möglichen zum Wirklichen. Möglichkeit (dynamis; lat.: potentia) und Wirklichkeit (energeia; lat.: actus). Jedes Geschehen läßt sich als Übergang von der Möglichkeit in die Wirklichkeit interpretieren. So ist die Eichel der Möglichkeit nach eine Eiche, aber nur unter gewissen Bedingungen (fruchtbarer Boden, der Keimling wird weder zertreten noch ausgerupft etc.) wird sie auch zur Eiche, verwirklicht diese Möglichkeit also. Die Eiche wiederum ist der Möglichkeit nach Brennholz, das Holz der Möglichkeit nach Asche. Bewegung in einem weiten Sinn (Übergang von einem Zustand in einen anderen) ist also immer als der Übergang von Möglichkeit in Wirklichkeit, von Potenz in Akt gedacht. Diese Grundprinzipien der aristotelischen Seinslehre bilden den theoretischen Hintergrund für die Philosophie von Thomas v. Aquin, so auch für seine „Gottesbeweise“. • Die Physik (zur theoretischen Philosophie gehört auch noch Mathematik) b) praktische Philosophie: Ethik c) poietische Philosophie: die „Poetik“ (nicht vollständig überliefert) Poietische Philosophie poiein: „herstellen“, v.a. Kunstwerke: nur 1 Buch überliefert, v.a. über die Tragödie). 3. Gott in der Spätantike: Neopythagoreer und Neuplatoniker 3.1. Der Neupythagoreismus ist eine philosophische Strömung, die sich ab dem ersten vorchristlichen Jahrhundert entwickelt hat. Vertreter der neupythagoreischen Philosophie sind etwa Nigidius Figulus (1. Jhdt v. Chr.) oder Apollonius von Tyana (1. Jh. n. Chr.). In ihr bilden sich die wesentlichen Elemente der spätantiken Mystik aus: Das Urgöttliche wird als der Welt völlig entrückt gedacht, die Beziehung zu ihm kann nur über einen Mittler hergestellt werden, die Gottesschau bedarf einer Entrückung, einer Ekstase, eines Heraustretens des Geistes Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 17 aus der körperlichen Welt. Die platonischen Ideen werden zu Gedanken des Demiurgen, sie haben nicht, wie bei Platon, ein Eigensein. In der christlichen Schöpfungslehre des Mittelalters werden in Anknüpfung an diese Position die Ideen als Gedanken Gottes aufgefaßt, von denen mittels des sogenannten „principum individuationis“ die Einzeldinge genommen werden. Drittens wird die Sphärenwelt mit allerhand Geistern und Kräften bevölkert. Dieser grundsätzliche Dualismus stellt das Problem der Erlösung, der Rückkehr zum Göttlichen aus der Trennung, der Überbrückung der Kluft zwischen Welt und Gott. 3.2. Die Lichtmetaphorik bei Plotin: das Schöne als Aufstiegshilfe der Seele zu Gott Der Neuplatoniker Plotin bietet dafür mit seiner Emanationslehre eine Lösung an. Auf dem Hintergrund dieser Lehre entwickelt er auch eine metaphysische Lehre vom Schönen („Ästhetik“), die über das Mittelalter bis in den Neoplatonismus der Renaissance von großem Einfluß gewesen ist. Plotin geht von der Konzeption der Gottheit als dem schlechthin Einen aus. Darin ist der Gedanke enthalten, dass das Transzendente, das der Vielfalt der Welt zugrundeliegt, über den Gegensätzen dieser Welt, als das ganz andere, stehen muss. Das wahrhaft Seiende Platons, das bei diesem schon als Einheit gedacht war, aber in der Ideenwelt doch auch wieder in einem vielgestaltigen, hierarchisch auf die höchste Idee hin geordneten gestuften Verhältnis von Einheiten- Ideen – gedacht war, wird streng als das absolute, in sich Eine gedacht. Das Absolute steht über allem, es ist die unbedingte Fülle des Seins, die nicht in sich selbst bleiben kann, weshalb sie in die Welt der Vielgestaltigkeit emaniert. Auch diesen Vorgang des Hervortretens des Einen in die Vielheit erklärt er mit einem Platon entlehnten Bild, wenn er die Emanation der Welt aus Gott mit dem Aussenden von Lichtstrahlen durch die Sonne vergleicht. Je weiter entfernt allerdings die Emanationen vom Ur-Einen, dem höchsten Prinzip und absolut Guten sind, desto weniger haben Sie an dessen Natur Anteil. So kommt es zu einer bipolaren Welt resp. zu einem Kosmos, der sich zwischen diesen beiden Polen auseinandergefaltet hat: auf der einen Seite das absolut Gute, das Eine, das Reine, das Vollkommene, auf der anderen Seite die ungeformte, chaotische Vielheit, das Böse, Schlechte, die Materie. Plotins System ist ein streng monistisches, also kann er den Gegensatz zum Göttlichen nur als die äußerste Entfernung vom Göttlichen, die Abwesenheit des Göttlichen denken. Einerseits ist nun die Welt durch die Emanation entstanden. Dieser gestufte Hervorgang geht von dem der Gottheit am nächsten liegenden Bereich, der Welt des Intelligiblen, der Weltseele, den Kosmos bis hinab zum Gegenpol, der als Finsternis, Lichtlosigkeit gedacht wird. Andererseits kann durch den Aufstieg über die gleichen Stufen, auf denen es zum Abstieg gekommen ist, Erlösung für die Seele erlangt werden. Der Mensch nimmt in dieser Welt insofern eine ausgezeichnete Position ein, als er einer Ekstase fähig ist, die ihn mit dem Ur-Einen verbindet. Diese Verbindung mit dem Ur-Einen nennt Plotin Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 18 henosis. Der Aufstieg zum Ur-Einen geschieht durch eine Entfernung von der Materie und der Dunkelheit und einer Hinwendung zum Licht.. Dazu bedarf es einer katharsis, einer Reinigung von den dunklen, materiellen Bestandteilen, die durch Askese herbeigeführt wird. Die Seele soll dazu kommen, sich zu schämen, einen Leib zu haben. Die niedrigeren Stufen der Materie werden dabei als weniger vom Licht ergriffen, resp. durchdrungen oder geformt angesehen. Das Geformte ist nun das Schöne, das Ungeformte das Hässliche. Hier ist das Schöne als das Klare, Durchleuchtete, der Glanz aufgefaßt. Durch die Schönheit wird die Seele des Menschen entflammt und zum Aufstieg zum Ur-Einen animiert. Diese Konzeption lässt sich mit der Charakterisierung der Rolle des Eros beim Aufstieg zur Erkenntnis der Ideen beim mittleren Platon vergleichen. Die gleiche Ambivalenz wie in Platons Konzeption lässt sich aber auch bei Plotin feststellen: die Schönheit kommt nicht um ihrer selbst willen in diesen hohen Rang, sondern als ein Instrument zur moralischen Vervollkommnung des Menschen, das letztlich zur Abwendung von der Sinnenwelt führt, denn wie bei Platon ist die ästhetische Erkenntnis bei Plotin die niedrigere Form des Erkennens. Plotin wendet sich allerdings gegen die Maßästhetik des späten Plato, von Aristoteles und der Stoa. Schönheit kann ihm zufolge nicht auf den Proportionen der Einzelteile beruhen, denn dann gäbe es keine schönen Einzelteile, und aus hässlichem Zusammengesetztes könne man nicht schön nennen. Er findet, seiner Konzeption gemäß, das Merkmal des Schönen im Glanz, womit nicht der äußerliche schöne Schein gemeint ist, sondern die Offenbarung der Abkunft des Schönen vom Einem, dem Inbegriff allen Lichtes. Der nous, die intelligible Welt, die erste Stufe der Emanation ist demnach vollkommen im Licht und das Licht im nous. Dieses Licht, das allen Ideen inhäriert, garantiert sozusagen dadurch, dass diese die Formen der Dinge in der Welt darstellen, die Schönheit des Kosmos. Da die Schönheit in der intelligiblen Form liegt, und nicht in der Materie selbst, die nur durch Teilhabe an der Form oder durch Durchdrungensein vom Licht schön wird, dadurch, dass sie die Idee durchscheinen lässt, ist die Erkenntnis des Schönen eigentlich keine ästhetische, sondern eine geistige Schau. Darin kommt es Plotin zufolge zu einer Verschmelzung von Subjekt und Objekt, indem die Seele das Licht, von dem sie selbst genommen ist, erkennt, das ihr Verwandte, und darin ihrer selbst innewird. Das Schönheitserlebnis wird also mit mystischen Weihen versehen, die Goethe in folgender Weise beschrieben hat: Wär nicht das Auge sonnenhaft Die Sonne könnt‘ es nie erblicken Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft Wie könnt uns Göttliches entzücken? Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 19 4. Die Gottesbeweise bei Thomas von Aquin NB: der Text des „Ontologischen Argumentes“ von Anselm und der Text der „quinque viae“ in der Fassung der Summa Theologiae wurden in der Vorlesung ausgegeben und ausführlich gemeinsam interpretiert. Das Verständnis der Argumentation von Thomas auf der Grundlage der ebenfalls in der Vorlesung ausführlich diskutierten Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie sind der Kernpunkt dieses Kurses. Die fünf Wege sollen bei der Prüfung nicht nur ihrem Namen nach, sondern auch der Argumentationsstruktur nach wiedergegeben werden können. Bereiten Sie sich darauf durch Lektüre des im Anhang in lateinischer Sprache und deutscher Übersetzung enthaltenen Textes von Thomas vor. 4.1. Thomas im Kontext des Aristotelismus und der Lehre von der „doppelten Wahrheit“ Die aristotelische Philosophie mit ihren hier grob skizzierten Grundprinzipien liegt der klassischen mittelalterlichen Theologie (Scholastik) zu Grunde. Die quinque viae des Thomas v. Aquin beruhen darauf: Thomas von Aquin wendet sich gegen den sogenannten „ontologischen Gottesbeweis“ des Anselm von Canterbury. Lt. Anselm ist die Idee Gottes diejenige des Höchsten Seienden, des perfekten Seienden, dessen, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann (id, quo maius nihil cogitari potest). Da nun diesem Größtmöglichen in diesem Sinne (als des vollendeten, in jeder Hinsicht vollkommenen Seienden), etwas mangelte, wäre es ein bloß Gedachtes, nämlich die Existenz, ist es, wenn es bloß als Gedachtes gedacht wird, nicht die Idee des Größtmöglichen, wenn sie nur als gedachte gedacht wird, sondern nur dann, wenn sie als existierend gedacht wird. Bei Anselm von Canterbury (siehe den gemeinsam gelesenen Text) ist dieses Argument in ein Gespräch mit Gott eingebunden, es hat die Form der Überlegung darüber, was im Begriff Gottes eigentlich gedacht wird, gesetzt wird. Der Haupteinwand gegen das Argument liegt darin, dass Existenz keine Prädikat ist, das man einer Sache zusprechen kann oder nicht. Thomas von Aquin lehnt den ontologischen Gottesbeweis ab, der rein aus der Vernunft heraus argumentiert, und vom Denken einen Weg zum Sein finden will. Dennoch hält er Gottes Existenz nicht für unbeweisber. Er geht aber den Weg, ihn aus seinen „Spuren“ in der Welt aufzuweisen. Grundlegend dafür ist seine Stellungnahme innerhalb des mittelalterlichen Streites um die sogenannte „doppelte Wahrheit“. Das Kennenlernen der aristotelischen Tradition, die zunächst als nicht in Übereinstimmung mit den geoffenbarten Wahrheiten zu bringen angesehen worden war, führte u.a. zur der Ansicht, dass die Offenbarung Gottes und die natürliche Vernunft in Widerspruch miteinander stehen könnten. Mit anderen Worten: Gott könnte am Wege des Glaubens Dinge offenbaren, die der Vernunft widersprechen. Thomas argumentiert, dass Gott als der Urheber der Vernunft nichts dieser Widersprechendes offenbaren könne. Aus der natürlichen Vernunft können wir nur wissen, dass Gott ist und was er in Bezug auf uns ist, nicht aber, was er in sich ist. Letzteres hat uns Gott in der auf den Glauben bezogenen Offenbarung mitgeteilt. Das übersteigt zwar unsere Vernunft, insofern wir nicht selbst Gott sind, der actus purus, stets verwirklichte Möglichkeit, reine Aktualität, unendlich ist, während wir endlich sind, stets in Hinsicht auf etwas in unserem Sein im Zustand der Potenz. Es ist die Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 20 große Leistung von Thomas v. Aquin, am Höhepunkt des Mittelalters eine großangelegte Synthese von Glauben und Vernunft geschaffen zu haben. 4.2. Die quinque viae In der Summa theologiae verteidigt er deshalb auch die Lehre von der Erkennbarkeit, dass Gott ist, durch die natürliche Vernunft, in den sogenannten quinque viae, den „Beweisen vom Dasein Gottes“. Im Folgenden wird nur knapp zusammengefasst, was in der Vorlesung ausführlich dargelegt worden ist. Hier wird wieder vorausgesetzt, dass wir von Gott nicht wissen können, was er an sich sei, sondern ihn nur aus seinen Wirkungen in der Welt erkennen. Die Beweise halten sich im Schema der von Thomas adaptierten aristotelischen Metaphysik: Sie gehen aus 1) von der Veränderung/Bewegung. Alles was verändert wird, wird von etwas anderem verändert. Hier kann man entweder in einen unendlichen Regress kommen, oder eine erste Ursache der Veränderung/Bewegung annehmen, die selbst von nichts außerhalb ihrer selbst bewegt wird. Das nennen alle Gott. Hier ist es wichtig zu beachten, dass Thomas unter „Bewegung“ jegliche Veränderung aufasst und dass er sie mit Aristoteles als den Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit erklärt. Zunächst führt Thomas aus, dass alles, was von der Möglichkeit in die Wirklichkeit überführt wird, nur durch etas, was schon jene Wirklichkeit ist, dazu geführt wird. Z.B. erhitzt man Wasser durch eine Hitzequelle oder färbt einen Stoff durch einen Frabstoff von dieser Farbe usw. Deshalb kann sich nichts aus sich selbst heruas verändern, in dem Sinne, das es alleinige Ursache seiner Bewegung wäre. Denn dann müsste es zur selben Zeit am selben Ort in der selben Hinsicht etwas der Wirklichkeit und der Möglichkeit nach sein, etwas also „verwirklicht“ (etwa das Blau-Sein) und zugleich es nicht verwirklicht haben, was ein logischer Widerspruch ist. Also braucht jedes einen Beweger außerhalb seiner. Bei Lebewesen müssen wir beachten, dass diese der aristotelischen Philosophie gemäß das Prinzip ihrer Bewegung in sich selbst tragen (wenn ich beschliesse, etwas zu tun, bin ich insofern Ursache meiner Veränderung), das ganze Lebewesen aber erst durch ein anderes auf die Bahn seiner Entwicklung gesetzt wird (der Same oder der Setzling durch eine ausgewachsene Pflanze, das Tier durch Zeugung oder künstliche Befruchtung, deren Elemente ja wieder von Tieren stammen usw.). 2) von der Wirkursache: der Beweis ist gleich strukturiert wie der erste: man muß, nur geht er davon aus, dass alles in der Welt eine Ursache hat. Diese kann nun nicht den verursachten dingen selbst zugeschrieben werden, es kann also nichts (Endliches) Ursache seiner selbst sein. Der Begriff der Ursache beinhaltet das Vorangehen. Wäre etwas Ursache seiner selbst, müsste es also vor sich selbst da sein, was nicht sein kann. Also werden alle Dinge von etwas anderem verursacht. Um nicht einen in endlosen Regress zu kommen muss auf eine erste Wirkursache geschlossen werden, die selbst von nichts außerhalb ihrer selbst bewirkt wird. 3) vom Begriff der Notwendigkeit aus: die Dinge in der Welt können sein oder nicht. Was sein kann, aber nicht sein muss, ist möglich. Notwendig hingegen nennen wir das, was schlchthin sein muss, das nicht als Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 21 nichtseiend gedacht werden kann. Die endlichen Dinge, die vergehen, sind offensichtlich nicht notwenidg, aber möglich. Sie können sein, und dass sie wirklich werden, hat ihren Grund nicht in ihnen selbst, sondern in anderen, die sie ins Sein bringen. Etwas an Notwendigkeit muss nämlich in den Dingen sein, sonst wäre überhaupt nichts. Da aber etwas ist, das was ist, aber entsteht und vergeht, haben die Dinge ihre Notwendigekit nicht in sich, sondern von einem anderen her. Von diesen gilt aber wieder das gleiche. Man kann auch hier die Struktur der Beweise 1und 2 feststellen, da Thomas, um nicht in einen unendlichen Regress zu kommen, auf ein Wesen schließt, das selbst notwendig existiert und allem andern Grund seines Werdens und Vergehens ist, selbst aber keinen Grund außer sich hat. Insofern kann man auch den Schluß auf ein notwendiges, von sich her Seiendes als den Kerngedanken der fünf Wege ansehen und somit den – auch literarisch im Zentrum stehenden „Kontingenzbeweis“ als den zentralen und grundlegenden. Wichtig ist, zu sehen, dass hier auf ein Wesen geschlossen wird, in dem es die genannten Unterschiede oder Diastasen nicht gibt: Gott ist sein Sein selbst, insofern ist er alle Wirklichkeit, es gibt in ihm keinen Übergang von Möglichkeit zur Wirklichkeit, keine Ursachenketten und kein Entstehen und Vergehen. „Das, was alle Gott nennen“ wird also als die oberste Bedingung von allem, was bedingt ist. Erschlossen. Dieses wird als das selbst nicht mehr bedingte, das Unbedingte aufgefasst. In vielen Religionen wird in unterschiedlicher Art und Weise dieses Unbedingte, das Absolute, erschlossen. Das besondere an den monotheistischen Religionen ist, dass das Absolute in Ihnen personal gedacht resp. verstanden wird. Der vierte Beweis geht von der Hierarchie des Seienden aus: alles kann mehr oder weniger einer Qualität aufweisen, und das wird in Hinsicht darauf gesagt, dass etwas sich an ein Höchstes in dieser Qualität annähert (das Wärmere ist dem „ganz heißen“, dem Feuer, näher, als das kältere). Daraus folgert Thomas, dass etwas existiere, dass in höchstem Maße wahr, gut, vollkommen ist und die Ursache dieser Vollkommenheiten, da das Wesen nach Aristoteles ja auch die Gattung vorstellt und das in einer Gattung vollkommene (platonisch!) die Ursache der Gattung ist. Im Unterschied zum Anselmschen Beweis, der vom Denken des Begriffs des vollkommensten Wesens ausgeht, wird hir von den in der Erfahrungswelt anzutreffenden Vollkommenheiten ausgegangen, die wiederum auf ein ihnen Grund gebendes, von sich aus (mit Notwendigkeit und nicht bloß per Teilhabe) Vollkommenes verweisen. Der fünfte Weg, der sogenannte physikotheologische oder teleologische geht von der Beobachtung der Zielgerichtetheit der Naturvorgänge und der Handlungen vernunftloser Wesen aus. Wo aber zielgerichtetes Handeln ist, ist einer, der diese Ziele bestimmt. Im Hintergrund steht die Annahme, dass nur vernunftbegabte Wesen sich selbst Zwecke setzen können. Wir beobachten aber auch, dass etwa die Planeten auf ihren Bahnen bleiben, Pflanzen eine zielgerichtete Entwicklung vom Samen zum Samenträger durchlaufen, Tiere ihre Zwecke in der Welt verfolgen, kurzum, dass die Welt im Großen und Ganzen vernünftig eingerichtet scheint. Hier setzt auch die Debatte um das „intelligent design“ ein. Die Frage ist allerdings, ob wir die Ordnung in der Welt an sich erkennen oder sie von uns aus hineintragen. Z.B. das Argument, dass Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 22 trotz der geringen Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben entwickeln kann, sich solches doch entwickelt hat, sagt nur aus, dass dies eben geschehen ist. Hier haben Sie genügend Raum für eigene Spekulationen, beachten Sie aber die Kritik Kants am Begriff der Teleologie und das religionskritische Argument der Theodizeefrage, das in gewisser Hinsicht eine Umkehrung des physikoteleologischen Beweises darstellt. 5. Neuzeitliche Philosophie 5.1. Der „ontologische“ Gottesbeweis bei Rene Descartes. Der neuzeitliche Philosoph Rene Descartes unternimmt in seinen „Meditationes de prima philosophia“ (Meditationen über die erste Philosophie) einen Versuch des Beweises des Daseins Gottes, der an das Anselmsche Argument angelehnt ist, aber von völlig anderen Voruassetzungen ausgeht, als es bei dem mittelalterlichen Bischof der Fall ist. Die Situation von der Descartes ausgeht, ist diejenige des radikalen Zweifels. Er fragt sich, ob er überhaupt etwas als gewiß annehmen kann, oder ob er nicht in allem getäuscht wird. Die Welt könnte ja von einem bösen Dämon hervorgebracht worden sein, der es darauf angelegt hat, ihn zu täuschen. Das fundamentum inconcussum, das nicht zu erschütternde Fundament, die Grundlage, von der aus die radikale Skepsis überwunden werden kann, ist nun für Descartes in seinem eigenen Sein gegeben. Solange er denkt (wahrnimmt, Ideen hat, ob diese sich nun auf eine Außenwelt beziehen, falsch oder richtig sind, Täuschungen oder Wahrheiten), ist zumindest sicher, dass er selbst ist: cogito ergo sum. (Ich denke, also bin ich). Descartes will also nicht sein Sein aus seinem Denken im Sinne logischer Operationen ableiten, sondern findet die einzige Gewißheit in der Frage, ob er überhaupt etwas erkennen kann oder nur Täuschungen unterliegt, in der Tatsache, dass er als erkennendes Wesen, auch wenn er alles falsch erkennt, sein muß, solange er sich diese Frage stellen kann. Nun geht er daran, die Ideen von den Dingen, die er in sich vorfindet (was natürlich heißt, seine Wahrnehmung der Welt) daraufhin zu untersuchen, ob sie „klar und distinkt“ sind, somit vertrauenswürdig oder eher wie die Vorstellungen von Irren oder die unlogischen Vorstellungen, die man im Traum hat, und welche Quelle diese Ideen haben können. Alle Ideen beziehen sich nun auf Dinge, die so oder anders sein könnten, bei denen also die Möglichkeit der Täuschung nicht auszuschließen ist, sie beziehen sich auf etwas, was nicht notwendigerweise auch real existiert.. Die Idee Gottes aber, als des höchsten und vollkommenen Wesens, kann er als endliches Wesen nicht sich selbst gebildet haben und mit der von Anselm her bekannten Überlegung kann Descartes auch sagen, dass sie sich notwendigerweise auf etwas bezieht, das existiert, da zur Idee des vollkommenen Wesens ja auch seine Existenz gehört. Dieses vollkommene und gute Wesen garantiert ihm nun auch die Realität der Außenwelt, womit Descartes den radikalen Zweifel überwunden hat. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 23 5.2. Die Pascalsche „Wette“ Blaise Pascal hat ein Argument für den Glauben an Gott vorgelegt, das von der skeptischen Infragestellung der Erkennbarkeit Gottes ausgeht, in der Form einer Wette. Das Fragment, in dem die diesbezüglichen Überlegungen Pascals überliefert sind „Infini Rien“, ist von der Textgeschichte her sehr kompliziert und schwierig. Darauf kann hier nicht eingangen werden. Im Anhang sind die zentralen Passagen wiedergegeben. Das Fragment ist als ein Gespräch mit einem Gesprächspartner, der offensichtlich nicht glaubt, abgefaßt. Pascal schlägt diesem eine Wette vor. Zunächst knüpft er an die alte Metapher der Seefahrt für die Unsicherheit der menschlichen Geschäfte an, das er zunächst universalisiert. Dem Gesprächspartner, dem die Wette vorgeschlagen wird, sagt er: "Sie sind im Boot" (vous êtes embarquè). Wir sind immer schon in der Situation der Ungewißheit, und es gilt nicht mehr, zwischen dem, was einem im Schiffbruch nicht genommen werden kann, und dem Risiko des Schiffbruchs zu wählen. Das Ziel lautet also nicht: glückliches Leben durch Besinnung auf die Besitztümer, die einem nicht genommen werden können - ein Gedanke, der eine Verinnerlichung anzeigt - sondern Beantwortung der Frage: wie kann ich dem inneren Schiffbruch entgehen? Diesen inneren Schiffbruch gibt es nun aber nur für den Fall, daß es eine unendliche oder über die endliche Bestimmung des Menschen hinausgehende Bedeutung des Lebens gibt. Was den Gedanken der Wette bei Pascal nun so überzeugend macht, ist die direkte Art, in der Pascal auf den entscheidenden Punkt zugeht: gibt es diese unendliche Bedeutung, dann gewinnt derjenige, der sein Leben in Hinsicht auf sie ausrichtet, Unendliches und derjenige, der dies nicht tut, verliert Unendliches. Hat das Leben diese Bedeutung nicht, verliert man schlimmstenfalls Endliches, aber was hätte dies - ohne unendliche Bedeutung - zu bedeuten, wo doch alles Eitelkeit und Windhauch ist und man von Jahrhundert zu Jahrhundert aufs Neue feststellt, daß es "Nichts Neues unter der Sonne" gäbe. Im der in den Standardausgaben unmittelbar folgenden Aufzeichnung kommentiert Pascal den Gedankengang der Wette noch einmal: Der Haupteinwand bleibt nämlich bestehen: man bemüht sich, wenn man sich ums Unendliche bemüht, um etwas Unsicheres, dagegen ist die Bemühung um Endliches auf Sicheres gerichtet. Und hier wird die Schiffahrt wieder zum tragenden Bild der Entgegnung: Pascal ruft uns alle skeptischen Erwägungen, die er im Zusammenhang mit dem Elend und der Eitelkeit der menschlichen Angelegenheiten angestellt hat, in Erinnerung und resumiert: „daß man gar nichts tun dürfte, denn alles ist unsicher“. Damit hat er gezeigt, daß der Einwand auf einen Widerspruch hinausläuft und verneint, wie es die reductio ad absurdum genannte Schlußform erlaubt, eine der Annahmen, auf denen dieser Widerspruch beruht. Daß man sich nämlich nicht um Unsicheres bemühen dürfe. Da die doppelte Verneinung Bejahung ergibt, schließt er: man darf sich um Unsicheres bemühen. Und wenn man dies darf, dann bekommt der in der „Wette“ vorgetragene Gedankengang starke Überzeugungskraft. Pascal stellt dabei folgende Überlegung an: dass wir den nächsten Tag nicht sehen werden, ist sicher möglich. Aber es ist unsicher, ob wir ihn sehen werden. Wir sind stets in der Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 24 Gefahr, in einen Schiffbruch zu geraten, den wir nicht überleben. Aber, so Pascal, es ist zwar sicher möglich, daß die Religion nicht wahr ist, aber die Möglichkeit, dass sie wahr ist, ist nicht mit Sicherheit auszuschließen (die Möglichkeit, daß unsere endlichen Beschäftigungen unendlich sind, hingegen schon). Also: wenn man schon für das Unsichere arbeitet, dann tut man besser daran, dafür auch den größtmöglichen Gewinn ins Auge zu fassen. Und der winkt auf dem Gebiet der Unendlichkeit. Es handelt sich aber entgegen dem ersten Augenschein bei dieser Argumentation dennoch nicht wesentlich um eine „Versicherungsstrategie", sondern um ein fundamentaltheologisches argumentum ad hominem. Der Vater der Wahrscheinlichkeitsrechnung richtet seine Reflexion darüber, was angesichts gesicherter Unsicherheit (daß der Mensch sterblich ist) und unsicherer Sicherheit (daß der religiöse Mensch aus diesem Schiffbruch errettet werden kann) zu tun ist, an den Ungläubigen. An den „Weltmenschen" also, der religiöse Handlungen für irrelevant hält - und zwar nicht irgendwelche spezifischen, sondern alle und von ihrem Wesen her, insofern sie mit Bereichen umgehen, in denen es kein gesichertes Wissen gibt. Die Kraft des Argumentes wird ihm vom Musageten der Philosophie, wie Franz Rosenzweig mit Bezug auf Schopenhauer den Tod genannt hat, verliehen: vom letztendlichen und unausweichlichen Schiffbruch, dem unser Leben zusteuert. Pascal zeigt damit, daß die größere Unsicherheit auf Seiten dessen liegt, der mit der Unsicherheit der religiösen Sphäre argumentiert. 5.3. Der Gott Spinozas Baruch Spinoza (1632-1677) wendet die Unetrscheidung von Substanz und Akzidens so an, dass ihm zufolge nur eine Substanz existiert, und alles (mit Notwendigkeit ablaufende) Geschehen an ihr ist, also Akzidens. Indem damit der gesamte Weltprozess als eine Substanz, nämlich Gott, angesehen wird, spricht auch von Pantheismus. Gott ist alles resp. alles ist in Gott (Panentheismus). Wenn Spinoza von deus sive natura (Gott bzw. Natur) spricht, unterscheidet er zwischen der hervorbringenden (zugrundeliegenden) Natur, der natura naturans und der hervorgebrachten Natur, der natura naturata. Spinoza beantwortet damit auch die den quinque viae zugrundliegende Frage, nach der Notwenidgkeit, die den endlichen Seienden zukommt, nur dass er nicht aus der Vergänglichkeit auf ein ihnen äußeres, im strengen Sinn transzendentes Absolutes schließt, sondern die Notwendigkeit selbst in der Welt sieht. Hatte Descartes das Wesen der Materie als „Ausdehnung“ bezeichnet und dem die geistige Substanz, das „Denken“ als zweites Prinzip gegenüber gestellt, so sind für Spinoza Ausdehnung und Denken bloss zwei Attribute der einen Substanz. für diese Lehre ist der geborene Jude aus der Synagoge ausgeschlossen worden. In seiner Hauptschrift, der Ethik, die er in mathematischer Weise vorgetragen hatte, bemüht er sich, auf dieser Grundlage eine Affektenlehre zu entwickeln, die es dem Menschen über die Einsicht in den notwendigen Weltenlauf eermöglicht, ein von Weisheit und Glück bestimmtes Leben zu führen. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 25 5.4. David Hume (1711-1776) Ist die französische Philosophie der frühen Neuzeit, die sich auf Descartes gründet, in der Regel rationalsitsich verfasst (also durch eine apriorische Erkenntnistheorie gekennzeichnet), sind die englischen Philosophen oft Empiristen, die davon ausgehen, dass die Ideen im menschlichen Geist erst durch erfahrung im laufe derselben gebildet werden. David Hume hat mit seinem auf der empiristischen Erkenntnistheorie, nach der die Ideen bloß Verkettungen von sinneseindrücken sind, beruhenden Kritik des Kausalitätsbegriffes nachhaltig auf die Heruasbildung der sog. „kritischen Philosophie“ Immanuel Kants eingewirkt. Für Hume ist die Grundlage des Begriffes der Ursache die Beobachtung, dass zwei Ereignisse in enger räumlicher und zeitlicher Nachbarschaft stattfinden; den Unterschied zwischen zufälligem Zusammentreffen und Kausalzusmmenhängen sieht Hume alleine in der öfteren beobachtung, d.h., der Gewohnheit. Die Kategorie der Kausalität wird somit aus dem Zusammenhang der Dinge „entfernt“ und eigentlich im Individuum, im Bewußtsein verankert. Für den beweis durch die Induktion hat dieses Skepsis er Kausalität gegenüber freilich weitreichende Folgen. 5.5. Die Ablehnung der Gottesbeweise bei Immanuel Kant (1724-1804). Von dem Streit zwischen Rationalisten und Empiristen geht Immanuel Kants Philosophie zunächst aus. Die Rationalisten machen die Vernunft zum Ausgangspunkt der Philosophie. Sie nehmen, dass wir die ganze Welt aus den Vernunftideen erkennen (die von Platon über Descartes zur deutschen Aufklärungsphilosophie in höchst unterschiedlichen Variationen vorgetragene Auffassung). Die Empiristen dagegen halten die Vernunft für etwas Nachträgliches, die Vernunftideen für als e Ableitungen aus der sinnlichen Erfahrung. Dieser Standpunkt wird vor allem von der englischen Aufklöärungsphilosophie (etwa David Hume und John Locke) vertreten. Kant vermittelt sozusagen zwischen den beiden Stabndpunkten. Die Leitfrage, die er sich in in seinem Hauptwerk, der „Kritik der reinen Vernunft“ stellt, ist: dabei: was ist überhaupt ein möglicher Gegenstand der Erkenntnis? Anders gesagt: wie können wir die Grenzen dessen, was wir wissen können, bestimmen. Er nennt dies die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des Erkennens. Dies Frage bezeichnet er als die transzendentale Frage. Sie geht nicht auf den Inhalt des Erkennens selbst, sondern auf die Formen des Erkennens, die Frage danach, was und wie wir überhaupt erkennen können. Erkennen ist für ihn nun immer zusammengesetzt aus Anschauung und Denken. Er fragt also nach den Formen der Anschauung und nach den Formen des Denkens. Erstere sind Raum und Zeit, zweitere die Verstandeskategorien. Laut Kant können wir ohne Kategorien keinen Gegenstand denken, aber auch keinen gedachten Gegenstand ohne Anschauungen erkennen, die den Begriffen entsprechen. Da nun alle unserer Anschauungen sinnlich sind, können wir nichts erkennen, was außerhalb der sinnlichen Erfahrung liegt. Dieses Erkennen als Ordnen des in der sinnlichen Anschauung zunächst regellos gegebenen kann aber nicht ohne Prinzipien der Einheitsbildung geschehen, die Kant im erkennenden Subjekt ansetzt, das die sogenannte „ursprüngliche synthetische Einheit Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 26 der transzendentalen Apperzeption“ bildet, die reine Identität des Ichbewußtseins. Er geht also, ähnlich wie Descartes, vom Ichbewußtsein als Grundlage der Erkenntnis aus. Damit ist aber nicht das „empirische Ich“ gemeint, die unserem inneren Sinn zugängliche Aufeinanderfolge der Vorstellungen, sondern das „transzendentale Ich“, also das abstrakte Ichbewußtsein als Grundlage möglicher Erkenntnis. Kant geht nicht, wie Descartes, vom „Ich–Denke“ aus, sondern zeigt, dass es allem Vorstellen zu Grunde liegt. Nun fragt sich Kant in weiterer Folge, ob Metaphysik als Wissenschaft möglich sei. Unter Metaphysik versteht er die Lehre von der Seele, der Welt und Gott, drei Ideen, denen keine sinnliche Anschauung im oben ausgeführten Sinn entspricht. Kant nennt diese „Ideen“ auch die Begriffe der reinen Vernunft. In ihnen wird ein Ganzes, eine unbedingt Einheit gedacht. Es werden deshalb diese drei Ideen angeführt, weil sie der Einheit des erkennenden Subjekts (Seele), der Einheit der Bedingungen der Reihe der Erscheinungen (Welt; der Inbegriff aller Erscheinungen) und der absoluten Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt (Gott; die oberste Bedingung von allem, was gedacht werden kann) entsprechen. Die Vernunftideen werden von uns notwendigerweise mitgedacht, sie sind in der Vernunft gesetzt. In den sogenannten Antinomien der reinen Vernunft zeigt Kant nun, dass weder die Seele als Inbegriff der Einheit des erkennenden Subjekts noch die Welt als Inbegriff der Erscheinungen selbst zum Gegenstand der Anschauung werden kann. Gott ist für Kant nun ein Ideal der reinen Vernunft, worunter er ein Einzelnes versteht, das von der Idee bestimmt ist: der Weise wäre ein Ideal, das die Idee der Weisheit verwirklicht. Gott als Wesen also die Verwirklichung der Idee der obersten Bedingung von allem, was gedacht werden kann. Kant lehnt nun die Gottesbeweise ab, die er in den ontologischen, den kosmologischen und den physikotheologischen (oder: -teleologischen) aufteilt. Den ontologischen lehnt er ab, weil Sein kein reales Prädikat ist, somit dem Begriff eines Dinges nicht etwas an seinem Inhalt hinzufügt. Das Wirkliche ist begrifflich gleich bestimmt wie das Mögliche. Ein mögliches Pferd also unterscheidet sich vom Begriff her nicht von einem wirklichen Pferd. Den kosmologischen Beweis, den Schluß von der Existenz der Welt (dass überhaupt etwas existiert) auf ein notwendiges Wesen als Ursache derselben, lehnt Kant ab, weil der Ursache–Wirkung– Zusammenhang eine Verstandeskategorie ist, die über die sinnlich gegebene Welt hinaus nicht angewandt werden kann und weil der Begriff des notwendigen Wesens wiederum auf den Begriff des „höchsten Seienden“ rekurriert, also den ontologischen Beweis voraussetzt. Der physikotheologische, der von den Zwecken ausgeht, setzt ebenso eine Verstandeskategorie, den Zweck voraus, die auf den Bereich möglicher Erfahrung eingeschränkt ist. Der Begriff der Zweckmäßigkeit ist weiters lt. Kant ein von den Menschen gebildeter, der nichts darüber aussagt, ob die Welt an sich zweckmäßig ist, sie ist es für den Menschen, der sie denkt, als ob sie zweckmäßig wäre. Kant sieht weiters in diesem Beweis eine Aufnahme des kosmologischen, da auf das Vorhandensein eines die Zwecke setzenden obersten Wesens nur über die Zufälligkeit der Welt und den daraus gezogenen Schluß auf das notwendige Wesen, als einer „allumfassenden Realität“ geschlossen wird. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 27 Somit liegt auch diesem Beweis letztlich der ontologische zu Grunde. Kant bestreitet also die Möglichkeit, dass man einen theoretischen Beweis für das Dasein Gottes führen kann, aber er räumt ein, dass man Gott über die Postulate (Forderungen) der praktischen Vernunft aufweisen kann, allerdings spricht er hier von einem „Glauben“ der praktischen Vernunft. Dabei geht er von der einfachen Beobachtung aus, dass nicht immer derjenige, der gut handelt, im Leben es auch besser hat als der Ungerechte. Er nennt dies einen Skandal der praktischen Vernunft. Diese nämlich gebietet, stets so zu handeln, dass die Prinzipien, nach denen man handelt, eine allgemeine Gesetzgebung begründen könnten. Kant vertritt eine formale Ethik, nach der der Bestimmungsgrund des Handelns nicht im für mich Nützlichen oder Zweckmäßigen liegen kann, sondern im Bereich des Allgemeinverbindlichen. Das unbedingt Geforderte, das Sittengesetz soll das Handeln bestimmen. Nun ist, wie ausgeführt, nicht immer derjenige, der sich in seinem Handeln vom Sittengesetz bestimmen läßt, auch derjenige, der das Streben des Menschen nach Glückseligkeit verwirklicht. Dieser aber erweisen wir uns durch das sittliche Handeln als würdig, aber ihre Verwirklichung ist unserem Willen (der unser Handeln bestimmt) entzogen. Somit ist das oberste Gut (das gute Handeln) mit dem vollkommenen Gut (der Glückseligkeit) nicht vereint. Kant fragt nun nach den Bedingungen, unter denen diese Einheit statthaben könnte und findet sie in den Postulaten (1) der „Freiheit des Willens“, die den Menschen von der alleinigen Bestimmung von der Naturnotwendigkeit abtrennt und ohne die sittliches Handeln nicht möglich ist, (2) der Unsterblichkeit der Seele, als Voraussetzung für die Annäherung des Willens an eine vollständige Bestimmtheit durch das Sittengesetz und (3) des Daseins Gottes als des vollkommenen Wesens, das die Übereinstimmung zwischen obersten und vollkommenen Gut herbeiführen kann. Diese Postulate werden nicht auf theoretischem Weg erkannt, sondern von der praktischen Vernunft für wahr gehalten, sie sind im sittlichen Handeln vorausgesetzt, Kant spricht von einem reinen praktischen Vernunftglauben. 6. Religionsphilosophie und Religionskritik 6.1. Religion innerhalb der „Grenzen der Vernunft“: der Deismus Für Kant ist die Religion insofern relevant, als sie „innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft“ interpretierbar ist, als sie das natürliche Sittengesetz befördert. Damit hält er sich in der Tradition der neuzeitlichen Religionsphilosophie seit Herbert v. Cherbury (16. Jhdt) auf, die die Religion auf die ihr zugrundeliegende Lehren hin interpretiert, die Gebräuche, Riten und Lehren der Religion werden auf eine darin enthaltene rationale Lehre hin gelesen. H. v. Cherbury (1583-1648), ein deistischer Philosoph (Deismus: Glaube an einen für den Kosmos letztverantwortlichen persönlichen Gott, der aber – im Gegensatz zum Gott des theistischen Glaubens, nachdem er die Welt erschaffen und ihr die ihr zugundeliegenden Gesetze gegeben habe, nicht mehr in das Weltgeschehen eingreift und sich v.a. nicht übernatürlich offenbart), hat in seinem Buch „De Veritate“ im Jahr 1624 als die Merkmale der „natürlichen“ Religion 1. Glaube an die Existenz Gottes, 2. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 28 dessen Verehrung, durch 3. Tugend und Frömmigkeit angesehen, zu denen 4. Reue und Sühne sowie 5. der Glaube an jenseitige Gerechtigkeit in der Form von Lohn und Strafe komme. (Dieser Religionsbegriff ist für heutige Religionsphilosophie oder –wissenschaft zu eng, da er sich nur auf monotheistische Religionen anwenden läßt). Viele Philosophen der Aufklärung, v.a. der englischen Aufklärung, aber auch etwa Voltaire (1694-1778) in Frankreich, waren Deisten. Bei Voltaire verbindet sich eine scharfe Kritik am Offenbarungsglauben mit der Überzeugung, dass Gott für die moralische Weltordnung unverzichtbar sei, daher sein berühmter Ausspruch: „wenn es keinen Gott gäbe, müßten wir ihn erfinden“. 6.2. Theistische und atheistische Religionskritik Aus Kants Beschränkung der Religion auf die Beförderung des natürlichen Sittengesetzes folgt eine kritische Haltung alle den Bereichen des Religiösen gegenüber, die nicht in dieser Hinsicht interpetiert werden können. Er gilt deshalb auch als Begründer der Religionskritik im strengen Sinn, da es dieses Wort vor ihm nicht gegeben hat. Es wird erstmals im Gefolge seiner Philosophie von J. H. Tieftrunk (1759-1837) verwendet. Er entwickelt 1790 in seiner Abhandlung „Versuch einer Kritik der Religion und aller religiösen Dogmatik, mit besonderer Rücksicht auf das Christenthum“ im Berlinischen Journal für Aufklärung das Programm einer Versöhnung der Religion mit der Kritik, die die Vernunftprinzipen zur Geltung bringt. Wie Kant vertritt Tieftrunk eine reine Vernunftreligion auf der Basis der praktischen Vernunft. Er fordert, dass die Auslegung der Bibel sich vor der Religionskritik zu rechtfertigen habe.. Das Anliegen der Religionskritik läßt sich allerdings länger zurückverfolgen, man spricht von einer „retrospektiven Übertragung“ des Begriffes der Religionskritik „auf weit zurückliegende Epochen“. So hat es eine ähnliche Religionskritik bereits in der Antike gegeben. Wir haben bereits die Religionskritik bei Xenophanes besprochen, der die Lehren der Religionen als anthropomorphistisch kritisiert hatte und dagegen ein philosophisches Gottesbild entwickelt. Auch im beriets behandelten Neuplatonismus, wo Gott als der Ineinsfall der Gegensätze, als das ganz andere interpretiert worden ist, kann man eine Form der Religionskritik finden, die ein Gottesbild propagiert, das über die „anthropomorphen“ Vorstellungen der Religionen hinausweist.. Der Gedanke ist ungefähr so zu verstehen: wenn die geschaffene Welt durch Gegensätze charakterisiert ist, dann muß das Transzendete, das Absolute, das jenseits der Welt liegt, als das ganz andere, frei von diesen Gegensätzen sein. Von einer solchen „theistischen“ (oder auch: deistischen!) Religionskritik ist eine „atheistische“ Religionskritik zu unterscheiden. Ansätze zu einer solchen gibt es auch bereits in der Antike, etwa bei Demokrit und Epikur, deren Anliegen es war, die Menschen zum glücklichen Dasein zu bringen. Den Grund für das Unglück der Menschen erblicken sie in der Furcht, diese führen sie auf die Götterfurcht zurück. Nimmt man den Menschen nun den ursprünglichen Gegenstand der Furcht, die Götter, befreit man sie von der Furcht zum Glück. Wurden Gott bzw. die Götter zwar nicht geleugnet, wurde doch ihr Interesse für die Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 29 menschlichen Dinge bestritten. Besonders Epikur und Lukrez haben sich bemüht, die Menschen von ihrer (eingebildeten) Furcht vor den Göttern zu befreien. Wegen der Leugnung der moralischen Bedeutung des Gottesglaubens und des problematischen Versuchs, auch die Götter als materielle Wesen zu fassen, galten die Materialisten (bes. Epikur) schon in der Antike, bis in die Neuzeit hinein, (zu Unrecht) als Atheisten. Epikur hat das klassische Argument der Religionskritik, dass die Übel in der Welt mit dem Dasein eines guten Gottes nicht vereinbar wären, in folgender Weise formuliert: „Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht, oder er kann es und will es. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er mißgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl mißgünstig wie auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg?” 6.3. Die Frage der Theodizee Die darin angesprochene Frage geht auf die Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel in der Welt und ist eine der meistdiskutierten Fragen der abendländischen Religionsphilosophie. In gewisser Weise ist es spiegelbildlich auf das teleologische Argument für Gottes Dasein bezogen, dass gerade die Zielgerichtetheit der innerweltlichen Prozesse und die sinnvollen Organisation des Komsos als Beweisgrund für Gottes Dasein anführt. Die klassische Antwort der traditionellen christlichen Theologie hat Augustinus formuliert: das Uebel hat kein Sein an sich, sondern ist eine Minderung am Guten. Also ist nur das Gute eigentlich, das Böse hat kein eigenes Sein, sondern besteht nur in einer Minderung, einer Beraubung (Privation) am Guten. Dies nennt man die „Privationstheorie des Gbösen“. In der Neuzeit hat Gottfried Wilhelm Leibniz den Ausdruzck „Theodizee“ geprägt, um das Problem der Rechtfertigung Gottes zu benennen. Seine Antwort geht von der Idee der „möglichen Welten“ aus. Demnach sind alle Welten, die sich widerspruchslos denken lassen, möglich, sie sind vom Wesen Gottes aus gesehen eine Möglichkeit, die Gott wählen hätte können. Ist er zwar frei, so wird er aus moralischer Vollkommenheit heraus doch die beste aller möglichen Welten geschaffen haben; in dieser verbindet sich eine möglichst geringe Anzahl von Prinzipien mit einer möglichst hohen Entfaltung individueller Möglichkeiten. Nun muss erklärt werden, warum es trotzdem Übel in der Welt gibt. Zunächst ist jede geschaffene Welt eine endliche, und dadurch notwendigerwiese nicht ident mit dem Unendlichen. Diesen Mangel nennt Leibniz das malum metaphysicum. Dann gibt es naturhaftes Übel, malum physicum, von dem wiederum das malum morale, das moralisch Schlechte, zu unterscheiden ist. Diese sind aufgrund der Endlichkeit auch in der optimalen Welt, der besten Kombination dessen, was miteinander kompatibel ist, nicht auszuschließen. Gott hat sie um des optimalen Ganzen willen in Kauf genommen. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 30 Voltaire, der zunächst dieser Lehre Leibnizens gefolgt ist, hat sich unter dem Eindruck des Erdbebens von Lissabon und des siebenjährigen Krieges einer pessimistischeren Weltsicht zugewandt. Die Idee, dass diese Welt die Beste aller möglichen Welten sei, karikiert er in seiner Erzählung „Candide“, in der der Held nach vielen Abenteuern in der Welt als rechte Lebensmaxime „cultiver son jardin“ (seinen Garten bestellen) erkennt und schlußendlich ein Leben in epikureischer Zurückgezogenheit wählt. Wenn auch diese Welt eine Welt leidvoller Erfahrungen darstellt, so müssen wir dennoch als letzte Ursache dieser Welt Gott annehmen, vor allem aufgrund der Begründung der Moral 6.4. Skepsis Auch die antiken Skeptiker, die keine einheitliche Schule bilden, sondern unterschiedlichen Perioden und Schulen angehören, können als Religionskritiker betrachtet werden Sie betonen, daß es für uns Menschen keine unbezweifelbar gewisse Erkenntnis gibt und daß dies in besonderem Maße auf die angeblichen religiösen Erkenntnisse zutrifft. Dies ist ein vielen modernen religionskritischen Strömungen zugrundeliegendes Motiv, etwa auch bei Fr. W. Nietzsche (1844-1900) 6.5. Religionskritik im Gefolge der Philosophie Hegels Nach Kant wurde im deutschen Idealismus, bei G.W.F. Hegel (1770-1831), der Mensch zum Subjekt der Geschichte gemacht, indem diese als die Selbstentfaltung des Geistes interpretiert worden ist. Die Religion wird dabei zu einer Stufe auf dem Weg des Zu–Sich–Selbst–Kommens des absoluten Geistes in seiner Entfaltung in der Geschichte, die christliche Lehre von der Menschwerdung Gottes wird als Vollendung dieser Bewegung gesehen. Die nachhegelschen Religionskritiker, wie Feuerbach, drehen diese Argumentation um. Feuerbach sieht im Christentum eine verkappte Form der Anthropologie. Demnach hat der Mensch Aussagen über sich selbst bloß an den Himmel außerhalb seiner selbst projiziert. Die Religion (das Christentum) enthält somit richtige Aussagen über den Menschen in einer falschen Form, sie sind Ausdruck eines falschen Bewußtseins. Ludwif Feuerbach (1804-1872) begreift den Menschen als Gattungswesen, als Gattung ist der individuell sterbliche Mensch unendlich, und die Aussagen über diese Unendlichkeit hat er auf einen außer sich projizierten Gott übertragen. In der Religion wird somit das Gattungswesen des Menschen als Gott verehrt, die Liebe zwischen den Menschen in die Liebe Gottes hinaus projiziert. Diese Projektion muß zurückgenommen werden, damit der Mensch zu sich selbst findet. Feuerbach betrachtet den Menschen als „Anfang, Mitte und Ende der Religion“. Religion wird hier also als Selbsttäuschung des Menschen gelesen, als ein Code, den man entschlüsseln kann in eine Aussage über den Menschen. Diese These ist eine andere als die vom „Priesterbetrug“, wonach die Religion eine Erfindung einer Priesterkaste ist, die sie als Mittel zur Knechtung der übrigen Menschen gebrauchen. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 31 Karl Marx (1818-1883) geht in seiner Religionskritik von Hegel und Feuerbach aus, die Geschichte wird vom Menschen als Subjekt derselben aus interpretiert, aber nicht der abstrakte Geist, das „transzendentale Ich“ ist Subjekt der Geschichte, und nicht der Mensch als abstrakt gedachtes Gattungswesen, sondern der arbeitende, produzierende Mensch. das Wesen des Menschen wird nicht abstrakt gedacht, sondern als „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“. Die Religion ist für Marx, wie für Feuerbach, Ausdruck eines falschen Bewußtseins, das die Situation der Entfremdung stützt, in der dem produzierende Menschen, der nicht Anteil an den Produktionsmitteln hat, der Besitz an den Ergebnissen seiner eigenen Tätigkeit entzogen wird, indem er gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen. 6.6. Radikale Religionskritik bei F. W. Nietzsche im Gefolge Arthur Schopenhauers F. W. Nietzsche geht nicht vom deutschen Idealismus aus, sondern von Arthur Schopenhauer (1788-1860), dessen erklärtem Gegner, von der sogenannten Neukantianischen Philosophie eines Friedrich Albert Lange (1828-1875), die die erkenntniskritische Seite an Kant favorisiert und die Glaubensbegründung fallen läßt, und von einer radikalen Erkenntnis- und Sprachkritik. Sehen wir uns Schopenhauers Philosophie kurz in ihren Grundzügen an: Schopenhauer sucht über Kant hinauszugehen, indem er zunächst von der durchgängigen Korrelation von Subjekt und Objekt ausgeht: alles, was erfahren und somit erkannt werden kann, ist stets in der Form der Vorstellung eines Vorstellenden gegeben, als Objekt für ein Subjekt. Entscheidend und signifikant für Schopenhauers Denken ist dabei die Idee der Korrelation, die besagt, dass dieses Verhältnis von Subjekt und Objekt nicht als Kausalverhältnis gedacht werden kann. Vielmehr betrachte er die Kategorie der Kausalität als eine der Formen, in denen der ihm zufolge allem Gegebensein eines Objektes für ein Subjekt zugrundeliegende „Satz vom Grund“ unsere Vorstellungen bestimmt. Den Satz vom zureichenden Grund, dass nichts ohne Grund geschehe, hatte er in seiner Dissertation von 1813 als das gemeinsame Prinzip aller Verstandes- und Vernunftoperationen, in denen uns vier unterschiedliche Klassen von Objekten gegeben sein können, dargestellt. Demnach finden wir Kausalität dort, wo ein Subjekt die Relationen ihm äußerer Objekte, also solcher der empirischen Erfahrungswelt, wahrnimmt. Damit beschäftigen sich die empirischen Wissenschaften. Davon unterscheidet er das ebenso auf den Satz vom zureichenden Grund zurückgeführte Grund-Folge-Verhältnis, das zwischen Begriffen, also in logischen Operationen obwaltet. Von diesen hebt er wiederum die mathematischen Operationen ab, in denen die Verhältnisse innerhalb der kantischen Formen der Anschauung, Raum und Zeit, an sich selbst analysiert werden. Eine vierte Klasse von Objekten, die schopenhauer einführt, hängt mit der Frage nach der Art und Weise, wie das Subjekt sich selbst gegeben ist und mit dem Verhältnis von Individualität und Allgemeinem zusammen. Individuation ist für Schopenhauer mit der als Verbindung der Anschauungsformen Raum und Zeit gedachten Materie notwendig verknüpft. Zeitlichkeit fasst er als reine Sukzession, Räumlichkeit als reines Nebeneinander auf, Materie als deren Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 32 Verbindung: das Ausgedehnte sich Verändernde. Dies ist transzendentalphilosophisch (in Kants Sinn) gedacht. Schopenhauer analysiert die Bedingungen der Möglichkeit des Gegebenseins von Materialität. Wie der Begriff der Materie Ausdehnung und Sukzession voraussetzt, so besteht die Möglichkeit von Individualität, also Besonderung und Unterscheidung nur unter der Bedingung, jeweils eine bestimmte Stelle im Raum-ZeitKontinuum im Unterschied zu allen anderen einnehmen zu können. Was nicht unter diesen Formen der Anschauung gegeben ist, kann deshalb auch nicht als ein Einzelnes, das sich von allen anderen unterscheidet, gedacht werden. Konsequent transzendentalphilosophisch argumentiert Schopenhauer zunächst auch hinsichtlich des Gegebenseins des Subjekts. Darunter versteht er eine besondere Klasse von Vorstellungen, die für jeden Vorstellenden genau ein Element enthält, nämlich sich selbst. Es ist die einzige Vorstellung, die dem Vorstellenden unmittelbar gegeben ist, vermöge dessen, was Schopenhauer der Tradition gemäß den „inneren Sinn“ nennt. Diese unmittelbare Gegebenheit ist aber nie in der Form des Objektseins zu haben, das Subjekt kann sich nie hinsichtlich seines Subjektseins Objekt werden, denn die durchgängige Korrelation von Subjekt und Objekt beläßt jeweils einen Teil des Vorgestellten in der Vorstellung seiner selbst in der Position des Subjekts. Diese Position kann somit nicht erfolgreich objektiviert werden, sie kann sich im Modus der Vorstellung nicht selbst anschauen, resp. durchsichtig werden. Schopenhauer drückt diesen kardinalen Punkt seiner Philosophie folgendermaßen aus: „Denn das vorstellende Ich, das Subjekt des Erkennens, kann, da es, als notwendiges Korrelat aller Vorstellungen, Bedingung desselben ist, nie selbst Vorstellung oder Objekt werden.“ Subjektivität kann sich also selbst im Modus der Vorstellung nicht durchsichtig werden, infolge dessen kann das abstrakte Ich-Bewußtsein nicht zur Grundlage der Beantwortung der metaphysischen Frage nach dem Grund des Seins gemacht werden. Anders ausgedrückt, kann eine Analyse unseres Weltbezuges in der Form der Vorstellung, d.h. unseres Erkenntnisvermögens uns nicht instand setzen kann, Auskünfte über das An-Sich der Welt, wie sie unabhängig von unserer Erfahrung derselben bestehen mag, zu geben. Für Schopenhauer folgt daraus, dass das erkennende Subjekt selbst den Formen der Vorstellung nicht unterworfen ist, sondern außerhalb derselben steht. Denn dasjenige, was allem Vorstellen zugrundeliegt aber selbst nicht Vorstellung werden kann, liegt, so Schopenhauers Überlegung, außerhalb der Welt als Vorstellung. Aus der durchgängigen Korrelation von Subjekt und Objekt folgt aber ebenso, dass mit dem Auftreten eines einzigen erkennenden Subjektes die Welt als Vorstellung anhebt und mit dem Ende des letzten vorstellenden Subjektes die Welt als Vorstellung enden würde. Nun sind nicht alle Komponenten oder Elemente der Welt selbst vorstellende; denn Vorstellung setzt Anschauung und Verstand voraus, deren Synthesis, mit Kant zu sprechen, erst Gegenstände in der Welt – die elementaren Bestandteile der Vorstellung, hervorbringt. Entsprechende Ausstattung bringen laut Schopenhauer erst die Tiere mit. Daraus ergibt sich in Schopenhauers Worten das Problem, daß das „Daseyn der Welt abhängig vom ersten erkennenden Wesen“ ist, dieses aber „abhängig von einer langen ihm vorangegangenen Kette [...] von Ursachen und Wirkungen, in die es selbst als kleines Glied eintritt“. Dieses Problem löst er folgendermaßen: Kausalität, Zeit und Raum kommen der Welt Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 33 als Vorstellung zu, wie aber die Analyse des Vorstellens zeigt, liegt diesem etwas zugrunde, was nicht als Element innerhalb der Welt als Vorstellung vorkommt. Dieses Zugrundeliegende hat offensichtlich ontologischen Vorrang vor der als Vorstellung gegebenen Welt, die somit als dessen Erscheinung gedacht werden kann. Die offensichtliche Schwierigkeit des Zuganges zu einer solchen außervorstellungsmäßigen Entität löst Schopenhauer mittels einer einfachen Überlegung, die auf die Art und Weise, wie sich ein Subjekt selbst gegeben ist, reflektiert. Wir sind uns selbst in unserer leibhaften Existenz nicht bloß mittelbar als Objekte unter anderen gegeben. Sondern, wir erfahren uns mittels des inneren Sinnes umittelbar als Subjekte der Vorstellung, und wir erfahren uns zugleich als wollende, als Willenszentren. Die Identität des wollenden und des erkennenden Subjekts in einem Individuum nennt er den „Weltknoten“, der, da er nicht unter die Relationen der Objektwelt, die uns allein erklärlich sind, fällt, uns unerklärlich bleibt. Schopenhauer kann aber den Ort dieser Identität angeben, und das ist der Leib. Dieser erweist sich, in Schopenhauers Sprache, als Objektivation des Willens, stellt sich doch jeder Willensakt in der Objektwelt als eine Aktion des Leibes dar. Wir erkennen also aus den leibhaftigen Handlungen a posteriori den Willen, umgekehrt ist der Wille das a priori des Leibes. Mit diesem Ausgang vom von der Triebhaftigkeit her verstandenen Leib vollzieht Schopenhauer eine deutliche Abkehr von der idealistischen Tradition der Geistphilosophie, ohne deren metaphysischen Fragebestand zugleich aufzugeben. Schopenhauer dient die Thematisierung des Leibs als Ausgangspunkt der Erschließung eines metaphysisch gedachten Willens, der als allen Vorstellungen zugrundeliegender nicht selbst vorgestellt werden kann, vielmehr als blinder Drang erlebt wird und letztendlich außerhalb von Zeit und Raum und Kausalität liegen muß, somit auch nicht individuell aufzufassen ist. Der Leib ist ihm somit der in die Welt als Vorstellung eingegangene, damit objektivierte und individualisierte Wille. Über einen Analogieschluß folgert Schopenhauer weiter, dass, wie der Erscheinung des Subjekts als Objekt, allen Objekten in der Welt der Vorstellung der nämliche Wille zugrundeliegt, die somit alle, je nach der Komplexität ihrer Organisation, als Objektivationsstufen des Willens aufgefaßt werden. Nietzsche geht zunächst von dieser Konzeption Schopenhauers aus, aber anders als dieser, der in pessimistischer Art und Weise die durch den blinden Willen hervorgebrachte Welt als ablehnenswert betrachtet und deshalb zu einer asketischen Haltung aufruft, zu einem Sistieren des Willens (auf die Diskussion der angeblichen oder wirklichen Widersprüchlichkeiten dieses Unternehmens kann hier nicht eingegangen werden), ruft Nietzsche zu einer Bejahung der Welt des Werdens auf, da diese die einzige sei, die wir hätten. In der Vertröstung auf ein Jenseits, das er aller metaphysischen und religiösen Weltauslegung (in unterschiedlichen Graden) zuschreibt, sieht er eine Abkehr vom Leben, somit eine Krankheit. Leben selbst faßt er nicht mehr, wie Schopenhauer, als von einem in allen gleichen Willen bestimmt auf, sondern als Resultante des Verhältnisses von Willensquanten, „hinter“ denen keine „eigentliche“ Welt mehr zu finden sei Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 34 (wie die Welt des Seins bei Parmenides, die Welt der Ideen bei Platon, der unbewegte Beweger, die aus sich heraus existierende Notwendigkeit bei Aristoteles und Thomas, die höchste Vollkommenheit des Anselm, die von der praktischen Vernunft postulierte Welt der Gerechtigkeit bei Kant). In dieser Hinsicht betrachtet er sich als Nachfolger der herakliteischen Philosophie. Dieses (hier nur grob skizzierte) Konzept entwickelt er als Antwort auf eine von ihm als welthistorisch entscheidend betrachtete Situation: Er sieht, dass durch die historische Kritik die Grundlagen des Christentums fragwürdig geworden sind und durch die kantische Kritik an der Abbildungsfunktion unseres Erkenntnisapparates und durch die wissenschaftliche Kritik am geozentrischen Weltbild, wie er meint, die weltanschaulichen Grundlagen des Christentums, die Möglichkeit, eine absolute Wahrheit zu erreichen und von einer zentralen Stellung des Menschen im Kosmos auszugehen, erschüttert. Wenn aber der Glaube an Gott hinfällig geworden ist, kann nicht, wie bei Feuerbach und Marx, so Nietzsche, der Mensch einfach die Stelle des „Königs“ übernehmen. Vielmehr ist das Wesen des Menschen bisher innerhalb der christlichen Weltanschauung bestimmt worden. Ist diese erschüttert, ist der Weg zu einer neuen „Wesens“bestimmung frei. Nietzsche sieht darin eine Chance und eine Gefahr zugleich. Eine Chance zu einer neuen Selbstbestimmung, die die aus dem Ressentiment, einem reaktiven Gefühl, entstandene moralische Weltanschauung überwindet, aber auch die Gefahr, dass durch den Wegfall des Ideals der Mensch sich nicht mehr auf ein Ziel hin anspannt und in Barbarei im Sinne oberflächlichen Dahinlebens versinkt (der § 125 von Nietzsches „Die fröhliche Wissenschaft“, in dem diese Thematik angesprochen wird, wurde in der Vorlesung gelesen und interpretiert). 7. Dialogische Philosophie (v.a. Ferdinand Ebner) Worauf die zuletzt kurz behandelten Philosophen des 19. und viele Philosophen des 20. Jhdts. aufmerksam gemacht haben, sind u.a. die vorrationalen, sinnlich–leibhaftigen Bedingungen der Vernunft. Der Mensch wird nicht mehr primär von seiner Vernunftbegabung, sondern als leibhaftiges, begehrendes, welthaftes Wesen in den Blick genommen. In der von der jüdischen und christlichen Tradition geprägten Religionsphilosophie des 20. Jahrhunderts wurde ebenso der Mensch als leibhaftiges Wesen in den Mittelpunkt gestellt, indem nicht mehr von der Selbstreflexion des Menschen, sondern von der personalen Erfahrung der Ausgangspunkt genommen worden ist. In unterschiedlicher Akzentuierung gehen davon Franz Rosenzweig, Martin Buber, Ferdinand Ebner, Emmanuel Levinas und eine Vielzahl weiterer Denker in dieser Tradition aus. Martin Buber hat darauf hingewiesen, dass die Einstellung des Menschen, wenn er sachlich–operativ mit der Welt verfährt, eine andere ist, als die, die er im personalen Bezug einnimmt, und gezeigt, dass sich mit diesen Einstellungen unterschiedliche welterschließende Sprechsituationen verbinden, die er die Ich–Es und die Ich–Du–Beziehung genannt hat. Ähnlich hat auch der österreichische Denker Ferdinand Ebner als die ursprüngliche Situation des Menschen diejenige der Beziehung vom Ich zum Du herausgestellt. Der Grundgedanke des Hauptwerkes von Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 35 Ebner (der Text wurde in der Vorlesung ausgegeben und interpretiert; das Folgende ist nicht mehr als eine knappe Zusammenfassung) besagt, dass „Geist“ nicht (cartresianisch) als eine eigene Substanz im Menschen, aber auch nicht als eine bloße Fiktion, die aus der sozialen Verfasssung des Menschen entspringt (als Garant derselben, als „Überbau“), zu denken ist, aber auch nicht als ein dem menschlichen Bedürfnis nach Metaphysik (einer abschließenden Daseinsorientierung) entspringendes Konstrukt. Wenn wir von „Geist“ sprechen, meinen wir aber, dass dem Dasein des Menschen eine Bedeutung innewohnt, die über die Befriedigung der bloß „natürlichen“ Daseinsinteressen (Selbstbehauptung im Dasein) hinaus geht. Diese Bedeutung erschließt sich für Ebner in den geistigen „Realitäten“, dem Ich und dem Du. Damit ist gemeint, dass der ursprüngliche Ort der Erfahrung von Geist nur in der personalen Begegnung stattfindet. Ebner geht es in erster Linie nicht darum, personale Begegnungen als ausgezeichnete Momente im Dasein herbeizuführen, sondern um eine Überlegung die Grundlagen unseres Seins und Daseinms betreffend. In der Geschichte der Philosophie ist in der Regel in der Bestimmung des Seins des Seienden vom Urteilsakt ausgegangen worden (so in der platonischen Methexislehre, bei Aristoteles, Descartes und Kant). Bei Descartes und im deutschen Idealismus wurde darüber hinaus die Identität des Ich-Bewußtseins als Grundlage der Urteilsakte zum Ausgangspunkt genommen. Davon hatten schon die Willensmetaphysiker wie Schopenhauer oder Nietzsche Abstand gewonnen. Für Ebner nun liegt die ursprüngliche Erfahrung von Sein, dort wo uns Sein sozusagen direkt zugänglich ist, in der personalen Daseinsweise des Menschen, der erst Ich sagen kann, wenn er von einem „Du“ angesprochen wird. Somit ist das „Ich“ nicht eine absolute Grundlage, sondern wird allererst in der Beziehung, im Verhältnis konstituiert (man kann sich darüber streiten, wie sehr dies die herausragenden Denker des deutschen Idealismus, etwa Fichte und Hegel, bereits mitgedacht haben). Dafür findet Ebner zwei Indizien, die das einsichtig machen können: die sprachliche Verfaßtheit des menschlichen Bewußtseins (Sprache ist immer etwas zwischen Sprecher und Hörer) und die Liebe zwischen Menschen. Darin leuchtet aber die Beziehung zu dem auf, der unserer Sprach- und Liebesfähigkeit durch sein Ansprechen und liebendes Entgegenkommen erst Grund gibt. Wenn Ebner auch von Gottesbeweisen nicht sprechen will, so ist dies doch der Versuch, Gotteserfahrung aufzuzeigen und das Wesen des Christentums neu zu bedenken. Gerade in der Tatsache, dass der Mensch das „Wort hat“, sieht Ebner einen Zugang zur christlichen Auffassung von der Welt: Ebner unterscheidet dabei mehrere Bedeutungen Sinn von „Wort“: 1. Das Wort mit dem Plural „Wörter“, also die „Sinneinheit“ innerhalb des Satzes, das einzelne verbum, nomen etc. kann gemeint sein, jedoch gibt Ebner zu bedenken, dass „das Wort mit dem Plural ‚Wörter‘ nichts ist als ein totes, um sein Leben gekommenes, aber doch auch wieder zum Leben zu erweckendes Glied des zerstückelten Satzes.“ 2. Das Wort mit dem Plural „Worte“ ist in manchen Fällen gemeint: spricht Ebner davon, dass man das rechte Wort trifft, so ist damit der einzelne Satz, die Äußerung, die im konkreten Fall die Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 36 Wirklichkeit angemessen zur Sprache, ins Wort bringt, gemeint (wiewohl natürlich auch mitunter ein einzelnes „Wort“ dies vollbringen kann - aber insofern ist es nicht mehr der tote Bestandteil der Sprache, der von den Anatomen und Physiologen des Sprachleibs untersucht und kategorisiert wird, sondern schon das Wort „in der Lebendigkeit seines Ausgesprochenseins“ - also „Satz“, lebendiges Glied des Sprachleibes und nicht toter Bestandteil des Sprachkörpers). In diesem Sinne, kann man auch von geflügelten Worten, Sprichworten, letzten Worten großer Männer und Ähnlichem sprechen. 3-4: „Wort“ als singulare tantum wird in zwei Bedeutungen verwendet: 3. Das Wort, das der Mensch hat und dessen „Haben“ ihn über das Tier erhebt, ist, wenn man so sagen will, seine Sprachfähigkeit, die nicht nur das Haben einer Sprache in dem Sinne meint, dass man ohne sie nicht zu Worten und Wörtern im vorhergehenden Sinn fähig wäre, sondern überhaupt zu keiner sprachlichen Gebärde: also weder zur Lautsprache noch zu einem anderen System von bedeutungsvollen Bewegungen, mittels derer ein Bewußtsein mit einem anderen kommunizieren kann - auch das begriffliche Denken und das Denken in Bildern setzen dieses Worthaben voraus. 4. Davon ist das „Wort im Anfang“ zu unterscheiden, durch das alles geworden ist: der logos des Johannesevangeliums, auf den die Erfahrung der worthaften Existenz des Menschen verweist. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 37 Anhang: Texte. 1. Das Lehrgedicht des Parmenides (Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker. Bd. 1, S. 148 ff.) 1. Das Rossegespann, das mich fährt, zog mich fürder, soweit ich nur wollte, nachdem es mich auf den vielgerühmten Weg der Göttin geleitet, der den wissenden Mann durch alle Städte führt. Dort also ging meine Fahrt; dort fuhren mich nämlich die viel verständigen Rosse, die den Wagen zogen, und die Mädchen wiesen den Weg. [...] Da nahm mich die Göttin huldreich auf. Sie ergriff meine Rechte und sprach mich mit folgendem Worte an: Jüngling, der Du unsterblichen Lenkern gesellt mit dem Rossegespann, das Dich trägt, unserem Hause nahst, sei mir gegrüßt! Kein böser Stern leitete Dich auf diesen Weg (denn weit ab fürwahr liegt er von der Menschen Pfade), sondern Recht und Gerechtigkeit. So sollst Du denn alles erfahren: der wohlgerundeten Wahrheit unerschütterliches Herz und der Sterblichen Wahngedanken, denen verläßliche Wahrheit nicht innewohnt. Doch wirst Du trotzdem auch das erfahren, wie man bei allseitiger Durchforschung annehmen müßte, daß sich jenes Scheinwesen verhalte. Doch von diesem Wege der Forschung halte Du Deinen Gedanken fern und laß Dich nicht durch die vielerfahrene Gewohnheit auf diesen Weg zwingen, [nur] Deinen Blick den ziellosen, Dein Gehör das brausende, Deine Zunge walten zu lassen: nein, mit dem Verstande bringe die vielumstrittene Prüfung, die ich Dir riet, zur Entscheidung. Es bleibt Dir dann nur noch Mut zu Einem Wege 2. Betrachte wie doch das Ferne Deinem Verstande zuverläßig nahe tritt. Denn er wird ja das Seiende nicht aus dem Zusammenhange des Seienden abtrennen, weder so, daß es sich in seinem Gefüge überall gänzlich auflockere, noch so, daß es sich zusammenballe. 3. Ein Gemeinsames [Zusammenhängendes] aber ist mir [das Seiende,] wo ich auch beginne. Denn dahin werde ich wieder zurückkommen. 4. Wohlan, so will ich denn verkünden (Du aber nimm mein Wort zu Ohren), welche Wege der Forschung allein denkbar sind: der eine Weg, daß [das Seiende] ist und daß es unmöglich nicht sein kann, das ist der Weg der Überzeugung (denn er folgt der Wahrheit), der andere aber, daß es nicht ist und daß dies Nichtsein notwendig sei, dieser Pfad ist (so künde ich Dir) gänzlich unerforschbar. Denn das Nichtseiende kannst Du weder erkennen (es ist ja unausführbar) noch aussprechen. 5. Denn [das Seiende] denken und sein ist dasselbe. 6. Dies ist nötig zu sagen und zu denken, daß [nur] das Seiende existiert. Denn seine Existenz ist möglich, die des Nichtseienden dagegen nicht; das heiß' ich Dich wohl zu beherzigen. Es ist dies nämlich der erste Weg der Forschung, vor dem ich Dich warne. Sodann aber auch vor jenem, auf dem da einherschwanken nichts wissende Sterbliche, Doppelköpfe. Denn Ratlosigkeit lenkt den schwanken Sinn in ihrer Brust. So treiben sie hin stumm zugleich und blind die Ratlosen, urteilslose Haufen, denen Sein und Nichtsein für dasselbe gilt und nicht für dasselbe, für die es bei allem einen Gegenweg gibt. 7. Denn unmöglich kann das Vorhandensein von Nichtseiendem zwingend erwiesen werden. Vielmehr Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 38 halte Du Deine Gedanken von diesem Wege der Forschung ferne. 8. So bleibt nur noch Kunde von Einem Wege, daß [das Seiende] existiert. Darauf stehn gar viele Merkzeichen; weil ungeboren, ist es auch unvergänglich, ganz, eingeboren, unerschütterlich und ohne Ende. Es war nie und wird nicht sein, weil es zusammen nur im Jetzt vorhanden ist als Ganzes, Einheitliches, Zusammenhängendes [Kontinuierliches]. Denn was für einen Ursprung willst Du für das Seiende ausfindig machen? Wie und woher sein Wachstum? [Weder aus dem Seienden kann es hervorgegangen sein; sonst gäbe es ja ein anderes Sein vorher], noch kann ich Dir gestatten [seinen Ursprung] aus dem Nichtseienden auszusprechen oder zu denken. Denn unaussprechbar und unausdenkbar ist es, wie es nicht vorhanden sein könnte. Welche Verpflichtung hätte es denn auch an- treiben sollen, früher oder später mit dem Nichts zu beginnen und zu wachsen? So muß es also entweder auf alle Fälle oder überhaupt nicht vorhanden sein. Auch kann ja die Kraft der Überzeugung niemals einräumen, es könne aus Nichtseiendem irgend etwas anderes als eben Nichtseiendes hervorgehen. Drum hat die Gerechtigkeit Werden und Vergehen nicht aus ihren Banden freigegeben, sondern sie hält es fest[.] Die Entscheidung aber hierüber liegt in folgendem: es ist oder es ist nicht! Damit ist also notwendigerweise entschieden, den einen Weg als undenkbar und unsagbar beiseite zu lassen (es ist ja nicht der wahre Weg), den anderen aber als vorhanden und wirklich zu betrachten. Wie könnte nun demnach das Seiende in der Zukunft bestehen, wie könnte es einstmals entstanden sein? Denn entstand es, so ist es nicht und ebensowe- nig, wenn es in Zukunft einmal entstehen sollte. So ist Entstehen verlöscht und Vergehen verschollen. Auch teilbar ist es nicht, weil es ganz gleichartig ist. Und es gibt nirgend etwa ein stärkeres Sein, das seinen Zusammenhang hindern könnte, noch ein geringeres; es ist vielmehr ganz von Seiendem erfüllt. Darum ist es ganz zusammenhängend; denn ein Seiendes stößt dicht an das andere. Aber unbeweglich liegt es in den Schranken gewaltiger Bande ohne Anfang und Ende; denn Entstehen und Vergehen ist weit in die Ferne verschlagen, wohin sie die wahre Überzeugung verstieß; und als Selbiges im Selbigen verharrend ruht es in sich selbst und verharrt so standhaft alldort. Denn die starke Notwendigkeit hält es in den Banden der Schranke, die es rings umzirkt. Darum darf das Seiende nicht ohne Abschluß sein. Denn es ist mangellos. Fehlte ihm der, so wäre es eben durchaus mangelhaft. Denken und des Gedankens Ziel ist ein und dasselbe; denn nicht ohne das Seiende, in dem es sich ausgesprochen findet, kannst Du das Denken antreffen. Es gibt ja nichts und wird nichts anderes geben außer halb des Seienden, da es ja das Schicksal an das unzerstückelte und unbewegliche Wesen gebunden hat. Darum muß alles leerer Schall sein, was die Sterblichen [in ihrer Sprache] festgelegt haben, überzeugt, es sei wahr: Werden sowohl als Vergehen, Sein sowohl als Nichtsein, Veränderung des Ortes und Wechsel der leuchtenden Farbe. Aber da eine letzte Grenze vorhanden, so ist [das Seiende] abgeschlossen nach allen Seiten hin, ver- gleichbar der Masse einer wohlgerundeten Kugel, von der Mitte nach allen Seiten hin gleich stark. Es darf ja nicht da und dort etwa größer oder schwächer sein. Denn da gibt es weder ein Nichts, das eine Vereinigung aufhöbe, noch kann ein Seiendes irgendwie hier mehr, dort weniger vorhanden sein als das Seiende, da es ganz unverletzlich Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 39 ist. Denn [der Mittelpunkt,] wohin es von allen Seiten gleichweit ist, zielt gleichmäßig auf die Grenzen [...]. 2. Der ontologische Gottesbeweis in Anselm v. Canterburys „Proslogion“: Ergo domine, qui das fidei intellectum, da mihi, ut, quantum scis expedire, intelligam, quia es, sicut credimus, et hoc es, quod credimus! Et quidem credimus te esse aliquid, quo nihil maius cogitari possit. An ergo non est aliqua talis natura, quia dixit insipiens in corde suo: Non est deus? Sed certe ipse idem insipiens, cum audit hoc ipsum, quod dico aliquid, quo maius nihil cogitari potest, intelligit, quod audit; et quod intelligit, in intellectu eius est, etiamsi non intelligat illud esse. Aliud enim est rem esse in intellectu, aliud intelligere rem esse. Nam cum pictor praecogitat quae facturus est, habet quidem in intellectu, sed nondum intelligit esse, quod nondum fecit. Cum vero iam pinxit, et habet in intellectu et intelligit esse, quod iam fecit. Convincitur ergo etiam insipiens esse vel in intellectu aliquid, quo nihil maius cogitari potest, quia hoc, cum audit, intelligit et, quidquid intelligitur, in intellectu est. Et certe id, quo maius cogitari nequit, non potest esse in solo intellectu. Si enim vel in solo intellectu est, potest cogitari esse et in re, quod maius est. Si ergo id, quo maius cogitari non potest, est in solo intellectu, id ipsum, quo maius cogitari non potest, est, quo maius cogitari potest. Sed certe hoc esse non potest. Existit ergo procul dubio aliquid, quo maius cogitari non valet, et in intellectu et in re. Capitulum III Quod non possit cogitari non esse Quod utique sic vere est, ut nec cogitari possit non esse. Nam potest cogitari esse aliquid, quod non possit cogitari non esse, quod maius est quam quod non esse cogitari potest. Quare si id, quo maius nequit cogitari, potest cogitari non esse, id ipsum, quo maius cogitari nequit, non est id, quo maius cogitari nequit, quod convenire non potest. Sic ergo vere est aliquid, quo maius cogitari non potest, ut nec cogitari possit non esse. Et hoc es tu, domine, deus noster. Sic ergo vere es, domine, deus meus, ut nec cogitari possis non esse. Et merito. Si enim aliqua mens posset cogitare aliquid melius te, ascenderet creatura super creatorem et iudicaret de creatore, quod valde est absurdum. Et quidem quidquid est aliud praeter te solum, potest cogitari non esse. Solus igitur verissime omnium et ideo maxime omnium habes esse, quia, quidquid aliud est, non sic vere et idcirco minus habet esse. Cur itaque dixit insipiens in corde suo: Non est deus, cum tam in promptu sit rationali menti te maxime omnium esse? Cur, nisi quia stultus et insipiens? Capitulum IV Quomodo insipiens dixit in corde, quod cogitari non potest Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 40 Verum quomodo dixit in corde, quod cogitare non potuit; aut quomodo cogitare non potuit, quod dixit in corde, cum idem sit dicere in corde et cogitare? Quod si vere, immo quia vere et cogitavit, quia dixit in corde, et non dixit in corde, quia cogitare non potuit, non uno tantum modo dicitur aliquid in corde vel cogitatur. Aliter enim cogitatur res, cum vox eam significans cogitatur, aliter, cum id ipsum, quod res est, intelligitur. Illo itaque modo potest cogitari deus non esse, isto vero minime. Nullus quippe intelligens id, quod deus est, potest cogitare, quia deus non est, licet haec verba dicat in corde aut sine ulla aut cum aliqua extranea significatione. Deus enim est id, quo maius cogitari non potest. Quod qui bene intelligit, utique intelligit id ipsum sic esse, ut nec cogitatione queat non esse. Qui ergo intelligit sic esse deum, nequit eum non esse cogitare. Gratias tibi, bone domine, gratias tibi, quia, quod prius credidi te donante, iam sic intelligo te illuminante, ut, si te esse nolim credere, non possim non intelligere! Übersetzung: (Burkhard Mojsisch) Daß Gott wahrhaft existiert Herr, der du dem Glauben die Einsicht verleihst, verleih mir also, daß ich, soweit du es für nützlich erachtest, verstehe, daß du bist, wie wir glauben, und das bist, was wir glauben! Und zwar glauben wir, daß du etwas bist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann Oder existiert etwa demnach ein solches Wesen nicht, weil der Tor in seinem Herzen sprach: Es existiert kein Gott? Aber gerade auch der Tor, wenn er eben das vernimmt, was ich aussage als etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, versteht gewiß das, was er vernimmt; und was er versteht, ist in seinem Verstande auch wenn er nicht versteht, daß es existiert. Denn es ist eines, daß etwas im Verstande ist, ein anderes, zu verstehen, daß etwas existiert. Wenn nämlich ein Maler zuvor denkt, was er zu schaffen beabsichtigt, hat er zwar im Verstande, versteht aber noch nicht, daß existiert, was er noch nicht geschaffen hat. Wenn er aber bereits gemalt hat, hat er sowohl im Verstande als er auch versteht, daß existiert, was er bereits geschaffen hat. Also sieht auch der Tor als erwiesen an, daß etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, zumindest im Verstande ist, weil er das, wenn er es vernimmt, versteht und weil alles, was verstanden wird, im Verstande ist. Und gewiß kann das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht allein im Verstande sein. Denn wenn es auch nur allein im Verstande ist, kann gedacht werden, daß es auch in Wirklichkeit existiert, was größer ist. Wenn also das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, allein im Verstande ist, ist eben das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, eines, über das hinaus Größeres gedacht werden kann. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 41 Das aber ist doch unmöglich der Fall. Es existiert also ohne Zweifel etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, sowohl im Verstande als auch in Wirklichkeit. Daß sein Nicht-Sein nicht gedacht werden kann Das existiert schlechterdings so wahrhaft, daß sein Nicht-Sein nicht einmal gedacht werden kann. Denn es kann gedacht werden, daß etwas existiert, dessen Nicht-Sein nicht gedacht werden kann, was ein Größeres ist als das, dessen Nicht-Sein gedacht werden kann. Wenn daher das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, als nicht-existierend gedacht werden kann, ist eben das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, was sich nicht miteinander vereinbaren läßt. So wahrhaft existiert also etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, daß sein Nicht-Sein nicht einmal gedacht werden kann. Und das bist du, Herr, unser Gott. So wahrhaft existierst du also, Herr, mein Gott, daß dein Nicht-Sein nicht einmal gedacht werden kann. Und das mit Recht. Wenn nämlich ein Geist etwas Besseres als dich denken könnte, erhöhte sich das Geschöpf über den Schöpfer und urteilte über den Schöpfer, was gänzlich widersinnig wäre. Allerdings kann einzig mit Ausnahme von dir alles, was sonst noch existiert, als nicht-existierend gedacht werden. Du allein besitzt somit am wahrhaftigsten von allem und deshalb am meisten von allem Existenz, weil alles, was sonst noch existiert, nicht so wahrhaft und deswegen in geringerem Maße Existenz besitzt. Warum also sprach der Tor in seinem Herzen: Es existiert kein Gott, wo es doch für den vernünftigen Geist so sehr auf der Hand liegt, daß du am meisten von allem existierst? Warum, wenn nicht deshalb, weil er dumm und töricht ist? Wie sprach der Tor im Herzen, was nicht gedacht werden kann Wie aber sprach er im Herzen, was er nicht hat denken können; oder wie hat er nicht denken können, was er im Herzen sprach, wo doch im Herzen sprechen und denken dasselbe bedeuten? Wenn er es wahrhaft, vielmehr weil er es wahrhaft sowohl dachte, da er es im Herzen sprach, als auch nicht im Herzen sprach, da er es nicht hat denken können, so wird nicht nur auf eine einzige Weise etwas im Herzen gesprochen oder gedacht. Es wird nämlich etwas auf eine Weise gedacht, wenn das Lautgebilde, das es bezeichnet, gedacht wird, auf eine andere Weise aber, wenn eben das, was etwas ist, verstanden wird. Auf jene Weise kann daher Gottes Nicht-Sein gedacht werden, auf diese jedoch keineswegs. Denn niemand, der das, was Gott ist, versteht, kann denken, daß Gott nicht existiert, mag er auch ohne jede oder mit einer fremden Bedeutung diese Worte im Herzen sprechen. Gott ist nämlich das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Wer das treffend versteht, versteht durchaus, daß eben dies so existiert, daß es nicht einmal dem Denken nach nicht existieren kann. Wer also versteht, daß Gott derart existiert, kann ihn nicht als nichtPrivatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 42 existierend denken. Dank dir, gütiger Herr, Dank dir, daß ich das, was ich früher aufgrund deiner Gabe glaubte, nun aufgrund deiner Erleuchtung derart verstehe, daß ich, wollte ich es nicht glauben, daß du existierst, nicht umhinkönnte, es zu verstehen. 3. Die „quinque viae“ des Thomas v. Aquin. Prima autem et manifestior via est, quae sumitur ex parte motus. Certum est enim et sensu constat aliqua moveri in hoc mundo. Omne autem quod movetur, ab alio movetur. Nihil enim movetur, nisi secundum quod est in potentia ad illud ad quod movetur: movet autem aliquid secundum quod est actu. Movere enim nihil aliud est quam educere aliquid de potentia in actum: de potentia autem non potest aliquid reduci in actum, nisi per aliquod ens in actu: sicut calidum in actu, ut ignis, facit lignum, quod est calidum in potentia, esse actu calidum, et per hoc movet et alterat ipsum. Non autem est possibile ut idem sit simul in actu et potentia secundum idem, sed solum secundum diversa: quod enim est calidum in actu, non potest simul esse calidum in potentia, sed est simul frigidum in potentia. Impossibile est ergo quod, secundum idem et eodem modo, aliquid sit movens et motum, vel quod moveat seipsum. Omne ergo quod movetur, oportet ab alio moveri. Si ergo id a quo movetur, moveatur, oportet et ipsum ab alio moveri; et illud ab alio. Hic autem non est procedere in infinitum: quia sic non esset aliquod primum movens; et per consequens nec aliquod aliud movens, quia moventia secunda non movent nisi per hoc quod sunt mota a primo movente, sicut baculus non movet nisi per hoc quod est motus a manu. Ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, quod a nullo movetur: et hoc omnes intelligunt Deum. Secunda via est ex ratione causae efficientis. Invenimus enim in istis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium: nec tamen invenitur, nec est possibile, quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius; quia sic esset prius seipso, quod est impossibile. Non autem est possibile quod in causis efficientibus procedatur in infinitum. Quia in omnibus causis efficientibus ordinatis, primum est causa medii, et medium est causa ultimi, sive media sint plura sive unum tantum: remota autem causa, removetur effectus: ergo, si non fuerit primum in causis efficientibus, non erit ultimum nec medium. Sed si procedatur in infinitum in causis efficientibus, non erit prima causa efficiens: et sic non erit nec effectus ultimus, nec causae efficientes mediae: quod patet esse falsum. Ergo est necesse ponere aliquain causam efficientem primam: quain omnes Deum nominant. Tertia via est sumpta ex possibili et necessario: quae talis est. Invenimus enim in rebus quaedam quae sunt possibilia esse et non esse: cum quaedam inveniantur generari et corrumpi, et per consequens possibilia esse et non esse. Impossibile est autem orrmia quae sunt talia [semper] esse: quia quod possibile est non esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihü fuit in rebus. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil esset: quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil esset: quod patet esse falsum. Non ergo omnia Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 43 entia sunt possibilia: sed oportet aliquid esse necessarium in rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis aliunde, vel non habet. Non est autem possibile quod procedatur in infinitum in necessariis, quae habent causam suae necessitatis sicut nec in causis efficientibus, ut probatum est. Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis: quod omnes dicunt Deum. Quarta via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniuntur. Invenitur enim in rebus aliquid magis et minus bonum, et verum, et nobile; et sic de aliis huiusmodi. Sed magis et minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant diversimode ad aliquid quod maxime est: sicut magis calidum est, quod magis appropinquat maxhne calido. Est igitur aliquid quod est verissimum, et optimum, et nobilissimum, et per consequens maxime ens: nam quae sunt maxime vera, sunt maxime entia, ut dicitur II Metaphys.[1, 993b23-31] Quod autem dicitur maxime tale in aliquo genere, est causa omnium quae sunt illius generis: sicut ignis, qui est maxime caiidus, est causa omnium calidorum, ut in eodem libro dicitur [ibid.]. Ergo est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et bonitatis, et cuiuslibet perfectionis: et hoc dicimus Deum. Quinta via sumitur ex gubematione rerum. Videmus enim quod aliqua quae cognitione carent, scilicet corpora naturalia, operantur propter finem: quod apparet ex hoc quod semper aut frequentius eodem modo operantur, ut consequantur id quod est optimum; unde patet quod non a casu, sed ex intentione perveniunt ad finem. Ea autem quae non habent cognitionem non tendunt in finem nisi directa ab aliquo cognoscente et intelligente, sicut sagitta a sagittante. Ergo est aliquid intelligens, a quo omnes res naturales ordinantur ad finem: et hoc dicimus Deum. Übersetzung (Horst Seidl) [Die prima via] Der erste und augenfälligere Weg aber ist der, welcher von der Bewegung her genommen wird. (a) Es ist nämlich gewiß und steht für die Sinneswahrnehmung fest, daß einige (Dinge) in dieser Welt bewegt werden. Alles aber, was bewegt wird, wird von etwas anderem bewegt. Nichts nämlich wird bewegt, außer sofern es sich zu dem in Möglichkeit verhält, wozu es bewegt wird. Etwas bewegt aber, sofern es in Wirklichkeit ist; denn bewegen heißt nichts anderes, als etwas aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit überführen. Aus der Möglichkeit kann aber etwas nicht überführt werden außer durch etwas Seiendes in Wirklichkeit: z. B. etwas Warmes in Wirklichkeit, wie das Feuer, bewirkt, daß das Holz, das warm der Möglichkeit nach ist, in Wirklichkeit warm wird, und dadurch bewegt es dieses und verändert es. Es ist aber nicht möglich, daß dasselbe (Ding) zugleich in derselben Hinsicht in Wirklichkeit und in Möglichkeit sei, sondern nur in verschiedenen Hinsichten: Was nämlich in Wirklichkeit warm ist, kann nicht zugleich in Möglichkeit warm sein, sondern es ist zugleich kalt in Möglichkeit. Es ist also unmöglich, daß etwas in derselben Hinsicht und auf dieselbe Weise bewegend und bewegt ist oder sich selbst bewegt. Alles also, was bewegt wird, muß von etwas anderem bewegt werden. (b) Wenn also das, wovon es bewegt wird, (seinerseits) Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 44 bewegt wird, dann muß es auch selbst von einem anderen bewegt werden, und jenes (wiederum) von einem anderen. Hier aber kann es nicht ins Unendliche gehen, weil so nicht etwas erstes Bewegendes wäre, und infolgedessen auch kein anderes Bewegendes, weil die zweiten bewegenden (Ursachen) nur dadurch bewegen, daß sie von einem ersten Bewegenden bewegt sind, wie z. B. der Stab nur dadurch (etwas) bewegt, daß er von der Hand bewegt ist. (c) Also ist es notwendig zu etwas erstem Bewegenden zu kommen, das von nichts bewegt wird. Und dies verstehen alle als Gott. [Die secunda via] Der zweite Weg ist aus dem Begriff der bewirkenden Ursache (genommen). (a) Wir finden nämlich, daß in den sinnlich wahrnehmbaren (Dingen) hier eine Ordnung der wirkenden Ursachen besteht. Es findet sich jedoch nicht und ist auch nicht möglich, daß etwas Wirkursache seiner selbst sei, da es so früher wäre als es selbst, was unmöglich ist. (b) Es ist aber nicht möglich, daß die Wirkursachen ins Unendliche gehen, weil bei allen geordneten Wirkursachen (insgesamt) das Erste Ursache des Mittleren, und das Mittlere Ursache des Letzten ist, sei es daß das Mittlere mehreres oder nur eines ist. Ist aber die Ursache entfernt worden, dann wird auch die Wirkung entfernt. Wenn es also kein Erstes in den Wirkursachen gibt, wird es kein Letztes und auch kein Mittleres geben. Wenn aber die Wirkursachen ins Unendliche gehen, wird es keine erste Wirkursache geben, und so wird es weder eine letzte Wirkung, noch mittlere Wirkursachen geben: was offenbar falsch ist. (c) Also ist es notwendig, eine erste Wirkursache anzunehmen. Diese nennen alle Gott. [Die tertia via] Der dritte Weg ist von dem Möglichen und Notwendigen her genommen und verläuft so: (a) Wir finden nämlich unter den Dingen solche, welche die Möglichkeit haben zu sein und nicht zu sein, da sich einiges findet, das entsteht und vergeht und infolgedessen die Möglichkeit hat zu sein und nicht zu sein. Es ist aber unmöglich, daß alles von dieser Art [ewig] sei, weil das, was möglicherweise nicht sein kann, auch einmal nicht ist. Wenn also alles die Möglichkeit hat nicht zu sein, dann war hinsichtlich der Dinge auch einmal nichts. Wenn dies aber wahr ist, dann wäre auch jetzt nichts, weil das, was nicht ist, nur anfängt zu sein durch etwas, was ist. Wenn also (einmal) nichts Seiendes war, dann war es auch unmöglich, daß etwas zu sein anfing, und so wäre nun nichts: was offenbar falsch ist. Also ist nicht alles Seiende nur Mögliches, sondern es muß auch etwas Notwendiges unter den Dingen geben. (b) jedes Notwendige aber hat die Ursache seiner Notwendigkeit entweder von anderswoher oder nicht. Es ist aber nicht möglich, daß es ins Unendliche bei den notwendigen (Dingen) gehe, die eine Ursache ihrer Notwendigkeit haben, wie dies auch bei den Wirkursachen nicht möglich ist, wie (oben) bewiesen. (c) Also ist es notwendig etwas anzunehmen, das an sich notwendig ist und die Ursache seiner Notwendigkeit nicht von anderswoher hat, sondern das (vielmehr) Ursache der Notwendigkeit für die anderen (Dinge) ist. Dies nennen alle Gott. [Die quarta via] Der vierte Weg wird von den Graden her genommen, die sich bei den Dingen finden. (a) Es findet sich nämlich bei den Dingen etwas mehr und weniger Gutes, Wahres und Edles, und so von anderem der Art. Mehr und weniger wird aber von verschiedenen (Dingen) ausgesagt, sofern sie sich in verschiedener Weise einem (Prinzip) annähem, das am meisten (d. h. in höchstem Grad) ist, wie z. B. das mehr wann ist, was Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 45 dem am meisten Warmen näher kommt. Also gibt es etwas, was am wahrsten, besten und edelsten ist und infolgedessen am meisten seiend; denn was am meisten (d.h. in höchstem Grad) wahr ist, ist am meisten seiend, wie es in Metaphys.II heißt. (b) Was aber so beschaffen genannt wird, daß ihm am meisten eine Eigenschaft in einer Gattung zukommt, ist die Ursache von allen (Dingen mit dieser Eigenschaft), die zu dieser Gattung gehören, wie z. B. das Feuer, das am meisten wann ist, die Ursache von allen warmen (Dingen) ist, wie in demselben (Metaphys.-) Buch gesagt wird. (c) Also gibt es etwas, was von allem Seienden die Ursache des Seins, der Gutheit und jeder anderen Vollkommenheit ist. Und dies nennen wir Gott. [Die quinta via] Der fünfte Weg wird von der (zweckvollen) Leitung der Dinge genommen. (a) Wir sehen nämlich, daß einige (Dinge), die des Denkens entbehren, nämlich die natürlichen Körper(dinge), wegen eines Zieles (Zweckes) tätig sind: was daraus deutlich wird, daß sie immer oder meistens auf dieselbe Weise tätig sind, um das zu erreichen, was jeweils) das Beste ist. Daraus ist offenbar, daß sie nicht aus Zufall, sondern aus (zweckvoller) Absicht zu ihrem Ziel gelangen. (b) Diejenigen (Dinge) aber, die kein Denken haben, streben nicht zu ihrem Ziel, außer weil sie geleitet sind von einem Denkenden und vernünftig Erkennenden, wie der Pfeil vom Bogenschützen geleitet wird. (c) Also gibt es etwas vemünftig Erkennendes, von dem alle Naturdinge auf ein Ziel hin geordnet werden. Und dies nennen wir Gott. 4. Aus dem Fragment „Infini Rien“ von Pascal: [Er] Gott ist, oder er ist nicht. Aber welcher Seite werden wir uns zuneigen? Die Vernunft kann hier nichts bestimmen. Ein unendliches Chaos trennt uns. Am äußersten Ende dieses unendlichen Abstands wird hier ein Spiel auf Kreuz oder Schrift gespielt. Was wollen Sie setzen? Aus Vernunft können Sie weder das eine noch das andere tun. Aus Vernunft körnnen Sie keines von beiden abtun. Beschuldigen Sie also nicht die des Irrtums, die eine Wahl getroffen haben. Denn Sie wissen hier gar nichts. - Nein, aber ich beschuldige sie nicht, diese Wahl, sondern überhaupt eine Wahl getroffen zu haben; denn wenn jener, der Kreuz wählt, den gleichen Fehler macht wie der andere, so irren sie eben beide. Das Richtige ist, überhaupt nicht zu wetten. - Ja, aber man muß wetten. Darin ist man nicht frei. Sie sind im Boot. Was werden Sie also wählen? Sehen wir zu: Da man wählen muß, laßt uns sehen, wo Sie am wenigsten riskieren. Sie haben zwei Sachen zu verlieren, das Wahre und das Gute, und zwei Sachen einzusetzen: Ihre Vernunft und Ihren Willen, Ihre Erkenntnis und Ihre Seligkeit, und Ihre Natur hat zwei Dinge zu meiden: Irrtum und Elend. Ihre Vernunft ist nicht mehr verwundet, da man notwendig wählen muß, wenn a man notwendig wählen muß, Sie das eine oder das andere wählen. Damit ist ein Punkt erledigt. Aber Ihre Seligkeit? Wägen wir Gewinn oder Verlust für den Fall, daß wir auf Kreuz setzen, daß Gott ist. Schätzen wir diese beiden Möglichkeiten ab: Wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie alles, wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Setzen Sie also ohne zu zögern darauf, daß er ist. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 46 Denen, die uns von Fehlern überzeugen, ist man sehr verpflichtet, denn sie töten ab. Sie lehren, daß man verachtet wurde, sie verhüten nicht, daß man es nicht auch in Zukunft sei, denn man hat genug andere Fehler, um verachtet zu werden. Sie bereiten die Übung der Verbesserung vor und die Befreiung von einem Fehler. Das ist wunderbar. Ja, man muß setzen. Aber vielleicht setze ich zu viel. - Laßt uns sehen. Da die gleiche Chance für Gewinn und Verlust besteht, so können Sie dennoch wetten, auch wenn Sie nur zwei Leben für eines zu gewinnen hätten; [wenn es aber drei Leben zu gewinnen gäbe, so müßte man spielen (den Sie sind gezwungen zu spielen) und Sie wären unklug - da Sie ja genötigt sind zu spielen -, wenn Sie nicht in einem Spiel, wo die Chance für Verlust und Gewinn gleich ist, Ihr Leben einsetzten, um drei Leben zu gewinnen. [Aber es gibt eine Ewigkeit des Lebens und des Glücks. Und wenn es unter dieser Voraussetzung eine Unendlichkeit von Möglichkeiten gäbe, von denen nur eine für Sie ist, so hätten Sie doch Grund genug, ein Leben einzusetzen, um zwei zu gewinnen; und Sie würden verkehrt handeln - da Sie ja verpflichtet sind zu spielen -, wenn Sie sich weigerten, in einem Spiel, wo unter einer Unendlichkeit von Möglichkeiten eine für Sie ist, ein Leben gegen drei zu spielen, falls es die Unendlichkeit eines unendlich glücklichen Lebens zu gewinnen gäbe Aber es gibt hier die Unendlichkeit eines unendlich glücklichen Lebens zu gewinnen bei einer Gewinnchance gegen eine endliche Zahl von Verlustmöglichkeiten; und was Sie spielen ist endlich. Das hebt jede Teilung auf. Überall wo das Unendliche ist und wo nicht unendliche Möglichkeiten des Verlusts gegen die des Gewinns stehen, gibt es kein Abwägen mehr, man muß alles geben. Und wenn man derart gezwungen ist zu spielen, muß man eher auf die Vernunft verzichten, um sein Leben zu bewahren, als es zu riskieren im Hinblick auf den unendlichen Gewinn, der ebenso leicht eintrifft wie der Verlust des Nichts. Denn es hilft nicht zu sagen, es sei ungewiß, ob man gewinnen würde, dagegen gewiß, daß man etwas riskiere und daß der unendliche Abstand zwischen der Gewißheit des Risikos und der Ungewißheit des Gewinnens das endliche Gut, das man bestimmt riskiert, dem unendlichen gleichmacht, das unsicher ist. So ist das nicht. Jeder Spieler wagt mit Gewißheit, um mit Ungewißheit zu gewinnen, und dennoch wagt er gewiß das Endliche, um ungewiß das Endliche zu gewinnen ohne dabei gegen die Vernunft zu sündigen. Es gibt keine Unendlichkeit des Abstands zwischen dieser Gewißheit des Wagnisses und der Ungewißheit des Gewinns; das ist falsch. Es gibt in Wahrheit eine Unendlichkeit zwischen der Gewißheit zu gewinnen und der Gewißheit zu verlieren. Aber die Ungewißheit zu gewinnen steht in einer Proportion zur Sicherheit des Wagnisses, entsprechend dem Verhältnis der Gewinn- und Verlustmöglichkeiten. Und daher kommt es, daß, wenn es auf beiden Seiten die gleiche Chance gibt, das Spiel gleich gegen gleich gespielt werden muß. Und dann ist die Gewißheit des Wagnisses der Ungewißheit des Gewinns gleich: So kann keine Rede davon sein, daß zwischen beiden ein unendlicher Abstand sei. Und so hat unsere Darlegung eine unendliche Kraft, wenn es das Endliche in einem Spiel zu wagen gilt, wo es gleiche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten gibt und ein Unendliches zu gewinnen ist. Das ist demonstrativ; und wenn die Menschen irgendeiner Wahrheit fähig sind, dann dieser. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 47 Was kann Ihnen denn Schlimmes zustoßen, wenn Sie sich auf diese Seite schlagen? Sie werden treu, rechtschaffen, demütig, dankbar, wohltätig, Freund, aufrichtig, wahrheitsliebend sein. Allerdings, die verderblichen Vergnügungen, Ruhm, Genüsse werden Sie nicht haben. Aber werden Sie nicht andere dafür haben? Ich sage Ihnen, Sie werden in diesem Leben dabei gewinnen; und Sie werden bei jedem Schritt, den Sie auf diesem Wege tun, Ihren Gewinn so sicher und Ihr Wagnis so nichtig sehen, bis Sie schließlich erkennen: Sie haben um etwas Sicheres, Unendliches gewettet, für das Sie nichts gegeben haben. 5. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900); Die Fröhliche Wissenschaft (1882), § 125 (Absätze von HGH.) Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: „Ich suche Gott! Ich suche Gott!“ — Da dort gerade Viele von Denen zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein grosses Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? sagte der Eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der Andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? ausgewandert? — so schrieen und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. „Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet, — ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir diess gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch Nichts von dem Lärm der Todtengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch Nichts von der göttlichen Verwesung? — auch Götter verwesen! Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besass, es ist unter unseren Messern verblutet, — wer wischt diess Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnfeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Grösse dieser That zu gross für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine grössere That, — und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser That willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!“ — Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an: auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. „Ich komme zu früh, sagte er dann, ich bin noch nicht an der Zeit. Diess ungeheure Ereigniss ist noch unterwegs Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 48 und wandert, — es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Thaten brauchen Zeit, auch nachdem sie gethan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese That ist ihnen immer noch ferner, als die fernsten Gestirne, — und doch haben sie dieselbe gethan!“ — Man erzählt noch, dass der tolle Mensch des selbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur diess entgegnet: „Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?“ — 6. Ferdinand Ebner (1882-1931). Das Wort und die geistigen Realitiäten.Pneumatologische Fragmente (1921); „Der Grundgedanke“1 <Die beiden Voraussetzungen.> <1.> Vorausgesetzt, daß die menschliche Existenz in ihrem Kern überhaupt eine geistige, das heißt eine in ihrer natürlichen Behauptung im Ablauf des menschlichen Lebens sich nicht erschöpfende Bedeutung hat; <2.> vorausgesetzt, daß man anders als im Sinne einer <2.1.> poetischen oder auch <2.2.> metaphysisch gemeinten oder gar nur <2.3.> aus „sozialen“ Gründen gebotenen Fiktion von etwas Geistigem im Menschen sprechen darf; <Geist als Verhältnis> so ist dieses wesentlich dadurch bestimmt, daß es vom Grund aus angelegt ist auf ein Verhältnis zu etwas Geistigem außer ihm, durch das und in dem es ist. <Das Wort als das Medium des Verhältnisses von Ich und Du.> Ein Ausdruck, und zwar eben der „objektiv“ faßbare und darum einer „objektiven“ Erkenntnis zugängliche Ausdruck des Angelegtseins auf eine derartige Beziehung ist in der Tatsache zu finden, daß der Mensch ein sprechendes Wesen ist, daß er das „Wort hat“. Das Wort jedoch hat er nicht aus natürlichen und aber auch nicht aus sozialen Gründen. Sozietät im menschlichen Sinne ist nicht die Voraussetzung der Sprache, sondern hat vielmehr diese, das in den Menschen gelegte Wort, zur Voraussetzung ihres Bestandes. Wenn wir nun, nur um ein Wort dafür zu haben, dieses Geistige im Menschen Ich nennen, das außer ihm aber, zu 1 Aus: Ferdinand Ebner. Schriften [Hrsg. Franz Seyr], Band 1. München 1963, 80f. Gliederung und Überschriften von HGH. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 49 dem im VerhäItnis das „Ich“ existiert, Du, so haben wir zu bedenken, daß dieses Ich und dieses Du uns eben durch das Wort und in ihm in seiner „Innerlichkeit“ gegeben sind; nicht jedoch als „leere“ Wörter, denen kein Bezughaben auf eine Realität innewohnte, - als was sie freilich in ihrem abstrakten, substantivierten und substantialisierten Gebrauche bereits erscheinen - vielmehr als Wort, das in der Konkretheit und Aktualität seines Ausgesprochenwerdens in der durch das Sprechen geschaffenen Situation seinen „Inhalt“ und Realitätsgehalt „redupliziert“. Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 50 Prüfungsfragen Diese Fragen sollten sie, wenn sie die Veranstaltung besucht haben oder eine Mitschrift organisiert, mit dem Skriptum und den zusätzlichen Unterlagen beantworten können. Benutzen Sie auch die Power-PointPräsentationen auf meiner homepage. 1. Welche Fragen umschreiben lt. Kant das Feld der Philosophie? 2. Die bestimmenden Fragen der frühen griechischen Philosophen? 3. Erläutern sie das Höhlengleichnis Platons 4. Erläutern sie die platonische Ideenlehre 5. Die drei Wege des Erkennens bei Parmenides 6. Substanz und Akzidens in der aristotelischen Philosophie 7. Die vier Ursachen jedes Seienden nach Aristoteles 8. Was will Aristoteles mittels der Begriffe dynamis und energeia (Potenz und Akt) erklären? 9. Erläutern sie die Emanationslehre Plotins 10. Erklären Sie den Gedankengang des ontologischen Gottesbeweises bei Anselm von Canterbury 11. Die fünf Wege des Gottesbeweises bei Thomas von Aquin 12. Erläutern Sie den Gottesbeweis in Rene Descartes‘ Meditationes de prima philosophia. 13. Erklären Sie den Gedanken der „Wette“ bei Blaise Pascal 14. Was versteht man unter Pantheismus? 15. Was versteht Kant unter „transzendental“? 16. Die Kritik der Gottesbeweise bei Immanuel Kant 17. Die Postulatenlehre von Immanuel Kant 18. Was versteht man unter „Deismus“? 19. Die Bedeutung von Herbert von Cherbury für die Religionsphilosophie 20. Was versteht man unter dem Problem der Theodizee? Erläutern Sie die Antworten von Augustinus und Leibniz. 21. Die nachhegelsche Religionskritik: Feuerbach und Marx 22. Schopenhauer und Nietzsches Religionskritik. 23. Erläutern Sie den „Grundgedanken“ von Ferdinand Ebner Privatdozent Dr. Hans Gerald Hödl: Christliche Philosophie Skriptum & Texte 51