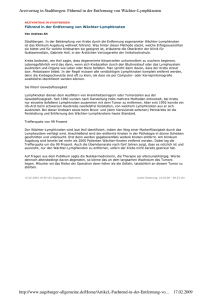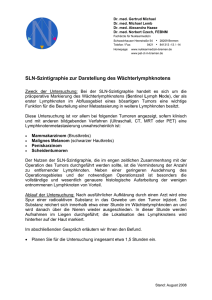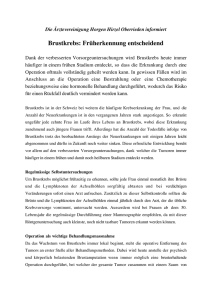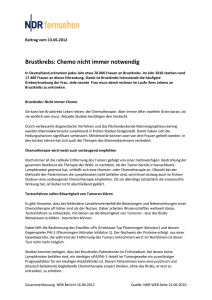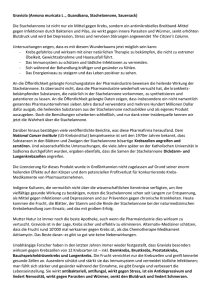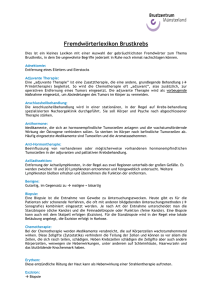Sendungsbroschüre
Werbung

Information zur Sendung vom 12. August 2010 (Wiederholung vom 23. April 2009) Dem Tumor auf der Spur Neues aus der Krebsforschung In jeder Wohnung, an jedem Arbeitsplatz sind wir Nacht für Nacht künstlichen Lichtquellen ausgesetzt. Ein Leben ohne sie ist undenkbar. Doch seit einigen Jahren hat der Krebsforscher Professor Richard Stevens einen schrecklichen Verdacht. Das nächtliche Kunstlicht könnte bei Menschen Krebs auslösen, da unser Hormonhaushalt durch Licht empfindlich gestört wird, so der Krebsforscher. Odysso zeigt, welche Art von Licht unsere Gesundheit besonders gefährdet. Allgegenwärtig: Künstliches Licht ist ein fester Bestandteil unseres Alltags Inhalt S. 2 Kosten-Nutzen-Analyse in der Krebstherapie S. 4 Impfen gegen Krebs S. 6 Gefährliches Kunstlicht S. 8 Lymphknoten metastasieren nicht S. 10Adressen & Links Kosten-Nutzen-Analyse in der Krebstherapie von Frank Wittig Seit knapp zehn Jahren drängt eine neue Generation von Krebsmedikamenten in die Behandlung: Zielgerichtete Therapie nennen die Hersteller ihre neuen Substanzen und wollen damit sagen, dass hier nicht wie bei der herkömmlichen Chemotherapie der ganze Körper mit einer Giftdusche behandelt wird, sondern dass ganz gezielt nur die Krebszellen angegriffen werden. Leider sind die Behandlungserfolge dieser Substanzen gering – die Kosten für das Gesundheitssystem dagegen erheblich. Außerdem können die Nebenwirkungen zum Teil noch gravierender sein als bei der herkömmlichen Chemotherapie. Dass schon die eine große Belastung sind, weiß Heike L. aus Salzgitter. Sie hatte 2002 nach einer operativen Entfernung ihres Eileiterkrebses zur Sicherheit eine klassische Chemotherapie gemacht: „Ich habe im Bett gelegen, konnte wirklich nur vom Bett bis zur Toilette gehen. Ich hatte Gliederschmerzen, unruhige Beine – also die Beine haben gezappelt. Und ich hatte wahnsinnige Schmerzen in den Beinen. Also das sind Schmerzen, die sind unbeschreiblich.“ Möglicherweise hat Heike L. von ihrer ersten, klassischen, Chemotherapie aber wenigstens profitiert und Jahre ohne Beschwerden gewonnen. Heike L. beim Ausritt mit der Stute Kaschaya Bei den meisten Patienten wirken die neuen Krebsmedikamente überhaupt nicht Im Moment geht es Heike L. so gut, dass sie mit ihrer Stute Kaschaya ausreiten kann. Die Frage ist allerdings, wie lange noch. Denn in ihrem Unterleib haben sich Krebsmetastasen ausgebreitet. Nach der Krebsoperation und einer zusätzlichen Chemotherapie hatte sie fünfeinhalb Jahre Ruhe. Vor einem Jahr wurde dann der schlimme Rückfall entdeckt: das Rezidiv. Heike L. erinnert sich noch an ihre erste Reaktion damals: „Als ich diese Diagnose bekommen habe, eben auch mit dem Vorwissen, dass es bei einem Rezidiv – und gerade bei einem so ausgeprägten Rezidiv – keinerlei Heilungsmöglichkeiten gibt, hatte ich für mich beschlossen, dass ich keine Chemotherapie mehr machen möchte. Eben wegen der Nebenwirkungen. Bei der ersten Chemotherapie waren diese die Hölle.“ Bei den neuen Krebsmedikamenten ist das die absolute Ausnahme. Ganz präzise sollen sie – so die Hersteller – nur auf Krebszellen wirken. Der Schönheitsfehler: Bei den meisten Patienten wirken sie überhaupt nicht. Die plagen sich nur mit den teils schweren Nebenwirkungen. Professor Wolf-Dieter Ludwig ist Krebsmediziner und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte. Er kennt die Studien zu den neuen Medikamenten. Seine Einschätzung: „Wir haben bisher nur sehr wenige Substanzen, die tatsächlich einen Fortschritt für die Patienten bedeuten. Wir haben gleichzeitig eine Kostenexplosion aufgrund der sehr hohen Kosten für diese neuen Arzneimittel, die unser Gesundheitssystem in Zukunft stark belasten werden.“ Er nennt Tarceva gegen Krebs der Bauchspeicheldrüse. Laut Hersteller ein großer Fortschritt. Aber, so Prof. Ludwig: „In der Studie, die zur Zulassung geführt hat, ist die Verlängerung des Überlebens gerade mal in der Größenordnung von zehn bis zwölf Tagen. Die Lebensqualität wird durch diesen Wirkstoff nicht verbessert. Und dieser Wirkstoff hat natürlich unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die in der Studie deutlich stärker waren als die Nebenwirkungen des herkömmlichen Zytostatikums.“ Besonders bitter: Die Behandlung mit diesen Mitteln gleicht einem Glücksspiel. Die Chancen auf den Gewinn: oft nur etwa eins zu zehn. Sendung vom 12.08.2010 |2 Wie bei Torisel gegen Nierenkrebs. Laut Zulassungsstudie profitieren nur neun Prozent der behandelten Patienten. Die Kosten liegen bei 57.000 Euro pro Jahr und Patient. Oder Vectibix gegen Darmkrebs: Das Medikament wirkt nicht einmal bei jedem zehnten behandelten Patienten. Kostet: 75.000 Euro pro Jahr und Patient. Und weil die meisten Behandlungen Nieten sind, kostet ein Erfolg das Gesundheitssystem eigentlich Hunderttausende Euro. So viel wie für ein Haus – für ein paar Monate Leben? Nur 9 Prozent der behandelten Patienten profitieren von Torisel Die Bestandsaufnahme zur neuen, „zielgerichteten Krebstherapie“ ist bitter. Dennoch greifen Hunderttausende Patienten jedes Jahr nach diesem Strohhalm. Auch wenn die Aussichten auf Erfolg bescheiden sind, die Nebenwirkungen gewonnene Lebenswochen auffressen und gigantische Kosten entstehen. Unverzeihlich ist aber, dass die millionenfach anfallenden Daten aus den Behandlungen nicht ausgewertet werden. Es gibt kein zentrales Register, in dem Erfolge und Misserfolge, Wirkungen und Nebenwirkungen systematisch erfasst werden, um für Patienten wenigstens den besten Umgang mit den Substanzen zu ermitteln. “... von 95 Prozent der Patienten kennen wir die Daten nicht systematisch ...“ Dirk Jäger leitet das Tumor-Kompetenzzentrum in Heidelberg. Auch er sagt uns: Die neuen Medikamente helfen nur selten, und wenn nur wenig: „Wenn wir beispielsweise die Situation bei Dickdarmkrebs anschauen, dann ist das durchschnittliche Überleben der Patienten in einer fortgeschrittenen Situation ohne Therapie etwa acht bis neun Monate. Mit der herkömmlichen Chemotherapie sind es ungefähr um die 20 Monate. Durch den Einsatz der neuen, zusätzlichen, modernen Substanzen – zum Beispiel Antikörper – sind es wahrscheinlich einige wenige Monate mehr.“ Das kritisiert auch Prof. Dirk Jäger, Leiter des nationalen Tumor-Kompetenzzentrums in Heidelberg: „Von 95 Prozent der Patienten kennen wir die Daten nicht systematisch. Und da sind wir in Deutschland sicher in einer katastrophalen Situation. Wir brauchen dringend eine neue Struktur, eine Registerstruktur, die es uns erlaubt, tatsächlich auch Verlaufsbeurteilungen von unseren behandelten Patienten zu erheben.“ Heike L. wollte nach der Rückkehr ihres Tumors eigentlich keine Chemotherapie mehr machen. Aber: „Ich habe mich dann entschieden, dennoch eine Chemotherapie zu machen. Ärzte haben mir dazu geraten, auch Bekannte. Es baut sich ein ungeheuerer Druck auf, etwas zu tun. Aber mit den Nebenwirkungen, die ich hatte, kann ich eigentlich die Hälfte der Zeit streichen.“ Heike L. hat sich entschieden: Sie will sich nicht mehr auf Teufel-komm-raus ans Leben klammern: „Die Frage ist auch, ob mir ein Monat länger überleben, ob mir das wichtiger ist als die Lebensqualität. Also für mich ist es eher sinnvoll, den Tagen Leben zu geben, als dem Leben Tage.“ Draußen in der freien Natur, unterwegs mit ihrer Stute Kaschaya und Hund Ludwig, das sind wertvolle Tage, die Heike L. noch genießen möchte. Unverzeihlich: Millionenfach anfallende Daten aus den Behandlungen werden bislang nicht ausgewertet Sendung vom 12.08.2010 |3 Impfen gegen Krebs von Frank Wittig Dass Krebs eine der gefährlichsten Erkrankungen ist, zeigen schon die Zahlen: Alleine in Deutschland erkranken jedes Jahr 400.000 Menschen an Krebs. Trotz jahrzehntelanger intensiver Forschung wurde bislang noch keine optimale Waffe gegen den Krebs gefunden. Das Beste wäre, wenn der Körper den Krebs selbst bekämpfen könnte – mit Hilfe des Immunsystems. Da aber dieses ausgeklügelte und höchst effektive Verteidigungssystem nicht auf Krebs optimiert ist, hilft man nach. Und zwar mit einer Impfung. Die vorbeugende Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs wird bereits eingesetzt. Jetzt aber soll eine Impfung das Tumorwachstum aufhalten und bereits an Krebs erkrankte Menschen vor einem Rückfall bewahren. Diese Strategie ist nicht ganz neu, aber bisher hat sie nicht gut funktioniert. Der Verdacht: Die Impfstoffe waren nicht präzise genug. Jetzt haben Wissenschaftler eine neue Methode entwickelt, die Hoffnungen weckt. Vielleicht hat er schon davon profitiert: Gerhard G. ist auf dem Weg zur Nachsorgeuntersuchung in der Tübinger Uniklinik. Ein schwerer Weg. Sein Nierenkrebs wurde zwar wegoperiert, die Angst aber bleibt. Gerhard G. hat sich im Rahmen einer Pilotstudie impfen lassen. Mit einem Medikament, das noch nicht auf dem Markt ist. Er hofft, dass so die Wahrscheinlichkeit, erneut an Krebs zu erkranken, gesenkt wird. Die besonders gute Verträglichkeit war mit ein Grund, weshalb er sich zur Teilnahme an der Studie entschlossen hat: „Zumal diese Impftherapie ja keine Bestrahlung und auch keine Chemotherapie ist, schien sie mir auch sehr verträglich für die Gesundheit. Es war zwar eine Studie, das wurde mir gesagt, aber ich war gerne bereit da mitzumachen.“ genannte Peptide, die nur für Krebszellen charakteristisch sind. Genau hier greift die Impfstrategie an. Mit Hilfe der Impfung soll ein Problem gelöst werden, das für alle Krebsarten gilt: Krebszellen fallen dem Immunsystem normalerweise gar nicht auf. Weil sie von Körperzellen abstammen, hält das Immunsystem sie für bekannt und ungefährlich. Doch tragen die Krebszellen an ihrer Oberfläche kleine Eiweißmoleküle, so- Ausgangspunkt für den Impfstoff ist chirurgisch entferntes Krebsgewebe. In unserem Fall war es Nierenkrebs. In den Labors von Immatics steht das Beste und Teuerste was Labortechnik heute zu bieten hat. Damit gelingt es den Tübinger Wissenschaftlern, die für diese Krebsart charakteristischen Peptide aus Die Forscher der Tübinger Biotechfirma Immatics sind außergewöhnlich erfolgreich im Aufspüren dieser Krebspeptide. Möglicherweise eine neue Waffe gegen Krebs, sagt Dr. Harpreet Singh, der wissenschaftliche Direktor von Immatics: „Mit unserer Technologie ist es uns gelungen, Tausende neuer Peptide zu identifizieren und davon Dutzende, die auch charakteristisch sind für eine Tumorart. Und wenn wir diese nun in Reinstform, also chemisch synthetisiert, dem Immunsystem wieder anbieten, dann gibt es eine Chance, dass das Immunsystem spezifisch gegen den Krebs aktiviert wird.“ Sendung vom 12.08.2010 |4 dem Gemisch der aufgelösten Krebszellen herauszufiltern. Doch damit nicht genug. Die winzigen Peptide werden in ihre Einzelteile zerlegt. Schritt für Schritt. Zehntausend Molekülspektren in einem Messlauf mit dem Massenspektrometer. Bis der Bauplan für die Krebspeptide exakt bekannt ist. Auf die Analyse des Bauplans folgt der Nachbau: Die benötigten Bausteine, Aminosäuren, liegen in kleinen Fläschchen als Rohmaterial vor. Jedes Krebspeptid nachbauen Die Chemikerin Sonja Mauch kann am Peptidsynthesizer jedes Krebspeptid nachbauen. Anlass zu der Hoffnung, im Kampf gegen Krebs einen entscheidenden Schritt voran zu kommen. Dr. Harpreet Singh erläutert, warum er und seine Mitarbeiter hoffen, mit ihrer Form der Impfung bessere Ergebnisse zu bekommen als andere Forschergruppen bei früheren Versuchen: „Das Besondere ist, dass wir zehn oder sogar mehr verschiedene Peptide einsetzen. Im Idealfall wird nicht nur eine Immunzelle aktiviert, sondern verschiedenste, die gleichzeitig den Tumor angreifen. Und wir erhoffen uns dadurch, dass der Krebs effektiv zurückgedrängt oder zumindest in seinem Wachstum eingeschränkt wird.“ fremd anerkennen. Oder der Körper kann die Tumorzellen als fremd erkennen und eliminieren, und kann damit verschiedene Tumoren im ganzen Körper bekämpfen.“ Und so soll es dann funktionieren: Die Killerzellen erkennen die Krebszellen an ihren Peptiden. Sie senden Porenbildner aus. Das sind Eiweiße, die die Außenhülle der Krebszellen durchlöchern und ihnen den Garaus machen. Gerhard G. ist erleichtert. Die Befunde bei seinem Nachsorgetermin sind unauffällig. Niemand kann sagen, ob das schon ein Erfolg der Impfung ist. Auch wenn er immerhin 16 mal die Spritzen mit den für Nierenkrebs charakteristischen Krebspeptiden bekam. Insgesamt haben die ersten Studien ermutigende Ergebnisse erbracht, sagt Arnulf Stenzl: „Bei diesen Studien hat sich gezeigt, dass zwar nur eine relativ kleine Zahl von Patienten einen Rückgang des Tumors zeigt, eine Verkleinerung der Metastasen. Aber dass eine größere Anzahl von Patienten eine stabile Phase erreicht. Das heißt: Die körpereigene Abwehr hat den Tumor im Griff, er wächst nicht weiter. Und wenn wir diese Phase erreichen, dann können wir im Anschluss an die Impftherapie eine der neueren Chemotherapien anwenden, und dadurch sozusagen dem Tumor den letzten Rest geben.“ Noch ist die Therapie in einer experimentellen Phase Die Peptide werden wie bei einer normalen Impfung in den Körper gespritzt. Das Ziel: sogenannte „dendritische“ Zellen des Immunsystems. Wichtige Schaltstellen, wenn das Immunsystem gegen einen Feind scharf gemacht werden soll. Die Krebspeptide landen auf speziellen Rezeptoren auf der dendritischen Zelle. Diesen Steckbrief des Feindes präsentiert die dendritische Zelle einer anderen Zellart des Immunsystems: den Killerzellen. So erhalten die Killerzellen die „Lizenz zum Töten“. Sie sollen mit den Krebspeptiden regelrecht auf die Krebszellen abgerichtet werden. Ausgestattet mit dem Einsatzbefehl vermehren sie sich und nehmen den Kampf mit dem Krebs auf. Oder – wie bei Gerhard G. – das Risiko verringern, dass der Krebs nach der OP zurückkommt. Auch mit nur einer Niere kann der Pfarrer fast wieder so leben wie vor der Krankheit: „Ich arbeite wieder voll in meinem Beruf. Da vergisst man – Gott sei Dank – auch einen Teil der Krankheit wieder. Es wird halt dann immer sehr spannend, wenn die Zeit zur Nachuntersuchung kommt. Aber ein Stück weit – ja, gewöhnen kann man sich daran nicht. Aber man genießt die Zwischenzeit dafür umso mehr.“ Bei dem Tübinger Urologen Professor Arnulf Stenzl laufen Studien mit dem neuen Impfmittel. Er ist von dem Konzept dieser Therapie überzeugt: „Mit der Impftherapie, also mit der Stimulierung des Immunsystems, haben wir die Möglichkeit, die körpereigene Abwehr dahin zu bringen, dass sie Tumorzellen als Impfen gegen Krebs. Auch wenn die ersten Ergebnisse Anlass zur Hoffnung geben: Noch ist die neue Therapie in einer experimentellen Phase. Es wird noch Jahre dauern, bis die Wirkung zweifelsfrei erwiesen ist und die Impfung als normale Therapie zugelassen wird. Sendung vom 12.08.2010 |5 Gefährliches Kunstlicht von Volker Ide Brustkrebs ist in Deutschland, wie in ganz Europa und in Nordamerika, der häufigste Krebs bei Frauen – er macht fast 30 Prozent der Krebserkrankungen aus. Das Erstaunliche: In den Industrieländern tritt Brustkrebs fünfmal häufiger auf als in weniger entwickelten Ländern. Genetische Unterschiede können nicht die Ursache sein. Denn wenn Frauen aus China, Westafrika oder Thailand in ein Industrieland auswandern, nimmt auch bei ihnen die Zahl der Brustkrebserkrankungen zu. Wissenschaftler suchen seit vielen Jahren weltweit nach den Ursachen. Der amerikanische Krebsforscher Richard Stevens hatte eine beunruhigenden Vermutung: Das viele künstliche Licht, das bei uns die Nacht zum Tag macht, könnte ein Faktor sein. Denn das Kunstlicht bringt den Hormonhaushalt unseres Körpers gewaltig durcheinander. „Andere Kollegen dachten: Das ist doch verrückt, wie kann Licht eine so schreckliche Krankheit wie Brustkrebs hervorrufen? Aber im Laufe der Jahre interessierten sich immer mehr Leute dafür, wie Licht unseren Alltag, unseren Schlafrhythmus und unser Hormonsystem verändern kann. Eben für alles, was im Zusammenhang mit der Zunahme von Brustkrebs stehen könnte. Inzwischen ist aus meiner Idee mehr geworden: Ein begründeter Verdacht, dem nachgegangen werden muss“, erklärt der Wissenschaftler. Es scheint, dass jenseits der Zapfen und Stäbchen, die in unseren Augen das Sehen ermöglichen, weitere Rezeptoren existieren, die offensichtlich über den Außenreiz Licht einen starken Einfluss auf unsere innere Uhr haben. Und damit auf die Produktion von Melatonin: „Melatonin ist ein kleines Molekül, das im Gehirn entsteht. Es beeinflusst andere Hormone. Melatonin und Brustkrebs hängen so zusammen: Zum einen verlangsamt Melatonin das Wachstum von Tumoren. Zum anderen hemmt es die Produktion von Östrogenen. Wird weniger Melatonin gebildet, steigt also der Östrogenpegel. Und wir wissen, dass Östrogene eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Brustkrebs spielen“, so der Krebsforscher. Tatsächlich: Blinde Frauen erkranken weniger häufig an Brustkrebs Wenn die Hypothese von Professor Richard Stevens stimmt, müssten blinde Menschen weniger Krebs Der amerikanische Krebsforscher Richard Stevens bekommen. Und tatsächlich fanden Forscher heraus, dass blinde Frauen beispielsweise weniger häufiger an Brustkrebs erkranken als Sehende. An der Medizinischen Hochschule von Harvard stieß Professor Stevens auf weitere Hinweise. Dort lagern Daten von 120.000 Krankenschwestern, die jedes Jahr Fragebögen zu ihrer Gesundheit ausfüllen. Vor allem bei Nachtschichten sind Krankenschwestern viel künstlichem Licht ausgesetzt. Stimmt die Hypothese von Professor Stevens, wäre ein erhöhtes Krebsrisiko die Folge. Und tatsächlich, auch hier ist das Ergebnis eindeutig: Je öfter die Krankenschwestern nachts arbeiten, desto häufiger erkranken sie an Brustkrebs. Und eine Blutproben-Analyse von Krankenschwestern zeigte es ganz deutlich: Nachtschwestern haben deutlich weniger Melatonin, und mehr Brustkrebs fördernde Östrogene im Blut. Viel Kunstlicht während der Nacht bedeutet also weniger Melatonin und ein erhöhtes Krebsrisiko. Was lange nur die Hypothese eines amerikanischen Professors war, scheint sich jetzt zu bestätigen. Im OktoSendung vom 12.08.2010 |6 ber 2007 hat die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bestimmte Formen von Schichtarbeit als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Am Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Sozialhygiene der Uniklinik Köln wurden rund 30 weltweite Studien zum Thema Schichtarbeit und Krebs ausgewertet – mit bemerkenswerten Ergebnissen. Die Kölner Wissenschafter interessieren sich hierbei vor allem für den Zusammenhang zwischen externen Zeitgebern, insbesondere dem Licht, und der Möglichkeit, Krebs zu bekommen. Die Studie ergab ein erhöhtes Krebsrisiko bei Flug- und Schichtpersonal Ein zentrales Ergebnis dieser so genannten MetaAnalysen (Auswertungen von Studienergebnissen zur gleichen Fragestellung) ist, dass sich bei den beiden untersuchten Studiengruppen, nämlich Flugpersonal und Schichtpersonal, eine statistisch signifikante Risikoerhöhung für Krebs zeigt. „Auch wenn die Erhöhung des Risikos nicht zu vergleichen ist mit beispielsweise der Risikoerhöhung beim Rauchen“, wie der Arbeitsmediziner am Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Sozialhygiene, Dr. Thomas Erren, betont. Bei Flugpersonal stellte sich ein um 70 Prozent höheres Brustkrebsrisiko heraus, für Prostatakrebs stieg das Risiko um 40 Prozent. „Ähnliche Ergebnisse erhielten wir bei Schichtpersonal“, erklärt Privatdozent Thomas Erren. Die Erforschung der Hintergründe für das gestiegene Krebsrisiko bei Schichtarbeit ist relativ neu. Doch für Thomas Erren ein ausreichender Grund, etwa in der Arbeitswelt bereits heute Änderungen einzuführen: „Das heißt: Ungeachtet der gesicherten Ursachenkette, die wir momentan noch nicht kennen, gibt es auf jeden Fall einen Faktor, den wir bereits jetzt beeinflussen können: Licht.“ Er schlägt daher vor, die Licht-Dunkel-Verhältnisse für Schichtarbeiter dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus anzunähern, um die inneren Uhren schneller auf Nachtarbeit umzustellen. Das könnte einer vermuteten Bildung von Krebs möglicherweise vorbeugen. Die nächtliche „Lichtbeschallung“ ist also ein Risiko für unsere Gesundheit. Doch wer jetzt denkt, er könnte mit Melatonin-Tabletten sein Defizit ausgleichen, sei gewarnt. Denn, so der Arbeitsmediziner Thomas Erren: „Aus meiner Sicht ist Melatonin mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schlüsselsubstanz. Aber eben nicht ausschließlich für diese Phänomene. Die Wechselwirkung etwa im Körper, auch mit anderen Substanzen, sind aus meiner Sicht viel zu wenig verstanden, als dass man Melatonin an dieser Stelle womöglich einsetzen kann.“ Was man auf jeden Fall für die nächtliche Lichthygiene tun kann Etwas kann man allerdings auf jeden Fall für die nächtliche Lichthygiene tun: Nicht bei laufendem Fernseher einschlafen, oder das Gerät am besten ganz aus dem Schlafzimmer verbannen. Und auch die Nachttischlampe sollte vor dem Einschlafen ausgeschaltet werden. Lichthygiene: die Nachttischlampe vor dem Einschlafen ausschalten Die Ursache liegt vermutlich in der Art der Lichtquelle. Amerikanische Wissenschaftler um Professor Stevens fanden nämlich heraus: Vor allem blaues Licht, das in den meisten künstlichen Lichtquellen vorkommt, unterdrückt die Melatoninproduktion. Rot dagegen nicht. Doch ob das Licht allein die Wurzel des Übels ist, können die Wissenschaftler noch nicht endgültig sagen. Eine Rolle in der Krebsentwicklung kann auch die Art der Nahrung, die der Schichtarbeiter abends zu sich nimmt, spielen. Sendung vom 12.08.2010 |7 Lymphknoten metastasieren nicht von Markus Hubenschmid Es ist ein hundert Jahre alter Standard in der Krebstherapie. Findet der Arzt einen bösartigen Tumor, dann entfernt er meistens auch die Lymphknoten. Denn die Lymphknoten stehen im Verdacht, Metastasen zu bilden und neue Krebsgeschwüre zu produzieren. Doch dieser Verdacht wird jetzt von Medizinern des Tumorregister München in Frage gestellt. Ihre These: Metastasen, also Tochtergeschwülste, sind nicht an der Streuung weiterer Krebs Bei einem bösartigen Tumor werden meistens auch die Lymphknoten entfernt zellen beteiligt. Doch was bedeutet dieser Befund aus den Krebsregisterdaten für die Operationspraxis? Und welchen Nutzen haben beispielsweise Brustkrebs-Patientinnen überhaupt, wenn ihnen bei einer Tumor-Erkrankung routinemäßig Lymphknoten entfernt werden? Wir treffen Ivanka Klaus, eine lebensfrohe und aktive Frau. Dass sie eine schwere Krankheit hat, sieht man ihr nicht an. Doch in ihrem letzten Urlaub ertastete die Krankenschwester einen Knoten in der Brust. Die traurige Diagnose: Brustkrebs. „Zuerst war ich sehr schockiert. Ich habe vor mir einen Berg gesehen, vor mir das Ende der Welt gesehen und ich dachte, so das war’s jetzt.“ Doch Ivanka Klaus hatte Glück im Unglück, der Tumor in der Brust hatte noch nicht gestreut. Die drei Lymphknoten, die man ihr zur Kontrolle entfernte, waren noch nicht von Metastasen befallen. Ein Befund, der große Erleicheterung für sie bedeutete. Welchen Nutzen haben die Patientinnen von der Entfernung der Lymphknoten? Viele Frauen haben weniger Glück. Ihnen werden zahlreiche Lymphknoten in der Achselhöhle entfernt. Ein Eingriff, der zu erheblichen Beschwerden führen kann. Deshalb ist jetzt unter Experten ein Diskussion über den Nutzen der Lymphknoten-Entfernung entbrannt, obwohl die Achselhöhle bei Brustkrebs schon seit ein paar Jahren viel schonender operiert wird als früher. Um herauszufinden, welches Vorgehen für Patientinnen mit Lymphknoten-Metastasen am besten ist, besuchen wir zunächst das Tumorregister München im Universitäts-Klinikum Großhadern. Dort hat die Diskussion ihren Ausgang genommen. Die Professoren Jutta Engel und Dieter Hölzel kritisieren die bestehende Operationspraxis und halten die großzügige Entfernung der Lymphknoten für nicht mehr zeitgemäß. „Wir gehen davon aus, dass heute etwa 20.000 Frauen jedes Jahr einen positiven Wächterlymphknoten haben und dann ist entsprechend der Leitlinien weiter zu operieren. Von diesen 20.000 haben ungefähr 40 Prozent Einschränkungen der Armbeweglichkeit oder Lymphödeme“, so Prof. Hölzel. Die Forscher haben sich ausführlich mit der Lymphknoten-Entfernung und der Metastasen-Bildung beschäftigt. Sie haben über 400.000 Patienten-Daten und zahlreiche internationale Studien ausgewertet. Prof. Dieter Hölzel erläutert das Ergebnis: „Wir halten die Entfernung der Lymphknoten für eine Übertherapie, weil wir an den Tumorregister-Daten gesehen haben, dass es keinen Einfluss auf das Überleben hat. Der Standard ist, dass mindestens zehn Lymphknoten entfernt werden. Wenn wir jetzt die Hypothese haben, dass diese Lymphknoten keine Fernmetastasen machen, dann ist deren Entfernung überflüssig.“ Sollte diese Hypothese tatsächlich stimmen, so wären befallene Lymphknoten keine Quelle von Metastasen und damit nicht an der weiteren Ausbreitung des Tumorleidens beteiligt. Stattdessen würden sich Sendung vom 12.08.2010 |8 Metastasen nur über die Blutbahn, durch Zellen des Haupttumors im Körper ausbreiten. Eine gewagte These: Stürzt ein Dogma der Krebsmedizin? Unumstritten: Die Notwendigkeit, den Wächter-Lymphknoten für Diagnosezwecke zu untersuchen An der Universitäts-Frauenklinik Tübingen treffen wir die Brustkrebsspezialistin Tanja Fehm. Was meint sie zur These, dass von Lymphknoten, die von Tumorzellen befallen sind, keine Gefahr ausgehe? Prof. Tanja Fehm : „Also es ist in der Regel so, dass die Lymphknoten sicher nicht die Hauptursache von Metastasen sind. Man versteht den Brustkrebs ja als eine systemische Erkrankung. Das heißt, obwohl wir ein lokales Tumorgeschehen haben, wissen wir, dass die Mammakarzinome schon frühzeitig Tumorzellen in die Blutlaufbahn abgeben, die dann möglicherweise später auch die Metastasierung verursachen können. Nichtsdestotrotz kann man nicht ausschließen, dass Tumorzellen auch den Weg über die Lymphbahnen und von da aus in den Blutkreislauf nehmen.“ Von Lymphknoten könnte also zumindest eine kleine Metastasen-Gefahr ausgehen. Unumstritten bleibt allerdings die Notwendigkeit, den sogenannten Wächter-Lymphknoten für Diagnosezwecke zu untersuchen. Das ist der am nächsten beim Tumor liegende Knoten. Ist er von Tumorzellen befallen, so kommt es zur kritisierten Entfernung von mindestens zehn Lymphknoten in der Achsel. Doch warum operiert man nicht nur tatsächlich befallene, sondern auch negative Knoten, wenn die großzügige Entfernung angeblich keinen Einfluss auf die Überlebenszeit hat? Am Institut für Pathologie der Uniklinik Tübingen werden entnommene Lymphknoten auf Tumorzellen untersucht. Prof. Falko Fend ist Experte für die Ursachen und Verlaufsformen von Krebserkrankungen. Was sagt er zum Vorwurf der Übertherapie? Prof. Falko Fend: „Es ist sicher so, dass für einen Teil der Patientinnen dies eine Übertherapie darstellt. Aber wir wissen von neueren Studien vor allem von Frauen, die eine zusätzliche Chemotherapie zur Operation erhalten haben, eine sogenannte adjuvante Chemotherapie, dass sie von der Lymphknoten-Entfernung profitieren. Es sind vielleicht 10, 20 Prozent der Frauen, die davon profitieren. Aber wir wissen eben noch nicht welche dieser Frauen und man wird sicher noch viel Arbeit investieren müssen, um herauszufinden, welche Frauen diese Lymphknoten-Entfernung brauchen und bei welchen man eventuell darauf verzichten kann.“ Für Patientinnen gilt weiterhin: ist der Wächterlymphknoten befallen, werden die Achsellymphknoten entfernt Ein Ausweg aus dem Dilemma könnte sein, die Therapie künftig noch stärker zu individualisieren. Ob die Münchner Forscher dagegen Recht behalten mit ihrer These, soll eine von ihnen angestrebte, klinische Studie klären. Für die Patientinnen bedeutet das: Ist der Wächterlymphknoten befallen, bleibt die Operation der Achsellymphknoten bis auf weiteres Standard. Prof. Dieter Hölzel will seine Hypothese in einer Studie testen Prof. Tanja Fehm: „Also ich denke, die LymphknotenEntfernung hat ja mehrere Aufgaben. Zum einen hat sie die Aufgabe, dass man die Prognose der Patienten besser einschätzen kann. Es ist ein deutlicher Unterschied, ob die Patientin nur einen befallenen Lymphknoten hat oder acht, oder neun. Weil das würde das Therapiekonzept für die Patientin deutlich ändern. Deshalb hat die Lymphknoten-Entfernung die wesentliche Aufgabe die Patientin von der Prognose besser einschätzen zu können und das Therapiekonzept besser wählen zu können.“ Sendung vom 12.08.2010 |9 A d re s s e n L i n ks Tumorregister München (TRM) [www.nct-heidelberg.de] Munich Cancer Registry (MCR) Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) am IBE / Klinikum Großhadern Universitätsklinikum Heidelberg. Marchioninistr. 15 D-81377 München [www.immatics.net] [www.tumorregister-muenchen.de] Internetseite der immatics biotechnologies GmbH in Tübingen. PD. Dr. Thomas C. Erren Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin [www.faz.net] und Sozialhygiene Ein Dogma der Krebsmedizin fällt. Ein Bericht in der Universitätsklinikum Köln FAZ-online vom 7. Februar 2009. Kerpener Straße 62, Haus 11 B D-50924 Köln [de.wikipedia.org/wiki/Metastase] [cms.uk-koeln.de/arbeitsmedizin] Informationen zu Metastasen bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Prof. Dr. med. Tanja Fehm Universitätsfrauenklinik Tübingen Calwer Str. 7 D-72076 Tübingen [www.uni-frauenklinik-tuebingen.de] Ko n t a k t Prof. Dr. Falko Fend Südwestrundfunk (SWR) Institut für Pathologie FS-Wissenschaft und Bildung Eberhard-Karls-Universität Tübingen Redaktion Odysso Liebermeisterstraße 8 76522 Baden-Baden D-72076 Tübingen E-Mail: [email protected] [www.path.med.tum.de] [www.swr.de/odysso/] Unsere nächste Sendung kommt am 19. August 2010: M A N N H AT ‘ S N I C HT L E I C HT ( Wi e d e r h o l u n g vo m 0 4 . 0 3 . 2 0 1 0 ) Männer sterben früher als Frauen, Männer bekommen mehr schwere Krankheiten wie Diabetes, Arteriosklerose oder Krebs. Männer leider häufiger an Burnout und Überarbeitung. Schon Jungs schneiden in der Schule schwächer ab als Mädchen, brechen häufiger die Lehre ab oder das Studium. Sie sind aggressiver und werden häufiger sozial auffällig. Wo liegen die Gründe für all diese Probleme? Ist es die genetische Veranlagung oder das Testosteron? Besitzen Männer grundsätzlich weniger soziale Kompetenz? Macht der Stress im Beruf sie krank? Liegt es am Lebenswandel der Männer, die zuviel arbeiten, rauchen, trinken und sich von Fast-Food ernähren? Sind Männer also das „schwache Geschlecht“ ohne Selbstbeherrschung? Oder in Wirklichkeit der benachteiligte Teil der Menschen? Odysso hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Sendung vom 12.08.2010 | 10