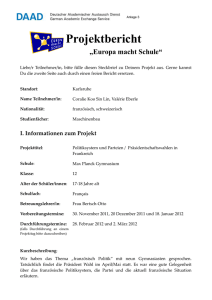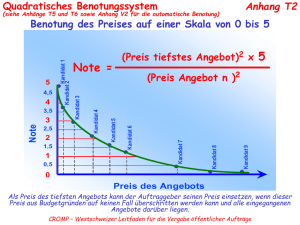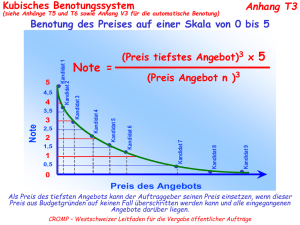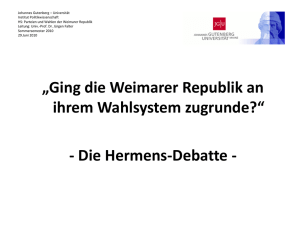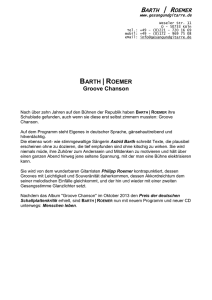wissen als die Amis? - Universität Regensburg
Werbung

FRP Kommentar 02/2012 www.regensburger-politikwissenschaftler.de Mehr wissen als die Amis? Die Beobachtung des US-Wahlkampfs im Zeitalter des Internets von Scot W. Stevenson August 2012 Anfang des Jahres wurde ich gebeten, in einem Hörfunk-Interview über den Vorwahlkampf der Republikaner zu sprechen. Beim Vorgespräch ging es neben den üblichen Themen wie die Rolle der Medien, der Einfluss von SuperPAC-Spenden und die Dauer des Wahlkampfes auch um einzelne Kandidaten. Der Moderator sprach dabei zu meiner Überraschung den ehemaligen Gouverneur Buddy Roemer an. Ich hatte den Namen zwar schon mal gehört, mich aber ehrlich gesagt nicht um seine Bewerbung gekümmert: Zu sehr war ich davon überzeugt, dass er nicht die geringste Chancen auf die Nominierung haben würde. Mein Gegenüber wies dagegen ein umfassendes Wissen über Roemers Ansichten und politisches Programm auf. Es stellte sich heraus, dass der Republikaner seinen Wahlkampf zum großen Teil auf Internet-Diensten wie Twitter aufgebaut hatte, die der Moderator verfolgte. Ich nicht. Und so wusste der Journalist deutlich mehr als ich, der angebliche Experte. Dass das Internet den Wahlkampf in den USA verändert hat, ist spätestens seit dem Sieg des Demokraten Barack Obama 2008 eine Binsenweisheit. Weniger bekannt ist, wie es die Situation für politisch Interessierte im Ausland ändert. Der direkte Zugang zu den Reden der Politiker (YouTube, Twitter), ihren Programmen (Webseiten) und die Möglichkeit, politische Diskussionen zu verfolgen oder sogar daran teilzunehmen (Facebook, Google+, Foren) erlaubt eine Beschäftigung mit den Bewerbern und Themen in einer bislang nie dagewesenen Breite und Tiefe. Ein Deutscher mit guten Englischkenntnissen kann mit genug Fleiß einen Wissensstand erreichen, der über den eines Durchschnittsamerikaners liegt, ohne jemals in die USA zu reisen. Allerdings ergeben sich eine Reihe neuer Probleme. Da eine systematische Erfassung fehlt, werden diese hier anekdotenhaft vorgestellt. Dabei kristallisiert sich eine Schwierigkeit heraus: Probleme bei der Einordnung aufgrund von fehlendem Hintergrundwissen. Wir können hier mit dem Beispiel Roemer fortfahren. Erst durch das Internet ist auch in Übersee klar geworden, wie viele Bewerber es eigentlich bei einer US-Präsidentenwahl gibt, denn die klassischen Medien wie Fernsehen und Zeitung neigen in den USA wie im Ausland dazu, die faktisch chancenlosen Kandidaten schon allein aus Platz- und Zeitgründen auszuklammern. Als einfaches Experiment dazu mag man einen politischen interessierten Deutschen, der sich nicht so stark über das Internet informiert, nach einem der demokratischen Gegenbewerber von Obama fragen. Die wenigsten können einen Namen wie John Wolfe, Jr. nennen. In der Regel ist nicht einmal bekannt, dass Obama Rivalen hat, obwohl viele wissen, dass auch die Demokraten einen Nominierungsparteitag abhalten. –1– FRP Kommentar 02/2012 www.regensburger-politikwissenschaftler.de Angesichts der fehlenden Berichterstattung in den amerikanischen und deutschen Medien kann man zwar ahnen, dass diese Gegenbewerber keine zentrale Rolle spielen können. Allerdings bringt die neue Information zumindest Unsicherheiten mit sich. Ist vielleicht doch ein Überraschungssieg möglich? Nehmen die Medien Einfluss auf den Ausgang der Wahl, weil sie Bewerber wie Wolfe nicht berücksichtigen? Modelle aus der Heimat helfen nur begrenzt: Dass sich eigentlich chancenlose Kandidaten bei einer Wahl aufstellen lassen, ist zwar auch im deutschen System nicht unbekannt. Man denke an einen Kanzlerkandidaten der Grünen oder die vielen SPDMitglieder, die über Jahrzehnte bei den Landtagswahlen in Bayern gegen eine übermächtige CSU angetreten sind. Allerdings ist hier die Motivation eines „treuen Parteisoldaten“ mit Aussicht auf eine spätere Belohnung durch die Parteiführung einfacher zu verstehen als warum eine Einzelperson die Kosten und Mühen eines amerikanischen Vorwahlkampfes auf sich nehmen würde. Auch die Kongresswahl wirft Fragen auf. Schaut man sich aufmerksam die Kandidatenlisten bei einer Website wie dem RaceTracker Project an, findet man Bezirke, in denen nur ein Kandidat der beiden großen Parteien antritt, da sein Sieg als sicher gilt. Einen Gegenbewerber der anderen Partei gibt es nicht. Als Beispiel mag in diesem Zyklus der Bezirk TX-03 in Texas dienen, wo es keine demokratische Alternative zum republikanischen Amtsinhaber Samuel Johnson geben wird. Auch dies ist kein ungewöhnliches Phänomen für die USA, wo die Parteien von sich aus keine Kandidaten aufstellen können. Für den deutschen Betrachter stellt sich dagegen im Extremfall die Frage nach dem Demokratieverständnis, wenn dem Wähler faktisch nur ein Kandidat geboten wird. Die bisherigen Beispiele betreffen Situationen, in denen das Internet einen Zugang zu neuen Informationen, bislang unbekannten Details sowie zu Randaspekten bietet. Probleme bei der Einordnung finden wir allerdings auch, weil bekannte Debatten genauer verfolgt werden können, sprich, es mehr in die Tiefe als die Breite geht. Hier sticht insbesondere im Präsidentschaftswahlkampf die Frage nach der Haltung zu einem Recht auf Abtreibung heraus. Jeder amerikanischer Kandidat muss dazu Stellung beziehen und in den US-Medien und in politischen Diskussionen wird der Frage viel Platz eingeräumt. Im Internet wird die Debatte noch lauter geführt, zum Teil mit äußerst scharfen Formulierungen. Es ist daher schwierig zu erklären, dass die Haltung des Präsidenten zur Abtreibung eigentlich von nachgeordneter Bedeutung ist. Bekanntlich könnte das Oberste Gericht das Urteil Roe vs Wade aufheben oder der Kongress im Extremfall die Verfassung ändern, aber die Exekutive ist weitgehend machtlos. Die Meinung Obamas oder des republikanischen Bewerbers Mitt Romney zur Abtreibung soll vielmehr Rückschlüsse auf den Charakter dieser Männer zulassen. Dies gilt auch für eine Reihe von verwandten Fragen wie die zur gleichgeschlechtlichen Ehe (primär Sache der Bundesstaaten) oder die religiösen Ansichten (vgl. Rolle des Bundes nach dem Ersten Verfassungszusatz). In politischen Systemen wie das der Bundesrepublik, in denen weniger der einzelne Kandidat als die Partei im Fokus steht, spielen vergleichbare Fragen eine entsprechend untergeordnete Rolle. Auch hier bietet das Bekannte nur eine geringe Hilfestellung. –2– FRP Kommentar 02/2012 www.regensburger-politikwissenschaftler.de Es lassen sich weitere Beispiele finden. Zusammengefasst können wir nach der bisherigen Auflistung jedoch sagen, dass das Internet mehr von der Komplexität des amerikanischen Wahl- und Staatssystems offengelegt hat, als bislang vom Ausland her einsehbar war, und dass dies zu Schwierigkeiten bei der Einordnung führen kann. Die Situation ist zu neu, um die Folgen klar absehen zu können. Spekulativ könnte man mehr Druck auf die klassischen Medien erwarten, sich in größerer Tiefe und Breite als bislang mit dem amerikanischen System zu beschäftigen, zum Beispiel durch mehr Berichte über andere Bewerber. Die Medien würden dabei allerdings riskieren, die Leser und Zuschauer zu vertreiben, die nur über die großen Linien und wirklich wichtigen Entwicklungen informiert werden wollen. Bieten sie andererseits jedoch nicht weitergehende Informationen an, riskieren sie, gerade die interessiertesten Leser an Quellen im Internet zu verlieren. Allerdings wäre auch ein Lernprozess denkbar, so dass sich nach den Erfahrungen mit einigen US-Wahlzyklen viele Fragen für politisch Interessierte gar nicht mehr stellen. Um zu unserem ursprünglichen Beispiel zurückzukehren: Roemer gab im Mai 2012 seinen Präsidentschaftswahlkampf auf. Scot W. Stevenson ist Autor und Blogger – [email protected] Kontakt: Forum Regensburger Politikwissenschaftler Institut für Politikwissenschaft, Universität Regensburg Universitätsstraße 31, D-93053 Regensburg [email protected] –3–