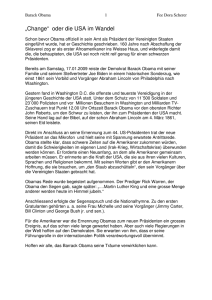Barack Obama und der Libyen-Krieg - Hanns-Seidel
Werbung

POLITISCHER BERICHT AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA Dr. Ulf Gartzke Leiter der Verbindungsstelle Washington Nr. 10/2011 – 26. Juli 2011 IMPRESSUM Herausgeber Copyright 2011, Hanns-Seidel-Stiftung e.V., München Lazarettstraße 33, 80636 München, Tel.: +49 (0)89 1258-0, E-Mail: [email protected], Online: www.hss.de Vorsitzender Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair, Staatsminister a.D., Senator E.h., Hon.-Prof. Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Witterauf Verantwortlich Ludwig Mailinger Leiter des Büros für Verbindungsstellen Washington, Brüssel, Moskau / Internationale Konferenzen Hanns-Seidel-Stiftung e.V. Tel.: +49 (0)89 1258-202 oder -204 Fax: +49 (0)89 1258-368 E-Mail: [email protected] Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Berichtes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das Copyright für diese Publikation liegt bei der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Die Autoren tragen für ihre Texte die volle Verantwortung. 1 Barack Obama und der Libyen-Krieg ¾ Angesichts des aktuellen Ringens zwischen dem amerikanischen Präsidenten Obama und dem US-Kongress über die Anhebung der nationalen Schuldengrenze gerät ein weiterer Krisenherd zunehmend aus dem, nicht zuletzt medialen, Fokus: der Libyen-Krieg. ¾ Dieser Konflikt, obgleich aus amerikanischer Sicht militärisch wenig herausfordernd, befindet sich aktuell in seinem fünften Monat. Alle euphorischen Hoffnungen auf einen schnellen Sieg haben getrogen. Oberst Gaddafi hält sich noch immer in Tripolis auf, auch wenn seine Einflusszone geschwunden ist, und noch immer weiß im Westen wohl niemand so recht, wem man da in Gestalt der Rebellen eigentlich den Vormarsch frei bombt. ¾ Während Gaddafis militärisches Potential zur Bedrohung von US-Interessen weiter schrumpft, sofern dieses in der jüngeren Vergangenheit denn überhaupt noch veritable Ausmaße aufwies, wächst wegen der finanziellen Lasten und der umstrittenen Legitimität des Krieges der politische Druck auf Obama. ¾ So lagen die Kosten des amerikanischen Libyen-Einsatzes bereits Mitte Mai bei über 650 Millionen US-$ und werden bis September, zum avisierten Einsatzende, auf fast 850 Millionen US-$ anwachsen – so die zurückhaltenden Schätzungen der US-Regierung. Angesichts von Wirtschaftskrise und drohendem Staatsbankrott sind diese Ausgaben einer breiten Mehrheit des amerikanischen Volkes nicht mehr zu vermitteln – und das nicht nur aus finanziellen Erwägungen heraus oder infolge einer lähmenden Kriegsmüdigkeit, welche die USA nach 10 Jahren Afghanistan und Irak fraglos ergriffen hat. ¾ Vielmehr werden die Gründe für den Einsatz in Frage gestellt. So waren in Libyen keine USInteressen unmittelbar bedroht, weshalb denn auch der damalige US-Verteidigungsminister Gates seinem Präsidenten ebenso von einem Einsatz abriet wie Obamas Nationaler Sicherheitsberater Tom Donilon. Deren Stimmen fanden jedoch nicht das Gehör des Präsidenten. ¾ Erfolgreicher waren in dieser Beziehung die US-Außenministerin Hillary Clinton und Samantha Power, eine ehemalige Bürgerrechtsanwältin, sowie die US-Botschafterin bei der UNO, Susan Rice, die vor einer drohenden humanitären Katastrophe in Libyen warnte. Auch wenn Barack Obama dieses Argument überzeugte, die Mehrheit des amerikanischen Volkes überzeugte es nicht. ¾ Hier herrscht vielmehr deutliche Skepsis. Eine unbedingte Notwendigkeit für ein aus humanitären Gründen notwendiges Eingreifen wird unter Verweis auf deutlich schwerwiegendere Menschenrechtsverletzungen in anderen Teilen der Welt oftmals bestritten. Auch die positiven Auswirkungen, welche bei einer Beseitigung Gaddafis für das libysche Volk zu erwarten wären, verfügen angesichts der Situation im Irak und der großen Opfer unter Befreiten und Befreiern dort nur über eine geringe Strahlkraft. 2 ¾ Nun ist Barack Obama nicht unmittelbar den Stimmungen seines Volkes unterworfen, den Vorgaben der amerikanischen Gesetzgebung allerdings schon. Entsprechend schwer wiegt denn auch der Vorwurf an Präsident Obama, die US-Verfassung gebrochen zu haben. ¾ Diese billigt nämlich nur dem US-Kongress die Entscheidung über einen Kriegseintritt der USA zu. Auch wenn in nur knapp fünf Prozent der Fälle, in denen ein amerikanischer Präsident seine Streitkräfte in einen Einsatz entsandte – keine andere Nation der Neuzeit hat häufiger militärische Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele angewandt als die USA – eine formelle Kriegserklärung erfolgte, war jeder Präsident hierbei stets um eine enge Zusammenarbeit mit dem US-Kongress bemüht. ¾ Hinzu kommt die im Jahr 1973, zur Zeit des Vietnamkrieges, vom Kongress verabschiedete „War Powers Resolution“, die den amerikanischen Präsidenten verpflichtet, spätestens 90 Tage nach dem Beginn einer größeren Militäroperation die Zustimmung des Kongresses einzuholen. Dieser Verpflichtung ist Präsident Obama für den Libyen-Einsatz bislang nicht nachgekommen; ebenso wenig übrigens wie sein Amtsvorgänger Clinton für die Bombardierung Jugoslawiens 1999. ¾ Angesichts der verfassungsrechtlichen Relevanz dieser Frage leisten nicht nur die gegnerischen Republikaner Widerstand. Auch unter den Demokraten im Kongress mehren sich die Stimmen mit dezidierter Kritik am Vorgehen des Präsidenten. Neben verfassungsrechtlich oder pazifistisch motivierten Zweifeln ist es auch die Art und Weise des Zustandekommens des Libyen-Einsatzes, die nicht wenige demokratische Kongressabgeordnete in die Opposition zu Obama treibt, erschien doch vielen ihr Präsident bei dieser Entscheidung nicht als treibende Kraft, sondern vielmehr als ein von europäischen, insbesondere französischen Interessen, Getriebener. ¾ Aus europäischer Sicht könnten sich auch die NATO-kritischen Töne als gefährlich erweisen, welche sich in die inneramerikanische Libyen-Debatte mischen. Hier werden insbesondere die massiven militärischen Unzulänglichkeiten der europäischen NATO-Staaten als Konsequenz ihrer drastisch gekürzten Militärausgaben heftig kritisiert. So wird vermerkt, dass Großbritannien und Frankreich bereits wenige Wochen nach Beginn der Militäraktion an die Grenzen ihrer militärischen Leistungsfähigkeit gestoßen sind und bei Munition bzw. Ersatzteilen auf massive US-Unterstützung angewiesen waren – ein Umstand, der auf den Fluren des Pentagon hinter vorgehaltener Hand oftmals für blankes Entsetzen sorgte. ¾ Klar und offen ausgesprochen wurde die amerikanische Kritik von US-Verteidigungsminister Gates kurz vor Ende seiner Amtszeit. In seiner Abschiedsrede bei der NATO Anfang Juni beleuchtete Gates schonungslos die Defizite der europäischen NATO-Alliierten und sagte dem transatlantischen Bündnis gar eine trostlose Zukunft voraus. ¾ Der damalige Verteidigungsminister verwies auf eine neue Generation amerikanischer Politiker, die nicht mehr durch die Erfahrungen des vergangenen Kalten Krieges geprägt seien. Diese könnten, so Gates, in nicht allzu ferner Zukunft zu dem Schluss gelangen, dass sich die amerikanischen Investitionen in die NATO angesichts der mangelhaften militärischen Fähigkeiten auf der europäischen Seite aus sicherheitsökonomischen Gründen schlicht nicht mehr lohnen würden. 3 ¾ Dass auf diese berechtigte Kritik des US-Verteidigungsministers von französischer Seite geradezu herablassend reagiert wurde und sich Gates von Präsident Sarkozy überdies noch Kritik an einem vermeintlich zu geringem Engagement der USA anhören musste, ist in Washington bei vielen eingefleischten NATO-Befürwortern auf völliges Unverständnis gestoßen. ¾ Zeitlich näher und für Barack Obama politisch bedeutsamer als der langfristige Fortbestand der NATO sind jedoch die US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Insbesondere hier wird sich das politische Kapital auszahlen können, welches den Republikanern derzeit aus der Libyen-Krise erwächst. ¾ So haben die derzeit führenden Kandidaten unter den potentiellen republikanischen ObamaHerausforderern, Mitt Romney und Michelle Bachmann von der Tea Party, bereits Libyen als Wahlkampfthema entdeckt. Insbesondere ihre Kritik daran, dass Präsident Obama bislang weder die vitalen nationalen Interessen hinter dem Libyen-Einsatz benannte noch eine klare Exit-Strategie für die US-Truppen formuliert hat, findet breite Zustimmung. ¾ Somit könnte Oberst Gaddafi auch bei einer militärischen Niederlage ein später politischer „Triumph“ vergönnt sein. Der Autor dankt Dennis Prange für seine Hintergrundrecherchen in Vorbereitung dieses Berichts. +++