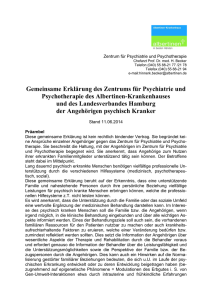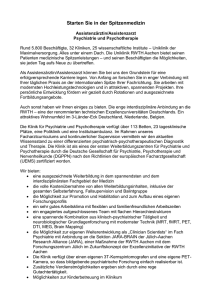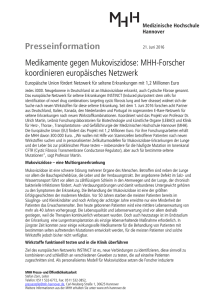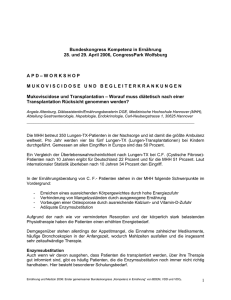Titelgeschichte - Medizinische Hochschule Hannover
Werbung

Titel mhh Info Februar/März 2005 Psyche in Not Zahlen und Fakten (ina) Im Zentrum Psychologische Medizin der mhh wurden im vergangenen Jahr knapp 4.600 Menschen ambulant und stationär behandelt, inklusive Notfälle. Davon versorgte die Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie rund 1.100 Fälle stationär. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Sozialpsychiatrie und Psychotherapie behandelten rund 350 Fälle auf ihren mhh-Stationen. Die stationäre Versorgung der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie lag bei 90 Fällen. Die durchschnittliche Verweildauer auf den Stationen betrug für die Patienten 22 Tage in der Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie, 38 Tage in der Abteilung Sozialpsychiatrie und Psychotherapie sowie 51 Tage in der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie. Insgesamt verfügen die drei Abteilungen über 130 Betten: die Klinische Psychiatrie hat 76, die Sozialpsychiatrie 40 sowie 20 Tagesklinikplätze und die Psychosomatik 14 mhh Info Februar/März 2005 Titel Mauer des Schweigens Psychische Krankheiten sind nach wie vor ein Tabuthema (ina) Ich werde noch wahnsinnig, du bist ja irre, sie ist total durchgeknallt – solche Sätze haben in unserer Alltagssprache einen festen Platz. Was mit ihnen gemeint ist, beschreibt nichts Gutes: Etwas in uns löst sich von der Vernunft ab, wir bekommen unser Leben nicht mehr in den Griff. Und wo wird das schlimmstenfalls enden? In der »Klapse«. Doch wer will schon als verrückt abgestempelt werden? Ist ja auch kein Wunder, deshalb schneidet die Allgemeinheit psychisch kranke Menschen, empfindet sie als Bedrohung und hält bewusst Abstand. Doch wie kommt diese Haltung zustande? Einmal natürlich, weil die meisten »Normalen« keinen Kontakt zu psychisch Kranken und damit keine Erfahrungen mit ihnen haben. Doch viele wollen mit psychisch Kranken auch nichts zu tun haben, sie nähren ihr Wissen aus Vorurteilen – aus Angst, Grenzen zu überschreiten? Diese Erfahrungen sammelten wir bei den Recherchen zum aktuellen Titelthema. Nach Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) werden in Deutschland von den Hausärzten bereits mehr als zehn Millionen Menschen mit psychischen Störungen pro Jahr versorgt – das ist nahezu jeder achte Einwohner und jeder vierte Patient. Warum hört man trotzdem so wenig von ihnen in den Medien? Erfolgsstorys über Patienten, die nach einer Organtransplantation munter weiterleben, gibt es genug – doch Geschichten über die Gesundung von »Geisteskranken« sind selten. Um sie herum steht eine Mauer des Schweigens. Dagegen hilft nur Aufklärung. Erst wenn die so genannten Normalen erkennen, dass sie sich – vielleicht unbewusst – gleichgültig gegenüber psychisch Kranken verhalten, wird es ihnen möglich, die »Anderen« zu verstehen. Kurzmeldungen Konzerte in der Psychiatrie (bb) Ab April dieses Jahres geben begabte Studierende der Hochschule für Musik und Theater weitere Konzerte in der mhh: Es sind Stücke für Klavier, Gesang, Streich- und Blasinstrumente. Unterstützt von der hannoverschen Gruppe des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now e.V. Hannover spielen sie am 6. April, 15. Juni, 5. Oktober (GospelChor), 26. Oktober und 30. November 2005 jeweils um 19 Uhr im großen Gemeinschaftsraum der mhh-Psychiatrie am Ende des Hauptgebäudes neben der Tagesklinik. Das Programm hängt im Leitflur der Psychiatrie, der Eintritt ist kostenlos. Eingeladen sind PsychiatrieErfahrene und deren Angehörige, Patientinnen und Patienten der somatischen Stationen, Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mhh. Kontakt: Dr. Peter Bastiaan, Telefon: (0511) 532-3185 PD Dr. Thomas Huber, (0511) 532-2404. Pavillon der Sinne (bb) Er ist eine Vision – der Pavillon der Sinne – doch die Mitglieder des gleichnamigen gemeinnützigen Vereins haben sich zum Ziel gesetzt, ihn wirklich werden zu lassen. Es sind mhh-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die psychisch Kranken sowie psychisch Gesunden ermöglichen wollen, in der mhh künstlerisch aktiv zu werden. »Dabei sollen die Menschen da abgeholt werden, wo sie gesund sind und Ressourcen haben. So sollen Selbstheilungskräfte aktiviert werden«, sagt Vera Stankovic, die das Projekt mitinitiierte. Der Pavillon soll ermöglichen, kreativ zu sein: Von der Malerei und Bildhauerei über das Schreiben und die Musik bis hin zur Wahrnehmung der verschiedenen Sinne. Der gewünschte Ort des zweistöckigen, insgesamt etwa 500 Quadratmeter großen Pavillons ist der Platz zwischen der Psychiatrischen Poliklinik und der Mensa. Der Bau soll auch ein Café beherbergen, um Kunstwerke ausstellen zu können und Begegnungen möglich zu machen. Nun sucht der Verein Ideen, tatkräftige Unterstützung, Mitglieder und Spenden. Kontonummer 900121475 bei der Sparkasse Hannover, BLZ 25050180. Kontakt: Vera Stankovic, Station 53b, Telefon: (0511) 532-3525 E-Mail: [email protected] 13 Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie Abteilungsleiter: Professor Dr. Friedhelm Lamprecht (bb) Die 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mhh-Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie befassen sich mit dem Erkennen, der psychotherapeutischen Behandlung, Vorbeugung und Rehabilitation von Krankheiten, die maßgeblich durch psychosoziale Faktoren wie beispielsweise durch lang andauernden Stress entstehen. Dies betrifft seelisch verursachte Essstörungen ebenso wie körperliche Symptome ohne organische Ursachen, beispielsweise Herzschmerzen oder chronische Funktionsstörungen des Dickdarms. Darüber hinaus kümmern sich die Beschäftigten um Menschen, die traumatische Erlebnisse hatten oder Angststörungen bzw. depressive Störungen haben. Ein weiteres wichtiges Arbeitsgebiet ist es, Menschen psychodiagnostisch zu untersuchen und psychotherapeutisch zu unterstützen, die chronische Erkrankungen bewältigen müssen – zum Beispiel einen Hörsturz, Schuppenflechte und Neurodermitis – oder einen schwerwiegenden medizinischen Eingriff wie eine Organtransplantation vornehmen lassen mussten. Klinische Psychiatrie und Psychotherapie Abteilungsleiter: Professor Dr. Dr. Hinderk M. Emrich (bb) Die mhh-Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie ist Teil der gemeindepsychiatrischen Konzeption von Hannover. Ihre 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um psychisch kranke Menschen, die im Norden und Osten Hannovers leben. Dabei sind multiprofessionelle Teams mit Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Psychologinnen und Psychologen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Ergo- und Kunsttherapeutinnen und -therapeuten sowie Pflegekräften für die Diagnostik, Therapie und Lebensplanung zuständig. Für Einwohnerinnen und Einwohner anderer Stadtbereiche Hannovers sind die Nervenklinik Langenhagen, das Landeskrankenhaus Wunstorf und die Wahrendorffschen Kliniken in Ilten zuständig. In der mhh-Abteilung werden hauptsächlich Patientinnen und Patienten behandelt, die Schizophrenien, affektive Psychosen, neurotische Entwicklungen, dementielle Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen oder Suchterkrankungen haben. Zudem existieren spezielle Arbeitsbereiche für Neurokognition und Sexualmedizin. Bei der Therapie auf den Stationen werden psychotherapeutische und medizinisch-pharmakologische Therapieansätze nicht gegeneinander gesetzt, sondern miteinander verbunden. Zudem wird eine Gleichrangigkeit von Teammitgliedern und Patienten im Sinne der »therapeutischen Gemeinschaft« angestrebt – zum Beispiel trägt keiner einen Kittel. Sozialpsychiatrie und Psychotherapie Abteilungsleiter: Professor Dr. Wielant Machleidt (bb) Die Sozialpsychiatrie hebt das soziale Ausmaß psychischer Störungen hervor. Sie tritt dafür ein, dass psychisch kranke Personen in ihren Gemeinden psychiatrisch versorgt werden. Deswegen arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mhh-Abteilung Sozialpsychiatrie und Psychotherapie in der Nähe der Menschen, die sie betreuen. Bei ihrer Arbeit beachten die Beschäftigten der Abteilung insbeson- 14 dere die sozialen Bedingungen, unter denen eine psychische Störung entsteht, verläuft, therapiert und rehabilitiert wird. Sozialpsychiatrie ist eine spezialisierte Disziplin der Psychiatrie, die eigene Institutionen in der Lehre, Forschung und Krankenversorgung sowie im Öffentlichen Gesundheitsdienst bildet. Diese Einrichtungen arbeiten zusammen mit den biologisch oder klinisch ausgerichteten psychiatrischen Disziplinen und gleichzeitig bilden sie ihr eigenes Profil. mhh Info Februar/März 2005 Titel Was heißt es, »psychisch krank« zu sein? Über fließende Grenzen zwischen den Gemütszuständen Psychische Gesundheit und Versagen der Psyche stehen nicht völlig isoliert und unvermittelt einander gegenüber: Vielmehr gibt es Zwischenzustände und Übergänge. Psychisch krank – auch diejenigen Menschen, die völlig unauffällige psychische Funktionen aufweisen, können Aspekte dieses Gemütszustands an sich selbst in Krisen- und Ausnahmesituationen erleben. So kennt vermutlich jeder von uns Ängste, Trauer und emotionale Enthemmungen sowie das Erlebnis »überglücklich« zu sein. Deshalb sollte es für Außenstehende auch möglich sein, sich in psychiatrische Erkrankungen und dadurch bedingtes Leid ein bisschen einzufühlen. Für die psychisch kranken Menschen ist es besonders schwierig, mit dem negativen Image psychiatrischer Untersuchungsergebnisse (Diagnosen) umzugehen: Schizophrenie, Demenz, Borderline und depressiven Psychosen wird oft ein abwertender Charakter zugewiesen. Obwohl Diagnosen in der Psychiatrie in der Regel nicht denselben naturwissenschaftlich-biologischen Stellenwert haben wie in anderen medizinischen Disziplinen, sind sie als Grundlage für die therapeutischen Maßnahmen unverzichtbar. Dabei unterscheiden Psychiater zwischen Anpassungs- und Persönlichkeitsstörungen. Letztere stammen vorwiegend aus der frühen Kindheit, beispielsweise Borderline-Persönlichkeitsstörungen – dabei sind die Betroffenen ihren eigenen Gefühlszuständen weitgehend ausgeliefert und können diese nicht gut selbst steuern. Zu den seelischen Verarbeitungsstörungen aus der späteren Kindheit gehören die Neurosen: Angststörungen, Depressionen und Zwangserkrankungen. Ein Schwerpunkt in der psychiatrischen Diagnostik und Therapie sind die so genannten endogenen Psychosen. Hierbei erleben die Patienten Nervenzusammenbrüche, die weitgehend auf ihrer biologischen Konstitution beruhen. Dazu gehören unter anderem Schizophrenie, die manisch depressiven Erkrankung (bipolare Störungen) und monopolare Depressionen, bei Professor Dr. Dr. Hinderk Emrich denen es in der Regel einen genetischen Hintergrund in der Familie gibt. Darüber hinaus sind die Suchterkrankungen und die durch Hirnfunktionsstörungen bedingten psychoorganischen Psychosen zu erwähnen. Dazu gehört Altersverwirrtheit. Wichtig ist es, zu betonen, dass psychiatrische Diagnostik nicht der Abstempelung von Patienten dienen darf, sondern dynamisch bleiben muss. Die ersten Untersuchungsergebnisse sind als therapeutische Basis zu sehen, die für die psychologische, psychophysiologische und neurodiagnostische Untersuchung wichtige Aspekte enthalten – sich aber durchaus im Laufe der Behandlung verändern können. Dies ist sogar wahrscheinlich, da behandelte psychiatrische Erkrankungen therapeutisch oft ganz hervorragende Prognosen aufweisen: Bei 70 Prozent der akut Erkrankten hat sich deren Zustand nach ungefähr vier Wochen bereits gut oder sehr gut gebessert. Schon aus diesem Grunde sind die Grenzen zwischen Normalität und Funktionsstörungen fließend. Hinderk Emrich, Direktor der Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie Kontakt: Professor Dr. med. Dr. phil. Hinderk Emrich Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie Telefon: (0511) 532-6572 E-Mail: [email protected] 15 Titel mhh Info Februar/März 2005 Wahnsinnig gut? Vor- und Nachteile von Medikamenten bei Psychosen Erst seit 1950 gibt es die ersten wirksamen Medikamente zur Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen – die so genannten Neuroleptika. Zuvor standen Patienten, deren Angehörige und Ärzte einer akuten Psychose weitgehend hilflos gegenüber: Beispielsweise bekamen manisch-depressive oder schizophrene Patienten Beruhigungsmittel, wurden isoliert und zum Teil sogar lebenslang »weggeschlossen«. Die Einführung der ersten Neuroleptika führte bei den Ärzten zu einer Aufbruchsstimmung in der psychiatrischen Therapie. Viele Patienten, die zuvor jahrelang in Anstalten betreut worden waren, konnten diese nun nach einigen Wochen oder Monaten verlassen: Die Medikamente brachten die Krankheitssymptome unter Kontrolle. In dieser Euphorie übersah man jedoch, dass die damals noch neuen Mittel bei hoher Dosierung ernste und teilweise bleibende Nebenwirkungen hatten, die dem Parkinson-Syndrom ähneln. Psychopharmaka: Ein Medikamentenschrank in der MHH Erst in den neunziger Jahren stand eine Vielfalt verschiedener, besser verträglicher Psychopharmaka zur Verfügung. Aber auch moderne Medikamente zur Psychosebehandlung haben spezifische Vor- und Nachteile: Von Patient zu Patient unterschiedlich, kommen Gewichtszunahmen, Störungen der Beweglichkeit, Unregelmäßigkeiten des weiblichen Zyklus und Erektionsstörungen bei Männern vor. Eine ähnliche Entwicklung nahmen die Antidepressiva. Die erste Medikamentengeneration wirkte schon sehr gut, aber es traten auch unerwünschte Symptome auf – unter anderem Mundtrockenheit, Herz-Rhythmus-Störungen und Blasenstörungen. Doch sie konnten im Verlauf der Entwicklung immer weiter reduziert werden. Auch ältere oder körperlich erkrankte Menschen können heute wirksam und sicher medikamentös antidepressiv behandelt werden. Ebenso ist die Gefahr, an einer Überdosis zu sterben, bei den neuen Antidepressiva kaum mehr vorhanden, da sie weniger toxisch als ihre Vorgänger sind. Besonders schwer zu ertragen ist für viele Patienten die Aussicht, für einen längeren Zeitraum Medikamente einnehmen zu müssen. Die Chancen, dank einer schnell begonnenen medikamentösen Therapie ein normales Leben ohne wesentliche Beeinträchtigung durch psychisches Leid führen zu können, sind heute jedoch so gut wie nie zuvor. Die Vielfalt verschiedener zugelassener Arzneimittel ermöglicht heute eine immer bessere, individuell abgestimmte Behandlung. Um diese Möglichkeiten nutzen zu können, bedarf es eine vertrauensvollen Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt, sowie umfangreiche Kenntnisse über die Wirkung und die Vor- und Nachteile der Medikamente. Stefan Kropp Kontakt: Privatdozent Dr. Stefan Kropp Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie Telefon: (0511) 532-6561, E-Mail: [email protected] Bausteine der Behandlung Sozio- und Psychotherapeutische Behandlung im Zentrum Psychologische Medizin Psychische Störungen wie Depressionen, Psychosen, Angstoder Abhängigkeitserkrankungen wirken oftmals schwerwiegend auf das Leben der Betroffenen und ihrer Familien. Es kann zu Partnerschaftskonflikten, Verlust des Arbeitsplatzes und möglicherweise sogar der Wohnung kommen. Soziotherapie, wie sie zum Beispiel die Therapeutenteams auf der Soziotherapiestation (51a) und in der Tagesklinik (51b) anbieten, verfolgt das Ziel, dass Betroffene ihre Alltagsfertigkeiten wieder entdecken, ihre sozialen Bindungen stärken und sich zum Experten ihrer Erkrankung machen. Dabei vermitteln Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte und Ergotherapeuten den Patienten Wissen über ihre Erkrankung, beraten Angehörige, leiten Menschen mit psychischen Störungen in der Arbeitstherapie an und informieren sie über Möglichkeiten der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Die Hilfestellung reicht von der Suche nach einer Wohnung bis zur Körperpflege und Wohnungshygiene. Gemeinsam mit anderen Betroffenen lernen sie auch, wieder zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen. Soziotherapeutische Qualifikationen und eine psychotherapeutische Grundhaltung werden seit 1972 in der mhh während der zweijährigen, berufsbegleitenden Sozialpsychiatrischen Zusatzausbildung (SPZA) vermittelt. Bis zu 18 Personen können daran teilnehmen. Die Ausbildung wendet sich an alle psychosozialen Berufsgruppen, die in psychiatrischen Einrichtungen im Großraum Hannover tätig sind. Kontakt: [email protected] In der Psychotherapie wendet sich der Therapeut mehr dem inneren Erleben, den Gefühlen und unbewussten Handlungsmotiven des Patienten zu: Eine bessere Kenntnis der eigenen, lebensgeschichtlich erworbenen Handlungs- und Denkmuster soll Betroffene davor schützen, sich immer wieder in Konflikte zu verstricken. Die psychische Störung wird als »Notlösung« der Psyche in Überforderungssituationen verstanden. Je nach Störung steht mal das erlernte Ver- halten (Verhaltenstherapie), mal das Erkunden der inneren, uns verborgenen Gefühle und Überzeugungen (tiefenpsychologische Psychotherapie) oder die Familie (Familientherapie) im Vordergrund der Betrachtung. Wie Psychotherapie wirkt, ist nach wie vor Gegenstand der Forschung. Psychotherapie bedient sich in erster Linie des gesprochenen Wortes im geschützten, vertrauensvollen Gespräch. Kunst-, tanz-, musik- und körpertherapeutische Verfahren erleichtern dabei den Zugang zum emotionalen Erleben der Betroffenen. Die »psychotherapeutische Grundhaltung« aller Therapierichtungen setzt eine zwischenmenschliche Basis voraus, in der sich der Patient mit seinen Gefühlen, Gedanken, seinem Erleben und Verhalten angenommen, verstanden und respektiert fühlt. Auf dieser Grundlage macht er neue Erfahrungen, gewinnt neue Einsichten und lernt neue Verhaltensweisen. Seit mehr als 25 Jahren bietet das mhh-Zentrum Psychologische Medizin psychotherapeutische Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Im Jahr 2000 wurde das »Institut für Psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung (IPAW)« gegründet. Dort werden Psychologen, angehende Psychiater und Ärzte anderer Fachrichtungen in tiefenpsychologisch orientierter Psychotherapie ausgebildet. Ein Vertiefungsgebiet Verhaltenstherapie ist in Vorbereitung. Detlef Bartschies Kontakt: Dr. Claudia Wilhelm-Gößling Telefon: (0511) 532-3175 E-Mail: wilhelm-gö[email protected] Dr. Detlef Bartschies Telefon: (0511) 532-5168 E-Mail: [email protected] Professor Dr. Gerhard Schmid-Ott Telefon: (0511) 532-2633 E-Mail: [email protected] 17 Titel mhh Info Februar/März 2005 Alkohol, Depressionen & Co Wer war zuerst da? Über Abhängigkeit, menschliche Psyche und die Wechselwirkungen Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen haben – abgesehen vom schweren Leidensdruck der Betroffenen – auch eine enorme gesundheitspolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung. Nach Schätzungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) entstehen der Wirtschaft in Deutschland jährliche Kosten in Höhe von zirka 40 Milliarden Euro, unter anderem durch Produktionsausfälle, wegen hoher Fehlzeiten süchtiger Arbeitnehmer oder frühzeitiger Berentungen. In den psychiatrischen Kliniken ist jeder dritte stationär aufgenommene Patient ein Suchtkranker. In Allgemein-Krankenhäusern werden zirka 15 bis 20 Prozent der Kranken aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit stationär behandelt. Nach Schätzungen der DHS sterben 40.000 Menschen pro Jahr an den Folgen ihrer Alkoholsucht, bei den Rauchern sind es sogar drei Mal so viele. Das Wort »Sucht« leitet sich sprachgeschichtlich vom Begriff »Siech, Siechtum« ab, kennzeichnet also einen Krankheits- oder Leidenszustand. »Sucht« findet sich in der deutschen Sprache in vielen Wörtern wieder, die ein Leiden, Laster oder Fehlverhalten charakterisieren: Habsucht, Eifersucht, Geltungssucht. Da der Begriff im medizinischen Zusammenhang zu ungenau ist, wurde er 1964 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch die Bezeichnung Abhängigkeit ersetzt. Deren zentrales Merkmal ist der so genannte Kontrollverlust, beispielsweise das »Nicht-mehr-aufhören-können« eines Alkoholikers nach Beginn des Trinkens. Sucht: Auch Alkohol kann abhängig machen 18 Auf die Frage, wie Abhängigkeit entsteht, gibt es keine allgemeingültige Antwort – die Ursachen sind sehr komplex. Neben sozialen und psychologischen Erklärungsmodellen spielen auch neurobiologische Faktoren – Prozesse, die sich im Gehirn abspielen – eine wichtige Rolle. Aus tierexperimentellen Untersuchungen ist bekannt, dass ein »Belohnungssystem« im Gehirn existiert. Es dient unter anderem der Aufrechterhaltung lebenswichtiger Verhaltensweisen wie Fortpflanzung oder der Bewertung von Ereignissen. Aber auch Rauschmittel, Nervenkitzel wie Bungee-Jumping, Fallschirmspringen oder Glückspiel können das »Belohnungssystem« aktivieren: Es entsteht ein Glücksgefühl, das im »Normalzustand« nicht erreicht werden kann. Häufig leiden Abhängige unter zusätzlichen psychischen Störungen: Alkoholkranke haben überdurchschnittlich oft depressive- oder Angststörungen. Auch Raucher weisen häufiger psychische Auffälligkeiten auf als die Allgemeinbevölkerung. Für dieses komplexe Bedingungsgefüge gibt es unterschiedliche Erklärungsmodelle: Nach dem so genannten Zufallsmodell treten zwei oder mehrere Störungen unabhängig voneinander bei einer Person auf. Entsprechend einer anderen Modellvorstellung kann die Suchterkrankung die Ursache einer psychischen Störung sein oder auch umgekehrt. Es ist eine wichtige therapeutische Aufgabe, durch längere Gespräche mit dem Betroffenen herauszufinden, wie sich die Situation bei ihm darstellt. Für die Therapie ist es wichtig, ob der Patient beispielsweise mit dem Trinken begonnen hat, weil er depressiv ist, oder ob die Gemütserkrankung Folge des Alkoholkonsums ist. In den vergangenen Jahrzehnten gab es erhebliche Fortschritte in der Behandlung von Suchtkranken. Neben differenzierten psychotherapeutischen Verfahren und soziotherapeutischen Maßnahmen werden auch zunehmend Psychopharmaka eingesetzt. Beispielsweise liegt die Abstinenzrate alkoholkranker Patienten, nach einer qualifizierten Entgiftung und Entwöhnung, bei zirka 50 Prozent. In der Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie gibt es ein umfangreiches Behandlungsprogramm für suchtkranke Menschen mit den Schwerpunkten Alkohol, illegale Drogen und Medikamente. Neben ambulanten Beratungen, stationärer Behandlung und verschiedenen Nachsorgegruppen gibt es ein spezifisches Angebot für Frauen. Hans Udo Schneider mhh Info Februar/März 2005 Titel Ein Teil des Teams: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stationen 37a und 52 Essstörungen, Ängste und Traumata Depressionen, Anpassungsstörungen, Burn-Out Station 37a versorgt Patienten mit schweren psychosomatischen und psychischen Störungen Beschäftigte der Station 52 bieten Psychotherapie bei seelischen Konflikten an Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Station 37a behandeln Patientinnen und Patienten mit schweren psychosomatischen und psychischen Störungen, so genannte funktionelle Leiden und Traumafolgekrankheiten. Zu den schweren psychosomatischen und psychischen Störungen gehören Essstörungen wie Magersucht und Bulimie. Funktionelle Leiden sind Körperbeschwerden, bei denen keine organischen Ursachen vorliegen. Folgen von Traumata sind schwere Ängste, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen. Auf der Station arbeiten eine Ärztin, ein Psychologe und sieben speziell ausgebildete Krankenpflegekräfte. Den Kern des stationären Behandlungskonzeptes bildet die psychoanalytisch orientierte Gruppenpsychotherapie, die dreimal pro Woche zwei Stunden lang obligatorisch stattfindet. Die erlebnis- und körperorientierten Gruppenangebote wie Gestaltungstherapie, Tanz und Bewegung, Körperwahrnehmungs- und Entspannungstraining bilden mit insgesamt zehn Behandlungsstunden pro Woche den zweiten Schwerpunkt des Therapie-Angebotes. Eine dritte Säule ist die Verhaltenstherapie: Vor Beginn des stationären Aufenthaltes vereinbaren Therapeut und Patient konkrete Ziele, beispielsweise den Abbau einer bestimmten Angst. Bei der Durchführung des Angstbewältigungstrainings wird der Betroffene durch zusätzliche Einzeltherapiegespräche unterstützt. Im Durchschnitt verweilen Patientinnen und Patienten zwei Monate auf der Station 37a. Vor einer stationären Aufnahme sind eine Überweisung und eine ambulante Voruntersuchung in der psychosomatischen Poliklinik der mhh erforderlich. Anmeldung unter Telefon: (0511) 532-6569. Eine stationäre Psychotherapie ist bei seelischen Schwierigkeiten dann sinnvoll, wenn eine ambulante Behandlung nicht ausreicht oder durch Belastungen im alltäglichen Umfeld erschwert wird. Auf der Station 52, die zur Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie gehört, arbeiten: ein Oberarzt, eine Stationsärztin, zwei Psychologinnen, eine Sozialarbeiterin, eine Krankengymnastin, fünf therapeutische Pflegekräfte sowie eine Ergotherapeutin. Sie alle bieten ihren Patientinnen und Patienten eine integrative Psychotherapie mit Gruppenschwerpunkt an. Menschen mit psychischen Problemen haben dort die Möglichkeit, die Ursachen und Folgen psychischer Symptome genauer zu betrachten, gemeinsam mit den Therapeutinnen und Therapeuten mögliche Lösungsansätze zu entwickeln und neue Wege im Denken und Handeln auszuprobieren. Dabei ist auch die Erfahrung in der Gruppe wichtig, deren Mitglieder sich gegenseitig unterstützen und neue Perspektiven ermöglichen. Zudem arbeiten die Patienten auf ihr persönliches, mit den Therapeuten vereinbartes Therapieziel hin. Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen mit Depressionen, Angst- und Anpassungsstörungen, in Lebenskrisen sowie mit beruflichen oder Beziehungskonflikten, Burn-Out-Syndromen und so genannten Persönlichkeitsstörungen. Nicht behandelt werden können akut Selbstmordgefährdete sowie Patienten mit Essstörungen oder Drogen- und Medikamentenabhängige. Das Therapiekonzept vereint tiefenpsychologische und verhaltenstherapeutische Elemente und gewährleistet so ein Eingehen auf individuelle Bedürfnisse. Einzelgespräche, Ergotherapie, Entspannungsverfahren, Physiotherapie und Sportprogramm sind Bestandteile der Behandlung. Interessierte können ohne Voranmeldung jeden Mittwoch um 16 Uhr eine Vorbereitungsgruppe auf der Station besuchen. Es handelt sich hierbei um eine Informationsveranstaltung, in der den möglichen künftigen Patienten die Therapiekonzepte dargestellt werden und in der sie sich kurz vorstellen. Thomas Huber Kontakt: ????????? Kontakt: PD Dr. Huber, Telefon: (0511) 532-2404 19 Der Schock steckt im Körper Die EMDR-Methode: Dr. Sack bewegt seine Hand vor dem Gesicht der Patientin hin und her, sie folgt ihr mit den Augen und erzählt dabei ihr traumatisches Erlebnis In die Traumasprechstunde der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie kommen rund 300 Menschen pro Jahr (bb) Angst, Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle, Verstörung – das alles kann ein traumatisches Erlebnis verursachen. Mehr noch, es löst häufig auch psychische und psychosomatische Erkrankungen aus: »In unserer Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie berichten mehr als zwei Drittel der Patientinnen und Patienten über mindestens eine traumatische Erfahrung. Von ihnen hat ein Drittel sexuelle Gewalt erfahren«, erklärt Dr. Martin Sack. Deswegen hat der Psychotherapeut mit seiner Kollegin Elke Baumann und seinem Kollegen Dr. Wolfgang Lempa eine spezielle Traumasprechstunde eingerichtet. Sie informieren Betroffene, die in der Regel vom Hausarzt oder psychiatrisch bzw. psychotherapeutisch tätigen Kolleginnen und Kollegen überwiesen werden, über Behandlungsmöglichkeiten, stellen Weichen für die weitere ambulante oder stationäre Therapie. »Dies ist wichtig, da Menschen mit sehr schweren oder langdauernden Traumatisierungen in der Kindheit eine andere Behandlung benötigen, als Menschen, die im Erwachsensenalter ein einmaliges Trauma erlebt haben«, sagt Dr. Sack. Die moderne Traumatherapie geht davon aus, dass bei einem traumatischen Erlebnis zu viele Informationen auf den Menschen einprasseln, so dass er sie nicht verarbeiten kann. »Doch diese Informationsstörung kann aufgehoben werden, sagt Dr. Sack. Beispielsweise mit Hilfe des Traumabearbeitungsverfahrens Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR.« Der Abteilungsleiter Professor Dr. Friedhelm Lamprecht hat es 1996 eingeführt. Bei dieser Methode bewegt die Ärztin oder der Arzt seine Hand vor dem Gesicht des Kranken hin und her, der Patient folgt mit den Augen und erinnert sich dabei an sein Erlebnis. »Die Augenbewegung führt zu einer körperlichen Entspannung, so dass man sich leichter mit seinen belastenden Erinnerungen konfrontieren und diese durcharbeiten kann«, erläutert Dr. Sack. Oft werde das Erlebte dabei viel detailgenauer wiedergegeben als in normalen Erzählungen. Das Verfahren könne auch 20 Jahrzehnte nach dem Trauma noch wirken. Das Wichtigste in der therapeutischen Arbeit sei jedoch, zuvor die Ressourcen der Patienten zu stärken, damit sie psychisch ausreichend stabil sind: »Der Patient muss zunächst lernen, gute Gefühle wachzurufen und zu festigen, damit er den Alltag bewältigen und mit seinen Problemen wie Ängsten oder sich aufdrängenden Traumaerinnerungen umgehen kann«, sagt Dr. Sack. Das könne manchmal viel therapeutische Arbeit in Anspruch nehmen. »Ohne ausreichende Stabilisierung besteht die Gefahr, dass die Traumaexposition überfordert und die Ängste verschlimmert«, führt er aus. Hartmut Berg*, der vor ein paar Wochen in die Traumasprechstunde kam, war von Anfang an psychisch stabil genug für diese Therapie. Er wurde acht Wochen zuvor von einem Unbekannten überfallen und mit einem Messer in den Rücken gestochen. Seitdem quälten ihn schwere Schlafstörungen und Alpträume – der Schock steckte in seinem Körper. Die Erinnerungen drängten sich ungewollt immer wieder auf, beim Anblick eines Messers zitterte er und brach in Schweiß aus. Dr. Sack wendete drei Mal im Abstand von je einer Woche die EMDR-Methode bei ihm an. Schon beim ersten Erzählen verdrängte Hartmut Berg keine Einzelheit des Erlebten mehr. Er schlief besser und konnte Messer sogar anfassen. Bei der zweiten Sitzung nahm die Belastung weiter ab. »Nach der dritten Stunde war das Ziel erreicht«, erinnert sich Dr. Sack. Ihm waren alle Informationen bewusst geworden und er konnte seine Geschichte erzählen, ohne dass sie ihn emotional überschwemmte. Die auf die Überfallerinnerung bezogenen Ängste waren völlig verschwunden. * Name von der Redaktion geändert mhh Info Februar/März 2005 Titel »Wir sind Menschen mit Gesichtern« Ulrich Weinert kam jahrelang zur Behandlung seiner Schizophrenie in die mhh – ein Erfahrungsbericht »Psychisch krank – ich persönlich habe diesen Zustand lange Zeit als emotionale Gefangenschaft erlebt. Meine psychiatrische Diagnose lautet Schizophrenie. Es ist eine Gespaltenheit der Persönlichkeit, die meiner Meinung nach in meiner Erziehung begründet ist. Meine Persönlichkeit ist in meinem Elternhaus zu kurz gekommen. Es ging nur darum, dass ich Besucht die MHH täglich: Ulrich Weiner funktioniere. Der Weg zum Besseren hatte kurz nach dem Abitur begonnen. Meine Eltern hatten mich bis dahin auf ihre Linie gezwungen, mir eingeschärft, was für mich wichtig sein sollte. Vor der Behandlung in der mhh fühlte ich mich nie als Person richtig anerkannt – es war, als lebte ich in einer falschen Welt. Bei der Bundeswehr fiel ich 1976 auf, weil ich dort eine einmalige Essstörung hatte. Nach einer Untersuchung beim Nervenarzt wurde ich jedoch vom Militärdienst befreit. 1977 folgte mein erster Psychiatrieaufenthalt in Langenhagen. Mit 22 Jahren kam ich dann 1978 zum ersten Mal in die der Psychiatrie der mhh. Dort verbrachte ich vier Monate tagsüber auf der Station 51b: Das ist eine tagesklinische Station, auf der man von morgens bis nachmittags behandelt wird und danach wieder in die eigene Wohnung zurück fährt. Mit der Unterstützung des Teams begann sich mein Leben zu ändern: Hier lernte ich, mit Hilfe von Gruppengesprächen und Einzeltherapie, meine Persönlichkeit zu stärken und meine Probleme – auch mit Hilfe von Psychopharmaka – im Großen und Ganzen zu meistern. Ich durchlebte insgesamt dreizehn Klinikaufenthalte in der mhh, manche davon waren teilweise stationär – sowohl in der Sozialpsychiatrie als auch in der Klinischen Psychiatrie. Zu meinem Krankheitsbild gehört, dass ich Stimmen höre. Für mich sind es Zeichen aus einer Welt, die ich beachten muss. Manchmal kann ich diese Stimmen auch bestimmten Menschen zuordnen, die mich umgeben. Dann ist es, als würde ich ,Gedanken lesen‘ – dabei sprechen die Menschen in Wirklichkeit nicht mit mir, ich höre jedoch ihre Botschaften. Die Stimmen hören sich an wie geflüstert. Aber ich kann damit gut umgehen, für mich gehören sie zu meinem Leben dazu. Die Psychopharmaka, die ich täglich einnehme, vertrage ich gut. Für mich sind sie fast nebenwirkungsfrei. Ich weiß, dass viele andere Patienten sie mit sehr gemischten Gefühlen einnehmen, aber für mich sind es ,Gesundheitsmittel‘ geworden. Sie helfen mir, zusammen mit den Therapiegesprächen, meine Aufgabe für die Gesellschaft zu leisten: Dazu gehört meine Arbeit im Niels-Stensen-Haus, einer Werkstatt für behinderte Menschen der Caritas. Ich bin dort seit sechs Jahren Pförtner und Telefonist. Nach Feierabend komme ich jeden Tag in die mhh, hier besuche ich den Andachtsraum, bete meinen Rosenkranz im Flur der Psychiatrie zwischen den Stationen und der Poliklinik, trinke einen Kirschsaft. Hier kommt meine Welt für mich in Ordnung, hier fühle ich mich wohl. Oft komme ich auch mit anderen Menschen ins Gespräch, etwa in der Straßenbahn, auch in der mhh. Wenn ich ihnen von meiner Krankheit erzähle, passiert es nur ganz selten, dass sie mich spontan ablehnen. Bislang ist das erst zwei Mal geschehen. Dank solcher Gespräche bekommen psychisch Kranke für Gesunde ein Gesicht. Die so genannten Normalen bleiben nicht an ihren Vorurteilen hängen, sondern können sich ihr eigenes Bild machen. Psychiatrie-Patienten sind wie alle Menschen auf die Anerkennung der Gesellschaft angewiesen, sie benötigen sie zur Bewältigung ihrer Krankheit sogar noch mehr als gesunde Menschen. Psychiatrie-Patienten benötigen zur Bewältigung ihrer Lebenssituation die Anerkennung ihrer Person umfassender als gesunde Menschen. Sie brauchen die Stärkung ihrer Selbstachtung besonders. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich das Leben noch mehr genießen kann. Wer will nicht gerne in Frieden leben, in seiner Freizeit angenehme Kontakte haben? Man müsste nur den Mut haben, in das gesunde Leben einzutreten, dann wäre alles einfacher.« Aufgeschrieben von Kristina Weidelhofer in Zusammenarbeit mit Ulrich Weinert 21 Titel mhh Info Februar/März 2005 Perspektiven für psychisch Kranke Die mhh war Wegbereiterin für die Reform der Psychiatrie Verfolgt man die Geschichte seelischen Leidens und blickt dabei zurück ins vergangene Jahrhundert, so wird rasch deutlich, dass dessen soziale und psychologische Dimension speziell in der Psychiatrie zu lange vernachlässigt wurde: Bis ins 20. Jahrhundert waren psychisch Kranke weitgehend sozial ausgegrenzt – als »Verrückte« abgestempelt, in so genannte Irrenhäuser abgeschoben, oft ohne Hoffnung auf Freiheit und menschliche Behandlung. Diese unselige Entwicklung in der Medizin und in der Gesellschaft fand ihren katastrophalen Tiefpunkt mit der Vernichtung »unwerten Lebens« im Dritten Reich. Im Jahr 1975 legte der Deutsche Bundestag die so genannte Psychiatrie-Enquête vor: Eine internationale Expertenkommission nahm darin die Verhältnisse der psychiatrischen Versorgung kritisch in Augenschein. Desolate, ja unwürdige und unmenschliche Verhältnisse – vor allem auch in den psychiatrischen Anstalten – wurden aufgedeckt, auch in Deutschland. Von der Bundesregierung wurde daraufhin 1978 beschlossen, neue Formen einer menschenwürdigen Versorgung psychisch Kranker zu entwickeln und zu erproben. Ein Ziel sollte sein, diese Menschen in die Gesellschaft zurückzuholen, sie zu integrieren. Die Psychiatrie der mhh nahm damals, in der Gründungszeit der Sozialen Psychiatrie, eine wegbereitende Funktion ein. Die beiden psychiatrischen Abteilungen der Hochschule hatten bereits vor der Verabschiedung der Psychiatrie-Enquête die Versorgungsverpflichtung für die hannoverschen Stadtteile Kirchrode, Misburg, Kleefeld, Zooviertel, List und Lahe übernommen. In kleinen überschaubaren Einheiten in der stationären, der tagesklinischen und der ambulanten offenen Krankenversorgung sollte die angemessene Wahrnehmung der Patienten, die Entwicklung einer therapeutischen Beziehung und Gemeinschaft und der Umgang mit dem sozialen Umfeld ermöglicht werden. Dies aus der Überzeugung, dass nur so durch das ganze Spektrum seelischen Leidens und 22 Krankseins erkennbar und behandelbar werden kann. Diese leitende Idee beseelte die Gründer der Medizinischen Hochschule Hannover und mit ihnen die Begründer der hiesigen Psychiatrie, Karl Peter Kisker und Erich Wulff. Die Stadt und der Landkreis Hannover entschlossen sich in den frühen 70er Jahren ebenfalls zur Gründung einer Sozialen Psychiatrie. Die psychiatrischen Krankenhäuser in Langenhagen, Ilten und Wunstorf beteiligten sich an diesem Reformprozess – sowohl in ihrem Inneren als auch in ihrer Kooperation mit den neuen psychosozialen Diensten. Komplementäre Einrichtungen im Bereich der sozialen Fürsorge, des Wohnens und der Arbeitsrehabilitation wurden im Rahmen dieses Reformprozesses ebenfalls eingerichtet. So wurde Hannover zur Modell-Region im Rahmen des Reformprogramms der Bundesregierung nach der Psychiatrie-Enquête. In all diesen Jahren entwickelte sich ein kreativer wissenschaftlicher Austausch mit verschiedenen Reforminitiativen in anderen Ländern, innerhalb und außerhalb Europas, der sich bis heute als fruchtbar erweist. Die hiesige Soziale Psychiatrie ist heute unter gewandelten Zeitbedingungen in verschiedenster Weise innovativ: zum Beispiel bei der Verwirklichung offener beziehungsorientierter ambulanter und stationärer Behandlungsformen, bei integrierten Versorgungskonzepten mit personenzentriertem Zuschnitt und in der Umsetzung selbstbestimmter sozialer Teilhabe für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen auch im hohen Alter. Zudem bemühen wir uns seit langem um die interkulturelle Wahrnehmung der Patienten und ihres sozialen Umfeldes. Wielant Machleidt und Johann Pfefferer-Wolf Bunt: Die Therme hat der Patient angemalt Die Kluft zwischen Wille und Tat In akuten psychischen Krisen entscheiden Mediziner und Juristen, ob eine klinische Behandlung nötig ist (bb) Vor der Tür des fünfstöckigen Hauses tritt Dr. Stefan Bartusch mit hochgezogenen Schultern von einem Fuß auf den anderen, es schneit. Der Oberarzt der Sozialpsychiatrischen Poliklinik der mhh wartet auf die Vormundschaftsrichterin Elke Hindrichs*. Sie entscheiden heute, ob Klaus Lesser* stationär aufgenommen werden muss. Er hat manisch-depressive Tendenzen, ist zwischen den Krankheitsphasen aber ganz normal. Seit kurzem ist er wieder ganz anders, nun schläft und isst er wenig, trifft wahllos Bekannte, konsumiert Drogen und malt großflächige Bilder. Als sein Bruder dies bemerkte, schaltete er die Poliklinik und das Vormundschaftsgericht ein. Deswegen kommt auch die Richterin. Sie geht gemeinsam mit Dr. Bartusch in den dritten Stock und klopft an seine Tür – Klaus Lesser weiß von dem Besuch, sie haben sich schriftlich angekündigt. Die Wohnung ist aufgeräumt und warm, Stühle stehen bereit, Klaus Lessers Bruder ist bei ihm. Der Fernseher läuft, die Programmzeitung ist aufgeschlagen, alles ist ganz normal – bis auf die Farben: Bunte Pinselstriche zieren Tischdecke, Herd und Kühlschrank. Es begann im Sommer vor acht Jahren, nachdem er viele Jahre in einer Gärtnerei gearbeitet hat. Plötzlich ging der zuverlässige, pflichtbewusste Mann nicht mehr gärtnern. Er vernachlässigte seinen Körper, genoss das Leben ohne Maßen, rauchte und trank. Solange, bis er depressiv wurde und in stationäre Behandlung musste. Als sich sein Zustand wieder gebessert hatte, konnte er wieder arbeiten. Doch bald wiederholte sich alles, insgesamt dreimal – bis er seine Arbeit verlor. Zwischen den Krankheitsphasen war er gesund und half in der Familie: Er pflegte seine Mutter bis zu ihrem Tod. Seit einigen Wochen muss Klaus Lesser nun wieder ambulant psychiatrischen beraten und behandelt werden, doch er hielt die Termine nicht ein. Deshalb sind Elke Hindrichs und Dr. Bartusch bei ihm. Sie setzen sich und reden mit ihm über Schulden und Termine, über Medikamente, die seine Stimmungen regulieren. Klaus Lesser schaut angespannt. Er trägt Badelatschen, Tennissocken und Jeans. Seine Arme hängen herunter zwischen den Beinen – ein kleiner Mann mit rundem Bauch. »Mir geht es gut«, sagt er. Aber er möchte niemandem Kummer machen, schon gar nicht seinem Vater oder Bruder. »Arbeitsamt? Jaja, da muss ich schon hin. Ich habe es vergessen«, gibt er schuldbewusst zu. Er möchte Künstler sein, Dinge aus seinem Keller anmalen und eine Ich-AG gründen, die Sachen verkaufen. »Ich fürchte, das wird leider nur ein kurzes Feuer – so etwas wie eine Theateraufführung«, sagt Dr. Bartusch. Er weiß, dass bei seinem Patienten bald eine Depression folgen kann und befürwortet eine rechtliche Betreuung. »Eine Betreuung ist der erste Schritt, eine Art Hilfe zur Selbsthilfe«, erklärt die Richterin. Der zweite Schritt wäre dann der Klinikaufenthalt. Sie entscheidet sich für Dr. Bartuschs Vorschlag: Eine gesetzlich eingesetzte Betreuerin soll für ein halbes Jahr ihre professionelle Hilfe anbieten: Die Finanzen von Klaus Lesser regeln, sich darum kümmern, dass er Medikamente nimmt und sich beim Arbeitsamt meldet. »Sie sind der Arzt und Sie sind die Richterin – ich sträube mich gegen die Entscheidung nicht«, sagt Klaus Lesser. Den Termin am kommenden Tag bei Dr. Bartusch verspricht er auch einzuhalten. »Ich kenne Herrn Lesser seit fast zehn Jahren, ich glaube zu 80 Prozent, dass er kommt. Er will es auf jeden Fall, es ist nur die Frage, ob er die Kluft zwischen Wille und Tat überwindet«, sagt Dr. Bartusch, als er wieder draußen vor der Tür steht. Die Antwort steht am nächsten Tag vor seiner Tür: Klaus Lesser ist pünktlich. * Name geändert 23 mhh Info Februar/März 2005 Hinterm Tresen: Helga Erhardt verkauft immer mittwochs und freitags für jeweils drei Stunden im »Lädchen« (links) An der Bandsäge: Die Ergotherapeutin Christiane Neuperger und der Werkzeugmacher Werner Berwitz. Zum Team gehört noch Karen Kretzschmar (oben) Das »Lädchen« in der Ladenpassage Ein Schaufenster zur Psychiatrie (mc) Im »Lädchen« der Ladenpassage gibt es Dinge, die den Alltag verschönern: Windmühlen für den Garten oder watschelnde Pinguine aus Holz. Diese Werke stammen nicht aus industrieller Massenproduktion, sondern aus der mhh: Es sind wertvolle Materialien, denen kreative Menschen ein liebevolles Design gegeben haben. Alle Dinge tragen das Kürzel ET/AT – es steht für Ergotherapie und Arbeitstherapie. Denn das »Lädchen« bezieht seine Produkte aus einer Werkstatt der mhh-Psychiatrie, einem Ort, an dem sich Kunst, produktive Arbeit und soziale Therapie verbinden. Das »Lädchen« ist das Aushängeschild der Werkstätte und die Menschen, die dort arbeiten, möchten damit Kontakte pflegen. Für den Austausch zwischen Psychiatrie-Patientinnen und -Patienten, Gästen, Beschäftigten und Kranken von anderen Stationen sorgt auch die Cafeteria der mhh-Psychiatrie. Sie befindet sich im Sockelgeschoss, in der Nähe des Ausganges zur Mensa, und hat wochentags von 12 bis 13.30 Uhr geöffnet. Dort finden jeden Donnerstag um 19 Uhr auch Tanzabende statt. Darüber hinaus hat jeder die Möglichkeit, an den vierteljährig stattfindenden Konzerten im großen Gemeinschaftsraum neben der Cafeteria teilzunehmen oder das Weihnachts- und Sommerfest der Psychiatrie zu genießen. Sozialpsychiatrische Poliklinik Die Sozialpsychiatrische Poliklinik der mhh behandelt Menschen mit psychischen Störungen oder in psychosozialen Krisen in ihrem Lebensraum. Dabei unterstützt das aus mehreren Berufsgruppen bestehende Therapeutenteam psychisch erkrankte Menschen bei ihrer sozialen Integration. Mit dieser Arbeit können viele Krankenhausbehandlungen vermieden werden. Zu den ergänzenden Hilfestellungen gehören ambulant betreutes Wohnen, therapeutische Wohnheime, Werkstätten für seelisch behinderte Menschen sowie Selbsthilfe- und Angehörigengruppen. Die Sozialpsychiatrische Poliklinik der mhh in der Walderseestraße gibt es seit mehr als dreißig Jahren. Sie ist zuständig für Menschen mit Wohnsitz in der List, im Zooviertel, in Klein-Buchholz sowie in Teilen von Groß-Buchholz. Für Menschen mit schweren psychischen Störungen bietet sie eine umfassende psychiatrisch-psychotherapeutische Be- 24 handlung an. Das Therapeutenteam berät darüber hinaus Menschen in akuten Krisen und macht bei Bedarf Hausbesuche. Weiterhin bestehen mehrere gruppentherapeutische Angebote; unter anderem die tägliche Arbeitstherapie. Die Poliklinik übernimmt auch gesundheitsamtliche Aufgaben für die Region Hannover. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prüfen unter anderem, ob psychisch auffällig gewordene Personen im Notfall zur Krankenhausbehandlung eingewiesen werden müssen. Stefan Bartusch und Bernd Brüggemann Kontakt: Ina Mogilewska Telefon: (0511) 962-900 E-Mail: [email protected] mhh Info Februar/März 2005 Titel Ansprache im Alltag mhh-Sozialarbeiterin Anke Pagendarm unterstützt psychisch Kranke dabei, selbständig zurechtzukommen (ina) Es ist früher Nachmittag, als Anke Pagendarm, Sozialarbeiterin der Sozialpsychiatrischen Poliklinik in der Walderseestraße, an der Tür von Hannelore Jensch* klingelt. Die 65-Jährige wartet bereits – der heiße Tee steht dampfend in der Kanne auf dem Wohnzimmertisch, daneben eine Dose mit Keksen. Seit sieben Jahren kennt Anke Pagendarm die psychisch kranke Frau schon: Hannelore Jensch hat seit 1978 psychotische Schübe: manische Phasen, in denen sie teilweise auch unter Wahnvorstellungen leidet. Sie hat schon reichlich Psychiatrie-Erfahrungen hinter sich. Doch momentan ist alles in Ordnung. Ihre Wohnung ist aufgeräumt, Hannelore Jensch macht einen ausgeglichenen Eindruck. Sie plaudert über ihre Enkelkinder, ihre Tochter, ihren Sohn. Die Familie steht im Mittelpunkt ihrer Erzählungen. »Keine kritischen Anzeichen«, sagt später Anke Pagendarm. Eine nahende Psychose erkennt die Mitarbeiterin schnell: »Wenn sie in ihren Gedanken hin und her springt, wenn ihre verstorbene Mutter plötzlich wieder an Bedeutung gewinnt und die Wohnung unordentlich wird.« Außerdem verhält sich Frau Jensch in solchen Phasen angespannt und gereizt: »Sie selbst bemerkt dies aber nicht an sich.« Ein solcher Besuch ist eher die Ausnahme. In der Regel kommt Hannelore Jensch einmal pro Monat zu Anke Pagendarm in die Walderseestraße. Dann sprechen sie über alles, was die Patientin gerade bewegt: ob sie mit ihren Medikamenten gut zurechtkommt, wie sie ihren Alltag bewältigt. Die Beschäftigten der Sozialpsychiatrischen Poliklinik arbeiten im so genannten Tandem-Prinzip: »Je ein eine Ärztin oder ein Arzt und ein weiteres Teammitglied sind für jeden einzelnen Patienten zuständig«, erklärt Anke Pagendarm. Im Team arbeiten Ärzte, Pflegekräfte, Sozialpädagogen und Ergotherapeuten zusammen. Die Tandemtherapeuten versorgen ihre Patienten umfassend – vorbeugend, nachsorgend und in Notfallsituationen. Im Fall von Hannelore Jensch kooperieren sie eng mit dem »Gemeinnützigen Verein zur Förderung sozialer Beziehungen«. Er wurde 1991 von Waltrud Knittel gegründet, die bis zum Jahr 2000 als Sozialarbeiterin in der Sozialpsychiatrischen Poliklinik gearbeitet hat. Vier Mal pro Woche kann Hannelore Jensch am gemeinsamen Frühstück des Vereins teilnehmen. Im Anschluss daran stehen Ausflüge, Werkangebote oder Spiele-Runden auf dem Programm. Außerdem finden Einzelstunden statt. Hannelore Jensch ist erleichtert, dass sie Dank der ambulanten Hilfen seit langer Zeit nicht mehr in die Klinik musste. »Mein letzter stationärer Aufenthalt ist schon drei Jahre her«, sagt sie: »Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe.« Nach einer halben Stunde kann Anke Pagendarm beruhigt die Wohnung ihrer Patientin verlassen. »Bis zum nächsten Mal in der Walderseestraße.« * Name von der Redaktion geändert ten diese nun nach einigen Wochen oder Monaten verlassen: Die M 25