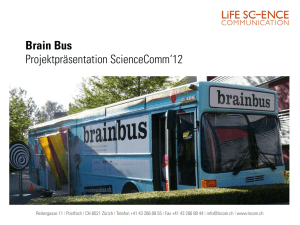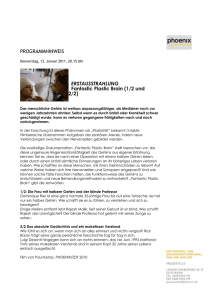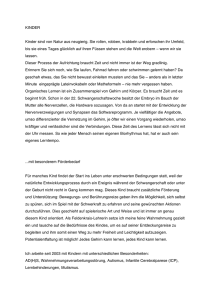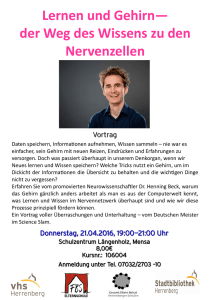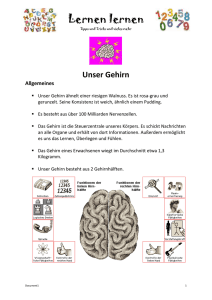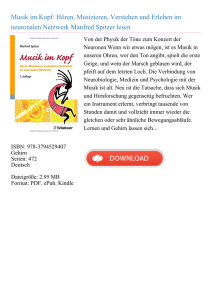Was ist Whole Was ist Whole-Brain-Thinking
Werbung

Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 Fragen und Antworten zu Whole Brain Thinking Technology Was ist WholeWhole-BrainBrain-Thinking®? Haben Sie sich jemals gefragt: "Wie können Menschen "so schlau" und "so dumm" zur gleichen Zeit sein?" Wir alle sind schon Menschen begegnet, die auf einem Gebiet oder in einem Bereich, schlau und kompetent waren und in einer viel weniger anspruchsvollen Fragestellung total versagten. Das "geistesabwesende" Genie ist dafür ein Beispiel. Wissenschaftliche Theorien stellen für diesen Menschen kein Problem dar, sich auf einer Party mit anderen Gästen zu unterhalten dagegen schon. In der Praxis finden wir beispielsweise den Strategen, den Spezialisten bezüglich "grösserer Zusammenhänge", der aber gleichzeitig laufend Details übersieht. Wie lässt sich das erklären? Wissenschaftliche Untersuchungen über das Gehirn haben ergeben, dass jeder von uns eine bestimmte Art und Weise zu denken bevorzugt. Dies wiederum beeinflusst unsere Informationsaufnahme und die Verarbeitung von Informationen. Die Kenntnis des eigenen Denkstils und die der Anderen, kombiniert mit der Fähigkeit, ausserhalb seines bevorzugten Denkstils zu agieren, bezeichnet man als Whole-Brain-Thinking®. Ein einfach zu begreifendes Modell beschreibt diese Denkstilpräferenzen. Das Modell wurde von Ned Herrmann während seiner Zeit als Leiter der Führungskräfteentwicklung bei General Electric entwickelt. Ned Herrmann war Physiker und fasziniert davon, wie man mit Hilfe von Erkenntnissen über Vorgänge im Gehirn die oben beschriebene Schlau / Dumm-Frage beantworten konnte. Auf der Grundlage bereits existenter Forschungsergebnisse zum Thema Gehirn und durch seine eigenen Studien fand Herrmann heraus, dass es vier Muster Modi gibt, die die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen im Gehirn modellhaft reflektieren. Das Whole-Brain-Modell ist der physiologische Ansatz, der aus diesem Prozess heraus entstanden ist. Welche sind die vier Denkstilpräferenzen? Unter dem Begriff Whole-Brain-Modell wird die Unterteilung des Gehirns in vier unterschiedliche Quadranten verstanden. Die Quadranten beziehen sich auf unterschiedliche Denkstile. Alle Quadranten besitzen die gleiche Bedeutung. • • • • Der obere linke, blaue, A-Quadrant steht für logisches, analytisches, quantitatives, faktisches Denken. Der untere linke, grüne B-Quadrant bezieht sich auf Details, Planen, Organisieren, und die sequenzielle Informationsverarbeitung. Der untere rechte, rote C-Quadrant ist auf die zwischenmenschlichen, emotionalen Aspekte einer Situation ausgerichtet. Der obere rechte, gelbe D-Quadrant betrifft das Entwickeln und Integrieren von Informationen; es handelt sich um einen intuitiven, ganzheitlichen und kreativen Denkansatz. Wie haben sich meine Denkstilpräferenzen entwickelt? Experten sind sich einig – wir sind ein Produkt aus unseren Anlagen und unserer Erziehung. Der Grad der Abhängigkeit ist seit Jahrhunderten Inhalt von Expertendebatten. Die genetischen Anlagen, mit denen wir geboren werden, repräsentieren das "Natürliche" in uns. Das Gehirn allerdings existiert Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 nicht in einem Vakuum. Jede Interaktion, die wir mit der Welt haben, baut buchstäblich unser Gehirn auf und verändert es. Alles hat einen Einfluss: unsere Eltern, die Schulbildung, die Arbeit und Hobbys. Basierend auf dem Ansatz des Einflusses unserer Umwelt auf unser Leben ging Herrmann’s These davon aus, dass wir zu etwa einem Drittel durch unsere Gene und etwa zu zwei Dritteln aufgrund der Sozialisierung durch das menschliche Umfeld und unsere Tätigkeiten geprägt sind. Das bedeutet Hoffnung für alle, die an persönlichem Wachstum und Veränderung ihres Lebens interessiert sind. Es ist sinnvoll, seine Erfahrungen und deren Reihenfolge zu reflektieren. Es ist ebenfalls sinnvoll, über eine persönliche und professionelle Entwicklungsstrategie zu verfügen, und dabei Wege zu suchen, die den Zugang zu neuen Aktivitäten und Interessen eröffnen. Welche Forschung steht hinter WholeWhole-BrainBrain-Thinking®? Nach der modernen Hirnforschung ist jedes Gehirn einzigartig und das Gehirn im Allgemeinen spezialisiert (z.B. linke Gehirnhälfte versus rechte Gehirnhälfte). Während Experten sich noch über den Spezialisierungsgrad uneinig sind, besteht die Einigkeit darüber, dass Spezialisierung im Gehirn existiert. Das Dominanzkonzept ist ebenfalls anerkannt: Augendominanz, Handdominanz, Fussdominanz, Ohrdominanz und Gehirndominanz. Trotz des symmetrischen Aufbaus unseres Körpers - wir Menschen haben zwei Augen, zwei Hände, zwei Füsse, und zwei Gehirnhälften - sind sich Experten darüber einig, dass der Gebrauch dieser dualen Organe weitgehend asymmetrisch erfolgt. Mit anderen Worten, wir benutzen eine Hälfte mehr als die andere. Die Kombination dieser Nutzungsstrukturen, der Spezialisierung und der Asymmetrie beeinflusst unser Allgemeinverhalten. Innerhalb der beiden Gehirnhälften finden wir zwei Hauptstrukturen vor, die miteinander verknüpft sind. Diese beinhalten die beiden zerebralen Hemisphären, die über den "Corpus Callosum" miteinander verbunden sind, und die beiden Hälften des limbischen Systems, die über den "Hippocampus" verbunden sind. Sie sind die Verbindungen, die für die direkte Kommunikation der beiden Hälften des "cerebralen Systems" und des "limbischen Systems" verantwortlich sind. Warum möchte ich mehr „WholeWhole-Brain“ Brain“ (mit ganzem Gehirn) denken? Whole-Brain-Thinking® gibt Ihnen die Möglichkeit, beides, Ihre Arbeitsleistung und Ihre Kommunikation zu verbessern. Wie oft haben Sie ein Projekt oder eine Aufgabe beendet und sich danach gefragt: "Warum haben wir nicht an diesen Aspekt gedacht?" Oder aber "Warum kann ich mich mit dieser Person einfach nicht verständigen?". Whole-Brain-Thinking® zu nutzen bedeutet, in der Lage zu sein, die Denkstilpräferenzen aller vier Quadranten einzusetzen. Dadurch können Sie jede Situation vergleichend und aus verschiedenen Sichtweisen betrachten. Als Ergebnis haben Sie dann tatsächlich "an alles" gedacht. Im Bezug auf Kommunikation bedeutet das, dass jeder Quadrant seine eigene Sprache als Ausfluss der ihm zugeordneten Denkstilpräferenzen besitzt. Im Normalfall schalten wir ab, wenn jemand einen Sprachstil verwendet, mit dem wir Schwierigkeiten haben. Whole-Brain-Thinking® liefert den Rahmen dafür, "zuzuhören" und mit anderen "zu sprechen". Es erlaubt einem, "wirklich zu hören", was andere sagen, auch wenn diese eine "andere Sprache" sprechen. Sie können Ihre Ideen auf diesem Wege in der Sprache des Denkstils Ihres Gegenübers präsentieren. So werden Kommunikationswege geöffnet und freigeschaltet. Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 In welchen Situationen kann man WholeWhole-BrainBrain-Thinking® anwenden? In jeder Situation, die einen umfangreicheren Gedankenprozess als den eines Quadranten mit dessen spezifischen Eigenschaften erfordert. Es folgen drei Beispiele für häufige Anwendungen von Whole-Brain-Thinking®: Entscheidungsfindung Die meisten Entscheidungen profitieren von einem ganzheitlichen Gedankenprozess. Wir benutzen hierfür einen Ansatz, den man "walk around" nennt. Ein typisches Beispiel ist der Kauf eines Autos. Quadrant A-Denker schauen sich die Informationen vorzugsweise über die technischen Leistungen des Fahrzeuges im Internet an. Quadrant B-Denker lesen die Kundenberichte, um Daten zur Verlässlichkeit und zu praktischen Merkmalen des Fahrzeuges zu erhalten (z.B. Kofferraumgrösse, Sicherheitsbewertung usw.). Personen aus dem C Quadranten fahren eine "Testrunde" mit dem Auto, um festzustellen, ob sich das Fahrzeug ihrer Wahl für sie "richtig anfühlt" und der D Quadrant-Denker wird sein Augenmerk auf ästhetische Merkmale, wie Farbe, Styling und Neuheiten eines Fahrzeugmodels richten. Whole-Brain-Thinking® zu nutzen bedeutet, in allen vier Quadranten zu denken, was einem einerseits mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Entscheidungsfindung verschafft und andererseits unerwartete Überraschungen zu vermeiden hilft. Nur den Denkstil eines Quadranten einzusetzen, wird oft zu einem schlechteren Ergebnis führen. Stellen Sie sich eine Person vor, die ein Auto auf Grund seines Erscheinungsbildes, der Fahrweise und des Fahrgefühls kauft, dabei aber übersieht, die Grösse des Kofferraums zu prüfen, und nach dem Kauf feststellt, dass die Golfschläger im Kofferraum keinen Platz haben! Teambeziehungen Teambeziehungen Die meisten Teams werden mit der Einstellung gebildet, von den Unterschieden der einzelnen Teammitglieder per Synergie zu profitieren. In vielen Fällen beeinträchtigen jedoch eben diese Unterschiede in den Denkstilen die Teamperformance. Whole-Brain-Thinking® kann Teams dabei helfen, die Unterschiede zwischen einzelnen Teammitgliedern und die daraus resultierenden Folgen für das Team wahrzunehmen, Kommunikationsprobleme und Konflikte zu beseitigen und dann diese Unterschiede dafür zu nutzen, das Ideenpotenzial seiner Teammitglieder mit grösserem Erfolg für die einzelnen Mitglieder und das gesamte Team einzusetzen. Darüber hinaus kann ein Team, das seine Denkstilpräferenzen kennt, die Kommunikation mit anderen Teams und Arbeitsgruppen trotz unterschiedlicher Denkstilpräferenzen zum Vorteil aller deutlich verbessern. Kommunikation Ziel von Kommunikation ist in den meisten Fällen, eine Idee zu vermitteln, Informationen auszutauschen oder jemanden von etwas zu überzeugen. Wie oft haben Sie die frustrierende Situation erlebt, dass Sie versucht haben, jemandem etwas zu erklären und Ihr Gegenüber hat sie einfach nicht verstanden. Um sich effektiv zu verständigen, ist es wichtig, "die Sprache" und Denkweise der Person, mit der sie kommunizieren, zu verstehen. Eine Whole-Brain-Diagnose Ihrer Zuhörerschaft liefert Ihnen wichtige Informationen, damit Sie Ihre Sprache und Präsentation auf Ihre Zuhörer zuschneidern können. Sollten die Denkstilpräferenzen Ihres Publikums unklar sein, so nutzen Sie den "Whole-Brain Ansatz", um sich in allen "Sprachen" Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 auszudrücken. Dies vermindert die Gefahr von gescheiterter Kommunikation und verbessert die Aussicht darauf, dass Ihre Aussagen von Ihrem Publikum wirklich verstanden werden. Ist Präferenz das gleiche wie Kompetenz? Eine Präferenz für einen Arbeitsbereich oder für eine Tätigkeit und die Kompetenz, die nötig ist, diese Handlung oder Tätigkeit auszuführen, sind nicht das Gleiche. Am einfachsten ist es, sich ein Fach in der Schule vorzustellen, das sie wirklich gerne mochten. Ihr Interesse steht für Ihre Präferenz. Sich für etwas zu interessieren, bedeutet aber nicht unbedingt, dass sich daraus Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln, sondern zunächst einmal nur, dass Sie sich gerne gedanklich mit diesen Themen beschäftigen und dass Sie diese Aktivität positiv anregt. Jetzt denken Sie an einen Themen- oder Aufgabenbereich, der Ihnen nicht zusagt oder den Sie sogar ablehnen. Stellen Sie sich vor, Sie treten eine Arbeitsstelle an, die gewisse Kompetenzen in einem solchen Bereich voraussetzt. Es wird Sie einige Mühe, also Energie, kosten, sich diese Kompetenzen anzueignen und es drängt sich die Frage auf, ob Sie dauerhaft an dieser Funktion erfolgreich sein werden. Wir entwickeln häufig Kompetenzen in Bereichen geringerer Präferenz, obwohl wir hierfür mehr Aufwand betreiben und mehr Energie einsetzen müssen als in den Bereichen, in denen unsere Präferenzen liegen. Erfolgswege und Fallen Tipps 1. Der erste Schritt ist die Auseinandersetzung mit den eigenen gedanklichen Prozessen. Denken Sie darüber nach, "wie Sie denken". Schauen Sie sich die Fälle genauer an, bei denen Sie "gedanklich stecken bleiben". 2. Schreiben Sie sich auf, welche Art von gedanklichen Aktivitäten Sie motiviert und welche Sie gedanklich "auslaugt". Planen Sie Ihre Tätigkeiten und seien Sie sich dieser Elemente bei der Planung bewusst. 3. Fangen Sie an, Ihre bevorzugten Quadranten zu definieren, indem Sie herausfinden, welche Art von Denken Sie am meisten befriedigt und interessiert. 4. Finden Sie heraus, wo und wie Ihre mangelnden Präferenzen Ihre Effektivität beeinträchtigen. Gibt es Tätigkeiten, die Sie vermeiden, verschieben oder bei denen Sie nicht die Leistung aufweisen, die Sie gerne erbringen möchten oder die von Ihnen erwartet wird. 5. Suchen Sie sich Hilfestellungen für diese Bereiche. Entweder Sie beschäftigen sich mit Ihren Denkstrukturen, um mehr Whole-Brain zu agieren oder Sie lassen sich durch geeignete Personen helfen. Besuchen Sie Fortbildungen! Erarbeiten Sie sich neue Fähigkeiten! Aber bedenken Sie bitte: Wenn Sie keine Vorliebe für eine Tätigkeit besitzen, werden Sie kaum eine nennenswerte Kompetenz erwerben! 6. Üben Sie sich darin, mit den unterschiedlichen Quadranten zu arbeiten und tun Sie dies im Rahmen eines Hobbys oder einer Aktivität, die Ihnen Spass macht. Wenn Sie beispielsweise gerne "Heimwerken", können Sie Ihren A-Quadranten ausbilden, indem Sie versuchen zu verstehen, wie ein Gerät funktioniert, ihren B-Quadranten stärken, indem Sie ihre Aufmerksamkeit auf Zeiteinteilung und Details richten. An ihrem C-Quadranten arbeiten Sie, indem Sie andere in Ihr Tun einbeziehen und ihnen beibringen, wie man eine bestimmte Tätigkeit ausübt. An Ihrem D-Quadranten üben Sie sich, indem Sie etwas Neues ausprobieren, andere Farben oder ein neues Design verwenden. Fallen 1. Beschränken Sie sich nicht im Wesentlichen nur auf die Denkstile von einem oder zwei Quadranten. Beachten Sie bitte, dass wir alle Zugang zu allen vier Quadranten haben, auch wenn wir den Einen dem Anderen vorziehen! Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 2. Nehmen Sie bitte nicht an, Sie wüssten "auf Anhieb", wie andere denken. Überprüfen Sie diese Annahme zum besseren Verständnis. Stellen Sie Fragen aus unterschiedlichen Richtungen, um einen tieferen Einblick zu gewinnen. 3. Verwechseln Sie bitte nicht Kompetenz mit Präferenz, nur weil Sie annehmen, dass eine Person auf Grund ihrer Präferenzstruktur keine Kompetenz auf einem bestimmten Gebiet besitzen kann. Jeder kann sich Fähigkeiten in Bereichen geringerer Präferenz aneignen, um alltäglichen Herausforderungen gerecht zu werden. 4. Die Präferenzstruktur bietet keine Entschuldigung dafür, sich bestimmten Tätigkeiten zu entziehen. Es ist kontraproduktiv, sich nicht mit weniger bevorzugten Quadranten zu beschäftigen, wenn dies bedeutet, dass man seine Pflichten vernachlässigt oder bedeutsame Chancen nicht wahrnimmt. 5. Erkennen Sie bitte die Komplexität Ihrer Gehirntätigkeit. Verdeutlichen Sie sich bitte, dass Sie Zugang zu Denkstilen aller Quadranten haben. 6. Unterstellen Sie bitte nicht, nur weil eine Person Präferenzen in einem Quadranten besitzt, dass sie auf Grund dessen alle Denkstile, die diesem Quadranten zugeordnet werden, mit der gleichen Vorliebe benutzt. Vergessen Sie nicht, dass jeder Quadrant verschiedene Vorlieben beinhaltet und wir nicht für alle diese Denkstile Präferenzen besitzen. Beispielsweise muss eine Person, die ganzheitliches und intuitives Denken schätzt und anwendet, nicht unbedingt auch kreativ und künstlerisch sein. Wie kann ich mein WholeWhole-BrainBrain-Thinking® verstärken? Ein wichtiger Aspekt von Whole-Brain-Thinking® ist die Möglichkeit, sich in weniger bevorzugten Quadranten "auszustrecken". Eine sinnvolle Metapher ist, sich seine Präferenzen als etwas Elastisches vorzustellen, so als wären sie ein Gummiband, das man je nach Bedarf leicht von einem zu anderen Quadranten ausdehnen kann. Sich in anderen Denkweisen zu üben, sich gedanklich zu "dehnen", wird Ihren gedanklichen Horizont erweitern und Sie werden in der Lage sein, ganzheitlicher an Probleme, Entscheidungen oder Situationen heranzugehen. Beginnen Sie Ihr "Whole-BrainStretching", indem Sie sich das Whole-Brain-Modell ansehen und dann klären, welche der beschrieben Denkstile Sie am meisten herausfordern. Welche Themen werden von Ihnen gerne vernachlässigt und wo geht Ihnen die Zeit und Energie aus? In welche Quadranten fallen diese Aufgabenbereiche und Tätigkeiten? Als nächstes überlegen Sie, zu welchen Tageszeiten Sie Ihre gedanklichen Hochs und Tiefs haben. Wenn Sie ein "Morgenmensch" sind, dann erledigen Sie Ihre Aufgaben am Morgen, wenn Sie sich fit dafür fühlen. Falls Sie ein "Abendmensch" sind, gehen Sie die Aufgaben, die Ihnen am wenigsten zusagen, später am Tag oder in der Nacht an, nämlich dann, wenn Sie sich auf Ihr gedankliches Hoch stützen können. Sie werden sehen, dass sich der Aufwand bei der Bewältigung besonderer Herausforderungen schon dadurch reduziert, weil Ihnen dafür mehr Energie zur Verfügung steht. Eine weitere Möglichkeit, sich Denkstile anderer Quadranten zu bedienen, besteht darin, Personen zur Hilfe zu holen, die Vorlieben für die gefragten Denkstile besitzen. Verbringen Sie Zeit mit diesen Menschen und lernen Sie so, Situationen mit anderem Gedankenprozedere zu lösen! Falls Sie Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, wie der Denkstil eines Quadranten eine bestimmte Aufgabe lösen würde, so stellen Sie sich eine Person vor, die den Denkstil dieses Quadranten für Sie repräsentiert und fragen Sie sich: "Wie würde... mit dieser Situation umgehen?" Ein anderer Weg, sich gedanklich zu "dehnen", besteht darin, Whole-Brain-Thinking® als geistiges Modell bei Ihren tagtäglichen Aufgaben und Projekten aktiv zu praktizieren. Beginnen Sie damit, sich zu überlegen: "Was muss ich tun, damit ich alle vier Quadranten einbeziehe?" Beenden Sie ihre Aufgabe, indem Sie sich nochmals vergewissern, dass Sie alle vier Quadranten bei der Lösung berücksichtigt haben. Beginnen Sie Ihre Tätigkeit mit Denkstilen aus den Quadranten, die Sie normalerweise gerne übersehen. Erstellen Sie ein Vier-Quadranten-Formblatt, teilen Sie dieses in vier Bereiche und schreiben Sie in jede Box die zugehörigen Arbeitsschritte. Je mehr Sie üben, desto routinierter werden Sie in der Handhabung der Denkstile der vier Quadranten. Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 Selbst wenn Sie natürlicherweise Whole-Brain veranlagt sind, können Sie Ihr Whole-Brain-Denken noch verstärken. Sie mögen zwar in einem konkreten Fall immer Denkstile aus allen vier Quadranten berücksichtigen, sind jedoch immer wieder mit einer Situation konfrontiert, die von Ihnen verlangt, noch tiefer mit Denkstilen eines einzelnen Quadranten einzusteigen. Berücksichtigen Sie bitte folgende Beispiele, sich intensiver mit einem Quadranten zu beschäftigen: Für den A-Quadranten vollziehen Sie eine gründliche Zahlenanalyse, zum B-Quadranten entwickeln Sie einen detaillierten Projekt- und Zeitplan, für den C-Quadranten regen Sie eine Diskussion zur Konfliktlösung an und schliesslich erstellen Sie für den D-Quadranten eine langfristige Prognose über die nächsten 8 Jahre. Ich habe von rechter und linker Gehirnhälfte gehört. gehört. Wie aber bekomme ich ein Whole Brain? Bei oberflächlicher Betrachtung besteht das Gehirn aus zwei Hälften und in diesem Rahmen scheint die klassische Zweiteilung rechts / links durchaus eine zutreffende Beschreibung der Struktur des Gehirns zu sein. Bei genauerer Untersuchung zeigen sich jedoch vier Teile anstatt zweier. Diese vier paarweise vorhandenen Teile bestehen aus den zwei cerebralen Hemisphären und den beiden Teilen des limbischen Systems. Die paarweisen Strukturen sind miteinander verbunden, die beiden cerebralen Hemisphären über den Corpus Callosum, die beiden limbischen Hälften über den Hippocampus. Es ist weitgehend bekannt, dass das menschliche Gehirn hoch spezialisiert ist. Die Whole-Brain-Theorie weist spezielle Gehirnmodi nun den vier physiologischen Hirnstrukturen zu. Diese Zuweisung bildet die Basis des "Vier Quadranten Modells". Nachdem Dominanzen nur zwischen paarweisen Strukturen auftreten, haben wir die Grundlage für ein anspruchvolles und brauchbares Modell, das nicht nur aus dem linken und rechten Modus, sondern auch aus dem cerebralen und dem limbischen Modus besteht. Der cerebrale Modus besteht aus den zwei miteinander verbundenen cerebralen Hemisphären und der limbische Modus besteht aus den zwei miteinander verbundenen Hälften des limbischen Systems. Datenerhebungen zeigen auf, dass es eine gleich hohe Anzahl von Menschen mit cerebralen und limbischen, sowohl links- als auch rechtshemisphärischen Ausprägungen gibt. Somit räumt uns das "Vier Quadranten Modell" die Möglichkeit ein, nicht nur zwischen linker und rechter Gehirnhälfte zu unterscheiden. Es erlaubt uns vielmehr weitere Denkstile zu unterscheiden, kognitiv / intellektuell, was die cerebrale Hemisphäre, und strukturiert / emotional, was die limbischen Präferenzen beschreibt. Die Organisation des Gehirns und seine Physiologie sind Bestandteil seiner Ganzheitlichkeit. Das Gehirn ist so aufgebaut, dass spezialisierte Bereiche, die der Verarbeitung von Informationen dienen, mit anderen spezialisierten Gehirnteilen mit anderen Funktionen zusammenspielen. Nehmen wir dieses Bild, so sind wir keine einseitigen, sondern vielseitige Wesen. Das Organisationsmodell erklärt uns, wie das Wechselspiel zwischen den verschiedenen Gehirnmodi und Denkstilansätzen von Dominanzen und Präferenzen bestimmt wird. Ich habe vom HBDI® gehört. Welche anderen Anwendungen gibt es im Rahmen des WholeWhole-BrainBrain-Konzepts? Bekannte Anwendungen des HBDI® und des Whole-Brain-Konzepts: • • • • • • Denkstile Lernstile Textanalyse Kreatives Problemlösen Förderung an Kreativität Design • • • • Zusammensetzung von (Projekt-)Teams Effizienz / Effektivität Potenzialanalyse von TopManagement-Teams Führungskräfteentwicklung Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 • • • • • • • • • • • • • • • • • • Innovation Information Kommunikation Lehren/Lernen Berufswahl/Karriere Veränderungsprozesse Mit Veränderung umgehen Persönlichkeitsentwicklung Personalentwicklung Kommunikations- und Informationsmanagement Unternehmensklima Unternehmenskulturanalyse Unternehmensentwicklung Organisationsentwicklung Paar Profile Team Profile Teamentwicklung Entwicklung der Interaktion in Gruppen und Teams • • • • • • • • • • • • • • • Effektive Meetings & Entscheidungsprozesse Bereichsentwicklung und Strategieumsetzung Strategie & Leitbildentwicklung Synergien Coaching Management-Coaching Projektmanagement Change Management Marktpositionierung Whole-Brain-Audit Kundenorientierung Mergers & Acquisitions Vertriebs- und Verkaufseffektivität Lieferantenmanagement / Customer RelationshipManagement The Business of ThinkingProgramme Ist Gehirndominanz die Folge genetischer Anlagen Anlagen oder das Resultat von Erziehung / Sozialisierung? Beides: Wir sind der Meinung, dass Erziehung / Sozialisierung den weit grösseren Einfluss ausübt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wir gehen davon aus, dass 70% unserer Persönlichkeit von Erziehung / Sozialisierung und 30% von unseren genetischen Anlagen geprägt sind. Es sind die tiefgreifenden Einflüsse von Eltern, Schule, Freunden, Arbeit und Lebenserfahrungen, die unsere geistigen Präferenzen formen. Diese leiten uns darin, was wir tun und wie wir es tun. Wir betrachten diese Erkenntnis als hoffnungsvolle Perspektive, denn wenn wir unsere Lebensumstände verändern, können wir uns auch selbst verändern. Sind der "Gehirndominanz "GehirndominanzWhole-BrainBrain-Konzept valide? Welche minanz-Ansatz" und das WholeNachweise gibt es? Das Konzept der Gehirndominanzen wurde mehrfach bewiesen. Zuerst durch Forschung und Experimente von führenden Wissenschaftlern in der Gehirnforschung wie Roger Sperry, Robert Ornstein, Henry Mintzberg und Michael Gazzanniga. Zweitens wurde es in hunderten von EEGExperimenten, die Ned Herrmann persönlich durchgeführt hat, validiert, und drittens konnte man den Beweis aus den von Ned Herrmann geführten öffentlichen Vorführungen innerhalb von 15 Jahren entnehmen. Viertens dienen die wissenschaftlichen Studien von C. Victor Bunderson und James Olsen of Wicat sowie später die Studien von C. Victor Bunderson und Kevin Ho der Validierung des Modells. Parallel dazu experimentierten Schadty und Potvin an der Universität von Texas zu dieser Frage. Weitere Beweise stammen von mehr als 60 Dissertationen über das HBDI® und das Whole-BrainKonzept. Zusätzlich zu diesen wissenschaftlichen Studien gibt es viele Tausende Stimmen von Personen, die das HBDI® für besonders wertvoll und aussagekräftig für die Beschreibung und das Verständnis ihres persönlichen Lebens und ihrer Arbeitswelt halten. Wurde Teilnehmern die Frage gestellt, ob ihnen dieses Modell dabei geholfen hat, sich selbst, die Menschen, die sie kennen und die Erfahrungen, die sie gemacht haben, besser zu verstehen, so waren die Antworten durchwegs positiv. Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 Warum hat Ned Herrmann die WholeWhole-BrainBrain-Technologie entwickelt? In seiner langjährigen Phase als bildender Künstler hat sich Ned Herrmann oft die Frage nach der Natur und dem Ursprung von Kreativität gestellt. Als Folge seiner Untersuchungen wurde ihm klar, dass die Quelle von Kreativität im Gehirn zu finden ist. Dieser "AHA"- Effekt führte ihn zum WholeBrain-Modell und der Entwicklung des HBDI®. Ned Hermann war Leiter der Führungskräfteentwicklung bei General Electric. Der Erkenntnis, dass das Gehirn als Kreativitätsquelle anzusehen ist, folgte schnell die Ansicht, dass unser Gehirn auch das Zentralorgan unseres Lernprozesses darstellt. Die beiden Tätigkeitsfelder Herrmanns als Künstler und Lehrer erlaubten es ihm, seine neugewonnenen Einsichten als Lehrer beim kreativen Whole-BrainLernen anzuwenden. General Electric unterstützte Neds Experimente und Anwendungen, die dann zur Entwicklung des Whole-Brain-Konzepts und des HBDI® führten. Quelle: Herrmann International Deutschland Das HBDI™/H.D.I. im Detail Jeder Mensch ist einmalig! Jeder Mensch hat Denk- und Verhaltensweisen, die er bevorzugt und die für ihn typisch sind. Sie sind Ausdruck seiner Einmaligkeit und Voraussetzung seiner Autonomie. Diese sogenannten Dominanzen haben sich auf der Grundlage der angeborenen Eigenheiten durch das Elternhaus, die Schulerziehung und Ausbildung und durch die soziale Umgebung entwickelt. Mehr und mehr Menschen verlangen heute, dass ihre Einzigartigkeit anerkannt und berücksichtigt wird. Sie wollen authentisch sein und gestehen diese, unter Umständen unterschiedliche Authentizität, auch anderen Menschen zu. Toleranz zeigt sich dann nicht nur in Duldung der Unterschiede sondern auch in der Anerkennung des besonderen Wertes, den diese Andersartigkeit hat. UNSERE VIER Erst mit wertfreien Erkenntnissen über unsere Denk und Verhaltensweisen können wir unser volles Potenzial nutzen. Der Amerikaner Ned Herrmann, Top-Manager bei General Electric, hat in den 70er Jahren eine Methode entwickelt, individuell unterschiedliche Denkstile sichtbar und damit vergleichbar zu machen. Seine Entwicklung basiert auf Untersuchungen über die menschliche Kreativität. Aus den gewonnenen Erkenntnissen ergab sich ein aufschlussreicher Zusammenhang mit den Ergebnissen der Gehirnforschung, vor allem in den Arbeiten von Paul Broca, Paul MacLean und Roger Sperry. Medizinische Untersuchungen zeigten, dass die beiden Hemisphären des Grosshirns trotz symmetrischer Anlage weitgehend unterschied-liche Funktionen ausüben. Die linke Hemisphäre arbeitet sequentiell, ist also eher für logisch-analytisches Denken geeignet. Die rechte Hemisphäre arbeitet mit Bildern, Mustern und nonverbalen Ideen; sie ist der visionäre Teil des Gehirns. Ned Herrmann entwarf ein metaphorisches Modell des Gehirns, das die Denk- und Verhaltensweisen in vier Kategorien einordnet, so dass sich die vier Quadranten A, B, C und D ergeben. Jeder Mensch hat bevorzugte Lernstile, die seinem Dominanzprofil entsprechen. Der Lernende, der sein Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 UNTERSCHIEDLICHEN ICHS A Rationales Ich begriffliches Denken logisch analytisch rational B Sicherheitsbedürftiges Ich kontrolliert konservativ organisiert strukturiert C Fühlendes Ich zwischenmenschlich zwischenmenschlich emotional musikalisch mitteilsam D Experimentelles Ich bildhaftes Denken einfallsreich intuitiv konzeptionell H.D.I. Profil (Herrmann-Dominanz-Instrument) kennt, kann sich bewusst die für ihn geeigneten Lernerfahrungen suchen. Lehrer und Trainer sollten das berücksichtigen, und versuchen, alle Quadranten anzusprechen, um den Zuhörern ganzheitliches Lernen zu ermöglichen. Das H.D.I. Profil zeigt und erläutert die von Ihnen bevorzugte Art zu denken, zu lernen, zu kommunizieren und Entscheidungen zu treffen. Sie finden auch eine Erklärung dafür, warum Sie mit einigen Leuten besser zurecht kommen als mit anderen. Weiter wird Ihnen klar, warum einige Schulfächer und Aspekte Ihrer Ausbildung für Sie attraktiver oder interessanter waren als andere und weshalb Ihnen auch bei Ihrer Arbeit manche Tätigkeiten mehr liegen und Spass machen als andere. Ein Dominanzprofil ist wertfrei, denn es gibt keine guten oder schlechten Profile. Das H.D.I. Profil zeigt den Denk- und Verhaltensstil eines Menschen. Was aber nicht gemessen wird sind Intelligenz, Geschicklichkeit oder Kompetenz. BEWUSSTES SELBSTMANAGEMENT WIRD MIT HILFE DES HBDI™/H.D.I. PROFILS MÖGLICH. Quelle: Roland Spinola, Herrmann International Deutschland Das Herrmann Dominance Dominance Instrument (HBDI™) im Vergleich mit anderen Instrumenten Das Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI™) ist das weltweit führende Analyseinstrument für Denkstilpräferenzen. Es identifiziert den bevorzugten Ansatz einer Person z.B. hinsichtlich des intuitiven, analytischen, strukturellen und strategischen Denkens. Seine Kenntnis führt bei Einzelpersonen zu einem deutlich steigernden Selbstverständnis. Neben dem HBDI™, früher auch H. D. I. (Herrmann Dominanz Instrument) genannt, gibt es eine Reihe anderer Analyseinstrumente, die sich mit menschlichem Denken und Verhalten beschäftigen. Bei einem direkten Vergleich unterschiedlicher Instrumente ergibt sich oft die Schwierigkeit, dass man “Äpfel mit Birnen” zu vergleichen versucht das ist natürlich möglich, aber nicht immer sinnvoll. Um den Einsatz des HBDI™ bei seinen vielen Anwendungsmöglichkeiten beurteilen zu können, werden hier die wesentlichen Merkmale und Vorzüge dargestellt. Das Modell Das Modell 1. Das HBDI™ berücksichtigt die Ergebnisse der modernen Gehirnforschung 2. Das HBDI™ basiert nicht auf einem Konstrukt Die Entdeckung der speziellen Arbeitsweisen der linken und rechten Grosshirnhälfte hat unser Wissen über das Denken und Verhalten des Menschen entscheidend erweitert und verändert. Ein Modell, das unterschiedliche Denkstile darstellt, kann ohne diese Erkenntnisse nicht mehr auskommen. Das HBDI™ berücksichtigt die beiden bedeutendsten Theorien über Aufbau und Dem HBDI™ liegt kein Konstrukt zugrunde, das z. B. durch die Erhebung bei einer Anzahl anderer Menschen gebildet wurde. Damit wird ein Vergleich mit einer oft nicht ganz durchschaubaren Theorie vermieden. Das führt zu der oben genannten Wertfreiheit und erlaubt gleichzeitig den Vergleich mit eigenen Zielen oder mit Anforderungen, die sich z. B. Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 Funktionsweise des Gehirns: Das dreiteilige Gehirn nach Paul MacLean und die unterschiedlichen Spezialisierungen der beiden Grosshirnhemisphären und verbindet sie zu einem metaphorischen Modell. aus einer Aufgabe oder einer beruflichen Position ergeben. Die Vermeidung des Begriffes “Test” unterstreicht diesen für das HBDI™ sehr wichtigen Sachverhalt. Das Instrument Das Instrument 3. Das HBDI™ ist weltbekannt und international einsetzbar 4. Das HBDI™ ist das Ergebnis umfangreicher Validierungsarbeit Das Instrument existiert heute in der 23. Version, die seit ca. 1989 stabil ist. Die Herrmann Institute sind weltweit in vielen Ländern im Einsatz. Die Zusammenarbeit klappt sehr gut, so dass auch mehrsprachige international arbeitende Kunden betreut werden können, wobei das “Heimatinstitut” die Verantwortung für Koordinierung übernimmt. Der HBDI™ Fragebogen, der auch online ausgefüllt sein kann, liegt inzwischen in 16 Sprachen vor. Ned Herrmann, Erfinder des HBDI™, hat von einem unabhängigen Forschungsinstitut umfangreiche Validierungsstudien durchführen lassen, die bis zum heutigen Tag fortgeführt werden. Eine Zusammenfassung der Validierung befindet sich in seinem Buch “Kreativität und Kompetenz”. Inzwischen wurden sehr viele Dissertationen und andere wissenschaftliche Arbeiten über das HBDI™ veröffentlicht. Weitere Unterlagen stehen dem wissenschaftlich Interessierten über die Ned Herrmann Group in USA zur Verfügung. Das Profil Das Profil 5. Das Profil wird unmittelbar als stimmig und anschaulich erlebt 6. Das HBDI™HBDI™-Profil ist veränderbar Das HBDI™ ist eine Selbstanalyse – nahezu alle Teilnehmer erleben das Ergebnis als “stimmig”. Ned Herrmann nennt dies “face validity”. Die Profildarstellung trägt den unterschiedlichen Denkstilen Rechnung: Die graphische Darstellung für den mehr visuellen Denkstil und die tabellarische Auflistung für die Detailanalyse. Die Farben unterstützen die Anschaulichkeit. Die Analyse nach dem HBDI™ trägt der Tatsache Rechnung, dass wir wachsen können. Das Profil ist nicht starr, wir können uns ändern, wenn wir das wollen - das wird von vielen Menschen als eine “Botschaft der Hoffnung” empfunden und macht ihnen Mut, sich auf Veränderungen einzulassen. Die Darstellung Anwendung 7. Das HBDI™ erlaubt die Darstellung von Gruppen und von Durchschnittsprofilen 8. Anwendung und Einsatz des HBD™ TeamTeamProfils Der Einsatz des HBDI™ Team-Profils bringt die Erkenntnis über Unterschiede, Stärken und Entwicklungspotenziale einer Gruppe oder eines Teams. Das Gruppenprofil ermöglicht folgende Anwendungen: - Zusammensetzung von (Projekt-)Teams - Entwicklung der Interaktion in Teams - Teamentwicklung - Potenzialanalyse von TopmanagementTeams Ein wesentlicher Vorzug des HBDI™ besteht darin, die Zusammensetzung von Gruppen darzustellen und so mit einem Blick das Besondere einer Gruppe zu erkennen. Einen weiteren Vorzug stellt die Möglichkeit des Durchschnittsprofils dar: Damit können typische Profile von Gruppen dargestellt werden, z. B. Berufe. Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 Die Auswertung 9. Das HBDI™ wird zentral ausgewertet Die Auswertung des HBDI™ in Zentraleuropa erfolgt durch Herrmann International Deutschland. Dies hat erhebliche Vorteile: Die Integrität des Auswertungsalgorithmus und Datenschutz werden gewahrt. Die Ergebnisse stehen in hoher, gleichbleibender Qualität stets zur Verfügung. Zusatzauswertungen, z. B. PaarGruppenprofile, Durchschnittsprofile und Statistiken sind per Computer beliebig möglich. Der Service 10. Das HBDI™ wird durch einen hervorragenden Service unterstützt Bei Herrmann International Deutschland stehen erfahrene und sehr kundenorientierte Mitarbeiter/innen zur Verfügung, die einen raschen und an den Bedürfnissen des Kunden orientierten Service bieten. Neben der Auswertung gibt es eine Reihe von Produkten rund um das HBDI™ die den Trainern und Berater die Arbeit erleichtern, u. a: Bücher, Trainerhandbuch, Spiele und Übungen, über 100 Farbfolien, Manuskripte, Themenpakete und Sonderdrucke. Die Anwendung Weitere Vorteile 11. 11. Das HBDI™ ist nicht auf eine Anwendung (z. B. Team oder Lernstil) begrenzt 12. Die Auswertungssoftware: HTMS™HTMS™Herrmann Thinking Management System Die Liste der Anwendungen des HBDI™ ist nicht begrenzt, da einerseits alle menschlichen Aktivitäten von der einmaligen Ausprägung unserer Denk- und Verhaltensstile bestimmt werden und andererseits kein vorgegebenes Konstrukt einschränkend wirkt. Die folgenden Beispiele zeigen die Vielfalt der Anwendungen: - Kommunikation + Konfliktbewältigung - Teambildung - Kreatives Problemlösen - Berufsberatung, Ausbildungswahl - Personalberatung - Lehren und Lernen Die Auswertungssoftware HTMS™ bietet hohe Funktionalität und Stabilität des Systems durch moderne Servertechnologie und -handling. Sie ist internetbasiert: Der Zugriff auf HTMS™ und sofortige Auswertung und Ansicht der Profilergebnisse ist für lizenzierte HBDI™ Trainer von überall aus und jeder Zeit möglich. Die autorisierten Trainer können die Daten selbstständig verwalten, Passwörter vergeben und Profile ausdrucken. Dabei wird die hohe Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche des HTMS™ sehr geschätzt. Bemerkenswert ist die Vielfalt der Auswertungsmöglichkeiten, z.B. Statistiken, Stressprofil, Profilschwerpunkt des Teams in der Dominanzverteilung. Weitere Vorteile 14. Geschichte HBDI™/ H. D. I. in Deutschland 13. 13. Das Ergebnis der Auswertung ist wertfrei Ein besonderer Vorzug des HBDI™ ist seine Wertfreiheit. Die Analyse zeigt bevorzugte Denkund Verhaltensstile im Vergleich (“Dominanz eines Stils gegenüber einem anderen”) und vermeidet damit absolute Beurteilungen. Es wird dem Teilnehmer kein “Weltbild” aufgedrängt, das Wertmassstäbe für “gut” und “schlecht”, “richtig” und “falsch” vorgibt. Dadurch ist ein angst- und vorurteilsfreier Umgang mit den Ergebnissen möglich, was sich in einer grösseren Bereitschaft zur Offenlegung der Ergebnisse durch den Roland Spinola hat jahrzehntelange Erfahrung als Führungskraft in den Bereichen Vertrieb und Personalentwicklung der IBM Deutschland. Er hat 1982 die Lizenz für das HBDI™/H. D. I. in Deutschland erworben und seit dieser Zeit das Instrument im deutschsprachigen Raum eingeführt. Fragebogen und Auswertungsunterlagen wurden von ihm ins Deutsche übertragen und bilden heute die offiziell von der Herrmann International, USA, anerkannte Fassung. Die Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 Teilnehmer zeigt. Mitarbeiter von Herrmann International Deutschland arbeiten eng mit dem weltweiten Netz von Herrmann International zusammen. Literatur: Joachim Bauer, Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern steuern, teuern, München, Piper Verlag GmbH, 2007 Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit. Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren, München, Heyne Verlag, 2008 Ned Herrmann, Das GanzhirnGanzhirn-Konzept für Führungskräfte, Führungskräfte Wirtschaftsverlag Überreuther Wien, 1997 Ned Herrmann: Kreativität und Kompetenz. Das einmalige Gehirn. Mit dem Originalfragebogen. Fulda: Paidia-Verlag, 1991 Ned Herrmann, The Creative Brain, The Ned Herrmann Group: Brain Books, Lake Lure, NC, 1989, ISBN: 0-944850-02-2 Ned Herrmann: Whole Brain Business Book. Harnessing the Power of the Whole Brain Organis Organisation and the Whole Brain Individual, Individual, New York, 1995 Martina SchimmelSchimmel-Schloo, Lothar J. Seiwert, Hardy Wagner (Hrsg.), PersönlichkeitsModelle, PersönlichkeitsModelle, mit CD-ROM, Offenbach, Gabal Verlag GmbH, 2002, ISBN: 3-89749-180-X Michael Sänger (Hrsg.), (Hrsg.), Persönlichkeitsprofile. Schärfen Sie Ihr Profil durch: Transaktionsanalyse, HirnHirnDominanz--Instrument, kreatives Dominanz reatives und laterales Denken, Denken, Rollenspiele, Rollenspiele, Imagebildung, Imagebildung Bonn, Verlag Beste Unternehmensführung, 1996 Roland Spinola, Frank D. Peschanel: Das HirnHirn-DominanzDominanz-Instrument (HDI) - Grundlagen und Anwendungen ungen des NedAnwend Ned-HerrmannHerrmann-Modells für die Personalentwicklung, Personalentwicklung, Speyer, Gabal Verlag GmbH, 1992 Thomas Fuchs, Das Gehirn - ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologischphänomenologisch-ökologische Konzeption, Konzeption, Kohlhammer Verlag, 2007, ISBN-10: 3170192914 Walter Simon (Hrsg.), (Hrsg.), Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests Persönlichkeitstests, sts, GABAL Verlag GmbH, 2006, ISBN: 3897496364 Einige der interessanten Websites: Google Suchbegriff/Thema Website Geschichte der Gehirnforschung Gehirn http://www.robert-illing.de/ Anzahl der Ergebnisse Im Google am 25.05.2010 104‘000 http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn 3'630'000 Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. Whole Brain Thinking™ - Potenziale erkennen und nutzen Ergänzende Dokumentation zum Netzwe etzwerktreffen werktreffen vom 28.05.2010 Das menschliche Gehirn Spektrum der Wissenschaft Verlag http://www.spektrumdirekt.de/artikel/979577&_z=798884 493‘000 http://www.wissenschaft-online.de/artikel/1034197&_z=859070 23.05.2010 Gen-Schalter bewahren Erinnerungen Potenziale erkennen Potenziale erkennen Gehirn An der 3. Stelle 80'700 25‘700 http://potentialscout.patrickhaas.de/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=27 HBDI-Potential-Profil: Das bekannte und weltweit genutzte Analysetool potenziale erkennen hbdi potenziale erkennen hbdi unternehmensführung Die Entwicklung des Gehirns von der Zeugung bis zum Schulanfang Gehirnentwicklung und Lernen im Kleinkindalter Konsequenzen für die Erziehung im Kindergarten herrmann brain dominance instrument Beziehung verändert Gehirn 149 68 http://www.erziehungstrends.de/Gehirn/Entwicklung 1'380'000 http://www.kindergartenpaedagogik.de/779.html 2‘930 http://en.wikipedia.org/wiki/Herrmann_Brain_Dominance_Instrument 23‘900 http://www.ifzn.uni-mainz.de/Dateien/Text_Fuchs.pdf 1'010'000 http://www.orgportal.org/index.php?id=12&tx_ttnews[pointer]=10&tx _ttnews[tt_news]=688&tx_ttnews[backPid]=3&cHash=1e29a194db Neurodidaktisches Lernzentrum Neue Lernhilfe Zürich Seebacherstr. 22 8052 Zürich 044 300 31 13 www.lernhilfe-zh.ch www.nlz-hbdi.com. It all began with Ned Herrmann Ned Herrmann (1922-1999) Pioneer of creative thinking in the corporation and founder of Whole Brain Technology Ned Herrmann was equally at ease in the classroom, the office, the artist's studio, the research laboratory, and the boardroom. In each of these situations, he aspired to be a "living example" of the whole brain concepts he developed. For the last two decades, he dedicated his life to applying brain dominance theory to teaching, learning, increasing self-understanding and enhancing creative thinking capabilities on both an individual and corporate level. Ned's contribution to the universal application of brain dominance brought him worldwide recognition. In 1992, he received the Distinguished Contribution to Human Resource Development Award from ASTD - an honor symbolic of the significance of Ned's work. He keynoted world conferences on Creativity, Gifted and Talented Children, Instructional Systems Design, Training & Development, Creative Management and Cerebral Dominance just in the last few years. In 1993, he was elected President of The American Creativity Association. Ned was inducted into the HRD Hall of Fame in February 1995 at the Training '95 Conference in Atlanta. He received an Honorary Doctor of Science from the University of Alaska Fairbanks in May 1995. Though known today as a master of human resource development, in college Ned studied the sciences and performing arts. He majored in both physics and music. This dual interest in both the arts and sciences seemed to pull him in two different directions but continued to intrigue him throughout his long career with General Electric. With this background, Ned was well prepared for what would eventually become his life's work: to integrate the scientific study of the brain with the study of creative human development, in his search for the nature and sources of creativity. Ned became Manager of Management Education for GE in 1970. With his primary responsibility of overseeing training program design, the issue of how to maintain or increase an individual’s productivity, motivation, and creativity were serious concerns. A prolific painter and sculptor himself, personal experience was a valuable resource. In fact, Ned's participation in an art association panel on creativity first opened his eyes to the burgeoning research on brain function, particularly with regard to the left and right hemispheres of the cerebral cortex. He integrated his own concepts with Left Brain/Right Brain and Triune Brain theories into a new "brain dominance technology" which produced immediate and dramatic advances in an individual's self-understanding, productivity, motivation, and creativity. In 1978, Ned created the Herrmann Participant Survey Form to profile workshop participant's thinking styles and learning preferences in accordance with brain dominance theory. Sponsored by GE, he developed and validated the Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI), the scored and analyzed Participant Survey, and designed the Applied Creative Thinking Workshop (ACT), which has been internationally recognized as a leading workshop on creative thinking. Continuing research and application of the HBDI led to the development of a comprehensive four part Whole Brain Model, which Herrmann International continues to use today. Ned was featured in Business Week, New Age Journal, Discover, USA Today, Training and Reader's Digest. These are just a few of the many national, as well as international publications that have acknowledged his work. He was named Brain Trainer of the Year in 1989 by ASTD was included in the Executive Excellence Magazine's listing of 100 personalities with unique perspectives on Management and Leadership. Ned's successful book, The Creative Brain, now available in paperback, allows laymen and professionals to benefit from his knowledge of thinking and learning styles, brain function, creativity and training. Ned's second book, The Whole Brain Business Book, was published by McGraw-Hill in 1995. Ned’s wife, Margaret Herrmann, and his three daughters are actively involved in the work that Ned began. Ned passed way on December 24, 1999 after a valiant battle with cancer. PERSONAL CURRICULUM VITAE WILLIAM E. "NED" HERRMANN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Legion of Merit, US Army Air Force • • Elected President of the American Creativity Association, 1993, 1995 • • • • • • • • Honorary Doctor of Science, University of Alaska, Fairbanks, 1995 Silver Star, US Army Air Force Bachelor of Arts double major in Physics and Music Cornell University, Class of 1943 Graduate Studies R.P.I., New York University Soloed in both Carnegie Halls, New York and Pittsburgh Leads in six Light Operas and twelve Civic Plays, Schenectady, NY Schenectady Man of the Year, Junior Chamber of Commerce, 1958 15 one-man art shows Over sixty blue ribbons in art shows, 1969 through 1980 President of the Stamford Art Association Founder and Chairman of the Ned Herrmann Group, Inc. Author, The Creative Brain, 1988 Distinguished Speaker Award, Institute of Management Studies, 1989 13 Keynote presentations at multinational, world-level conferences Creative Leadership Award, DuPont Corporation, 1990 Brain Trainer of the Year Award, ASTD, 1990 Author, What Will I Be When I Grow Up? ASTD Distinguished Contribution to Human Resource Award, 1991 Who's Who Among Leading American Executives, 1993 Colleague of the Creative Education Foundation, 1994 Young President’s Organization, National Award for Most Innovative Program, 1994 Hall of Fame Award for Human Resource Development by Training Magazine, 1995 Who's Who Among Famous Americans, 1995 Honorary Doctor of Humane Letters, Franklin University, Columbus, Ohio, 1995 Author The Whole Brain Business Book McGraw-Hill, 1996 Charter Member, Franklin University Advisory Board, 1997 Charter Member, American Creativity Association Advisory Board, 1997 Innovation Achievement Award, Innovation Network, 1997 Lifetime Achievement Award, American Creativity Association, 2000 Ned Herrmann's books Geschichte der Gehirnforschung http://www.robert-illing.de/ Stationen der Gehirnforschung durch die Jahrtausende (c) Prof. Dr. rer. nat. Robert-Benjamin Illing, Neurobiologisches Forschungslabor Universitäts-HNO-Klinik, Killianstr. 5 79106 Freiburg i. Br. Email: [email protected] • • • • • • • • • • • • • • Ab ca. 5000 v.Chr.: Trepanationen (Schädeleröffnungen) werden an lebenden Menschen durchgeführt; die Lage der Öffnungen an den trepanisierten Schädeln scheint keinen Regeln zu folgen, die Größe der Löcher beträgt zwischen einem und etwa fünf Zentimetern Durchmesser; der Anteil an verheilten Trepanationen liegt bei 70%. ca. 2700 v.Chr.: Shen Nung begründet die Akupunktur. ca. 1700 v.Chr.: Das Edwin Smith Papyrus wird als ältestes Dokument einer Beschreibung des Gehirns niedergeschrieben. ca. 500 v.Chr.: Alcmaeon von Kroton präpariert sensorische Nerven und entwickelt die Vorstellung, dass sie hohl seien. 460-379 v.Chr.: Hippocrates erklärt, dass das Gehirn für Empfindung und Intelligenz verantwortlich sei, und beschreibt Epilepsie als eine Störung der Hirnfunktion. 387 v.Chr.: Plato lehrt, dass mentale Vorgänge im Gehirn verankert seien. 335 v.Chr.: Aristoteles weist der Wahrnehmung des Menschen fünf Sinne zu: Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, und erklärt, dass das Herz die Quelle mentaler Prozesse ist. ca. 290 v.Chr.: Herophilus erklärt nach Vivisektionen die Ventrikel des Gehirns als den Sitz menschlicher Intelligenz. ca. 280 v.Chr.: Erasistratos von Koes findet, dass das Gehirn aus verschiedenartig gestalteten Teilen besteht. ca. 100: Marinus von Alexandria beginnt die Hirnnerven paarweise zu nummerieren und beschreibt den Vagus. 177: Galen lehrt "Über das Gehirn" und betrachtet den Inhalt der Ventrikel, den Spiritus animalis, als Vermittler zwischen Wahrnehmung und Bewegung. 705: In Baghdad wird ein Haus für Geisteskranke eingerichtet. ca. 900: Ahmed ibn Sahl al-Balkhi schreibt über den "Lebensunterhalt für Leib und Seele". ca. 1020: Alhazen (Ibn al-Haitham) widerspricht der Lehre von den Sehstrahlen, die vom Auge ausgehen (Euklid, Ptolemäus) und erklärt, dass das Sehen nicht im Auge sondern im Gehirn stattfindet. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ca. 1250: Albertus magnus schreibt, dass sich drei Ventrikel im Gehirn befinden: ein vorderer, ein mittlerer und ein hinterer; der Fluß des Spiritus animalis von einem Ventrikel in den nächsten vermittelt den Prozess von der Wahrnehmung über das Denken zur Erinnerung; der Römische Brunnen wird als Modell für die Hirnfunktion angeführt. 1504: Leonardo da Vinci fertigt Wachsausgüsse der Ventrikel des menschlichen Gehirns an. 1538: Andreas Vesalius veröffentlicht seine "Tabulae Anatomica". 1543: Vesalius publiziert "On the Workings of the Human Body" und erwähnt darin Zirbeldrüse und Balken. 1550: Vesalius beschreibt den Wasserkopf. 1561: Gabriele Falloppio beschreibt einige Kranialnerven. 1562: Bartolomeo Eustachio schreibt sein Buch "The Examination of the Organ of Hearing". 1564: Aranzi prägt den Ausdruck Hippocampus. 1573: Constanzo Varolio benennt die Brücke (Pons Varolii). 1583: Felix Platter erklärt, dass die Augenlinse zur Fokussierung des Bildes auf dem Augenhintergrund dient. 1586: Piccolomini unterscheidet zwischen Grauer und Weißer Substanz der Hirnrinde. 1604: Johannes Kepler beschreibt das invertierte Bild auf dem Augenhintergrund. 1609: J. Casserio beschreibt die Mammilarkörper. 1621: Robert Burton verfasst "Die Anatomie der Melancholie". 1641: Franciscus de la Boe Sylvius beschreibt die große seitliche Fissur an der Hirnoberfläche (Sylvische Fissur). 1649: René Descartes erklärt die Zirbeldrüse als Kontaktstelle zwischen Körper und Geist und verwendet die Orgel als Modell für die Hirnfunktion. 1650: Sylvius beschreibt die enge Passage zwischen dem 3. und 4. Ventrikel (Aqueductus Sylvii). 1660: Giovanni Borelli zeigt, dass der Spiritus animalis nicht gasförmig ist und vermutete stattdessen einen Nervensaft (Succus nerveus). 1664: Thomas Willis veröffentlicht seine "Cerebri anatome"; Willis erklärte die Windungen der Großhirnrinde als Sitz des Gedächtnisses, die weiße Substanz der Hemisphären als Sitz der Imagination, das Corpus striatum sei für Wahrnehmung und Bewegung zuständig, während das Kleinhirn und die ihm anliegenden Regionen alle unwillkürlichen Funktionen des Nervensystems bewirken sollten. 1664: Willis beschreibt den 11. Hirnnerven. 1664: Gerardus Blasius entdeckt und benennt die mittlere Hirnhaut (Arachnoidea). 1665: Nicolaus Stenonis (Steno) präsentiert seinen "Discours sur l'anatomie du cerveau". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1668: Abbé Edme Mariotte entdeckt den Blinden Fleck. 1670: William Molins benennt den Nervus trochlearis. 1681: Willis prägt die Bezeichnung Neurologie. 1695: Humphrey Ridley beschreibt den Corpus restiforme (unterer Kleinhirnstil). 1704: Antonio Valsalva publiziert sein "On the Human Ear". 1709: Domenico Mistichelli beschreibt die Kreuzung der Pyramidenbahn. 1717: Antony van Leeuwenhoek beschreibt hohle Nervenquerschnitte unter dem Mikroskop. 1736: Jean Astruc prägt den Terminus Reflex. 1738: Jan Swammerdam glaubt nachgewiesen zu haben, dass die Nervenfunktion nicht auf dem Fluß eines Spiritus animalis beruhen könne. 1753: Alexander Monro beschreibt das nach ihm benannte Foramen Monroe; seine Untersuchungen ergeben keine Hinweise auf hohle Nerven. 1772: John Walsh experimentiert mit elektrischen Fischen. 1774: Franz Anton Mesmer lehrt über tierischen Magnetismus. 1776: Michele Vicenzo Giancinto Malacarne publiziert ein Buch über das Kleinhirn. 1776: Francesco Genari beschreibt den nach ihm benannten Streifen durch Schicht 4 des primären visuellen Kortex. 1777: Philip Meckel vermutet, dass das Innenohr mit Flüssigkeit gefüllt ist. 1779: Antonius Scarpa beschreibt das Ganglion des vestibulären Systems (Scarpa's Ganglion). 1781: Felice Fontana beschreibt mikroskopische Eigenschaften des Axoplasmas. 1782: Francesco Gennari beschreibt den Streifen von Gennari im visuellen Kortex. 1786: Felix Vicq d'Azyr entdeckt den Locus coeruleus. 1791: Luigi Galvani präsentiert seine Arbeiten über die elektrische Stimulation von Nerven und Muskeln des Frosches. 1794: John Dalton beschreibt die Farbenblindheit. 1796: Johann Christian Reil beschreibt die Insula (Reil'sche Insel). 1796: Samuel T. Soemmerring veröffentlicht sein Buch "Über das Organ der Seele", mit einem Nachwort von Immanuel Kant. 1804: Friedrich Wilhelm Adam Sertürner isoliert Morphium aus Opium. 1805: Felix Vicq d'Azyr entdeckt den Nucleus ruber. 1808: Franz Joseph Gall publiziert seine "Phrenologie". 1809: Johann Christian Reil benutzt Alkohol um das Hirngewebe zu härten. 1809: Luigi Rolando reizt die Hirnrinde galvanisch. 1811: Julien Jean Legallois entdeckt das Atemzentrum im Hirnstamm. 1811: Charles Bell erkennt den funktionellen Unterschied zwischen dorsalen und ventralen Rückenmarkswurzeln; die gleiche Entdeckung macht Magendie wenig später (Bell-Magendie-Gesetz). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1813: Felix Vicq d'Azyr entdeckt das Claustrum. 1817: James Parkinson publiziert "An Essay on the Shaking Palsy" (Parkinson'sche Krankheit), der erste Bericht über diese Krankheitsform. 1822: Friedrich Burdach benennt den Gyrus cinguli und unterscheidet zwischen medialem und lateral Corpus geniculatum. 1823: Marie-Jean-Pierre Flourens erklärt, das Kleinhirn reguliere motorische Aktivität. 1824: Flourens führt Ablationen durch, um Verhalten zu studieren. 1824: Francois Magendie liefert erste Hinweise auf die Rolle des Kleinhirns für den Gleichgewichtssinn. 1825: Jean-Baptiste Bouillaud präsentiert Patienten, denen nach Frontalhirnverletzungen die Sprache verloren ging. 1825: Luigi Rolando beschreibt den Sulcus, der den präzentralen vom postzentralen Gyrus trennt (Sulcus rolandi). 1825: Johannes Müller formuliert das Gesetz von der spezifischen Energie der Sinnessubstanzen. 1827: Francois Magendie entdeckt das Foramen von Magendie. 1836: Gabriel Gustav Valentin identifiziert Kern und Kernkörperchen von Nervenzellen. 1836: Robert Remak beschreibt myelinisierte und unmyelinisierte Nervenfasern. 1837: Jan Purkinje beschreibt große Neurone im Kleinhirn (Purkinje-Zellen) und dokumentiert die zelluläre Natur der Gewebeschichtung. 1838: Carlo Matteucci leitet Ströme von Muskeln ab. 1838: Robert Remak vermutet, dass Nervenfasern aus Nervenzellkörpern entspringen. 1838: Theordor Schwann beschreibt die Zellen, die im peripheren Nervensystem die Myelinscheide bilden (Schwann'sche Zellen). 1839: Schwann und Matthias Schleiden begründen die Zellentheorie. 1840: Adolph Hannover verwendet Chromsäure, um das Nervengewebe für die Mikroskopie vorzubereiten. 1840: Jules Gabriel Francois Baillarger beschreibt den 6-schichtigen Aufbau der Grauen Substanz der Großhirnrinde sowie ein horizontales Netz myelinisierter Nervenfasern auf Höhe der Schicht 4 (Baillarger-Streifen). 1842: Benedikt Stilling untersucht das Rückenmark in Serienschnitten. 1842: Crawford W. Long verwendet Äther als Narkotikum für den Menschen. 1843: Emil du Bois-Reymond beweist die Identität des Spiritus animalis mit einem elektrischen Strom. 1843: James Braid prägt den Ausdruck Hypnose. 1844: Horace Wells verwendet Lachgas als Narkotikum. 1846: Carl Gustav Carus veröffentlicht sein Buch "Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele". 1847: James Young Simpson verwendet Chloroform als Narkotikum. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1848: Phineas P. Gage erleidet und überlebt Frontalhirnläsion durch einen Eisenstab, der Schädel und Gehirn durchstößt. 1849: Hermann von Helmholtz zeigt, dass die Geschwindigkeit der Nervenleitung viel langsamer ist als die des Lichtes. 1850: Augustus Waller beschreibt degenerierende Nervenfasern im histologischen Schnitt. 1851: Heinrich Müller beschreibt die Farbpigmente in der Netzhaut. 1851: Marchese Alfonso Corti beschreibt das Rezeptororgan im Innenohr (Corti'sches Organ). 1852: Albert Kölliker beschreibt den Ursprung von Nervenfasern in Rückenmarksneuronen. 1853: George Meißner beschreibt eingekapselte Nervenendigungen in der Haut (Meißner-Körperschen). 1853: William Benjamin Carpenter erklärt die 'sensorischen Ganglien' im Thalamus als Ursprung bewussten Wahrnehmens. 1854: Louis P. Gratiolet beschreibt die Furchung der Hirnrinde. 1855: Bartolomeo Panizza kann zeigen, dass die Occipitalrinde wichtig für das Sehvermögen ist. 1855: Richard Heschl beschreibt den transversalen Gyrus des Temporallappens der Hirnrinde (Heschl's Gyrus). 1859: Charles Darwin veröffentlicht sein Buch "Ursprung der Arten". 1860: Albert Niemann reinigt Kokain. 1860: Gustav Theodor Fechner veröffentlich seine "Elemente der Psychophysik". 1861: Paul Broca vermutet laterale Differenzierungen der Hirnrindenfunktionen. 1861: Thomas Henry Huxley prägt den Ausdruck Sulcus calcarinus. 1863: Ivan M. Sechenov veröffentlicht "Reflexes of the Brain". 1863: Nikolaus Friedreich beschreibt eine fortschreitende, vererbbare Degeneration des Zentralnervensystems (Friedreich's Ataxie). 1864: John Hughlings Jackson schreibt über den Verlust von Sprache nach Hirnverletzungen. 1865: Otto Friedrich Karl Deiters unterscheidet zwischen Protoplasmafortsätzen (später Dendriten genannt) und Achsenzylinder (später Axon genannt) und beschreibt den Nucleus vestibularis lateralis (Deiters'scher Kern). 1866: John Langdon Haydon Down veröffentlicht sein Werk über angeborene Idiotie. 1866: Julius Bernstein vermutet, dass der Nervenimpuls aus einer 'Welle negativer Ladungen' besteht. 1867: Theodore Meynert führt detaillierte histologische Untersuchungen der Hirnrinde durch. 1868: Bernstein registriert den Zeitverlauf des Aktionspotentials. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1869: Francis Galton behauptet die Vererbbarkeit von Intelligenz. 1870: Eduard Hitzig and Gustav Fritsch entdecken den motorischen Kortex durch elektrische Stimulation der Hirnrinde von Hunden und Katzen. 1871: Weir Mitchell beschreibt das Phänomen des Phantomschmerzes. 1871: Louis-Antoine Ranvier beschreibt die periodischen Einschnürungen von Nervenfasern (Ranvier'sche Schnürringe). 1872: George Huntington beschreibt die Symptome eines vererbbaren Veitstanzes (Chorea Huntington). 1872: Du Bois-Reymond hält seine Rede "Über die Grenzen des Naturerkennens" mit dem berühmt gewordenen, auf die Gehirnforschung bezogenen Schlusswort Ignorabimus: wir werden nicht wissen. 1873: Camillo Golgi veröffentlicht das erste Manuskript über die Verwendung von Silbernitrat für die 'Schwarze Reaktion' (la reazione nera) in der Neurohistologie. 1874: Vladimir Alekseyevich Betz beschreibt große Pyramidenzellen in der Großhirnrinde (Betz-Zellen). 1874: Roberts Bartholow führt elektrische Reizungen an der menschlichen Hirnrinde durch. 1874: Carl Wernicke veröffentlich "Der aphasische Symptomencomplex". 1875: David Ferrier unterscheidet verschiedene Regionen des motorischen Kortex. 1875: Richard Caton registriert elektrische Ströme von der Hirnrinde. 1875: Wilhelm Heinrich Erb und Carl Friedrich Otto Westphal beschreiben den Kniesehnenreflex. 1876: David Ferrier veröffentlicht "The Functions of the Brain". 1876: Franz Christian Boll entdeckt das Rhodopsin. 1876: Francis Galton verwendet die Termini "nature and nurture" um den Unterschied zwischen Einflüssen der Vererbung und der Umwelt auf Verhaltensleistugen zu erläutern. 1877: Jean-Martin Charcot veröffentlicht seine "Lectures on the Diseases of the Nervous System". 1878: Claude Bernard beschreibt die blockierende Wirkung von Curare auf Nerven und Muskeln. 1878: Paul Broca publiziert "Le grand lobe limbique". 1879: Golgi beschreibt das Muskelsehnenorgan (Golgi-Sehnenorgan). 1879: Wilhelm Wundt gründet in Leipzig das erste Institut für Psychologie um menschliches Verhalten zu erforschen. 1880: Jean Baptiste Edouard Gelineau prägt den Ausdruck Narcolepsie. 1880: Friedrich Sigmund Merkel beschreibt freie Nervenendigungen in der Haut (Merkel'sche Scheiben). 1881: Hermann Munk beschreibt Störungen des Sehens nach Entfernung des Occipitallappens bei Hunden. 1883: Victor Horsley beschreibt die Wirkung von Lachgas als Anästhetikum. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1883: Emil Kraepelin unterscheidet zwischen Neurosen und Psychosen. 1884: Franz Nissl beschreibt das granuläre endoplasmatische Retikulum (Nissl-Substanz). 1885: Carl Weigert führt Hematoxylin als Färbemittel in die Neurohistologie ein. 1885: Hermann Ebbinghaus unterscheidet in seinem Buch "Über das Gedächtnis" zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. 1886: Vittorio Marchi publiziert ein Färbeprotokoll zur Darstellung degenerierenden Myelins. 1887: Sergei Korsakoff beschreibt die Symptome, die als Folge übermäßigen Alkoholkonsums entstehen (Korsakoff Syndrom). 1889: Santiago Ramón y Cajal begründet die Neurondoktrin mit der Behauptung, dass Nervenzellen eigenständige zelluläre Einheiten seien. 1889: William His prägt den Ausdruck Dendrit. 1889: Victor Horsley beschreibt somatotopische Karten in der motorischen Hirnrinde des Affen. 1889: Franz C. Müller-Lyer entdeckt die Müller-Lyer Täuschung. 1890: Cajal formuliert das Gesetz der dynamischen Polarisierung der Nervenzellen. 1890: William James formuliert seine "Principles of Psychology". 1891: Heinrich Quincke führt die Lumbalpunktion in die Medizin ein. 1891: Wilhelm von Waldeyer prägt den Terminus Neuron. 1891: Sigmund Freud prägt den Ausdruck Agnosia. 1892: Salomon Eberhard Henschen lokalisiert den visuellen Kortex am Sulcus calcarinus. 1893: Paul Emil Flechsig beschreibt die Ontogenese der Myelinisierung des Gehirns. 1893: Charles Scott Sherrington prägt den Terminus Propriozeption. 1894: Nissl färbt neuronale Zellkörper mit Dahlia Violett. 1895: William His benutzt erstmals den Ausdruck Hypothalamus. 1896: Rudolph Albert von Kolliker prägt den Ausdruck Axon. 1896: Joseph Babinski beschreibt das Babinski Zeichen. 1896: Kraepelin beschreibt das Krankheitsbild der Dementia praecox. 1897: Ivan Petrovich Pavlov publiziert seine Arbeit über die Physiologie der Verdauung. 1897: John Jacob Abel isoliert das Adrenalin. 1897: Charles Scott Sherrington prägt den Ausdruck Synapse. 1897: Ferdinand Blum verwendet Formaldehyd als Fixativ für das Hirngewebe. 1897: Felix Hoffmann synthetisiert Acetylsalicylsäure (Aspirin). 1898: Edward L. Thorndike entwickelt die Puzzle Box für Verhaltensversuche. 1898: John Newport Langley prägt den Ausdruck Autonomes Nervensystem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1898: Angelo Ruffini beschreibt eingekapselte Nervenendigungen in der Haut (Ruffini Körper). 1899: Francis Gotch beschreibt die Refraktärzeit zwischen einzelnen Nervenimpulsen. 1900: Freud publiziert seine "Traumdeutung". 1900: Sherrington definiert das Kleinhirn als Kopfganglion des propriozeptiven Systems; Propriozeption, die Eigenwahrnehmung, nennt Sherrinton unseren 'heimlichen sechsten Sinn'. 1900: M. Lewandowsky prägt den Ausdruck Blut-Hirn-Schranke. 1902: Bernstein formuliert die Membrantheorie für Zellen. 1903: Ivan Pavlov prägt den Ausdruck konditionierter Reflex. 1903: Alfred W. Campbell untersucht die Zytoarchitektur der menschlichen Hirnrinde. 1905: Alfred Binet and Theodore Simon entwickeln den ersten Intelligenztest. 1906: Alois Alzheimer beschreibt den vorzeitigen Altersschwachsinn (Alzheimer'sche Krankheit). 1906: Sherrington publiziert "The Integrative Action of the Nervous System". 1907: Ross Granville Harrison führt Experimente mit Nervenzellkulturen aus. 1907: John N. Langley führt das Konzept des molekularen Rezeptors ein. 1908: Vladimir Bechterew beschreibt den Nucleus vestibularis superior. 1909: Harvey Cushing stimuliert erstmals die menschliche sensorische Hirnrinde elektrisch. 1909: Korbinian Brodmann beschreibt 47 diskrete Areale der menschlichen Hirnrinde (Brodmann's Areae). 1911: Eugen Bleuler prägt die Bezeichnung Schizophrenie. 1912: Samuel A.K. Wilson prägt den Begriff Extrapyramidales System. 1913: Santiago Ramon y Cajal entwickelt eine Astrocytenfärbung unter Verwendung von Goldchlorid und Quecksilber. 1913: Edwin Ellen Goldmann findet, dass die Blut-Hirn-Schranke für große Moleküle unpassiertbar ist. 1913: Edgar Douglas Adrian veröffentlicht seine Beobachtungen zum Allesoder-Nichts-Prinzip des Nervenimpulses. 1914: Henry H. Dale isoliert das Acetylcholin. 1914: Joseph Francois Felix Babinski prägt den Ausdruck Anosognosia. 1919: Cecile Vogt beschreibt über 200 verschiedene Regionen der menschlichen Großhirnrinde. 1919: Gordon Morgan Holmes identifiziert die Sehrinde mit der Area striata. 1919: John B. Watson, Begründer des Behaviorismus, erklärt, dass naturwissenschaftliche und psychologische Forschung ohne Verweise auf ein Bewusstsein auszukommen habe. 1921: Otto Loewi publiziert seine Befunde zum Vagusstoff, der sich bald als das Acetylcholin erweist. 1921: Pio del Rio-Hortega beschreibt Microglia-Zellen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1921: Herbert M. Evans und J.A. Long können das Längenwachstum bei Tieren durch Hypophysenextrakte wieder herstellen, nachdem es durch Hypophysektomie verloren gegangen war. 1924: Sherrington entdeckt den Streckreflex. 1928: Ernst Scharrer entdeckt die innere Sekretion und begründet damit die Neuroendokrinologie. 1928: Walter R. Hess berichtet von 'affektiven Reaktionen' nach hypothalamischer Reizung. 1928: Cajal erklärt das erwachsene Gehirn als unfähig zur Regeneration. 1929: Hans Berger publiziert erste Befunde, die er mit dem Elektroenzephalogramm (EEG) am Menschen gemacht hat. 1929: Karl Lashley definiert die Konzepte der Equipotentialität und der Massenwirkung für die Großhirnrinde. 1930: Victor Hamburger beobachtet als erster den planmäßigen Zelltod (Apopthose) während der Ontogenese. 1930: John Carew Eccles kann inhibitorische Wirkungen von Neuronen des Zentralnervensystems nachweisen. 1939: Una Lucy Fielding und Gregor Popa entdecken das Pfortadersystem zwischen Hypothalamus und Adenohypophyse. 1931: Ulf S. von Euler und J.H. Gaddum entdecken Substanz P. 1932: Max Knoll und Ernst Ruska erfinden das Elektronenmikroskop. 1932: Walter B. Cannon prägt den Begriff der Homöostase. 1933: Ralph Waldo Gerard beschreibt das erste experimentell evozierte Potential. 1934: S. Howard Bartley führt Studien über visuell evozierte Potentiale am Kaninchen aus. 1935: Frederic Bremer führt die Präparation des 'cerveau isole' ein und entwickelt das Konzept eines Schlafzentrums im Hirnstamm. 1936: Max Planck schreibt "Vom Wesen der Willensfreiheit". 1936: Egas Moniz veröffentlicht seine Beobachtungen nach frontaler Lobotomie am Menschen; Walter Freeman folgt seiner Methode. 1937: James Papez publiziert seine Beobachtungen zum konnektiven Zusammenhang limbischer Strukturen. 1937: Heinrich Klüver und Paul Bucy veröffentlichen ihre Studien zur beidseitigen temporalen Lobotomie. 1937: John Zachary Young propagiert das Riesenaxon des Tintenfischs als Modell für Nervenzellfunktionen. 1938: Burrhus Frederic Skinner publiziert "The Behavior of Organisms", in dem er die operante Konditionierung darstellt. 1938: Albert Hofmann synthetisiert LSD. 1938: Ugo Cerletti und Lucino Bini behandeln Patienten mit Elektroschocks. 1939: Carl Pfaffman beschreibt richtungsspezifische Mechanorezeptoren bei der Katze. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1939: Nathaniel Kleitman publiziert "Sleep and Wakefulness". 1943: Warren S. McCulloch und Walter Pitts zeigen in theoretischen Arbeiten, dass ein Verband von Neuronen in der Lage wäre, wie eine Rechenmaschine logische Operationen auszuführen und begründen damit den Computer als Modell für die Hirnfunktion. 1946: Theodor Rasmussen beschreibt das olivocochleäre Bündel (Bündel von Rasmussen). 1948: Norbert Wiener veröffentlicht seine "Cybernetics; or Control and Communication in the Animal and the Machine". 1948: Edward C. Tolman fordert die Existenz kognitiver Karten im Gehirn, d.h. topographische Repräsentationen, die Sinnesreize mit Gedächtnisinhalten integrieren. 1949: Kenneth Cole entwickelt die Methode der Spannungsklemme. 1949: Horace Winchell Magoun definiert das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem (ARAS). 1949: John Cade entdeckt, dass Lithium ein wirksames Mittel gegen bipolare Depressionen ist. 1949: Giuseppe Moruzzi und Horace W. Magoun publizieren "Brain Stem Reticular Formation and Activation of the EEG" 1949: Donald O. Hebb veröffentlicht sein Buch "The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory". 1950: Karl Lashley publiziert "In Search of the Engram". 1950: Eugene Roberts und J. Awapara identifizieren GABA im Hirngewebe. 1951: MAO-Inhibitoren werden als Mittel zur Behandlung von Psychosen eingesetzt. 1951: Nikolaas Tinbergen beschreibt das Paarungs- und Attakierverhalten des Stichlings. 1952: Paul MacLean prägt den Terminus Limbisches System. 1952: Alan L. Hodgkin und Andrew F. Huxley leiten erstmals Aktionspotentiale intrazellulär ab. 1952: Walle J.H. Nauta entwickelt die erste Tracingmethode, die es erlaubt, beliebige axonale Faserzüge experimentell anzufärben und macht damit den Weg frei für eine umfassende Kartierung der neuronalen Verknüpfungen im Gehirn. 1953: Eugene Aserinski und Nathaniel Kleitman beschreiben schnelle Augenbewegungen (REM) während des Schlafs. 1953: Heinrich Klüver und E. Barrera führen die Luxol-Blau-Färbung in die Neurohistologie ein. 1953: Stephen Kuffler beschreib die center-surround-Organisation und die on-off-Organisation rezeptiver Felder retinaler Ganglionzellen. 1953: Dem Patienten H.M. werden wegen lebensgefährlicher Epilepsie Hippocampi und Mandelkerne beidseitig entfernt (bilateral mediale Lobektomie des Temporallappens); seine Epilepsie wurde dadurch • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • weitgehend geheilt, er litt für den Rest seines Lebens jedoch an einer totalen anterograden Amnesie. 1954: Sanford Palay und G.E. Palade beweisen mit Hilfe des Elektronenmikroskops die strukturelle Autonomie der Nervenzelle. 1954: James Olds beschreibt die Induktion von Wohlempfinden durch hypothalamische Reizung. 1956: Roger Wolcott Sperry weist durch Experimente am Frosch nach, dass Verhaltensleistungen unmittelbar auf korrekten Mustern neuronaler Kontakte beruhen. 1956: Lars Leksell verwendet Ultraschall für Untersuchungen am Gehirn. 1956: Rita Levi-Montalcini und Stanley Cohen isolieren und reinigen den Nervenwachstumsfaktor (NGF). 1957: Wilder Penfield and T. Rasmussen kartieren den sensorischen und motorischen Homunculus. 1957: Eccles erkennt im Initialsegment von Axonen die Entscheidungsinstanz, welche über alle erregenden und hemmenden Eingänge des Neurons integriert und bei Erreichen eines Schwellenwertes Aktionspotentiale generiert. 1957: Edwin J. Furshpan und David D. Potter entdecken elektrische Synapsen. 1957: Vernon B. Mountcastle entdeckt ein Mosaik funktioneller Säulen (Module) im Isokortex. 1957: Skinner veröffentlicht sein "Verbal Behavior", Leon Festinger seine "Theorie der kognitiven Dissonanz". Der Konflikt zwischen diesen Ansätzen begründet die Kognitive Wende in der Psychologie. 1959: Peter Karlson und Martin Lüscher prägen den Terminus Pheromon. 1960: Oleh Hornykiewicz zeigt, dass der Gehalt an Dopamin im Gehirn von Parkinsonpatienten reduziert ist. 1962: Eldon Foltz führt die erste Cingulotomie aus, um chronischen Schmerz zu behandeln. 1962: Sperry und Michael S. Gazzaniga beobachten Wahrnehmungs- und Verhaltensdefizite bei Patienten, deren Balken (Corpus callosum) durchtrennt werden musste (Split-Brain). 1963: Sperry formuliert seine Chemospezifitätshypothese. 1965: Joseph Altman weist Neurogenese im postnatalen Säugergehirn nach. 1965: Hans Kornhuber und Lüder Deeke messen das Bereitschaftspotential. 1965: Ronald Melzack und Patrick D. Wall publizieren ihre Gate-Theory der Schmerzwahrnehmung. 1967: Gründung des ersten Instituts für Neurobiologie an der Harvard Medical School in Boston. 1969: Gerald Schneider und G. Raismann weisen nach, dass nicht nur die Funktion, sondern auch die Struktur des Gehirns von Säugetieren durch Erfahrung veränderbar ist. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1969: David V. Reynolds beschreibt den analgetischen Effekt elektrischer Stimulation des Zentralen Höhlengraus. 1972: Charles Gross entdeckt in der temporal gelegenen Hirnrinde von Affen Neurone, deren rezeptive Felder so eingerichtet sind, dass die maximale Aktivierung durch die Präsentation der Silhouette einer Hand erreicht wird. 1972: Godfrey N. Hounsfield entwickelt die Computer-Tomographie. 1973: Candace B. Pert und Solomon Snyder finden Opioidrezeptoren im Hirngewebe. Pert schreibt später über "Molecules of Emotion". 1973: Timothy Bliss und Terje Lomo beschreiben das Phänomen der Langzeitpotenzierung. 1974: John Hughes und Hans Kosterlitz entdecken die endogenen Morphine, kurz Endorphine. 1974: Michael E. Phelps, Edward J. Hoffman und Michel M. Ter Pogossian entwickeln den ersten Positron-Emissions-Tomographen (PET). 1976: Choh Hao Li und David Chung veröffentlichen grundlegende Befunde zum ß-Endorphin. 1976: Erwin Neher und Bert Sakmann entwickeln die Patch-Clamp-Technik. 1976: John O'Keefe beschreibt place units im Hippocampus der frei beweglichen Ratte. 1976: Hendrik van der Loos und Thomas A. Woolsey entdecken das barrel field im somatosensorischen Kortex der Maus. 1977: Karl R. Popper und Eccles publizieren ihr Buch "The Self and Its Brain". 1978: David H. Hubel und Torsten Wiesel beschreiben orientierungsspezifische rezeptive Felder an Neuronen der primären visuellen Hirnrinde der Katze. 1978: David Premack und Guy Woodruff prägen den Terminus Theory of Mind. 1979: Douglas R. Hofstadter publiziert sein "Gödel, Escher, Bach", dessen Arbeitstitel noch "Gödel's Theorem and the Human Brain" hieß. 1980: Arthur P. Arnold und Fernando Nottebohm bringen Zebrafinkenweibchen durch Hormongaben zum Singen; nach der Hormonbehandlung zeigten sie eine Hirnmorphologie, die denen der Männchen entspricht. 1980: John R. Searle präsentiert sein Gedankenexperiment des Chinesischen Zimmers, das als größter philosophischer Polarisator des 20. Jahrhunderts bezeichnet wurde. 1982: David Marr publiziert seine "Vision". 1983: Benjamin Libet beginnt seine vielbeachtete Serie von Experimenten am menschlichen Gehirn, die die Frage nach der Willensfreiheit betreffen. 1984: R. Desimone, T.D. Albright, C.G. Gross und C. Bruce finden gesichtsspezifische rezeptive Felder von Neuronen im Inferotemporalkortex. 1989: Roger Penrose publiziert "The Emperors New Mind" (dt.: "Computerdenken"). • • • • • • • 1990: Siege Ogawa entwickelt die nicht-invasive Technik der funktionellen Kernspinresonanztomographie (fNMR, fMRI, BOLD-MRI), mit welcher das regionale Muster des Blutflusses im Gehirn beobachtet wird. 1993: Das Gen, das für die Chorea Huntington verantwortlich ist, wird identifiziert. 1995: Walter Gehring entdeckt Gene, deren ektopische Expression bei der Fliege Drosophila zur Bildung zusätzlicher Augen führt und zu denen homologe Gene u.a. im menschlichen Genom existieren. 1996: Giacomo Rizzolatti und Vittorio Gallese beschreiben Spiegelneurone in der prämotorischen Großhirnrinde (F5) eines Affen. 2004: Edvard und May-Britt Moser entdecken Rasterzellen (grid cells) im Cortex entorhinalis der Ratte. seit ca. 1990: Die Liste neuronaler Korrelate bewussten Erlebens, Urteilens und Handelns des Menschen wächst unter Anwendung bildgebender Verfahren. seit ca. 2000: Die Feuilletons großer Zeitungen füllen sich mit treffenden und unzutreffenden Berichten über aktuelle Befunde und Thesen der Gehirnforschung: die Öffentlichkeit ist interessiert. Literatur o o o o o o o o Illing RB. 2010. Wenn Blei zu Gold werden soll: Die Geist-Materie-Diskussion in logischer und historischer Perspektive. In: Das rätselhafte ICH (Düringer H. et al., Hrsg.), S. 77-106. Haag und Herchen, Frankfurt/M. Illing RB. 2009. Gehirn und Transzendenz. In: Gottesbilder an der Grenze zwischen Naturwissenschaft und Theologie (Souvignier G. et al., Hrsg.), S. 125143. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. Illing RB. 2005. Seelenintuition, Freiheitsintuition und Gehirnforschung. In: Gott - Geist - Gehirn (Achtner W. et al., Hrsg.), S. 15-47. Haag und Herchen, Frankfurt/M. Illing RB. 2004. Humbled by History. Sci. Amer. Mind 14(1): 86-93. Illing RB. 2002. Geschichte der Neurobiologie. In: Lexikon der Biologie, Bd. 10, S. 72-86. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Illing RB. 2002. Von der Hirnkarte zum Roboter. Ideengeschichte der Gehirnforschung (Teil 2). Gehirn und Geist 2/2002: 62-67. Illing RB. 2002. Vom Loch im Kopf zum Neuron. Ideengeschichte der Gehirnforschung (Teil 1). Gehirn und Geist 1/2002: 64-71. Illing RB. 2001. Geschichte der Hirnforschung. In: Lexikon der Neurowissenschaft, Bd. 4, S. 40-50. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. o Illing RB. 1996. 4000 Jahre Gehirnforschung. Biol. in uns. Zeit 26: 136-148. ****** Breidbach O. Die Materialisierung des Ichs: Zur Geschichte der Gehirnforschung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt/M. 1996. Finger S. Origins of Neuroscience. Oxford 1994. Florey E, Breidbach O. Das Gehirn - Organ der Seele? Berlin 1993. Hagner M. Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn. Frankfurt/M. 1997. Oeser E. Geschichte der Hirnforschung. Darmstadt 2002. Shepherd GM. Foundations of the Neuron Doctrine. Oxford 1997. Spillane JD. The Doctrine of the Nerves. London 1981. ****** • The Journal of the History of the Neurosciences. Seit 1992. Swets & Zeitlinger Publ. bzw. Taylor & Francis, Inc. >> Diese Seite wird ständig weiter entwickelt (letzte Änderungen: Mai 2010) << (c) Prof. Dr. rer. nat. Robert-Benjamin Illing Neurobiologisches Forschungslabor Universitäts-HNO-Klinik Killianstr. 5 79106 Freiburg i. Br. Email: [email protected]